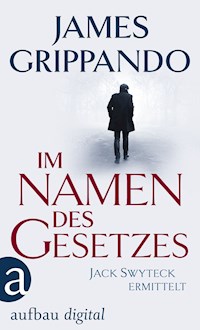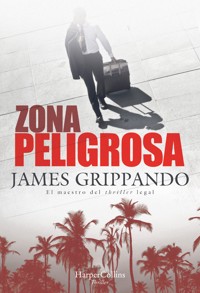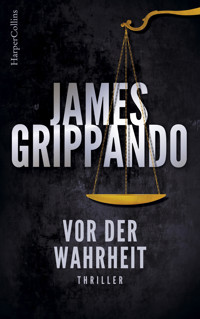9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: James Grippando Thriller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
USA, Präsidentschaftswahlkampf 2000: Allison Leahy, erfolgreiche linksliberale Staatsanwältin, is going for President! Ihr Gegenspieler, General Lincoln Howe, versucht mit allen Mitteln, den Umfragenvorsprung der beliebten Juristin aufzuholen.
Da wird seine Enkelin gekidnappt. Das FBI schaltet sich ein. Hat Lincoln Howe die Entführung inszeniert, um Allison, die Leiterin des FBI, in ein schlechtes Licht zu stellen? Und was hat die Entführung von Allisons Adoptivtochter Emily, die sich vor acht Jahren ereignete und niemals aufgeklärt wurde, mit dem aktuellen Fall zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Ähnliche
Über das Buch
USA, Präsidentschaftswahlkampf 2000: Allison Leahy, erfolgreiche linksliberale Staatsanwältin, is going for President! Ihr Gegenspieler, General Lincoln Howe, versucht mit allen Mitteln, den Umfragenvorsprung der beliebten Juristin aufzuholen.
Da wird seine Enkelin gekidnappt. Das FBI schaltet sich ein. Hat Lincoln Howe die Entführung inszeniert, um Allison, die Leiterin des FBI, in ein schlechtes Licht zu stellen? Und was hat die Entführung von Allisons Adoptivtochter Emily, die sich vor acht Jahren ereignete und niemals aufgeklärt wurde, mit dem aktuellen Fall zu tun?
Über James Grippando
James Grippando ist Autor diverser New York Times-Bestseller. Er arbeitete zwölf Jahre als Strafverteidiger bevor sein erstes Buch »Im Namen des Gesetzes« 1994 veröffentlicht wurde und ist weiterhin als Berater für eine Kanzlei tätig. Er lebt mit seiner Familie im Süden Floridas.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
James Grippando
Die Entführung
Roman
Aus dem Amerikanischen von Norbert Möllemann
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Danksagungen
Prolog: März 1992
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil 2
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Teil 3
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Teil 4
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Teil 5
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Epilog
Impressum
Danksagungen
Mein Dank gilt …
Tiffany. Ich sage es nicht oft genug, aber ohne dich würde ich es nicht schaffen.
Carolyn Marino, Robin Stamm und den üblichen Verdächtigen mit dem ungewöhnlichen Talent – Artie Pine, Richard Pine und Joan Sanger.
Und Carlos Sires, Eleanor Raynor, Judy Russell, Nancy Lehner, Eric Helmers, Jim Hall, Terri Gavulic (einmal Pfeffer, immer Pfeffer), Gayle DeJulio, Jennifer Stearns und Jerry Houlihan.
Aller guten Dinge sind drei, obwohl wir alle wissen, daß es tatsächlich das vierte ist.
Prolog: März 1992
Um elf Uhr war das Geschrei endlich vorbei.
Es hatte als Wimmern begonnen, schwach, aber gleichmäßig. Mit jedem zittrigen Atemzug war es stärker, von Minute zu Minute schriller geworden und gipfelte schließlich in einem verzweifelten Urschrei, der sich über die Grenzen von Sprache hinwegsetzte und kaum noch menschlich klang.
Wie jede Nacht schauderte es Allison Leahy auch heute nacht vor den Schreien ihrer vier Monate alten Tochter. Daß der Kinderarzt ihr erklärt hatte, das sei »normal«, machte es ihren Ohren auch nicht angenehmer. Irgend etwas mußte ihr Baby beunruhigen, obwohl Allison das deutliche und hilflose Gefühl hatte, daß Klein Emily wahrscheinlich ihre Pubertät erreichen würde, bevor Mami es begriffen hatte.
Sie hatte einige Theorien – besser gesagt, Ängste, die sie in Anfällen von Panik quälten. Es konnte etwas Ernstes sein, ein psychologisches Anzeichen dafür, daß Emily ihre Adoptivmutter ablehnte. Vielleicht war es eins dieser gefürchteten Syndrome, das Vermächtnis einer unbekannten jungen Mutter, deren pränatale Diät aus Wodka und Zigaretten bestanden hatte. Oder war Allison selbst das Problem? Es war sehr gut möglich, daß ihre Freunde recht hatten: Es war verrückt von einer neununddreißigjährigen Karrierefrau, ein Neugeborenes zu adoptieren, ohne daß ein Vater in Sicht war.
Glücklicherweise löste sich ihre Paranoia für gewöhnlich beim bloßen Anblick dieses kleinen Gesichts auf – wenn sie die Stupsnase sah und den perfekten kleinen Mund, Züge, die die Leute dazu veranlaßten, zu sagen, sie sähe genau aus wie ihre Mutter. Nicht wie ihre biologische Mutter. Wie ihre wirkliche Mutter. Allison genoß diese Ähnlichkeit, auch wenn sie nur Zufall war.
»Schläfst du, mein Herzchen?« flüsterte sie voller Hoffnung.
Emily lag zusammengesunken in ihrem Autositz, das Doppelkinn auf der Brust. Die Stille war eine deutliche »Antwort«.
Allison schaltete den Wäschetrockner aus. Sie konnte sich nicht mehr erinnern, woher sie den hilfreichen Tip hatte, aber ein Kleinkind in einem Autositz auf einen warmen, vibrierenden Trockner zu setzen wirkte wie mechanischer Baldrian. Sie nahm ihr Baby in die Arme und ging durch die Küche. Vor dem tragbaren Fernseher, der auf der Küchenanrichte stand, blieb sie stehen. Anthony Hopkins bedankte sich glücklich bei der Academy für seinen Oskar als bester Darsteller. Emily riß ihre verschlafenen Augen auf, als wäre sie irgendwie von der Magie Hollywoods gebannt.
Allison lächelte, ging weiter den Flur entlang ins Kinderzimmer und redete in einem weichen, rührseligen Mami-Tonfall auf ihr Baby ein. »Irgendwann wirst du da stehen, mein Herzchen. Vielleicht merken dann sogar die alten Hollywood-Dummköpfe, daß sie ja auch keine getrennten Auszeichnungen für den besten Regisseur und die beste Regisseurin vergeben. Also müssen sie auch nicht den besten Hauptdarsteller und die beste Hauptdarstellerin getrennt ehren. Du wirst Emily Leahy, der beste Hauptdarsteller, sein. Besser als alle Jungs und alle Mädchen. Weil du die Beste bist. Ja«, schwärmte sie, »das bist du: die Beste!«
Sie legte ihren kleinen Vierzehnpfundgewinn auf die rosafarbenen Baumwolldecken im Gitterbettchen, dankbar dafür, daß ihre chronische Unfähigkeit, ihre Meinungen für sich zu behalten, diesmal nicht dazu geführt hatte, daß sie völlig vergeblich neunzig Minuten lang über dem Wäschetrockner ausgeharrt hatte. Emily schlief tief und fest. Vielleicht würde sie sich ja an eine Mutter gewöhnen, die sich nicht scheute, ihre Ansichten zu vertreten. Das würde ich ihr auch raten, dachte Allison.
Allison war während der Eisenhower-Ära in einer kleinen Stadt nördlich von Chicago aufgewachsen, wo sie im Alter von neun Jahren von der katholischen Schule geflogen war. Sie hatte einer alten Nonne, die gemeint hatte, ihre Mutter käme in die Hölle, weil sie geschieden war, eine dicke Lippe verpaßt. Den Rest ihrer Schulzeit absolvierte sie an einer staatlichen High-School, und ihr Studium am University of Illinois College of Law schloß sie im 76er Jahrgang als Zweitbeste ab. In lediglich zwei Jahren erlangte sie nationale Anerkennung als Beraterin für eine Verbraucherschutzorganisation. Elf Kleinkinder, von denen man angenommen hatte, sie seien den plötzlichen Kindstod gestorben, waren in Wirklichkeit Opfer von Billigplüschtieren, deren Füllmaterial Rückstände von geruchlosen, aber hochtoxischen Lösungsmitteln enthielt. Allison hatte der Regierung den Weg geebnet, wasserdichte Strafanzeigen gegen die Topmanager zu erstatten, die für diese dubiosen Methoden der Kostensenkung verantwortlich waren. Ihre Beharrlichkeit hatte die Aufmerksamkeit des Bundesstaatsanwalts auf sich gezogen, der sie auf der Stelle einstellte. In sechs Jahren hatte sie nicht einen einzigen Fall verloren. Nach vierjährigem Arbeitsaufenthalt in Washington als bislang jüngste Vorsitzende der Abteilung »Public integrity« im Justizministerium kam sie zurück nach Chicago und betrat die Bühne der großen Politik. Im Alter von sechsunddreißig Jahren gewann sie das heiß umkämpfte Rennen um den Posten des Bezirks-Staatsanwalts von Cook County mit sechzig Prozent der Stimmen. Die weibliche Hälfte der Wählerschaft hatte auf ihre Botschaft, Frauen würden zu oft das Opfer von Gewaltverbrechen, eine deutliche Antwort gegeben. Aber selbst ihre eigenen Demoskopen waren sich nicht sicher, ob ihre männlichen Wähler sich von ihren Wahlaussagen hatten leiten lassen oder von dem, was ihr sexistischer Gegenspieler den »Grace Kelly-Faktor« genannt hatte. Die Bürde ihrer dreijährigen Amtstätigkeit hatte ihrem Äußeren nichts anhaben können, auch wenn ihre blonden Haare mittlerweile schulterlang waren und in ihren haselnußbraunen Augen immer häufiger Skepsis aufblitzte. Wie ihre Mutter kürzlich gesagt hatte, war sie eine Frau im Übergang von strahlender Schönheit zu eleganter Selbstgewißheit.
»Gute Nacht, mein Liebling«, sagte sie und gab Emily einen Kuß auf die Stirn. Sie legte den Sender des Babyphons auf die Kommode neben dem Kinderbett. Der kleine drahtlose Empfänger paßte gut in die tiefe Tasche ihres Frotteebademantels. Sie stellte die Lautstärke ein. Es war, als würde man das eigene Baby belauschen, ein Abhörgerät, das es besorgten Eltern erlaubte, im Haus herumzulaufen oder in einem anderen Raum zu schlafen, ohne ein einziges Quäken oder Glucksen zu überhören. Allison stellte das Gerät auf gleichmäßigen Empfang, dann schaltete sie die Winnie-Puuh-Lampe auf der Kommode aus und ging in ihr Schlafzimmer.
Das Telefon klingelte, und sie geriet in Panik. Sie schnappte sich den schnurlosen Hörer und lief ins Gästeschlafzimmer am anderen Ende des Hauses, weit weg von ihrem schlafenden Engel, der es ihr übelnehmen würde, wenn er jetzt aufwachte.
»Hallo«, sagte sie mit heiserem Flüstern.
»Ich bin’s, Mitch.«
Sie seufzte. Mitch O’Brien, ihr Exverlobter. Ihre Beziehung hatte drei Jahre gedauert, bis Allison sich schließlich eingestehen mußte, daß ihr Versäumnis, sich auf einen Hochzeitstermin festzulegen, nicht nur Verzögerungstaktik gewesen war. Vor knapp acht Monaten hatten sie sich gütlich getrennt, aber seit er sich vor drei Monaten gemeldet hatte, um ihr zu ihrer Adoption zu gratulieren, hatte er es sich angewöhnt, jeden Montagabend anzurufen. Allison hatte nichts dagegen einzuwenden, aber als sie ihm vorgeschlagen hatte, sie könnten ja Freunde bleiben, hatte sie nicht beste Freunde gemeint.
»Und wie geht’s der kleinen Miss America?« fragte er.
»Das war letzte Woche. Diese Woche ist sie bester Darsteller.«
»Du meinst beste Darstellerin.«
»Das wird sich noch herausstellen«, sagte sie geziert.
Ein zufriedenes Glucksen rauschte im Babyphon. Emily schien ihr zuzustimmen.
Allison lächelte. »Sie plappert neuerdings so munter drauflos, daß ich sie darauf vorbereiten sollte, im Jahre 2010 Oprah zu ersetzen. Wäre das nicht ein guter Einstieg? Michael Crichton und Martha Stewart könnten gemeinsam ihr vorzügliches neues Mittel gegen Krebs anpreisen.«
Mitch lachte, dann wechselte er das Thema. Er ging schnell dazu über, sie auszuhorchen, wie es bei ihr mit Männergeschichten aussah. Es gab da wirklich etwas »Neues von Bedeutung«, obwohl eine Wochenendbeziehung zu einem Mann, der in New York lebte, schwerlich als bedeutsam bezeichnet werden konnte im Vergleich zu dem, was sich im Nebenraum abspielte. Allison war schon nicht mehr bei der Sache, statt dessen konzentrierte sie sich auf die Geräusche des Wohlbefindens aus dem Babyphon. Alles andere nahm sie gar nicht mehr wahr – Mitchs Worte, das Verrinnen der Zeit.
Alles auf der Welt, das sich nicht um Emily drehte.
Aus dem Funkgerät drangen Störgeräusche. »Der Lauscher« hatte neunzig Minuten lang am Ende der Straße Royal Oak Court geparkt, wo der Empfang laut und deutlich gewesen war. Ein gleichmäßiger Refrain aus Glucksern und Seufzern, gefolgt von zeitweiligem Schnauben – der kindlichen Version, Baumstämme zu sägen. Nun aber waren nur nervende Funkstörungen zu vernehmen, gewürzt mit gelegentlichen Einsprengseln einer hirnverbrannten Unterhaltung zwischen Allison Leahy und Mitch O’Brien.
Sie hat ein schnurloses Telefon, stellte er fest. Die kombinierten Sendefrequenzen verfälschten das Signal, das er aus Leahys Babyphon empfing.
Er schaltete den elektronischen Scanner am Armaturenbrett aus. Das Knistern hörte auf. Im Kleinbus war es dunkel und still. Er öffnete das Fenster auf der Fahrerseite einen Spaltbreit, um abgestandenen Zigarettenrauch hinauszulassen, dann drückte er seine Camel im überquellenden Aschenbecher aus. Das rote Blinklicht auf der Konsole zeigte an, daß das winzige Aufnahmegerät immer noch in Betrieb war. Er drückte die Stoptaste und nahm die Kassette heraus. Er hatte soviel Gekrächze und Babygrunzen aufgenommen, wie er brauchte – insgesamt fast neunzig Minuten, wenn er alles zusammenrechnete, was er in einer Woche der Überwachung aufgezeichnet hatte.
Zuvor hatte er dafür gesorgt, daß die Straßenlaterne an der Ecke erloschen und das Leahy-Anwesen in Dunkelheit gehüllt war. Er zog sein Sporthemd aus und schlüpfte in eine Nomex-Kapuzenjacke. Sie lag eng an wie eine Taucherjacke und war eine glatte und perfekte Ergänzung zu seinen schwarzen Jeans und den schwarzen Turnschuhen. Er sah prüfend in den Rückspiegel und schmierte sich schwarze Farbe ins Gesicht. Als seine Tarnung komplett war, wischte er sich die Hände ab und zog sich schwarze Gummihandschuhe über. Er benutzte nie Leder. Tierhaut hinterläßt ihre eigenen deutlichen Muster, so ähnlich wie Fingerabdrücke. Leise stieg er aus dem Kleinbus.
Das Haus im Stil einer Ranch stand im hinteren Teil eines tausend Quadratmeter großen stark bewaldeten Grundstücks. Eine dichte, drei Meter hohe Hecke schirmte den Garten gegen die Öffentlichkeit ab. Unter den knorrigen Ästen hochgewachsener Eichen schlängelte sich ein Gehweg über fünfundzwanzig Meter von der Straße zur Türschwelle. Der Mann suchte sich die höchste Eiche aus, die nah am Haus stand, dann stieg er leise durch die Hecke und kletterte auf den Baum. In Sekundenschnelle hatte er einen langen Ast erreicht, der über dem Dach hing. Vorsichtig ließ er sich auf das Dach aus Zedernschindeln hinab.
Mit drei leisen Schritten erreichte er den Schornstein. Von einer vorherigen Erkundung wußte er, daß der Alarmkasten auf der Rückseite des Schornsteins befestigt war. Er hatte die Größe einer großen Frühstücksdose und war grau angestrichen. Er war mit einem Vorhängeschloß gesichert, hatte aber an der Vorderseite Lamellen, durch die das Alarmsignal austreten konnte. Der Mann öffnete den Reißverschluß an seiner Gürteltasche, nahm eine Spraydose heraus und steckte einen Plastikstrohhalm auf die Düse. Der Halm paßte genau zwischen die Lamellen des Kastens. Er betätigte die Düse, aus der ein Strahl weißen Isolierschaums schoß, der sich sofort ausdehnte und den Kasten füllte. Der Schaum härtete in Sekundenschnelle aus. Der Alarm war außer Betrieb gesetzt, ohne daß ein Draht hätte durchtrennt werden müssen.
Er steckte die Spraydose zurück in die Tasche und kletterte die Eiche wieder hinunter. Innerhalb von dreißig Sekunden kroch er unter das Fenster des Schlafzimmers, das im hinteren Teil des Hauses gelegen war. Der Raum war dunkel, aber an den kleinen Tanzbären auf den Vorhängen erkannte er, daß er an der richtigen Stelle war. Er schlich sich dichter heran, um genauer sehen zu können, wobei er fast mit der Nasenspitze das Fenster berührte. Hier gab es weder Sicherheitsriegel noch ausgefallene Schlösser. Nur Drähte, die das Fenster mit der außer Betrieb gesetzten Alarmanlage verbanden. Vielleicht war diese zusätzlich mit einer zentralen Alarmstation verbunden, aber er konnte sich darauf verlassen, daß es mindestens fünf oder zehn Minuten dauern würde, bis man dort reagierte.
Er grinste, weil es so einfach schien. Es ist wirklich ein Kinderspiel, eine private Alarmanlage außer Gefecht zu setzen.
Es war schon fast Mitternacht, als Allison den Hörer auflegte. Mitch hatte gar nicht aufhören wollen, aber sie war müde. Schließlich hatte sie fast unhöflich werden müssen. Seit drei Wochen führten ihre Unterhaltungen regelmäßig zu einem ärgerlichen Ende. Heute hatte er wissen wollen, ob die Tatsache, daß sie alleinerziehende Mutter war, irgendwelche politischen Gegenreaktionen provozierte. Natürlich fragte sie sich selbst auch, ob sie noch wählbar war. Eine Zeitung hatte schon Fragen aufgeworfen über ein System, das es einer bestimmten Staatsanwältin möglich machte, sich vor ihrer Hochzeit für eine Adoption zu bewerben und auch dann noch auf der Bewerberliste zu bleiben, als ihre Beziehung längst zerbrochen war. Sie wollte jedenfalls ein Kind. Aber sie war nicht bereit, zu diesem Zweck den falschen Mann zu heiraten. Und sie war überzeugt, daß – zu Recht oder zu Unrecht – eine Adoption für eine unverheiratete Frau nicht dieselben moralischen Verurteilungen oder politischen Verwicklungen hervorrufen würde wie eine nichteheliche Schwangerschaft.
Allison schaltete das Schlafzimmerlicht aus und ging schläfrig den Flur entlang. Der drahtlose Empfänger in ihrer Tasche übertrug nach wie vor Emilys normale nächtliche Geräusche. Babygeräusche waren nichts, worüber man sich Sorgen machen mußte. Erst wenn sie nichts mehr hörten, fühlten sich junge Mütter veranlaßt, zum Kinderbett zu eilen, um sich zu vergewissern, daß alles in Ordnung war.
Sie lächelte in freudiger Erwartung, als sie sich dem abgedunkelten Kinderzimmer näherte. Sie lugte durch den Türspalt, und plötzlich stockte ihr Atem. Das Baby lag auf dem Bauch. Allison legte Emily niemals auf den Bauch. Die empfohlene Schlafposition, um dem plötzlichen Kindstod vorzubeugen, war die Seiten- oder Rückenlage. Allison rannte zu dem Bettchen und lehnte sich über das Gitter.
Ihr Schrei gellte durch die Nacht.
Eine Puppe lag an Emilys Stelle. Allison warf sie panisch zur Seite und riß die Decke zurück. Etwas fiel auf den Boden. Sie machte das Licht an. Ein Diktiergerät sandte die Geräusche ihres Babys aus.
Sie schrie noch lauter und rannte zum Fenster. Der Riegel war offen. Ein rundes Loch war ins Glas gebohrt – gerade groß genug, daß eine dünne Metallstange oder ein spitzer Stock hindurchpaßten, womit man den Riegel öffnen konnte. Ihr entsetzter Gesichtsausdruck spiegelte sich im Fenster.
»Emily!«
Sie raste aus dem Kinderzimmer hinaus den Flur entlang und griff sich das Telefon. Ohne ihre Schritte zu verlangsamen, durchsuchte sie die Küche, das Bad, jedes Zimmer im Haus und rief ständig den Namen ihres Kindes. Sie rannte immer noch, als sie die 911 wählte, schließlich blieb sie an der Küchenanrichte stehen.
»Jemand hat mein Baby entführt!« sagte sie dem Mann an der Zentrale.
»Beruhigen Sie sich doch, Ma’am.«
»Beruhigen Sie sich! Meine vier Monate alte Tochter ist aus ihrem Kinderbett entführt worden. Schicken Sie sofort einen Einsatzwagen. Royal Oak Court 901.«
»Sind die noch da?«
»Nein. Ich weiß es nicht. Ich sehe niemanden. Sie haben mein Baby mitgenommen!«
»Ich schicke sofort eine Einheit los, Ma’am. Sie sind schon unterwegs. Bleiben Sie bitte im Haus.«
Ein Auto, dachte Allison. Sie müssen ein Auto haben. Sie raste durch das Wohnzimmer vor die Haustür.
»Emily!«
Sie untersuchte die Veranda, die Sträucher und die Rosenbeete neben dem Gehweg. Dornige Zweige zerkratzten ihre Haut und zerfetzten ihren Morgenmantel. Sie rannte zur Straße und hielt nach Autos oder Fußgängern Ausschau – nichts. Sie bekam fast keine Luft mehr. Schmerzen schienen ihr den Magen umzudrehen, und heiße Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie sah nach links, dann nach rechts, in beide Richtungen der Straße. Nichts und niemand war zu sehen.
»Ma’am«, sagte der Mann von der Einsatzzentrale, »sind Sie noch dran?«
Allison war zu keiner Antwort fähig. Am Ende des Gehwegs sackte sie in die Knie. Ihre Schultern wurden von heftigem Schluchzen geschüttelt. Ein kratzendes Geräusch drang aus ihrer Tasche. Ihre Hand zitterte, als sie in ihren Morgenmantel faßte und den Empfänger herausnahm.
Ein Schauer lief ihr über den Rücken, als ihr klar wurde, was es war. Das Babyphon übertrug noch immer aus dem Kinderzimmer. Das Diktiergerät war noch in Betrieb.
Die auf Band aufgezeichneten Geräusche Emilys wurden in ihrer Hand abgespielt.
Teil 1 Oktober 2000
1
Allison konnte fühlen, wie ihr Herz pochte. Ihre Lungen brannten, und sie schnappte nach Luft. Die digitale Anzeige ihres Laufbandes sagte ihr, daß sie die Zweimeilenmarke erreicht hatte. Sie drückte den Geschwindigkeitsknopf, um das Tempo zu verlangsamen und wieder zu Atem zu kommen. Sie war schweißgebadet, und ihre Gymnastikhose und ihr extragroßes T-Shirt klebten an ihrem durchtrainierten achtundvierzigjährigen Körper. Es war ihr Lieblings-T-Shirt, weiß mit leuchtend roten und blauen Buchstaben.
»Leahy for President – Ein Neues Jahrtausend«, stand darauf.
Nach fast vier Jahren als Justizministerin trennten Allison gerade noch zwei Wochen von dem historischen Datum, an dem die Wähler entscheiden würden, ob die oberste Polizistin der Nation die erste Präsidentin werden würde. Das Rennen war völlig offen, und es gab keinen kandidierenden Amtsinhaber, da ihr Chef – der demokratische Präsident Charlie Sires – am Ende seiner zweiten und damit letzten vierjährigen Amtsperiode stand. Mit der Kabinettsumbildung durch den Präsidenten nach der Wiederwahl im Jahre 1996 war Allison in der zweiten Amtsperiode zur Justizministerin berufen worden. Acht Monate zuvor hatte sie sich selbst noch nicht ernsthaft als Präsidentschaftsanwärterin betrachtet. Aber nachdem die Republikaner Lincoln Howe, den populärsten Schwarzen des Landes, nominiert hatten, machten die Meinungsumfragen schnell deutlich, daß die Demokraten eine charismatische weiße Frau ins Rennen schicken mußten, um ihn schlagen zu können.
Ironischerweise hatte der dreißigminütige Lauf auf dem Laufband sie tatsächlich dreißig Meilen näher an ihre nachmittägliche Wahlkampfkundgebung herangebracht. Es war die letzte Station einer zweitägigen Bustour durch Pennsylvania, einen kritischen Staat, bei dem es unsicher war, wie sich die vierundzwanzig Wahlmänner verhalten würden. Ihr Wahlkampfbus hatte in den letzten sechs Monaten eine Strecke von fast zehntausend Meilen zurückgelegt. Mehr als zuvor funktionierte der Wahlkampf gerade in der Zielgeraden wie eine gut geölte politische Maschinerie – was einem durchschnittlich gut organisierten menschlichen Wesen allerdings bestenfalls wie völliges Chaos vorkäme. Ein Dutzend lärmender Mitarbeiter waren an Faxgeräten und Computerterminals beschäftigt. Eine Ansammlung vollgestopfter Archivkartons versperrte den Eingang zur Toilette, als wären sie strategisch so plaziert, daß jeder, der verzweifelt genug wäre, die Bordtoilette aufzusuchen, zu Fall kommen mußte. Tausende Wahlkampfanstecker, Flugblätter und Aufkleber waren verstreut hinten im Bus gelagert. Vier kleine Farbfernseher waren an der Decke befestigt und strahlten verschiedene Programme aus, um einen simultanen Nachrichtenüberblick zu ermöglichen. Ein Programm war elektronisch »ausgerichtet« und ständig eingestellt auf die mehr oder weniger kontinuierliche Berichterstattung von CNN über den Wahlkampf 2000.
»Das reicht an Selbstquälerei für einen Tag«, sagte Allison stöhnend. Sie drückte auf die Stoptaste und stieg vom Laufband.
Laufen war ihr hauptsächliches Training seit den Januar-Vorwahlen der Demokraten in New Hampshire. Egal welche Stadt sie besucht hatten, sie war die Hauptstraße hinauf- und hinuntergelaufen, und die Menschen hatten sich ihr angeschlossen, um mitzulaufen. In den Vorwahlen hatte ihr das schon eine große Öffentlichkeit verschafft, aber nachdem sie im August die Nominierung für die Demokraten gewonnen hatte, wurden es so viele Leute, daß sie eine Demonstrationsgenehmigung brauchte. In der letzten Woche hatten Zeitdruck und der kalte Regen aus den Appalachen sie gezwungen, ihr Training im Bus auf dem Laufband zu absolvieren, während sie die Lagebesprechungen mit ihrem Wahlkampfstrategen David Wilcox abhielt.
»Gibt’s was Neues, David?« fragte sie, während sie sich vornüberbeugte und ihre Wadenmuskeln dehnte.
Wilcox, Absolvent der Woodrow Wilson School of Public Affairs in Princeton, war einundfünfzig Jahre alt, groß und drahtig. Als junger Stipendiat im Weißen Haus hatte er unter Präsident Carter geglänzt, aber eine bittere Niederlage bei der Bewerbung für den Kongreß im Jahre 1982 hatte ihn veranlaßt, seine Bemühungen um eine Kandidatur nicht weiter zu verfolgen. In der High-School hatte man ihm eine Karriere als Talkmaster prophezeit, und schließlich hatte er seinen Platz als Wahlkampfstratege gefunden. Nach siebzehn Jahren konnte er eine stattliche Liste zufriedener Auftraggeber vorweisen, die neun Senatoren der Vereinigten Staaten, sieben Kongreßmitglieder und fünf Gouverneure umfaßte. Er war der führende Kopf bei Allisons unverhofftem Sieg über einen amtierenden Vizepräsidenten bei den Vorwahlen der Demokraten. In den letzten paar Wochen hatte er sich zunehmend Sorgen über den wachsenden Einfluß außenstehender Berater gemacht, und so hatte er beschlossen, Allison bei ihrer Bustour persönlich zur Seite zu stehen. Er war gerade dabei, eine Checkliste durchzugehen, anscheinend ohne Allisons verschwitzte Kleidung oder die vorbeihuschende Landschaft von Pennsylvania im Fenster hinter ihr zu bemerken.
»Man will uns ein Drogenproblem anhängen.« Für einen dünnen Mann hatte er eine sonore Stimme; sie unterstrich seine seriöse Erscheinung, die eher zu einem Staatsbankett im Weißen Haus als zu einem frenetisch jubelnden Wahlkampftroß gepaßt hätte. »Unsere vornehme Opposition scheint zum letzten Strohhalm zu greifen. Sie versuchen um jeden Preis, etwas aus der Behandlung Ihrer Depressionen damals im Jahr 1992 herauszuschlagen.«
»Das ist acht Jahre her. Politisch gesehen, ist das kalter Kaffee.«
»Die behaupten, Sie hätten Prozac genommen.«
»Ich habe Ihnen doch gesagt, daß ich eine Therapie gemacht habe.«
»Betreiben Sie jetzt nicht Haarspalterei?«
Sie sah ihn empört an. »Meine vier Monate alte Tochter wurde direkt aus ihrem Kinderbett entführt, aus meinem eigenen Haus. Ja, ich war depressiv. Ich war in einer Gruppentherapie. Wir waren zu acht. Lauter Eltern, die ihre Kinder verloren hatten. Nein, ich habe nie Prozac genommen. Aber würden Sie die anderen aus der Gruppe fragen, würden sie wahrscheinlich sagen, daß ich es hätte gebrauchen können. Also erwarten Sie nicht, daß ich mich dafür entschuldige, daß ich um Unterstützung gebeten habe. Und sitzen Sie hier nicht herum und tun so, als wäre das alles neu für Sie. Ich habe alle Karten auf den Tisch gelegt an dem Tag, als ich Sie beauftragt habe.«
Er dachte angestrengt nach. »Mir wäre es am liebsten, wenn wir die ganze Angelegenheit in einen größeren Zusammenhang stellen könnten.«
Ihr Gesichtsausdruck wurde starr. »Ich habe nicht vor, Emilys Entführung zum Wahlkampfthema zu machen, falls Sie darauf hinauswollen.«
»Allison, wir können nicht einfach sagen, Sie waren depressiv, und damit hat sich’s. Wir brauchen eine positive Wendung.«
»In Ordnung«, sagte sie sarkastisch. »Wie wär’s damit? Depression ist eine gute Sache. So was macht kreativ. Jede Erfindung, jede Leistung ist auf Depression, nicht auf Euphorie zurückzuführen. Keiner ist auf die Idee gekommen, zu sagen: ›Das Leben ist toll, laßt uns das Feuer erfinden.‹ Es war der Unzufriedene in der hintersten Ecke der Höhle, der schließlich aufstand und sagte: ›He, ich friere mir hier den Arsch ab!‹ Ihr wollt, daß etwas getan wird in Washington? Dann wählt ruhig die chronisch Depressiven.«
Er verzog keine Miene. »Bitte, wiederholen Sie das nicht in der Öffentlichkeit. Sonst werde ich depressiv.«
»Na gut«, sagte sie grinsend. »Wir alle hier könnten ein paar neue Ideen gebrauchen.« Sie atmete tief durch. Wilcox fand das gar nicht witzig, aber sie wußte, daß er nicht darauf beharren würde. Während des ganzen Wahlkampfs hatte sie jede Erwähnung der Entführung mit einer schroffen – manchmal spitzen, manchmal schnodderigen – Erwiderung abgeschnitten, was die Tagesordnung unmittelbar auf weniger persönliches Terrain gelenkt hatte. »Gibt’s sonst noch was?« fragte sie.
»Es widerstrebt mir, darauf herumzureiten, aber die Frau von General Howe mischt neuerdings auch kräftig mit. Unsere Umfragen belegen, daß sie Punkte sammelt. Eine Menge Wähler – Männer und Frauen, Demokraten und Republikaner – haben das nostalgische Bedürfnis nach einer First Lady im Weißen Haus.
Wir können diesen schwülstigen Phantasien nur etwas entgegensetzen, wenn wir die Rolle des First Husband, des Ehegatten der Präsidentin, in den Vordergrund stellen. In zwei Wochen sind Wahlen, und vierzig Prozent der Wähler haben keinen Begriff von Peter Tunnello.«
»Entschuldigen Sie bitte, aber der Topmanager einer Aktiengesellschaft kann nicht mal eben von einer Aktionärsversammlung verschwinden, um an einem Gummiadlerpicknick von Kriegsveteranen teilzunehmen.«
»Genau darum geht es aber. Ich nehme an, er täte es, wenn Sie ihn darum bitten würden.«
»Woher wollen Sie wissen, daß ich ihn nicht gefragt habe?«
»Ich entnehme es Ihrer ganzen Einstellung. Es hat genau nach dem Parteitag begonnen, als Howes Lager diese üblen Gerüchte in Umlauf brachte, Sie hätten Peter nur deshalb geheiratet, damit er Ihre politischen Ambitionen finanziert. Seit damals führen Sie einen Eine-Frau-Kreuzzug; Sie schütteln mehr Hände und treiben mehr Geld auf, als irgend jemand zuvor in der Geschichte. Verstehen Sie mich nicht falsch. Das Geld ist großartig. Aber je mehr Sie die Einzelkämpferin spielen, desto mehr nähren Sie Zweifel an Ihrer Ehe.«
»Das ist doch keine Präsidentschaft nach dem Motto: Du bekommst zwei zum Preis von einem. Meine Ehe ist meine Angelegenheit.«
»Es wäre dennoch gut, wenn das amerikanische Volk Sie beide ab und zu zusammen sehen würde, vor allem, wo der Wahltag immer näher rückt. Einfach ein paar öffentliche Demonstrationen der Zuneigung, wie bei Nancy und Ron Reagan.«
»Kurzmeldungen!« rief einer der Berater. Er warf sein Handy auf den Sitz neben sich und drehte sich zu Allison um. »Howe ist gerade drauf und dran, irgend etwas in New Jersey vom Stapel zu lassen. Sehen Sie bei CNN rein.«
Allison rückte näher an den Hauptmonitor heran. Ihre Berater sahen aufmerksam hin und mußten sich anstrengen, bei dem Brummen des Dieselmotors etwas zu hören. Wilcox drehte die Lautstärke auf. General Howe war fast am Ende einer kurzen Rede angelangt, die er in Atlantic City vor dem Nationalkonvent der American Legion, einer Organisation von Kriegsveteranen, hielt.
Auf dem Bildschirm sah man einen großen, gutaussehenden Afroamerikaner an einem brusthohen Pult stehen und auf eine enthusiastische Menge schauen. Die amerikanische Flagge hing schlaff an einer gelb angestrichenen Ziegelwand. Ein blau-weißes Banner, das an den Deckenbalken befestigt war, verkündete den Wahlslogan: »Lincoln Howe – Lincoln NOW!« Der Saal war brechend voll, und die begeistertsten Fans waren strategisch geschickt in den Gängen postiert, um den Eindruck der allgemeinen Hochstimmung noch zu verstärken.
General Howe war eine imposante Erscheinung, auch wenn er nur einen schlichten Anzug und eine Mütze der Kriegsveteranen trug. Armeebestimmungen verboten das Tragen der Uniform nach der Pensionierung, aber die im Hintergrund angebrachte überlebensgroße Fotografie erinnerte die Wähler an seine glänzende vierzigjährige Karriere als Soldat. Es war ein Foto wie gemacht für Geschichtsbücher: Der triumphierende General in Reitstiefeln, grüner Reithose und kurzer Jacke inspiziert seine Truppen, die Brust dekoriert mit einer Reihe von Medaillen, einschließlich der Tapferkeitsmedaille. Auf jeder Schulter trägt er vier silberne Sterne. Rechts von Howe hing ein Foto, das ihn in einer anderen Uniform zeigte, auf der Brust die Nummer zweiundzwanzig, unter dem Arm einen Football. 1961 hatte Howe als Running Back mit der Footballmannschaft der Army die Heisman-Trophäe gewonnen. Der beste College-Footballspieler hatte eine vielversprechende Karriere als Profisportler aufgegeben, um seinem Land zu dienen.
»Was ich aus meiner Einsatzzeit im Vietnamkrieg am deutlichsten in Erinnerung habe«, sagte er mit donnernder Stimme, »ist das unheimliche Gefühl, gegen einen unsichtbaren Feind zu kämpfen. Als wir durch den undurchdringlichen Tropendschungel des A Shau-Tals marschiert sind, gab es immer wieder wie aus dem Nichts Gewehrfeuer, Männer fielen – und dann war alles ruhig. Der Feind war nirgendwo zu sehen.
Dieser Wahlkampf erinnert mich in eigenartiger Weise an jene Erfahrung. Während wir entlang unserer Wahlkampfroute marschieren, werden wir aus dem Nichts unter ein Sperrfeuer genommen, das von den hochbezahlten Beratern meiner demokratischen Opponentin ausgeht. Aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, sich dem Kampf zu stellen, ist Ms. Leahy nirgendwo zu sehen.«
Eine Mischung aus leichtem Gelächter und Applaus rollte durch das Auditorium.
General Howe blickte mit ernsthafter Miene direkt in die Kamera und sprach lauter. »Das amerikanische Volk hat etwas Besseres verdient. Deshalb fordere ich Sie heute heraus. Kommen Sie heraus aus Ihrem Versteck im Dschungel von Washington. Diskutieren Sie mit mir mit offenem Visier.«
Die Menge jubelte, aber der General sprach weiter.
»Ich rede nicht von einer weiteren Runde unerträglich süßer Frage-und-Antwort-Spielchen wie jene sogenannten Debatten, die wir Anfang des Monats geführt haben. Ich kann keinen Moderator gebrauchen, der eher eine Klapperschlange anfassen würde als ein heißes Eisen. Vergessen wir die Großversammlungen in Stadthallen, wo man nie weiß, ob sich einer an die schwierigen Fragen herantraut. Ich schlage ein Podium mit vier unabhängigen Experten vor. Sie wählen zwei aus, ich wähle zwei aus. Diese vier sollen die Fragen stellen, die das amerikanische Volk bewegen. Und wir werden sie beantworten!«
Die Menge brach in noch lauteren Jubel aus. Ballons schwebten von der Decke. Die Fans klatschten Beifall, schwenkten ihre roten und blauen Papptafeln und skandierten: »Wir wollen Lincoln! Wir wollen Lincoln!«
Die Fernsehberichterstattung schaltete schnell um zu einem förmlichen und ernsthaften Moderator, der an dem kleinen Kopfhörer in seinem Ohr nestelte. »Aus Washington zugeschaltet ist jetzt Nick Beaugard, politischer Experte von CNN. Nick, warum gerade jetzt diese Herausforderung?«
Auf dem Bildschirm erschien das Brustporträt eines grauhaarigen Reporters vor der Kulisse des Weißen Hauses. »Wenn man dem Wahlkampfteam von General Howe glaubt, hat man versucht, die unparteiische Kommission für Präsidentschaftsdebatten davon zu überzeugen, einer weiteren Debatte zuzustimmen, nachdem es nicht gelungen war, in der ersten Runde einen Gewinner zu ermitteln. Aber die tatsächliche Notwendigkeit für Howes Wahlkampf ergibt sich aus der schmerzlichen Realität der jüngsten Meinungsumfragen. Denn in den acht Wochen nach dem Parteitag vom August lagen General Howe und Justizministerin Leahy gleichauf. Das überrascht nicht weiter, da beide gemäßigte Positionen vertreten und abgesehen von der Frage der Militärausgaben eine ähnliche Haltung zu den Wahlkampfthemen haben. Konservative Republikaner haben den General jüngst als ›Lincoln Center‹ bezeichnet, eine wenig schmeichelhafte Anspielung auf die Politik der Mitte des gebürtigen New Yorkers.
In den vergangenen neun Tagen haben wir einen dramatischen Umschwung erlebt. Die bedeutendsten Umfragen haben ergeben, daß eine wachsende Zahl bislang unentschiedener Wähler sich Leahy zuwendet. Die heutigen Zahlen von CNN/USA today/Gallup-Umfragen weisen für Leahy gepfefferte sechs Punkte Vorsprung aus. Ein deutlicher Sieg über Ms. Leahy in einer Debatte ohne jedes Tabu könnte General Howes einzige Hoffnung sein. Andererseits, vor die Wahl gestellt zwischen einem schwarzen Mann und einer weißen Frau, könnte das amerikanische Volk durchaus seinen ersten weiblichen Präsidenten wählen.«
Der Moderator legte nachdenklich seine Stirn in Falten. »Hat es denn schon irgendeine Reaktion aus dem Leahy-Team gegeben?«
»Bisher nicht«, sagte der Korrespondent. »Es heißt, die Justizministerin sei mit ihrem Vorsprung zufrieden. Aber es gibt auch Berichte über Skepsis im Leahy-Lager, ob Ms. Leahy einer Debatte mit General Howe, in der grundsätzlich alles erlaubt ist, gewachsen sein würde.«
»Bis hierhin schönen Dank. Nun zu den anderen Nachrichten des Tages –«
Allison betätigte die Stummschaltung der Fernbedienung. Sie machte ein ernstes Gesicht. »Die glauben wohl, ich werde kneifen. Wir müssen auf der Stelle auf eine solche Herausforderung reagieren.«
»Bloß keine unüberlegten Handlungen«, sagte Wilcox. »Wir müssen die Sache überprüfen und uns sicher sein, das Richtige zu tun.«
»Natürlich ist es das Richtige. Er schlägt eine Form vor, die die Kandidaten tatsächlich zwingt, ihre Standpunkte offenzulegen. Die bisherigen Debatten haben uns jedenfalls gezeigt, daß General Howes Redegewandtheit eher der eines gealterten Footballkämpen entspricht als der eines kommandierenden Generals.«
»Vorsicht, Allison. Sie haben es hier mit einer Soldaten-Mentalität zu tun. Howe würde Sie nicht zu einer Debatte einladen, wenn er sich nicht schon irgendeinen Hinterhalt ausgedacht hätte. Bevor wir zu irgend etwas unsere Zustimmung geben, sollten wir genau wissen, was er uns anbietet.«
»Die Einzelheiten können wir später klären«, sagte sie mit einer abwinkenden Handbewegung. »Berufen Sie noch vor unserer Veranstaltung in Philly eine Pressekonferenz ein. Ich möchte sicherstellen, daß meine Reaktion rechtzeitig zu den Sechsuhrnachrichten draußen ist.« Ihr Mund kräuselte sich zu einem zuversichtlichen, kaum wahrnehmbaren Lächeln. »Mir würde ein guter altmodischer Schlagabtausch mit Lincoln Howe gut gefallen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ich nehme die Herausforderung selbstverständlich an.«
2
Alle viertausend mit rotem Samt bezogenen Sitze im Fox Theatre von Atlanta waren mit Parteigängern besetzt. Schilder und Mützen waren im Saal verboten, aber die politischen Anstecker, die an den Jackenaufschlägen befestigt waren, ließen auf ein Publikum schließen, das sich zu ziemlich gleichen Teilen in Anhänger von Leahy und Howe aufteilte.
Unmittelbar nachdem Allison am Montagabend die Herausforderung von General Howe angenommen hatte, war der politische Schlagabtausch von der Kommission für Präsidentschaftsdebatten auf Donnerstag in Atlanta angesetzt worden, zwölf Tage vor der Wahl. Allison hatte fast den ganzen Mittwochabend und den gesamten Donnerstag damit verbracht, sich auf die Themen vorzubereiten, sich mit ihren Helfern zu treffen und sich mit den allerneuesten Tips von ihren Beratern einzudecken.
Allison stand vom Publikum aus gesehen links hinter einem Mahagonipult. Sie trug ein hellblaues St.-John-Kostüm und hatte ihr Haar modisch hochgesteckt, was ihre seriöse und zugleich weibliche Erscheinung unterstrich, die die Titelbilder von Tausenden von Zeitschriften geziert hatte. Lincoln Howe stand auf der rechten Seite. Er trug einen maßgeschneiderten Anzug, ein hellblaues Hemd, eine rote Krawatte und goldene Manschettenknöpfe. Obwohl er den ganzen Wahlkampf selbstverständlich in Zivilkleidung bestritten hatte, wirkte er immer wie ein Soldat, dem man die Uniform weggenommen hatte. Heute abend sah er ganz nach Präsident aus.
»Guten Abend«, sagte der Moderator, »und willkommen bei den Präsidentschaftsdebatten der Wahl 2000. Heute abend haben wir eine ungewöhnliche Runde. Vier renommierte Journalisten, jeweils zwei von jedem Kandidaten ausgesucht, dürfen jede beliebige Frage stellen.«
Allison ließ ihren Blick über das Publikum schweifen, während der Moderator die Runde vorstellte. Sie tauschte ein kleines Lächeln mit ihrem Ehemann, der in der zweiten Reihe saß. Peter Tunnello war nach Meinung der Zeitschrift Business Week »ein visionärer Millionär aus eigener Kraft«, der dem Geschäft des Plastikrecycling den Weg gebahnt hatte – ein ausgesprochen profitables und dazu politisch korrektes Betätigungsfeld für den Gatten einer Politikerin. Mit seinen sechsundfünfzig Jahren war er acht Jahre älter als Allison. Er hatte vornehm graumeliertes Haar und dunkle Augen, mit denen er seine Frau bezaubern, aber auch seine Feinde einschüchtern konnte. Allison war einige Monate vor Emilys Entführung gelegentlich mit ihm ausgegangen. Sie hatte ihn nicht umwerfend gefunden, aber wenn die nachfolgende Tragödie und die endlose Suche eins bewiesen hatten, dann das, daß Peter zu der seltenen Sorte Männer gehörte, die in Zeiten der Not zu einem halten.
Allison war keine Sklavin ihrer Intuition, aber irgend etwas in der Luft – die Schwingungen, die Atmosphäre – gab ihr plötzlich das Gefühl, daß heute abend wieder eine solche Zeit der Not eintreten könnte.
Der Moderator fuhr fort. »Da dies die dritte Debatte ist, werden wir auf Eröffnungserklärungen verzichten und direkt zu den Fragen übergehen.«
Allison nippte an ihrem Wasser, erleichtert darüber, sich nicht noch einmal anhören zu müssen, wie der General seinen Lebenslauf vortrug, so beeindruckend der auch war. Eine Tapferkeitsmedaille für Vietnam. Sein kühner Triumph als Viersternegeneral, der mit den Operationen des Spezialkommandos beauftragt war, das achtunddreißig amerikanische Geiseln aus der Gewalt von schwerbewaffneten Terroristen in Beirut befreit hatte. Der wohlverdiente Ruf eines furchtlosen Falken im Pentagon. Sie fragte sich allerdings, wann seine Strategen endlich begriffen, daß dieser ganze militärische Machismo sogar seine größten Verehrer nervös machte in bezug auf die Wählbarkeit eines Präsidenten, der möglicherweise ein bißchen zu eifrig dabei war, ihre Söhne und Töchter in den Krieg zu schicken.
Der Moderator wandte sich der Runde zu. »Mr. Mahwani, wir beginnen mit Ihnen, Sir.«
Abdul Kahesh Mahwani war ein radikaler, aber geachteter ehemaliger Vorsitzender der Nationalen Vereinigung Schwarzer Journalisten. Er hatte sich in den sechziger Jahren einen Namen gemacht durch die Unterstützung der Bürgerrechtsbewegung, dann war er zum Islam übergetreten und hatte seinen Namen geändert. Sein schwarzer, rasierter Schädel glänzte unter den Bühnenscheinwerfern. Seine runzlige Hand zitterte, als er langsam ein gefaltetes Taschentuch aus der Brusttasche zog und sich die feuchte Stirn abtupfte.
Mahwani war von General Howe ausgewählt worden. Er war derjenige der Viererrunde, der Allison am nervösesten machte.
»Mr. Mahwani, Ihre Frage bitte.«
Der vornehme alte Herr mischte seine Notizkarten auf dem Tisch vor sich, dann legte er sie beiseite. Er nahm seine Brille ab und hielt sie in der Hand, wie ein Lehrer seinen Zeigestock.
»Herzlichen Glückwunsch!« rief er zur Überraschung aller aus. »Ich beglückwünsche Sie beide zu dieser heilsamen Diskussion, bei der es sicherlich um wichtige Themen gehen wird.«
Er lehnte sich zurück in seinem Stuhl, als wollte er nicht weiter zu den Kandidaten, sondern zur ganzen Welt sprechen. Seine Stimme nahm den rhythmischen Tonfall eines Predigers aus den Südstaaten an. »Am siebten November wird das amerikanische Volk mehr tun, als über Wahlkampfthemen abstimmen. Es wird einen Menschen wählen, der es ins nächste Jahrtausend führt. Es wird einen Mann oder eine Frau zu seinem Präsidenten bestimmen.
Dieser Wahlkampf hat bisher jede Diskussion über die Persönlichkeit der beiden Kandidaten völlig außer acht gelassen. Aber ich bin sicher, daß Millionen von Zuschauern zu Hause sich heute abend einige grundlegende Fragen stellen. Wie kann ein Präsident eine Nation führen, wenn nicht durch sein Beispiel? Ist dieser Mann oder ist diese Frau als Bürger ein Vorbild für unsere Kinder?«
Mahwani beugte sich effektvoll vor, blickte dann von einem zum anderen Kandidaten – zuerst zu Howe, dann zu Allison. Seine Stimme nahm einen gedämpften Tonfall an, womit er das Publikum zwang, noch aufmerksamer zuzuhören. »Meine Frage an beide Kandidaten ist ganz einfach: Haben Sie jemals Ihr eheliches Treuegelöbnis gebrochen?«
Es wurde still im Publikum. Nach einer peinlichen Pause ergriff der Moderator das Wort. »Ms. Leahy, Ihre Antwort bitte.«
Allison mußte schlucken. Voranzugehen barg immer ein Risiko, aber auf eine solche Frage als erste zu antworten war besonders verfänglich. Sie dachte sorgfältig über die Frage nach, wollte die Antwort gut abwägen. Sie suchte Peters Blick in der zweiten Reihe. Er wirkte stoisch und zugleich zuversichtlich. Schließlich antwortete Allison. Sie richtete ihre Antwort an das Publikum statt an Mahwani oder gar an ihren Mann.
»Zuallererst lassen Sie mich folgendes sagen: Obwohl ich Mr. Mahwanis Recht zu fragen, was immer er will, respektiere, steht diese persönliche Frage völlig außerhalb des Stils dieses themenorientierten Wahlkampfs, den General Howe und ich bisher gepflegt haben. Ich bin stolz auf die Tatsache, daß dieser Präsidentschaftswahlkampf – im Gegensatz zu vielen anderen in der Vergangenheit – auf zivilisierte und informative Weise geführt wird. Ich bin stolz darauf, daß sich beide Kandidaten den persönlichen Diffamierungen und Beleidigungen, ebenso wie den Angriffen auf Familienmitglieder, verweigert haben, die leider ein Markenzeichen amerikanischer Politik geworden sind.
Mr. Mahwanis Frage wirft eigentlich ein viel wichtigeres Thema auf. Werden wir als Amerikaner an diesem wichtigen Schritt nach vorn festhalten und über politische Themen diskutieren, anstatt uns in Beschimpfungen zu ergehen? Oder werden wir zurückkehren in eine Zeit, in der die Bewerbung um ein Amt gleichbedeutend war mit der Eröffnung der Jagdsaison auf die intimsten und persönlichen Geheimnisse der Kandidaten, unabhängig davon, wie unbedeutend diese für die Wahlthemen sind?
Bitte verstehen Sie mich richtig. Ich kann mir Umstände vorstellen, unter denen extrem persönliche Fragen relevant sein können. Wenn ein Kandidat sich direkt an die Medien wendet und seine oder ihre eheliche Treue zum Thema macht, dann sollte dieser Kandidat damit rechnen, einige kritische Fragen beantworten zu müssen. Wenn eine dritte Partei Beweise vorlegt, daß ein Kandidat sich unmoralisch verhält, dann sollte die Öffentlichkeit eine Antwort erwarten können. Aber ich denke nicht, daß jeder Kandidat bei jeder Wahl gezwungen ist, wie selbstverständlich die Medien in sein Schlafzimmer sehen zu lassen.«
Sie hielt inne, aber ihre Stimme blieb klangvoll. »Aus dem Interesse, der politischen Debatte in Amerika ein würdiges Niveau zu erhalten, weigere ich mich, auf diese Frage zu antworten, und zwar ganz einfach aus Prinzip.«
Ein herzlicher Applaus ertönte von der linken Seite des Publikums. Sie blickte noch einmal zu ihrem Mann in der zweiten Reihe. Auch er applaudierte. Sie stieß einen unmerklichen Seufzer der Erleichterung aus.
»Ruhe bitte«, sagte der Moderator.
Der Applaus nahm langsam ab. Mahwani sah weg und schüttelte sichtlich angewidert den Kopf.
»General Howe«, sagte der Moderator. »Dieselbe Frage. Ihre Antwort bitte.«
Alle Augen wandten sich dem General zu. Vor allem Mahwani fixierte ihn mit stählernem Blick – obwohl Allison hätte schwören können, den Austausch eines leisen und verschworenen Lächelns zwischen den beiden Männern entdeckt zu haben.
Howe umfaßte das Pult und straffte seine Schultern in Richtung der zentralen Fernsehkamera.
»Meine lieben amerikanischen Mitbürger«, sagte er feierlich. »Vor nahezu vier Dekaden stand Dr. Martin Luther King auf den Marmorstufen des Lincoln Memorial und erklärte dem amerikanischen Volk: ›Ich habe einen Traum.‹ Er träumte von dem Tag, an dem die Menschen nicht mehr nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach ihrem Charakter.
Ich habe denselben Traum. Alle Menschen sollten nach ihrem Charakter beurteilt werden. Das gilt für Männer ebenso wie für Frauen. Das gilt für Weiße, Schwarze und Menschen aller Rassen. Und vor allen Dingen gilt dies für Kandidaten, die sich um öffentliche Ämter bewerben – Männer und Frauen, die sich um die Gunst und das Vertrauen der Öffentlichkeit bemühen.
Offenbar haben meine Opponentin und ich unterschiedliche Prinzipien. Während Ms. Leahy die Antwort aus Gründen des Prinzips verweigert, werde ich sie beantworten – auf der Basis meiner Prinzipien.«
Howe sah direkt in die zentrale Kamera. »Nein, ich habe niemals das eheliche Treuegelöbnis gebrochen. Und ich würde niemals schweigen über etwas, das meiner Ansicht nach die heiligste Prüfung für den Charakter eines jeden Mannes ist.« Er hielt inne, dann warf er einen verurteilenden Blick auf Allison. »Und einer jeden Frau.«
Howes Anhänger brachen in Jubel und stehende Ovationen aus. Der Moderator hob die Arme. »Ruhe bitte. Ruhe.«
Der Jubel wurde nur noch lauter.
Allisons Herz pochte heftig. Die Deckenscheinwerfer schienen plötzlich noch heißer. Allison bekam feuchte Hände. Sie sah zu David Wilcox hinüber, der sie von Anfang an vor einem Hinterhalt gewarnt hatte. Normalerweise verzog er in der Öffentlichkeit keine Miene. Jetzt hingegen sprachen seine Blicke Bände.
Der Rest des Abends war nicht mehr von Bedeutung. Allison war völlig demontiert worden.
3
»Leahy verweigert Aussage zu Ehebruch«, lautete die Schlagzeile am Freitagmorgen.
Am Abend zuvor hatte sich Allison mit Bauchschmerzen in ihr Hotelzimmer im Ritz Carlton zurückgezogen, in der Hoffnung, daß sie am nächsten Morgen weg wären.
Statt dessen waren sie schlimmer.
Sie warf das Atlanta Journal auf das ungemachte Bett. Die New York Times und die Washington Post hatten weniger sensationelle Schlagzeilen, aber um acht Uhr hatte sie genug gelesen und gehört, um zu wissen, daß selbst die angesehensten Druck- und Fernsehmedien dieselben verdammten Fragen nach ihrem Charakter aufwarfen. Hatte sie etwas zu verbergen? Wenn ja, würde das amerikanische Volk eine Frau zum Präsidenten wählen, die ihren Mann betrogen hatte?
Als der Strahl der warmen Dusche auf ihren Körper prasselte, fiel ihr wieder ein, was ihre Mutter vor acht Jahren gesagt hatte, als Emily entführt worden war – das Kredo der Leahys: »Nichts geschieht ohne Grund.« Heute morgen ergab nicht einmal dieses Kredo einen Sinn. Allison hatte den Verlust ihrer Tochter nur durch die Schlußfolgerung überwunden, daß sie zu etwas anderem bestimmt war in ihrem Leben, zu etwas, das so großartig war, daß es selbst über die Mutterschaft hinausging. Sie hatte sich in ehrenamtliche Tätigkeit gestürzt. Schließlich bekleidete sie den Posten der Vorstandsvorsitzenden bei der Benton Foundation und übernahm den Vorsitz des amerikanischen Kinderschutzbundes, was ihr die Bekanntschaft mit der First Lady eintrug. Sie setzte ihren Kreuzzug fort als Justizministerin und als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten. Der Verlust von Emily würde nie einen Sinn ergeben, aber sie hatte sich bemüht, soviel Sinn daraus zu ziehen wie irgend möglich.
Der Ehebruchskandal bedrohte nicht nur ihre Hoffnungen auf die Präsidentschaft, sondern erschütterte ihren inneren Frieden, den sie auf dem wackligen Fundament des Ehrgeizes aufgebaut hatte.
»Ich hab’s dir ja gesagt«, flüsterte sie sich selbst zu, als sie ihr nasses Spiegelbild in der gläsernen Duschtür vor sich sah. Genau das hätte ihre Mutter ihr gesagt, wenn sie noch am Leben wäre. Sie hatte Allison gewarnt, daß Washington launisch sei, besonders gegenüber Frauen. Aber Allison war viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, aufzusteigen, als daß sie sich Sorgen über den Absturz gemacht hätte. »Frauen wollen so sein wie sie, Männer wollen sie kennenlernen« – Mit diesen Worten hatte das Lifestyle-Magazin George vor vier Jahren das Phänomen Leahy auf den Punkt gebracht. »Die Klasse von Jackie O., das Charisma von JFK«, hatte die Times erklärt. Allison brachte so viel Enthusiasmus für ihr Amt auf, daß die Menschen das Justizministerium humorvoll als das Energieministerium bezeichneten. Talentierte Anwälte, die im Normalfall nicht daran gedacht hätten, ihre lukrativen Privatkanzleien aufzugeben, rannten ihr scharenweise die Tür ein für einen schlecht bezahlten staatlichen Posten, nur um mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie konnte einen Modetrend dadurch auslösen, daß sie am Samstagmorgen im Büro einen Gymnastikanzug trug, oder ein lokales Restaurant wurde dadurch »chic«, daß sie auf dem Weg zur Arbeit kurz einkehrte, um ein Muffin zu essen.
Und jetzt der Absturz – verdammte elf Tage vor der Wahl. Mutter, du hattest wieder mal recht. Also schaff mir die Bastarde vom Hals.
Gegen halb neun hatte Allison in ihrem Zimmer gefrühstückt, ihre Koffer gepackt und war vorbereitet auf einen langen Tag voller Auftritte in Atlanta. Sie und David Wilcox saßen auf dem Rücksitz einer Limousine, auf dem Weg vom Ritz Carlton in Buckhead nach Five Points in der Innenstadt. Normalerweise bewachte das FBI die Justizministerin, jetzt aber genoß sie zusätzlich den Schutz des Secret Service. Eine Plexiglasscheibe trennte sie und Wilcox von den Agenten auf den Vordersitzen, so daß sie ungestört waren. Während der Fahrt die Peach Street hinunter waren beide in Gedanken versunken. In der Limousine wurde es abwechselnd hell und dunkel durch die Schatten der gläsernen Bürotürme. Schließlich brach Wilcox das Schweigen.
»Ich muß es wissen, Allison.«
Sie wandte sich ihm zu. »Sie müssen was wissen?«
Er hob eine Augenbraue, als hätte sie einen Scherz gemacht. »Warum sind Sie der Frage ausgewichen?«
»Weil sie keine Antwort verdient hat.«
Er lachte in sich hinein, aber es war ein verärgertes Lachen. »Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Meryl Streep in Brücken am Fluß? Vielleicht ist es im Kino anders, aber außerehelicher Sex kann immer noch das Ende einer politischen Karriere bedeuten.«
»Ach ja?« sagte sie in einem herausfordernden Tonfall. »Ich muß sagen, daß ich diese ganze Kontroverse sehr faszinierend finde. Und was ist mit all den Männern, die in diesem Land zum Präsidenten gewählt wurden, obwohl sie die größten Schürzenjäger waren? Aber in dem Moment, wo nur die leiseste Möglichkeit besteht, daß eine Frau, die für das Präsidentenamt kandidiert, ihrem Mann untreu gewesen sein könnte, schlägt die alte Doppelmoral gleich wieder zu. Die ganze Nation macht plötzlich einen Zeitensprung. Es ist wie ein Rückfall ins Jahr 1952, als auf der Titelseite von Look in bezug auf Adlai Stevenson die Frage aufgeworfen wurde: Kann ein geschiedener Mann zum Präsidenten gewählt werden?«
Wilcox war wie versteinert. »Ich möchte Sie daran erinnern, daß die Frage mit nein beantwortet wurde. Und er verlor gegen einen geachteten Kriegshelden, einen General der Armee der Vereinigten Staaten.«
»Lincoln Howe ist kein Dwight Eisenhower.«
Sie schwiegen wieder, bis die Limousine an einem hochaufragenden zylinderförmigen Gebäude vorbeifuhr, das aussah wie ein siebzigstöckiger Silo.
»Ich denke, daß Sie die Frage beantworten sollten«, sagte er, während er aus dem Fenster starrte.
Allison sah ihn gereizt an. »Nein.«
»Haben Sie denn tatsächlich etwas zu verbergen? Ist das der Grund, warum Sie nicht antworten wollen?«
Sie verzog das Gesicht. »Ich stand gestern abend vor fünfzig Millionen Zuschauern und habe mich geweigert, irgendwelche Fragen über eheliche Treue zu beantworten – aus Prinzip. Wenn ich dann, nur zwölf Stunden später, nach einem Blick auf die jüngsten Meinungsumfragen, plötzlich doch auf die Frage antworte, was würde das über meine Prinzipien aussagen?«
Die Augen traten ihm fast aus dem Kopf. »Es ist ja wohl nicht nur Ihr Ruf, der hier auf dem Spiel steht, oder? In diesem Geschäft macht man sich keinen Namen, indem man Wahlen auf der Zielgeraden verliert. Ein Jahr meines Lebens – achtzehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche – habe ich in Ihren Wahlkampf gesteckt, und zwar mit einem Ziel: daß Sie gewählt werden. Das lasse ich mir doch nicht vermasseln durch irgend so eine Wochenendsause mit irgend so einem neunzehnjährigen Wahlkampfhelfer, von dem Sie mir nichts erzählen wollen.«
»Das denken Sie wirklich von mir?« fragte sie verbittert.
»Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich habe es einfach verdient, die Wahrheit zu erfahren.«
»Der einzige, der es verdient hat, alles zu wissen, ist Peter. Und wissen Sie was? Peter hat nicht im Traum daran gedacht, mich so einen Blödsinn zu fragen, bevor er das Hotel heute morgen verlassen hat. Aber wenn Sie es unbedingt wissen wollen, sage ich’s Ihnen: Nein, ich habe Peter nie betrogen. Wollen Sie jetzt vielleicht noch wissen, welche Stellungen ich bevorzuge?«
Sein Handy klingelte. Er wandte den Blick ab und meldete sich. »Wilcox.«
Allison holte tief Luft. Es überraschte sie, daß selbst ihr eigener Wahlkampfleiter ihre Integrität in Frage stellte. Es war ihr bisher noch gar nicht in den Sinn gekommen, aber vielleicht hätte Peter auch ein bißchen Beruhigung gebrauchen können. Vielleicht waren es doch nicht nur »Geschäfte« gewesen, die ihn früher als erwartet hatten aus dem Ritz aufbrechen lassen.
Ihr Blick wanderte zurück zu Wilcox. Er massierte sich die Schläfen, als er das Telefon abschaltete.
»Was gibt’s«, fragte sie.
»Die Ergebnisse der Gallup-Umfragen von gestern abend sind da. Ihre sechs Punkte Vorsprung sind auf eineinhalb zusammengeschmolzen. Wenn man die Irrtumswahrscheinlichkeit einbezieht, laufen Sie und Howe ein totes Rennen.« Er kniff die Augen zusammen, dann sah er ihr in die Augen. »Ihnen ist doch hoffentlich klar, was das bedeutet, oder?«
»Ja«, sagte sie ungläubig. »Wir sind wieder im Jahr 1952 angekommen.«
Aus seiner Hotelsuite fünfzehn Stockwerke über Atlanta lächelte Lincoln Howe hinab auf den Schauplatz seines gestrigen Sieges. Das alte Fox Theatre hatte die Architektur einer Moschee, mit Zwiebeltürmen und Minaretten, ein grandioses Monument aus der Zeit der vorübergehenden Faszination der Amerikaner für »alles Ägyptische«, nachdem im Jahre 1922 das Grabmal von Tutenchamon entdeckt worden war. Das Vordach über dem Haupteingang an der Peachtree Street kündete noch immer »Präsidentschaftsdebatte, heute 21:00 Uhr« an. Der General bekam leuchtende Augen und wünschte, es wäre heute abend und er könnte das alles noch einmal erleben.
»Witzig, nicht wahr?« sagte er, als er sich vom Fenster abwandte. Aber sein Wahlkampfmanager hörte nicht zu. Wie üblich saß Buck LaBelle am Telefon und führte fünf Gespräche gleichzeitig.
Seit Jahren kannte General Howe den vierundvierzig Jahre alten LaBelle, der sich als Zigarren kauendes Mitglied der Legislative des Staates Texas einen Namen gemacht hatte. Er war Absolvent der Texas A&M University und ein Wahlkampfmanager, der aus dem Schlachtruf von Alamo eine amerikanische Siegeshymne gemacht hätte. Als Vorsitzender der Republican National Party in den frühen Neunzigern war er ein hartnäckiger Spendenbeschaffer und Hauptautor des Wahlkampfhandbuchs des Republikanischen Nationalkomitees gewesen. Howe persönlich hatte ihn rekrutiert, damit er seinen Wahlkampf zu den Vorwahlen in Texas leitete. Er sah in dem erfahrenen LaBelle die perfekte Ergänzung zu sich selbst, einem Kandidaten, der bisher nie ein öffentliches Amt bekleidet hatte. Bis zum Memorial Day hatte LaBelle die Spitzenposition unter den nationalen Wahlkampfmanagern errungen.
Howe schaute mit gebieterischer Miene zu ihm hinüber. LaBelle legte pflichtschuldig den Hörer auf und widmete dem General seine ganze Aufmerksamkeit.
Mit einer knappen Kopfbewegung deutete Howe auf das Fenster. »Sehen Sie den Notausgang seitlich vom Theater? Dort drüben.« Er wies hinunter. »Auf der Ponce de Leon Avenue.«
LaBelle ging zum Fenster und blickte hinab. »Ja, Sir. Sehe ich.«
»Als ich ein Junge war, nahm meine Tante mich und meinen Bruder genau in dieses Fox Theatre mit, um mit uns eine Samstagnachmittagsvorstellung anzusehen. Ich dachte erst, sie wollte uns reinschmuggeln. Ich verstand nicht, warum wir durch den Notausgang hineingingen. Aber das war der einzige Eingang für Farbige. Die Weißen benutzten diesen prächtigen Eingang von der Straße her, der so aussieht wie ein Grabmal.«
LaBelle blinzelte; er schämte sich für die Weißen. Doch dann wurde er plötzlich ganz ernst. »Ich bin froh, daß Sie das nicht gestern abend während der Debatte erwähnt haben, Sir.«
»Warum?«
Er verzog das Gesicht peinlich berührt. »Weiße tun eine ganze Menge Dinge aus Schuldgefühlen heraus. Sie lächeln Sie an. Sie laden Sie zu sich nach Hause ein. Sie erlauben Ihnen sogar, das Fox Theatre durch den Vordereingang zu betreten. Aber solange es geheime Wahlen in diesem Land gibt, werden sie niemals aus Schuldgefühl einen Schwarzen zum Präsidenten wählen.«
»Sondern? Wegen seines Charakters?«
»Allerdings. Die Medien weiden sich doch schon daran. Warten Sie nur, bis unsere örtlichen Organisationen dieses Thema anheizen. Alle Priester, Prediger und Rabbis werden an diesem Wochenende über Ehebruch reden. Bei den Radio- und Fernsehshows werden die Telefone nicht mehr stillstehen. Besorgte Eltern werden die Lokalzeitungen mit Leserbriefen bombardieren. Die Lehrer werden Moral zum Unterrichtsthema machen. Es gibt zahllose Möglichkeiten, dieses Thema zu behandeln.«
»Und ich? Was soll ich sagen?«
»Ich werde selbst etwas aufsetzen. Es hat mir nicht gepaßt, was unsere Redenschreiber zustande gebracht haben. Sie sind zu ängstlich, was man irgendwie verstehen kann. Unmengen von Leuten haben Affären gehabt oder jemandem verziehen, der sie betrogen hat. Sie werden befürchten, daß wir uns zu sehr als Richter aufspielen – als wollten wir sie verurteilen, nicht Leahy.«
»Und wie wollen Sie das machen?«
»Sir, ich bin fest davon überzeugt, daß man die Heuchelei der Amerikaner nicht unterschätzen darf.«
»Buck, Sie sind ein politisches Genie.«
»Sie können das ruhig mir überlassen, Sir. Ich werde dafür sorgen, daß von heute an bis zur Wahl jeder Mann und jede Frau in Amerika über Untreue in der Ehe spricht.«
Der General wandte sich zum Fenster und betrachtete erneut das Transparent am Vordach des Theaters, das die Debatte vom Vorabend ankündigte. »Jeder«, sagte er selbstgefällig, »außer Allison Leahy.«
4
Der Freitag war reine Zeitverschwendung. Allison hatte sich bemüht, über wesentliche Dinge zu reden. Sie hatte sogar für ihre »Nulltoleranz«-Politik gegenüber jugendlichen Autofahrern geworben – die Promillegrenze sollte bei Null liegen, da für Jugendliche Alkoholkonsum sowieso illegal war. Aber alle hatten sich ausschließlich für ihre Schlafgewohnheiten interessiert.
Sie war mit ihren Gedanken tatsächlich woanders gewesen seit der morgendlichen Fahrt in der Limousine, bei der der anklagende Tonfall ihres eigenen Wahlkampfmanagers sie auf den Gedanken gebracht hatte, daß ja vielleicht sogar ihr eigener Mann Zweifel hatte. Daß er sich ganz gegen seine Gewohnheit nicht nach ihrem Telefonanruf am Mittag gemeldet hatte, hatte ihre Befürchtungen nicht gerade zerstreut. Sie sagte ihre letzte Freitagabendveranstaltung ab, um die Nacht in ihrem eigenen Bett verbringen zu können, an der Seite von Peter.
Um 22:55 Uhr landete der Privatjet schließlich am National Airport von Washington. Vom Terminal fuhr sie nach Hause, allein auf dem Rücksitz ihrer Limousine. Ihre übliche Eskorte fuhr voraus, zwei der vier FBI-Agenten, die sie schon zu ihrer Zeit als Justizministerin bewacht hatten, noch bevor sie ihre Kandidatur angekündet hatte und zu einer interessanteren Zielscheibe wurde, die zusätzlich den Schutz des Secret Service benötigte.
Die Wahrzeichen der Macht und der Geschichte Washingtons erleuchteten den Nachthimmel entlang der Schnellstraße. Das Jefferson Memorial. Das hoch aufragende Washington Monument. Die Kuppel des Capitols in der Ferne. Während der Fahrt erinnerte sie sich an ihren ersten Familienausflug nach Washington vor vierzig Jahren, auf dem sie ihrem zehn Jahre alten Bruder eine Ohrfeige verpaßt hatte, weil er ihr erklärte, nur Jungs könnten Präsident werden. Ob durch die zerkratzte Windschutzscheibe des Familienkombis oder durch die dunkel getönten Fenster der Limousine der Justizministerin, die beeindruckenden steinernen Monumente waren dazu angetan, Träume zu inspirieren und der Politik Würde zu verleihen.
Was für eine Illusion, dachte sie.
Sie schaltete den kleinen Fernseher an, der in die Konsole eingelassen war. Der Bildschirm verbreitete flimmerndes Licht. Es war kurz nach halb zwölf. Aus makabrer Neugier wollte sie wissen, was die Gäste der Talkshows heute abend über sie redeten. Jay Leno hatte gerade mit der Einleitung seiner »Tonight Show« begonnen. In seinem üblichen dunklen Anzug stand er vor einer jubelnden Menge, wie immer ein teuflisches Grinsen im Gesicht.
»Fairerweise müssen wir sagen«, scherzte Leno, »daß Justizministerin Leahy wirklich mit harten Fragen bombardiert wird. Erst heute hat ein Reporter sie auf den Kopf zu gefragt, ob sie ihrem Mann beim Sex Schweinereien ins Ohr flüstert. Darauf gab Ms. Leahy die ehrliche Antwort: ›Nur, wenn ich ans Telefon gehe.‹ Nun, Leute, die Lady hat Klasse. Sie führt diese Sex-Kontroverse wirklich nicht im Liegen!«
Leno grinste, und die Menge grölte. Die Band knallte eine harte Gitarrenversion von Roy Orbisons »Pretty Woman« heraus, eines alten Songs, der jetzt bestens bekannt war als Titelmelodie des Films mit Julia Roberts als Straßenhure.
Allison schaltete den Fernseher aus, als die Limousine am Dent Place 3321 hielt. Ihr Haus aus dem neunzehnten Jahrhundert im Federal-Stil war einfach, jedoch reich an Erinnnerungen: der frischgebackene Senator John F. Kennedy und seine Frau Jackie hatten es vor fast fünfzig Jahren zu ihrer ersten Wohnung in Washington auserkoren. Es war nicht Allisons erste Wahl gewesen, und es hatte seinerzeit nicht einmal zum Verkauf gestanden. Aber Peter hatte gemeint, wenn sie schon Grundbesitz in der Hauptstadt erwerben wollten, dann müßte es schon etwas von Camelot sein.
Die Wagentür wurde geöffnet, und ihre Bewacher vom FBI traten zur Seite. Allison nahm Handtasche und Aktenkoffer und betrat, in ihren marineblauen Trenchcoat gehüllt, den Gehweg. Die FBI-Leute begleiteten sie durch das vier Meter hohe schmiedeeiserne Tor bis zur Haustür. Die Verandabeleuchtuung verströmte ein unheimliches gelbes Licht. In der kühlen Nachtluft war Allisons Atem schwach zu sehen, als sie in ihrer Handtasche nach ihrem Schlüssel suchte, der natürlich mal wieder zuunterst lag.
»Gute Nacht, Roberto«, sagte sie mit einem höflichen Lächeln.
Er antwortete mit einem einfachen Nicken und drehte sich wortlos um. Allison sah ihm von der Veranda aus nach, als er den alten steinernen Gehweg hinunterging, zurück zur Limousine. Er war schon immer ein verschlossener Typ gewesen, aber heute schien er noch reservierter zu sein. Vielleicht hatte auch er neuerdings eine schlechtere Meinung von ihr.
Oder vielleicht bist du einfach paranoid.
Sie öffnete die Haustür, betrat die mit Marmor geflieste Diele und schaltete die Alarmanlage aus.
»Peter?« rief sie. Das Erdgeschoß war völlig dunkel. Allison stellte ihren Aktenkoffer ab und hängte den Mantel an die Garderobe, dann knipste sie das Flurlicht an und ging hinauf. Ihre Absätze klapperten auf den alten Eichenstufen. Als sie oben ankam, hörte sie aus dem Schlafzimmer den Fernseher. Ihr Magen zog sich zusammen. Hoffentlich sah Peter sich nicht gerade die »Tonight Show« an.
Die Schlafzimmertür stand halb offen. Mit einem leichten Stoß öffnete sie sie ganz. Eine Tiffany-Lampe auf der Kommode verströmte sanftes Licht über die französischen Antiquitäten, von denen die meisten direkt beim Louvre des Antiquaires in Paris gekauft worden waren. An der vier Meter hohen Kassettendecke aus Mahagoni hing ein Baccarat-Kronleuchter. Die Einrichtung war mehr nach ihrem Geschmack als nach Peters, obwohl sie zugeben mußte, daß sie sich das alles von ihrem Einkommen als Angestellte der Regierung nicht hätte leisten können. In den Anfängen ihrer Beziehung hatte Peter es sich zur Aufgabe gemacht, ihr teure Dinge zu kaufen, um alles zu ersetzen, was mit Erinnerungen behaftet war. Er hatte die komplette Einrichtung bezahlt, die für das Leben nach Emily stand.