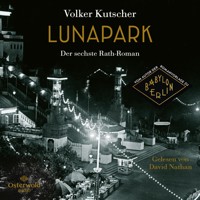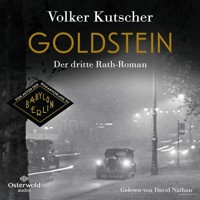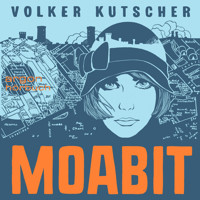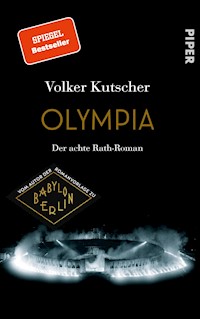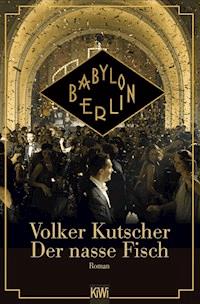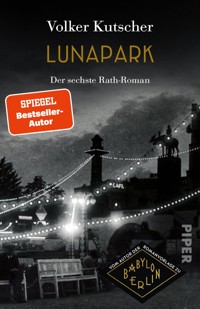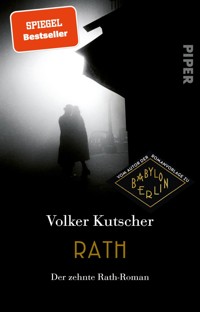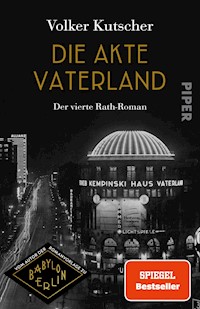
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Berlin am Abgrund: Gereon Raths vierter Fall. Juli 1932, die Berliner Polizei steht vor einem Rätsel: Ein Mann liegt tot im Lastenaufzug von »Haus Vaterland«, dem legendären Vergnügungstempel am Potsdamer Platz, und alles deutet darauf hin, dass er dort ertrunken ist. Kommissar Gereon Rath hat schon genug Ärger. Seine Ermittlungen gegen einen mysteriösen Auftragsmörder treten seit Wochen auf der Stelle, seine große Liebe Charlotte Ritter fängt als Kommissaranwärterin am Alex an – ausgerechnet in der Mordkommission. Und der Tote vom Potsdamer Platz scheint Teil einer Mordserie zu sein, deren Spur weit nach Osten führt. »Ein fabelhafter Krimi, dessen Spannung sich neben der politischen Düsternis aufbaut« Die Literarische Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 848
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Kriminalroman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Akte Vaterland« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Erstausgabe: Kiepenheuer & Witsch, Köln 2012
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Bundesarchiv, Bild 102-13681 / Fotograf: Georg Pahl
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence, München mit abavo vlow, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
Prolog
Erster Teil
Berlin
2. bis 6. Juli 1932
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Zweiter Teil
Masuren
7. bis 13. Juli 1932
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Dritter Teil
Preußen
18. Juli bis 6. August 1932
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Epilog
Nachbemerkung des Autors
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Das Jahr 1932 wird unser Jahr sein, das Jahr des endlichen Sieges der Republik über ihre Gegner. Nicht einen Tag, nicht eine Stunde mehr wollen wir in der Defensive bleiben – wir greifen an! Angriff auf der ganzen Linie! Unser Aufmarsch schon muß Teil der allgemeinen Offensive sein. Heute rufen wir – morgen schlagen wir!
Karl Höltermann, SPD, im Dezember 1931
Prolog
Sonntag, 11. Juli 1920
Er ist wieder unterwegs und schleicht durch die Wälder, hat seinen Unterschlupf verlassen und schnürt durchs Gehölz, niemand wird ihn hören, niemand ihn sehen. Eine gelbfarbene Trägheit liegt in der Luft, selbst im Schatten der Bäume spürt er die Wärme des Tages, der Sommer ist mit Macht ins Land gekommen. Die Lindenblüten verbreiten ihren Duft und die Wintergerste auf den Feldern drüben bei Markowsken. Tokala hält inne und nimmt einen tiefen Atemzug. Auch den See kann er bereits riechen und freut sich auf das Bad im kalten, weichen Wasser.
Je näher er seinem Ziel kommt, desto langsamer werden seine Bewegungen. Er ist scheu, und wenn er sich einmal zeigt, dann nur, um den Menschen einen Schrecken einzujagen. Er mag es nicht, wenn sie in seinen Wald kommen, er mag ihr lautes Rufen nicht, nicht ihr rücksichtsloses Trampeln durchs Unterholz, das ihre Verachtung zeigt für alles, was ihm heilig ist.
Er hat einen Spiegel in seiner Hütte hängen, und manchmal, bevor er hinausgeht, reibt er sein Gesicht mit schwarzer Erde ein, bis seine Augen wild leuchten und er aussieht wie ein Raubtier, wenn er die Zähne bleckt. In der Dämmerung macht ihn das so gut wie unsichtbar, jetzt aber steht die Sonne hoch am Himmel, und er hat auf diese Tarnung verzichtet. Umso vorsichtiger bewegt er sich, seine Mokassins sind aus Elchleder, in ihnen schleicht er leise wie eine Katze.
Tokala muss aufpassen, der See gehört schon zu ihrem Reich, er könnte auf Menschen stoßen. In seine Wälder trauen sie sich nicht, dort haben sie Angst, Angst vor dem Moor und vor dem Kaubuk.
Kaubuk. Ja, so nennen sie ihn, weil sie keinen anderen Namen finden. Seinen alten Namen, an den er sich selbst kaum erinnert, haben sie längst vergessen, und noch weniger kennen sie seinen neuen, den er sich zugelegt hat, als er ihre Welt verlassen hat vor vielen Wintern, seinen wahren Namen, seinen Kriegernamen.
Tokala.
Der Fuchs.
Wie ein Fuchs schnürt er durch die Wälder, versteckt sich in seinem Bau, und sie lassen ihn gewähren. Sie lassen ihn in Ruhe seine Dinge tun und er sie die ihren; niemand mischt sich ein in die Welt des anderen, das ist die unausgesprochene Abmachung seit Jahren. Es ist gefährlich in ihrer Welt, doch ab und zu muss er es wagen, muss des Nachts in ihre Städte und Dörfer, wenn er neue Bücher braucht oder Petroleum oder ein paar von den Früchten, die bei ihm im Moor nicht wachsen wollen.
Seine Vorsicht ist nicht übertrieben, er hat den See schon fast erreicht, da hört er ein Summen und Singen und hält inne, inmitten der Bewegung, und lauscht. Eine Frauenstimme, eine unbestimmte Melodie. Langsam schleicht er zu seinem Uferversteck. Tokala hat sie erkannt, schon an ihrer Stimme erkannt, noch bevor er ihr Sommerkleid weiß und rot durchs Geäst schimmern sieht.
Niyaha Luta, so nennt er sie.
Er hat sie schon einmal gesehen, vor wenigen Wochen an derselben Stelle, und auch da hat er in seinem Versteck gehockt und sich nicht zu rühren gewagt. Er wusste, dass sie ihn nicht sehen konnte im Dunkel des dichten Buschwerks, und doch schien sie ihn direkt anzuschauen, als sie aufblickte von ihrem Buch. Dass sie sich nicht allein fortgestohlen hatte aus der Stadt, das merkte er, als ein metallisches Scheppern und Klingeln in sein Versteck drang und kurz darauf ein Mann mit einem Fahrrad aus dem Wald trat. Sie hatte ihn erwartet, das konnte man sehen. Und dann küsste sie ihn. Es war tatsächlich sie, die ihn küsste, nicht umgekehrt, und da wurde Tokala klar, dass sie sich nicht zum ersten Mal trafen und dass ihre Begegnung kein Zufall war.
Das war der Moment, in dem er sich aus seinem Versteck zurückgezogen hatte ins Dunkel des Waldes.
Und jetzt ist sie wieder hier, und Tokala hockt in seinem Versteck, sieht ihr Kleid, ein Muster wie aus roten Federn auf leuchtendem Weiß, er sieht ihre nackten Beine, die ins Wasser baumeln. Sie sitzt auf dem sonnenbeschienenen Ast, der in den See hinausragt, genau wie damals, und wieder liest sie in einem Buch.
Zweige knacken, als ein Mann aus dem Wald tritt. Nicht der Mann mit dem Fahrrad, es ist ein anderer, und Tokala sieht in ihrem Gesicht, dass sie diesen Mann nicht erwartet hat. Sie klappt ihr Buch zu, als habe er sie bei etwas Verbotenem ertappt.
»Hier also treibst du dich rum«, sagt der Mann.
»Ich treibe mich nicht rum, ich lese.«
»Du liest! Mitten in der Wildnis, wo alle in die Stadt gekommen sind, selbst die Bauern aus Jewarken und Urbanken, um ihre vaterländische Pflicht zu erfüllen?«
Sie reden viel von Vaterland in diesen Tagen. Tokala versteht ihre Reden nicht. Und warum Männer in Uniformen ihn jagen, wenn er von Suwalki ein paar Flaschen Petroleum mitbringt oder Salz im Tausch für seine Pelze. Für ihn macht es keinen Unterschied, ob er im Markowsker Wald unterwegs ist oder bei Karassewo, sie aber tun, als sei es der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Die Grenze. Er hat noch nie verstanden, was sie damit meinen. Der Wald ist derselbe, zu beiden Seiten der Grenze, und Tokala wird nie verstehen, warum der eine Baum preußisch sein soll und der nächste polnisch.
Es plätschert, als der Mann ins seichte Uferwasser tritt und zu Niyaha Luta hinübergeht.
»Dass du dich so weit in den Wald hineinwagst! Hast du keine Angst, dass du dich ins Moor verirrst? Oder dass der Kaubuk dich holt?«
»Ich bin kein Kind mehr, dem man mit so etwas Angst einjagt.«
»Nein, du bist kein Kind mehr, fürwahr.« Der Mann schaut sie an, auf eine Art und Weise, die Tokala nicht gefällt. »Du bist eine erwachsene Frau. Hast jetzt sogar Stimmrecht.«
»Ich habe abgestimmt, gleich nach dem Kirchgang. Wenn das deine Sorge sein sollte.«
Sie will laut und mutig klingen, das spürt Tokala, doch ein leises Zittern schwingt in ihrer Stimme mit.
»Meine Sorge …« Er schnaubt verächtlich. »Und danach hattest du nichts Eiligeres zu tun, als hier hinauszureiten …«
Sie schaut sich um, ängstlich. Als fürchte sie, der Mann mit dem Fahrrad könne jeden Augenblick aus dem Wald kommen. Tokala hockt in seinem Versteck und fürchtet sich mit ihr.
»Liegt es vielleicht daran, dass da ein rotes Taschentuch bei der Stadtmühle am Brückengeländer hängt?«
Sie sagt nichts, und der Mann tritt näher, bis an den Ast, auf dem sie sitzt, und zeigt auf die Rinde.
»Da hat jemand ein Herz reingeritzt«, sagt er.
»Ach ja?«
Sie klingt wieder mutiger. Der Mut der Verzweiflung.
»A Punkt, Em Punkt«, sagt er und pult mit seinen Fingern im Holz, »und daneben Jot Punkt, Pe Punkt. Ganz frisch reingeritzt.«
Sie sagt nichts, doch Tokala sieht die Angst in ihren Augen.
»A Punkt, Em Punkt, das könntest ja glatt du sein, mein Täubchen.«
Sein Zeigefinger fährt den Buchstaben in der Rinde nach.
»Aber wer ist Jot Punkt Pe Punkt?«, fragt er.
Tokala sieht, wie sich ihre Angst langsam in Wut verwandelt.
»Was willst du mir sagen?«, herrscht sie ihn an, »was zum Teufel willst du mir sagen?«
»Dass du dir einen Schmisser angelacht hast, das will ich dir sagen! Und was ich davon halte!«
Der Mann brüllt jetzt. Tokala in seinem Versteck hält sich die Ohren zu, doch das Brüllen dringt hindurch.
»Ich habe dir nie irgendwas versprochen!«
Sie ist heruntergesprungen vom Ast, steht mit den nackten Füßen im seichten Wasser und funkelt ihn wütend an.
»Ach ja?«, sagt er. »Aber dem Polack, dem hast du was versprochen, oder wie muss ich das hier verstehen?«
»Du musst gar nichts verstehen, das geht dich alles einen feuchten Kehricht an!«
»Man redet schon über euch! Du bist nicht einmal großjährig und treibst dich mit diesem Kerl rum, wirfst ihm verliebte Blicke zu!«
»Ich habe dir nie etwas versprochen, und niemals, nie im Leben werde ich zulassen, dass ein Kerl wie du mich anfasst!«
Der Mann taumelt zurück, als hätten ihre Worte ihn körperlich getroffen. Wie Stockhiebe. Dann steht er wieder ruhig. Und spricht auch wieder leiser.
»Aber ihn lässt du ran, was? Den Polack!«
»Er ist kein Pole, er ist Preuße, so wie du.«
»Du gibst es also zu!«
»Und wenn schon? Vielleicht werde ich ihn heiraten!«
»Einen Katholiken? Einen Polenfreund?«
»Ich wüsste nicht, was dich das angeht.«
»Was mich das angeht? Das fragst du noch?«
»Ja, das frage ich dich! Ich weiß nicht, was du hier willst. Verschwinde endlich und lass mich in Ruhe!«
»Einen Teufel werde ich. Einer muss dir ja Manieren beibringen! Wenn dein Vater das schon versäumt hat!«
»Wage es ja nicht, mich anzufassen!«
Der Mann macht einen Schritt auf sie zu, und ihre Augen funkeln ihn an, doch das scheint ihn nicht zu schrecken.
»Nur ein Kuss«, sagt er, und es klingt alles andere als zärtlich. »Wenn du den Polacken küsst, habe auch ich jedes Recht, dich zu küssen!«
Mit beiden Händen fasst er ihre dünnen Arme, die ihn abzuwehren versuchen. Tokala hockt in seinem Versteck und sieht, wie der Mann sie gepackt hält und seinen Mund auf ihr Gesicht drücken will und wie sie versucht auszuweichen. Er ist stärker.
»Lass mich los«, ruft sie, als sie ihren Mund endlich wieder frei bekommt.
»Was ist denn? Eine Hure wie du kann doch gar nicht genug kriegen von den Männern, oder?«
Der Mann zwingt sie mit festem Griff zu Boden, ins seichte Uferwasser, das plätschert, als sie versucht, sich zu wehren. Er ist böse, Tokala hat es gewusst.
»Lass mich!«, schreit sie ihn an, doch der böse Mann lässt sie nicht, ihr Schreien geht unter in einem Gurgeln, ihr Kopf muss unter Wasser geraten sein.
Tokala wendet seinen Blick ab. Und sieht eine andere Frau und einen anderen Mann, nicht im See, in einer Hütte, im Schein einer Petroleumlampe. Die Frau blutet über dem Auge, das Gesicht des Mannes ist gerötet, er ist betrunken und wütend, und er schlägt zu und zerreißt ihr das Nachthemd …
Tokala schiebt das Bild weg und schaut wieder zum Seeufer, sieht, wie der Mann dort die Frau bedrängt. Etwas in ihm will eingreifen, doch eine andere Stimme hält ihn zurück. Er hat sich nicht einzumischen in die Welt der Menschen! Wie viele Männer gibt es drüben in der Stadt, die ihren Frauen wehtun? Das ist ihre Welt, und Tokala weiß, dass sie böse ist. Deswegen hat er sie verlassen. Die aus der Stadt mischen sich nicht in seine Dinge, und er mischt sich nicht in die ihren, so funktioniert sein Leben seit Jahren, und es ist das einzige Leben, das er sich vorstellen kann.
Er erträgt den Anblick nicht länger, er muss zurück in seinen Wald, er kann keine Sekunde länger bleiben. Und während er langsam rückwärts schleicht, so wie er es gelernt hat aus den Büchern, sieht er noch, wie der böse Mann an ihrem Sommerkleid zerrt, und hört den Stoff reißen, er sieht, wie der Mann sich auf die wehrlose Frau legt und seinen Hosenschlitz aufknöpft, wie er sie mit dem anderen Arm zu Boden drückt und mit den Knien ihre Schenkel spreizt. Tokala hört sie schreien, und wieder erstickt ein Gurgeln ihren Schrei, als ihr Kopf kurz unter Wasser gerät. Und wieder sieht er die Frau mit dem zerrissenen Nachthemd, ihre leblosen Augen.
Mit diesem Bild im Kopf läuft er fort, läuft in den Wald, läuft so schnell er nur kann, läuft weg von ihrer Welt und ihrer Gewalt, weit weg, so weit es nur geht.
Das Böse ist zurückgekehrt, das Böse, vor dem er einst geflohen ist, vor dem er sich sicher gewähnt hat in seinen Wäldern.
Er rennt und rennt, läuft fort vor seiner Vergangenheit, der er doch nicht entkommen kann. Als er den See schon weit hinter sich gelassen hat, bleibt er endlich stehen, mitten im Wald, und es brüllt und schreit aus ihm heraus, dass ringsum die Vögel aufflattern. So steht er da in seiner Hilflosigkeit und Ohnmacht und schreit.
Es geht nicht! Du kannst nicht an ihrer Welt teilhaben, ohne Schmerz zu erfahren, ohne das Böse zurückzurufen, nicht einmal als Beobachter kannst du das. Dies ist die Lektion, die du gelernt hast. Nun weißt du, bestimmter noch als sonst, warum du dich fernhalten musst von ihrer Welt, warum es das einzig Richtige ist, sich fernzuhalten von ihnen und in den Wäldern zu leben.
Erster Teil
Berlin
2. bis 6. Juli 1932
The sun beating down on dead bodies doesn’t know about the future, doesn’t see the big picture, it just knows where to send the flies.
Ed Brubaker, Sleeper, Season Two, #7
1
So dunkel und leer hatte Reinhold Gräf den Potsdamer Platz noch nie gesehen. Frühmorgens, Viertel nach fünf, die Leuchtreklamen waren längst erloschen, und die Gebäude, die den Platz säumten, ragten wie schwarze Felsen gegen den Himmel. Der schwarze Maybach, aus dessen Seitenfenster der Kriminalsekretär schaute, war der einzige Wagen auf der sonst viel befahrenen Kreuzung. Nicht einmal der Verkehrsturm war um diese Zeit besetzt, die Ampeln lauerten dunkel hinter dem Glas. Gräf drückte seine Stirn gegen das Autofenster und betrachtete die Regentropfen, die sich auf der Scheibe zu kleinen Bächen sammelten, in die der Fahrtwind blies.
»Da ist doch schon Haus Vaterland«, meldete sich Lange vom Rücksitz, »das mit der Kuppel, oder?«
Gräf antwortete nicht, er ließ den Fahrer halten und klappte das Fenster herunter. Der Schupo, der an der Stresemannstraße im Regen stand, hatte das Mordauto bereits erkannt und trat heran.
»Lieferanteneingang, Herr Kommissar!« Der Uniformierte zeigte in die Köthener Straße und salutierte.
»Kommissar kommt noch«, sagte Gräf. Er klappte die Scheibe wieder hoch und bedeutete dem Fahrer, rechts abzubiegen.
Seine Laune war nicht die beste. Lange war der einzige Beamte, der mit rausgefahren war; der Kriminalassistent hatte ebenfalls Nachtdienst in der Mordbereitschaft. Christel Temme, die Stenotypistin, hatten sie aus dem Bett geklingelt und in Schöneberg abholen müssen. Dann saß noch der Fahrer mit im Wagen, sonst hatte Gräf um diese Uhrzeit, in der Grauzone zwischen Mitternacht und Morgen, niemanden erreicht, nicht einmal einen Kommissar. Obwohl Gereon Rath Rufbereitschaft hatte, war er nicht ans Telefon zu bekommen. Nach vier vergeblichen Versuchen hatte Gräf aufgegeben und war mit Lange ins Mordauto gestiegen, um die Stenotypistin einzusammeln und endlich zum Tatort zu fahren. Die ganze Fahrt über hatten sie sich angeschwiegen, bis Lange das Schweigen mit seiner überflüssigen Bemerkung unterbrochen hatte.
Natürlich war das hier Haus Vaterland. Die Köthener Straße führte sie an der dunklen Rückseite entlang, vorbei an einer endlose Reihe hoher Rundbögen, notdürftig beleuchtet vom Gaslicht der Straßenlaternen. Einst hatte hier die Ufa residiert, aber dann hatte Kempinski den riesigen Komplex für viel Geld von Grund auf umbauen lassen zu Berlins größtem Vergnügungstempel. Und nun vereinte Haus Vaterland all die Vergnügen unter einem Dach, die der durchschnittliche Tourist aus der Provinz von einem gelungenen Abend in der Weltstadt Berlin erwartete: essen, tanzen, saufen und spärlich bekleidete Revuegirls anglotzen.
Im grellen elektrischen Licht, das aus einem offenen Tor ganz am Ende des Gebäudes fiel, glitzerten die Regenfäden. Der Lieferanteneingang lag so weit von der viel befahrenen Stresemannstraße entfernt wie eben möglich. Zwei Autos standen am Straßenrand, ein heller Lieferwagen mit offener Hecktür und ein dunkelroter Horch. Der Fahrer des Mordautos parkte direkt dahinter, stieg aus und öffnete Gräf die Wagentür.
»Lassense man gut sein, Schröder, ich bin ja nicht der Polizeipräsident.«
»Jawohl, Herr Kriminalsekretär.«
Mathée Luisenbrand, der schmeckt. So stand es auf der Seitenwand des Lieferwagens, der direkt vor dem Eingang parkte, und in kleineren Buchstaben darunter: Herbert Lamkau, Spirituosen. Der Regen wurde immer heftiger, Gräf zog den Hut tiefer.
»Vergiss den Fotoapparat nicht«, blaffte er Lange an, der bereits Anstalten machte, ins Trockene zu kommen. Es hatte ruppiger geklungen, als Gräf beabsichtigt hatte, er wollte nur unmissverständlich klarmachen, wer hier die Ermittlungen leitete, solange der diensthabende Kommissar durch Abwesenheit glänzte. Lange sollte sich bloß nichts einbilden: Kommissaranwärter war kein Dienstgrad, der Mann war nach wie vor Kriminalassistent, und ob er die Prüfung zum Kriminalkommissar schaffen würde, musste sich erst zeigen. So lange jedenfalls hatte Reinhold Gräf den höheren Dienstgrad.
Der Kriminalassistent gehorchte ohne Murren und ging zum Kofferraum des Mordautos, ruckelte einmal daran, ruckelte ein zweites Mal, diesmal heftiger, doch nichts passierte. Gräf kannte das, bei Nässe klemmte die Klappe meistens. Es gab da einen Trick, den hätte sich der Kriminalassistent wohl besser mal zeigen lassen in all den Monaten, die er nun schon am Alex war.
Der Kriminalsekretär umkurvte die Pfützen und ging zum hell erleuchteten Lieferanteneingang hinüber, in dem ein Schupo Wache stand. Der Regen hatte sich in Gräfs Hutkrempe gesammelt und ergoss sich auf den Betonboden, als er den Kopf neigte, um seinen Dienstausweis aus der Westentasche zu fummeln. Der Schupo trat einen Schritt beiseite, um das Wasser nicht auf die Stiefel zu bekommen.
»Melde gehorsamst: Polizeioberwachtmeister Reuter vom sechzehnten Revier, Voßstraße. Uns wurde gegen vier Uhr zweiunddreißig telefonisch ein Leichenfund gemeldet. Haben die Lage in Augenschein genommen und dann unverzüglich die Mordbereitschaft informiert.«
»Schon irgendwelche Erkenntnisse?«
»Keine, Herr Kommissar, nur dass …«
»Kriminalsekretär«, sagte Gräf. »Kommissar ist noch unterwegs.«
»Melde gehorsamst: keine Erkenntnisse, Herr Kriminalsekretär. Außer dass der Mann tot ist.«
Gräf nickte. »Wo liegt sie denn, unsere Leiche?«
Der Tschako zuckte zur Betondecke. »Oben.«
»Auf dem Dach?«
»Im Lastenaufzug. Vierte Etage. Oder dritte. Ist stecken geblieben.«
Gräf schaute sich um. Links waren zwei schmucklose metallene Aufzugtüren zu sehen. Rechts führte eine Betontreppe nach oben.
»Wir haben niemanden mehr mit den Aufzügen hier fahren lassen«, sagte der Schupo, »wegen der Spurensicherung.«
»Sehr gut«, lobte Gräf. Derartige Umsicht war bei Schutzpolizisten nicht selbstverständlich, obwohl Gennat nicht müde wurde, auch den Blauen immer wieder die Grundlagen moderner Polizeiarbeit zu predigen. »Gab’s irgendwelche Probleme deswegen?«
»Nur mit dem Gerichtsmediziner. Der hat geflucht, als er die Treppe hochsteigen musste.«
»Gibt’s denn keine Personenaufzüge?«
»Jede Menge. Aber nicht hier hinten. Weiter vorne im Gebäude, in der Mittelhalle.«
Gräf seufzte und nickte der Stenotypistin zu, die inzwischen auch angekommen war und ihren Regenschirm ausschüttelte. »Wir müssen Treppen steigen, Fräulein Temme«, sagte er und öffnete die Tür. Er sah noch, dass Lange den Kofferraum endlich aufbekommen hatte, bevor er mit der Stenotypistin zur vierten Etage hinaufstiefelte. Eine Handvoll Männer blickte sie an, als sie oben aus dem Treppenhaus traten. Neben dem Schupo, der hier Wache schob, stand ein Wachmann der Berliner Wach- und Schließgesellschaft, daneben ein Mann, der unschwer als Koch zu erkennen war, dann einer im Blaumann und schließlich ein elegant gekleideter drahtiger Herr, dessen sandfarbener Sommeranzug dunkle Regenflecken aufwies. Mit wenigen Blicken verschaffte sich Gräf einen Überblick: hinter ihm die Tür zum Treppenhaus, in der Wand links von ihm zwei Fenster, in der Wand gegenüber die beiden Aufzugtüren. Die linke Doppeltür war geöffnet und gab den Blick in den düsteren Schacht frei und auf ein dickes Drahtseil, an dem die steckengebliebene Aufzugkabine hing, von der nur die oberen zwei Drittel zu sehen waren. Das Licht in der Kabine brannte noch und beleuchtete einen großen Stapel sperrhölzerner Schnapskisten, die auf einem Gitterwagen standen. Mathée Luisenbrand war in schnörkeligen Buchstaben auf das Holz gebrannt.
Der schmeckt, dachte Gräf und zückte seinen Dienstausweis.
»Was ist denn passiert?«, fragte er in die Runde.
Bevor der Schupo etwas sagen konnte oder sonst jemand, hatte sich der Anzugmann, dessen struppiges Haar davon kündete, dass man ihn aus dem Bett geholt hatte, schon in Bewegung gesetzt.
»Ich kann es mir nicht erklären, Herr Kommissar, es ist alles …«
»Kriminalsekretär«, verbesserte Gräf. »Kommissar kommt gleich.«
»Fleischer, Direktor Richard Fleischer«, sagte der Anzugmann und streckte seine Hand aus. »Ich leite Haus Vaterland.«
»Soso.«
»Ich hoffe, wir können diese unerfreuliche Angelegenheit diskret behandeln, Herr Kriminalsekretär. Und schnell. Wir öffnen in wenigen Stunden, und …«
»Wir werden sehen«, sagte Gräf.
Direktor Fleischer wirkte irritiert. Er war es offenbar nicht gewohnt, unterbrochen zu werden. Schon gar nicht zweimal hintereinander.
»All unsere Fahrstühle«, fuhr er fort, »auch die Lastenaufzüge und selbst die Speiseaufzüge werden regelmäßig gewartet, zuletzt vor einem Vierteljahr. Immerhin haben wir siebzehn Aufzüge in unserem Haus und können uns nicht erlauben, dass …«
»Aber stecken geblieben ist er, Ihr Lastenaufzug, oder?«
Fleischer wirkte beleidigt. »Das sehen Sie ja selbst«, sagte er. »Aber dadurch ist Herr Lamkau nicht ums Leben gekommen.«
»Solche Schlussfolgerungen überlassen Sie mal der Kriminalpolizei. Sie kennen den Toten?«
»Nicht persönlich. Einer unserer Lieferanten.«
Gräf nickte und betrachtete die Aufzugkabine, in der sich ein Schatten bewegte. Neben der Schnapslieferung erhob sich eine hagere Gestalt in einem weißen Kittel, und ein blond gescheitelter Kopf schaute aus der Kabine. Obwohl Doktor Karthaus fast eins neunzig maß, war von ihm nur ein Brustbild zu sehen. Es sah aus wie im Kasperletheater.
»Na, wenn das mal nicht die Kripo ist!«
Karthaus’ Worte klangen metallisch hohl aus dem Schacht.
»Herr Doktor! Erstaunlich, dass Ihr Horch immer schneller ist als das Mordauto!«
»Beschweren Sie sich nicht. Seien Sie froh, dass ich Dienstbereitschaft habe. Doktor Schwartz hätte sich geweigert, hier reinzuklettern. Hätte er in seinem Alter wahrscheinlich auch gar nicht mehr geschafft.«
»Tja«, sagte Gräf, »die Würde des Alters lässt sich mit dem, was wir hier tun, nicht immer vereinbaren.«
»Da haben Sie recht«, meinte Karthaus, »trotzdem würde ich lieber arbeiten, als hier nur Däumchen zu drehen.«
Gräf ging hinüber und schaute in die Kabine. Der Tote lag neben seiner Lieferung und steckte in einem hellgrauen Krämerkittel. Sein Gesicht war bleich, die Lippen blau. Über ihm war ein rotes Tuch an das Gitter geknotet, der Stoff schien wasserdurchtränkt zu sein. Auch die Haare glänzten nass, die Schultern ebenfalls, der Stoff des Kittels hatte sich an den Schultern dunkelgrau gefärbt, und rings um den Kopf waren noch die Spuren einer Wasserlache und eines Rinnsals zu erkennen, das zur Aufzugsecke hin abgeflossen war.
»Ist noch in den Regen gekommen, was?«
Der Gerichtsmediziner zuckte die Achseln. »Das müssen Sie die Spurensicherer fragen. Ich hoffe, die kommen bald, damit ich endlich loslegen kann.«
»Sind unterwegs.«
»Und wo bleibt der Kommissar?«
»Kommt Zeit, kommt Rath«, sagte Gräf. Er zeigte zur Tür, wo sich die Spitze eines Kamerastativs aus dem Treppenhaus schob. »Jetzt kommt erst einmal der Kollege Lange und macht Fotos. Und danach dürfen Sie an die Leiche.«
Lange, der Kamera und Stativ geschultert hatte, schaute fragend in die Runde. Gräf nickte nur kurz in Richtung Aufzug, und der Kriminalassistent verstand.
»Morgen, Doktor«, sagte Lange und ließ das schwere Gerät in die Aufzugskabine hinab, »könnten Sie das vielleicht mal annehmen?«
Gräf wandte sich wieder den wartenden Zeugen zu. »Wer hat den Toten eigentlich gefunden?«
Der Koch hob die Hand wie in der Schule. »Ich, Herr Kriminalsekretär.«
»Herr Unger ist einer unserer Chefköche«, soufflierte Direktor Fleischer.
Gräf ging es mehr und mehr auf den Wecker, wie der Geschäftsführer sich in den Vordergrund drängte. »Wo waren denn Sie, als die Leiche gefunden wurde, Herr Direktor?«, fragte er.
»Ich?« Fleischer stutzte. »Natürlich zu Hause. Wieso wollen Sie das wissen?«
»Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sich der Direktor persönlich zu dieser Uhrzeit schon im Gebäude aufhält.«
»Aber ich bitte Sie! Es wurde ein Toter gefunden! Der Wachdienst hat mich selbstverständlich umgehend benachrichtigt, also bin ich hergekommen.«
»Sehr lobenswert«, sagte Gräf und nickte anerkennend. »Ich nehme aber an, die anderen Herren hier waren vor Ort, als die Leiche gefunden wurde.«
Wachmann, Koch und Blaumann nickten.
»Gut. Dann werde ich Sie als Erstes befragen. Wo kann man sich denn hier in Ruhe unterhalten?«
»Ich … ähh … Ich könnte Ihnen mein Büro anbieten«, sagte Direktor Fleischer, sichtlich überrumpelt.
»Gute Idee. Steht dort auch ein Telefon?«
»Selbstverständlich.«
»Dann führen Sie mich und Fräulein Temme doch bitte dorthin. Und lassen Sie alle Mitarbeiter zusammentrommeln, die zum Zeitpunkt des Leichenfundes im Hause waren.«
Fleischer nickte und setzte sich in Bewegung. »Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Wir müssen zwei Etagen tiefer.«
Aus dem Lastenaufzug blitzte es. Lange hatte mit dem Fotografieren begonnen. Gräf seufzte. Jetzt musste er nur noch herausbekommen, wo zum Teufel Gereon Rath sich gerade herumtrieb, dann würde der Tag vielleicht doch zu retten sein.
2
Die Dämmerung schimmerte graublau durch das Glasdach und hatte schon begonnen, das müde Licht der elektrischen Glühbirnen zu verdrängen. Stimmengemurmel, Lautsprecherkratzen und Trillerpfeifen, die typischen Bahnhofsgeräusche kamen Rath lauter vor als sonst, was an der Tageszeit liegen mochte. Die große Uhr zeigte dreiundzwanzig Minuten nach fünf, und er hatte den Eindruck, dass die meisten Leute, die sich um diese Zeit im Bahnhof Zoo herumtrieben, genauso müde waren wie er selbst, trotz des Lärms, den sie veranstalteten. Er hatte zwei Tassen schwarzen Kaffee getrunken, doch immer noch fühlte er sich, als sei er nicht in seinem Körper, sondern schwebe irgendwo darüber und beobachte sich selbst: einen groß gewachsenen, dunkelhaarigen Mann im hellgrauen Sommeranzug und mit dazu passendem Hut, in der einen Hand eine Bahnsteigkarte, in der anderen einen Blumenstrauß und eine rote Hundeleine. Ein müder Mann, der gerade durch die Sperre ging, einen ebenso verschlafenen schwarzen Hund im Schlepptau.
Die Blumen hätte er beinahe vergessen, erst als er den Bahnhof Zoo betreten hatte, war ihm das eingefallen. Und dann hatte er im Blumenladen unten in der Halle schon Licht gesehen und an die Scheibe geklopft. Das Mädchen, das gerade die frisch eingetroffenen Blumen in die Vasen sortierte, hatte ein Einsehen gehabt und den Laden aufgeschlossen und ihm – gegen Aufpreis – einen Strauß gebunden. So standen sie also nun auf dem Bahnsteig wie bestellt und nicht abgeholt: ein Mann, ein Hund, ein Blumenstrauß.
Rath reckte sich und stellte sich auf die Zehenspitzen, um seinen Kreislauf in Schwung zu bringen, dann zog er das Zigarettenetui aus der Innentasche, klemmte die Blumen unter den Arm und zündete sich eine Overstolz an. Eigentlich hätte er gar nicht hier stehen dürfen, er war für die Wochenendbereitschaft eingeteilt, und das hieß, er musste jederzeit telefonisch erreichbar sein. Normalerweise gab man am Alex immer die aktuelle Telefonnummer durch, unter der man zu erreichen war, wollte man nicht das ganze Wochenende zu Hause neben dem Telefon verbringen. Rath vermutete, dass sich Buddha Ernst Gennat, der Leiter der Mordinspektion, allein anhand der Rufnummern, die während der Rufbereitschaft hinterlassen wurden, ein genaues Bild von den Gewohnheiten seiner Beamten machen konnte, welche Kneipen sie so besuchten, welche Restaurants, Theater, Kinos, Sporthallen, Rennbahnen, vielleicht auch welche Frauen. Genau deswegen blieb Rath nach Möglichkeit zu Hause, wenn es ihn traf. Genau wie heute, nur dass er niemandem am Alex Bescheid gesagt hatte, dass er kurz zum Bahnhof Zoo raus war. Er würde eine halbe, vielleicht eine Dreiviertelstunde weg sein, was sollte da schon passieren?
In der letzten Zeit hatte es kaum Mordfälle gegeben – wenn man die Kommunisten und Nazis nicht mitzählte, die einander mit wachsendem Vergnügen totschlugen, seit die neue Reichsregierung als eine ihrer ersten Amtshandlungen das SA-Verbot der Regierung Brüning wieder einkassiert hatte. Erst gestern hatte es im Wedding und in Moabit Schießereien gegeben. Das Ergebnis: ein toter Nazi, acht Verletzte. Um diese Fälle kümmerte sich die Revierkripo, vom Alex kamen da, wenn überhaupt, nur die Beamten der Politischen Polizei raus. Ansonsten hatten vor allem Selbstmorde Konjunktur, nach wie vor: Im Grunewald hatte sich jemand den Kopf weggeschossen, in der Bernauer Straße eine Frau ihr fünfjähriges Kind aus dem Fenster geworfen und war hinterhergesprungen. Der alltägliche Wahnsinn also.
Selten war Gereon Rath die Arbeit in der Mordinspektion so sinnlos vorgekommen wie in der jüngsten Zeit. Er hatte immer gedacht, die Polizei sei dazu da, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen; mittlerweile aber kam es ihm so vor, als seien sie nur noch diejenigen, die die Scherben zusammenkehrten.
Der Lautsprecher auf dem Bahnsteig kratzte, und dann kündigte eine militärisch schnarrende Stimme an, der Nordexpress werde mit etwa zehn Minuten Verspätung in Berlin eintreffen. Rath schnippte die Overstolz auf den Bahnsteig und zündete sich gleich die nächste an. Dann eben noch eine Zigarettenlänge warten. Er spürte, dass er umso nervöser wurde, je länger ihr Zug auf sich warten ließ. Außer ihm war sonst niemand am Bahnhof, kein Grinsemann, keine Greta, niemand, der hätte stören können, zwei Anrufe hatten gereicht, um das sicherzustellen. Rath wusste, dass die meisten von Charlys Freunden ihm ohnehin nicht gern über den Weg liefen, schon immer hatten sie ihn irgendwie gemieden. Oder er sie, so genau wusste er das nicht. Mit all diesen Juristen und Studenten hatte er jedenfalls noch nie etwas anfangen können.
Er musste daran denken, wie er Charly zum Bahnhof gebracht hatte letzten Herbst und wie beschissen er sich dabei gefühlt hatte. Nun endlich kam sie zurück, und er fühlte sich kaum besser, obwohl er nichts so sehr herbeigesehnt hatte wie diesen Moment. Ein Semester hatte sie in Paris bleiben wollen, dann waren es doch zwei geworden. Sie hatten sich viel geschrieben in der Zeit und auch telefoniert, aber nur ein einziges Mal gesehen, ein paar Wochen nach ihrer Abfahrt, als sie sich in einem Hotelzimmer in Köln getroffen und nach einer hektischen Liebesnacht wieder verabschiedet hatten. Und dann war sein lange geplanter Weihnachtsbesuch in Paris ins Wasser gefallen, weil er keinen Urlaub hatte nehmen können. Ein Auftragsmörder hatte Berlin unsicher gemacht, ein Scharfschütze, der seine Opfer mit einem einzigen präzisen Schuss ins Herz erledigte und keine Spuren hinterließ. Sein erstes Opfer, einen halbseidenen Rechtsanwalt, hatte es vor dem Opernhaus in Charlottenburg erwischt, nur das Projektil hatte der Mörder zurückgelassen, keinerlei weitere Spuren, und Czerwinski, der dicke Kriminalsekretär, hatte noch am Tatort gewitzelt: »Vielleicht war es ja das Phantom der Oper.« Damit hatte der Mörder seinen Namen weg, einen Namen, den auch die Hauptstadtpresse dankbar aufgegriffen hatte.
Das Phantom, wie der Todesschütze seither auch im internen Dienstgebrauch genannt wurde, hatte Rath eine weihnachtliche Urlaubssperre beschert, und er hatte sich damit getröstet, dass Charly ja schon Mitte Februar zurückkehren werde. Oder sie das Phantom noch vor Silvester schnappen würden und er wenigstens zum Jahreswechsel für ein paar Tage nach Paris reisen könnte.
Beides war nicht eingetreten.
Sie hatten das Phantom nicht erwischt, nicht vor Silvester, nicht im neuen Jahr, der Unbekannte hatte im Gegenteil weitergemordet, mindestens zwei weitere Todesfälle gingen auf sein Konto, wahrscheinlich sogar mehr, der mysteriöse Scharfschütze war zu einem Symbol des Versagens der sonst so erfolgsverwöhnten Inspektion A geworden.
Und Charlys Rückkehr … Ende Januar, zwei Wochen vor dem Termin, hatte sie nach Berlin telegrafiert, dass Professor Weyer den Vertrag mit ihr verlängert habe, und Rath hatte so getan, als freue er sich mit ihr, hatte sie beglückwünscht, obwohl er sich nicht danach fühlte. Beruflich schien alles bestens zu laufen in Paris, Fräulein Charlotte Ritter war dabei, sich einen Namen zu machen in der Welt der Juristen. In der Welt von Gereon Rath aber sah es anders aus. Das Foto, das sie ihm dagelassen hatte, kam ihm mittlerweile so unwirklich vor, als zeige es einen Menschen, den es gar nicht gab.
Nun aber war das alles vorbei. Sie kam zurück, endlich zurück, und er hatte sich geschworen, sie nie wieder so lange weggehen zu lassen. Hatte sich geschworen, sein Leben endlich in die Hand zu nehmen.
Er hatte den zweiten Zigarettenstummel gerade aufs Gleisbett geworfen, da kündigte der Lautsprecher die Einfahrt des Zuges an. Endlich. Rath stellte sich kerzengerade, zupfte ein wenig an seinem Anzug und schaute den Lichtern entgegen, die langsam aus der Morgendämmerung wuchsen, geräuschlos zunächst, bis der Nordexpress auch sein Getöse in den Bahnhof schob, die Halle mit Fauchen und Wasserdampf füllte und mit lautem metallischen Quietschen. Nachtblaue Schlafwagen zogen an Rath vorbei und wurden immer langsamer, bis der Zug mit einem letzten Zischen der Ventile schließlich zum Stehen kam.
Für einen Moment war es so ruhig, als sei die Zeit stehen geblieben, dann flogen die Türen auf, und überall stiegen Menschen aus den Waggons und füllten den Bahnsteig augenblicklich mit Lärm und Geschnatter. Rath machte einen langen Hals und suchte Charlys schlanke Gestalt. Hoffnungslos in dem Gewimmel. Er musste einen Schritt zurücktreten, weil er sonst umgerannt worden wäre, da bellte der Hund einmal kurz auf, wedelte heftig mit dem Schwanz und zerrte plötzlich mit aller Kraft an der Leine. Rath gab nach und ließ sich von Kirie durch das Gewimmel ziehen.
Und dann sah er Charly auf dem Bahnsteig stehen, sah ihren suchenden Blick und blieb stehen, so sehr warf ihn dieser Anblick um. Der Hund jaulte kurz auf, als die Hundeleine spannte, und schaute sich verwundert um zu seinem Herrchen. Rath stand da und starrte Charly an.
Eigentlich hatte sie sich kaum verändert, und dennoch hätte er sie beinahe nicht wiedererkannt. Ihre Frisur war anders, als er sie in Erinnerung hatte, kürzer und anders geschnitten, das dunkle Haar von einem rötlichen Schimmer, den er nicht kannte. Ihr Hut musste neu sein, und auch der Mantel, den sie trug, und die Schuhe. Das Bild widersprach so sehr dem, das er all die Monate in seinem Gedächtnis bewahrt hatte, dass ihn das Gefühl der Fremdheit vollkommen unerwartet überfiel. Er riss den Arm hoch und winkte mit dem Blumenstrauß. Endlich hatte sie ihn entdeckt, sie lächelte, und das Grübchen auf ihrer linken Wange machte sie wieder ein wenig vertrauter. Kirie zerrte weiter an der Leine, und Rath setzte sich wieder in Bewegung, ließ sich förmlich hintreiben zu ihr.
Und dann waren sie bei ihr angekommen.
Der Hund fremdelte kein bisschen, er sprang sie an und leckte ihr durchs Gesicht, und sie lachte, und Rath freute sich so sehr über dieses Lachen, dass er nur dastand und guckte, immer noch dastand, als Kirie sich längst beruhigt hatte und nur noch mit dem Schwanz wedelte und sie anhechelte. Einen Moment standen sie sich gegenüber und fanden keine Worte. Charly schaute ihn an mit ihren dunklen Augen.
»Willkommen daheim«, sagte er schließlich, um überhaupt etwas zu sagen, und nahm sie in den Arm. Er atmete ihren Duft, und auch wenn das Parfum ihm ebenso fremd erschien wie ihr Äußeres, erkannte er darunter doch den unverwechselbaren Geruch, den nur Charlys Haut aussandte, und dieser Duft war es, der alle Eindrücke der Fremdheit vergessen machte und mit einem Mal zahllose Erinnerungen zurückbrachte; nicht eigentlich Erinnerungen, nichts aus dem Gedächtnis, sondern etwas viel tiefer Gehendes, von dem er nicht gewusst hatte, dass es überhaupt existierte. So viel lag in diesem Duft, dass Rath sich mit einem Mal fühlte, als habe es die vergangenen Monate der Trennung nie gegeben, als würde es so etwas wie Trennung zwischen ihnen gar nicht geben können.
Er drückte sie lange und trat einen Schritt zurück, um sie zu betrachten. Ihre Augen lachten.
»Sind die Blumen da für mich? Oder erwartest du noch jemanden?«
»Marlene Dietrich. Aber die scheint den Zug verpasst zu haben.«
Sie verdrehte die Augen, aber sie lächelte dabei. Rath reichte ihr den Strauß.
»Jetzt bin ich völlig hilflos«, sagte sie und hob beide Hände. In der linken hielt sie eine kleine Reisetasche, in der rechten die Blumen.
»Hilflos ist gut«, sagte er und gab ihr einen Kuss. Als er spürte, wie sie ihn erwiderte, hätte er auf der Stelle über sie herfallen können.
Doch dann fing der Hund an zu bellen, und die Leute guckten zu ihnen herüber.
»Ich denke, wir sollten sehen, dass wir in eine etwas privatere Umgebung kommen«, sagte Rath, und sie grinste.
Er organisierte einen Gepäckträger und führte Charly zum Auto, das gleich vor dem Bahnhof parkte. Der Dienstmann verstaute Charlys Koffer und die Tasche auf dem Schwiegermuttersitz, und Rath gab ihm ein anständiges Trinkgeld. Kaum hatte er die Beifahrertür geöffnet, sprang Kirie in den Wagen. Er zog den widerstrebenden Hund am Halsband aus dem Auto und schickte ihn neben die Koffer auf den Notsitz.
»Der Hund weiß eigentlich, dass er nach hinten muss, wenn jemand anderes mitfährt«, sagte Rath, als er neben ihr im Auto saß und den Motor startete.
»Wer ist denn so alles mitgefahren in den letzten Monaten?«
»Offensichtlich so wenige, dass Kirie sich schon nicht mehr daran erinnert.«
Rath legte den Gang ein. Dass er von der Hardenbergstraße gleich wieder abbog, als sie den Steinplatz erreicht hatten, schien ihr nicht weiter aufzufallen. Als er dann aber in der Carmerstraße parkte und ihr die Autotür öffnete, schaute Charly sich neugierig um. Rath hob den Hund aus dem Notsitz, dann die Koffer und stiefelte auf das Haus zu, hinter Kirie her, die den Weg kannte, und war froh, dass Charly sein Grinsen nicht sehen konnte. Sie folgte ihnen die kurze Außentreppe hoch und in das lichtdurchflutete, marmorgetäfelte Treppenhaus.
»Guten Morgen, Herr Rath«, grüßte der Portier aus seiner Loge.
»Morgen, Bergner«, erwiderte Rath.
»Was wird das?«, flüsterte Charly, als sie bei den Aufzügen standen und einigermaßen außer Hörweite waren. »Wo sind wir hier?«
»Lass dich überraschen.«
Rath drückte den Aufzugknopf, und kurz darauf öffnete sich die Tür. Er musste dem Liftboy nicht sagen, wohin sie wollten, und als sie in der dritten Etage wieder ausstiegen, schaute Charly immer noch wie ein einziges Fragezeichen.
Er zog den Schlüssel aus der Tasche und schloss auf, und Kirie verschwand sofort im Türspalt. Rath öffnete die Tür zur Gänze und stellte die Koffer auf den Marmorboden in der Diele. Er musste sich Mühe geben, sein Grinsen nicht allzu breit werden zu lassen, und wandte sich ab, damit sie es nicht sah. Jetzt erst hatte sie das Messingschild neben der Tür entdeckt.
Rath war dort eingraviert, mehr nicht. Mit Vornamen hatte er sich nicht festlegen wollen. Noch nicht.
»Ich fass es nicht«, sagte sie und trat ein.
»Ich dachte, ich vergrößere mich etwas«, sagte Rath und half ihr aus dem Mantel. »Willst du’s dir nicht ansehen?«
Sie trat ein und schaute sich um. Bewundernd. Die Wohnung war schließlich schon in der Diele eindrucksvoll. Hell und modern. Nur der Hund, der sich wieder in sein Körbchen gelegt hatte und schläfrig blinzelte, störte das perfekte Bild ein wenig.
»Alle Achtung! Wie lange wohnst du schon hier? Haben sie dich zum Oberkommissar befördert oder gleich zum Kriminalrat?«
Er hatte befürchtet, dass sie irgendetwas in dieser Richtung fragen würde.
»Erbschaft«, sagte er also, so beiläufig wie möglich. »Onkel Joseph.«
Das stimmte sogar, doch viel hatte ihm sein Patenonkel, der vor einem halben Jahr gestorben war, nicht hinterlassen. Von dem Scheck aus Übersee aber, den er vor dreieinhalb Monaten erhalten hatte, wollte er ihr lieber nichts erzählen. Zwar hatte nicht der Name Abraham Goldstein darauf gestanden, sondern nur ein Firmenname, von dem Rath bislang noch nie etwas gehört hatte, eine Transatlantic Trade Inc., die ihm zweitausend US-Dollar consulting fee zukommen ließ, doch auch Charly würde eins und eins zusammenzählen können. Und das sollte sie nicht. Niemand durfte wissen, dass er Zuwendungen aus dubiosen Quellen annahm, dass er eigentlich sogar der Ansicht war, das Geld stehe ihm zu, wenn schon der Freistaat Preußen nicht in der Lage war, ihn anständig zu bezahlen. Sein Jahresgehalt betrug nicht einmal fünftausend Mark.
Er liebte ihre dunklen Augen, und er liebte es noch mehr, wenn Charly sie so weit aufriss wie gerade jetzt. Er wusste, wie sehr sie für moderne Architektur schwärmte, und hatte die vier Räume entsprechend eingerichtet. Nicht gerade billig, aber solide. Viel Leder und viel Stahl, edle Hölzer. Die Möbel würden hundert Jahre halten.
Rath öffnete die Tür zum Salon. »Wenn ich bitten darf.«
Die Morgensonne hatte sich gerade freigearbeitet und schickte ihre ersten Strahlen durchs Fenster auf einen üppig gedeckten Frühstückstisch. Es duftete nach frisch gebackenen Schrippen und Kaffee. Der Champagner stand im Kühler, die Gläser an ihrem Platz.
Charly war tatsächlich sprachlos.
»Ich … Meine Güte, ist das ein Empfang«, sagte sie schließlich.
»Ein Berliner Frühstück, dachte ich. Baguette und Camembert kannst du doch bestimmt nicht mehr sehen.« Er zeigte auf die Tür, die er noch nicht geöffnet hatte. »Und nachher zeige ich dir noch das Schlafzimmer.«
»Lüstling!«
»Stets zu Diensten, die Dame.« Er merkte, wie ihn allein der Gedanke erregte, mit ihr nach nebenan zu gehen. Auf das Frühstück hätte er jetzt gut verzichten können.
»Das ist ja …«
Zu spät. Sie hatte den Champagner entdeckt.
»… Heidsieck Monopol.« Genau diese Marke hatten sie bei ihrem ersten Rendezvous getrunken. Im Europahaus. Wenn Rath daran dachte, dass das nun schon über drei Jahre zurücklag, dann war das, was er heute vorhatte, mehr als überfällig.
Er schenkte vorsichtig ein und reichte ihr ein Champagnerglas. Das mit dem Ring.
Er hob sein Glas, und sie stießen an. Charly lächelte und zeigte ihr Grübchen. Er beobachtete sie, während er trank; es dauerte nur einen Moment, ehe sie stutzte und den Ring aus den Champagnerperlen fischte.
Sie sagte nichts, starrte nur den Ring an, der zwischen ihren Fingern tropfte und glänzte, und schien langsam zu begreifen, was das bedeuten könnte.
»Fräulein Charlotte Ritter«, sagte er und nahm ihre Hand, »ich möchte hiermit und in aller Form um Ihre Hand anhalten.«
Er schaute in ihre erstaunten Augen und begriff, dass dies keine Sache war, die er mit der Ironie angehen konnte, mit der er für gewöhnlich jede romantische Situation zerstörte, obwohl er sie eigentlich nur entkitschen wollte. »Charly«, sagte er und glaubte, noch nie in seinem Leben etwas mit diesem Ernst gesagt zu haben, »willst du mich heiraten?«
Sie starrte ihn an, beinahe erschrocken, so glaubte er, und ließ sich auf den nächsten Stuhl fallen.
»Puh«, sagte sie, »das ist aber ein bisschen viel Überraschung an einem Morgen!«
»Ich dachte, ich mache dir einen Antrag, bevor wir ins Schlafzimmer gehen. Ich bin katholisch.«
»Das hat dich doch sonst nie gestört.«
»Charly …« Immer noch hielt er ihre Hand. Nun hockte er wirklich vor ihr wie ein Rosenkavalier des letzten Jahrhunderts, aber das störte ihn nicht. »Ich hätte dich schon längst fragen sollen. Nur … dann kam Paris dazwischen. Aber ich meine es ernst, verdammt ernst: Willst du meine Frau werden?«
Sie schaute ihn an. »Versteh mich nicht falsch, aber bevor ich antworte, muss ich …« Sie brach ab und nahm einen neuen Anlauf. »Gereon, das ist tatsächlich eine sehr ernste Frage. Und auch wenn du sie vielleicht schon längst hättest stellen können, kommt sie jetzt doch – etwas plötzlich. Ich …«
Wieder brach sie ab, und mit einem Mal wusste Rath, warum er diese Situation so gescheut hatte, warum er ihr aus dem Weg gegangen war, obwohl er die Ringe schon vor über einem Jahr gekauft hatte. Mit einem Mal stand da wieder diese Fremdheit im Raum, die er schon am Bahnhof gespürt hatte. Die Frau, die da vor ihm saß, trug Pariser Mode, nichts an ihr erinnerte an das Berliner Mädchen, das er kannte.
Er ließ ihre Hand los und wollte wieder aufstehen, da spürte er, wie sie seinen Kopf in ihre Hände nahm und ihn küsste. Sofort war die erotische Stimmung, die er schon zum Teufel glaubte, wieder da. Jedenfalls seine Erektion.
»Ist das jetzt ein Ja?«, fragte er.
»Lass uns nicht reden«, sagte sie, »nicht jetzt. Später.«
Er küsste sie noch einmal und begann, ihre Bluse aufzuknöpfen.
»Nicht so stürmisch«, sagte sie. »Wolltest du mir nicht das Schlafzimmer zeigen?«
»Wie Sie wünschen, gnädige Frau.«
»Fräulein!«, sagte sie entrüstet.
Er hob sie hoch und trug sie zum Schlafzimmer hinüber. Sie war so weich und warm und federleicht, wie er sie in Erinnerung hatte. Er wusste nicht, ob er sich mit seinem Antrag blamiert hatte, er wusste nicht, wie ihre Antwort lautete, er wusste nur, dass sie das ernste Thema mit einem Kuss beiseitegeschoben hatte und es zwischen ihnen plötzlich wieder so war wie früher.
Das Telefon klingelte.
Er ließ sich nicht beirren und bugsierte Charly ins Schlafzimmer, ließ sie aufs Bett fallen und küsste sie, während er sich wieder an ihrer Bluse zu schaffen machte und sie seinen Krawattenknoten löste.
Das Telefon klingelte weiter. Da war jemand hartnäckig, doch Rath war entschlossen, das Klingeln zu ignorieren, bis Kirie das Telefon mit ihrem Bellen übertönte, und Charly grinste und sagte: »Vielleicht ist es doch besser, du gehst ran.«
Rath schaute auf die Uhr. Viertel vor sechs. Er seufzte und stand auf, ging an den Apparat und meldete sich.
»Mensch, Gereon, endlich! Wo hast du gesteckt, verdammt noch mal?«
Reinhold Gräf. Rath hatte es befürchtet.
»War nur kurz am Bahnhof.«
»Kurz? Verdammt, ich versuch schon seit einer Ewigkeit, dich zu erreichen …«
»Was ist denn los?«
»Männliche Leiche. Haus Vaterland, Potsdamer Platz.«
»Scheiße.«
»Ja, Scheiße! Mensch, beeil dich, bevor neben allen anderen Beteiligten auch noch Böhm spitzkriegt, dass der diensthabende Kommissar auf sich warten lässt!«
Rath legte auf und zog die Krawatte fest. Er musste Charly nichts erklären, sie war schon dabei, ihre Bluse wieder zuzuknöpfen.
3
Das Haus Vaterland lag am Potsdamer Platz wie ein gestrandeter Vergnügungsdampfer, und etwas in der Art war es auch. Mit Patriotismus hatte das Haus nichts am Hut, es ging einzig und allein darum, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, und zwar möglichst viel davon. Hinter der Fassade warteten rund ein Dutzend verschiedenartigster Lokale auf Kundschaft: ein bayrisches Brauhaus, eine spanische Bodega, eine Wildwestbar, ein türkisches Café und vieles mehr, alles mit passender Inneneinrichtung, passender Speisekarte und passendem Unterhaltungsprogramm. Gaffer, die nur mal kurz gucken und staunen wollten, waren nicht willkommen, wer hineinwollte, musste am Eingang einen Verzehrgutschein lösen.
In seinen ersten Berliner Tagen hatte Rath in der Rheinterrasse so etwas wie Heimat zu finden versucht, dann aber festgestellt, dass es hier nur viel zu süßen Wein gab und kitschige Rheinromantik. Zu Berlins viel beschworenem Weltstadtflair, an das vor allem die Berliner selbst glaubten und die Touristen aus der Provinz, die voller Staunen auf die glitzernde Stadt schauten, hatte das Etablissement jedenfalls nicht viel beizusteuern, da hatten die mondänen Bars im Westen wie Femina oder Kakadu eindeutig mehr zu bieten, jedenfalls für Raths Geschmack. Das Vaterland beeindruckte mit seiner schieren Größe und mit den Neonröhren, deren Lichteffekte den nächtlichen Potsdamer Platz beherrschten.
Um diese Uhrzeit allerdings war der gestrandete Vergnügungsdampfer so dunkel und so tot wie ein Geisterschiff. Nur die Autos vor dem Lieferanteneingang, allen voran das Mordauto, zeigten, dass irgendetwas passiert sein musste. Rath parkte seinen Buick hinter dem Opel vom Erkennungsdienst und blieb noch einen Moment im Wagen sitzen. Er zog an seiner Overstolz und blies den Rauch gegen die Windschutzscheibe. Noch nie hatte er so wenig Lust auf Arbeit verspürt, ja, einen regelrechten Widerwillen gegen seinen Beruf empfunden, wie an diesem Morgen. Einen Moment lang hatte er daran gedacht, Charly einfach mitzunehmen, doch sie hatte abgelehnt. »Was sollen die Kollegen denken, wenn wir zu zweit dort auftauchen?« Ihre Antwort hatte ihn auf eine unbestimmte Weise gekränkt, obwohl er wusste, dass sie recht hatte.
Er drückte die Zigarettenkippe in den winzigen Aschenbecher des Buick und stieg aus, entschlossen, die Sache hier so schnell wie möglich hinter sich zu bringen und in die Carmerstraße zurückzukehren, zu Charly, in deren Obhut er Kirie gelassen hatte.
Doktor Karthaus, der auch außerhalb des Seziersaales stets seinen weißen Arztkittel trug, stand vor dem Eingang, in der Hand eine Zigarette, und unterhielt sich mit einem Schupo. Der Blaue salutierte, als Rath herantrat, der Gerichtsmediziner deutete lediglich ein Kopfnicken an.
»Morgen, Doktor.«
»Herr Kommissar! Schön, dass Sie uns auch noch beehren. Ich rauche mir hier vor Langeweile schon die Lunge schwarz. Was war denn los? Autopanne? Sollten sich besser einen deutschen Wagen zulegen.«
Rath ignorierte die Anspielung. »Was für eine Leiche haben wir denn hier?«, fragte er.
Karthaus lächelte sanft. »Das ist das Schöne an der Kriminalpolizei – dass man alles dreimal erzählen darf. Kommen Sie mit, dann zeig ich’s Ihnen. Liegt noch oben. Die Bestatter warten schon sehnsüchtig darauf, sie endlich abtransportieren zu können.«
»Oben?«
Karthaus schnippte seine Zigarette in eine Pfütze. »Wenn der Herr Kommissar bitte folgen wollen.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte sich der Gerichtsmediziner um und ging ins Gebäude. Rath folgte dem weißen Kittel in einen großen, schmucklosen Raum, von dem zwei Lastenaufzüge und ein Treppenhaus abgingen. Schien die Warenannahme von Haus Vaterland zu sein. Karthaus nahm die Treppe. Es ging in den vierten Stock, wo zwei Schupos und zwei schwarz gekleidete Männer vor den Aufzügen warteten. Auf dem Boden stand ein Zinksarg.
»Können wir jetzt?«, fragte einer der Schwarzen, als er den Doktor sah.
»Gleich. Der Herr Kommissar nimmt die Leiche noch eben in Augenschein.« Karthaus lächelte säuerlich und zeigte auf eine Aufzugkabine, die einen guten Meter zu tief im Schacht hing. Zwei Spurensicherer waren damit beschäftigt, Fingerabdrücke sicherzustellen, von den Aufzugknöpfen und von einem Gitterwagen, der in der Kabine stand und in voller Höhe mit Spirituosenkisten beladen war.
»Irgendein dämlicher Unfall, oder was?«, fragte Rath und zündete sich eine Zigarette an. Er verspürte schon jetzt wenig Lust, diesem läppischen Mist hier nachzugehen. Hätte Gräf das nicht auch alleine regeln können?
»Unfall?« Karthaus schaute skeptisch. »Ich fürchte nicht.«
Rath stieg in die Kabine hinunter, die Zigarette zwischen den Lippen, der Gerichtsmediziner folgte ihm.
Der Tote lag auf dem Boden und trug einen grauen Arbeitskittel. Seine weit aufgerissenen Augen, die noch niemand geschlossen hatte, waren weit aus den Höhlen getreten und stierten ins Leere, als hätten sie sämtliche Schrecken der ewigen Verdammnis gesehen; und einen kurzen Moment war Rath von der Vorstellung gefangen genommen, der Lastenaufzug des Hauses Vaterland führe tatsächlich geradewegs immer weiter nach unten bis in die Hölle. Unwillkürlich folgte Rath den toten Augen und schaute nach oben, sah aber nur vergilbtes Sperrholz.
»Wie ist er denn gestorben, wenn’s kein Unfall war?«
Der Doktor räusperte sich. »Ich weiß, es hört sich ungewöhnlich an, doch ich bin mir sicher, dass die Obduktion meine Einschätzung bestätigen wird …«
»Obduktion?«
»Ihr Kollege hat bereits mit dem Staatsanwalt telefoniert. Auf meine Empfehlung hin, natürlich.«
»Wo sind sie überhaupt, die Kollegen?«
»Zeugenvernehmungen, soweit ich weiß. Also«, sagte Karthaus ungeduldig, »dieser Mann ist, wenn mich nicht alles täuscht, ertrunken.«
Die Spurensicherer schienen Karthaus’ Befund zu kennen, jedenfalls arbeiteten sie mit stoischer Miene weiter.
»Ertrunken?«, fragte Rath. »Ertrinkt man normalerweise nicht im Wasser?«
»Vielleicht wurde die Leiche hier nur abgelegt.«
»Sieht nicht so aus«, mischte sich einer der Spurensicherer ein. »Haben sogar Fußspuren von ihm gefunden. Deutet alles darauf hin, dass er selbst in diesen Aufzug gestiegen ist.«
Der andere Mann schwieg und sicherte in aller Seelenruhe einen Fingerabdruck auf dem Stahlrohr des Gitterwagens.
»Außerdem«, fuhr sein Kollege fort, »ist er mit dem eigenen Lieferwagen angereist. Also, wennse mich fragen: Den hat niemand hier abgelegt.«
Rath schaute Doktor Karthaus an, doch der zuckte nur mit den Achseln. »Nach der Obduktion wissen wir mehr«, sagte er.
»Wo ist der Kollege Gräf, sagten Sie?«
»Vernehmungen. In irgendeinem Büro. Fragen Sie die Schupos«, sagte Karthaus und kletterte aus der Kabine.
Rath drückte seine Zigarette draußen auf dem Fußboden aus, ungefähr in Brusthöhe, und folgte dem Gerichtsmediziner, der es eilig hatte, sich zu verabschieden. Die Bestatter sahen das als Aufforderung, sich endlich an die Arbeit zu machen, und hievten ihren Zinksarg zum Aufzug. Ein Blauer erbot sich, den Herrn Kommissar zu seinen Kollegen zu bringen. Während Rath dem Uniformierten nach unten folgte, durch einen dunklen Lagerraum und das gespensterhaft leere Löwenbräu, in dem noch die Bierdünste des Vorabends in der Luft standen, überkam ihn wieder dieses Gefühl, am falschen Ort zu sein.
Der Schupo öffnete eine große Tür, und plötzlich standen sie in der imposanten Mittelhalle. Von hier gelangte man über eine Vielzahl von Treppen, Galerien, Aufzügen und Türen zu all den unterschiedlichen Lokalen und Attraktionen, die Haus Vaterland auf vier Etagen für seine Gäste bereithielt. Rath hatte die Halle als einen Ort geschäftigen Rummels in Erinnerung, überall Menschen, auf dem Weg von einem Restaurant ins nächste, jetzt aber wirkte sie, gerade wegen ihrer Größe, gespenstisch leer. Nur rund zwei Dutzend Menschen warteten auf den Treppenstufen, ein paar in Küchenschürzen, andere in Kellnerkleidung oder Straßenanzügen, ein paar im Blaumann. Vier, fünf Schupos standen in der Gegend herum wie Hunde, die eine Schafherde bewachten. Und wie der Schäfer stand Kriminalassistent Andreas Lange mit zwei Uniformierten an der Treppe, auf der sich die Angestellten niedergelassen hatten. Als er Rath entdeckte, ließ er die Schupos stehen.
»Morgen, Herr Kommissar. Schön, dass Sie hier sind.«
»Morgen, Lange. Was für ein Menschenauflauf!«
»Alles Zeugen. Hat Kollege Gräf zusammentrommeln lassen.«
»Und die haben alle was gesehen?«
Lange zuckte die Achseln. »Wissen wir noch nicht. Das sind alle Mitarbeiter, die zum mutmaßlichen Todeszeitpunkt schon hier im Haus waren. Oder noch.«
»Alle?«
Rath schaute sich die Wartenden an. Wenn Gräf wirklich vorhatte, die alle zu befragen, dann säßen sie noch Stunden hier. »Da können wir ja froh sein, dass die Sache nicht gestern Abend passiert ist, als hier Hochbetrieb herrschte. Dann säßen jetzt ein paar Tausend Leute mehr hier auf den Treppen.«
Lange schwieg. Rath musste an Charly denken, die in der Carmerstraße wartete, und bekam immer schlechtere Laune. »Schon irgendwelche Erkenntnisse?«, fragte er.
»Wie man’s nimmt. Wir haben einen Toten, wir haben eine ungewöhnliche Todesart. Und sonst nicht den blassesten Schimmer, was dem armen Kerl passiert ist.«
»Ertrunken. Glauben Sie das wirklich?«
Lange zuckte die Achseln. »Wenn der Experte das sagt.«
»Ist der Tote denn schon identifiziert?«
Lange zog ein Dokument aus der Tasche. »Hat die Spurensicherung in seinem Kittel gefunden.«
Herbert Lamkau, las Rath. Ein Führerschein, ausgestellt im Oktober 1919 im Landkreis Oletzko. Der Mann auf dem Foto blitzte aus den Augen, als habe er den Passfotografen mit seinem Blick erstechen wollen. Wahrscheinlich von Kaiser Wilhelm abgeguckt.
»Lamkau. Das steht auch draußen auf dem Lieferwagen, oder?«
Lange nickte. »Ist wohl der Inhaber.«
»Komisch, dass der Chef persönlich die Lieferung ausfährt …«
»Wer weiß, wie groß die Firma ist. Vielleicht ist er der einzige Mitarbeiter.«
»Eine Klitsche soll einen Riesenbetrieb wie das Haus Vaterland beliefern? Kann ich mir nicht vorstellen. Versuchen Sie mal herauszufinden, wie groß die Firma ist und ob Lamkau immer selbst rausgefahren ist.«
»Wird gemacht.«
»Und sagen Sie den Leuten vom ED, sie sollen sich in jedem Fall auch mal die Technik des Aufzugs anschauen. Nur, um auf Nummer sicher zu gehen.«
Lange nickte. »Wir haben schon mit dem Haustechniker gesprochen. Und mit dem Koch, der buchstäblich über die Leiche gestolpert ist …«
»Aha.«
»Der Mann hat den Aufzug hochgeholt in den vierten Stock und wäre beinahe in die Kabine gefallen, als er die Tür geöffnet hat. Hat erst im letzten Moment gesehen, dass die viel zu tief im Schacht hing, und sich gerade noch festhalten können. Tja, und dann hat er die Leiche entdeckt.«
»Und Alarm geschlagen.«
»Ja. Hat den Wachdienst informiert, und der wiederum hat uns alarmiert. Der Haustechniker hat sich den Aufzug angesehen und gesagt, damit sei eigentlich alles in Ordnung.«
»In Ordnung sah mir das nicht aus.«
Lange zuckte die Achseln. »Der Techniker geht davon aus, dass jemand irgendwo zwischen zwei Stockwerken den Notausschalter betätigt und dann nicht Bescheid gesagt hat. Dann kann es wohl vorkommen, dass die Kabine nicht mehr richtig justiert ist und nicht exakt auf Bodenniveau hält.«
»Mmm-ha …« Rath sah ein undeutliches, verschwommenes Bild durch seine Gedanken flimmern, doch bevor er Einzelheiten erkennen konnte, hatte es sich schon wieder aufgelöst. »Demnach müsste Lamkau den Notausknopf gedrückt haben, bevor er gestorben ist, oder?«, fragte er.
»Wir werden sehen. Der ED hat die Fingerabdrücke auf dem Knopf gesichert.«
Rath zeigte zu der Bürotür. »Und wer sitzt gerade beim Kollegen Gräf drin?«
»Der Wachmann. Nach dem Koch der Zweite, der die Leiche gesehen hat.«
»Gut, dann lass ich mich da mal blicken.«
Rath klopfte und trat ein, noch bevor jemand »Ja, bitte« sagen konnte. Das Büro war überraschend klein und dunkel, verglichen mit der gleißenden Helligkeit der riesigen Halle; einzige Lichtquelle war eine Schreibtischlampe mit grünem Schirm. Reinhold Gräf wirkte erleichtert, als er seinen Chef erblickte. An der Wand hinter dem Direktionsschreibtisch, an dem der Kriminalsekretär saß, hingen unzählige Künstlerfotos: Musiker, Zauberer, Sänger, Tänzerinnen. An einem kleinen Besuchertisch saß Christel Temme mit ihrem Block und registrierte das Eintreffen des Kommissars genauso gleichmütig wie alles andere. Die Temme war berüchtigt dafür, selbst bei der Vernehmung des abgebrühtesten Mörders keine Miene zu verziehen. Sie schrieb alles, was gesagt wurde, ungerührt mit, ganz gleich, wie ungeheuerlich es sein mochte. Oder wie unwichtig.
Auf dem Stuhl zwischen den Schreibtischen saß allerdings kein abgebrühter Mörder, sondern ein hagerer Mann in der Uniform der Berliner Wach- und Schließgesellschaft, der Anfang vierzig sein mochte und seine Mütze in der Hand knetete. Gräf stand von seinem Stuhl auf.
»Der Herr Kommissar«, sagte er. Halb war es eine Begrüßung, halb eine Erklärung für den Wachmann. Der Kriminalsekretär blieb neben seinem Stuhl stehen, als wolle er seinem Vorgesetzten Platz machen.
Der Wachmann stand ansatzweise auf und deutete ein Kopfnicken an, Rath beschied ihm mit einer Handbewegung, sich wieder zu setzen.
»Herr Janke arbeitet als Wachmann hier im Hause«, erläuterte Gräf überflüssigerweise.
Rath nickte und setzte sich auf die Schreibtischkante. »Fahren Sie doch bitte fort«, sagte er und zündete sich eine Zigarette an.
Gräf blieb stehen, obwohl Rath den Stuhl gar nicht beanspruchte. So schauten die beiden Kriminalbeamten auf den Wachmann hinab, dessen Blick zwischen Rath und Gräf hin- und herwanderte.
»Also …«, begann der Mann, und sofort hörte man den Stenostift wieder übers Papier kratzen, »ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren …«
»Sie wollten mir gerade sagen, woran Sie erkannt haben, dass der Mann im Aufzug tot war, Herr Janke«, half Gräf, der sich wieder hinsetzte, als er merkte, dass Rath keinerlei Anstalten machte, die Befragung zu übernehmen.
»Richtig.« Janke nickte. »Also, das war so, ich bin runter in die Kabine …«
»Mussten Sie die Tür öffnen?«, fragte Gräf.
»Wie?«
»Die Tür des Aufzugs.«
»Die war doch offen. Hatte Unger schon geöffnet.«
»Der Koch, der die Leiche gefunden hat.«
»Genau.« Der Wachmann schielte von einem Polizisten zum anderen, als wittere er eine Fangfrage. Als niemand etwas sagte, fuhr er fort. »Also, ich bin dann rein in die Kabine. Wie der da lag mit seinen starren Augen – ich hab mir gleich gedacht, der lebt nicht mehr. Aber ich hab erst mal seine Halsschlagader gefühlt.«
»Wieso die Halsschlagader?«, fragte Gräf.
»Das … das haben wir so gelernt … auf unserem Lehrgang. Wach- und Schließgesellschaft.«
Gräf nickte und machte eine Notiz. Rath saß auf der Schreibtischkante, zog an seiner Zigarette und ertappte sich dabei, wie er auf die Uhr schaute. Alles hier ging ihm auf den Wecker, die Umständlichkeit dieses Wachmanns, Gräfs Nachfragen selbst bei unwichtigen Details, die ganze unerträgliche Langsamkeit dieser Vernehmung.