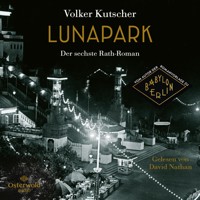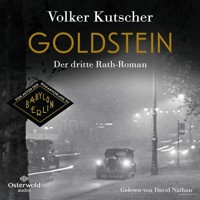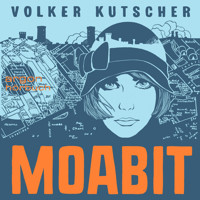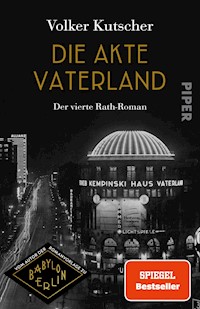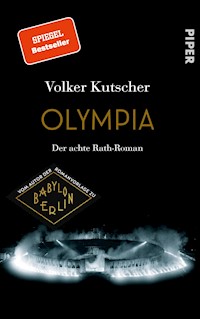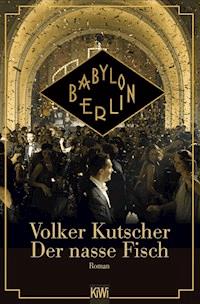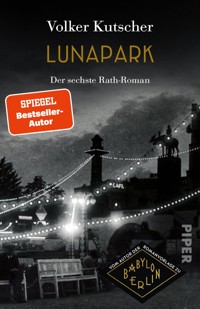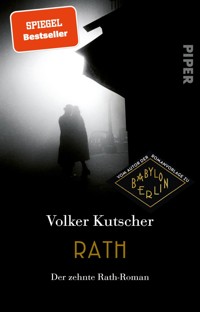
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Familie Rath steuert auf ein dramatisches Ende zu: Gereon hat nach der Rückkehr aus den USA ein Versteck in Rhöndorf bei Bonn bezogen und schlägt sich nach Berlin durch, um Charly beizustehen. Sie muss Hannah Singer aus den Wittenauer Heilstätten befreien und Fritze verteidigen, der unter Mordverdacht gerät. Der Judenhass wächst und mit der Reichspogromnacht kulminiert eine Entwicklung, die Charly vorhergesehen und Gereon lange geleugnet hat. Damit ist beiden klar: Ein Leben in Deutschland ist so nicht mehr möglich, Widerstand ist geboten. Haben sie eine gemeinsame Zukunft und wo würde die liegen? Mit gewohnt hoher Spannung, historischer Tiefenschärfe und psychologischer Figurenzeichnung bringt Volker Kutscher seine Erfolgsserie zu einem offenen Abschluss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 919
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum ePUB
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher :www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung : zero-media.net, München
Coverabbildung : picture alliance | Fred Stein
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E‑Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
PROLOG
–
Teil Eins
Charlotte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Teil Zwei
Gereon
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Teil Drei
Severin
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
EPILOG
–
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Zitat
So it goes.
Kurt Vonnegut, Slaughterhouse Five or The Children’s Crusade
PROLOG
Berlin,Freitag, 16. September 1938
–
Baumwipfel. Baumwipfel vor stählern graublauem Himmel. Sie ziehen vorüber, einer nach dem anderen, in eintönig gleichförmigem Rhythmus. Hannah kann sie sehen, wenn sie den Kopf ein wenig nach rechts dreht, hinter dem Wagenfenster huschen sie vorüber. Dann fühlt sie sich für einen winzigen Augenblick frei, obwohl sie weiß, dass sie das nicht ist; ihr Kopf ist der einzige Körperteil, den sie überhaupt noch bewegen kann, alles andere hat Wärter Scholtens so fest an die Trage geschnallt, dass es nicht einmal verrutscht, wenn der Fahrer mal wieder eine Kurve etwas rasanter nimmt. Dann spürt sie nur die Gurte, die ihr umso tiefer ins Fleisch schneiden.
Sie ist draußen, sie ist tatsächlich draußen. Sie hätte nicht gedacht, die Mauern der Wittenauer Heilstätten jemals wieder verlassen zu können, jedenfalls nicht lebendig. Vor dem Fenster und dem Himmel und den Bäumen wackelt das Gesicht des dicken Sanitäters im Rhythmus des Straßenpflasters. Sie haben ihr nicht gesagt, wo es hingeht, das sagen sie einem nie, aber das mussten sie auch nicht. Sie fahren ins Humboldtkrankenhaus, da werden die Bekloppten aus Dalldorf immer hingebracht, egal ob sie krank sind oder sonstwas ansteht.
Sie weiß das, weil sie das alle wissen und weil sie schon einmal dort war. Es war der fünfte Mai, sie kann sich genau an das Datum erinnern, schließlich ist es der Geburtstag ihres Sohnes. Monatelang hatte Hannah ihre Schwangerschaft geheimhalten können, so lang, dass sie ihr das Kind nicht mehr wegmachen konnten. Denn das ist es, was sie normalerweise tun.
Wegmachen.
Weggenommen haben sie ihr den Jungen trotzdem, kaum hatte sie ihn aus sich herausgepresst. Sie hatte ihn noch schreien hören, den ganzen Kreißsaal hatte er zusammengebrüllt, ihr starker Junge, da hatten sie ihn auch schon fortgebracht. Der Schmerz, den sie in jenem Moment empfunden hat und der schlimmer war als sämtliche Geburtsschmerzen, sitzt tief in ihrer Seele, auch jetzt, wo die Geburtsschmerzen längst vergessen sind. Es ist der einzige Schmerz, der überhaupt noch zu ihr dringen kann, alles andere perlt ab an dem Panzer, den sie sich zugelegt hat.
Fest mit diesem Schmerz verbunden ist eine Art Triumphgefühl, das ihr Trost gibt und Halt: Ein Teil von ihr ist draußen, außerhalb dieser Anstalt, in der sie selbst den Rest ihres Lebens verbringen soll. Aber er muss das nicht, er ist draußen. Friedrich. So hat sie ihren Sohn getauft, ohne zu wissen, mit welchem Namen sie ihn rufen werden. Es ist auch gleich, wie sie ihn nennen, für Hannah wird ihr Sohn immer Friedrich heißen. Wie sein Vater.
Dass sie selbst jemals wieder freikommen kann, diesen Gedanken hatte sie aufgegeben. Die Hoffnung wurde mit jedem Tag, den sie wieder in Dalldorf verbrachte, kleiner und kleiner. Sie ist schon zu oft ausgebrochen. Das erste Mal, vor vielen Jahren, war es noch einfach. Nachdem Fritze sie aber mit Waffengewalt befreien wollte, wird sie strenger bewacht denn je zuvor.
Fritze. Weiß der Henker, was aus dem geworden ist, wahrscheinlich sitzt er im Knast. Sie weiß überhaupt nichts, sie lassen niemanden zu ihr, seit einem Jahr hat sie keinen normalen Menschen mehr gesehen, nur die Bekloppten und die Wärter von Dalldorf.
Irrenanstalt ist schlimmer als Knast, das steht fest, das weiß sie, denn sie kennt beides. Die meiste Zeit verbringt sie angeschnallt und bewegungslos im Bett, auch tagsüber, und wenn sie sich mal die Beine vertreten darf oder auf die Toilette geht, wird sie von mindestens zwei kräftigen Wärtern begleitet. Nicht von Scholtens, der ist dafür zu feige, der nähert sich ihr immer nur dann, wenn sie wehrlos ist. Mitten in der Nacht, wenn keiner zuguckt und sie sich hilflos unter den Ledergurten windet.
Hannah ist sicher, dass der Mistkerl sich deswegen auch für Friedrichs Vater hält. Was er aber nicht ist. Sie weiß genau, wie es passiert ist und wann. Die letzte Nacht, die sie mit Fritze zusammen in Freiheit verbracht hat, bevor dieser Cliquenhäuptling sie an die Bullen verpfiffen hat.
Das weiß aber Wärter Scholtens nicht. Und deswegen glaubt Hannah, dass er hinter ihrer Einlieferung steckt. Dass er bei der Anstaltsleitung vorgesprochen und alles in die Wege geleitet hat. Wer auch sonst?
Jedenfalls hat sie sofort verstanden, was es bedeutet, als Oberschwester Ingeborg ihr das ausgefüllte Formular gezeigt hat, ein Antrag auf Unfruchtbarmachung nach den Paragraphen 1 bis 3 des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, ausgestellt von Direktor Waetzoldt und genehmigt vom Erbgesundheitsgericht Wedding. Der Stempel war erst einen Tag alt. Ganz oben stand, eingetragen mit Schreibmaschine, der Name Hannah Singer und direkt darunter die Begründung: Die Genannte leidet an paranoider Schizophrenie.
Mit Hannahs Tobsuchtsanfall, der diese Diagnose zu bestätigen schien, hatte Oberschwester Ingeborg gerechnet; die zwei Wärter an ihrer Seite waren die stärksten, die Wittenau aufzubieten hat. Sie haben nicht lange gebraucht, um Hannah zu fixieren. Dann haben sie ihr eine Spritze in die Venen gedrückt, und irgendwann hat sie aufgehört zu schreien und an den Gurten zu zerren. Kurz darauf ist der Krankenwagen vorgefahren, und sie haben sie zu fünft auf die Krankentrage umgebettet, unter tätiger Mithilfe von Wärter Scholtens, der die Gurte so festgezogen hat, dass sie Hannah unerbittlich ins Fleisch schneiden.
»Die Singer ist gefährlich, passt gut auf«, hat Scholtens den Sanitätern noch mit auf den Weg gegeben, als die sie mitsamt Trage in den Krankenwagen schoben.
Doch die Sanis scheinen unbeeindruckt. Der Dicke hinten im Wagen, der auf sie aufpassen soll, würdigt sie keines Blickes, für den ist das alles Routine.
Für sie nicht.
Hannah Singer, der verrückten Tochter des verstorbenen Kriegskrüppels Heinz Singer, soll es verwehrt werden, weitere Kinder in die Welt zu setzen.
Das einzig Gute an der Sache: Dazu muss die Verrückte erst einmal aus der Anstalt hinausgebracht werden. Hannahs vielleicht letzte Chance, doch noch freizukommen. Das Krankenhaus ist nicht die Irrenanstalt, so gesehen ist sie also schon draußen, der erste Schritt ist getan. Und früher oder später werden sie ihr für den Eingriff die Gurte lösen müssen.
Der Krankenwagen verlangsamt seine Fahrt und nimmt die letzte Kurve. Keine Bäume mehr hinter dem Fenster, stattdessen eine braun verputzte Fassade. Der Wagen bremst. Kurz darauf öffnet sich die Hecktür, und es wird heller. Der Dicke öffnet die Tür und springt hinaus.
»War sie ruhig?«
Die Stimme des Fahrers.
»Hat keine Probleme gemacht«, sagt der Dicke. »Die haben mal wieder maßlos übertrieben. So ein zartes Mädel. Und in der Klapse reden sie von ihr, als sei sie ein wildes Raubtier.«
Der Geruch einer Zigarette steigt in Hannahs Nase. Dann hört sie eine fremde Stimme.
»Was ist denn hier los? Rauchen können Sie in Ihrer Pause, Sobotka, aber nicht in Gegenwart einer Patientin!«
»Tschuldigung, Doktor, aber das ist nur eine aus Dalldorf.«
»Und? Sind das etwa keine Patienten?«
»Natürlich.«
»Nun holen Sie die Dame doch erst einmal aus dem Wagen. Und machen Sie die Zigarette aus. Können Sie gleich weiterrauchen.«
Die Trage bewegt sich, Hannah wird aus dem Krankenwagen gezogen. Erblickt drei weißgekleidete Männer, die beiden, die sie hergebracht haben, und einen älteren, der sich über sie beugt. Er macht ein freundliches Gesicht.
»Guten Morgen«, sagt er. »Ich bin Doktor Eck. Sie sind hier im Erwin-Liek-Krankenhaus. Sie müssen keine Angst haben, wir kümmern uns um Sie.«
Hannah schweigt. Seit sie in Dalldorf einsitzt, hat sie kein Wort mehr gesprochen. Mit niemandem. Wenn sie überhaupt einmal den Mund aufmacht, dann schreit sie, schreit wie am Spieß, bis allen die Trommelfelle zu platzen drohen. Das ist das Schöne daran, bekloppt zu sein: Man kann sich alles erlauben.
Der Fahrer löscht seine Zigarette mit etwas Spucke zwischen Zeigefinger und Daumen. Dann übergibt er dem Weißkittel einen Stapel Papiere.
»Ovarektomie angeordnet«, sagt er.
Der Arzt zieht die Stirn in Falten und blättert durch die Papiere. »Ist die Patientin denn über das Wesen und die Folgen des Eingriffs aufgeklärt worden?«, fragt er und schaut dabei Hannah an. Hannah schweigt.
»Haben die in der Anstalt gemacht«, sagt der Fahrer. »Was soll man da auch groß aufklären? Die ist verrückt. Kann nicht mal sprechen. Nur Kreischen und Schreien. Dass so etwas keine Kinder kriegen sollte, versteht sich doch von selbst.«
Der Doktor will gerade etwas antworten, da nähert sich ein anderer Weißkittel von hinten und reißt ihm die Papiere aus der Hand.
»Schon gut, Kollege Eck, lassen Sie mal, ich übernehme die Patientin. Direktor Waetzoldt hat sie mir bereits telefonisch angekündigt.«
»Haben Sie denn Kapazitäten, Doktor Bischoff?«
»Natürlich. Kann den Eingriff gleich vornehmen. Alles so weit vorbereitet.«
»So schnell? Eine Ovarektomie ist doch keine Notoperation.«
»Sie sollte so schnell wie möglich wieder zurück in die Anstalt. Wie mir Waetzoldt sagt, ist die Patientin höchst gefährlich.«
»Auf mich macht sie eher einen verängstigten Eindruck.«
»Das ist ja das Tückische an Verfolgungswahn. Da gehen Angst und Aggressivität nahtlos ineinander über.«
Der andere guckt skeptisch.
»Sie scheinen ja gut im Bilde zu sein.«
»Wie gesagt, habe mit Direktor Waetzoldt telefoniert.«
Der andere reicht seinem Kollegen die Papiere und verschwindet im Inneren des Krankenhauses.
So schnell wie möglich wieder zurück.
Sie darf keine Zeit vertrödeln, sie muss handeln.
Bevor Hannah weiter darüber nachdenken kann, wird sie mitsamt der Trage und den Gurten auf ein Rollgestell verfrachtet, das am Eingang wartet. Doktor Bischoff gibt ihr eine Spritze, die er aus seinem Arztkittel holt. Zur Beruhigung, wie er sagt, nicht zu ihr, sondern zu den Sanitätern, doch sie wird nicht ruhig, ganz im Gegenteil.
Durch ein großes Tor geht es ins Innere des Krankenhauses. Endlose Flure. Das Geräusch der Rollen, von denen eine in regelmäßigen Abständen kurz und hektisch quietscht, hallt von den Wänden wider. Hannah sieht neonhelle Deckenleuchten an sich vorbeihuschen, in endloser Reihe, und fühlt sich so hilf- und wehrlos wie selten in ihrem Leben. Ihre Augen schielen nach rechts und links. Überall Geschäftigkeit, Menschen in Weiß, die dem vorüberhastenden Krankenbett keinerlei Aufmerksamkeit schenken. Sowas erleben die hier täglich. Dass es eilig ist.
Das Gesicht des Arztes, der sie übernommen hat und ihr nun folgt, kann Hannah über dem weißen Kittel kaum sehen, nur ein energisches Kinn und eine zu groß geratene Nase. Bischoff, den Namen merkt sie sich. Der Mann würdigt sie keines Blickes, guckt stur geradeaus. Als interessiere ihn gar nicht, welche Patientin er da gerade vor sich herschieben lässt, um ihr den Unterleib aufzuschneiden. Und dort alles kaputtzumachen.
Eine große Schwingtür fliegt auf. Das wird der Operationssaal sein. Hannahs Herz schlägt schneller. Sie beobachtet ihre Umgebung wie im Fieber, ihre Gedanken fliegen.
»Alles für Ovarektomie vorbereitet?«
Die Stimme des Arztes. Krankenschwestern huschen umher. Wasser rauscht aus Wasserhähnen, Metall klimpert, es riecht nach Desinfektionsmitteln.
Hannah liegt ruhig da. Scheinbar schläfrig. Aber sie ist hellwach. Lauert auf den richtigen Moment. Doch der kommt nicht.
Sie messen ihr den Blutdruck, fühlen den Puls. Als seien sie wirklich besorgt um sie, als sei sie eine richtige Patientin. Angeschnallt aber ist sie immer noch. Nur die Handgelenke haben sie von den Ledergurten befreit. Sie lässt alles über sich ergehen, sträubt sich nicht.
Wieder greift jemand nach ihrem Unterarm, wieder spürt sie den Stich einer Nadel.
Und dann wird sie tatsächlich ruhiger. Eine alte Bekannte meldet sich zurück, nach langer Zeit, und Hannah schließt die Augen und lächelt. Schwester M ist wieder da, ihre einzige Verbündete in jenen Jahren, da sie mit ihrem kriegsverkrüppelten Vater auf der Weidendammer Brücke betteln musste. Das ganze Geld ist für das Morphium draufgegangen, das der Alte gegen seine Schmerzen brauchte und gegen sein verpfuschtes Leben, und ab und an konnte Hannah davon etwas abzweigen, ohne dass er es merkte. Damals begann ihre Freundschaft zu Schwester M, das geliebte Morphium, das sie auch in jener Silvesternacht begleitete, als sie das Krähennest abfackelte, diese Bretterbude, in der ihr Vater mit der üblen Bettlerbande, bei der sie untergekommen waren, seinen Rausch ausschlief. Die Nacht, die sie nach Wittenau gebracht hat. Acht tote Dreckschweine, vom Krieg entstellte Körper, vom Krieg entstellte Seelen, die der Welt und vor allem Hannah all die Qualen zurückgeben wollten, die sie selbst hatten erleiden müssen.
»Ist alles so weit?«
Wieder die Stimme des Arztes. Irgendwoher ein unverständliches Murmeln.
»Gut. Dann sollten wir gleich beginnen. Chloräthylen zur Einleitung der Dauernarkose, dann Äther. Analgetikum intravenös zugeben. Die Patientin ist eine gefährliche Verrückte und sollte so lange fixiert bleiben, bis die Narkose eingesetzt hat.«
Narkose. Hannah erschrickt, obwohl Schwester M sie bereits in den Arm genommen hat. Wie eilig die es haben! Sie wird hier nicht rechtzeitig rauskommen, nicht, bevor sie ihr unten alles kaputtgemacht haben.
Aber ihre Chance ist immer noch da, und diesmal wird sie die nutzen. Damals nach der Geburt war sie zu schwach. War vor allem zu sehr mit der Suche nach ihrem Kind beschäftigt, das sie ihr weggenommen hatten. Konnte ihren Sohn nirgends finden, war völlig verzweifelt, hatte irgendwann Tränen in den Augen.
Und dann war es zu spät, dann hatten sie die herumirrende Patientin wieder eingesammelt und an ein Bett geschnallt und nach Dalldorf verfrachtet.
Das wird ihr diesmal nicht passieren. Diesmal nicht. Sie fasst einen Plan, und Schwester M hilft ihr dabei: Sobald sie aus der Narkose erwacht, sich eine Weile noch schlafend stellen. Auf einen günstigen Moment lauern. Und dann sofort raus. Diesmal zielstrebig. Sich durch nichts aufhalten lassen.
Hannah lächelt. Schwester M. ist ihre Freundin. Sie genießt ein lange vermisstes Glücksgefühl.
Plötzlich riecht es muffig süßlich, Hannah öffnet die Augen. Über ihr ein Pferdegesicht. Der Arzt. Doktor Bischoff. Lächelt er? Oder ist das Hass in seinen Augen? Lächelnder Hass.
Seine Stimme klingt ruhig und warm.
»Ganz normal einatmen.«
Eine lederne Atemmaske drückt auf Mund und Nase.
Hannah atmet nicht. Sie kann nicht, sie starrt den Doktor an und muss daran denken, was mit ihr geschehen soll. Bischoff, sie darf den Namen nicht vergessen.
»Atme!«
Die Stimme des Arztes klingt jetzt strenger.
Doch Hannah atmet nicht. Deine Chance, denkt sie nur. Sobald du wieder wach wirst, haust du ab. Du haust ab, du haust ab, du haust ab.
»Zähl einfach bis zehn. Und atme.«
Hannah zählt nicht. Aber die Verspannung löst sich, und sie atmet ein. Egal, was sie mit dir machen, denkt sie, Hauptsache, du kommst frei! Dann schließt sie die Augen, um nicht in dieses Gesicht schauen zu müssen, in das Gesicht dieses Mannes, der sie verstümmeln will.
Sie schließt die Augen und überlässt sich Schwester M, die sie an die Hand genommen hat. Hannah lässt sich führen und findet sich in Breslau wieder, in der Abendsonne. Spürt die Wärme der letzten Sonnenstrahlen auf ihrer Haut.
Sie hat Piefke an der Leine und spaziert mit dem Hund durch den Volkspark unten an den Hollandwiesen. Die Stunden nach Geschäftsschluss. Breslau, allein mit dem Hund, das waren ihre schönsten Jahre. So wird sie es wieder halten, sich einen Hund anschaffen und von allen Menschen fernhalten. Der einzige Mensch, um den sie sich jemals kümmern wird, ist ihr Sohn. Sie wird ihn finden und zu sich holen, und dann wird alles gut. Alles wieder gut. So wie in Breslau. Hannah spaziert mit Piefke hinunter zum Ufer der Ohle. Die Sonne schickt ihre letzten Strahlen durch das Geäst der Uferbäume, und Piefke schaut sie mit derart schiefem Kopf und treuen Augen an, dass ihr ganz warm ums Herz wird.
Das ist das Letzte, was sie sieht, dann wird alles dunkel.
Und still.
Und kalt.
Teil Eins
Charlotte
September 1938
Die durchschnittlichen Baukosten einer Kleinwohnung betragen 5000 bis 7000RM. 1934 wurden rund 284000 Wohnungen gebaut. Der Bau einer Irrenanstalt kostet etwa 6 Mill. RM. Wieviele Familien könnten dafür eine Wohnung erhalten?
O. Bewersdorff, H. Sturhann, Rechenbuch für Knaben- und Mädchen-Mittelschulen, Heft 1, Leipzig/Berlin 1936
1
Sie schlief noch, er hörte ihr gleichmäßiges Atmen und sah, wie sich die Bettdecke kaum merklich hob und wieder senkte. Draußen wurde es schon hell, die Morgensonne malte kleine Streifen auf die grüngoldene Tapete über dem Waschtisch, und von der Straße drangen die ersten Geräusche des Tages hinauf in ihr kleines Zimmer. Er richtete sich auf, stützte seinen Kopf auf den Unterarm und betrachtete ihr Profil, diese elegante Linie, die Lippen, Nase und Stirn bildeten und von der er am liebsten einen Scherenschnitt hätte anfertigen lassen. Hatte er aber nicht, er hatte ja nicht einmal ein Foto von ihr. Durfte es nicht haben.
Deswegen nahm er sich nun Zeit und betrachtete die feinen Härchen auf ihrer Haut, die in der Sonne leuchteten. Er konnte sich nicht helfen, er war völlig überwältigt von diesem Moment, von ihrem Anblick, vom Duft ihrer Haut. Das ganze Bett war davon erfüllt, und er überlegte ernsthaft, ob er die Bettwäsche nicht aus dem Hotel schmuggeln sollte, um sich diesen Duft so lang wie möglich zu bewahren.
So war das immer. Im Banne ihres Körpergeruchs, der auf ihn wirkte wie eine Droge, konnte Gereon Rath sich keine andere Frau auf dieser Erde vorstellen, mit der er jemals zusammen sein wollte. Konnte sich überhaupt nicht vorstellen, jemals ohne Charly zu sein. War er aber zu lange Zeit ohne sie, wurde die Erinnerung an sie immer unwirklicher, bis sie ihm vorkam wie ein schöner Traum, dessen Fetzen mehr und mehr von einer unbarmherzigen Wirklichkeit verweht wurden.
Erst das Jahr im Untergrund, dann das Jahr in Amerika – nach all den langen Monaten hatte er irgendwann so gut wie gar nicht mehr an sie gedacht, selbst das Traumbild war verblasst, die Liebe zu ihr nur noch Erinnerung. Vielleicht wollte er das so, weil er dem Schmerz keine Nahrung hatte geben wollen. Weil er nicht damit gerechnet hatte, so bald wieder nach Deutschland zurückzukehren, ja überhaupt jemals zurückzukehren.
Wie man sich irren konnte.
Sie bewegte sich, streckte ihre Arme in den Morgen und gähnte, blinzelte gegen das Sonnenlicht. Schreckte zurück, als sie bemerkte, dass er sie beobachtete.
Rath lächelte. »Keine Angst, ich bin’s nur«, sagte er.
Sie richtete sich auf. Das Haar hing ihr in wirren Strähnen ins Gesicht. Wie schön sie war, wenn sie so verknittert aussah. Gerade, wenn sie so verknittert aussah.
»Du bist schon wach?«, fragte sie.
»Ist ja auch schon hell.«
»Wie spät ist es denn?«
Er schaute auf die Armbanduhr, die neben ihm auf dem Nachttisch lag. »Viertel nach.«
»Viertel nach was?«
»Acht.«
Sie überlegte kurz. »Das heißt viertel neun, oder?«
Er nickte. An ihre Art, die Uhr zu lesen, würde er sich nie gewöhnen.
»Jedenfalls Zeit fürs Frühstück«, sagte er und vergrub seine Nase in ihrem Haar, küsste ihren Hals, doch sie wehrte ihn ab.
»Gereon, lass das.«
»Also bitte!« Er tat empört. »Für Sie immer noch Helmut, Frau Michalek!«
»Lass die blöden Witze.«
»Was ist denn los? Heute mit dem falschen Fuß aus dem Bett gestiegen?«
»Ich bin noch gar nicht aus dem Bett gestiegen, und genau das ist das Problem.«
Sie fummelte eine Juno aus dem Etui und steckte sie an.
»Man muss ja auch nichts überstürzen. Wir haben Sonntagmorgen.«
»Ja.« Sie zog an ihrer Zigarette und fuhr sich mit der anderen Hand durchs Haar. »Und ich habe zu tun. Böhm hat mir noch eine Observierung aufs Auge gedrückt. Ich muss den Neun-Uhr-Zug kriegen.«
»Davon hast du gestern abend gar nichts erzählt.«
»Wir haben auch nicht viel Zeit mit Erzählen verbracht.«
Das stimmte. Sein Zug aus Köln hatte Verspätung gehabt, und als er endlich im Hansahotel angekommen war, hatte Charly schon im Bett gelegen. Das Hitlerbild über dem Bett hatte sie abgenommen und auf den Boden gestellt, mit dem Gesicht zur Wand, so wie sie es immer machten, damit der Führer ihnen nicht bei Dingen zusah, die ihn nichts angingen. Rath hatte nur noch seinen Koffer in die Ecke geworfen, sie hatten keine Zeit verloren. Und danach waren sie ziemlich schnell eingeschlafen.
»Dann erzähl doch mal«, sagte er. »Wie ist es dir die letzten Wochen so ergangen?«
»Na, wie schon?« Die schmalen Schultern unter ihrem Nachthemd hoben sich leicht. »In meinem Leben passiert nicht viel. Habe zwei untreue Ehefrauen überführt und einen untreuen Buchhalter. Und heute nachmittag geht es wieder um einen Mann, den seine Frau verdächtigt, in fremden Betten zu wildern.«
»Hört sich nach nem Haufen Arbeit an.«
»Könnte mir Sinnvolleres vorstellen. Aber was will man machen?« Sie pustete Zigarettenrauch in die Luft. »Und bei dir? Wie geht’s deinem Vater?«
»Unverändert. Wenn das so weitergeht, liegt meine Mutter früher unter der Erde als der Alte. Auch vom Rollstuhl aus kann man seine Familie schikanieren. Selbst wenn einer nur noch brabbelt und man kein Wort versteht.«
»Gereon, du solltest etwas gnädiger mit ihm sein. Der Mann hatte einen Schlaganfall.«
Ja, dachte Rath. Und ich frage mich, warum er daran nicht einfach gestorben ist. Wäre es so gekommen, wie es in Ullas Brief gestanden hat, würde es uns allen besser gehen. Und wie immer, wenn er diesen Gedanken dachte, überfiel ihn das schlechte Gewissen.
»Du hast recht«, sagte er, »ich sollte gnädiger sein. Ich bin ja nicht in Köln, ich muss ihn nicht jeden Tag ertragen. Schlage mich stattdessen mit den Kohlweißlingraupen in Rhöndorf herum.«
»Mit was?«
»Mit Schädlingen. Der OB hat eine neue Erfindung gemacht, und ich darf sie ausprobieren. Behandelt mich wie einen Gärtner. Oder wie ein Faktotum.«
»Hm, das hört sich ja an, als würden wir beide unser Leben den wirklich wichtigen Dingen widmen.«
»Den wirklich wichtigen Dingen sollten wir uns hier widmen.«
Er unternahm einen zweiten Versuch, sie noch umzustimmen, und küsste ihren Nacken, die Stelle, an der sie immer schwach wurde. Er hörte ein leises Stöhnen und wähnte sich schon am Ziel, da riss sie sich abrupt los und drückte ihre Zigarette in den Aschenbecher auf dem Nachttisch.
»Tut mir leid, Gereon. So geht das nicht.«
Sie schlug die Decke zurück und stieg aus dem Bett. Er gab auf und griff zu seinen Zigaretten. Seine Erektion war ohnehin zum Teufel.
»Ich wünschte ja auch, wir hätten mehr Zeit füreinander«, sagte er.
»Und ich wünschte, wir müssten uns nicht in einem Hotel treffen wie zwei Ehebrecher. Ich fühle mich ja wie die Leute, die ich sonst immer beschatte. Dabei sind wir verheiratet. Und das sogar miteinander.«
»Aber leider bist du Witwe, meine Ärmste.«
»Es gibt viele Länder auf der Welt, wo ich das nicht länger sein müsste.«
Rath wusste, was sie meinte. Als er, nachdem Engelbert Rath sich von seinem Schlaganfall halbwegs wieder erholt hatte, kurz vor Weihnachten von Köln nach Berlin gefahren war, hatte er ihr seinen amerikanischen Pass gezeigt. Rhodes, Gerald, geboren 1901 in Asbury Park, New Jersey, die Identität, die ihm Dolly Sinatra in Hoboken verschafft hatte. Der Pass, mit dem er in die Staaten zurückkehren wollte. Mit Charly. Wenn in Deutschland alles geregelt war.
Er musste an ihr Wiedersehen denken im vorweihnachtlichen Schneetreiben in der Spenerstraße, ihre Freudentränen. Er hatte auf sie gewartet, bis sie nach Hause gekommen war, und sie noch vor der Haustür abgefangen. Hatte sie in den Arm genommen, das erste Mal seit Ewigkeiten. Hatte ihren Duft eingeatmet und mit einem Mal wieder gewusst, wie sehr sie ihm gefehlt hatte. Und dennoch hatten sie nicht zusammen Weihnachten feiern können. Nicht Silvester. Keinen Geburtstag und nichts.
Weil die Dinge nicht so gelaufen waren, wie er sich das vorgestellt hatte. Weil sie ja nie so liefen, wie er sich das vorstellte.
»Charly, wir werden auswandern, versprochen«, sagte er. »Wir werden wieder zusammenleben. Wenn es an der Zeit ist. Aber ich kann meinen Vater nicht im Stich lassen. Der Mann ist schwerkrank, er liegt im Sterben.«
»Dein Vater liegt schon fast ein Jahr im Sterben. Aber er stirbt nicht.« Sie griff zu ihren Strümpfen, die auf dem abgehängten Hitlerbild gelandet waren, und streifte sie nacheinander über. »Du hast ihn immer gehasst, er kann auch ohne dich sterben. Lass uns endlich das Land verlassen. Solange es noch geht. Es wird doch alles immer schlimmer hier. Womöglich befinden wir uns bald im Krieg mit halb Europa. Wer weiß, wohin wir dann überhaupt noch können.«
»Du verstehst das nicht. Trotz allem ist er mein Vater. Und dann sind da ja auch noch meine Mutter und Ulla. Und Severin.«
»Die werden schon damit fertig, auch ohne dich.«
»Charly, das ist meine Familie.«
»Ihr seid schon eine seltsame Familie. Dein Vater hat deinen Bruder verstoßen, auf die brutalste Weise. Und trotzdem kommt der nach so vielen Jahren, die er auf der anderen Seite des Atlantiks gelebt hat, nach Deutschland zurück, in ein Land, in dem sich alles zum Schlechteren gewendet hat, nur weil der Vater, der ihn nicht einmal mehr als Sohn akzeptiert, im Sterben liegt?«
»Ich sage ja, du verstehst das nicht.«
»Nein, das verstehe ich wirklich nicht.«
Charly war inzwischen komplett angekleidet. Nur der Mantel und der Hut fehlten noch. Und ihre Handtasche.
»Du gehst schon?«
»Ich habe doch gesagt, dass ich den Neunuhrzug erwischen will. Noch eine Tasse Kaffee unten, dann muss ich los.«
Rath stand auf. »Ich begleite dich.«
»Wie?«
»Ich begleite dich zum Bahnhof. Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Zeit miteinander.«
Sie schien kurz zu überlegen. »Gut«, sagte sie schließlich. »Aber dann beeil dich.«
Rath schlüpfte so schnell es ging in seine Hosen, stopfte das Hemd mehr schlecht als recht in den Gürtel, schlang sich die Krawatte um den Hemdkragen und zog sie fest. Als er sich die Schuhe gebunden hatte, war Charly mit Schminken fertig. Sie zupfte noch ein bisschen an ihren Haaren herum.
»Wie sehe ich aus?«, fragte sie.
»Perfekt. Wie immer.« Er schnappte sich sein Jackett und öffnete ihr die Tür. »Nach Ihnen, Frau Michalek.«
Unten im Frühstücksraum tranken sie so viel Kaffee, wie zu einer Zigarettenlänge passte, dann brachen sie auf. Charly trug keinen Koffer, nur ihre Handtasche, das war das einzige was sie zu ihren Treffen je mitnahm.
»Wir werden das Zimmer später räumen«, sagte Rath dem Mann an der Rezeption, der die Augenbrauen hochzog, als sie die Drehtür ansteuerten. »Ich bringe meine Frau schnell noch zum Bahnhof, dann hole ich mein Gepäck.«
»Sehr wohl, Herr Michalek.«
So weit war es schon, sie kannten ihn hier mit Namen. Kein Wunder: Ein Ehepaar, das einmal im Monat ein Hotelzimmer nehmen musste, um sich sehen zu können, das gab es wohl nicht allzu häufig.
Vom Hansahotel zum Hannoveraner Hauptbahnhof war es nicht weit. Sie mussten nur die Adolf-Hitler-Straße runter, keine zehn Minuten Fußweg. Dennoch hatte Charly es eilig, in einem Affenzahn hetzte sie am glamourösen Eingang des Palasttheaters vorüber, Rath konnte kaum Schritt halten.
»Mensch, Charly, so geht das nicht weiter!«
»Meine Rede.«
Am Ernst-August-Platz stand die Ampel auf Rot, endlich musste sie stehen bleiben. Rath ergriff ihre Hände und schaute ihr in die Augen.
»Ich mache einen Plan, versprochen, einen konkreten. Ich bereite unsere Ausreise vor. Ich kann bestimmt wieder bei der Post arbeiten. Oder wir machen in Hoboken zusammen ein Detektivbüro auf, was meinst du?«
Sie lachte. »Das ist das erste Mal, dass du konkret über unsere Zukunft redest, weißt du das? Das erste Mal seit wieviel Monaten?«
»Weil ich ja nicht weiß, was mit Severin ist. Ich kann doch nicht ohne ihn zurück.«
Wobei Rath sich, wenn er ehrlich war, nicht ganz sicher war, ob sein Bruder so bald wieder in die Staaten wollte. Der Musikjournalist hatte sich, als der Tod des Vaters entgegen der ärztlichen Prognose nicht eingetreten war, zusammen mit seiner Freundin in Berlin niedergelassen, weil er dort eine Stelle als Deutschlandkorrespondent für Associated Press antreten konnte, und schien sich als amerikanischer Staatsbürger in der Reichshauptstadt ganz wohlzufühlen.
»Aber du hast recht, Charly, ich muss keine Rücksicht nehmen auf meinen Bruder, der nimmt auch keine Rücksicht auf mich. Sobald hier alles erledigt ist, verlassen wir das Land, ganz gleich, ob Severin mitkommt oder nicht. Mein Wort darauf!«
Die Ampel sprang auf Grün, und die Fußgängermeute hastete los. Den Blick, den Charly ihm zuwarf, bevor sie sich von der Menschenmenge über die Straße treiben ließen, konnte Rath nicht genau entschlüsseln, wie so oft bei ihr, doch es wirkte, als wollte sie ihm nicht so recht glauben.
»Wirklich, Charly«, sagte er, als er sie wieder eingeholt hatte, kurz vor dem Bahnhofsportal, »ich meine es ernst.«
»Das hoffe ich doch«, sagte sie. »Aber mache bitte keine Versprechen, bei denen du dir nicht sicher bist, ob du sie auch halten kannst.«
Er nickte. Und hielt ihr die schwere Bahnhofstür auf.
»Soll ich noch mit hinauf zum Gleis kommen?«, fragte er, als sie durch die Halle hasteten. »Ich habe ein sauberes Taschentuch dabei. Dann kann ich dir winken, wie es sich für einen Ehemann gehört, der seine Frau zum Bahnhof bringt.«
Sie lächelte. »Das ist mir zu sentimental. Spar dir die Bahnsteigkarte.«
Er nickte. Sie hatte ja recht. Keine übertriebenen Sentimentalitäten, die machten nur traurig.
»Dann mach’s gut«, sagte er und gab ihr einen Kuss. »Wir sehen uns in vier Wochen.«
Sie schenkte ihm einen letzten Blick, dann schulterte sie ihre Handtasche und machte sich auf den Weg. Er schaute ihr hinterher und sah noch, wie sie dem Beamten an der Bahnsteigschranke ihre Fahrkarte zeigte und die Treppe hinaufging. Dann war sie verschwunden.
Rath machte kehrt und zündete sich eine Zigarette an. Den Sonntag hatte er sich anders vorgestellt, jedenfalls den Morgen. Manchmal waren sie bis mittags im Bett geblieben, so lange bis die Rezeption höflich nachfragen ließ, wann die Herrschaften denn abzureisen gedachten.
Als er ins Hotel zurückkam, sprach ihn der Mann an der Rezeption an.
»Hat die werte Frau Gemahlin den Zug bekommen, Herr Michalek?«
Verdammt neugierig, der Kerl.
»Ja«, sagte Rath, »sie musste leider schon los. Wichtige Termine.«
»Kein Wunder! Wie es zugeht in Ihrer Heimat! Sie kommen doch aus dem Sudetenland, wenn ich das richtig sehe?«
»Ja.«
»Haben die Tschechen Ihnen auch so übel mitgespielt?«
»In Klein Petersdorf haben wir wenig mit Tschechen zu tun gehabt.«
»Und warum sind Sie dann weg aus der Heimat?«
»Beruflich.« Rath zuckte die Achseln. »Was will man machen? Der Mensch braucht Arbeit.«
»Im Rheinland, oder?«
»Wie bitte?«
»Sie klingen so … so rheinisch. Da müssen Sie doch schon viele Jahre dort leben. Im Rheinland, meine ich …«
»Sicher. In Köln.«
»Werden Sie denn wieder zurückgehen?«
»Zurückgehen? Wohin?«
»Na, nach Böhmen. Ich meine, es ist ja nur noch eine Frage der Zeit, dann kehrt Ihre Heimat heim ins Reich.«
»Wer weiß.«
»Der Führer wird das schon hinbekommen.« Der Portier machte ein Gesicht, als wollte er Rath jeden Moment tröstend auf die Schulter klopfen. »Keine Sorge. Dann hat Ihre Odyssee ein Ende.«
Rath sagte nichts dazu. Er hatte keine Lust auf dieses Gespräch und hoffte, der Rezeptionist möge endlich Ruhe geben. Doch der Mann war noch nicht fertig. Er beugte sich über seinen hölzernen Tresen und tat geheimnisvoll.
»Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf …«, sagte er, und Rath zuckte bei dem Wort Rat unwillkürlich zusammen, wie immer, wenn er diese Silbe hörte. »Kehren Sie mit Ihrer Frau in die Heimat zurück. Sie gehören unter ein Dach, Sie müssen dem Führer Kinder schenken. Das, was Sie beide da machen, jeder in einer anderen Stadt, das verträgt doch auf Dauer keine Ehe.«
2
Der D-Zug aus Hannover rollte über die Hardenbergbrücke, und Charly schaute so lange auf das Turmgebirge der Gedächtniskirche, bis es sich hinter das schmutzige Glas des Bahnhofs geschoben hatte. Der riesige Protzbau aus Kaisers Zeiten war ihr immer schon deplaziert vorgekommen in dieser Gegend, ein Relikt aus einer anderen Welt, das überhaupt nicht zum modernen Berlin passen wollte. Der Bahnhof war einer der hässlichsten der Stadt, trotzdem mochte sie ihn; wenn sie Berlin verließ oder zurückkehrte, war es fast immer der Bahnhof Zoologischer Garten, in dem sie ein- oder ausstieg. Und die Gedächtniskirche sagte ihr jedesmal: Du bist wieder da, bist wieder in Berlin, mein Kind. Wo die Verrückten sind, da jehörste hin.
Charly stand auf und öffnete die Abteiltür. Der Zug kam zum Stehen, und die Türen wurden geöffnet. Sie war eine der wenigen Reisenden, die keinen Gepäckträger herbeiriefen. Vor allen anderen stieg sie die Treppe des Fernbahnsteigs hinunter und ging gleich hinüber zum S-Bahnhof. Sie wollte nach Hause, nur nach Hause, auf dem schnellsten Wege.
Böhm hatte ihr keinen Termin aufs Auge gedrückt, das war gelogen. Natürlich hatte sie keinen Termin. Nicht an einem Sonntag, nicht an dem Sonntag, an dem Wochenende, an dem sie sich mit Gereon traf. Da konnte Böhm noch so sehr betteln, dieses Wochenende hatte sie sich bislang immer freigehalten von irgendwelchen Bespitzelungen im Auftrag seines Detektivbüros.
Nein, sie hatte keinen Termin, es war etwas anderes. Etwas Unerwartetes. Sie hatte Gereons Gegenwart einfach nicht mehr ertragen, sie hatte fahren müssen. Schon am Vorabend, ja eigentlich schon im Zug nach Hannover, hatte sie gemerkt, dass sie die Nase voll hatte von ihren heimlichen Treffen in diesem billigen Hotel auf halber Strecke, damit niemand die ganze Strecke zwischen Berlin und Köln fahren musste.
Ja, sie hatte die Nase voll davon, und vielleicht hatte sie sogar die Nase voll von ihm. Dieser Gedanke hatte sie erschreckt, als er das erste Mal aufgekommen war, noch undeutlich und kaum zu greifen; mittlerweile aber dachte sie ganz nüchtern und sachlich darüber nach. Was verband sie eigentlich noch mit Gereon Rath? Außer der Tatsache, dass sie miteinander verheiratet waren? Verheiratet. Waren sie das überhaupt noch? Immerhin bezog sie Witwenrente, nachdem man ihn letzten Herbst endlich offiziell für tot erklärt hatte.
Sein Leben gelassen im Kampf gegen das jüdische Berufsverbrechertum. So hatte es geheißen. Sie und Reinhold Gräf waren die einzigen auf der Trauerfeier, die wussten, dass das eine Lüge war. Nicht einmal Gereons Eltern, die mit versteinerten Gesichtern neben ihr in der ersten Reihe gestanden hatten, wussten das. Es musste wenige Wochen vor dem Schlaganfall Engelbert Raths gewesen sein.
Charly hatte die Beileidsbekundungen entgegengenommen und ebenso die Witwenrente. Weil sie glaubte, ein Anrecht darauf zu haben. Weil ihr dieser Staat, der ihr die Rente zahlte, den Mann wirklich genommen hatte. Weil er ihn aus dem Land getrieben hatte. Weil er ihm die Rückkehr unmöglich machte, wollte er nicht sein Leben riskieren. Und dann war Gereon doch zurückgekommen. Einfach so. Als sei nichts geschehen. Doch es war einiges geschehen.
Die S-Bahn war vollgestopft mit Sonntagsausflüglern, die auf dem Weg ins Grüne waren oder gerade von irgendwoher zurückkamen. Die Zahl der Berlintouristen, jedenfalls die der deutschen, war deutlich gestiegen, seit die Nazis an der Regierung waren. Dauernd wurden irgendwelche Delegationen aus der Provinz in die Reichshauptstadt geschleust, damit ganz Deutschland sehe, wie sehr sich das einstige Sündenbabel doch verändert hatte. Kein Laster mehr und keine Versuchung, stattdessen kaltmonströse Neubauten, Uniformierte aller Couleur und an jeder Ecke Hakenkreuzfahnen.
Die S-Bahn hielt am Bahnhof Bellevue, und Charly quetschte sich durch die Menge. Nur noch über den Gerickesteg, dann war sie in Moabit. Nirgends in Berlin fühlte sie sich so heimisch wie in diesem Stadtteil, in dem sie aufgewachsen war. Aber auch hier hingen Hakenkreuzfahnen an den Fassaden, zu jedem hohen Feiertag, und davon kannte die Regierung Hitler mehr als die katholische Kirche. An ihre Hausgemeinschaft durfte sie gleich gar nicht denken, an Herrn Maltritz, den Haus- und Blockwart, oder an Frau Brettschneider, die neugierige Nachbarin. Das waren hundertfünfzigprozentige Nazis.
Nein, auch in Moabit fühlte sie sich nicht mehr zuhause, nicht einmal in der Spenerstraße, in der sie schon gewohnt hatte, bevor sie wusste, dass es einen Menschen namens Gereon Rath überhaupt gab, und in der sie wieder wohnte, seit alle Welt Gereon Rath für tot hielt. Und selbst sie hatte das ja irgendwann geglaubt, nach dem Inferno der Hindenburg, monatelang hatte sie das. Bis zu Gereons Anruf. Seinem Anruf bei Reinhold Gräf. Bei Gräf, nicht bei ihr.
Und dann, viele Wochen später, hatte er eines Tages einfach so im Schneetreiben der Spenerstraße gestanden, keine fünfzig Meter von ihrer Haustür entfernt. Hatte da gestanden und offensichtlich geglaubt, dass sie, Charlotte Rath, nichts Besseres zu tun habe, als ihm um den Hals zu fallen. Einfach so, als sei nichts gewesen.
Sie hatte ihm eine gescheuert. So fest sie konnte.
Und dann doch einen Heulanfall bekommen. Ohne etwas dagegen tun zu können. Er hatte sie aus dem Schneegestöber in eine Toreinfahrt gezogen. Hatte sie in den Arm genommen und getröstet. Oder es wenigstens versucht. Sie hatte sich von ihm losgerissen und ihn weggestoßen.
»Aber Charly, was ist denn los?«
»Was los ist? Ich habe monatelang geglaubt, du bist tot! Warum hast du dich nicht gemeldet?«
Eine Stinkwut hatte sie empfunden, eine Wut, die die Freude, ihn wiederzusehen, bei weitem übertraf, eine Wut, die sie bis heute spürte, bei jedem ihrer Treffen.
Ja, manchmal war sie wütend darüber, dass er überlebt hatte und Freddy nicht. Freddy Siegel. So kurz die Zeit mit ihm auch gewesen sein mochte, es war eine glückliche Zeit. Ja, Freddy hatte sie glücklich gemacht, ihr eine ganz andere Welt eröffnet als Gereon Rath. Ein Klavierspieler, ein Künstler, ein mutiger Mann. Der letzten Endes nur hatte sterben müssen, weil er Charly beschützen wollte. Weil sie in den tödlichen Zwist zwischen Gereon Rath und Johann Marlow geraten war.
Alles Gereons Schuld, dachte sie manchmal. Aber das war es natürlich nicht. Ihr Leben wäre auch ohne Gereon Rath verkorkst gewesen. Da reichte ganz allein das, was die Nazis aus ihrer Stadt und ihrem Land und ihrem Leben gemacht hatten.
Dennoch hatte sie ihre ganze Wut an ihm ausgelassen.
»Warum hast du dich nicht gemeldet, verdammt nochmal? Kein einziges Lebenszeichen. Über Monate!«
»Es ging nicht anders, Charly. So musstest du dich nicht länger verstellen.«
»Nein, musste ich nicht. Ich konnte aus vollem Herzen trauern, du Arschloch!«
Sie hatte ihm noch eine gescheuert und war froh, dass sie nicht mehr heulen musste. Sie hasste sich, wenn sie sich so weich zeigte. Und gab sich deshalb umso kratzbürstiger.
»Du kannst froh sein, dass ich keinen Neuen habe!«
Der Satz hatte ihn getroffen, das war ihm anzusehen, und fast tat er ihr deswegen leid.
»Charly, wir sind immer noch verheiratet.«
»Nein, nicht mal mehr auf dem Papier. Ich bin die Witwe Rath, schon über ein Jahr. Seit neuestem auch amtlich. Sie haben dich für tot erklärt. Fiel mir nicht schwer, dem zuzustimmen. Jetzt bekomme ich wenigstens Witwenrente.«
»Wirklich?« Er hatte die Augenbrauen hochgezogen. »Dann hat Tornow es endlich geschluckt.«
»Ist das alles, was dich interessiert?«
»Nicht so laut, Charly. Es darf immer noch niemand wissen, dass ich lebe.«
Er hatte ihr einen amerikanischen Pass gezeigt und von Hoboken gesprochen und dass er mit ihr und Severin dorthin zurückkehren wolle, sobald sie den von einem schweren Schlaganfall gezeichneten Engelbert Rath beerdigt und alles geregelt hätten. Was, wie es sich damals anhörte, nur eine Frage von Wochen, ja Tagen sein müsse. Doch der alte Rath lebte immer noch, und sein Sohn war immer noch in Deutschland.
Seines Vaters wegen war er zurückgekehrt, das hätte sie sich denken können. Seines Vaters, nicht ihretwegen. Hätte sie auch erst im Sterben liegen müssen, bevor er den Atlantik ihretwegen überquert hätte? Diese Frage hatte sie ihm nicht gestellt. Aber sich selbst. Immer wieder.
Auch jetzt, als sie die Treppe ihres Mietshauses hinaufstieg. Noch im Gehen fummelte sie den Wohnungsschlüssel aus ihrer Handtasche.
»Heil Hitler, Frau Rath.«
»Schönen guten Tag, Frau Brettschneider.«
Die Nachbarin, die schon in der Spenerstraße gewohnt hatte, bevor Greta und Charly dort eingezogen waren, und die beiden neben ihr wohnenden Frauen immer misstrauisch beäugt hatte, war von ausnehmender Freundlichkeit, seit Greta ausgezogen war und sie in Charly nun die Witwe eines im Dienst verstorbenen – im Dienst gefallenen, so hatte die Brettschneider tatsächlich einmal gesagt – Polizeibeamten sah. Was nichts an ihrer Neugier geändert hatte, nur dass diese jetzt etwas wohlwollender geworden war.
Die Nachbarin schloss ihre Wohnungstür, und Charly öffnete die ihre. Hinter der Briefklappe lag die Post von gestern. Zwei Rechnungen und ein unscheinbarer Umschlag, die Adresse handschriftlich, aber mit Blockbuchstaben, fein säuberlich in blauer Tinte geschrieben: Charlotte Rath, Berlin NW40, Spenerstraße 7. Sie drehte den Umschlag um. Kein Absender. Von Gereon kam der bestimmt nicht. Der wagte es nicht, ihr zu schreiben. Außerdem hatte sie ihn doch heute noch gesehen.
Sie hängte den Mantel an die Garderobe, nahm die Post und legte sie auf den Küchentisch. Dort stand eine halbvolle Rotweinflasche. Charly holte ein Glas aus dem Schrank und schenkte sich großzügig ein. Sie trank einen Schluck und betrachtete die Briefe, die vor ihr lagen. Der Geschmack des Weins, die Wärme, die er in ihrer Kehle hinterließ, beruhigten sie. Charly schob die Rechnungen beiseite, nahm den handbeschriebenen Umschlag und schlitzte ihn mit ihrem Frühstücksmesser auf. Ein doppelt umgeschlagenes Blatt Papier fiel heraus, und sie faltete es auseinander. Auch hier kein Absender. Ebensowenig eine Anrede oder ein Datum, nichts. Nur drei Worte standen dort, mehr nicht. Drei Worte in großen, sorgfältig gemalten Blockbuchstaben, bei denen ihr, sie konnte nichts dagegen tun, sofort die Tränen in die Augen schossen.
APFELKUCHENMITSAHNE
3
Sebastian Tornow stand am Fenster und schaute in den verregneten Park, der sich hinter dem Prinz-Albrecht-Palais erstreckte. Seine Uniform war frisch gereinigt und gebügelt, der Schreibtisch aufgeräumt, das Kirschholz blank poliert. Und dennoch hatte er schlechte Laune. Nicht nur wegen des Wetters. Er haderte mit seinem Alltag, mit dem Mist, mit dem er sich immer wieder herumschlagen musste.
Was wäre das Deutsche Reich ohne die Schutzstaffel? Nichts, ein Dreck! Ohne die SS wäre das alles doch längst zusammengebrochen. Eine entsprechende bauliche Würdigung jedoch hatten sie nicht erfahren. Der SS-Führungsstab residierte in einem ehemaligen Hotel, die Geheime Staatspolizei in einer ehemaligen Gewerbeschule, und der SS-Sicherheitsdienst in einem alten, verstaubten Palais. Ein einziges Sammelsurium. Und doch konzentrierte sich genau hier die Macht im Deutschen Reich, in diesen drei Provisorien, deren einzige Gemeinsamkeit ihre unmittelbare Nachbarschaft war.
Und der feiste Göring? Residierte nur einen Steinwurf entfernt in seinem Reichsluftfahrtministerium, einem imposanten Bau, einem der ersten, den das nationalsozialistische Deutschland in Berlin hatte errichten lassen. In einem Bau, wie ihn auch die SS verdient hätte. Aber egal; mochte Göring sich mit seinem Riesenministeriumspalast trösten, der mächtigste Mann in Deutschland – nach dem Führer natürlich, soviel Respekt besaß auch die SS –, der mächtigste Mann hieß nicht Hermann Göring, der mächtigste Mann hieß Heinrich Himmler.
Und der legte leider keinen Wert auf eine repräsentative Residenz. Das ehrwürdigste Gebäude im zusammengewürfelten Ensemble von Himmlers Machtzentrale war noch das Prinz-Albrecht-Palais des SD, das sich seinen neuen Aufgaben erst nach umfangreichen Umbauten gewachsen zeigte und dennoch aus allen Nähten platzte. Und in einem dieser mickrigen, durch Einziehen einer Zwischendecke entstandenen Büros, die überhaupt nicht dem nationalsozialistischen Geist entsprachen, der doch immerwährende Größe atmen sollte, hockte Sebastian Tornow. Schon seit Jahren. Wie er auch seit Jahren schon über den Dienstgrad eines Obersturmbannführers nicht hinausgekommen war. So schnell es nach seiner Rückkehr aus dem Exil auch vorangegangen sein mochte mit seiner Karriere, so lange trat er nun auch schon auf der Stelle.
Wurde Zeit, dass sich das änderte. Zu sehr hatte er seine Arbeitskraft in den Dienst der Sache gestellt, hatte immer wieder Feuer ausgetreten, die der nationalsozialistischen Sache hätten gefährlich werden können. Ja, er hatte sogar einen Anschlag auf Hermann Göring vereitelt, ohne dass ihm das je gelohnt worden wäre. Hätte er den Fettsack mal besser krepieren lassen, vielleicht hätte Himmler ihm das mit einer Beförderung gedankt. Nein, Hingabe und Pflichterfüllung waren nicht alles, irgendwann musste man andere Saiten aufziehen, um voranzukommen.
Gedankenverloren strich er mit der linken Hand über den leeren rechten Uniformärmel, der perfekt gefaltet an die Uniform getackert war. Es gab Momente, in denen Sebastian Tornow vergaß, dass er vor Jahren seinen rechten Arm verloren hatte, aber in Momenten wie diesem fiel es ihm immer wieder ein, wurde ihm bewusster denn je. Und dann spürte er den Hass auf jenen Mann, der ihn zum Krüppel gemacht hatte. Den Hass auf Gereon Rath.
Rath hätte längst tot sein sollen, doch er hatte sich aus dem Staub gemacht. Befand sich weit außerhalb der Befehlsgewalt der SS, irgendwo in den USA, und dennoch war Tornow immer noch damit beschäftigt, die Scherben aufzufegen, die der Mann in Berlin hinterlassen hatte. Als ob man nichts Besseres zu tun hätte.
Eine dieser Scherben war Friedrich Thormann, der ehemalige Zögling der Raths, der im Olympischen Dorf Zeuge der Exekution des allzu redseligen Doktor Schmidt geworden war. Sie hatten Thormann im Griff, weil sie Hannah Singer in ihrer Gewalt hatten, die verrückte Jüdin, die der Junge so liebte, dass er sie sogar in einer waghalsigen Aktion aus der Irrenanstalt hatte befreien wollen.
Und nun diese vermaledeite Nachricht aus den Wittenauer Heimstätten. Warum hatten sie die Singer überhaupt ins Krankenhaus bringen lassen? Sie hätten sie keinen Millimeter mehr aus der Geschlossenen herauslassen dürfen, nicht einmal zum Hofgang. Völlig unnötig, dieser Krankenhausaufenthalt. Er fragte sich, wer den veranlasst hatte. Konnten die Dinge denn nicht einmal so laufen, wie sie sollten?
Tornow seufzte und setzte sich an seinen Schreibtisch. Es half ja nichts, er musste sich kümmern. Er nahm den Telefonhörer mit der Linken und klemmte ihn zwischen Ohr und Schulter ein. Dann drehte sein Zeigefinger die Wählscheibe.
»Obersturmbannführer Tornow hier. Verbinden Sie mich bitte mit der Reichsjugendführung. Amt für weltanschauliche Schulungen, Hauptbannführer Rademann.«
Er wartete eine Weile, doch niemand hob ab. Schließlich meldete sich die Telefonzentrale und richtete aus, dass sich Hauptbannführer Rademann bereits nach Hause begeben habe. Also ließ Tornow sich mit der Lothringer Straße verbinden. Und tatsächlich, der faule Sack war bereits zuhause, pünktlich zum Abendbrot. Machte in diesem Land eigentlich nur die SS Überstunden?
»Sebastian!« Die Stimme von Wilhelm Rademann klang überrascht durch den Hörer. »Was verschafft mir die Ehre?«
Tornow kam gleich zur Sache.
»Das Mädchen. Hannah Singer. Sie ist …«
»Ich weiß«, unterbrach ihn Rademann.
»Und warum erfahre ich das dann nicht von dir?«
»Ich bin doch auch erst heute informiert worden.«
»Und der Junge?«
»Der weiß noch nichts.«
»Gut. Aber wie gehen wir weiter vor? Irgendwann wird er es erfahren, fürchte ich. Dann haben wir nichts mehr gegen ihn in der Hand.«
»Das müssen wir auch nicht. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen.«
»Ist er denn schon so weit? Er ist noch nicht einmal achtzehn.«
»Wird er aber bald. Ich denke, du solltest mal mit ihm reden.«
»Die Aufnahme der Staffelbewerber findet schon am neunten November statt.«
»Eben, wir können nicht noch ein Jahr warten. Wäre nicht der erste Siebzehnjährige, der mit einer Sondererlaubnis antritt. Du regelst das schon. Wenn am zwanzigsten April der Eid auf den Führer ansteht, ist er längst achtzehn. Der Junge gäbe einen perfekten SS-Mann ab. Sein leiblicher Vater …«
»Ich weiß, ich weiß. Friedrich von Randow, der Vorzeige-Arier. Vielleicht sollte der auch mal mit ihm reden.«
»Das lassen wir besser bleiben. Major von Randow ist Wehrmachtsoffizier, da weiß man nicht, was so einer von der Schutzstaffel hält. Nein, es ist besser, ein befreundeter SS-Offizier macht ihm die Sache schmackhaft. Du hast den Jungen doch schon kennengelernt.«
»Eben. Da war er eher bockig.«
»Das hat sich geändert. Friedrich ist nun mehr oder weniger seit zwei Jahren in meiner Obhut. Das vergangene Jahr bei der Hitlerjugend und nicht zuletzt die häusliche Erziehung haben ihre Wirkung gezeigt. Um bedingungslosen Gehorsam zu erzielen, gilt es vor allem, Vertrauen aufzubauen. Und den Willen der jungen Zöglinge zu brechen.«
»Und du denkst, das ist dir gelungen.«
»Natürlich. Ich bin HJ-Führer. Ich weiß, wie man mit solchen Burschen umspringt.«
Tornow legte auf. Unwillkürlich musste er grinsen. Friedrich Thormann als SS-Staffelanwärter, eine schöne Vorstellung. Sollte der Plan gelingen, wäre der Junge endlich eingenordet, und es gäbe ein Problem weniger im Leben des Obersturmbannführers Sebastian Tornow. Und was für eine späte, aber umso befriedigendere Genugtuung wäre es, den ehemaligen Pflegesohn von Gereon und Charlotte Rath in der schwarzen Uniform der Schutzstaffel zu sehen?
4
Die Sprossen der Strickleiter waren rund einen halben Meter voneinander entfernt, gar nicht so einfach, die hinaufzuklettern. Aber Fritze hatte Übung darin. Man durfte nur nicht aus dem Rhythmus kommen, dann ging es leichter: den Schwung von jeder Sprosse mitnehmen für die nächste. Oben angekommen musste er sich über einen Balken schwingen und in eine Sandgrube springen. Das sah von oben höher aus als von unten: Ja, es galt auch, seine Angst zu überwinden, Weicheier konnten sie in der Hitlerjugend nicht gebrauchen.
Fritze hatte den Sprung schon zigmal gemacht, er zögerte nicht, schließlich ging es hier um jede Sekunde. Die anderen aus ihrer Schar, gut dreißig Jungen, alle aus ihrer Schule, die meisten sogar aus Fritzes Klasse, hatten den Parcours schon hinter sich gebracht und warteten am anderen Ende. Nur Scharführer Kramer begleitete ihn, die Stoppuhr in der Hand, und feuerte ihn an.
»Na los, Thormann«, rief er, nachdem Fritze im Sand gelandet war, »wieder hoch mit dir, das geht auch schneller! Stell dir vor, der Feind ist hinter dir her, da sollteste mal sehen, wie dir det Beine macht.«
Kramer war nur wenige Jahre älter als die Truppe, die er befehligte, doch er tat immer so, als habe er mindestens seit Königgrätz in allen Kriegen mitgekämpft.
Fritze war gut gelandet und lief weiter. Als Nächstes musste er ein Seil hochklettern und sich dann einen Balken entlanghangeln wie ein Affe im Urwald. Nur nicht nach unten gucken, immer nach oben, das war der ganze Trick. Einmal hatte ein Hitlerjunge bei dieser Übung den Halt verloren und sich ein Bein gebrochen, so tief ging es hinab. Seitdem hatten sie auch hier Sand hingekippt.
Der Parcours, der auf ihrem Übungsgelände aufgebaut war, hatte es in sich. Mit Strickleiter, Klettertau und Hangelbalken fing es an, von dort mussten sie sich wieder abseilen, so schnell wie möglich, ohne sich dabei die Hände aufzuschürfen, und unten angekommen ging es dann gleich weiter mit einem Kriechgraben, ein spitzes Schotterbett, das sie durchrobben mussten wie die Indianer, ohne an die mit kleinen Glöckchen gespickten Drähte zu kommen, die nur wenige Zentimeter über ihnen gespannt waren, denn das gab Strafsekunden.
Fritze warf sich auf den Boden und robbte los, mit Ellbogen und Knien, das ging am schnellsten, hin und her, wie eine Eidechse. Und den Kopf immer schön unten.
»Na los, Thormann, schneller! Beweg deinen Arsch!«
Den Kriechgraben hatte er fast gepackt, ohne ein einziges Mal an den Draht gestoßen zu sein. Die spitzen Steine pikten in Ellbogen und Knie, aber das kannte er schon. Zähne zusammenbeißen und durch.
Nun hatte er den Teppichklopfer vor sich, zwei Teppichstangen, eine tiefe, unter der er drunter durchmusste, und eine hohe, über die er rübermusste. Auch da verlor er keine Zeit. Dann die Löwengrube, eine Grube wie ein Schützengraben, zwei Meter tief, in die er reinspringen und wieder rauskrabbeln musste. Und am Ende der Strecke, wenn man schon ziemlich außer Atem war, wartete noch eine gut zwei Meter hohe Holzwand, die man irgendwie überwinden musste.
Schließlich hatte er es geschafft, nur noch die Holzwand, hinter der die Kameraden warteten, und er war durch. Mochte er in ihrer Schar ein Außenseiter sein, mochten Idioten wie Atze oder Heinzi ihn auch immer wieder mit irgendeinem Mist aufziehen: Im Geländesport machte ihm keiner etwas vor. Wenn sie ihn schon nicht mochten, sollten sie wenigstens Respekt vor ihm haben. Und heute war Fritze besonders froh, dass die Geländeübung auf dem Programm stand, das lenkte ab. Bei Weltanschaulicher Schulung hätte er die ganze Zeit an Hannah denken müssen und wie es ihr wohl gehen mochte. Sie war im Krankenhaus, das wusste er, aber er wusste nicht, warum und wie krank sie war.
Die Holzwand kam näher. Fritze hatte keine Ahnung, wie er in der Zeit lag, aber vom Gefühl her war er ganz gut unterwegs, er würde bestimmt wieder zu den Ersten gehören. Besser als Heinzi Gebhardt oder Atze Rademann war er allemal. Und wie er das letzte Hindernis überwinden konnte, wusste er auch: mit Anlauf hoch, die Oberkante erwischen und sich mit dem Schwung, den man vom Sprung noch hatte, hochziehen und drüber, das hatte er schon hundertmal gemacht.
Fritze sprang, er stieß sich optimal ab und bekam die Oberkante der Holzwand zu fassen. Oder eben auch nicht, seine Finger fanden keinen Halt, er rutschte ab und landete auf dem Hosenboden. Die Kameraden, die sich hinter und neben dem Hindernis versammelt hatten, lachten.
Kramer blieb ernst. »Mensch, Thormann, wat issen los? Weiter!«, brüllte er. »Aufstehen! Denk an den Feind! Mach deine gute Zeit nicht kaputt! Noch führst du!«
Fritze rappelte sich wieder auf, lief ein paar Schritte zurück und nahm neuen Anlauf. Diesmal schaffte er es mit Schwung gleich bäuchlings auf die Wand, doch wieder fand er oben keinen Halt. Alles war irgendwie glitschig, als habe jemand das Holz mit Schmierseife eingeschmiert, und er rutschte wieder ab. Diesmal zwar auf der richtigen Seite, aber völlig unkontrolliert, so dass er beinahe kopfüber fiel, auf der Schulter landete und mit dem Kopf auf den Sand knallte.
Ein wenig benommen rappelte er sich auf, immer noch außer Puste, der Schweiß lief ihm die Stirn hinunter und tropfte von der Nasenspitze, Sand klebte ihm in den Haaren.
Heinzi Gebhardt löste sich aus der Truppe und reichte ihm sein Handtuch. Das machte man so, das gehörte zur Kameradschaft; Fritze, immer noch ein wenig benommen, wunderte sich nur, dass es ausgerechnet Gebhardt war, der sich so kameradschaftlich zeigte. Gebhardt, der sonst keine Gelegenheit ausließ, ihm eins auszuwischen. Mit einem Kopfnicken nahm Fritze das Frotteetuch entgegen und wischte sich den Kopf ab, ebenso Hals und Nacken.
Aus irgendeinem Grund fingen die Kameraden wieder an zu lachen, nein, sie lachten nicht nur, sie johlten geradezu.
»Schnauze«, brüllte Scharführer Kramer, der hinzugekommen war und die Stoppuhr mit einer theatralischen Bewegung anhielt. »Was ist denn das hier für ein Sauhaufen?«
Das Gejohle hörte schlagartig auf.
Kramer schaute Fritze an und kam näher. »Wie siehst du denn aus?«, fragte er.
»Wie?«
Fritze wusste nicht, was Kramer meinte, doch dann folgte er dessen Blick und sah auf das Handtuch, mit dem er sich gerade den Schweiß und den Sand abgewischt hatte. Das ihm Heinzi Gebhardt gegeben hatte und das ein einziger schmutzig schwarz verschmierter Lappen war. Fritze hob seine ebenfalls schwarz verschmierte Hand an die Nase und roch.
Motoröl. Schwarzes, schmutziges, schmieriges Altöl.
Fritze wollte gar nicht wissen, wie sein Gesicht aussehen mochte, es reichte schon, wie seine Uniform aussah. Seine schmucke Uniform war ölbeschmiert, alle Stellen, mit denen er die Holzwand berührt hatte. Deswegen hatte er keinen Halt gefunden, nicht nur das Handtuch, auch das letzte Hindernis hatten sie mit Altöl beschmiert.
Sie.
Nicht sie! Gebhardt.
Dessen Vater betrieb eine Autowerkstatt.
Fritze betrachtete seine Uniform. Die war hinüber, die würde niemand mehr sauber bekommen, nicht einmal Frau Rademann. Allein seine Uniform sah so aus, die Hemden und Hosen der Kameraden waren blitzeblank. Sie hatten das Altöl erst auf die Hinderniswand geschmiert, nachdem alle anderen durch waren. Aber wer auch alles mitgemacht haben mochte, Heinzi Gebhardt war derjenige, der das Öl besorgt hatte. Er war derjenige, der Fritze das verschmutzte Handtuch gegeben hatte. Und er war der einzige in ihrer Truppe, der es nach dem Anschiss von Scharführer Kramer noch wagte zu grinsen.
Normalerweise beherrschte sich Fritze und wartete, bis sie das HJ-Gelände verlassen hatten, bevor er sich um Heinzi Gebhardt kümmerte, wenn mal wieder eine Abreibung fällig war, doch das war ihm nun unmöglich. Er spürte, wie die Wut von ihm Besitz ergriff, wie sie langsam in ihm anstieg, eine Wut, die sich lange schon angestaut hatte und in den letzten Tagen noch verstärkt worden war durch seine Sorgen um Hannah. Und jetzt musste sie raus.
»Gebhardt, du verdammtes Dreckschwein«, zischte er und ballte die Fäuste, »das wirst du büßen!«
Heinzis Grinsen war verschwunden. Er schaute sich unsicher um, als erwartete er, dass jemand ihm zu Hilfe kam, doch niemand machte Anstalten. Allein Kramer rief ein hilfloses »Thormann! Nein!«, doch zurückhalten konnte er Fritze so schnell auch nicht, dafür stand er zu weit weg.
Heinzi wollte weglaufen, doch es standen zu viele Hitlerjungen um ihn herum. Und so erwischte ihn der rechte Haken mit voller Wucht. Seine Lippe platzte auf, aber er blieb stehen. Und bevor Fritze einen linken Haken hinterherschicken konnte, hatte Kramer ihn erreicht und umklammerte ihn mit beiden Armen, so dass Fritze sich kaum noch rühren konnte. Der Scharführer war nicht nur zwei, drei Jahre älter, er war auch stärker als Fritze. Heinzi nutzte die vorübergehende Wehrlosigkeit seines Kontrahenten und spuckte ihm Blut und Spucke ins Gesicht.
»Was ist denn hier los?«
Die laute Stimme kam vom Tor her, das den Zugang zum HJ-Gelände markierte. Dort stand ein Mann in Uniform, der seinen Blick über ihre Reihen wandern ließ. Wilhelm Rademann. Früher hatte Fritzes Pflegevater ihre Schar kommandiert, doch das machte er nur noch ganz selten persönlich, dafür war der Hauptbannführer ein viel zu hohes Tier. Er überließ die Führung dem jungen Kramer, den er selbst vor rund einem Jahr als Scharführer eingesetzt hatte. Zum HJ-Heim am Dohnagestell kam Rademann nur noch unregelmäßig und unangemeldet, um nach dem Rechten zu sehen. Kramer, der einen Höllenrespekt vor Rademann hatte, nahm Haltung an, hielt Fritze aber immer noch fest, was irgendwie komisch aussah.
»Heil Hitler, Hauptbannführer«, bellte er. »Melde gehorsamst: Dem Hitlerjungen Thormann wurde offensichtlich ein Streich gespielt. Wollte gerade einschreiten und die Jungen zur Rechenschaft ziehen.«
»Sie sollten Ihre Jungen im Griff haben, Kramer. Dafür habe ich Sie auf diesen Posten gesetzt.«
»Jawohl, Hauptbannführer.«
»Nun lassen Sie den Hitlerjungen Thormann mal los.«
Kramer gehorchte, und Fritze wischte sich Heinzis Blut und Spucke aus dem Gesicht. Er hatte es schon ein paarmal erlebt, dass Herr Rademann sich für ihn einsetzte, wenn andere Hitlerjungen ihn gehänselt oder ihm sonstwie übel mitgespielt hatten.
Doch diesmal schien es anders zu laufen. Der Hauptbannführer baute sich vor ihm auf, die Hände in die Seiten gestemmt.
»Was denkst du dir nur dabei, Thormann?«, fragte er, und Fritze wusste nicht, was er damit meinte. Aber Rademann erwartete auch keine Antwort, er redete weiter. »Wie viele Jahre bist du jetzt in der Hitlerjugend? Wie viele Stunden haben wir dir eingebläut, dass Disziplin das Wichtigste ist im Leben eines Hitlerjungen? Disziplin und Gehorsam.«
»Jawohl, Hauptbannführer.«
Zuhause musste Fritze immer Wilhelm zu Herrn Rademann sagen, was er hasste. Das Hauptbannführer, das in der HJ verlangt wurde, war ihm tausendmal lieber.
»Und dann«, fuhr Herr Rademann fort, »fällt dir nichts Besseres ein, als inmitten eines Geländewettkampfes, der euch Kameradschaft, Kraft, Zähigkeit und viele andere bedeutende Tugenden lehren soll, über einen deiner Kameraden herzufallen und ihn blutig zu schlagen? Wir sind doch nicht bei den Hottentotten!«