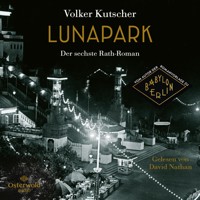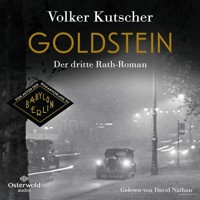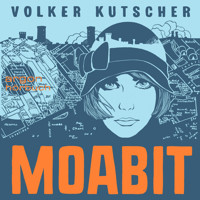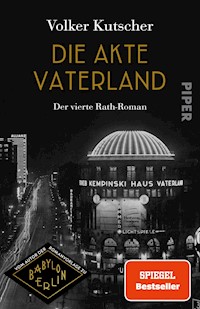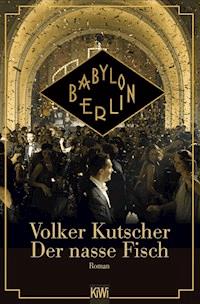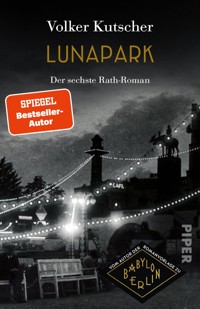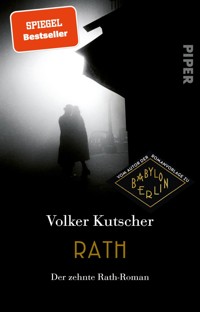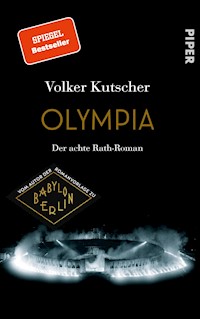
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Der überzeugendste Roman Kutschers.« DER SPIEGEL Während die Nazis bei Olympia 1936 eine freundliche Fassade errichten, deckt der derzeit bekannteste Kommissar des historischen Krimis ein unfassbares Komplott auf. In seinem achten Fall verschlägt es Gereon Rath in das olympische Dorf. Die Olympischen Spiele 1936 sollen der Welt die Harmlosigkeit der Nazis vor Augen führen. Doch bei seinen verdeckten Ermittlungen wird nicht nur für Rath immer klarer, welche gefährliche Scharade das Regime hier spielt. Zu allem Überfluss muss sich der unangepasste Kommissar auch noch mit häuslichen Problemen auseinandersetzen, denn seine Frau Charly sucht plötzlich das Weite. Wie kaum ein anderer Autor schafft es Volker Kutscher, mit seiner erfolgreichen Krimireihe über Kommissar Gereon Rath das Berlin während des Nationalsozialismus' lebendig werden zu lassen. »Atmosphärisch dicht, spannungs- und temporeich« ARD druckfrisch Die Gereon-Rath-Romane zählen zu den erfolgreichsten Reihen der deutschen Literaturlandschaft. Fans und Kritiker feiern die atmosphärischen und packenden Erzählungen, in denen Wahrheit und Fiktion einen Pakt mit Kutschers großem Erzähltalent schließen. Ein großer historischer Kriminalroman in Serie – die Vorlage für »Babylon Berlin« Spätestens seit dem Erfolg der TV-Serie "Babylon Berlin" ist Gereon Rath eine Ikone des historischen Kriminalromans. Für Fans von Volker Kutscher ist das keine Neuigkeit. Werfen Sie jetzt das Kopfkino an, und folgen Sie Gereon Rath durch acht packende Fälle aus dem Berlin der 20er und 30er-Jahre!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 782
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Olympia« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2020
Gesetzt aus der Goudy Old Style
Satz: Tobias Wantzen, Bremen
Karte: © www.pharus-plan.de
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
–
Prolog
–
Erster Teil – Citius
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Zweiter Teil – Altius
–
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Dritter Teil – Fortius
–
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Epilog
–
Addendum
–
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
The fact is that some of us went to Berlin with the mistaken idea that we were going to watch or take part in a sports meeting; instead we’re treated to a piece of political propaganda.
Arthur Godfrey Kilner Brown, britischer Leichtathlet und Olympiasieger 1936
Prolog
Donnerstag, 29. April 1937
Überall in dieser Stadt dampfte es aus der Erde, aus jedem Kanaldeckel, aus jedem Gully, aus jedem Brunnen. Am gewaltigsten aber dampfte es vor dem Hotel Rose, dessen Balkone direkt zum Kochbrunnenplatz hinauswiesen. Selbst im Innenhof des Grandhotels, das wie die meisten Wiesbadener Häuser einmal bessere Zeiten gesehen hatte, krochen Dampf und Nebel aus der Unterwelt.
Der Lieferwagen des Dotzheimer Weingutes Jacoby rollte geradewegs über die Dampfwolke und hielt vor dem Kellereingang. Der Sommelier stand schon am Treppenaufgang, die berufsbedingt elegante Erscheinung in direktem Widerspruch zu seinem Gesichtsausdruck.
»Na endlich, da sind Sie ja, wurde auch Zeit! Der Riesling geht uns schon aus, sollen unsere Gäste verdursten? Nu machen Se mal Tempo!«
Der Mann am Steuer des Lieferwagens zündete sich in aller Ruhe eine Zigarette an. Wortlos schwang er sich vom Fahrersitz, ging um den Wagen herum und öffnete die Hecktür.
Er kannte den Sommelier des Hotels Rose nun schon eine Weile und wusste, wie er ihn behandeln musste: das Geschimpfe gar nicht erst beachten. Mit den Gastronomen und Weinhändlern, mit denen er täglich zu tun hatte, konnte er umgehen, sonst kannte er in dieser Stadt kaum jemanden – seinen Hauswart, seinen Chef, ein paar Kollegen. Das war’s, keine Freunde, kein Stammtisch, nicht mal eine Liebschaft. Einen wie ihn nannte man wohl einen Einzelgänger.
Manchmal fragte er sich, ob das nicht immer schon so gewesen war, oder erst seit jenem Tag, als er sich, wenige Wochen nach der Olympiade, die sein ganzes Leben verändert hatte, beim alten Jacoby bewarb.
Heinrich Jacoby hatte hinter seinem Schreibtisch gesessen wie ein argwöhnischer Uhu und ihn über den Rand seiner Brillengläser gemustert.
»Kessler heißen Sie also …«
»Kessler. Jawohl. Wilhelm Kessler.«
»Geboren in Neuwied?«
»Jawohl.«
»Junggeselle.«
»Jawohl.«
»Sind schon für die Firma Wittkamp gefahren, sehe ich …«
»Jawohl. Im Raum Köln.«
»Und gedient haben Sie auch.«
»Jawohl.«
»Nichts für ungut, aber das hört man Ihnen heute noch an, Herr Kessler. Jawohl!«
Ein Lachen und einen Handschlag später hatte sein neues Leben begonnen. Es war nicht das Leben, das er sich ausgesucht hätte, aber wer konnte das schon, zumal in diesen Zeiten? Er konnte froh sein, dass er überhaupt noch eines hatte.
Er streifte die abgewetzten Lederhandschuhe über und stemmte die ersten zwei Kisten Dotzheimer Judenkirch, schleppte wortlos Kiste für Kiste in den Weinkeller, während der Sommelier auf dem Hof stand und überflüssige Befehle erteilte. Endlich war die letzte Weinkiste ausgeladen, die letzte für das Hotel Rose, die letzte für heute. Er ließ sich den Lieferschein quittieren und stieg zurück in den Wagen.
Es war spät geworden. Grundsätzlich machte ihm das nichts aus, einen pünktlichen Feierabend hatte man in diesem Beruf ohnehin nie. Wenn er es dann allerdings nicht einmal mehr zur Abendvorstellung schaffte, haderte er doch mit seinem Schicksal. Ab und an ein Spielfilm, das war der einzige Luxus, den er sich erlaubte, seit er in dieser verschlafenen Stadt sein zurückgezogenes Leben lebte. Um für anderthalb Stunden wenigstens das Gefühl zu haben dazuzugehören, zu den Menschen, die mit ihm im dunklen Saal saßen, auch wenn er das nicht tat.
Das war der Preis, den er zahlte für sein Überleben: kein Leben mehr zu haben, jedenfalls kein glückliches. Aber hatte er das überhaupt jemals gehabt? Er hatte eine Frau gehabt, eine Frau, mit der er sogar Kinder hatte haben wollen, doch war es bei dem Wunsch geblieben. Und das einzige, was ihn sein trostloses Dasein ertragen ließ, war die Hoffnung, sie eines Tages wiederzusehen. Manchmal wurde die Sehnsucht nach seinem alten Leben, obwohl es alles andere als perfekt gewesen war, so groß, dass er es kaum ertragen konnte.
Doch das war vorbei, damit hatte er sich abzufinden. Selbst wenn die Zeiten sich wieder zum Besseren wenden sollten, würden sie nie wieder so werden, wie sie einmal gewesen waren.
Er fuhr den Lieferwagen ohne Umwege ins Wiesbadener Westend und parkte unter der Straßenlaterne vor seinem Haus. Er öffnete die Hecktür und wunderte sich, wie vertraut ihm der Mann, dessen Gestalt sich in der Fensterscheibe spiegelte, inzwischen war. Manchesterhosen, Lederjacke, Schirmmütze und Schnauz, nicht einmal seine eigene Mutter hätte ihn erkannt.
Er holte eine Flasche Riesling für den Abend aus dem Wagen. Kein Mensch mehr auf der Straße. Er ging durch die Toreinfahrt und überquerte den Hof. Allein das Dudeln eines Radios begleitete seinen Weg das Treppenhaus hinauf. So war das meistens hier, und wenn er doch mal jemandem begegnete, interessierte der sich nicht groß für ihn. Was auf Gegenseitigkeit beruhte, die meisten seiner Nachbarn hier im Hinterhaus kannte er bis heute nicht. Oben unterm Dach hatte er seine Ruhe, so hoch stieg sonst niemand.
Die Wohnungstür war nicht verriegelt. Nichts Neues, schon einige Male hatte er morgens vergessen abzuschließen, dennoch machte ihn die unverschlossene Tür nervös. Jedesmal.
Er glaubte nicht, dass sie ihn aufgestöbert hatten, so einfach war das nicht, dennoch nahm er die Weinflasche in seine Rechte und umfasste mit festem Griff ihren Hals. Sollten sie ihn tatsächlich gefunden haben, würde er sich wehren, ganz gleich wie aussichtslos es sein mochte. Wenn ihn sein Leben eines gelehrt hatte, dann dies: Auch auf verlorenem Posten sollte man kämpfen.
Behutsam öffnete er die Tür und horchte, lauschte auf jedes Geräusch, doch alles, was er hörte, waren das Radio unten im Haus und das kaum wahrnehmbare Knarren der Türangeln. Auf leisen Sohlen betrat er die Wohnung, eine Diele ächzte unter seinem Schritt.
Er blieb stehen und erstarrte, denn mitten im Raum saß jemand.
Es dauerte eine Weile, bis er merkte, dass der Mann, der da im Sessel kauerte, sich nicht mehr regte. Sondern mit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit starrte, den Kopf seltsam schief. Beinahe als habe er sich zum Musikhören dorthin gesetzt und sein Ohr zum Plattenspieler geneigt, um zu lauschen. Doch es lief keine Musik. Und der Mann konnte auch nichts mehr hören.
Auf dem senfgelben Sessel, dem einzigen gemütlichen Möbelstück im ganzen Raum, saß eine Leiche. Ein Mann, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Hager, vielleicht Mitte vierzig, in einen unauffälligen grauen Anzug gekleidet.
Als er sich fragte, wer zum Teufel das sein mochte und wie er in seine Wohnung gelangt war, hörte er ein Geräusch und fuhr herum, bereit, jeden Angriff abzuwehren. Zur Not eben mit einer Weinflasche, und wenn es das Letzte sein sollte, was er in seinem Leben noch tun würde.
Eine tiefe, warme Frauenstimme kam aus dem Dunkel.
»Nicht! Tun Sie mir nichts!«
Eine Stimme, die er kannte. Eine Stimme aus seinem alten Leben. Keine von denen, die er befürchtet hatte und deretwegen er eine Weinflasche in der erhobenen Hand hielt.
Dennoch gab es keinen Zweifel: Die Vergangenheit hatte ihn eingeholt.
Erster TeilCitius
Samstag, 25. Juli, bis Montag, 3. August 1936
Da die in Deutschland stattfindende Olympiade dazu dienen soll und kann, Deutschlands Ansehen in der Welt zu heben und das bestehende Mißtrauen in die Staatsführung zu beseitigen, darf der Erfolg, den die Olympiade für Deutschland damit verspricht, nicht durch irgendwelche Maßnahmen aufs Spiel gesetzt werden, die nicht zur Abwehr gleichzeitig auftauchender Gefahren unbedingt erforderlich sind.
Interne Stellungnahme zu Den Vorschlägen des Sicherheitshauptamtes des Reichsführers SS betreffend Maßnahmen polizeilicher und propagandistischer Art gelegentlich der Olympiade 1936
1
Vor Haus Zittau, gleich neben der Schwimmhalle, knatterte das Sternenbanner im Wind. Die Fahne machte das einzige Geräusch weit und breit, das Dorf lag wie tot in der Mittagssonne; niemand war unterwegs. Was für ein Unterschied zu gestern Abend, als sich die Menschen auf dem schmalen Weg zwischen den schlichten Walmdachhäusern dicht an dicht drängten, während die Fahne zu den Tönen der amerikanischen Nationalhymne den Mast hinaufgeklettert war.
Fritze klaubte das Foto aus der Brusttasche, das er aus der Zeitung ausgeschnitten und fein säuberlich auf Pappe geklebt hatte. Heimlich, denn sein Pflegevater durfte davon nichts wissen. Für Wilhelm, wie Fritze Herrn Rademann nennen musste, obwohl ihm eigentlich gar nicht danach war, gehörten die Negersportler nämlich von der Olympiade ausgeschlossen. »Das sind doch Tiere«, hatte er gesagt, »was soll das für einen Sinn haben? Man lässt einen Menschen ja auch nicht gegen ein Pferd um die Wette rennen.«
Für Fritze war Jesse Owens kein Tier, sondern der größte Sportler des Planeten. Schlicht und einfach der schnellste Mann der Welt. Er hatte die selbstgebastelte Autogrammkarte gestern schon in der Tasche gehabt, bereit, sie jederzeit hervorzuholen, jedoch hatte das Schicksal es nicht gut mit ihm gemeint. Bei der Zuteilung der Busse hatte man ihn hinten zum allerletzten geschickt, Owens aber hatte im ersten gesessen und war auch einer der Ersten, die ausstiegen. Fritze, mit zwei Koffern und dem Mantel irgendeines Schwimmers beladen, hatte keine Chance gehabt. So waren sie vom Empfangsgebäude die Dorfaue hinaufmarschiert zu den Unterkünften, über zweihundert amerikanische Athleten, alle in blauen Anzügen und mit Strohhüten auf dem Kopf, flankiert von den weißen Uniformen des Jugendehrendienstes, angeführt vom deutschen Empfangskomitee, Jesse Owens ziemlich weit vorne, Fritze mit seinem Schwimmer ziemlich weit hinten. Gleich nach der Hymne waren die Athleten, denen man die Müdigkeit nach der langen Reise ansah, in ihren Unterkünften verschwunden. Fast wie eine Schulklasse, die gerade in der Jugendherberge angekommen ist und sich um die besten Betten streitet. Fritze hatte sich gemerkt, in welches Haus Owens gegangen war. Haus Bautzen.
Sachsenstraße, so nannten sie diesen Abschnitt hier, den Abschnitt zwischen Schwimmhalle und Speisehaus, weil die amerikanischen Athletenunterkünfte allesamt die Namen sächsischer Städte trugen.
Er konnte es immer noch nicht ganz fassen: Olympische Spiele in Berlin, und er mittendrin. Er, Friedrich Thormann, Sohn einer Mutter, die ihn verstoßen, und eines Vaters, der ihn nie gekannt hatte und von dem man nicht einmal wusste, wie er hieß und ob er überhaupt noch lebte. Fritze Thormann, der die meisten Jahre seines jungen Lebens auf der Straße und in Waisenhäusern verbracht hatte. Der vor wenigen Jahren noch vor den Berliner Bahnhöfen Passanten angeschnorrt und in aufgebrochenen Laubenpieperhütten geschlafen hatte, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und nun gehörte er dazu, war mittendrin in Olympia, jedenfalls mitten im Olympischen Dorf, und trug voller Stolz die Uniform des Jugendehrendienstes: weiße Kniestrümpfe, weiße Shorts und eine weiße Jacke, auf dem Kopf ein weißes Schiffchen und auf der linken Brusttasche die olympischen Ringe.
Nur die Besten waren ausgewählt worden. Dass er mit Abstand der sportlichste seiner HJ-Schar war, hatte sicherlich geholfen, wichtiger aber waren seine Sprachkenntnisse, das Französische, das er mit Charly, das Englische, das er mit Gereon gepaukt hatte, um aufs Gymnasium gehen zu dürfen. Dafür war er ihnen dankbar, aber noch mehr, das spürte er, war er dem Führer zu Dank verpflichtet. Dafür, dass einer wie Fritze Thormann es in diesem Land überhaupt so weit bringen konnte. Vom Straßenjungen bis zum Jugendehrendienst.
Seit dem Beginn der Großen Ferien waren sie nun schon hier, und die ersten Mannschaften waren kurz danach eingezogen, doch erst seit gestern Abend, seit die grauen Wehrmachtsbusse mit den Amerikanern vorgefahren waren, hatte das Olympische Dorf seinen Namen auch verdient. Im Ehrendienst hatten sie schon seit Tagen von nichts anderem gesprochen. Ohne die Amis – mit Stars wie Jesse Owens, Glenn Hardin, Earle Meadows, Forrest Towns oder Eleanor Holm – wären die Olympischen Spiele keine richtigen Olympischen Spiele gewesen, da waren sich alle einig. Dabei hatte es lange so ausgesehen, als würden die Amerikaner gar nicht kommen. Noch vor einem Jahr hatte in den Zeitungen gestanden, dass sie die Spiele in Berlin wegen der jüdischen Greuelpropaganda in den amerikanischen Zeitungen boykottieren könnten. Doch schließlich hatte der Führer die amerikanischen Funktionäre überzeugen können, dass Deutschland ein normales Land war wie jedes andere auch und nicht das Ungeheuer, das die ausländische Lügenpresse so gerne aus ihm machte.
Fritze schaute sich um. Das Haus, in dem Jesse Owens gestern Abend verschwunden war, lag still und verschlafen vor ihm. Kein Mensch zu sehen. Er fühlte sich nicht ganz wohl in seiner Haut, denn eigentlich sollte er bei den anderen sein, beim gemeinsamen Essen, bei dem sie auch nie Ruhe hatten, weil sich immer mal wieder einer der Athleten mit einem Auftrag meldete. Heute jedoch hatte Fritze sich unerlaubt entfernt und kam sich vor wie ein Deserteur. Sein knurrender Magen aber war ein Preis, den er für ein Autogramm von Owens zu zahlen bereit war.
Er ging um das schlichte einstöckige Walmdachhaus herum. Auf der Terrasse saß niemand, die hölzernen Liegestühle waren leer, auf einem lag noch ein blaues Handtuch, sonst nichts. Fritze ging hinüber zur Terrassentür und klopfte kurz entschlossen gegen das Glas. Schon bei der ersten Berührung seiner Fingerknöchel schwang die Tür nach innen. Er zuckte zurück, dann steckte er seinen Kopf durch den Spalt und lugte hinein. Ein großer Raum, menschenleer, an der Wand prangte eine Ansicht der Stadt Bautzen, eingerahmt von Frauen in Tracht. Evangelische Wendinnen beim Kirchgang, stand darüber. Die Schlafräume lagen gleich hinter dem Gemeinschaftsraum, rechts und links des langen Gangs, der bis vorne zur Haustür reichte – die Athletenunterkünfte waren alle nach demselben Prinzip gebaut. Fritze machte einen Schritt hinein. Sollte er es wirklich wagen? An die Tür zur nächsten Schlafkammer klopfen? Nein, er kam sich schon jetzt vor wie ein Eindringling, höchste Zeit umzukehren. Er wollte durch die Terrassentür wieder hinaus, da ließ ihn eine tiefe Stimme einfrieren.
»What the heck are you doing here, boy?«
Fritze fühlte sich ertappt. Es stand ihm nicht zu, sich in den Athletenhäusern herumzutreiben, außer wenn ein Auftrag dies nötig machte. Doch er hatte keinen Auftrag, niemand hatte ihn gerufen. In der Tür zum Gemeinschaftsraum stand ein Mann, der schwärzer war als alle Neger, die Fritze jemals gesehen hatte. Er trug den blauen Trainingsanzug der amerikanischen Olympioniken mit dem rot-weißen USA-Schriftzug quer über der Brust und musterte den Eindringling mit misstrauischem Blick.
Fritze nahm Haltung an, so wie sie es beim Jugendehrendienst gelernt hatten. So wie er es schon bei der HJ gelernt hatte.
»I’m sorry, Sir, I am looking for Mister Owens …«
»Mister Owens? He ain’t here.«
Fritze räusperte sich, weil er das Gefühl hatte, seine Stimme sei ihm abhandengekommen. »Do you know where to find him?«
Der Schwarze schaute ihn an und sagte lange nichts. Eine Ewigkeit, wie es Fritze schien.
»You are kind of an errand boy, aren’t you?«
»Yes, Sir, Jugendehrendienst, Sir! At your service!«
Der Schwarze zeigte auf seine Trainingsanzugsbrust. »You are here to serve me?«
»Yes, Sir.«
Die Mundwinkel des Sportlers zogen sich in die Breite. »That’s great: White boy serves a black man! I think I like it here.«
Fritze wusste nicht, was er sagen sollte, er wusste nicht, ob der Mann sich über ihn lustig machte oder es ernst meinte.
»So how about fetching me something?«
»Sir?«
»May you get me a hamburger. And a Coke.«
Einen Hamburger? Fritze war irritiert. Meinte der vielleicht ein Frankfurter Würstchen und hatte die Städte durcheinandergebracht? Und das andere? Wollte der wirklich Kokain? Was dachten die in Amerika denn, wie es in Berlin zuging?
»I’m sorry, Sir, I’m afraid I don’t understand.«
»A burger. Never heard?«
Fritze zuckte die Achseln. »I’m sorry.«
»It’s beef in a bread roll with onions, and a slice of tomato. And I’m sure you can get Coca-Cola in our lunchroom over there. I already had one yesterday.«
»Coca-Cola, of course, Sir. And a … burger.«
»Just say you want this for Mister Albritton and they should give it to you.«
»Der Hochspringer!«
»Pardon?«
»I mean, you are David Albritton. The … the high jumper.« Gestern erst hatte Fritze den Artikel Amerikas schwarze Kämpfer im Tageblatt gelesen. Er stand vor dem Weltrekordhalter im Hochsprung.
»You know me?«
»I read about you in the newspaper.«
»So I’m already famous in Germany? Do you want an autograph, boy?«
»Sure«, sagte Fritze, obwohl er von Albritton nicht einmal ein Foto hatte. Aber vielleicht hatte der ja Autogrammkarten. Manche Sportler hatten das. Max Schmeling hatte das.
»You will get my autograph after bringing me my food. And maybe …« Er zwinkerte verschwörerisch. »… maybe Jesse will be back and give you an autograph, too.«
»That would be very kind, Sir.«
Albritton lachte. »Of course. It is. And now hurry up, I’m hungry.«
Fritze spürte eine gewisse Erleichterung, als er wieder auf der Dorfstraße stand. Der schwarze Sportler hatte ihn eingeschüchtert. Obwohl er sicher war, dass der Mann sich auch einen Spaß mit ihm erlaubt hatte. Wahrscheinlich war er es in seiner Heimat wirklich nicht gewohnt, von einem Weißen bedient zu werden. Überhaupt bedient zu werden. Fritze hatte keine Ahnung, wie so ein Sportlerleben in Amerika aussah.
Haus Berlin, das zentrale Speisehaus, lag nur wenige Schritte von den amerikanischen Unterkünften entfernt. Es sah einladend aus, hell und modern, mit großen Fenstern. Hier hatte jede Nation ihren eigenen Speisesaal mit eigener Küche. Der Saal der Amerikaner trug die Nummer zwölf und lag im Erdgeschoss, direkt am Ende der Sachsenstraße. Als Fritze die Tür öffnete, fühlte er sich längst nicht mehr so unbehaglich wie vorhin, nun hatte er eine Aufgabe. Und als Belohnung winkte ein Autogramm, vielleicht sogar zwei. Die anderen Jungen würden neidisch sein. Obwohl sie nicht offen darüber sprachen und sich unter den Augen ihrer Vorgesetzten lieber über die deutschen Medaillenhoffnungen unterhielten, waren die amerikanischen Negersportler für die meisten Kameraden im Jugendehrendienst die eigentlichen Helden.
Vor der Essensausgabe, einer ganzen Batterie von Durchreichen, die wie Postschalter aussahen, warteten drei, vier Kellner auf ihre Bestellungen. Fritze stellte sich geduldig hinten an, es war beinah wie auf dem Postamt.
»Was will denn der Jugendehrendienst hier?«, fragte der Mann hinter dem Tresen, der ganz in Weiß gekleidet war und eine Kochmütze trug. »Das hier ist unser Reich, hier serviert nur der Lloyd!«
»Mister Albritton schickt mich. Auf eine Coca-Cola und einen … Hämbörger.« Obwohl Fritze sich ein bisschen albern vorkam, sprach er das Wort genauso aus, wie er es von dem Amerikaner gehört hatte. Der Mann an der Essensausgabe schien zu wissen, was es zu bedeuten hatte.
»Steht zwar nicht auf dem Speiseplan, lässt sich aber machen«, sagte er. »Wir braten gerne auch Extrawürste. Oder -börger.« Er drehte sich um und rief die Bestellung nach hinten. Dann wandte er sich wieder dem Jungen zu. »Wird ’nen kleinen Moment dauern. Willste so lang warten? Musst nur aufpassen, dass du unseren Stewards nicht im Weg stehst.«
Fritze stellte sich ein wenig abseits an die Wand und schaute sich um. Ein gutes Dutzend langer Tafeln, akkurat in zwei Reihen aufgestellt, an den meisten saßen Männer und aßen. Weiße Männer vor weißen Tischdecken. Fritze fragte sich, wo die Negersportler sein mochten, von denen es bei den Amis doch so viele gab. Ob die alle trainierten? Und später aßen? Vielleicht durften Schwarze ja nicht zusammen mit Weißen an einem Tisch sitzen. Oder wollten es nicht.
Ein lautes Scheppern riss ihn aus seinen Gedanken. An einem der Tische musste ein Teller zu Boden gegangen sein. Ein dicker Mann im dunklen Zweireiher, der neben all den schlanken Sportlern und blauen Trainingsanzügen wie ein Fremdkörper wirkte, war aufgestanden. Es sah aus, als wolle er eine Rede halten, doch das tat er nicht. Er stand einfach da und stierte in die Ferne, als könne er dort etwas sehen, was sonst niemand sah. Die Männer ringsum schauten ihn an, als erwarteten sie eine Ansprache oder etwas in der Art, doch der dicke Mann sagte keinen Ton, er starrte lediglich mit großen Augen geradeaus. Sein Gesicht war blaurot angelaufen, mit der einen Hand krallte er sich am Tischtuch fest, mit der anderen griff er sich an die Brust, irgendwo zwischen Herz und Hals. Sein Tischnachbar, ein blonder Athlet, sprang auf und machte Anstalten, dem Dicken auf den Rücken zu klopfen, als gelte es, einen Bissen zu lösen, der dem Mann im Halse steckengeblieben war.
Doch bevor es dazu kam, erbrach sich der Unglückliche in einem großen Schwall quer über den Tisch, über Teller, Gläser, Servietten und die Trainingsanzüge der in seiner Reichweite Sitzenden, die reflexartig beiseite sprangen. Der Dicke schien davon nichts mitzubekommen, immer noch stierte er die Wand an, dann ließ er das Tischtuch los und kippte wie ein gefällter Baum nach vorne auf den besudelten Tisch, warf dabei noch ein paar Gläser und Flaschen um und blieb reglos liegen. Noch einmal klirrte es laut, als zwei, drei Gläser über die Tischkante rollten und auf dem Boden zerschellten, dann war es still wie in einer Kirche. Alle Umstehenden schauten entsetzt und ohne einen Ton zu sagen auf den leblosen, massigen Körper, der zwischen all den Schüsseln und Platten lag. Dann, mit einem Mal, fingen alle an zu tuscheln und schienen ratlos, was zu tun sei, nur der Blonde beugte sich zu dem Dicken hinab.
»Scheiße«, entfuhr es dem Steward, der neben Fritze an der Essensausgabe stand. Er stellte die Gemüseplatten, die er gerade aufgenommen hatte, wieder ab und ging so schnell er konnte zum Tisch hinüber. Fritze folgte ihm, er hatte das Gefühl, helfen zu müssen, obwohl er keine Ahnung hatte wie. Inzwischen hatten der hilfsbereite Blonde und ein anderer Athlet den leblosen Körper vom Tisch gehoben und behutsam auf den Boden gelegt, der Blonde beugte sich über den Dicken und versuchte, ihn mittels Ohrfeigen wieder wachzubekommen, doch das Gesicht, das nach der blauroten Färbung wenige Sekunden zuvor nun erschreckend bleich wirkte, blieb ohne jede Regung. Der Blonde suchte an der Halsschlagader nach dem Puls und machte ein besorgtes Gesicht, fing schließlich an, mit beiden Händen gegen den Brustkorb zu drücken, hielt dem Dicken die Nase zu und begann mit der Mund-zu-Mund-Beatmung.
»We need a doctor«, rief er, als er den Brustkorb wieder bearbeitete, »we need a fucking doctor here!«
Die Kellner, von denen inzwischen ein halbes Dutzend um den Tisch herumstanden wie die Ölgötzen, reagierten nicht, vielleicht war ihr Englisch nicht gut genug oder sie standen einfach auf der Leitung, also rannte Fritze los. Er wusste wohin, der Sanitätsdienst des Olympischen Dorfes hatte auch hier im Haus ein kleines Büro samt Behandlungszimmer. Er klopfte an die Tür und stürmte ohne abzuwarten hinein. Hinter dem Schreibtisch saß ein weißbekittelter Mann, der ihm mit hochgezogenen Augenbrauen entgegenblickte.
»Heil Hitler, Sanitätsrat, ein Notfall in Speisesaal zwölf, bitte kommen Sie schnell!«
»Heil Hitler, mein Junge. Nu mal langsam mit den jungen Pferden. Was ist denn passiert?«
»Keine Ahnung. Da ist einer zusammengebrochen, bitte machen Sie schnell. Ich glaube, der stirbt!«
Mit einem Mal kam Bewegung in den Arzt, er stand auf und folgte dem Jungen in den Speisesaal. Der Blonde im Trainingsanzug war immer noch mit Wiederbelebungsversuchen beschäftigt, doch der Dicke regte sich nicht, sein Gesicht schien eher noch bleicher geworden zu sein. Fritze hatte schon einige Leichen in seinem Leben gesehen, und noch bevor der Doktor sich niederbeugte, war er sicher, dass da nichts mehr zu machen war.
»Hilmar Schmidt«, stellte sich der Arzt vor. »I am a doctor.«
Die Umstehenden machten bereitwillig Platz, auch der blonde Ersthelfer. Alle schauten den Mann im weißen Kittel an, als sei er eine Art Zauberer und könne alles wieder gut machen. Doch Doktor Schmidt war kein Zauberer. Er fühlte den Puls, unternahm noch einige Wiederbelebungsversuche, die Fritze allerdings eher halbherzig erschienen, dann schaute er zu den Männern auf, die um ihn herumstanden.
»I am very sorry. But this man can’t be helped, he is dead. I’m afraid he had a heart attack.«
Die Sportler schauten betroffen zu Boden oder unterhielten sich flüsternd, die Stewards schienen nicht so recht zu wissen, ob sie weiter servieren sollten oder ob das pietätlos war. Einer fing schließlich an, die Scherben aufzufegen, ein anderer räumte das vollgekotzte Geschirr ab, Teller, Schüsseln, Flaschen, Gläser und was sonst noch so auf dem Tisch stand. Als alles abgeräumt war, ersetzten zwei Stewards die schmutzige Tischdecke durch eine blütenweiße neue. Alles sah wieder picobello aus, einzig der tote Mann störte das makellose Bild. Die ersten Sportler verließen den Saal. Tuschelnd, achselzuckend. Andere standen ratlos um die Leiche herum.
Auch Fritze kam sich überflüssig vor, er ging zur Essensausgabe. Er wusste nicht, ob die in der Küche etwas von dem Zwischenfall mitbekommen hatten, die Arbeit jedenfalls hatten sie nicht eingestellt: In der Durchreiche stand eine große braune Papiertüte, daneben eine kleine Flasche mit einer braunen Flüssigkeit. Fritze nahm beides an sich. Die Tüte war warm, die Flasche eiskalt.
Er machte sich auf den Weg zum Ausgang, da rief ihn eine Stimme zurück.
»Hey, Junge! Einen Moment noch!«
Es war der Doktor, der sich ihm mit flatterndem Kittel näherte. Es wirkte, als müsse er sich um einen weiteren Notfall kümmern, doch legte er Fritze lediglich die Hand auf die Schulter.
»Einen Moment, Junge«, sagte er. »Ich muss noch kurz mit dir reden.«
»Mit Verlaub, Sanitätsrat, ich habe einen Botengang auszuführen. Das Essen wird kalt.«
»Keine Sorge, es dauert nicht lange.« Der Doktor räusperte sich. »Es war gut, dass du mich sofort geholt hast. Nicht deine Schuld, dass da nichts mehr zu machen war, das geht manchmal ganz schnell.«
»Jawohl, Sanitätsrat.«
»Ich bin Oberarzt, kein Sanitätsrat.«
»Jawohl, Oberarzt!«
»Doktor reicht. Wie heißt du denn, Junge?«
»Thormann, Friedrich, Oberrottenführer der Hitlerjugend, für die Zeit der Olympischen Spiele zum Jugendehrendienst abkommandiert.«
»Soso, Oberrottenführer Thormann, hast du denn mitbekommen, was da drüben passiert ist?«
»Jawohl. Der Herr hat sich an die Brust gefasst, ist blau angelaufen, hat sich übergeben und ist dann umgekippt.«
»Hört sich nach einem Herzanfall an.«
»Das wissen Sie doch schon. Haben Sie doch eben allen gesagt.«
»Oh, du kannst Englisch.«
»Of course.«
»Nun, Oberrottenführer Thormann, so eine Diagnose ist immer nur vorläufig. Erst die Obduktion bringt Gewissheit. Aber die Menschen erwarten von einem Arzt natürlich, dass man ihnen etwas sagt. Gerade in so einer Situation.«
Fritze nickte. »Verstehe.«
»Eigentlich rechnet man als Mediziner im Olympischen Dorf mit anderen Einsätzen. Mit Sportverletzungen und dergleichen.« Der Oberarzt schüttelte den Kopf. »Aber eigentlich sollen herzkranke Funktionäre auch nicht bei den Athleten essen.«
Fritze nickte noch einmal und wollte sich auf den Weg machen, doch der Doktor hielt ihn zurück. »Einen Moment noch, Thormann«, sagte er und schaute ihn mit ernsten Augen an. »Du bist dir doch darüber im Klaren, dass du niemandem erzählen darfst, was du gerade gesehen hast?«
Fritze schaute den Oberarzt verwundert an.
»Was hier geschehen ist«, fuhr der fort, »ist bedauerlich, aber nicht zu ändern. Ein Unglück, wie es jederzeit überall auf der Welt passieren kann. Vermutlich waren die Strapazen der langen Reise letzten Endes zuviel für den armen Mann. Aber das darf keinen Schatten auf das Olympische Dorf werfen, das verstehst du doch, oder? Hätte der Mann sein Mittagessen mit den anderen Funktionären eingenommen, wäre er im Adlon oder im Esplanade gestorben und nicht hier.«
Fritze nickte, obwohl er sich nicht ganz sicher war, ob er verstand.
»Also hör gut zu: Ich werde den zuständigen Stellen Bericht erstatten und die Todesursache untersuchen lassen. Aber du erzählst niemandem davon, nicht deinen Kameraden, nicht deinen Freunden, nicht einmal deinen Vorgesetzten, auch nicht deinen Eltern. Hast du das verstanden, Oberrottenführer Thormann? Niemandem!«
»Ja … Jawohl, Oberarzt!« Fritzes Antwort kam zögerlicher, als er beabsichtigt hatte.
»Ehrenwort?«
»Ehrenwort.«
Endlich ließ der Doktor seine Schulter los und ging wieder zurück zu dem toten dicken Mann. Fritze öffnete die gläserne Tür mit den Ellenbogen und trat hinaus an die frische Luft, in der Linken die warme Papiertüte, in der Rechten die kalte Colaflasche. Ob er für seinen Botengang ein Autogramm bekommen würde, vielleicht sogar zwei, das war ihm mit einem Mal herzlich egal.
2
Nichts hier hatte sich verändert, alles war wie eh und je: dreckig und dreieckig. Als sei die winzige Gaststätte zwischen den drei holzvertäfelten Wänden aus Zeit und Raum gefallen und hätte nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, was vor ihrer Tür geschah. Das Nasse Dreieck war ein Zufluchtsort, dem die irren Kapriolen, die die Welt draußen schlug, nichts anhaben konnten: Ganz gleich, was dort geschah, das Dreieck würde bleiben, wie es war. So gesehen also genau der richtige Platz für einen wie ihn.
Und dennoch fühlte es sich falsch an. Rath saß an dem dunkelhölzernen Tresen neben Reinhold Gräf, wie sie schon vor Jahren dort gesessen hatten, und schaute Schorsch beim Bierzapfen zu. Sie hatten noch kein Wort gesprochen, nicht einmal eine Bestellung aufgegeben, aber das war im Dreieck auch nicht nötig. Der Wirt war schon dabei, zwei Mollen und zwei Kurze fertig zu machen. Er kannte seine Gäste.
Früher hatten Rath und Gräf regelmäßig hier verkehrt, früher, als sie noch Kollegen, Partner und Freunde in Ernst Gennats Mordinspektion am Alex gewesen waren. Doch dann hatte ihre Freundschaft einen Knacks bekommen, aus Gründen, über die Rath nicht gerne nachdachte.
Schorsch stellte zwei Biergläser und zwei Stumpen auf das abgewetzte, glänzende Holz des Tresens. Rath und Gräf kippten den Kornbrand hinunter, in einer wie einstudiert wirkenden Gleichzeitigkeit, doch war es lediglich ein Hunderte Male zelebriertes Ritual. Die Schnapsgläser in einem Zug geleert und zurück auf den Tresen gestellt, dann die Biergläser, zwei, drei große Schlucke. Dann Schweigen. Genau wie früher. Nur hatte das Schweigen früher nicht so bleiern und unangenehm im Raum gestanden.
Rath fummelte eine Overstolz aus seinem Zigarettenetui und zündete sie an. Er nahm zwei tiefe Züge, ehe er das erste Wort sprach.
»Eigentlich dachte ich, wir wären durch damit«, sagte er und schaute den Rauchkringeln hinterher.
»Durch womit?«
»Na, mit dem hier.« Rath zeigte mit seiner Zigarettenhand im Raum umher und hinterließ eine sich verwirbelnde weißblaue Rauchfahne, die sich langsam im allgemeinen Kneipendunst auflöste. »Mit diesen Treffen. Ich dachte, meine Arbeit für euch hätte sich erledigt.«
»Vielleicht solltest du nicht so viel denken, Gereon.«
»Himmler ist seit sechs Wochen Polizeichef, der SD hat sein Ziel erreicht, was braucht ihr da noch Informationen aus dem LKA?«
Gräf schaute auf sein Bierglas und tat, als sei Rath gar nicht im Raum. »Wann wir deine Mitwirkung brauchen und wann nicht«, sagte er, »das sind Dinge, über die nicht du dir Gedanken machen musst.«
»Verstehen würde ich’s trotzdem gern. Die SS hat dank Himmlers neuem Posten doch jetzt sowieso überall ihre Finger drin. Heydrich bläst die Pfeife, nach der Nebe tanzen muss. Nach der wir alle tanzen müssen.«
»Eben. Auch du, mein lieber Gereon.« Zum ersten Mal an diesem Abend schaute Gräf ihn an. »Du bist inoffizieller Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS, und als solcher ist es deine Pflicht, deinem Führungsoffizier nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft zu erteilen, wann immer er das verlangt.«
Führungsoffizier. Wie Rath es hasste, wenn Gräf dieses Wort benutzte. Seit einem Jahr ungefähr war der einstige Gestapo-Kommissar als Untersturmführer im Sicherheitsdienst des Reichsführers SS beschäftigt.
»Was willst du, ich bin doch hier. Auch wenn dein Anruf aus heiterem Himmel kam – nach sechs Wochen Funkstille – und du mir den Abend versaut hast. Mir und Charly. Es ist Samstag, verdammt nochmal!«
»Hör auf zu jammern. Mir hat man auch den Abend versaut. So ist das eben in unserem Beruf.«
»Ich glaube nicht, dass wir beide denselben Beruf haben«, sagte Rath. »Ich bin immer noch Polizist.«
»Das mag sein. Aber für mich bist du in erster Linie ein mir zugeteilter Mitarbeiter des SD.«
»Ein bisschen mehr Absprache wäre trotzdem sinnvoll. Das Problem an solch einem Treffen aus heiterem Himmel ist ja nicht nur, dass meine Frau stinksauer ist, sondern auch, dass es witzlos ist: Ich bin völlig unvorbereitet und habe so gut wie keine Informationen, die interessant für euch wären.«
»Als ob das etwas Neues wäre! Aber darum geht es heute auch nicht.«
»Ach was? Wolltest du nur ein Bierchen mit mir trinken?«
»Es gibt keinen Grund, sarkastisch zu werden. Aber wir sind heute tatsächlich nicht zum Reden hier, wir haben noch etwas vor.« Gräf kippte den Rest seines Bieres hinunter. »Trink aus, Gereon«, sagte er. »Wir müssen los.«
»Wie?«
»Ein kleiner Ausflug.«
»Und wohin geht’s?«
»Du wirst sehen.«
Rath drückte seine Zigarette aus, obwohl sie erst halb geraucht war, doch an irgendetwas musste er seine Wut auslassen. Das alles klang nach einem völlig verkorksten Abend.
»Aber du zahlst«, sagte er.
»Es geht hier um die Staatssicherheit«, sagte Gräf und legte ein paar Münzen auf den Tresen. »Da muss ein Beamter der Sicherheitspolizei auch mal eine Ehekrise in Kauf nehmen. Über allem stehen Volk und Reich!«
»Und ganz oben steht der Führer …«, knurrte Rath. »Da bin ich aber wirklich gespannt, was du zu bieten hast. Das muss schon etwas Gewaltiges sein, dass du so geheimnisvoll tust. Will jemand dem ollen Adolf ans Leder?«
»Du solltest nicht so daherreden. Wenn das jemand Falsches zu Ohren bekommt, kann das übel enden. Dann kann auch ich nichts mehr für dich tun.«
»Es bekommt aber niemand Falsches zu hören. Nur du. Und du bist doch mein Freund, oder?«
»Ich sage ja nur: Überspann den Bogen nicht«, sagte Gräf. Raths Frage beantwortete er nicht.
Ihre Freundschaft, die es tatsächlich einmal gegeben hatte, spielten sie sich nur noch vor; seit Monaten taten sie das, wenn nicht seit Jahren. Vielleicht konnte Rath es deshalb nicht lassen, diese angebliche und vor langer Zeit einmal doch sehr reale Freundschaft ab und an anzusprechen. Und auszuloten.
Er rutschte vom Barhocker und griff nach Hut und Autoschlüsseln.
»Gut, dann lass uns fahren.«
»Steck die Schlüssel ein«, sagte Gräf. »Wir nehmen meinen Wagen.«
»Du musst mich nicht mitnehmen, ich fahre lieber selber.«
»Egal. Du fährst mit mir.«
»Du musst mir nur sagen, wo’s hingeht, dann …«
»Schluss jetzt, du fährst mit mir. Das ist ein Befehl!«
Gräfs Stimme klang ungewohnt scharf. Rath hatte eine Antwort auf den Lippen, aber er schluckte sie hinunter. Wortlos folgte er Gräf durch die Tür nach draußen. Das ist ein Befehl! Es war das erste Mal, dass Gräf so etwas zu ihm sagte, und obwohl diese vier Worte eigentlich nur die Dinge beschrieben, wie sie wirklich lagen, hätte Rath am liebsten gemeutert. Doch er würgte die Wut, die in ihm hochsteigen wollte, wieder hinunter und stieg in den schwarzen Audi, der vor dem Dreieck parkte. Nagelneues Modell. Die SS ließ sich in Sachen Dienstwagen nicht lumpen.
Die Fahrt ging in Richtung Westen, erst den Landwehrkanal entlang und am Halleschen Tor dann in die Saarlandstraße. Die meisten Häuser zeigten sich im Fahnenschmuck, auch das Hotel Excelsior gegenüber dem Anhalter Bahnhof, in dem Rath vor sieben Jahren seine ersten Berliner Nächte verbracht hatte. Seither hatte die Straße ihren Namen schon dreimal geändert: von Königgrätzer Straße in Stresemannstraße, dann ab dreiunddreißig wieder Königgrätzer, weil Stresemann bei den Nazis verpönt war, und seit einem Jahr nun also Saarlandstraße. Weil sich die Saarländer mit so großer Mehrheit für den Anschluss ans Reich entschieden hatten.
Man erzählte sich, dass das Excelsior einmal Adolf Hitler persönlich des Hauses verwiesen haben sollte, doch blähten sich jetzt auch hier die Hakenkreuzfahnen im Wind, im steten Wechsel mit den weißen Olympiafahnen. Selbst Mendelsohns modernes Columbushaus am Potsdamer Platz, Zeuge einer vergangenen Zeit, musste Hakenkreuzfahnen an seiner Fassade dulden.
An der ausgebrannten Reichstagsruine bog Gräf auf die Charlottenburger Chaussee, die mitten durch den Tiergarten führte, und hier wurde es noch schlimmer, hier hatte die öffentliche Hand geflaggt. Die Chaussee war Teil der sogenannten Via triumphalis, die vom Stadtschloss über die Linden und den Tiergarten bis zum Reichssportfeld reichte. Sie passierten das Charlottenburger Tor, und mit jedem Meter, den sie weiter Richtung Westen fuhren, wuchs Raths Wut. Warum bestellte Gräf ihn erst nach Kreuzberg, wenn es doch wieder in den Westen ging?
»Jetzt frage ich mich wirklich, warum ich nicht meinen eigenen Wagen nehmen konnte. Wo wir doch fast an meiner Haustür vorbeifahren. Ist das Schikane, oder was?«
Gräf zuckte die Achseln. »Ich habe meine Anweisungen.«
»Und die wären? Mir den Abend zu verderben?«
»Dich persönlich zu unserem Zielort zu bringen.«
»Und wo zum Teufel liegt der?«
Gräf sagte nichts und bog am Knie rechts ab. Zur Carmerstraße, wo Charly auf ihn wartete, wäre es nach links gegangen. Rath zündete sich vor Wut eine Overstolz an. Den Rest der Fahrt schwieg er. Auch von Gräf kam kein Ton, dessen Gesicht war ausdruckslos auf den Verkehr gerichtet. Sie passierten das Charlottenburger Rathaus und das Schloss, und dann erhob sich auf der rechten Straßenseite, gleich hinter der S-Bahn-Brücke, eine von kleinen Türmchen gekrönte Dächerlandschaft. Das Krankenhaus Westend. Sie waren am Ziel. Gräf parkte vor dem Haupteingang.
»Ein Krankenbesuch?« Rath stieg aus und schnippte seine Zigarette auf die Straße. »Und wir haben nicht mal Blumen dabei …«
Gräf schloss den Wagen ab und ging wortlos voran. Nicht in den Bettentrakt, sondern hinab in die Katakomben des Krankenhauses, vorbei an mehreren Wachtposten, die Gräf alle zu kennen schienen und sie mit einem Kopfnicken passieren ließen, in einen dunklen, gefliesten Raum, an dessen Längswand vier mit Leinentüchern abgedeckte Rollbahren standen. In der Mitte des Raumes, rings um eine weitere Bahre, auf der sich der behaarte bleiche Bauch eines toten Mannes wölbte, standen zwei Ärzte in weißen Kitteln und ein Mann in schwarzer Uniform.
Gräf blieb an der Tür stehen und nahm Haltung an.
»Heil Hitler, Obersturmbannführer!«, sagte er und ließ den rechten Arm nach oben schnellen. Rath winkelte seine Rechte an und nuschelte sein »Hei’itler«. Mehr bekamen sie von ihm nicht, auch nicht die SS.
Der rechte Uniformärmel des Obersturmbannführers hing schlaff und akkurat gefaltet herab, den muskulösen linken, der sich nun zum Deutschen Gruß erhob, umspannte die rote Hakenkreuzbinde. Sebastian Tornow sah aus wie immer: wie aus dem Ei gepellt.
»Heil Hitler, Untersturmführer«, sagte Tornow, »da sind Sie ja endlich!« Seine Miene war ernst. Er ignorierte Rath, als sei der gar nicht im Raum, und wandte sich den beiden Ärzten zu. »Die Kriminalpolizei ist da, wir können loslegen. Bevor wir beginnen, möchte ich die Herren jedoch darauf aufmerksam machen, dass alles, was in diesem Raum heute zu sehen und zu hören war und ist und sein wird, selbstverständlich striktester Geheimhaltung unterliegt.« Tornow räusperte sich. »Oberführer Grawitz, dann klären Sie den Oberkommissar doch bitte kurz auf.«
»Gern, Obersturmbannführer«, sagte der ältere der beiden Mediziner, der seinen Schnurrbart trug wie Adolf Hitler. Was eher lächerlich wirkte, wie Rath fand. Anbiedernd. Aber vielleicht verehrte Oberführer Grawitz ja auch nur Charlie Chaplin. Oberführer, das war schon ein hohes Tier in der SS. Ein, zwei Dienstränge höher als Sebastian Tornow selbst. Trotzdem wirkte es so, als habe Tornow in diesem Raum das Sagen.
Der SS-Mann im Arztkittel nickte dem Obersturmbannführer zu und wies auf den dickbäuchigen Toten auf der Bahre.
»Diese männliche Leiche wurde uns heute aus dem Olympischen Dorf zur Obduktion gebracht. Es handelt sich um den amerikanischen Staatsbürger Walter Morgan. Morgan sitzt … saß im Vorstand der Amateur Athletic Union und war in dieser Funktion Mitglied der US-Olympia-Delegation. Heute hat er im Anschluss an einen Besuch des Olympischen Dorfes zusammen mit einigen Sportlern seines Landes im Speisesaal zwölf des Zentralen Speisehauses zu Mittag gegessen. Noch während des Mittagsmahls ist Morgan plötzlich zusammengebrochen; sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen blieben wirkungslos. Kollege Schmidt …« – Grawitz deutete auf den zweiten Weißkittel – »… attestierte vor Ort Herzversagen als Todesursache und …«
»Danke, Oberführer!«, unterbrach Tornow. »Ich denke, es ist nicht nötig, dass Sie sich in Einzelheiten verlieren, die werde ich mit dem Oberkommissar noch erörtern. Uns reicht der medizinische Befund. Wir wollen nicht zuviel Ihrer wertvollen Zeit stehlen.«
Grawitz schaute pikiert, gleichwohl machte er keinerlei Anstalten zu widersprechen. Tornow mochte einen niedrigeren Dienstrang haben. Aber er kam vom SD.
»Gewiss, Obersturmbannführer, das ist schnell erklärt. Die Todesursache ist keine natürliche, wie zunächst angenommen. Wir haben im Blut des Toten Digitalis in immens hoher Konzentration feststellen können, eine Dosierung, die mit Sicherheit als letal anzusehen ist. Im Mageninhalt des Toten – Rindfleisch, Kartoffeln und Gemüse – fanden sich ebenfalls Spuren von Digitalis. Es ist davon auszugehen, dass dem Mann mehrere Milligramm des Giftes verabreicht wurden. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es ihm ins Essen gerührt worden.«
»Vielen Dank, Oberführer«, sagte Tornow. »Vielen Dank auch an Sie, Doktor Schmidt. Sie können wieder an Ihre Arbeit gehen. Untersturmführer, Sie können im Wagen warten.«
Keiner der Männer widersprach, auch nicht der SS-Oberführer, in dessen Krankenhaus sie sich befanden. Sie nickten devot und verließen den Obduktionssaal so leise und dezent, als seien sie aus Versehen in ein fremdes Schlafzimmer geplatzt. Fehlte nur, dass sie eine Entschuldigung murmelten.
Die Tür schlug zu, und dann waren sie allein, SS-Obersturmbannführer Sebastian Tornow und Kriminaloberkommissar Gereon Rath. Allein mit dem Leichnam eines amerikanischen Sportfunktionärs. Und zum ersten Mal, seit Rath den Raum betreten hatte, schaute Tornow ihn an. Und sprach ihn an.
»Na, was sagst du dazu, Gereon?«
Rath mochte es nicht, wenn Tornow ihn duzte. Als habe ihre Freundschaft immer noch Bestand. Dabei wusste er, dass der Mann ihn bis aufs Blut hasste. Nicht nur, weil er ihm die Schuld am Verlust seines rechten Arms gab.
»Was sage ich wozu, Obersturmbannführer?«
»Na, zu dieser Sauerei hier.« Tornow zeigte auf die Leiche. »Ein toter Amerikaner im Olympischen Dorf. Vergiftet.«
»Nun, ich würde sagen, Obersturmbannführer, Sie haben den falschen Beamten kommen lassen. Das LKA ist nicht zuständig. Das ist ein Fall für Ernst Gennat und die Mordinspektion.«
»Ist das dein Ernst? Das Mordauto im Olympischen Dorf? Da können wir ja gleich eine Pressekonferenz einberufen. Doktor Schmidt war glücklicherweise so geistesgegenwärtig und hat im Beisein von Zeugen noch im Speisesaal Herzversagen als Todesursache attestiert. Und das bleibt auch unsere offizielle Darstellung: Ein US-Funktionär, der einige Schwimmsportler seiner Mannschaft im Olympischen Dorf besucht und gemeinsam mit ihnen zu Mittag gegessen hat, ist tragischerweise einem Herzanfall erlegen. Unser Mister Morgan hier war bekanntermaßen herzkrank, also ist das keine allzu große Überraschung.«
»Dann ist ja alles in bester Ordnung, Oberstummbannführer.«
»Ist es eben nicht.« Tornows Augen funkelten wütend. Schien ordentlich unter Druck zu stehen, der Mann. »Wir müssen wissen, was passiert ist. Den Täter stellen. Damit er nicht noch weiteren Schaden anrichtet.«
»Wie meinen Sie das?«
»Das liegt doch auf der Hand. Da sind Feinde der nationalsozialistischen Regierung am Werk, die uns die Spiele neiden und sie mit allen Mitteln sabotieren. Wer weiß, was sie als nächstes planen?«
»Ein Mord, nur um die Olympischen Spiele zu sabotieren? Ist das nicht ein bisschen übertrieben?«
»Unseren Feinden ist jedes Mittel recht, unser Land zu diskreditieren, ganz gleich ob Kommunisten, Juden oder Plutokraten …«
Rath fragte sich, ob Tornow immer schon so misstrauisch gewesen war oder ob das erst die Arbeit für den Sicherheitsdienst bewirkt hatte. Ob SD oder Gestapo: Geheimpolizisten sahen überall Verschwörer am Werk, das lag wohl in der Natur ihrer Tätigkeit.
»Und das«, fuhr Tornow fort, »müssen wir verhindern. Es gilt, die Hintergründe dieses Giftmordes aufzuklären und der Schuldigen habhaft zu werden, bevor sie noch einmal zuschlagen können. Und dabei dürfen wir keinerlei Aufsehen erregen. Niemand darf auch nur mutmaßen, im Olympischen Dorf könne ein Mord geschehen sein.«
Da hatte er wohl recht, dachte Rath. Ein Giftmord in der Küche des Olympischen Dorfes war nichts, was an die Öffentlichkeit dringen durfte. Dann hätte man die Spiele gleich abblasen können, und die Stimmen im Ausland, allen voran in den USA, die die Berliner Spiele am liebsten boykottiert hätten, die hätten am Ende doch noch gewonnen. Was Rath nicht bedauert hätte, er machte sich nicht viel aus dem Spektakel.
»Und was habe ich damit zu tun?«, fragte er.
»Du bist wirklich schwer von Begriff, was? Du wirst die Ermittlungen übernehmen und mir den Schuldigen bringen, bevor er noch mehr Unheil anrichtet.«
»Mit Verlaub, Obersturmbannführer, aber ich habe derzeit andere Aufgaben. Mein Dienstherr ist das preußische Landeskriminalamt, mein Chef heißt Arthur Nebe.«
»Das ist alles geregelt, mit Nebe habe ich bereits gesprochen.«
Tornow zog ein paar Papiere aus seiner Aktentasche, die neben einem kleinen Tisch voller Metallschalen und Instrumente an der Wand stand, und legte sie auf den weißen Bauch der Leiche.
»Was ist das?«
»Das hier ist die Verfügung über deine vorübergehende Versetzung zur Kriminalpolizeiwache Elstal, von Nebe bereits unterzeichnet.«
»Elstal hat eine Kriminalwache?«
»Vorübergehend. Die Kriminalwache im Olympischen Dorf. Ab sofort verstärkst du die Kollegen, die wir dort stationiert haben. Melde dich morgen um acht im Empfangsgebäude. Kurz hinter der Stadtgrenze, direkt an der Chaussee nach Hamburg.«
Rath konnte es nicht ausstehen, wenn die SS im Zusammenhang mit der Kriminalpolizei von Kollegen sprach. Das Schlimme war nur, dass es stimmte. Seit Heinrich Himmler Polizeichef war, entsprach das genau den Tatsachen. Nur wenige Tage nach seiner Amtseinführung hatte der SS-Chef die gesamte deutsche Polizei neu organisiert: Kriminalpolizei und Geheime Staatspolizei waren nun im Hauptamt Sicherheitspolizei zusammengefasst, das Reinhard Heydrich leitete, Himmlers Adlatus in Berlin. Auch Raths Vorgesetzter Arthur Nebe war SS-Mitglied, kein Wunder, dass der spurte, wenn der SD anfragte. Raths alter Chef Ernst Gennat hätte keinen seiner Kommissare einfach so an die SS ausgeliehen.
Rath räusperte sich. »Ich werde also in die Kriminalwache Elstal versetzt«, sagte er. »Und was soll ich dort tun?«
»Offiziell hilfst du den Kollegen, passt auf, dass keinem Sportler die Armbanduhr gestohlen wird oder was die Kripo dort sonst so tut. Deine eigentliche Aufgabe aber ist es herauszufinden, wer hinter diesem Giftmord steckt. Ohne dass jemand merkt, dass du in dieser Richtung ermittelst. Ein Todesfall in der amerikanischen Olympiadelegation ist schlimm genug, aber das lässt sich regeln. Doch darf nie auch nur der leiseste Verdacht aufkommen, dass es sich dabei um einen Mord handeln könnte.«
»Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen, Obersturmbannführer.«
»Wie du das anstellst, ist mir herzlich egal. Weitere Morde oder Sabotageakte müssen um jeden Preis verhindert, die Verantwortlichen für diese feige Tat so schnell wie möglich unschädlich gemacht werden. Es geht um Deutschlands Ruf in der Welt; ich hoffe, dir ist der Ernst der Lage bewusst.«
3
Was für ein Mistwetter. Es war gespenstisch, die Dorfaue verschwand im dichten Nebel, das Olympische Dorf wirkte wie eine Geisterstadt. Hätte Fritze nicht gewusst, wieviele Menschen hier lebten, er hätte denken können, Schröder und er seien die Einzigen auf dem Gelände.
Die Athleten waren noch nicht auf den Beinen, jedenfalls noch nicht vor der Tür. Kein Wunder: Sonntagmorgen, kurz nach halb sechs, so früh standen nicht einmal die Japaner auf. Aber zwei Jugendehrendienstler, denen man eine Strafarbeit aufgebrummt hatte. Rönnberg, ihr Stubenältester, hatte sie noch vor dem Frühstück aufs Gelände gejagt. Fritze, weil er sich gestern ohne Abmeldung von der Truppe entfernt hatte, und Schröder, den Witzbold vom Dienst, der immer wieder mit Albernheiten auffiel, wegen einer dieser Albernheiten. Die beiden Jungen gingen die Wege ab und sammelten, ausgerüstet mit Blecheimern und Papierpickern, Unrat und Abfälle ein.
Sie hatten sich schon bis zur Unteren Dorfaue vorgearbeitet, da blieb Schröder plötzlich stehen und stellte seinen Blecheimer ab. »Pass mal auf«, sagte er, nahm Anlauf und schleuderte den hölzernen Papierpicker mit der metallenen Spitze wie einen Speer durch die Luft. Ein paar Meter weiter landete das Ding auf dem Rasen, der Kamerad riss die Arme hoch und jubelte.
»Neuer Weltrekord für Gerhard Stöck!«, rief er und drehte sich im Kreis. »Stöck, Stöck, Stöck! Wirf über siebzig Meter weg!«
Fritze musste lachen. Doch dann wurde ihm bewusst, welchen Blödsinn sie hier machten, statt ihre Pflicht zu erfüllen, und er hielt sich den Mund zu. Er lief auf den Rasen, zog den Picker aus dem Boden und brachte ihn Schröder zurück, der immer noch jubelnd auf dem asphaltierten Weg herumhüpfte.
»Los, lass uns weitermachen«, sagte er, »bevor noch jemand sieht, dass wir Blödsinn machen statt zu arbeiten.«
Schröder, der von der HJ Potsdam zum Jugendehrendienst gekommen war und dessen Vater angeblich in der dortigen Gauleitung arbeitete, hielt in seinem Gehüpfe inne und schaute Fritze an, eine Spur Verachtung im Blick.
»Was bissen du für’n Spießer?«
»Ich bin ein deutscher Junge, der seine Pflicht erfüllt«, sagte Fritze und kam sich vor wie sein eigener Großvater. Eigentlich hielt er sich für alles andere als spießig und verbissen, aber in diesem Fall hatte er tatsächlich Angst. Hauptmann Fürstner verstand keinen Spaß, wenn Jugendehrendienstler ihre Aufgabe nicht ernst nahmen. Einen von ihnen hatte es schon erwischt: Borchert, ein Großmaul aus der Uckermark. Ihn hatte Fürstner ohne viel Federlesens wieder nach Hause geschickt, nachdem man den Idioten dabei erwischt hatte, wie er Waschpulver in die Filteranlage des Schwimmbads schütten wollte.
Gut, das, was Schröder gemacht hatte, war dagegen vergleichsweise harmlos, aber auch Borchert hatte nur einen Streich spielen wollen, und womöglich reichte ein Speerwurf, der ein Loch in den gepflegten Dorfrasen bohrte, ebenfalls für einen Verweis und die Verbannung aus dem Dorf – zumal, wenn man, wie Schröder und er, sowieso schon einen Strafdienst aufgebrummt bekommen hatte. Und wenn Fritze eines nicht wollte, dann war es, aus dem Jugendehrendienst geworfen zu werden und zurück zu den Rademanns zu gehen. Auch wenn die neue Wohnung in der Lothringer Straße, nahe der Reichsjugendführung, wo Herr Rademann jetzt arbeitete, größer und schöner war als die alte. Noch mehr Angst hatte Fritze davor, dass Wilhelm Rademann, der nicht nur sein Pflegevater war, sondern auch sein HJ-Führer, ihn vor lauter Enttäuschung zurück ins Heim schicken könnte. Und dass er nie mehr in ein Waisenhaus gehen würde, das stand für Friedrich Thormann fest, ein für allemal, eher würde er sterben, das hatte er sich geschworen.
Schröder wusste von alldem nichts. Sollte er auch nicht. Der Kamerad nahm seinen Papierpicker und warf Fritze einen misstrauischen Blick zu. Fragte sich wohl, was er von so einem Kameraden halten solle, von so einem Langweiler, der zum Lachen in den Keller ging. Der einen vielleicht sogar verpfiff. Das würde Fritze natürlich niemals tun, aber das wusste Schröder nicht, sie kannten sich ja kaum. Wortlos setzten die beiden Jungen ihre Arbeit fort und füllten die Blecheimer mit Unrat. Nach einer Weile brach Schröder das Schweigen. Versuchte, gut Wetter zu machen.
»Das hätten unsere Ollen sich auch nicht träumen lassen, was?«, sagte er.
»Was?«, fragte Fritze, schärfer als beabsichtigt.
Jedesmal, wenn das Thema Eltern in ihrer Runde auftauchte, machte ihn das nervös. Was wussten die Kameraden? Ahnten sie, dass Wilhelm Rademann nicht sein richtiger Vater war? Wussten es vielleicht sogar?
»Na, dass wir hier unser Dasein als Straßenkehrer fristen müssen. Wenn mein Oller mich so sehen würde! Kolossal!«
In Schröders Gesicht machte sich ein Grinsen breit, die Vorstellung schien ihn zu amüsieren. Soweit Fritze wusste, war dessen Vater Rechtsanwalt. Schröder spießte ein Stück Butterbrotpapier auf, das am Wegesrand lag, und hielt es Fritze unter die Nase.
»Kiek mal, ick kann ooch spießig sein!«
Der Kamerad brach in schallendes Gelächter aus und ließ das Papier in seinen Eimer plumpsen.
»Du müsstest mal dein Gesicht sehen«, sagte er. »Wie du jekiekt hast, bis der Groschen endlich gefallen ist.«
Fritze grinste um des lieben Friedens willen mit. Der Kamerad schien ein Clown zu sein. Und keine zehn Sekunden den Mund halten zu können.
Während sie den Birkenring, den zentralen Platz des Dorfes, nach Abfällen absuchten, begann Schröder das nächste Gespräch.
»Sag mal, du warst dabei, erzählt man sich?«
»Was erzählt man sich?«
»Na, der dicke Ami. Du hast gesehen, wie er krepiert ist, oder?«
Fritze stockte. Schröder stierte ihn neugierig an. Wollte offensichtlich eine spannende Geschichte hören. Nur dass Fritze die nicht erzählen konnte. Dass er eigentlich überhaupt nichts erzählen konnte, wenn er an die Worte von Doktor Schmidt dachte.
Aber dass etwas passiert war, wusste Schröder natürlich, das wussten alle Kameraden vom Jugendehrendienst, das wusste jeder im Dorf. Doch niemand wusste etwas Genaues.
»Ich weiß auch nicht mehr als du.«
»Du warst doch bei den Amis. Als es passiert ist. Hat Rönnberg erzählt. Der kennt einen von den Kellnern.«
Prima, dachte Fritze, du wirst zu Stillschweigen verpflichtet, und die Stewards des Norddeutschen Lloyd tratschen wie die Waschweiber. Die hätte Doktor Schmidt sich mal zur Brust nehmen sollen.
»Welcher Kellner?«
»Spielt doch keine Rolle. Aber er hat dich gesehen.«
»Kann sein.« Fritze zuckte mit den Achseln. »Ich war im Speisehaus, ja. Hab eine Besorgung gemacht für Dave Albritton.«
»Ist das nicht ein Neger?«
»Isser. Und der Kumpel von Jesse Owens.« Fritze überlegte einen Augenblick, ob er Schröder von seinem Autogramm erzählen sollte, ließ es dann aber bleiben. »Jedenfalls war alles ruhig, als ich da war. Muss später passiert sein.«
Schröder schaute ihn an, als glaube er ihm nicht. Vielleicht war es auch nur die Enttäuschung. All seine Kameraden, da war Fritze sicher, hätten sonstwas darum gegeben, so eine Geschichte erzählen zu können. Dass jemand etwas erlebt hatte und es nicht erzählte, war für einen wie Schröder kaum vorstellbar.
»Schade«, sagte er. »Hatte gehofft, du hättest mir erzählen können, wie er krepiert ist. Würde so was gerne mal sehen.«
»Du würdest gerne einen sterben sehen?«
»Sicher.« Schröder grinste. »Hart wie Kruppstahl, oder? Das ist die deutsche Jugend!«
»Hast du denn schon mal jemanden sterben sehen?«
»Eben nicht. Als wir geboren wurden, war der Krieg ja schon vorbei.«
Schröder klang, als würde er das bedauern.
»In Spanien kämpfen sie«, sagte Fritze, »da ist jetzt wieder Krieg.«
»Ja, hab gehört, sind bald auch Deutsche dabei. Der Führer will Wehrmachtssoldaten hinschicken, damit die den kommunistischen Greueln Einhalt gebieten. Und die Deutschen im Land vor den Roten schützen.«
»Wenn du unbedingt Leute sterben sehen willst, dann geh doch dahin.«
»Na klar! Weil die auch Siebzehnjährige nehmen!«
»Dann warte eben, bis du achtzehn bist.«
»Da ist der Bürgerkrieg doch längst zuende, so lange halten die Roten nicht durch.« Schröder seufzte. »Ne, ich glaube, wir haben einfach Pech gehabt. Für unsere Generation wird es so bald keinen Krieg mehr geben.«
»Mach dir mal keene Sorgen, früher oder später wirst du deine Todeskämpfe sehen. Wenn du so wild drauf bist.«
»Wie du redest! Hast du denn schon jemanden sterben sehen?«
Fritze sagte nichts mehr. Er konnte mit solchen Jungen nicht reden, sie lebten in einer anderen Welt. Ja, er hatte schon einige Sterbende gesehen in seinem Leben und gewiss Schlimmeres erlebt als den Herzanfall eines dicken amerikanischen Sportfunktionärs. Aber reden konnte er darüber nicht.
4
Sie stand in der Wohnungstür, hielt ihren kleinen Koffer in der Hand und sah sehr entschlossen aus.
»Vielleicht tut es uns ja mal ganz gut«, sagte sie.
»Ich weiß nicht, was daran gut sein soll. Wir sind verheiratet. Wir sollten zusammenleben.«
Sie zuckte die Achseln. »Menschen, die zusammenleben, setzen sich auch zusammen, ehe sie Übernachtungsgäste aufnehmen, und besprechen das gemeinsam.«
»Ich habe dir doch erklärt, warum das nicht möglich war! Das hatte … berufliche Gründe. Ich konnte mich da nicht drücken.«
»Und ich habe dir erklärt, warum ich genau deswegen ausziehen muss. Vorübergehend.«
In der Tat. Das hatte sie. Dennoch hatte er nicht damit gerechnet, dass sie es tatsächlich tun würde. Obwohl er es besser hätte wissen sollen. Vor ihm stand Charlotte Rath, geborene Ritter, die sturste Frau des Universums.
»Mach’s gut, Gereon.« Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Du weißt ja, wie du mich erreichen kannst.«
Ja, das wusste er. Telefonisch. Bei Greta Overbeck. Falls die den Hörer überhaupt weiterreichte, wenn sie seine Stimme hörte.
Er wartete, bis Charly mit ihrem Koffer im Aufzug verschwunden war, dann ging er zurück in die Wohnung. Das Telegramm lag immer noch auf der Kommode im Flur.
Der Telegrammbote war mitten in ihr Sonntagsfrühstück geplatzt. Über dem ohnehin schon eine Gewitterwolke geschwebt hatte, weil er gestern nach dem Treffen mit Gräf und Tornow viel zu spät nach Hause gekommen war. Und nicht einmal erzählen durfte, warum. Die dünne Lügengeschichte, die er sich auf dem Heimweg zurechtgelegt hatte, wurde nicht gebraucht: Als er gegen elf endlich wieder zuhause war, hatte er die Wohnung dunkel und leer vorgefunden. Erst gegen zwei Uhr war Charly zurückgekehrt, hatte ihm aber noch nicht gesagt, wo und mit welchen Leuten sie den Abend verbracht hatte. Er hatte auch nicht danach gefragt. War eher erleichtert darüber, dass auch sie nicht wissen wollte, warum sein Treffen mit Gräf so lange gedauert hatte.
Und dann hatte der Telegrammbote geklingelt.
Rath nahm das dünne Papier von der Kommode und las sie noch einmal, die wenigen Worte, die Charly aus dem Haus getrieben hatten.
expect to arrive in berlin on tuesday 2 pm = looking forward to meeting you = frank miller
Frank Miller. Sein Olympiagast. Auf einer Dienstbesprechung vor ein, zwei Monaten hatte Nebe, sein Chef, das Thema aufgebracht und keinen Zweifel daran gelassen, was er von den Beamten des preußischen Landeskriminalamtes erwarte: Dass diese sich selbstverständlich und mit Freuden bereiterklären, einen ausländischen Gast für die Zeit der Olympischen Spiele zu beherbergen. Niemand hatte gekniffen, Rath hatte gar nicht anders gekonnt, als sich mit den anderen zu melden und ein Bett zur Verfügung zu stellen. Fritzes Zimmer stand ja leer, da konnte man gut für eine Weile jemanden unterbringen.
Dummerweise hatte er Charly nichts davon erzählt, und dann war der Bescheid vom Verkehrs- und Quartiersamt gekommen. Charly hatte den Brief geöffnet, und Rath hatte versucht, ihr die Sache zu erklären. Vergeblich.
»Du hältst es nicht einmal für nötig, mich zu fragen, bevor du so etwas zusagst?«
»Ich hatte doch keine Wahl. Außerdem bekommen wir ein kleines Entgelt für unsere Gastfreundschaft.«
»Man hat immer eine Wahl. Selbst im März hatte man das, obwohl der Wahlzettel nur eine Partei und einen Kandidaten aufgelistet hat. Ich habe mein Kreuz jedenfalls nicht bei Adolf Hitler gemacht.«
»Ich doch auch nicht. Was sind denn das für Vergleiche?«
»Aber du lässt dich für die Propaganda der Nazis einspannen.«
»Was heißt Propaganda. Das sind die Olympischen Spiele, das ist doch keine Erfindung der Nazis. Die hat die Republik für Deutschland nach Berlin geholt. Ich kann mich noch erinnern, dass du stolz darauf warst. Dass du dich darauf gefreut hast.«
»Ja, aber inzwischen ist einiges passiert in Deutschland, wenn ich dich daran erinnern darf. Und jetzt fallen die Spiele den Nazis in den Schoß.«
So war es noch eine Weile hin- und hergegangen, und in der Folge hatte Charly klein beigegeben und sich nicht mehr quergestellt. Hatte allerdings auch Konsequenzen angekündigt.
»Du kannst hier so viele Olympiagäste beherbergen, wie du willst. Aber ohne mich. Solange die hier sind, bin ich weg.«
Das hatte sie gesagt, und Rath hatte es nicht ernst genommen. Bis sie heute morgen ernst gemacht hatte. Von jetzt auf gleich. Sie hatte nicht einmal böse gewirkt, als sie mit ihrem Koffer aus dem Schlafzimmer gekommen war. Musste sie ja auch gar nicht. Wusste sie doch, wie weh es ihm tat, sie in Richtung Moabit ziehen zu lassen. Wie schwer es ihm fiel, allein zu sein.
Er setzte sich an den verwaisten Frühstückstisch, zündete sich eine Overstolz