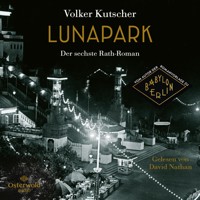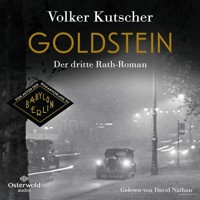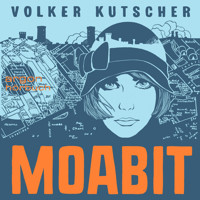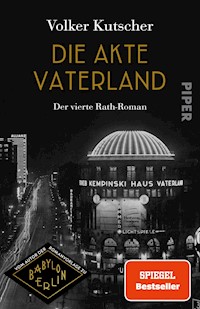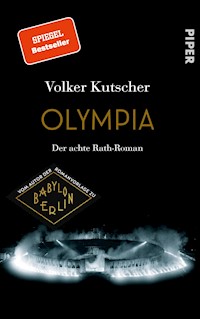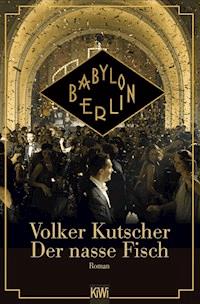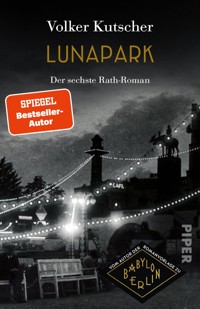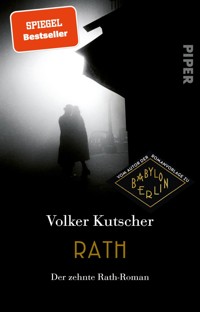10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Frühjahr 1937: Die Familie Rath ist zersprengt. Eigentlich wollte Charlotte Rath, geborene Ritter, schon längst im Ausland sein, doch halten die Umstände sie in Berlin fest. Ihr ehemaliger Pflegesohn Fritze ist in die geschlossene Abteilung der Nervenheilanstalt Wittenau gesteckt worden, ihre beste Freundin Greta spurlos verschwunden und steht unter Mordverdacht. Dem untergetauchten und von den Behörden für tot gehaltenen Gereon Rath wird es derweil zu gefährlich in Deutschland, er besteigt den Zeppelin, um in die USA zu entkommen. Während Charly versucht, Fritze aus der Klinik rauszupauken, das Verschwinden von Greta zu klären und den Mordfall zu lösen, geschehen jenseits des Atlantiks Dinge, die sie niemals für möglich gehalten hätte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 880
Veröffentlichungsjahr: 2022
Beliebtheit
Ähnliche
Impressum ePUB
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung : zero-media.net, München
Coverabbildung : akg-images/ US NAVY/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E‑Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
Westpassage
Buch Eins
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Intermezzo
Buch Zwei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Ostpassage
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Zitat
D’ailleurs c’est toujours les autres qui meurent.
Grabinschrift von Marcel Duchamp, Cimetière Monumental, Rouen
Westpassage
Schnelldampfer EuropaPosition 41° 44′ N, 49° 57′ WKurs WestsüdwestZielhafen New York CityDienstag, 25. August 1936
Dass sie sich auf hoher See befanden, war hier drinnen kaum zu spüren, der holzgetäfelte Salon hätte auch in einen gediegenen britischen Gentlemen’s Club gepasst. Die Stirnseite schmückte ein Relief, irgendetwas Antikes, ein Ochsenkarren voller Weintrauben, angeführt von einem Flötenspieler im dünnen Hemdchen. Und auf dem Ochsen saß nicht etwa Europa, wie man es auf einem Schiff dieses Namens hätte erwarten sollen, sondern ein zweiter halbnackter Kerl, der blöde besoffen grinste. Marion Goldstein kannte sich nicht so aus mit griechischen Sagen, sie hatte keine Ahnung, wen oder was das darstellen sollte, aber dass das nicht Europa war und auch kein göttlicher Stier, das sah ein Blinder mit Krückstock.
Sie hielt ihre Zigarette nun schon eine ganze Weile in der Hand, doch niemand machte Anstalten, der ganz in schwarz gekleideten Dame Feuer zu geben, keiner der Stewards, die hier ebenso flink wie dezent durch die Tischreihen huschten, noch einer der distinguierten Herren, die in den weichen Lederpolstern saßen und rauchten. Niemand würdigte die blonde Witwe auch nur eines Blickes. Marion kannte das bereits: Der Rauchersalon der ersten Klasse war, auch wenn dies nirgends geschrieben stand, den Herren der Schöpfung vorbehalten.
Es war ihr nicht wichtig, dass ein Kavalier ihr eilfertig sein Feuerzeug unter die Nase hielt, doch sie genoss es, die Herren ein wenig schwitzen zu lassen, diese Feiglinge, die nicht wussten, ob sie ihrer guten Erziehung folgen sollten oder ihrem Dünkel. Abe hätte die Männer allesamt verachtet. Er hätte sich einen Scheiß um ungeschriebene Gesetze geschert oder darum, was die anderen denken mochten; er hätte sich zu der einsamen Dame gebeugt, hätte ihr sein Lächeln gezeigt und ihr Feuer gegeben. Mit genau jenem Feuerzeug, das seine Witwe nun aus der Handtasche holte.
Sie hatte es mit an Bord genommen, Abes Zippo. Seinen Glücksbringer, als solchen hatte er das solide Sturmfeuerzeug immer bezeichnet. In jener Nacht aber, in jener verhängnisvollen Nacht vor genau zwölf Tagen hatte er es, warum auch immer, im Hotel zurückgelassen.
Nach Abes Tod hatte sie sich geschworen, das Feuerzeug niemals mehr aus den Augen zu lassen. Des Nachts lag es neben ihrem Bett und verbreitete einen dünnen Benzindunst, den sie mit in ihre Träume nahm. Meist waren es schöne Träume, meist traf sie Abe dort, und ihr Herz lernte wieder fliegen. Schlimm war nur das Aufwachen jeden Morgen, wenn ihr langsam klarwurde, was das leere Bett neben ihr zu bedeuten hatte: dass er nicht da war. Nie wieder da sein würde.
Das Feuerzeug war ein kleiner Trost. Als sei es ein Teil von ihm, als sei er nicht ganz fort. Als sie es ihm geschenkt hatte, ein Jahr, nachdem er sie aus Berlin mit in die Staaten genommen hatte, waren sie bereits verheiratet.
Sie hätten niemals zurückkehren dürfen, nicht für einen einzigen Tag, nicht für die dämliche Olympiade und nicht für die anderen Dinge, die Abe in Berlin plante. Denn eines stand fest: Abraham Goldstein würde noch leben, wären sie vor gut einem Monat, als die Manhattan nach Europa aufbrach, nicht an Bord gegangen.
Das Feuerzeug flammte auf, und die Glut fraß sich mit leisem Knistern in die Zigarette hinein. Marion nahm einen tiefen Zug und pustete den Rauch weit in den Raum hinein. Sie ließ die Klappe zurückschnappen, und ein metallisches Klacken zerschnitt die ledergepolsterte Stille. Einige Herren schraken zusammen, andere vergaßen für einen Augenblick den unausgesprochenen Vorsatz, den weiblichen Eindringling zu ignorieren, und drehten sich um. Aber niemand sagte etwas. Vielleicht war die schwarze Trauerkleidung Grund für ihre Zurückhaltung, vielleicht hatte sich auch herumgesprochen, welchen Mann die blonde Witwe betrauerte. Fast war es, als säße Abe im leeren Sessel neben ihr und hielte jeden, der irgendetwas zu meckern hatte, auf Abstand.
Marion Goldstein wusste nicht viel von den Plänen, die ihren Mann nach Berlin getrieben hatten. Das meiste hatte sie erst erfahren, als sie am Abend seines Todes alles, auch die abgeschlossenen Schubladen in ihrer Suite im Bristol, leergeräumt hatte. Ein Unbekannter, einer von Abes Berliner Kontakten, hatte sie angerufen und gewarnt, und sie hatte eiligst alles ausgeräumt und beiseitegeschafft. Als sie vom Lehrter Bahnhof zum Hotel zurückkehrte, hatten sie bereits damit begonnen, ihre Suite zu durchsuchen. Zwei Bullen in Zivil. Staatspolizei. Ihr Mann, der jüdische Kriminelle Abraham Goldstein, habe ein Attentat auf Reichsminister Hermann Göring geplant, so hatten sie erzählt, und Marion hatte es keine Sekunde geglaubt, die deutschen Sicherheitskräfte hätten den feigen Attentäter jedoch rechtzeitig gestellt und außer Gefecht gesetzt. Außer Gefecht gesetzt. Sie hatten ihn erschossen, diese Schweine!
Dass Abe kein Attentäter war, hatte Marion von Anfang an gewusst. Aus welchen Gründen er jedoch in Berlin gewesen war, hatten ihr erst die Dinge verraten, die er vor ihr verborgen gehalten und die sie vor der Polizei in Sicherheit gebracht hatte: Frachtpapiere, mit denen sie nicht viel anfangen konnte, eine Packung originalverpacktes Heroin mit dem Kreuz der Firma Bayer sowie eine Fahrkarte des Norddeutschen Lloyd für eine Atlantikpassage auf dem Schnelldampfer Europa von Bremerhaven nach New York am 21. August 1936, ausgestellt auf einen Doktor Werner Ferber aus Elberfeld im Rheinland.
Also hatte auch sie sich am 21. August auf der Europa eingeschifft. Zusammen mit Doktor Ferber, der, wie sich herausstellte, ein Chemiker der Eberfelder Bayer-Werke war, dem man wegen seines mosaischen Glaubens gekündigt hatte. Abe hatte dem jungen Doktor die Überfahrt in die Staaten besorgt, damit er dort neu anfangen könnte. Sie und Doktor Ferber teilten sich keine Kabine, selbstverständlich nicht, gleichwohl verbrachten sie an Bord viel Zeit miteinander, so viel, dass dies den übrigen Passagieren der ersten Klasse ausreichend Gelegenheit zum Tuscheln und Naserümpfen bot.
Sie hatte nicht vor, mit dem jungen Chemiker anzubändeln, ihr ganzes Interesse galt dem Sinn und Zweck seiner Überfahrt. Doktor Ferber war in dieser Sache sehr offen, handelte es sich bei Marion Goldstein doch um die Witwe seines Auftraggebers. Er war so offen, dass sie ihm klarmachen musste, dass diese Offenheit ihr gegenüber zwar angebracht sein mochte, anderen gegenüber aber unter allen Umständen zu vermeiden war. Sie sicherte ihm zu, Abes Abmachung einzuhalten: Doktor Ferber werde das Labor bekommen, das Abe ihm versprochen habe.
Wie sie das anstellen sollte, wusste sie noch nicht. Sie würde Verbündete brauchen, die Frage war nur, wem sie trauen konnte. Wenn sie an die Menschen dachte, die sie in New York erwarteten, Sally Epstein, Doktor M. oder Jack Helferich, dann wurde ihr klar, dass ihr aus Abes Umfeld nur Menschen einfielen, denen sie nicht traute.
Ein kaum hörbares Raunen wanderte durch den Saal, ein Raunen, das unmöglich ihr gelten konnte, denn sie saß still und friedlich in ihrem Sessel und rauchte. Sie schaute auf. Eine weitere Frau hatte den Rauchersalon betreten. Die Amerikanerin mit dem straff zurückgekämmten Haar und dem strengen, beinahe Angst einflößenden Blick war ihr schon beim Einschiffen in Bremerhaven aufgefallen, weil sie die Einzige in der ersten Klasse war, die ebenfalls schwarz trug.
Auch die amerikanische Witwe ließ sich regelmäßig mit einem Mann an ihrer Seite blicken, und bei den beiden war der Altersunterschied noch frappanter als bei Marion und Doktor Ferber. Nun aber war sie allein. Die Amerikanerin machte sich nichts aus dem Getuschel der Mitreisenden, und noch weniger schien sie das Geraune im Rauchersalon zu stören, im Gegenteil: Jeden ihrer Schritte, der sie weiter in diese Männerwelt hineintrug, kostete sie aus wie einen guten Schluck Cognac. Die Kombination aus schwarzem Abendkleid, hochhackigen Schuhen und kurzem Bolero war für eine Witwe schon fast zu elegant, der Hut hatte sogar einen kleinen schwarzen Schleier. Marion, die durchaus auf Kleidung achtete, war schmuckloser angezogen. Allerdings hatte sie auf die Auswahl des schwarzen Kleides bei Gerson auch nicht viel Zeit verwenden können, sie hatte Wichtigeres zu tun.
An Marions Tisch befanden sich nicht die einzigen freien Sitzgelegenheiten, doch an allen anderen Tischen wandten sich die Herren derart demonstrativ ab oder legten Taschen und Zeitungen auf die freien Sessel, dass der Neuen gar nichts anderes übrigblieb, als sich zu der einzigen anderen Frau im Rauchersalon zu setzen, wollte sie nicht auf dem Absatz wieder kehrtmachen. Doch die strenge Amerikanerin war keine Frau, die einfach so wieder umkehrte. Sie trat an Marions Tisch.
»Gestatten Sie, dass ick mir zu Ihnen setze?«
»Oh, Sie sprechen Deutsch! Ich hatte gedacht, Sie seien Amerikanerin!«
»Das bin ick auch.« Die Witwe streckte ihre schwarzbehandschuhte Hand aus. »Morgan. Olympia Morgan. Chicago, Illinois.«
Marion ergriff die dargebotene Hand. »Pleased to meet you«, sagte sie. »Goldstein. Marion Goldstein. From Brooklyn, New York. Nehmen Sie doch Platz.«
»Oh, Sie sind Amerikanerin«, sagte Misses Morgan und setzte sich. »Ick dachte, Sie sind Deutsche!«
»Auf eine gewisse Weise bin ich beides.« Marion drückte ihre Zigarette aus. »Aber auf Deutschland bin ich derzeit nicht gut zu sprechen. Dort habe ich meinen Mann verloren.«
»Oh, Sie Ärmste! My deepest condolences.« Die Witwe Morgan seufzte. »Dann haben wir beide dasselbe Schicksal! Ick habe mein Walter ebenfalls in Deutschland verloren. While he was at the Olympics. Heart Attack.«
»Oh, that’s sad. I’m sorry for your loss.«
Marion beließ es bei dieser kurz angebundenen Beileidsbekundung. Sie wollte nicht nachfragen, sie wollte nicht mehr wissen. Schließlich musste ihre Schicksalsgefährtin auch nicht wissen, dass Mister Goldstein bei einem Polizeieinsatz erschossen worden war.
Das Gespräch stockte eine Weile.
»Dann bringen also auch Sie die sterblichen Überreste Ihres Mannes back to the States?«, fragte die Witwe schließlich.
»Nein. Ich habe ihn in Berlin beerdigen lassen. Da kommt seine Familie her. Auf dem Friedhof Weißensee.«
Die Witwe Morgan schaute neugierig, sagte aber nichts. Sie klappte ihr Zigarettenetui auf und hielt es Marion unter die Nase. Marlboro, eine amerikanische Damenzigarette.
»Thank you, Misses Morgan.«
Marion griff zu. Sie warf das Zippo an, gab erst der Witwe Feuer und dann sich selbst. Einer der Herren am Nebentisch hüstelte demonstrativ, und Marion ließ das Feuerzeug geräuschvoll zuschnappen.
»Ick habe Walters Urne in my cabin«, sagte die Frau aus Chicago. »I don’t trust these Germans.«
Marion nickte. Auch sie hatte Abes Heroin in ihrem Handkoffer versteckt, und der stand in der Kabine unter ihrem Bett. Kein Gepäckträger hatte ihn anrühren dürfen. Sie wusste, dass man mit diesem Zeug in New York City gutes Geld verdienen konnte, und ob Abe ihr in den Staaten irgendetwas hinterlassen hatte, wusste sie nicht. Weil sie nicht wusste, was von seinem Besitz überhaupt legal und offiziell war. Ein Haus in Long Beach hatte er ihr versprochen, doch noch lebten sie in Williamsburg. Und wenn sie Pech hatte, würde ihr nicht einmal das bleiben, dann würde sie in den Staaten wieder bei null anfangen müssen. Dennoch: Alles besser als in Berlin zu leben. Ihre Heimatstadt war ihr seltsam fremd geworden, obwohl doch nur ein paar Jahre vergangen waren, seit sie ihr den Rücken gekehrt hatte. An Berlin hatte ihr immer das Amerikanische gefallen, die Unberechenbarkeit, der Duft von Freiheit, das Gefühl, alles sei möglich, doch davon war nichts mehr geblieben. Trotz der überbreiten Prachtstraßen erschien ihr die Stadt immer enger und armseliger.
»Sie reisen in Begleitung«, bemerkte Misses Morgan beiläufig. War doch neugieriger als sie tat.
»Nicht direkt. Doktor Ferber ist ein Bekannter meines verstorbenen Mannes. Abraham wollte ihm helfen, in den Staaten neu anzufangen. Nun muss ich mich wohl darum kümmern.«
»Oh, a doctor! Die werden immer gebraucht. Am besten, Sie fragen in die hospitals.«
»Doktor Ferber ist kein Mediziner, er ist Chemiker.«
»Oh!«
Die Witwe Morgan schaute, als sei sie gerade in einen Fettnapf getreten. Als sei es außerhalb ihrer Vorstellung, dass ein Doktor der Chemie überhaupt etwas Sinnvolles leisten könne.
»Bayer-Werke«, erklärte Marion und zählte die bekanntesten Marken auf: »Aspirin, Heroin, Lycetol, Prontosil …«
»Ah!« Die Amerikanerin nickte wissend.
»Und Ihr Begleiter?«, fragte Marion.
»Mister Fitzgerald? Oh, Sie glauben doch nicht etwa?« Sie winkte ab. »No, no! He was Walter’s secretary, now he’s mine.«
»Aha!«
Jetzt war es an Marion, wissend zu nicken.
»Was soll ick macken, die Geschäft geht weiter!« Olympia Morgan zuckte die Achseln. »So traurig es ist mit Walters Tod, but you know: business is bigger than all of us!«
»Da haben Sie recht«, meinte Marion Goldstein, »da haben Sie verdammt recht.«
Sie begann sich für die Witwe, die ebenso wie sie selbst keinen Deut darum gab, was andere Leute über sie dachten, zu interessieren.
»Sagen Sie doch«, fuhr sie also fort und schaute Olympia Morgan freundlich an, »von welchen Geschäften reden wir denn da?«
Buch Eins
Freitag, 23. April, bis Freitag, 7. Mai 1937
There’s a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving.
Led Zeppelin, Stairway to Heaven
1
Die Fenster waren sämtlichst geschlossen, dennoch drang das Scheppern und Schnaufen der Züge, die den Bahnhof Alexanderplatz verließen, zu ihnen in den Verhandlungssaal. Auf der anderen Seite der Stadtbahntrasse glänzten die vom letzten Regenschauer durchnässten Backsteine des Polizeipräsidiums in der schüchternen Aprilsonne. Charly konnte immer noch genau sagen, hinter welcher Fensterreihe die Büros der Mordinspektion lagen, obwohl es Jahre her war, dass sie dort gearbeitet hatte. Das regelmäßige Rattern der Eisenbahn, das ihren Arbeitstag begleitete, hatte damals etwas Beruhigendes gehabt, heute jedoch verstärkte es ihre nervöse Gereiztheit.
Sie hörte dem Mann im Zeugenstand zu und konnte ihre Ungeduld kaum im Zaum halten. Doktor Wolfgang Gerloff, SS-Mitglied und Amtsarzt der Staatspolizei, betete genau das herunter, was er Heiligabend des Jahres 1936 bereits schriftlich niedergelegt hatte, und das Gericht ließ ihn gewähren. Genausogut hätte der Vorsitzende das psychiatrische Gutachten verlesen lassen können. Dabei ging es in dieser Verhandlung um die Stichhaltigkeit genau dieses Gutachtens, aber statt dem Amtsarzt auf den Zahn zu fühlen und dessen Befund zu hinterfragen, bestätigte der Richter lediglich das gerade Gehörte. Stünde nicht so viel auf dem Spiel, Charly wäre eingeschlafen. So aber heizte die Schlafmützigkeit der Zeugenbefragung ihre Ungeduld nur an. Sie ertappte sich dabei, wie sie mit ihrem Stuhl zu wippen begann. Theo Contzen hingegen, der Rechtsanwalt neben ihr, wirkte so interessiert wie ein Atheist bei der Sonntagspredigt in der Kirche.
»Die staatspolizeilich veranlasste Einweisung des Thormann, Friedrich, in die geschlossene Abteilung der Wittenauer Heilstätten am vierundzwanzigsten Dezember sechsunddreißig«, wiederholte der Richter tausendfach bereits Durchgekautes, »folgte also letztlich nur dem von Ihnen, Doktor Gerloff, diagnostizierten amtsärztlichen Befund vom selben Tage, der dem Thormann schizoide paranoide Wahnvorstellungen attestiert?«
Der Arzt im Zeugenstand nickte.
»Richtig, Herr Vorsitzender. Wie ich bereits ausführte, äußerten sich die schizoiden paranoiden Wahnvorstellungen des Patienten in den wiederholten haltlosen Beschuldigungen zu Lasten eines ehemaligen SS-Angehörigen, dieser habe im August sechsunddreißig einen Mord im olympischen Dorf begangen. Dabei handelt es sich um einen Suizid, dessen Zeuge der Thormann geworden ist. Dabei ist nicht auszuschließen, dass genau dieses traumatische Ereignis den bereits schlummernden Wahn in dem Patienten ausgelöst hat.«
»Bereits schlummernd?«, fragte der Richter. »Wie ist das zu verstehen, Doktor Gerloff?«
»Nun, Herr Vorsitzender, natürlich muss eine Person, damit solch ein Wahn ausgelöst werden kann, eine gewisse Disposition mitbringen. Aufgrund der ungeklärten Vaterschaft des Thormann ist ein Defekt aus minderwertiger rassischer Vererbung daher höchst wahrscheinlich.« Der Amtsarzt machte eine Kunstpause, um seine Worte wirken zu lassen. »Allein schon deswegen, um eine Verschmutzung der Volksgemeinschaft durch solche Subjekte zu verhindern, war eine dauerhafte Unterbringung des Thormann in der geschlossenen Psychiatrie unabdingbar. Dies habe ich in meiner Expertise daher auch in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht.«
Das stimmte. Es war sogar beinahe wortwörtlich die Formulierung, die Doktor Gerloff in seinem Gutachten gewählt hatte, mit dem einzigen Unterschied, dass er dort das Präsens benutzt hatte und nicht das Präteritum. Ist eine dauerhafte Unterbringung des Thormann in der geschlossenen Psychiatrie unabdingbar. Mit derselben Begründung, denselben Worten. Minderwertig. Verschmutzung. Es hörte sich an, als rede man über Ungeziefer. Kaum zu glauben, dass es hier um einen sechzehnjährigen Jungen ging.
»Vielen Dank für Ihre deutlichen Ausführungen, Doktor Gerloff, das Gericht hat keine weiteren Fragen.«
Der Amtsarzt knöpfte sich das Jackett zu und machte Anstalten, aus dem Zeugenstand zu treten.
Charly stand auf. »Moment bitte«, sagte sie. »Wir hätten noch ein paar Fragen an den Zeugen.«
Doktor Gerloff fror mitten in der Bewegung ein und schaute sie überrascht an.
Ebenso der Richter. »Gnädige Frau«, begann er, »wäre es nicht eigentlich Sache des Rechtsanwaltes, den Zeugen zu befragen …«
»Herr Vorsitzender, Doktor Contzen und ich vertreten die Interessen von Friedrich Thormann gemeinsam. Ich darf Sie daran erinnern, dass ich Jura studiert habe.«
»Nun ja, aber …«
»Und wenn die Regierung mir nicht das zweite Staatsexamen verweigert hätte«, fuhr Charly fort, »dann wäre ich heute ebenso Rechtsanwalt wie Doktor Contzen.«
Der Richter schaute in seine Akten. »Nach meinen Informationen«, sagte er dann, »haben Sie zwei Jahre und zehn Monate als Rechtsanwaltsgehilfe gearbeitet. Das ist dann doch etwas anderes als ein Rechtsanwalt.«
Mit so etwas hatte Charly gerechnet. Deswegen saß Theodor Contzen neben ihr, ein ehemaliger Kommilitone, der es in seinem Beruf nicht allzuweit gebracht hatte und froh war über jede Mark, die er sich dazuverdienen konnte. Mehr als ein Strohmann war Theo nicht, und mehr benötigte Charly auch nicht.
Eigentlich hatte sie Guido Scherer mit dem Fall betrauen wollen, doch der hatte abgewinkt. Keine Zeit. So hatte er ihr mit einem bedauernden Achselzucken zu verstehen gegeben.
Keine Zeit. Charly hatte gewusst, dass das gelogen war. Kein Mut, das wäre ehrlicher gewesen. Guidos Kanzlei lief seit einiger Zeit so gut, dass er seinen einstigen Vorsatz, den Benachteiligten und Mittellosen zu helfen, längst vergessen hatte. Ein paar Fälle in Not geratener armer Schlucker übernahm die Kanzlei Scherer & Blum immer noch, vorausgesetzt allerdings, bei den armen Schluckern handelte es sich um solche, die weltanschaulich ohne jeden Zweifel die Sache des Nationalsozialismus unterstützten und vollwertige Mitglieder der vielbeschworenen Volksgemeinschaft waren. Wenn der Fall überdies noch positive Schlagzeilen versprach, dann waren die Herren Blum und Scherer dabei, andernfalls nicht. In der Sache Thormann war nichts zu verdienen, weder Ruhm noch Geld. Man konnte sich höchstens die Finger verbrennen.
Aber das war Charly egal. Es ging hier nicht darum, ob man sich die Finger verbrannte, es ging um den Jungen, einzig und allein um den Jungen. Seit fast vier Monaten saß Fritze nun in der Heilanstalt, und es war nur einem Zufall zu verdanken, dass sie überhaupt davon erfahren hatte. Hätte der Junge sein Pensionszimmer in Breslau im Voraus bezahlt, hätte es sich bei der Pensionswirtin nicht um eine Jüdin gehandelt, würde Charly immer noch in Prag sitzen und denken, Fritze gehe es gut, er habe sich eben nur dafür entschieden, in Deutschland zu bleiben, statt ihr ins Ausland zu folgen.
Doch das hatte er nicht, das hatten andere getan. Die Geheime Staatspolizei hatte Friedrich Thormann in die geschlossene Abteilung der Wittenauer Heilstätten einweisen lassen, aufgrund eines fadenscheinigen psychiatrischen Gutachtens, das ein Amtsarzt der Gestapo verfasst hatte, ebenjener Doktor Gerloff, der schon beim Betreten des Gerichts den im Gang wartenden Staatspolizeibeamten vertraulich zugenickt hatte. Einen der Beamten kannte Charly noch aus der Burg. Michael Steinke hatte seinerzeit, im selben Kommissaranwärterjahrgang wie sie, bei der Kriminalpolizei gearbeitet, einer der unbegabtesten Kriminalisten, denen sie jemals über den Weg gelaufen war.
Sie fragte sich, ob Steinke sich auch an sie erinnerte. Wenn dem so sein sollte, hatte der Mann nichts dergleichen erkennen lassen. Oberkommissar Steinke, auf dessen Anordnung Fritzes Einweisung erfolgt war, hatte bereits als Zeuge ausgesagt. Das psychiatrische Gutachten sei eindeutig und habe ihm keine andere Wahl gelassen. Charly und Theo hatten ihn reden lassen, ohne sich einzumischen, den Gefallen konnten sie dem Amtsarzt nicht tun.
Theo stand auf. »Ich darf darauf hinweisen, Hohes Gericht, dass Frau Rath hier nicht die Rolle einer Rechtsanwaltsgehilfin übernommen hat. Sie vertritt die Rechte von Herrn Thormann ebenso wie ich und genießt mein volles Vertrauen. Ich darf Sie also darum bitten, die Worte aus ihrem Munde ebenso ernst zu nehmen, als kämen sie aus dem meinen.«
»Wie Sie wünschen, Herr Rechtsanwalt«, sagte der Richter, »dann stellen Sie bitte Ihre Fragen. Oder lassen sie stellen.«
Der Amtsarzt warf einen irritierten Blick auf die Richterbank, dann auf Contzen und zuletzt auf Charly, setzte sich aber, als der Richter ihm dies mit einem energischen Wink bedeutete, wieder in den Zeugenstand.
Theo nahm Platz, und Charly stand auf.
»Herr Doktor Gerloff«, begann sie. »Sie messen der Herkunft von Friedrich Thormann einen großen Wert in Ihrer Diagnose bei.«
»Richtig.«
»Ist es denn Ihrer Meinung nach zulässig, rassenhygienische Gesichtspunkte in eine psychiatrische Begutachtung einfließen zu lassen?«
»Es ist nicht nur zulässig, es ist zwingend geboten.« Der Amtsarzt schaute beifallheischend zum Richtertisch. »Der Wert der Rasse für die Volksgesundheit, auch die psychische Volksgesundheit, kann gar nicht oft und stark genug betont werden. Die Aspekte der Rassenforschung spielen eine weitaus wichtigere Rolle in der Bewertung des Zustandes eines geistig gestörten Menschen als die Hirngespinste irgendeines dahergelaufenen jüdischen Quacksalbers aus Wien.«
»Demnach ist die Vererbungslehre also ein entscheidender Faktor für Ihre Diagnose.«
»Die schädliche Wirkung minderwertigen Erbguts. Selbstverständlich! Die zeigt sich hier ja in aller Deutlichkeit. Sie ist nicht ein, sie ist der entscheidende Faktor!«
Charly nickte. »Haben Sie vielen Dank, Doktor Gerloff«, sagte sie. »Mehr wollte ich nicht wissen.«
Sie setzte sich wieder hin, kritzelte ein paar Notizen in ihre Akte und tuschelte kurz mit Theo Contzen.
Der Amtsarzt schaute irritiert. Sein Blick wanderte zwischen Charly und der Richterbank hin und her. Dann platzte ihm der Kragen.
»Ich weiß nicht, worauf Sie mit Ihrer Fragerei hinauswollen«, rief er und stand auf. »Aber um solche Kinder, die doch nur aufgrund unverantwortlicher Fortpflanzung überhaupt existieren, hat sich der Staat zu kümmern. Und sie aus dem Volkskörper zu entfernen. Eine Einweisung in die Psychiatrie ist in solchen Fällen nicht nur angezeigt, sondern unerlässlich! Wie wollen Sie dem denn sonst Einhalt …«
»Es ist gut, Doktor Gerloff«, unterbrach ihn der Richter. »Wir haben alles Wichtige gehört. Wenn Frau Rath – oder Herr Contzen – keine weiteren Fragen haben, sind Sie aus dem Zeugenstand entlassen.«
»Wir sind fertig«, sagte Charly.
Gerloff, hochrot im Gesicht, warf ihr einen bösen Blick zu und verließ den Saal.
»Wie ich das sehe«, sagte der Richter, »wäre die Zeugenvernehmung hiermit abgeschlossen.«
»Einen Moment noch, Herr Vorsitzender«, sagte Theo Contzen und stand auf. »Wir bitten darum, dass das Gericht einen weiteren Zeugen aufruft.«
»Herr Rechtsanwalt!« Der Richter blätterte in der Akte. »Auf der Ladungsliste sehe ich keine weiteren Zeugen, daher …«
»Keinen geladenen Zeugen, einen präsenten.«
Der Richter zog die Augenbrauen hoch. »Sie haben einen Präsenzzeugen?«
»So ist es«, sagte Theo Contzen und las den Zettel ab, den Charly ihm zugesteckt hatte. »Wir beantragen, dass Major Friedrich von Randow in den Zeugenstand gerufen wird.«
Der Richter nahm, kaum hatte der Anwalt den Offiziersrang genannt, unwillkürlich Haltung an.
»Befindet sich Major von Randow denn im Gebäude?«
»Jawohl, Herr Vorsitzender«, sagte Theo. »Er wartet draußen im Gang.«
Der Richter räusperte sich. »Gerichtsdiener? Schauen Sie bitte draußen nach Major von Randow und bitten ihn in den Zeugenstand.«
Der Uniformierte neben der Tür salutierte. »Major von Randow in den Zeugenstand, jawohl!«
Er verließ den Saal und kehrte kurz darauf mit einem Mann zurück, dessen Erscheinungsbild unbestritten Eindruck machte: ein silberblonder Hüne in grauer Wehrmachtsuniform, auf dessen Schultern die rot-silbern geflochtenen Epauletten eines Majors prangten. Gemessenen Schrittes trat Randow nach vorn, die Uniformmütze unterm Arm. Kein Laut war zu hören, als der Major den Zeugenstand betrat, alle Blicke ruhten auf dem großen blonden Mann. Ein überzeugender Auftritt, Charly war zufrieden.
Der Richter belehrte den Zeugen vorschriftsgemäß, und Randow hörte sich die Ausführungen ruhig an, machte dazu jedoch ein Gesicht, als werde er gerade aufs Tiefste beleidigt, allein durch das Andeuten der Möglichkeit, er könne eventuell nicht die Wahrheit sagen.
Charly stand auf.
»Können Sie sich kurz vorstellen, Major von Randow?«, bat sie.
Der Major nickte. So ruhig und souverän er auch wirkte, ganz wohl zu fühlen schien er sich in seiner Rolle vor Gericht nicht.
»Mein Name ist Friedrich von Randow, geboren am achtzehnten Mai achtzehnhundertfünfundneunzig auf Schloss Randow in Pommern.«
»Wollen Sie kurz Ihren Werdegang schildern?«
»Meine Kindheit verbrachte ich auf dem elterlichen Schloss. Als ich zwölf Jahre alt war, schickte mich mein Vater, der Familientradition folgend, auf die Hauptkadettenanstalt in Groß-Lichterfelde, wo ich meine militärische Ausbildung durchlief. Im Weltkriege diente ich als Offizier in der dritten Infanteriedivision, zunächst an der Westfront und später an der Ostfront.«
»Für Ihre Verdienste um das Vaterland verlieh Seine Majestät der Kaiser Ihnen das Eiserne Kreuz erster Klasse …«, fragte Charly.
»Jawohl.«
Sie hasste es, so vaterländisch daherzureden, doch für ihre Zwecke war es nötig.
»Wollen Sie kurz berichten, Herr Major, wie es Ihnen nach dem Krieg ergangen ist?«
»Ungern. Es war keine schöne Zeit.«
»Das war es für die wenigsten hier im Saal, denke ich.«
»Ich war dreiundzwanzig und Oberleutnant. Mein Wunsch war es, weiterhin dem Vaterlande in der Armee zu dienen, doch unsere Division wurde aufgelöst.«
»Und Sie schlossen sich einem Freicorps an.«
»Ich war froh, weiter für die deutsche Sache kämpfen zu können. Im Baltikum.«
»Aber im März zwanzig kehrten Sie nach Berlin zurück.«
»Richtig. Mit meinem Corps. Um die Novemberverbrecher aus der Stadt zu jagen.«
»Was bekanntlich fehlgeschlagen ist …«
»Es war eine große Enttäuschung für mich. Man wusste ja nicht mehr, wie es weitergeht. Mit Deutschland. Mit Preußen. Mit der Armee.«
»Und in dieser Situation haben Sie jemanden kennengelernt.«
»Jawohl. Eine Dame.«
Die Stimme des Majors war leise geworden.
»Eine Dame, bei der Sie Zerstreuung gefunden haben.«
»Wie Sie das ausdrücken! Wir haben uns geliebt, Anna und ich.«
»Anna Thormann.«
»Ja.«
Der Richter merkte auf. Langsam schien ihm zu dämmern, worauf die Sache hinauslief.
»Aber Sie haben Fräulein Thormann nicht geheiratet?«, fragte Charly.
»Nein, das ging nicht.«
»Warum nicht?«
»Nun, es war eine … nicht standesgemäße Verbindung.«
»Eine Verbindung, die Sie gelöst haben. Bevor Sie sich im Dezember neunzehnhundertzwanzig mit einer standesgemäßen Dame verlobt haben. Ihrer jetzigen Frau. Carola von Sternheim.«
»Hören Sie!« Von Randow wurde wieder lauter. »Ich habe eingewilligt, vor Gericht auszusagen, aber wir müssen hier nicht jedes Detail meines Privatlebens beleuchten. Es geht allein um den Jungen, über den sollten wir reden, über nichts sonst!«
»Sie haben Recht, Major von Randow, reden wir über den Jungen. In welchem Verhältnis stehen Sie zu Friedrich Thormann?«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun … verwandtschaftlich.«
Der Offizier zögerte einen Moment. Dann machte er sich gerade und sagte den entscheidenden Satz. »Friedrich ist … nun ja, er ist mein Sohn.«
Im Saal war es für einen Moment so leise, dass man die berühmte Stecknadel tatsächlich hätte fallen hören können.
»Für das Protokoll bitte ich festzuhalten«, sagte Charly in die Stille, »Friedrich Thormann ist der leibliche Sohn von Anna Thormann und Major Friedrich von Randow.« Sie schaute auf die Richterbank. »Des Weiteren bitte ich das Hohe Gericht zu berücksichtigen: Das amtsärztliche Gutachten fußt, wie Doktor Gerloff soeben erläutert hat, auf der Annahme, dass Friedrich Thormann von minderwertiger rassischer Herkunft sei. Diese Annahme aber ist falsch, das genaue Gegenteil ist der Fall. Und so sehen wir die Einweisung in eine psychiatrische Anstalt als ungerechtfertigt an und bitten um die schnellstmögliche Entlassung des Jungen.«
Der Richter räusperte sich. »Major von Randow«, begann er. »Haben Sie diese Vaterschaft auch offiziell anerkannt?«
»Jawohl.«
»Und dennoch wurde Friedrich in die Obhut der staatlichen Jugendfürsorge gegeben.«
»Seine Mutter konnte sich nicht um ihn kümmern, sie wurde schwer krank, nachdem sie ihn zur Welt gebracht hatte.«
»Und Sie konnten sich nicht zu Ihrem Sohn bekennen.«
»Ich habe mich zu ihm bekannt.«
Der Richter blätterte in der Akte. »Und dennoch wurde der Junge im April einundzwanzig dem städtischen Waisenhaus Rummelsburg übergeben.«
»Richtig.«
»Herr Vorsitzender!« Charly stand auf und holte einen großen braunen Umschlag aus ihrer Tasche. »Erlauben Sie, dass ich Ihnen etwas zeige.«
Sie trat an den Richtertisch und holte ein Papier aus dem Umschlag.
»Dieses Schreiben beweist, dass der hier anwesende Major von Randow der leibliche Vater von Friedrich Thormann ist. Es ist ein Vertrag zwischen ihm und dem städtischen Waisenhaus Rummelsburg, dem er seinen Sohn anvertraut, indem er sich zu einer monatlichen Zahlung verpflichtet. Die Summe muss hier nicht öffentlich genannt werden. Aber ich bitte darum, dieses Schreiben zu den Akten zu nehmen.«
Der Richter schob seine Brille zurecht und las. Charly ging zurück zu ihrem Platz.
»Wenn sich das Waisenhaus, wie hier zu lesen ist, zur Diskretion verpflichtet, wie kommt es dann, dass wir hier und heute über dieses Schreiben reden?«
»Wissen Sie, Herr Vorsitzender, ich habe nicht nur Jura studiert, sondern bei der Berliner Polizei auch eine kriminalistische Ausbildung genossen.«
»Ah ja.«
Der Richter wirkte nicht sonderlich erfreut. Eine scheinbar belanglose Angelegenheit, die man schnell vom Tisch zu haben glaubte, hatte plötzlich unerwartete Dimensionen angenommen.
»Das Gericht wird die neue Sachlage eingehend werten«, sagte er. »Die Sitzung ist geschlossen. Die Verhandlung wird nächste Woche Mittwoch fortgesetzt.«
Charly packte die Akte ein und schloss ihre Tasche. Als sie den Saal an der Seite von Theo Contzen verließ, erhaschte sie den Blick von Oberkommissar Steinke, dem man die Vertagung offenbar bereits zugetragen hatte. Der ehemalige Mordermittler, der bei der Gestapo Karriere gemacht hatte, schien Charly nun doch zu erkennen. Und er sah nicht glücklich aus.
2
Glas, Stahl und Beton. Der schlichte moderne Kasten wirkte wie ein Fremdkörper in der altehrwürdigen, stuckbewehrten Häuserreihe. KANTGARAGEN-PALAST stand in großen Buchstaben ganz oben auf der gläsernen Fassade, Werbeschilder für Shell- und Olexbenzin zierten die Einfahrten. Ein Paradies für Automobilisten und eine fremde Welt für Andreas Lange. Der Kriminalkommissar hatte immer noch keinen Führerschein, deswegen saß er auch auf dem Rücksitz des Mordautos. Am Steuer saß ein Kriminalsekretär, Kowalski, der Neue aus Königsberg.
»Hier ist es«, tönte Czerwinski vom Beifahrersitz. »Da vorne links.«
Ein überflüssiger Hinweis, Kowalski hatte den Winker längst gesetzt, doch seit Anton Kowalski Anfang des Jahres vom Polizeipräsidium Königsberg an die Burg gewechselt war, tat Czerwinski so, als müsse er, der altgediente Berliner Bulle, dem Neuen aus der ostpreußischen Provinz zeigen, wo es in dieser Stadt denn langging.
Lange mischte sich nicht ein, schließlich war er Kriminalkommissar und kein Kindergärtner. Außerdem war es kurz vor halb acht, und er hatte noch keinen Kaffee getrunken. Das Telefon hatte geklingelt, als er sich gerade für die Rasur eingeseift hatte, und noch bevor er den Hörer abnahm, wusste er, dass der Anruf vom Alex kam.
»Wir haben einen Leichenfund«, hatte Wiesenkötter vom Bereitschaftsdienst gesagt, »das Mordauto ist schon unterwegs. Die Kollegen müssten in zehn Minuten bei Ihnen sein.«
Sie waren es in neuneinhalb. Lange hatte den Rest seiner Morgentoilette so schnell wie möglich hinter sich gebracht, für einen Kaffee allerdings hatte die Zeit nicht mehr gereicht. Der Wasserkessel hatte gerade zaghaft zu pfeifen begonnen, da hatte es auch schon an der Tür geklingelt. Seine neue Wohnung lag einfach zu nah am Präsidium.
Vor einem Jahr erst war Lange vom Prenzlauer Berg an den Werderschen Markt gezogen, die alte Adresse in der Franseckistraße war nicht mehr standesgemäß. Und insgeheim hatte er, wenn er ehrlich war, mit der Beförderung zum Oberkommissar gerechnet, die meisten aus seinem Jahrgang hatten die schon erfahren dürfen. Doch da tat sich seit Jahren nichts. Niemand sagte ihm, warum er so konsequent übersehen wurde, und das war auch nicht nötig. An seiner Aufklärungsquote konnte es nicht liegen, die war die beste in der ganzen Kriminalgruppe M. Es lag allein daran, dass er bislang weder in die NSDAP noch in die SS eingetreten war, nicht einmal in die SA. Genau wie sein Chef, Oberregierungsrat Ernst Gennat, hatte Andreas Lange sich jeglicher Annäherung an die neuen Machthaber verweigert.
Nun saß er ebenso schlecht gelaunt wie rasiert neben Christel Temme auf der Rückbank des Mordautos und beschäftigte sich vor allem mit der Frage, wann er heute wohl die erste Tasse Kaffee bekommen würde. Sein Kopf fühlte sich an wie in Watte gepackt.
Kowalski ließ den Gegenverkehr passieren und bog in die Einfahrt des Garagenhauses. Czerwinski hatte bereits das Beifahrerfenster geöffnet und zeigte dem Schupo, der unter dem Olex-Werbeschild unauffällig Wache schob, die Dienstmarke der Kriminalpolizei.
Der Blauuniformierte wies in das von Neonlicht erhellte Innere des Gebäudes. »Leiche liegt im dritten. Dahinten geht’s ruff«, sagte er.
Kowalski nickte und steuerte mit solchem Schwung die enge, gewundene Rampe hinauf, dass die Reifen auf dem glatten Betonboden quietschten. Lange konnte das Geräusch kaum ertragen, geschweige denn den Blick aus dem Wagenfenster. Er schloss die Augen.
»Hier darf einem auch keiner entgegenkommen«, meldete sich Czerwinski vom Beifahrersitz.
»Passiert auch nicht«, entgegnete Kowalski. »Außer, einer vertut sich. Die Ausfahrt ist auf einer anderen Rampe.«
»Ach ne?«
»Ach ja. So baut man Parkgaragen. Sowas haben wir in Königsberg auch.«
Czerwinski sagte nichts mehr, er verschränkte die Arme und schaute beleidigt aus dem Fenster.
Etage für Etage schraubte sich das Mordauto nach oben, bis Kowalski im dritten Obergeschoss von der Rampe aufs Parkdeck lenkte. Er stellte den Wagen in respektvollem Abstand zu einer Menschentraube ab, die sich an der Wand vor einer weit geöffneten Fensterreihe gebildet hatte: drei Schupos und eine Handvoll Zivilisten, die sich um etwas scharten, das man nicht sehen konnte.
Lange stieg aus und öffnete der Stenotypistin den Wagenschlag, die so viel Zuvorkommenheit mit einem scheuen Lächeln beantwortete. Dann erteilte er seine Befehle.
»Czerwinski, holen Sie den Fotoapparat aus dem Wagen. Kowalski, Sie und Fräulein Temme kommen mit mir.«
Czerwinski schien einen Protest auf den Lippen zu haben, doch Lange ignorierte das, setzte seinen Hut auf und ging zu den Schupos hinüber.
»Kriminalkommissar Lange, Mordkommission«, stellte er sich vor. »Wer ist denn hier der befehlshabende Beamte.«
»Melde gehorsamst, das bin ich, Kommissar«, sagte ein Mann mit akkurat gestutztem Schnauzbart, »Oberwachtmeister Bertram, hundertzweiundzwanzigstes Revier.«
Bevor Lange etwas sagen konnte, riss Bertram den rechten Arm hoch. »Heil Hitler, Kommissar!«
Lange quittierte den Deutschen Gruß mit einem Nicken und schaute auf den Betonboden. Dort lag ein athletisch gebauter, dunkelhaariger Mittdreißiger, der einen eleganten, aber dreckverschmierten Anzug trug, jedoch keinen Hut. Aus dem bleichen Gesicht starrten zwei leblose blaue Augen an die Betondecke.
»Wegen dem da sind wir geholt worden«, sagte Bertram.
»Wer hat die Leiche denn gefunden?«
»Der Herr da mit der Chauffeursmütze.«
Die Beschreibung war unvollständig. Der hagere Mann, auf den Oberwachtmeister Bertram mit seinem fleischigen Zeigefinger wies, trug außer der grauen, mit goldener Kordel verzierten Schirmmütze auch Lederstiefel, Lederhandschuhe und einen eindrucksvollen, von zwei Knopfreihen zusammengehaltenen dunklen Mantel. Kompletter konnte man als Chauffeur nicht eingekleidet sein.
»Gestatten, Meinecke«, stellte sich der Mann vor. »Stefan Meinecke. Ich fahre Herrn Carlsen.«
»Carlsen? Ist das der Mann da auf dem Boden?«
»Gott bewahre! Nein! Das muss ein Selbstfahrer sein.«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Nun, es ist jedenfalls keiner von uns. Die Kollegen kenne ich alle. Wenn wir Pause haben, sitzen wir unten im Groschenkeller zusammen.«
»Wer ist wir?«
»Na, die Chauffeure, die hier arbeiten. Noch. Werden ja immer weniger. Die meisten Herren steuern ihre Automobile lieber selbst.«
»Und als Sie heute morgen zur Arbeit kamen, lag der tote Mann dort auf dem Parkplatz?«
»Ne, da habe ich ihn ja erst hingebracht. Er saß im Auto. Da drüben.«
Meinecke zeigte auf eine hellgrüne Stahltür, die halb zur Seite geschoben war. Im Inneren der Garagenbox war ein dunkelgrüner Opel Olympia zu erkennen, dessen Fahrertür offenstand.
»Sie haben den Mann also bewegt?«
»Natürlich. Ich musste ihn doch da rausholen, hätte ja sein können, dass er noch lebt.«
»Und?«
»Wie: Und?«
»Lebte er noch?«
»Ne, der war tot. Ist ja auch kein Wunder bei so viel Abgasen.«
»Nun mal langsam: Was genau ist passiert?«
»Ich war in der Garage, um unser Automobil abzuholen.«
»Wann?«
»Ziemlich früh, so gegen sechse. Wollte den Wagen noch waschen, bevor ich Herrn Carlsen ins Büro fahre.« Meinecke wies auf eine geschlossene Garagenbox, auf deren Tür die Zahlen 313 gemalt waren. »Da drinne steht unsere Adler-Limousine. Also: die von Herrn Carlsen.«
»Solche Einzelheiten interessieren im Augenblick nicht.«
»Wie Sie meinen. Jedenfalls: Als ich aufschließen will, höre ich aus der Garage nebenan einen Motor im Leerlauf tuckern. Obwohl die Tür fest verschlossen war. Sowas ist ja gefährlich.« Der Chauffeur zeigte auf eines der Schilder, die in regelmäßigen Abständen an den Wänden des Garagenpalastes hingen.
MOTORABSTELLEN. VERGIFTUNGSGEFAHR.
»Und?«, fragte Lange.
»Ich habe geklopft. Hat aber niemand reagiert. Die Gase kamen schon durch den Türschlitz, also bin ick runter zur Pforte, die haben ja für alles einen Schlüssel, und bin mit Herrn Mölders so schnell es ging wieder hoch.«
»Moment, wer ist das?«
»Einer von den Garagenwärtern hier.«
Lange notierte sich den Namen.
»Jedenfalls«, fuhr Meinecke fort, »haben wir aufgeschlossen, und ick bin rein, hab mir ein Taschentuch vor die Neese gehalten, bin hin zum Auto und hab den Motor abgestellt. Und dann den Mann so schnell es ging aus der Garagenbox gezogen, die war ja schon völlig vernebelt.«
»Wo haben Sie den Mann denn vorgefunden?«
Meinecke schaute ihn an, als habe er in seinem ganzen Leben noch keine idiotischere Frage gehört. »Na, hinterm Steuer natürlich. War doch ein Selbstfahrer. Hatt ick Ihnen dette nich jesacht?«
Lange ließ sich von der eigenwilligen Berliner Freundlichkeit nicht irritieren, schließlich lebte er schon seit sieben Jahren in der Stadt. »Er saß also noch im Auto«, sagte er.
»Ja. Ist wohl zu lange sitzen geblieben. Und hat den Motor nicht ausgemacht. Selbstfahrer eben. Die wissen ja gar nicht, wie gefährlich so ein Automobil ist.«
»Und dann? Nachdem Sie den Mann aus der Garage gezogen haben?«
»Na, Mölders hatte inzwischen die Fenster hier aufgerissen. Da haben wir den Mann hingelegt, an die frische Luft. Hab noch Wiederbelebung versucht, war aber zwecklos.«
»Gibt es dafür weitere Zeugen?«
»Na, Herrn Mölders eben. Sonst wüsste ick keenen. Alle anderen kamen später, da war die Polente schon da. Also: Ihre Kollegen.«
Lange nickte. »Danke, Herr Meinecke. Das reicht fürs Erste. Wir müssen Sie gleich noch ausführlicher befragen. Halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung.«
»Aber …« Meinecke schaute auf die Uhr. »Wie lange wird das denn dauern? Herr Carlsen …«
»Ihr Chef, fürchte ich, wird sich heute eine Kraftdroschke gönnen müssen.« Lange wandte sich an den Kriminalsekretär. »Kowalski, kümmern Sie sich doch bitte um Herrn Meinecke. Und prüfen Sie, ob es noch weitere Zeugen gibt, insbesondere diesen Herrn Mölders. Ich schaue mir den Fundort derweil genauer an.«
»Jawohl, Herr Kommissar.«
Kowalski nahm sich des Chauffeurs an, der auch nicht glücklicher dreinschaute, als er es mit einem neuen Gesprächspartner zu tun bekam, und Lange wandte sich der Garage mit dem grünen Opel zu. Das stählerne Tor war zwar ein ganzes Stück zur Seite geschoben, ungefähr so weit, dass ein Mensch gut hindurchpasste, dennoch musste Lange sich ein Taschentuch vor Mund und Nase halten, als er hineinging und an den Wagen trat. Die Fahrertür stand offen, der Zündschlüssel steckte. Der Olympia war ein neueres Modell, von Opel eigens anlässlich der Olympischen Spiele herausgebracht.
Etwas Ungewöhnliches konnte Lange auf den ersten Blick nicht feststellen. Aber er merkte, dass ihm das Atmen immer schwerer fiel; das Taschentuch half nicht viel, er musste zurück an die frische Luft. Draußen schaute er sich die Konstruktion an und notierte die Nummer auf dem Garagentor. 314. Die Schiebetore liefen auf stählernen Schienen und verschwanden in geöffnetem Zustand komplett in den Seitenwänden der Garagenboxen. Sehr platzsparend.
Drüben bei der Leiche hatte Kriminalsekretär Kowalski damit bgonnen, die Zeugen zu befragen. Zwei Schupos hatte er an den Treppenhauszugängen postiert, um weitere Schaulustige fernzuhalten. Wer eine Garage in der dritten Etage sein Eigen nannte, der hatte heute morgen Pech gehabt. Eine Todesfallermittlung durfte nicht gestört werden; eine Selbstverständlichkeit, von der die Schutzpolizei im 122. Revier noch nichts gehört zu haben schien. Doch Kowalski war dabei, Ordnung ins Chaos zu bringen und die Menschentraube aufzulösen.
Czerwinski hatte es derweil immerhin fertiggebracht, die Kamera aufzubauen, und begann, die Leiche zu fotografieren.
»Nicht den Toten, Czerwinski!«, rief Lange.
Der dicke Kriminalsekretär schaute ihn irritiert an.
»Nicht die Leiche fotografieren. Das ist nicht die Auffindesituation. Wir brauchen Bilder aus Garage drei-eins-vier.«
Czerwinski murrte etwas Unverständliches, schulterte dann aber das Stativ und trottete zur Garagenbox hinüber.
»Machen Sie Aufnahmen von dem Opel«, sagte Lange. »Innen und außen. Und von der Garage selbst.«
Czerwinski versuchte, den Fotoapparat durch den Türspalt zu hieven, und verhakte sich mit dem Stativ.
Da hallte eine Stimme durch den Raum.
»An Ihrer Stelle würde ick damit noch ein bisschen warten.«
Lange drehte sich um. Dort stand ein Mann mit schütterem Haar, der einen grauen, groben Einteiler trug, auf dessen linker Brust ein Aufnäher mit den gelbgestickten Buchstaben KANTGARAGEN-PALAST prangte.
»Da drinne is noch allet voll mit Abjasen«, fuhr der Garagenmann fort. »Bevor Se da rinjehen, solltense erst ma jut lüften. Die Schilder hängen ja nich umsonst hier, wa?«
Czerwinski blieb stehen, das Stativ geschultert, und schaute seinen Vorgesetzten an.
»Sie sind hier angestellt?«, fragte Lange den Störenfried.
»Sieht man det nich?«
»Und Ihr Name?«
»Mölders. Erwin.«
»Sie haben Herrn Meinecke die Garage dreihundertvierzehn aufgeschlossen?«
»Richtig.«
»Prima, Herr Mölders, wir müssen uns unterhalten. Haben Sie auch einen Büroraum oder so etwas?«
»Sicher. Unten.«
»Das trifft sich gut. Wir brauchen einen Raum, in dem wir ungestört Zeugen vernehmen können.«
»Zeugen vernehmen? Können Se det nich am Alex machen?«
»Wenn Sie mit uns zum Alex kommen wollen, dann gerne.«
»Wie? Bin icke denn Zeuge? Ick hab nüscht jesehen. Nur die Jaraasche uffjeschlossen.«
»Glauben Sie mir, Sie sind Zeuge. Dann lassen Sie uns mal nach unten gehen. Und wenn Sie irgendwo noch eine Tasse Kaffee auftreiben könnten?«
Eine Viertelstunde später saß Andreas Lange sogar vor einem ganzen Kännchen. Erwin Mölders hatte sie in ein nach Motoröl riechendes Büro geführt und einen Kollegen zum Kaffeeholen in die benachbarte Kneipe geschickt, den Groschenkeller, von dem Meinecke bereits gesprochen hatte. Lange schenkte Kaffee nach und trank. So langsam wurde er wach.
Als Erstes vernahm er den Chauffeur noch einmal und ließ dessen Aussage von Christel Temme stenografieren. Kowalski stand an der Tür und hörte aufmerksam zu. Lange hatte ihn mit nach unten genommen, nachdem der Kriminalsekretär die Personalien sämtlicher Anwesenden aufgenommen und die Schaulustigen von den Zeugen getrennt hatte. Wobei die meisten Schaulustigen darauf bestanden hatten, gar keine zu sein, sondern nur ihr Auto abholen zu wollen. Kowalski hatte sie alle fortgeschickt. Ohne Auto. Letzten Endes waren tatsächlich nur zwei brauchbare Zeugen übriggeblieben, der Chauffeur Stefan Meinecke und der Garagenwärter Erwin Mölders.
Erst nachdem Meinecke seine Aussage gemacht hatte, die sich im Wesentlichen mit dem deckte, was er schon auf dem Parkdeck erzählt hatte, war Mölders an der Reihe. Der Parkhausangestellte, sichtlich unglücklich mit der Situation, die Polizei im Haus zu haben, konnte die Schilderungen des Chauffeurs bestätigen: Gegen viertel sieben sei Meinecke ganz aufgeregt im Büro aufgekreuzt, weil da jemand in einer verschlossenen Garage seinen Motor laufen lasse. Er, Mölders, sei mit dem Schlüsselbund hoch und habe die Box aufgeschlossen, Meinecke habe sich todesmutig hineingestürzt, den Motor abgestellt und den Fahrer aus dem Auto gezogen.
»Und Sie?«, fragte Lange.
»Icke? Hab die Fenster uffjerissen, wa? Is ja saujefährlich, det Zeuch.«
»Kohlenmonoxid.«
»Richtich. Sieht man ja auch an dem armen Rekowski.«
»An wem?«
»Klaus von Rekowski. Der Tote. Sie wissen wohl noch jar nüscht, wa?«
»Sie kennen den Mann?«, fragte Lange.
»Natürlich. Ick kenne all unsere Mieter. Und deren Chauffeure, falls die noch welche haben. Aber et jibt ja fast nur noch Selbstfahrer.«
»Und Herr von Rekowski war ein Selbstfahrer?«
»Sonst wäre ja wohl sein Chauffeur jestorben und nich er.«
»Hat der Mann noch gelebt?«
»Ne, der war mausetot. Meinecke hat Wiederbelebung jemacht, Beatmung und so, aber da war einfach nüscht mehr zu machen.«
»Und dann?«
»Na, icke runter und Ihre Kollegen anjerufen.«
»Das haben Sie genau richtig gemacht.«
»Schön. Nu sind Se ja ooch hier. Aber wie lange wollen Se eijentlich noch bleiben? Sie blockieren mir hier den janzen Betrieb.«
»Eine kriminalpolizeiliche Untersuchung braucht ihre Zeit.«
»Alle Automobilisten aus der Nachbarschaft jehören zu unseren Kunden. Die müssen doch irjendwohin mit ihren Fahrzeugen. Wat sollen die denn machen? Unter der Laterne parken und eenen Strafzettel riskieren? Wie sollen det aussehen, wenn die alle am Straßenrand parken? Stellen Sie sich det doch mal vor: die Kantstraße rechts und links mit Autos zujeparkt. Warum, meinen Se, jibt’s denn solche Großgaragen wie die unsere?«
Lange ließ den Redeschwall tapfer über sich ergehen. »Tut mir leid, Herr Mölders«, sagte er dann, »aber das kann ich Ihren Kunden nicht ersparen. Allerdings könnte ich die Kollegen von der Schutzpolizei anweisen, dass sie beim Ahnden von Laternenparkern in den nächsten Tagen hier in der Gegend etwas gnädiger vorgehen.«
Mölders sagte nichts, aber er sah nicht glücklich aus.
»Ist so etwas hier schon einmal passiert?«, fragte Lange. »Dass jemand bei laufendem Motor in seinem Auto erstickt ist?«
»Hier nicht. Soll aber vorkommen, wa? Det eener, der nich mehr leben will, sich seine Abjase direktemang vom Auspuff ins Auto leitet.«
Lange horchte auf. Meinecke war von einem Unfall ausgegangen. Ein Fahrer, der bei laufendem Motor zu lange in seinem Fahrzeug sitzen geblieben war.
»Könnten Sie sich das bei Herrn von Rekowski auch vorstellen?«, fragte er. »Dass es Selbstmord war?«
»Schwerlich.«
»Sie sind sich da sehr sicher. Kannten Sie ihn so gut?«
»Sie können ja mal kieken, inzwischen sollte man wieder rinkönnen in die Box. Dann sehense ja, ob da ’n Schlauch is oder so. Ick denke eher nich.«
Lange nahm seine Kaffeetasse und stand auf.
»Gut, Fräulein Temme, dann gehen wir mal nach oben und schauen uns die Sache an.«
»Jut, kann icke dann wieder an die Arbeit?«
»Sie kommen mit, Herr Mölders. Die Vernehmung ist noch nicht beendet.«
Missmutig folgte Erwin Mölders ihnen nach oben. Czerwinski hatte die Garagenbox inzwischen gut durchgelüftet und beide Türen ganz beiseitegeschoben. Das war auch das einzige, was er geändert hatte; der Opel stand genauso da wie vorhin, mit geöffneter Fahrertür. Auch die Leiche lag noch an ihrem Platz bei den Fenstern. Allerdings hatte sich gerade ein hagerer Mann im weißen Kittel darübergebeugt.
»Keine besonderen Vorkommnisse«, sagte Czerwinski eilfertig, kaum war Lange mit den anderen aus dem Treppenhaus getreten. »Nur Doktor Karthaus ist gerade gekommen.«
»Unübersehbar«, meinte Lange und ging hinüber. »Schon irgendwelche Erkenntnisse, Doktor?«
Karthaus schaute auf. »Nun mal langsam mit den alten Pferden. Habe mir den Mann ja gerade erst angeschaut. Die genaue Diagnose bekommen Sie nach dem Bluttest.«
»Und die ungenaue Diagnose?«
»Totenflecken von hellroter Färbung. Deutet auf eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung hin.«
»So weit waren wir auch schon.«
»Na, was fragen Sie dann?«, sagte Karthaus unwirsch und leuchtete dem Toten mit einer kleinen Taschenlampe in die weit geöffneten Augen. »Gehen Sie von einem Unfall aus? Oder war es ein Suizid?«
»Genau das wollen wir uns gerade anschauen.«
Lange betrat die offene Garagenbox und schnupperte vorsichtig. »Wie kann ich denn sicher sein, Doktor, dass man die Luft hier wieder atmen kann?«
»Riechen können Sie das nicht. Aber solange Sie keine Kopfschmerzen bekommen, Ihnen nicht übel wird und Sie nicht tot umfallen, sollte es gehen.«
Niemand lachte. Bei Karthaus konnte man nie sicher sein, ob so etwas als Witz gemeint war oder bierernst.
»Dann können Sie jetzt wohl loslegen, Czerwinski«, sagte Lange. »Sie haben den Doktor gehört: Sollten Sie tot umfallen, sagen Sie bitte Bescheid.«
Der Kriminalsekretär schulterte das Stativ und verfrachtete den Fotoapparat in die Garagenbox, während Lange den Opel unter die Lupe nahm. Ein Schlauch war nirgends zu sehen, weder im Innenraum noch am Auspuff.
»Sie scheinen recht zu haben«, meinte er zu Mölders, der sich die ganze Sache unbeeindruckt anschaute. »Sieht nicht nach Suizid aus.«
»Det jeht ooch ohne Schlauch, wenn die Garage nur schön dicht verrammelt ist. Aber trotzdem jloobe ick nich an Selbstmord.«
»Sie meinen, Rekowski ist hinter dem Steuer eingeschlafen?«
»Ne. Blödsinn. War ja abjeschlossen, und jenau det wundert mir.«
»Wieso?«
»Na, erstens: Warum sollte eener seine Garage abschließen, wenn er drinne is? Und zweitens: Selbst wenn er wollte, könnte er det jar nich. Unsere Garagenboxen lassen sich nur von außen abschließen.«
»Und das sagen Sie mir erst jetzt?«
»Vorher haben Se ja nich danach jefragt.«
»Das heißt, jemand muss Herrn Rekowski in seiner Garage eingeschlossen haben.«
»Anders isses nich möglich. Er selber kann’s jedenfalls nich jewesen sein. Außer er kann durch Wände jehen.«
»Verdammt, Herr Mölders«, sagte Lange. »Sie wissen, was das bedeutet?«
»Nö.«
»Die Polizei wird Ihre schöne Parkgarage noch etwas länger sperren müssen. Wir haben es jetzt mit einer Mordermittlung zu tun.«
Mölders riss die Augen auf und machte Anstalten, etwas zu sagen, winkte dann aber ab. Mittlerweile schien er sich in sein Schicksal zu fügen.
Lange winkte Kowalski heran. »Lassen Sie sich von Herrn Mölders einen Fernsprecher zeigen, und rufen Sie am Alex an. Wir brauchen den ED für eine umfangreiche Spurensicherung im ganzen Gebäude. Das hier war kein Unfall. Und auch kein Suizid.«
Kowalski verschwand mit Mölders im Treppenhaus. Lange wartete, bis Czerwinski mit dem Fotografieren in der Box fertig war, dann zog er seine Handschuhe über und schaute sich das Innere des Wagens an. Auf der Rückenlehne der vorderen Sitzbank entdeckte er einen dunklen Fleck und tippte mit der Fingerspitze darauf. Der weiße Stoff seines Handschuhs färbte sich rot. Das war tatsächlich Blut. Noch nicht ganz geronnen. Ihn wunderte, dass sich der Blutfleck auf der Beifahrerseite befand, Meinecke hatte doch ausgesagt, der tote Rekowski habe hinter dem Steuer gesessen, also auf der Fahrerseite.
Lange kniete auf dem weichen Polster der Sitzbank und warf einen Blick in das Handschuhfach. Darin lagen tatsächlich Handschuhe, zudem eine Brieftasche, aus demselben schwarzen Leder gefertigt. Lange klappte sie auf und fand diverse Ausweispapiere, alle ausgestellt auf den Namen Klaus von Rekowski, einen Führerschein, einen Reisepass und einen Mitgliedsausweis. Darauf war der Tote in einer schwarzen Uniform abgelichtet. Klaus von Rekowski war Hauptsturmführer bei der Schutzstaffel. Lange steckte seinen Fund in eine Beweissicherungstüte und seufzte. Ein SS-Mann. Das hatte ihm gerade noch gefehlt.
Er suchte weiter, aber Hutablage und Rücksitz waren leer, ebenso der Fußraum. Unter der vorderen Sitzbank jedoch ertastete er einen kleinen Gegenstand auf der Beifahrerseite und kramte ihn hervor. Ein Lippenstift. Guerlain Paris stand in feinen Buchstaben auf der Hülle. Ne m’oubliez pas. Und das im Wagen eines SS-Offiziers. Frauen, die sich die Lippen anmalten, waren im neuen Deutschland eigentlich verpönt. Von Rekowski jedoch schien kein Faible für ungeschminkte, blondbezopfte Gretchen gehabt zu haben. Lange konnte ihn verstehen. Er tütete auch diesen Fund ein und tastete den Fußraum unter der Sitzbank weiter ab, bis seine Fingerspitzen an etwas Weiches stießen. Textil. Ein Stück Stoff. Mit spitzen Fingern zog er es hervor und betrachtete es. Ein Taschentuch. Ein weißes, zerknülltes Taschentuch mit einer filigranen goldfarbenen Stickerei, die einen Schlüssel zeigte, der mit einem Anker über Kreuz lag. Lange wollte das Tuch schon eintüten, da bemerkte er den Duft, der von dem weißen Leinen ausging. Der Kommissar führte das Taschentuch vorsichtig an seine Nase und schnupperte. Unangenehm süßlich. Ein Geruch, den er kannte. Von seinem Zahnarzt.
3
Charly saß am Frühstückstisch und legte die Zeitung beiseite. Es war kaum zu ertragen, die Seiten trieften geradezu vom Eigenlob, das die Reichsregierung sich angedeihen ließ. Selbst das Berliner Tageblatt, das Charly einmal sehr geschätzt hatte, ließ sich voll und ganz vor den Karren der Propaganda spannen. Wie alle Zeitungen in Deutschland. Seitenweise ging es um die Hitler-Ausstellung, die bald unter dem Funkturm ihre Pforten öffnen sollte. Gebt mir vier Jahre Zeit. Eine umfassende Schau des Nationalsozialismus, wie das Tageblatt schrieb. Eine einzige eklig eitle und verlogene Selbstbeweihräucherung der Nazi-Clique und ihres selbsternannten Führers, wie Charly fand.
Goebbels’ Propagandaapparat feuerte aus allen Rohren. Andere Artikel schilderten die umfangreichen Vorbereitungen zum Tag der nationalen Arbeit, zu dem die Nazis den ersten Mai, den alten Kampftag der Arbeiterbewegung, vor vier Jahren erklärt hatten. Fahnen, Paraden, Reden, der übliche Zinnober. Berlin kam aus dem Jubeln und Marschieren gar nicht mehr heraus. Vergangene Woche erst hatten sie Hitlers Geburtstag mit ähnlichem Pomp gefeiert. Unerträglich. Was hatte der Mann denn geleistet außer achtundvierzig zu werden?
In einem plötzlichen Wutanfall fegte sie die Zeitung vom Tisch. Die Wanduhr in der Küche tickte leise, der Wasserhahn tropfte, sonst war nichts zu hören. Die Ruhe in der Wohnung machte sie verrückt. Warum, verdammt nochmal, war Greta nicht zuhause? Mit der hätte sie wenigstens reden können.
Charly steckte sich eine Juno an und inhalierte tief. Der Zigarettenrauch kräuselte sich vor dem Fenster, draußen ging der Regen in dicken Bindfäden auf die Spenerstraße nieder. Was für ein Start in die Woche. Wenn sie allein in der Wohnung war, überkam sie manchmal das Gefühl einer unerträglichen Einsamkeit. Als sei sie völlig allein auf der Welt. Und so fühlte sie sich inzwischen in dieser Stadt, daran änderten auch die viereinhalb Millionen Berliner nichts. Was nützte einem die Millionenstadt, wenn man darin kaum jemandem vertraute?
Sie tröstete sich damit, dass sie auf Abruf in Deutschland war. Sie musste den Jungen rausholen, dann konnte sie gehen. Für immer. Charly beneidete Greta, die mit ihrem schwedischen Pass hin- und herreisen konnte, wie es ihr beliebte. Für Monate war sie im Herbst nach Stockholm zu ihrer Mutter gefahren. Und wäre womöglich immer noch dort, wäre Charly nicht nach Berlin zurückgekehrt. So aber hatten sie ihre alte Frauenwohngemeinschaft wieder aufleben lassen. Charly war dankbar dafür, die Freundin hatte ihr Kraft gegeben in den letzten Wochen, mit Greta war die Wohnung in der Spenerstraße so etwas wie ein letzter Hort der Freiheit in einer Stadt, in der man nicht mehr sagen konnte, was man dachte, ohne damit seine Gesundheit oder gar sein Leben zu riskieren. In der Spenerstraße kamen Wilhelm Böhm, ihr Chef, oder Robert, den sie in Prag kennengelernt hatte, zu Besuch, oder andere Gleichgesinnte, die sich im eigenen Land inzwischen ebenfalls fremd fühlten. Viele waren das nicht.
Wo zum Teufel steckte Greta nur? Charly zog an ihrer Zigarette, aber auch das Nikotin konnte ihre nervösen Gedanken nicht beruhigen. Seit wann war sie eigentlich so dünnhäutig? Hätte sie sich früher schon solche Sorgen um die Freundin gemacht? Wo Greta Overbeck doch eine Frau war, die sich zu helfen wusste und um die man sich weiß Gott keine Sorgen zu machen brauchte. Dann schon eher um die Männer, mit denen sie etwas anfing.
Ob Greta glücklich war mit ihren ständig wechselnden Liebhabern? War Charly glücklich gewesen mit Gereon Rath? Bestimmt nicht immer. Wäre sie es geworden? Eine müßige Frage, denn Gereon war weg. Und sie merkte, dass er ihr fehlte. Manchmal kam es ihr vor, als sei er wirklich gestorben, so klein war die Hoffnung inzwischen geworden, ihn irgendwann wiederzusehen.
Er hatte irgendwo ein neues Leben angefangen. Irgendwo in Deutschland? Irgendwo im Ausland? Sie wusste es nicht. Sie durfte es auch nicht wissen, die Behörden waren misstrauisch. Sie hatten Gereon amtlich immer noch nicht für tot erklärt, dabei waren seit der Schießerei an der Schöneberger Brücke nun schon mehr als acht Monate vergangen. Nur seine Leiche hatte man eben nicht gefunden, das machte die Sache schwierig.
Charly erinnerte sich an den Schmerz, den sie verspürt hatte, als Reinhold Gräf ihr die Todesnachricht überbrachte. Wie gelähmt sie sich gefühlt hatte, innerlich taub, als sei alles Leben in ihr abgestorben. Es tat immer noch weh, wenn sie an diesen Moment dachte, obwohl es gar keinen Grund zur Trauer gab.
Oder eben doch. Denn das Leben, das sie führte, war nicht das, was sie sich gewünscht hatte. Sie war von dem Mann getrennt, den sie liebte, von dem Jungen, den sie hatte großziehen wollen, sie konnte den Beruf nicht ausüben, den sie ausüben wollte, weder den des Polizisten noch den des Rechtsanwaltes. Die Republik hatte ihr vorgegaukelt, ein selbstbestimmtes Leben zu haben, und sie hatte daran geglaubt. Bis die Nazis vor vier Jahren die Macht an sich gerissen hatten.
Greta konnte das ignorieren, die fuhr einfach nach Schweden, wenn es ihr in Deutschland zu eng wurde, und kam nach Berlin zurück, wann es ihr passte. Charly konnte das nicht. Dass sie im Januar aus Prag wieder hatte heimkehren können, war nur möglich gewesen, weil sie offiziell gar nicht ausgereist war. An der Grenze hatte sie einen falschen Pass vorgezeigt. Einer der Vorteile, dass sie bei Wilhelm Böhm angestellt war, ihrem früheren Vorgesetzten bei der Mordinspektion, der nun ein Detektivbüro betrieb und – weniger offiziell – als Fluchthelfer arbeitete: Es war kein Problem, an gefälschte Papiere zu kommen.
Die Gedanken an Böhm mahnten sie, dass es Zeit war aufzubrechen; sie drückte ihre Zigarette in den Aschenbecher und trank einen letzten Schluck Kaffee. Schon auf dem Weg zur Wohnungstür, den Mantel über dem Arm, die Handtasche geschultert, den Schlüssel in der Hand, hörte sie das Telefon klingeln. Charly erwog kurz, das Klingeln zu ignorieren, aber vielleicht war es ja Böhm mit einem Auftrag. Sie legte Mantel, Handtasche und Schlüssel auf den Garderobentisch und hob ab.
»Teilnehmer.«
»Ist das der Anschluss Greta Overbeck?«
Hätte sie es doch klingeln lassen! Wahrscheinlich einer von Gretas Liebhabern. Manche von denen waren ziemlich hartnäckig.
»Ja«, sagte sie, »aber Fräulein Overbeck ist gerade nicht im Haus.«
»Richten Sie ihr doch bitte aus, sie möge sich bei der Kriminalpolizei melden.«
»Kriminalpolizei? Was ist denn passiert?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen. Teilen Sie Fräulein Overbeck bitte mit, dass Sie sich umgehend melden soll. Es ist sehr wichtig.«
»Wenn Sie mir bitte noch sagen, wo genau sie sich melden soll.«
»Selbstverständlich. Im Präsidium am Alex. Kriminalgruppe M, Kommissar Lange.«
Charly stutzte.
»Andreas?«, fragte sie. »Sind Sie das?«
»Mit wem spreche ich bitte?«
Die Stimme am anderen Ende der Leitung hörte sich leicht pikiert an.
»Charlotte hier. Charlotte Rath.«
»Charly! Mein Gott! Wie geht es Ihnen? Ich … mein Gott, was für eine dumme Frage! Mein herzliches Beileid.«
»Danke.«
»Es tut mir so leid, die Geschichte mit Gereon, das ist ja so tragisch! Leider gab es noch keine Beerdigung, sonst hätte ich Ihnen doch längst … Ach, das klingt jetzt ganz anders, als ich es eigentlich sagen wollte.«
»Schon gut. Ich habe schon verstanden, was Sie sagen wollen. Ich weiß Ihre Anteilnahme zu schätzen. Vielen Dank.«
Charly konnte ihn zwar nicht sehen, aber sie war sich sicher, dass Andreas Lange rot angelaufen war.
»Es tut mir leid, Sie mit so etwas Banalem belästigen zu müssen.«
»Schon gut. Die Arbeit der Mordinspektion ist ja nicht banal. Mich wundert nur, welche Rolle meine Freundin in einer Mordermittlung spielt.«
»Todesfall. Wir nennen es immer Todesfallermittlung.«
»Natürlich. Der alte Gennat. Hat ja auch recht damit.«
Die Erinnerung an alte Zeiten machte sie wehmütig. 1927 hatte sie als Stenotypistin in der Mordinspektion angefangen, und die Zukunft war groß, hell und offen gewesen.
»Um was für einen Todesfall geht es denn?«, fragte sie. »Es ist nichts Familiäres, hoffe ich.«
»Nein, nein. Wir hatten einen Leichenfund. Im Kant-Garagenpalast.«
»Und? Was hat Greta damit zu tun?«
»Nun, Ihre Freundin steht mit Telefonnummer und allem Drum und Dran im Notizbuch des Toten.«