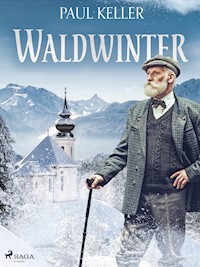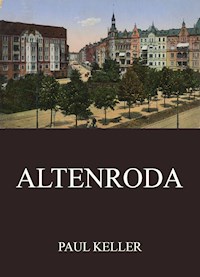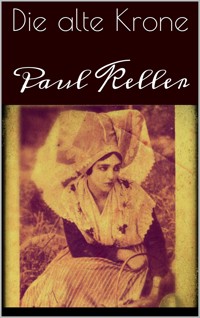Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Wenn mich, den Schlesier, das Heidegeheimnis meiner Heimat reizte, so lag das nahe. Ich bin mit ganzer Liebe an das Werk gegangen, habe nach den Trümmerbildern, die ich fand, die Sage vom Wendenkönig rekonstruiert und hoffe, daß mich das deutsche Herz nirgends, wo zwischen Nationalitäten abzuwägen war, zu einer Sünde ungerechter Parteilichkeit verführt hat." So schreibt Paul Keller im Vorwort zu seinem meisterhaften "Roman aus Wendenland", der vorwiegend in den Jahren 1860 bis 1866 spielt und anhand ausgewählter Begebenheiten und unvergesslicher Charaktere das Schicksal des kleinen Volkes der Lausitzer Sorben (auch Wenden genannt), einer Minderheit im großen deutschen Siedlungsgebiet ringsum, in diesem entscheidenden Zeitraum verfolgt. Das "Schweizer Volksblatt" schrieb in seiner zeitgenössischen Rezension: "Meisterhaft ist die Art, wie Keller das Wendenvölklein mit Sagen und Märchen, seinem Aberglauben, der sein ganzes Leben durchtränkt, schildert. Sprache und Technik zeigen Keller immer wieder in seiner Meisterschaft; er ist wirklich der Dichter, der mit dem Zauberstabe alles in eitel Poesie verwandelt, und er ist zugleich der Dichter, der mit dem König geht, der nur dem Hohen, dem Herrlichen, dem Schönen opfert ..." Noch heute sind die slawischen Sorben die einzige nennenswerte nichtdeutschte Minderheit, die seit Jahrhunderten in ihrem angestammten, wennzwar stark geschrumpftem Siedlungsraum auf dem heutigen Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland lebt und sich Sprache und Brauchtum noch immer bewahrt hat – und noch heute ist Paul Kellers Sorbenroman nicht nur aus historischen Gründen ungeheuer lesenswert!Paul Keller (1873–1932) wurde als Sohn eines Maurers und Schnittwarenhändlers geboren. Zwischen 1887 und 1890 besuchte er die Präparandenanstalt in Bad Landeck und anschließend von 1890 bis 1893 das Lehrerseminar in Breslau. Nachdem er acht Monate als Lehrer im niederschlesischen Jauer tätig war, wechselte er 1894 als Hilfslehrer an die Präparandenanstalt in Schweidnitz. Zwischen 1896 und 1908 war er Volksschullehrer in Breslau. Keller gründete die Zeitschrift "Die Bergstadt" (1912–1931) und schrieb schlesische Heimatromane sowie "Das letzte Märchen", eine Geschichte, in der ein Journalist in ein unterirdisches Märchenreich eingeladen wird, um dort eine Zeitung aufzubauen, und dabei in Intrigen innerhalb des Königshauses hineingerät. Die Namen wie "König Heredidasufoturu LXXV.", "Stimpekrex", "Doktor Nein" (der Oppositionsführer) haben wahrscheinlich Michael Ende zu seinem Roman "Die unendliche Geschichte" angeregt. Zusammen mit dem schlesischen Lyriker und Erzähler Paul Barsch unternahm Keller zwischen 1903 und 1927 zahlreiche Reisen durch Europa und Nordafrika. Zudem führten ihn etliche Lese- und Vortragstourneen durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Tschechoslowakei. Er war 1910 Mitglied der Jury eines Preisausschreibens des Kölner Schokoladeproduzenten Ludwig Stollwerck für Sammelbilder des Stollwerck-Sammelalbums Nr. 12 "Humor in Bild und Wort". Keller starb am 20. August 1932 in Breslau und wurde auf dem dortigen Laurentiusfriedhof bestattet. – Paul Keller gehörte zu den meistgelesenen Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was sich in einer 1931 bei fünf Millionen liegenden Gesamtauflage seiner Bücher widerspiegelt, und wurde in 17 Sprachen übersetzt. Schriftsteller wie der alte Wilhelm Raabe oder Peter Rosegger schätzten den Autor sehr. Gerade die früheren Werke wie "Waldwinter", "Ferien vom Ich" oder "Der Sohn der Hagar" zeichnen sich durch künstlerische Kraft und Meisterschaft aus. Seinen Roman "Die Heimat" (1903) nannte Felix Dahn "echte Heimatkunst". Seine bekanntesten Werke wurden zum Teil auch verfilmt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Keller
Die alte Krone
Roman aus Wendenland
83. bis 92. Auflage
Saga
Die alte Krone
German
© 1909 Paul Keller
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517321
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Zur Einleitung.
Die Spree ist ein Heidekind. Ihre Jugend ist arm und ohne Wagemut, ihre Kraft gering und ihre Lustigkeit schüchtern. Frühzeitig — als halberwachsen Ding — muss sie in Dienst nach der anspruchvollsten Stadt der Welt, nach Berlin, wo man ihr, einer jungen, billigen, schmucklosen Dienerin, auf die schwachen Schultern viel Last und Qual ladet.
Aber auch sie hat eine grüne Heimat und eine grüne Jugend. Gar nicht fern von dem schreienden, lachenden, gellenden Berlin wohnt die grosse Stille in hohen Föhrenwäldern, ist eine andere Welt, wohnt ein anderes Volk, ist eine andere Zeit. Gar nicht fern von dem prangenden Reichtum der glänzenden Weltstadt ziehen arme Sandwege durchs Land, stehen hohe Farnkräuter an alten Ziehbrunnen; nur wenige Stunden von dem Mittelpunkt kaltherziger Weisheit, heissblütiger Genusssucht, sieht das Volk auf den Blättern der Pflanze cerweny drest die Blutstropfen Christi glänzen, saugen die Kinder süssen Saft aus weissen Birkenstämmen, legen die Leute das Freundschaftskraut „kokoski“ unters verwitterte Strohdach, um am grünenden oder welkenden Kräutlein zu erkennen, ob das ferne liebe Leben eines Freundes noch frisch und grün oder im Tode verblichen sei.
Das ist das Land, wo ein kecker Hase, der ins Dorf kommt, den Leuten ein Feuer verkündet, wo man neun Sünden verziehen bekommt, wenn man eine Maulwurfsgrille tötet, wo der Mann sich eine krabbelnde Fledermaus unter die Mütze steckt, um im Spiele Glück zu haben, wo das Mädchen dem jungen Burschen, dessen Liebe sie gewinnen will, einen Apfel zu essen gibt, den sie eine ganze Nacht lang in der Schulterhöhle getragen hat.
Das ist das Land Wendei. Keine rote oder blaue Grenzlinie kennzeichnet das Wendenland auf einem Kartenbild; jahrhundertelang war es ein Spielball der Brandenburger, Sachsen und Böhmen, und auch heut noch muss man von der sächsischen Stadt Bautzen die böhmische Grenze entlang durch die schmale schlesische Lausitz bis hin in den brandenburgischen Spreewald wandern, wenn man die Wendei kennen lernen will.
Ein anderes Volk als in Berlin, der deutschesten aller deutschen Städte, die nur wenig Bahnstunden entfernt ist; — ureingesessene Slawen, die in grauer Vorzeit den ganzen Osten unseres Vaterlandes bis an die Ostsee beherrschten, dann zurückwichen Schritt um Schritt und die trotz jahrtausendelanger Abhängigkeit, in die sie alsbald gerieten, sich ihre trotzige Eigenart in Sprache und Sitte, in Kleidertracht, Häuserbau und Gemeindeanlage bewahrt haben. Jetzt aber ist Wendenland eine kleine, zerbröckelnde Slaweninsel im brausenden, deutschen Meere, das an seiner Küste zehrt, seine geistigen Springfluten über das Land giesst und es bald bis zum letzten Brocken aufgezehrt haben wird.
Sorben, oder — wie sie die Deutschen nennen — Wenden. Eines von den Völkern, die jahrtausendelang bestehen, ohne eine Geschichte zu haben, die alt werden, ohne je jung gewesen zu sein, Blutsverwandte der Tschechen und Schicksalsverwandte der südslawischen Stämme der Slowenen und Kroaten, die auf den mageren Ziegenweiden des felsigen Karstlandes ihre Jahrhunderte verträumten.
Kein hohes Lied, kein Heldenbuch, keine steinerne Tafel mit unvergänglichen Gesetzen, keine Ruhmeshalle mit Ewigkeitsphysiognomien grosser Menschen und grosser Geschehnisse kennzeichnet den Weg, den diese Nationen durch die Geschichte schritten. Ihre Spur verlief im Sand. Die Weltgeschichte vermerkt ihre Namen nur in nebensächlichen Fussnoten. Einige Grenzplänkeleien mit dem grossen Karl, dem schlauen Heinrich, dem Markgrafen Gero, den Meissener Bischöfen, den dänischen Herrschern, nicht viel mehr von eigener Geschichte.
Eine recht dürftige Historie. Geschickte, fleissige Forscher und Sammler haben dagegen Mythen, Sagen, Märchen, Volkslieder, Schnurren, Eigentümlichkeiten in Sitte und Brauch getreulich niedergeschrieben, Dinge, die Zeugnis geben von dem Leben, das einst im wendischen Völkerwald war. Schmaler, Andree, Schulenburg, Veckenstedt, Tetzner und andere tüchtige Männer wurden unsere Lehrer über das Wendentum. Aber es sind nur Einzelheiten, Forschungsergebnisse, abgerissene Töne und Klänge, die sie einfangen. Ein ganzes Bild haben sie nicht zusammengestimmt; selbst die Sage vom König der Wenden liegt bei ihnen in Schutt und Trümmern.
Die deutschen Dichter sind an diesem einsamen Heide- und Flusswald, an dieser geschichtlichen Trümmerburg vorbeigegangen. Die Wenden selbst waren immer stille Leute. Kein politischer Alarmruf ging von ihnen aus, kein kraftvoller Dichter erstand aus ihrer Mitte. Ein tausendjähriges Volk sind die Wenden, ohne Geschichte, ohne Literatur, ohne bildende Kunst, kleine Ansätze abgerechnet.
Wenn mich, den Schlesier, das Heidegeheimnis meiner Heimat reizte, so lag das nahe. Ich bin mit ganzer Liebe an das Werk gegangen, habe nach den Trümmerbildern, die ich fand, die Sage vom Wendenkönig rekonstruiert und hoffe, dass mich das deutsche Herz nirgends, wo zwischen Nationalitäten abzuwägen war, zu einer Sünde ungerechter Parteilichkeit verführt hat.
Kraft, geistige und körperliche Fruchtbarkeit, Entwicklungsfähigkeit, Wollen zur Höhe, Schätze und Kräfte sonder Zahl waren auch im Volke der Lausitzer Sorben. Die Kinder Gottes sind alle zur Herrschaft berufen. Aber den Wenden fehlten die Führer. Die Könige, die Führer, die Befreier kommen von selbst ihre lichte Strasse daher oder sie kommen nicht, mag das Volk auch tausend Jahre am Boden knieen und rufen: „Tauet Himmel den Gerechten!“
Gegen versagte Gnade, die im Weltplan begründet ist, hilft kein Wollen, kein Beten, kein Toben. Der Führer kommt nicht, das Volk verträumt seine Zeit, es altert und vergeht, ohne dass es jung war. — —
Heutigen Tags hat der Donner der Lokomotiven, das Schnaufen der Automobile, die durch die Wendei rasen, die Lutchen und andere Zwerggeisterlein, die Mittagsfrau und die Kobolde vertrieben; der scharfe Wind geistiger Aufklärung, der schneidend über alles Land fegt, hat die blauen Traumlichter romantischen Glaubens in den Herzkammern der Wenden ausgelöscht; die Sucht nach Gold und Lust hat das Heidevölklein aus seinen stillen Wald- und Wiesenwinkeln hinausgelockt ins breite allgemeine Gefild, in die grosse Stadt, wo die jungen Burschen ihre Kraft, die jungen Mütter die Milch ihrer Brust verkaufen; der Militarismus, der moderne Fabrikbetrieb verlangen viele Kräfte; die malerischen Volkstrachten mit ihrer soliden Pracht haben vielfach schäbigem modischen Zeug aus billigen Bazaren Platz gemacht; die wendische Sprache hört mehr und mehr auf: bald wird die ganze Wendei nichts mehr sein als eine historische Reminiszenz.
Aber in der Zeit, von der dies Buch erzählen will, in den Jahren 1860 bis 66, da war es doch noch ganz anders. Damals begann die Zersetzung des Wendentums erst, die jetzt beinahe vollendet ist.
Die alte Krone.
Rot glüht der Abend über die Heide. In den Wellen der stillen Spree schwimmen die ersten gelben Weidenblätter wie lange, gelbe Schifflein. Eine kleine Flotte, mit der der junge Herbst spielt. Weiden den ganzen Fluss hinab, auch auf den Moorwiesen, die sich lang im Abendsonnenschein dehnen. Torf schläft in der schlammigen, quabbeligen Erde, saures Gras wächst darüber, und zahllose Wollblumen wiegen leicht die Perückenköpfe. Hoch und ragend aber steht der Föhrenwald. Das Auge blickt tief hinein, denn die Stämme sind schlank, die Föhre duldet kein Unterholz. Wie ein Heer von Kriegern stehen die Stämme und sind alle rot wie in blankes Kupfer gepanzert.
Und erst die Kronen! Wie Burgen türmen sie sich in der Luft; das Abendsonnengold vermischt sich dem dunklen Grün, und die Burgen haben alle Wände und Dächer von grünroter Patina bedeckt.
Alt, ehrwürdig, kostbar ist das alles.
Kein Laut. Nur irgend ein schwarzgefiederter Burgwart gibt manchmal den Brüdern ein Signal, die draussen auf der Wiese noch nach Beute suchen.
Der erste Stern taucht auf.
Da treibt der Gänsehirt seine schnatternde Herde heim.
Das zweite Sternlein erglimmt.
Ein alter Wende blinzelt hinauf, erkennt sein Zeichen und treibt zehn Schweinchen, die er aufs Feld geführt hatte, in den Stall.
Das dritte Sternlein schimmert im Osten.
Da singt der Schafhirt zur Heimkehr.
Ein vierter Stern ersteht leuchtend am Himmel.
„Geht ein, Rote, Schwarze, geht ein!“ ruft der Kuhhüter und strebt nach dem Dorfe.
Das fünfte Sternlein strahlt friedlich hernieder. Da hören die Kinder auf zu spielen, schliessen sich den Herden an und helfen sie heimführen.
Draussen, wo die stille Spree schläfrig zwischen den Weiden rinnt und wo die alte Landstrasse weit hinausführt — Gott weiss, wohin! — wird es nun ganz still, und wie der Mond aufsteigt, findet er nichts Lebendes auf den weiten Wiesenplänen als ein paar Birken, die die weissen schlanken Leiber biegen und die herrlichen Lockenköpfe zu leisen Liedern zierlich bewegen. —
Eine Wolke verhüllt das strahlende Himmelslicht, und dunkle Schatten legen sich auf das Gelände und auf die alte Landstrasse, die weit hinausführt, Gott weiss, wohin.
Da schleicht durch die Schatten der Waldbäume ein Gespenst. Es hat einen brennenden Leib, greift mit zuckenden Armen irr in der Luft herum, dehnt sich zur Höhe, kauert sich zu Boden, huscht zu den Birken, verbirgt sich hinter den Weiden, schaut ins Wasser, springt wieder über die Wiese und zittert plötzlich entsetzt empor, als ein zweites brennendes Gespenst ihm nahe kommt.
Da gibt es eine wilde Jagd weit über den Moorgrund. Das erste Gespenst duckt sich zusammen, versteckt sich, wird aufgescheucht, — jagt davon, schlägt Zacken wie ein gehetztes Wild, springt zwischen die Bäume, und das zweite setzt ihm nach, langt nach ihm mit gierigen flackernden Händen — — —
Horch! Ein Knarren kommt die Landstrasse daher. Ein Wagen wird sichtbar. Darin sitzen Menschen. Ganz langsam geht das Pferd, fast unhörbar auf dem grasbewachsenen Wege. Der Kutscher hebt seine Peitsche und weist nach den brennenden Gespenstern.
„Ty ńewetko pomorski!“
„Fluche nicht, Lobo!“ sagt die eine Frau, die im Wagen sitzt, leise und ängstlich. „Gott schütze uns! Es sind Jakub und Merten. Gott sei ihnen gnädig!“
„Gott sei ihnen gnädig!“ brummt auch der eingeschüchterte Knecht.
Da recken sich die Gespenster, langen noch einmal mit brennenden Armen hinauf gen Himmel und verschwinden. —
Langsam schleicht das Fuhrwerk weiter. Nun, da es eine Wegbiegung erreicht, atmet die Frau auf und sagt zu der jüngeren Begleiterin, die neben ihr sitzt, im Flüsterton:
„Es waren Jakub und Merten. Jakub hat seinen Vater Merten, der bei ihm im Auszug war, mit einem Strick erdrosselt, weil er ihm zu lange lebte, und dann hat ihn der Gewissensteufel geplagt, und da hat er sich mit demselben Strick erhängt. Jetzt irren ihre armen Seelen über dem Moor. Hast du gesehen, wie der Vater den Strick in der Hand hält und den Sohn damit treibt?“
Das Mädchen schmiegt sich fröstelnd an die Alte.
„Ich fürchte mich,“ sagt es leise.
„Es ist unsere böse Gegend hier, Hanka,“ fährt die Ältere fort. „Um alles will ich hier nicht sein zur Abendzeit. Und wir wären längst daheim, wenn sich Lobo, der Liederlich, nicht betrunken hätte.“
Der Kutscher hört die Anklage und brummt für sich. Langsam schleicht das Gefährt dahin. Wer will in verrufener Gegend den bösen Jäger wecken oder in rascher Fahrt dem Nachtfuhrmann begegnen? Ist nicht selbst der himmlische Fuhrmann, dessen Wagen am Firmament steht, auf zu rascher Fahrt an eine Mauer der Hölle angefahren, so dass die hintere Achse aus dem Quadrat wich und sich die Deichsel für alle Ewigkeit verbog?
Langsam schleicht das Gefährt. Neue Wiesenflächen tauchen auf. Die alte Bäuerin sagt furchtsam, beklommen:
„Hanka, erschrick nicht; aber ich muss es dir sagen: Hier ist noch eine böse Gegend; hier wohnt die Todesgöttin Smjertniza. Gott schütze uns!“ — — —
In einem Nebelschloss wohnt die Todesgöttin Smjertniza. Sie ist immer in weissen Kleidern. Die Tür ihres Hauses ist zweifach verriegelt, mit einer Menschenhand und mit einem Menschenfuss. Aber ob sich auch die Menschen mit Hand und Fuss gegen die Tür ihres Schlosses stemmen, — wenn sie ihre Lichter entzündet, schiebt sie die Riegel zur Seite und geht über die Felder bis zu den Dörfern. Die Menschen sehen sie nicht. Die Tiere sehen sie. Aber der Mensch, dem sie begegnet und den sie meint, stirbt nach drei Tagen. — —
Drüben liegt die weite Wiese mit dem dunkeln Waldrand.
„Schau gerade aus, Hanka! Gerade aus! Schau nicht hinüber!“
Lobo, der Kutscher, hält durch Zurufe die Pferde zu noch langsamerem Gange an. Wie unter angstvollem Zauberbann schleicht der Wagen dahin.
Da schallt Hundegebell übers Feld. Die Frauen horchen erschreckt auf.
„Es ist Tyra, unser Hund!“ sagt Lobo. „Ich kenne ihn an der Stimme. Er hat sich losgerissen von der Kette.“
Zwei Tiere jagen aus dem Busch am Wegrand, ein Reh, ein Hund dahinter. Sie springen dicht vor dem Gefährt auf die Strasse. Die Pferde bäumen auf. Das Reh bleibt zitternd stehen. Der Hund steht, keucht. Die Pferde stehen.
Die alte Frau schreit gellend auf:
„Die Smjertniza, die Todesgöttin!“
Drüben über der Wiese, weit drüben steht das Nebelschloss — Lichter blitzen drin — eine weisse Gestalt löst sich von dem Schlosse los —
„Die Smjertniza! Die Tiere — sehen — sie —“
„Ty ńewetko pomorski!“ flucht da der Knecht, schlägt auf die Pferde wie rasend, die Pferde gehen durch, jagen die Strasse entlang, springen über einen Graben querfeld auf ein Dorf zu —
Beim Eingang des Dorfes schlägt der Wagen um, — zerbirst an einem Prellstein, — die Insassen fliegen heraus, — die Pferde reissen sich los, jagen davon —
Schreiende Leute kommen gelaufen. Sie richten Lobo, den Knecht, und Hanka, das Mädchen, die wenig verletzt sind, auf und tragen die Bäuerin, die am Sterben ist, nach ihrem Gehöfte.
Wie ein Herrensitz ist das Gehöft des Scholta1) Hanzo. Hoch ragt das schindelgedeckte Wohnhaus, das nach wendischer Art mit der schmalen Giebelseite der Dorfstrasse zugekehrt ist. Die Dorfstrasse ist ziemlich weit vom Hause entfernt. Eigener Zufuhrweg, Teich und Anger liegen zwischen ihr und dem Gehöft; das wendische Angerdorf ist breit und geräumig angelegt. Muster von Lindenblättern, mit Sternen durchwirkt, schmücken den Giebel des Hauses, ein Kreuz schaut ernst aus dem Blattgerank, und ein Spruch, der darunter steht:
„Durch Gott und eigene Kraft
Haben wir’s geschafft“
zeigt an: hier wohnen starke, selbstbewusste Menschen. Es ist eines der wenigen Bauernhäuser der Wenden, die gross, geräumig und von einem gewissen Luxus sind. Ein Mann hat es gebaut, der ein Withas2) werden wollte, der aber doch ein Bauer blieb. Eine hohe Mauer, ein festes Tor schliessen den Hof und den Vorgarten ab, der steinerne Stall, die hölzerne Scheune ragen darüber empor. Der Grossgarten trennt das Gebäude vollends von jeder unmittelbaren Nachbarschaft.
Es ist spät. Um diese Stunde wacht sonst im Gehöft kein Mensch mehr, es sei denn ein Wächter in unsicheren Zeiten, wenn Brandleger in der Gegend auftauchen.
Heute aber sitzen unter dem zweiten Hauptgebäude, das dem Wohnhaus gegenüber liegt, in einem Laubengang, zischelnde Leute, Knechte und Mägde des Grossbauern. Sie hocken auf niederen Schemelchen oder kauern am Boden und schauen hinüber nach den erleuchteten Fenstern.
„Ich hab’ schwarze Holzklötzer in der Spree schwimmen sehen,“ sagt ein Knecht.
„Und ich hab’ weisse Männer fahren sehen in einem Kahn,“ sagt eine Magd.
„Es meldet sich immer an,“ sagt ein drittes.
Dann Stille.
„Erzählt es noch einmal, wie es war, Lobo!“
„Es war ganz einfach,“ sagt einer. „Lobo war besoffen!“
„Hognity kjandros“ — fährt Lobo auf den Sprecher los.
Aber der wehrt ihn gemütlich ab.
„Ich bin kee „abgefaulter Baier“, ich bin höchstens a abgefaulter Schläsinger.“
„Cerwišco! Aas!“ fährt der Wende abermals auf und geht auf den Deutschen zu.
„Ruhe! Tormy gótuju. Die Wolken türmen sich!“ mahnt ein alter Wende. „Drüben liegt die sterbende Frau. Ruhe!“
Ein Weilchen Stille.
Dann: „Erzähl’ es noch einmal, wie es war, Lobo!“
Und Lobo erzählt von den Feuermännern, von dem Hund und dem Reh, von der Todesgöttin Smjertniza.
„Ich dachte, es wär’ Tyra, unser Hund. Es hat mich aber genarrt, es war nicht Tyra. Es war auch kein richtiges Reh. Es waren Tiere von der bösen Meute.“
„Gott schütze uns!“
Tiefe Stille. In den niederen Wendenstirnen arbeiten die Gedanken. Der Riesenarm des Ziehbrunnens streckt sich drohend zum Himmel.
Da flattert eine Gestalt über den Hof. Eine Magd ist es, die aus dem Herrenhause kommt.
„Wie geht es, Anna, wie geht es der Frau?“
Die Magd macht eine klagende Geberde. Dann sagt sie flüsternd:
„Wir wollen die Probe machen.“
Sie zeigt ein Stücklein Speck.
„Du hast ihr die Fusssohle damit gerieben?“
Die Magd nickt.
Da stehen alle wie auf ein heimliches Kommando auf, gehen auf den Zehenspitzen und schleichen den Stall entlang bis zur Hundehütte. Tyra fährt knurrend aus dem Schlafe, beruhigt sich aber, als er die bekannten Gesichter sieht.
Die Magd wirft ihm das Speckstück hin.
„Zeig’ es an, Tyra, zeig’ es an! Friss!“
Der Hund beschnuppert den Speck und lässt ihn liegen.
Da geht ein leiser Schreckensruf durch die kleine Schar.
„Er frisst ihn nicht! Die Frau muss sterben.“
„Tyra ist krank!“ wendet der deutsche Knecht ein. „Er frisst schon zwei Tage lang nichts.“
Sie sehen ihn zornig an und schleichen nach dem Laubengang zurück.
„Die Frau muss sterben!“
„Sie ist erst 50 Jahre. Sie könnte noch viel arbeiten. Sie muss noch lange nicht in den Auszug. Was stirbt sie schon?“
„Man sollte es ihren Söhnen nach Breslau schreiben.“
„Sie haben vielleicht jetzt keine Ferien.“
„Ty bamlak! braucht man Ferien, wenn die Mutter stirbt? Und überhaupt, richtige Studenten haben immer Ferien.“
„Der Grossbauer will morgen früh einen Brief an die Söhne schreiben.“
„Ja, und indes vergehen die drei Tage, die ihr die Smjertniza noch lässt, und die Söhne kommen zu spät.“
„Wie Gott will!“
Der eine Knecht entkorkt eine Branntweinflasche, nimmt einen tiefen Schluck und reicht die Flasche weiter.
„Wie Gott will!“ sagt der letzte, als er getrunken hat.
„Und nun müssen wir alle neue weisse Trauerkleider haben.“
„Die kauft der Grossbauer.“
Als die Mägde von den neuen Kleidern hörten, mischte sich in ihren jungen Herzen mit der Trauer um die Frau ein heimliches Entzücken.
„Grinst nicht so vergnügt, ihr eitlen Frauenzimmer,“ fuhr der alte Knecht Kito sie an. Er war sonst der lustigste Patron trotz seines Alters; aber heute war er völlig gebrochen.
„Erzählt es noch einmal, Lobo, wie es war.“
„Wir wissen es schon!“
„Nein, wie es dort war, in dem Dorfe, von wo ihr kamet.“
„Es war gut. Es gab viel zu essen. Drei Tage sind wir dort gewesen. Es gab reichlich zu essen; nur der Schnaps war etwas zu wässerig. Es war kein Rum darin.“
„Und dann fuhr das fremde Mädchen mit?“
„Sie ist eine Verwandte vom Grossbauern, freilich, das Wasser von der siebenten Windel. Und sie heisst Hanka.“
„Warum hat die Frau die Reise gemacht, zwei Tage mit dem Wagen hin, drei Tage dort, zwei Tage mit dem Wagen zurück? Mit der Eisenbahn fährt sie nicht. Eine ganze Woche war sie fort jetzt in der Arbeitszeit.“
„Sie kann tun, was sie will, sie ist die Frau. Und es sind Verwandte. Das fremde Mädchen bleibt jetzt hier.“
„Ja, sie wird den Juro heiraten, den Erbsohn,“ sagte eine junge Magd, denn sie ist aus dem könig —“
Eine Hand presste sich dem Mädchen auf den Mund, und alle Wenden sahen auf den deutschen Knecht.
Der stand auf und machte eine abweisende Handbewegung.
„Tut nicht so albern! Ich weiss soviel wie ihr!“
Er entfernte sich langsam und ging über den Hof.
Die andern fielen über die junge Magd her.
„Wie kannst du, Wořsla, du Plappermaul? — Vom König spricht man nicht! Noch dazu, wenn ein Fremder dabei ist. Das ist das heilige Geheimnis!“
Das hübsche junge Mädchen brach in Tränen aus.
„Ich wusste es nicht. Ich glaubte, er gehört zu uns.“
„Er ist ein guter Kerl,“ sagte einer; „aber er ist ein Deutscher.“
„Ein hognity kjandros ist er,“ lallte Lobo, der bereits wieder betrunken war.
„Sie ist verliebt in Wilhelm,“ sagte giftig eine Magd; „sie hat ihm drei Haare vom Nacken und ein Stück Haut vom Knie in den Osterkuchen gebacken. Nun ist er in sie vernarrt.“
„Es ist nicht wahr,“ schluchzte Wořsla, „es ist nicht wahr!“
„Ruhe!“ kommandierte der alte Kito. „Heute ist keine Zeit für Liebessachen!“
Es entstand eine Pause. Man hörte nichts als gelegentlich den glucksenden Ton, wenn einer Branntwein trank.
Da sprach der Alte:
„Ich will nicht, dass die Frau stirbt. Sie ist noch jung und sie ist gut. Vor dreissig Jahren bin ich mit ihr auf den Hof gekommen. Ich will nicht, dass sie stirbt. Ich werde sie anräuchern. Noch ehe die Sonne aufgeht, werde ich auf den Kirchhof gehen und Gras abschneiden von einem Kindergrabe. Und ich werde dabei zählen: neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. So werde ich zählen. Und am Morgen werde ich das Gras anzünden und die Frau beräuchern. Das wird ihr helfen. Das wird ihr helfen, oder — oder —“
Er machte eine Handbewegung. Starr blickte er vor sich hin und fuhr dann fort:
„Ich bin alt. Ich weiss nicht, ob ich zurückkomme, oder ob mich die Toten dort behalten. Zeit ist es längst. Es gibt auch Leute, die mir das Leben nicht mehr vergönnen. Wenn eines mit mir auf den Kirchhof gehen will, so soll er es sagen. Er darf aber auf dem Wege kein Wort sprechen.“
Sie duckten sich alle zusammen, als ob plötzlich ein eisiger Wind sie gefasst hätte.
Nur die junge Magd Wořsla sagte:
„Vater Kito, ich gehe mit dir. Du bist sonst so lustig und immer gut.“
Der Alte nickte und sah sie an.
„Wenn sie — wenn sie mich dort behalten, dann lege mir gleich zwei Steine auf die Augen.“
Schritte klangen über den Hof. Wilhelm, der deutsche Knecht, kehrte zurück.
„Will keiner einspannen und nach dem Doktor fahren?“ fragte er.
Sie wehrten alle ab. Der Arzt bringe den Tod. Der Bader sei bei der Frau, die Smjertniza sei auf dem Felde, der Doktor solle fortbleiben.
Der Deutsche wurde wütend.
„Gebt mir den Schlüssel zum Pferdestall!“ rief er zornig.
„Hognity kjandros!“ fuhr Lobo auf.
Da erhielt er eine Ohrfeige, dass er taumelte.
Mit Mühe wurden die Beiden auseinander gebracht. Vergebens versuchte der deutsche Knecht, den Schlüssel zum Pferdestall zu erlangen.
„So werde ich nach der Stadt laufen.“
„Das Hoftor ist zu. Den Schlüssel bekommt er nicht!“
Wilhelm lächelte verächtlich. Aber er fuhr zusammen, als er leises Weinen hörte. Wořsla, die junge Magd, hob die Hände zu ihm.
„Geh nicht! Die Smjertniza geht um! Geh nicht! Es ist nicht nötig! Ich gehe mit Kito zum Friedhof. Wir holen heiliges Gras von einem Kindergrab. Da räuchern wir die Frau an, und sie wird gesund werden.“
Sie streckte ihm, alle Scheu vergessend, beide Hände hin, er aber wehrte sie unwirsch ab und sagte:
„Du bist auch so eine Gans!“
Ging über den Hof und schwang sich über die Mauer.
Die weiten Matten des Riesengebirges sind dort am breitesten und schönsten, wo der grosse deutsche Elbestrom seine Quellen hat. Runde dichte Knieholzgebüsche sind über den kurzen Rasen verstreut wie dunkelgrüne Kränze.
Ein leichter milder Abendwind ging über die sich weit hindehnende Elbwiese und erquickte einige Wandersleute, die vom Gipfel des Hohen Rades herkommend, sich am Boden lagerten.
„Kolossale Fläche,“ sagte ein stattlicher Fünfziger und liess die fröhlichen, stahlgrauen Augen rundum schweifen. „Grandiose Fläche! Und das liegt nun alles hier oben 4000 Fuss hoch und hat keenen Zweck.“
„Aber, Papa, das ist doch so schön!“ entgegnete ihm seine schlanke Tochter; „sieh mal, wie sich diese weiten Wiesen hindehnen und eine so friedliche schöne Brücke sind zwischen den zwei grossen Gebirgskämmen —“
„Jawohl,“ unterbrach sie der Alte sarkastisch und mit imitiert flötender Stimme. „Diese epische, ruhige Breite, nur hin und wieder unterbrochen durch die Lyrismen winziger märchenhafter Knieholzwälder, deren Baumstämmchen nur so gross sind wie die Kinder und so verträumt sind wie die Kinder.“
„Papa!“
„Tja! Herrschaften, denken Sie nu ja nicht etwa, die Stelle von der epischen Wiese und von den lyrischen Kniehölzern is von mir. Keene Spur! Hier steht sie, die diese Stelle gedichtet hat — meine Tochter Elisabeth von Withold. Es hört sich grossartig an, sowas. Man kann sich zwar nischt dabei denken, aber es klingt nach was!“
„Papa, du hast —“
„Ich habe jar nischt. Dein Papa „hat“ nie! Nämlich spioniert! Er hat sich lediglich erlaubt, direkt auf dem Wege ein Notizblatt zu finden, das seine poetische Tochter verloren hatte und das er hiermit submissest zurückerstattet, weil er keine Verwendung dafür hat.“
„Gnädiges Fräulein, die Stelle von der epischen Ruhe dieser grossen hohen Wiesenflächen und ihrer lyrischen Unterbrechung durch die kleinen Büsche mit ihren bizarren Zwergstämmchen und wunderlichen Kronen ist herrlich. Bitte, schenken Sie mir das Blatt!“
Der das sprach, war ein junger, schlanker Mann. Der Alte lachte fröhlich.
„Bravo, Herr Juro, bravo! Man hört ihnen gleich an, dass Sie Ackerbau studieren und künftiger Scholta und Grossbauer im Wendenland sind. Jawohl, das ist unsere moderne Landwirtschaft! Der Landwirt stellt sich an die Wiese und phantasiert von epischer Ruhe und lyrischer Unterbrechung, und die Ochsen zu Hause verhungern und die Wirtschaft geht sachte zum Deibel.“
„Lieber Vater —“
„Lieber Sohn?! Sei du man stille! Denn du bist erst der rechte!“
Heinrich von Withold, ein zweiter junger Mann, nickte seinem Vater gemütlich zu und pfiff eine kurze musikalische Sentenz.
„Pfeif nur, Bürschel, pfeif nur! War wohl wieder von dem verrückten Kerl, von dem Wagner? Ich sage — einmal und nicht wieder!“
Niemand fragte, was er meine. Alle wussten, er meine, einmal habe er eine der neuen Wagnerschen Opern angehört und tue das nie wieder.
„Auf keinen Fall!“ fuhr Herr Withold zornig beteuernd fort. „Jetzt, — was soll ich machen, dass der Junge, der Heinrich da, sich viel mehr mit musikalischen Faxen abgibt, als dass er Volkswirtschaft und Agrikultur studiert, wofür ich ihn, Himmeldonnerwetter, nach Breslau zur Universität geschickt habe?! Was soll ich machen?“
„Ach, wir können die Kinder nach unserm Sinne nicht formen,
So wie Gott sie uns gab, muss man sie halten und lieben,“
entgegnete Heinrich, der Jüngling. „Siehst du, Papa, diese Verse sind auch dichterisch, zwar nicht von meiner Schwester Elisabeth, aber von Goethe, von Johann Wolfgang von Goethe.“
„Affe!“ sagte der Alte. (Er meinte seinen Sohn Heinrich, nicht Goethe). „Affe!“ wiederholte er, „ihr habt Glück, dass ihr so einen schafsgutmütigen Vater habt, sonst Donnerschlag ja —! Ich amüsier’ mich schon immer, wenn ich so’ne Visitenkarte von einem Studenten sehe: „stud. med.“, „stud. iur.“, „stud. phil.“, „stud. agric.“ und was da alles draufsteht. — Da sag’ ich mir immer, das erste „stud.“, das is das, was der Kerl im allgemeinen nicht macht, und das, was dahinter kommt, das is das, wovon er sich ganz besonders drückt. Herr Gott, dahier stehen zwei Studenten, cives academiae, wie es so stolz heisst — Herr Juro und Herr Heinrich, mein vielbegabter Herr Sohn; beide sollen in Breslau Agrikultur studieren, beide sollen ja einmal grosse Güter übernehmen. Gut! Kommen wir also hier an diese kolossalen Bergwiesen. Müsste man denken, — halt, — Studenten des Ackerbaues — halt! — was werden die machen? Werden sich gewiss hinstellen und sagen: Bis zu dem Gebüsch da soundsoviel Huben, bis zur Baude soundsoviel Huben und so weiter. Und dann: Verflixt ja, wenn ich diese Prachtwiesen unten im Gelände hätte — das Kroppzeug von Knieholz rodete ich aus — Klee? — Ruchgras? — Luzerne? — Zum mindesten Buchweizen? — Wollen mal sehen! — Aber die Wiesen liegen nu mal hier oben. 4000 Fuss hoch. Nichts zu machen mit Talbepflanzung. Aber mit Almenwirtschaft, zum Donnerwetter, mit rationeller Almenwirtschaft! Schande und schade um so herrliche Flur! Jawohl, so müsste man denken, würden zwei Studenten sagen, die Ackerbau studieren. Ach, du oller Döskopp! Einer spricht von epischer Breite und lyrischer Unterbrechung und einer pfeift ’ne Melodie, nach der nicht mal sein letzter Pferdeknecht tanzen mag.“
„Herr von Withold, Sie haben ganz recht. Was mich angeht, so befinde ich mich sicher an ganz falschem Platze. Ich habe eben für die Landwirtschaft nicht das mindeste Talent.“
„Na, Juro, so schlimm wird ja das nun nicht sein. Hauptsache, Sie geben sich Mühe. Seh’n Sie mal, das schöne Gut wartet doch auf Sie! Ein Rittergut können Sie aus der alten wendischen Scholtisei machen, wenn Sie’s vernünftig anstellen. Ihr Grossvater und ihr Vater haben ja kolossal zugekauft. Wie gross ist denn ihr Väterliches jetzt?“
„Ich weiss es nicht,“ sagte Juro achselzuckend.
„Sie — Sie wissen das nicht? Ja, erlauben Sie mal, das — das ist arg! Studiert Ackerbau und weiss nicht mal, wie gross das väterliche Gut ist. — Das ist ja unglaublich! Als ich so alt war wie Sie, kannte ich auf unserem Gute sozusagen jedes Rind, jedes Schaf, jeden Hahn persönlich mit seiner ganzen Lebens- und Familiengeschichte. Und Sie wissen nicht mal — ja, dann ist’s allerdings am besten, Sie hängen die Geschichte an den Nagel.“
„Ich möchte wohl, wenn ich es könnte.“
„Aber Mensch, Christ, Bürger, Sie haben doch Traditionen zu erfüllen! Sie können doch nicht mir nichts dir nichts eine so wunderbare Sache fahren lassen. Donnerwetter, bei Ihnen ist ja von Bauernwirtschaft gar keine Rede mehr, das ist doch ein grosses Gut! Ja, Mensch, wollten Sie denn lieber ein ärmlicher Stubenhocker sein als über eigenen Grund und Boden schreiten als freier Mann, dem niemand auch nur ein Wörtlein zu sagen hat, der lebt wie ein König?“
„Wie ein König der Wenden!“
„Red’ mir nicht hinein, Heinrich! König der Wenden, das gibt’s nich! Das is eine von den vielen alten Sagen, die die Wenden haben. Unsere Wenden sind gute Preussen, haben ihren König in Berlin, wie andere Preussen, ihren Bramborski Kral. Aber ein König in seiner Art ist jeder freie Landwirt und nur er, alle anderen bis zum Minister und General hinauf sind abhängige Diener.“
Er nahm einen Schluck aus der Reiseflasche und fuhr fort:
„Und Heimat — ist Heimat gar nichts mehr? Irgendein Tand, den man leichten Herzens aufgibt? Sehen Sie, Juro, Ihre Wendenheimat ist schön! Nicht lauter Kernboden — nein, viel Sand und auch Moor dazwischen. Aber doch gutes, treues Land, auf das man sich immer noch verlassen kann. Ja, und ich — ich bin ja eigentlich ein Fremder dort zu Lande. Na, schütteln Sie nich den Kopp! Ich bin ein deutscher Rittermässiger, der sich im Wendenland sein Gut gekauft hat. Ja, ich kann mich nicht beschweren, die Wenden sind gute Leute. Saufen ja ’n bissel — das tun wir auch, — sind auch sonst nicht gerade grosse Säulenheilige — das sind wir auch nicht, — aber sind fleissige Arbeiter und ehrliche Leute. Juro, ich bin ein Deutscher, aber ich möcht’ aus dem Wendenland nicht raus; es is mir zur Heimat geworden, wenn ich mir auch jetzt noch mit jedem wendischen Wort die Zunge verrenke. Und Sie — Sie sind doch ein geborener Wende!“
Juro liess den Kopf sinken und zupfte mit den Fingern an dem kurzen Grase. Der Wind spielte leicht mit seinen schlichten blonden Haaren, und eine tiefe Röte bedeckte seine Wangen. So sprach er:
„Ach, Herr von Withold, Sie wissen nicht, woran Sie da rühren. Das sind ja die Kämpfe, die ich seit vielen Jahren führe mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit mir selbst, auch mit meinem Bruder Samo. Dass ich für die Landwirtschaft kein Talent und kein Interesse habe, ist ja von meiner Nationalität ganz unabhängig und hat damit gar nichts zu tun. Ich studiere ja auch in der Hauptsache Medizin und höre nur nebenbei einige landwirtschaftliche Vorlesungen. Was mich grämt, ist aber, dass sie mich zu Hause alle als einen Abtrünnigen ansehen, als einen, der sein Wendentum verrät und ein Deutscher wurde.“
Der junge Mann stand auf. Eine grosse Erregung überkam ihn.
„Ich will’s ja nicht leugnen, ich bin ein Deutscher in meinem Herzen. Aber ich wehre mich dagegen, dass ich das Wendentum verraten haben soll. Was sind die Wenden noch? Ein winziges Häuflein, eingesprengt ins grosse deutsche Volk. Und wie ist ihnen zu helfen? Dadurch, dass sie sich feindselig und eigensinnig absperren? Dann müssen sie verhungern, vor allen Dingen auch geistig verhungern. Wir haben keine grosse Nationalliteratur, keine nationale Kunst, keine nationale Wissenschaft, keine grosse nationale Schulen, nicht einmal nationale Geschäftsbetriebe. Auf unseren Walddörfern sitzen wir in Armut, und wenn einer hinauskommt und nichts kann als seine wendische Sprache, die niemand versteht, dann wird er ein Helot, und das ganze Volk wird ein Helotenvolk werden. Das will ich nicht, dagegen wehr’ ich mich, eben weil ich die Meinigen liebe, und darum müssen wir, die selbst zu schwach sind, uns an ein stärkeres und reicheres Volk anschliessen, müssen wir eine Sprache haben, die ins weite Land klingt und auf vielen Märkten und in vielen Hörsälen verstanden wird.“
Er hielt inne und blickte hinunter ins tiefe Elbtal, das den preussischen und den böhmischen Kamm des Riesengebirges trennt. Steil fallen die Felsenwände des böhmischen Korkonosch hinab zum Fluss. Juros Blicke schweiften hinüber zum böhmischen Land. Und er sprach das, was in seinem jungen Grüblerherzen sich in vielen einsamen Stunden gebildet und immer wiederholt hatte, was er wie sein eigenes Evangelium auswendig konnte:
„Anschluss an ein glücklicheres Volk, als wir sind, denen das Schicksal durch alle Jahrhunderte die Grösse und Selbstherrlichkeit versagt hat! Kapitulation in Ehren! Aussöhnung mit gegebenen Notwendigkeiten, Aussöhnung, die uns nicht schändet, die uns vorwärts führt. Heimatsuchen in weitem Gefild, Heimatsuchen, das meinen stillen, gutmütigen Brüdern und Schwestern nicht schwer fallen wird. Aber nicht dort drüben, nicht bei den Tschechen, die unsere Vettern heissen, die viel glücklicher waren als wir, in viel reicherem Lande wohnen und die doch trotz aller Grossmannssucht den Weg zu einer hohen Staffel der Menschheit nicht fanden. Wir wollen Deutsche sein, im Deutschtum vorwärts kommen und ehrlich mithelfen, das, was uns am Deutschtum nicht gefallen kann, zu ändern und zu bessern.“
Der alte Withold reichte Juro gerührt die Hand, und der Mund des jungen, leidenschaftlich erregten Wenden zuckte.
Im Silberlicht des Mondes spielte die junge Elbe auf der Bergwiese. Und sie plauderte harmlos wie alle Bächlein, die mit Gräsern spielen und mit lachendem Glick-Glack und Hopp-Schlock über wichtigtuende Hölzchen wegsetzen, die sich ihnen neckend in den Weg legen. Das spielende Königskind, das zu Grossem berufen ist, zur Beherrscherin weiter Lande und mächtiger Städte, tändelt hier in seiner Jugendheimat, lacht, tanzt und plaudert wie ein armes Wiesenwässerchen, das im nächsten Dorfteich mündet.
Aber eine ungestörte Jugend haben Königskinder nicht. Alte Leute, die von ihrer grossen Mission wissen, nehmen sie von Zeit zu Zeit vom Spielplatz weg, bekleiden sie mit Grösse und Würde, mit Brokatgewändern und goldenen Kronen, trichtern ihnen ein trutzig und altklug Sprüchlein ein und stellen sie so dem Volk zur Schau.
„Seht da, das Königskind! Seht die Würde und Grösse, die in ihm ruht!“
Also geschieht es auch mit der jungen Elbe. Ihre Wässerchen werden in einem grossen Wasserbehälter aufgefangen, der dicht an einem felsigen Abgrund liegt, und wenn der ganze Behälter voll ist und wenn genug Volk da ist, das geneigt ist, feinen Tribut zu entrichten, dann zieht der Wärter, der Gouverneur des jungen Königskindes, eine Schleuse, und das Kind, das eben noch silbern lachte, spricht plötzlich mit donnernden Herrscherworten, entrollt seinen tausendfältigen Demantmantel, steigt mit Riesenschritten hinab ins Tal.
Freilich, es ist nur ein höfisches Theater, es ist nur, um dem Volk ein Schaustück zu stellen. Kaum ist das Königskind im Tal angelangt, so zieht es den wallenden Demantmantel wieder aus, hört auf, seinen eingelernten Donnerspruch zu sagen, und spielt und tändelt wieder wie andere Kinder. — —
Einsam lag die Gebirgsbaude an der Felsschlucht, wo der alte Wärter am Wasserbassin lehnte und wartete, ob er um ein Stücklein Trinkgeld den „Elbfall“ noch einmal „ziehen“ können würde. In der Baude sassen Gäste, lachten bei böhmischem Wein. Ein Fiedler spielte, sein Weib schlug die Guitarre. Sie sangen „Gott erhalte Franz den Kaiser“ und „Heil dir im Siegerkranz“.
Die drei Künstlermenschen, das Geschwisterpaar Withold und der junge Wende Juro, wanderten draussen durch den lichten Abend, sahen den Himmelskuss des Sternenlichts auf den Stirnen der Berge, sahen das tiefe dunkle Elbtal hinab einen weissen Nebelschwaden fahren, der war wie ein silberner Kahn auf dunklem Strom. Als die drei zu einem schmalen, steinigen Fusssteig kamen, der in die Elbschlucht führt, sagte Heinrich zu Juro und Elisabeth:
„Steigt ein Stücklein da hinab. Ich gehe hinüber zum Wärter, er muss den Fall noch einmal ablassen. Das wird schön aussehen jetzt im Mondschein.“
Da standen Juro und Elisabeth erst zögernd still, dann gingen sie beklommen den dunklen, schmalen Felsenweg hinab. Sie waren jung. Sie waren Träumer. Sie liebten sich, und ihre Seelen waren unverdorben. Da war die herzschlagende Scheu in ihnen, die bange Furcht und doch auch die schmerzliche Sehnsucht: jetzt in dieser lichten Abendstunde möge die Zeit gekommen sein, wo das goldene Tor zum Allerheiligsten ihrer Seele aufspringen und sich das Wunder offenbaren würde, das wohlgehütet da wohnte — ihre Liebe.
Langsam stiegen sie den holprigen Pfad hinab, und wenn der Mann dem Mädchen die Hand reichte, dann glühten die Hände ineinander wie im Fieberfeuer oder sie trafen sich kalt wie in Schreck und Angst.
Als sie endlich stehenblieben, war ein Baumstamm zwischen ihnen, aber sie fühlten ihre Nähe, und es war, als ob tausend weiche Wunderfäden sich um sie und den Stamm rankten und sie in weltferne Wonnen einspännen. Ein Nachtvogel huschte vor ihnen auf; sonst war alles in tiefer, feierlicher Ruhe.
Da kam ein Plätschern, ein Rauschen, dann ein Brausen, und donnernd fiel eine Silberflut vor ihren Augen durch die Nacht, und eine Siegeshymne dröhnte an ihr Ohr. Eine Fülle von Schönheit, Grösse, Kraft ward vor ihnen aufgetan, ein Siegesjubel, ein jauchzender Glaube an Glück und Freude durchschütterte sie —
Der Strom überdröhnte den Schlag ihrer Herzen, und sie lagen sich in den Armen zum ersten langen, heissen Kuss.
Sie sprachen kein Wort. Den ganzen grossen jubelnden Inhalt ihrer Herzen sang der silberne Fluss in gewaltiger Melodie.
Erst als der Strom versiegte, als ein dünnes Rinnlein einen leisen Epilog zu dem grossen Schauspiel sprach, da erwachten sie zur Menschensprache und gaben sich in stammelnden Fragen und wirren Antworten, mit leisem Seufzen und glückseligem Lachen Kunde von ihrer Liebe.
„Ich gehöre dir für immer und ewig!“
Diese Worte sprach Juro fest und mit feierlichem Ernst. Es war ein Gelöbnis, das aus der Gegenwart herauswuchs und an keine Kämpfe der Zukunft dachte.
Der Wendensohn und das deutsche Mädchen hatten sich verlobt. — — —
Heinrich kam, merkte sogleich, was geschehen sei, drückte dem Freund und seiner Schwester die Hand und übernahm es, oben auf dem Wiesenplan die Verwirrung der beiden jungen Leute durch seine Munterkeit zu verbergen.
Die Eltern und alle andern Gäste waren aus der Baude gekommen, und nun wurde im Freien eine grosse Polonaise geschritten, zu der der Böhme und sein guitarreschlagendes Weib gar lieblich musizierten.
Ein später Wanderer kam vom Hohen Rad herüber. Er war schon weit gegangen, hatte in vielen Bauden Einkehr gehalten und überall dieselbe Frage getan. Nun wies ihn die Spur, der er folgte, nach der Elbfallbaude, die da endlich vor ihm lag. Er hörte die Musik, sah tanzende Gestalten, hörte ein deutsches Lied singen und blieb stehen. Den Hut hielt er in der Hand, der Mond bestrahlte seinen Kopf.
Schlichtes, schwarzes Haar, in die Stirn gekämmt, etwa wie es die Russen tragen, breite Wangen, zwei kleine dunkle, bewegliche Augen. Die Figur klein, aber kräftig, ein wenig krummrückig, so dass der Hals kurz, gedrückt erschien. Er war jung, ohne recht jung auszusehen, über dem scharf und energisch geschnittenen Mund war kein Barthaar zu sehen.
Wieder tönte das Lied herüber. Da kniffen sich die kleinen Augen zusammen, und der Fremde sprach in fremder Sprache:
„Tolle Deutsche auf slawischem Boden!“
Im Weitergehen summte auch er ein Lied:
„Kde domov muj?“
Es war das tschechische Heimatlied: „Wo steht mein Vaterhaus?“
So kam er an die Baude heran. Mit finsterem Blick schaute er dem fröhlichen Tanze zu, blickte er besonders auf Juro, der mit Elisabeth tanzte und die Ankunft des Fremden gar nicht bemerkte.
Da fasste ihn dieser am Arm, hielt das Paar an.
„Hör auf zu tanzen!“
Er sagte es in der fremden Sprache.
Juro wandte sich ihm bestürzt zu.
„Was — was ist? — Samo — du? — du — Samo? — Ja, — was — was willst du denn?“
„Dass du aufhörst zu tanzen!“
„Was fällt dir ein? — Wo kommst du her? — Kennst du denn Fräulein von Withold nicht, die Tochter von Herrn von Withold aus unserem Nachbardorf?“
Der Fremde machte Elisabeth eine leichte mürrische Verneigung.
„Ich habe mit meinem Bruder zu reden,“ sagte er kurz.
„Samo, ich verbitte mir diesen Ton! Ich verbitte mir, dass du mich hier mitten im harmlosen Tanz überfällst.“
„So tanze weiter! Indes liegt unsere Mutter daheim im Sterben!“
„Du bist — du bist wohl wahnsinnig?“
Der andere reichte ihm ein Depeschenblatt hin.
„Mutter tödlich verunglückt —“
„Samo — was — was — das ist ja nicht möglich, — o Gott, Samo, das ist doch nicht wahr? Sag doch, was das ist, — sag doch, was du weisst —“
„Ich weiss, dass ich das Blatt in Breslau bekam, dass ich hierhergefahren bin und dass ich dich den ganzen Tag gesucht habe.“
Juro brach in ein mühsam unterdrücktes Schluchzen aus und wollte sich dem Bruder an die Brust werfen. Der wehrte ihn ab.
„Hol deine Sachen und komm!“
Eine Weile stand Juro fassungslos da, indes seine Hände das böse Blatt zerknitterten, dann wandte er sich zu Elisabeth.
Die stand mit todblassem Gesicht neben ihm. Die anderen drängten heran, die Musikanten brachen das Spiel ab, eine kurze Auskunft wurde gegeben, eine Flut bedauernder Worte wogte durcheinander.
Da ging Juro nach der Baude, holte sein geringes Reisegepäck. Als er vor Elisabeth zum Abschiednehmen stand, sagte er leise zu ihr:
„Nun bleib mir treu! Jetzt brauche ich dich mehr als früher!“
Sie wollte etwas sagen, aber ihre Lippen zuckten nur. Doch sie drückte ihm die Hand.
Bald darauf wanderten die beiden Brüder der preussischen Grenze zu.
Drüben im Wendenland kämpft die verunglückte Frau mit dem Tode.
„Es geht zu Ende! — Nehmt mich aus dem Bett! Holt frisches Stroh. — Weine nicht so sehr, Hanka! — Wenn ich tot bin, weine nicht auf meinem Sarg — — sonst müsste ich kommen und dich zu mir holen — —“
Eine lange, bange Pause. Dann fährt die Kranke fort:
„Kommt Juro? — Habt ihr ihm geschrieben? — — Ich muss noch mit ihm reden — — und ich will ihn sehen —“
Der alte Scholta tritt ans Bett seiner Frau.
„Juro kommt, und auch Samo kommt.“
Die Kranke lächelt und reicht ihrem Gatten die Hand.
„Hanzo! Ich danke dir, dass du mich zu deiner Frau genommen hast! Das war eine Gnade von Gott!“
Über das scharfgeschnittene, bartlose Gesicht des alten Wenden geht ein tiefer Schmerz; aber er sagt nichts als:
„Gott helfe dir!“
Die Frau richtet den Blick nach der Wand, wo der Glasschrank steht. Er ist aus gelbgestrichenem Kirschbaumholz und hat eine Tür mit drei Glasscheiben, durch die man ein Gewirr bunter Dinge sieht. Da sind