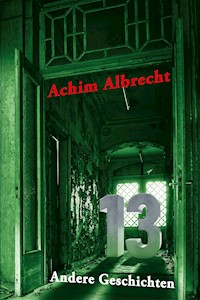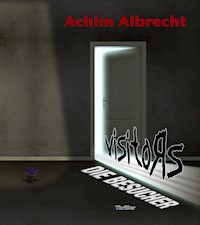Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OCM
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein verschlafenes Dorf in der Westpfalz. Ein Junge verschwindet und taucht viele Jahre später traumatisiert als Erwachsener unter den ungewöhnlichsten Umständen nahe einer riesigen unterirdischen Militäranlage der amerikanischen Streitkräfte wieder auf. Die 'Raketenstation' ist schon lange verlassen. Der Aufgefundene fantasiert von Stimmen, Lichtern und Insekten. Er ist gestört. Niemand schenkt seinen Worten Beachtung. Nur drei Jungen werden aufmerksam. Menschen und Tiere verändern sich. Langsam, unmerklich. Eine neue Bewegung nimmt ihren Ausgangspunkt in dem unscheinbaren pfälzischen Dorf. Seltsame Vorfälle passieren in immer kürzeren Abständen weltweit. Drei Jungen und ein verstörter Einsiedler begeben sich auf eine Mission. Eine Mission, die sie tief in den Pfälzer Wald führt. Sie haben eine Vermutung. Sie haben einen Plan. Ihr Gegner wartet auf sie. Eine ungewöhnliche Geschichte voller Spannung und nicht alltäglicher Charaktere, verwickelt in einen ungleichen Kampf mit ungewissem Ausgang. Ob die Geschichte wahr ist. Gewiss, das ist sie in Teilen. Ja, wirklich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Cover zeigt den Schattenriss von Bäumen in einem Wald vor mysteriösem, giftig grünem Leuchten.
Die Anderen
Achim Albrecht
1. Auflage September 2024
© 2024 OCM Verlag, Dortmund
Gestaltung, Satz und Herstellung: OCM Verlag, Dortmund
Verlag:OCM Verlag, Dortmund, www.ocm-verlag.de
ISBN 978-3-942672-83-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt auch für die Vervielfältigung (Digitalkopie/Fotokopie/Mikrokopie) und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
1. Kapitel – Im Wald
2. Kapitel – Die Suche
3. Kapitel – Der Vorfall
4. Kapitel – Walther
5. Kapitel – Der Facharzt
6. Kapitel – Abrisskante
7. Kapitel – Der Entdecker
8. Kapitel – Märchenwald
9. Kapitel – Die Unzertrennlichen
10. Kapitel – Die Vorbereitung
11. Kapitel – Das Treffen
12. Kapitel – Walther macht sich bereit
13. Kapitel – Walther erzählt
14. Kapitel – Die Pilzkundige
15. Kapitel – Die Welle
16. Kapitel – Die Aufrechten
17. Kapitel – Die Sache mit Karl
18. Kapitel – Der Verrat
19. Kapitel – Der Aufbruch
20. Kapitel – Der Abgeordnete
21. Kapitel – Die Zone
22. Kapitel – Im Schlund
23. Kapitel – Der Aufruhr
24. Kapitel – Apokalypse
25. Kapitel – Finis
26. Kapitel – Ernüchterung
27. Kapitel – Die Freunde
28. Kapitel – Epilog
Über den Autor
Über den Verlag
Orientierungsmarken
Cover
Impressum
Inhaltsübersicht
Textanfang
1. Kapitel Im Wald
Eine verhangene Sonne mischte sich wie ein zerlaufender Eidotter zwischen Wolkenschlieren. Es war brütend heiß, wie es sich für einen Hochsommertag gehörte. Der Waldweg schlängelte sich unter den Bäumen heraus über eine freie Fläche. Die Schatten hatten sich zurückgezogen und die Insektenschwärme rüsteten sich für die Dämmerung. Die Gegend wirkte ausgestorben. Der Wind, der gerne spielerisch über die Rapsfelder fuhr und die Pflanzen zu wirren Mustern zerzauste, hielt den Atem an. Die Sonne hatte für eine kurze Zeit die Herrschaft übernommen und alles beugte sich ihrem Willen.
Der kleine Junge war überraschend aufgetaucht. Er betrat den Pfad aus einer Senke heraus, die mit Büscheln vertrockneten Grases gesäumt war. Ohne seinen tief gesenkten Kopf zu heben, schien er dem Eigenleben seiner Sandalen zu folgen, die bei jedem Schritt Sand aufwirbelten. Ohne zu zögern wandte er sich nach rechts. Seine braunen Locken fielen in eine schweißnasse Stirn und waren über den Ohren ungeschickt gekürzt. Die Arme des Jungen schlenkerten beim Gehen. An seinen kurzen Hosen und dem Ringelshirt hatten sich Kletten und Blätter verfangen. Der Junge schien es nicht zu bemerken. Seine verschorften Knie bewegten sich über die Lichtung in Richtung eines dicht bewachsenen Waldstücks, durch dessen Blätterdächer die Sonne ihre Strahlen in feinen Mustern flocht. Der Junge hielt nicht inne. Er hatte das Spiel aus Licht und Schatten schon oft beobachtet. Er schien ein anderes Ziel zu haben. Ein Ziel, das jenseits der Lichtung lag, die an zwei Dörfern entlangführte. Das eine Dorf war hinter einer Senke verschwunden, das andere duckte sich in Sichtweite in eine hügelige Landschaft. In der Ferne konnte man Dächer sehen. Das Mauerwerk hielt sich verborgen.
Auf dem Pfad war man allein. Nur sonntags war der Wald erfüllt von Stimmen und Hundegebell. Familien unternahmen ihren Spaziergang und freuten sich über den freien Tag und die gedeckten Kaffeetafeln in den Häusern, wenn die Schatten länger wurden. Es war ein harmloses Vergnügen und die Gelegenheit, im Sonntagsstaat für zwei Stunden dem Alltag zu entfliehen. Für Väter gehörte der Spaziergang mit den Kindern zu ihrer Erziehungspflicht. Tanten und Onkel kamen hinzu. Mütter lösten sich für kurze Zeit von ihren hausfraulichen Pflichten und Kinder sträubten sich gegen gestärkte Hemden, bonbonfarbene Kleidchen, Samtschleifen im Haar und blank gewienerte Schuhe. Man schrieb den 25. August 1985.
Sieben Jahre vorher war der Junge, den der Wald mittlerweile wieder verschlungen hatte, auf die Welt gekommen. Er hieß Walther und sollte seiner Mutter keine Freude machen. Sie hatte es geahnt, weil es ihr Schicksal zu sein schien, dem Leben jedes Fünkchen Freude abtrotzen zu müssen. Sie war zu einer Zeit aufgewachsen, als man ihresgleichen noch Zigeuner nannte und davonjagte, bis ihre bunten Wagen, die stämmigen Zugpferde und die bunten Röcke der Frauen mit dem Horizont verschmolzen. ‚Fahrendes Volk‘ nannte man sie später und ‚Zigeuner‘ nur noch hinter vorgehaltener Hand, weil es sich so gehörte. An den Lebensumständen hatte sich nichts verbessert.
Die Großmutter, die aus der Hand und aus Teeblättern die Zukunft lesen konnte, hatte ihr gesagt, dass sie sich glücklich schätzen konnte, Ellen zu heißen. Ellen war keiner der alten Namen, die fremdländisch und nach Heimweh klangen. Ellen war ein eleganter Name, mit dem Versprechen auf roten Lippenstift und ausgestellte Röcke. Viel mehr konnte das Kind seiner Großmutter nicht entlocken, die hin und wieder schweigend die Innenfläche ihrer linken Hand inspizierte und seufzend darüberstrich, als ob sie die Linien und Einkerbungen wegwischen und ungeschehen machen wolle. Ellen hatte nicht den Mut Fragen zu stellen. Ohnehin gab es zu viel zu tun. Man zog von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt, nahm Aufstellung auf Jahrmärkten und handelte mit allem, was sich ergab, mit der Zukunft, die jedem Menschen in die Hand geschrieben steht, mit Pferden, die an die grellbunten Wohnwagen angebunden waren und mit Eisenwaren, deren Herkunft Ellen unbekannt blieb.
Überall, wo sie auftauchten, liefen Kinder neben den Wagen her, überall wies man ihnen widerstrebend Rastplätze zu und überall verjagte man sie unter Geschrei, begleitet von Steinwürfen, weil mit dem Auftauchen der Fremden Wäsche, Vieh und allerlei fremdes Gut verloren ging. Man schrieb dies den Zigeunern zu. Manchmal behaupteten die Leute auch, es seien Krankheiten ausgebrochen und Zigeuner beherrschten die alte Kunst des Verfluchens. In den Gesichtern der Dorfbewohner ließen sich die finsteren Gedanken erahnen.
In solchen Fällen drängte der vierschrötige Führer der Sippe, ein schnauzbärtiger Onkel, zum Aufbruch und die Wagen rumpelten hastig davon. Zurück blieben die Reste des Lagers und aufgebrachte Menschen, die ihre Fäuste hinter den Fahrenden schüttelten.
Es war ein freies Leben, sagten die einen. Es war ein elendes Leben, sagten die anderen. Ellen war in dieses Leben hineingeboren worden und sie war geboren worden mit dem Willen, anders zu sein.
Sie war jung, als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Wenn sie reisten, waren die Schulen eine willkommene Abwechslung. Die Lehrerinnen stellten sie der Klasse vor und setzten sie auf einen freien Platz. Sie wussten, dass das zarte Mädchen, das anders roch, anders sprach und anders gekleidet war, nicht lange bleiben würde. Kaum jemals machten sie sich die Mühe, den Wissensstand des Mädchens zu prüfen oder darauf zu achten, dass die abgegriffenen Bücher und Hefte dem Lehrplan entsprachen. Ellen jedoch war neugierig auf die Welt und lächelte. Ihr Lächeln war ihr Kapital und wer sie einmal hatte lächeln sehen vergaß weder ihr Gesicht noch ihre kerzengerade Erscheinung.
„Wie eine Königin“, hatte ein blonder Bauernjunge aus der Abschlussklasse geflüstert, als die fremdartige Erscheinung neben ihm in der Schulbank Platz nahm. Er konnte nicht aufhören sie anzustarren. Ellen strich sich die langen, glänzenden Haare aus dem Gesicht und lächelte. Das sicherte ihr in den Schulen, die sie besuchte, die Bewunderung der Jungen und den Neid der Mädchen, die spitze Bemerkungen machten und hinter ihrem Rücken abfällig über die Fremde redeten. Ellen war es gewohnt. Sie schien über den Dingen zu stehen. Für sie war die Schule der Schlüssel zu allem, was sie bereicherte. Vor allem mit den Büchern schloss sie Freundschaft. Alte, abgegriffene Exemplare waren ihr genauso recht, wie die neuen, die in Schutzumschläge eingebunden waren. Ellen las alles, dessen sie habhaft werden konnte und Welten taten sich auf. Manches konnte sie nicht verstehen, aber selbst dieses hatte für sie etwas Geheimnisvolles und sie versuchte die Inhalte im Gedächtnis zu behalten, bis sie zu einem späteren Zeitpunkt die Geheimnisse der Texte würde enträtseln können.
Man sah das schlanke Ding mit den bunten Überröcken auf Mauervorsprüngen, Treppen und am Waldrand sitzen, ein aufgeschlagenes Buch im Schoß. Der Zeigefinger der rechten Hand schob sich die Zeilen entlang und der Mund formte unhörbar Worte, die aus dem Buch herausfielen.
Ein Mann, der seine Messer und Scheren zum Schleifen an den Lagerplatz der Sippe gebracht hatte, beobachtete das Mädchen, das die Welt um sich herum vergessen zu haben schien. „Es war, als ob sie die Worte aus dem Buch herauslesen und aufsaugen würde“, sagte er und schüttelte den Kopf.
In ihrer Familie galt Ellen wegen ihrer sonderbaren Art als aufsässig und ihre sanfte Weigerung, die Welt der Bücher zu verlassen, in die sie sich bei jeder Gelegenheit flüchtete, verfestigte diesen Eindruck. Nur der Zuspruch und die Unterstützung der Großmutter, die sämtliche Klagen über das Mädchen und alle Versuche, sie von Schulbesuchen abzuhalten, mit herrischen Gesten abwehrte, ermöglichten Ellen ihren Freiraum.
Im Lager war es so manchem Mann aufgefallen, dass in Ellen die Verwandlung vom Mädchen zur Frau vorangeschritten war und ein Cousin, ein breitschultriger Mensch, der es gewohnt war, sich zu nehmen, was er begehrte, lockte Ellen mit dem Versprechen, ein Schmuckstück für sie in seinem Wagen zu haben. Es handele sich um eine Brosche, die prächtige Darstellung eines Pfaus mit gespreiztem Rad, das in allen Farben schillere. Ellen solle dieses seltene Stück, das er auf einem der Jahrmärkte gegen ein junges Füllen eingetauscht habe, tragen. Nur sie könne es tragen, denn diese Brosche würde jede andere Frau überstrahlen.
Ellen lächelte ihr sanftes, argloses Lächeln und ergriff die ihr angebotene Hand, die sie hinter sich herzog. Ihre erstickten Schreie und ihr Schluchzen hörte niemand aus der Sippe. Man musizierte rund um ein Feuer. Nur die Nachtvögel ahnten, was geschah.
Auf diese unglückselige Weise wurde Walther gezeugt. Die Schwangerschaft setzte der unschuldigen Neugierde des Mädchens ein jähes Ende. Der Rat der Männer sprach von ‚Ehre‘ und dem Bund, den man rasch schließen müsse. Man handelte den Brautpreis aus und setzte den Termin für das Hochzeitsfest. Ellen wurde in die Obhut der Frauen gegeben. Sie kümmerten sich um das verstörte Mädchen, allen voran die Großmutter, deren Fürsorge Ellen durch die Schwangerschaft begleitete.
Als der kleine Junge als blutverschmiertes Bündel nach stundenlangen Wehen seinen ersten weinerlichen Schrei machte, schickte sich die Großmutter an, sein linkes Fäustchen zu öffnen und intensiv seine Handinnenfläche zu lesen. Nach einer schier endlosen Zeit legte sie das schreiende Bündel in die Arme seiner Mutter. Dabei seufzte sie und schüttelte langsam den Kopf. Das war alles.
Die Zeit raste in immer gleichen Mustern über Ellen und ihren Sohn hinweg und hielt kaum inne, um Ellen Zeit zur Trauer einzuräumen, als ihr Mann, der sie mit Gewalt genommen hatte, mit Gewalt unter den Hufen eines aufgebrachten Pferdes zu Tode kam. Sie hielt auch nicht inne, als Ellen mit einem pausbäckigen, gehbehinderten Versorger aus einer anderen Sippe ausgestattet wurde, der auf Jahrmärkten Vogelstimmen nachahmte und Federbüschel für Hüte knüpfte. Manchmal wärmte ihm Ellen aus Pflichtbewusstsein das Bett, öfter spendete ihm ein selbst gebrannter Holunderschnaps Trost. Er war ein guter Mann, der in Ellens Augen das Desinteresse an seinen Angelegenheiten las und dennoch mit seinem Los zufrieden war.
Die kleine Familie hatte sich in einem verlassenen Aussiedlerhof niedergelassen. Über allem thronte die Großmutter. Sie beruhigte den kleinen Walther, wenn die Winterwinde das Gebälk des Hauses zum Knacken brachten. Sie hauchte Ellen mit ihrer Zuversicht neues Leben ein, wenn die junge Mutter in ein dumpfes Brüten verfiel und sie verlieh ihrer murmelnden Stimme einen unerbittlichen Unterton, wenn es an der Zeit war, den Mann wieder einmal auf seine Ernährerpflichten hinzuweisen.
Walther indes war ein besonderes Kind. Das für eine abgeschiedene dörfliche Gemeinschaft mitten im Pfälzer Wald unerhört frivol erscheinende ‚h‘ in seinem Namen zeugte davon. Immer hatte man von einem ‚Walter‘, nie von einem ‚Walther‘ gehört. Das ‚h‘ besaß Sprengkraft, denn es war eine Leugnung der Konvention, eine Kriegserklärung einer extravaganten Mutter, die sich für schöner und klüger halten mochte als den Rest des Dorfvolkes, obwohl jeder wusste, dass die drei auf dem Aussiedlerhof wenig besser als Zuchthäusler und nichts wert waren.
Ellen trug ihren Kopf erhoben und lächelte, wie sie es immer tat. Nur vor den Gesten und Verwünschungen der Großmutter schreckten die Dörfler zurück.
Das ‚h‘ war für Walther eine Hypothek, ebenso das Schreiben- und Lesenlernen in der Dorfschule. Er war ein verschlossener, in sich gekehrter Junge, der sich unsicher bewegte, manchmal schwankend, wie ein Schilfrohr im Wind, manchmal mit brachialer Gewalt vorwärts schießend, um gleich darauf wie angewurzelt stehen zu bleiben. Bei der Einschulung hatte man die Anschaffung einer Lesehilfe dringend empfohlen. Die dunkle Hornbrille verlieh dem Jungen etwas Eulenhaftes.
Es dauerte nicht lange, bis die Bedächtigkeit Walthers, seine kollernde Aussprache, die so bemüht war, als wolle er die Worte zerkauen, bevor er sie herausbrachte, und seine irritierende Art, den Kopf zwischen die Schultern zu ziehen und mit wässrigen Murmelaugen zur Decke zu starren, wenn das Wort an ihn gerichtet wurde, dazu führten, dass man ihn für zurückgeblieben hielt. ‚Einfältig‘ war das freundlichste Wort, das ihn im Dorf begleitete.
Seine Mitschüler hänselten ihn, wenn er mit Spucke gedankenverloren Zeichnungen auf seinem Schulpult anfertigte und alsbald verwischte. Sie hänselten ihn, wenn er schwerfällig Silben formte und dehnte, die nicht den Satz ergeben wollten, der im Schulbuch stand und sie hänselten ihn, wenn er auf Rechenaufgaben reagierte, als wären die Zahlen gefährliche Eindringlinge, die in seiner Welt nichts zu suchen hatten.
Walther ließ den Spott und die achselzuckende Gleichgültigkeit der Lehrerin hinter sich, wenn er sich in die Arme seiner Mutter flüchtete, die ihm beruhigend zusprach und ihn in den Armen wiegte, bis seine Tränen trockneten. Die Großmutter hielt sich im Hintergrund und erledigte, was erledigt werden musste. Aber in unbeobachteten Augenblicken schweifte ihr Blick prüfend über Mutter und Kind. Dann schüttelte die alte Frau wissend ihren Kopf, bevor sie sich anderen Dingen zuwandte.
Es war die Großmutter, die man hätte fragen können, ob Walther die besondere Gabe besaß, mit Tieren zu kommunizieren. Sie wusste es, aber sie wollte es für alle nicht noch schwerer machen. Andeutungen davon hatte sie aus Walthers Hand gelesen.
Dass es wahr sein musste, konnte die Großmutter mit eigenen Augen sehen, wenn sich Ameisen im Schoß des kleinen Jungen sammelten, ohne ihren Geschäften weiter nachzugehen. Dann bewegten sich die Lippen des Jungen unhörbar und er schloss die Augen, als wolle er Zwiesprache halten. Eichhörnchen und Vögel machten ihre Aufwartung, wenn Walther auf stämmigen Beinchen über die Wiese hinter dem Haus auf den Saum des Waldes zuhielt und mit eigentümlichen Gesten seiner starr von sich gestreckten Hände in die Hocke ging. Eine verletzte Katze versetzte den sonst so ruhigen Walther in einen nie gekannten Aufruhr. Er schrie und gestikulierte, sprudelte Unverständliches heraus und zog die widerstrebende Großmutter zu dem Tier, das wohl angefahren worden war. Hastig zog ihn die Großmutter mit sich fort. Sie konnte sehen, dass der Katze nicht mehr zu helfen war. Am Abend entsorgte Ellen den Tierkadaver in einer Sandkuhle nahe der Straße. Walther war erschöpft eingeschlafen, als er keine Tränen mehr hatte.
Die Großmutter sah es als erste, als sie im Morgengrauen den Kachelofen anfeuern wollte. Das Küchenfenster zeigt auf den verwitterten Jägerzaun und ein Stück Straße hinaus. Der braunhaarige Junge mit dem hellblauen Schlafanzug saß am Rand der Sandkuhle und steckte Feldblumen in eine Schicht aufgehäuften Sandes. Er ging sorgfältig und bedacht vor. Das Sandgrab war das Mindeste, was Walther für die Katze tun konnte.
Es war der Vogelstimmenmann, der seine Verantwortung als Ersatzvater angesichts des Elends, in dem der Junge zu versinken drohte, stärker spürte als sonst. Er nahm Walther an der Hand. Ein geheimnisvolles Lächeln lag auf seinem breiten Gesicht. Als der zerbeulte Lastwagen Stunden später wieder keuchend in der Auffahrt stand, hatte sich das Lächeln zu einem Lachen ausgeweitet und war auf das Gesicht des Jungen gewechselt. Glückselig rutschte er von dem zerschlissenen Polster des Fahrzeugs und stieß die Beifahrertür auf.
Das war der letzte Augenblick, in dem sich der Aussiedlerhof behäbig sonnen oder geduckt Regen und Schnee trotzen sollte. Ein drahtiges Bündel Hund schoss bellend und japsend auf die Wiese, schien sich selbst zu umrunden und in rasendem Tempo und hellwachen Augen von dem Areal Besitz zu ergreifen. Das Fell des Hundes war weiß und ocker gefleckt, die Rute nach oben gebogen, der Kopf ein spitz zulaufendes Etwas mit zwei Reihen Zähnen und einer seitlich aus dem Maul hängenden Zunge. Eine Promenadenmischung, passend zu den Bewohnern des Gehöfts, denn der Hund war als Streuner unterwegs gewesen, aufgegriffen und zum Tierheim gebracht worden. Auch er ein von der Gesellschaft Ausgestoßener, nicht der üblichen Norm entsprechend, aber voller Lebensfreude.
„Strolch“, rief Walther aus voller Kehle und wies mit dem Finger auf den Hund. Ellen und die Großmutter waren aus dem Haus geeilt und beobachteten das Schauspiel. Vom ersten Augenblick an, waren Walther und Strolch unzertrennlich und während Ellen ihren Sohn dafür lobte, dass er dem Hund einen so treffenden Namen gegeben hatte, verstand die Großmutter, dass es der Hund war, der Walther seinen Namen verraten hatte. Sie beobachtete die beiden, wenn sie Seite an Seite über die Wiese streiften, sich auf den Schulweg machten oder Kunststücke übten, bei deren Ausführung sich der Hund überaus gelehrig anstellte.
Es entging ihr aber auch nicht, dass die beiden stille Zwiesprache zu halten schienen, garniert von unscheinbaren Gesten und den ewig murmelnden Lippen des Jungen.
Es war jener sonnenbeschienene Tag im Jahr 1985, als Walther und Strolch, von ihrem Waldspaziergang nicht mehr zurückkehrten.
Auf dem Pfad, dessen loser Sand noch immer die Abdrücke der Sandalen des Jungen trug, schlugen die ersten schweren Regentropfen eines Gewitters ein, das sich blitzartig zusammengeballt hatte und vor der Entladung stand. Die unschuldigen Wolkenschlieren waren von einer schwärzlichen Gewitterwand überdeckt worden, die schwefelgelbe Ränder aufwies. Eine Reihe von Blitzen zuckte zur Erde und das Donnergrollen, das wie ein gewaltiges Rumpeln über die atemlose Stille herfiel, kam bedrohlich näher. Der aufkommende Sturm bog selbst starke Äste in Richtung der einfallenden Böen. Das Summen der Insekten hatte schlagartig aufgehört und die Tiere des Waldes suchten Schutz vor den Hagelschauern, die die Wolkentürme in sich trugen. Die Dörfer schienen sich noch tiefer zu ducken als sonst.
Der kleine Junge mit den dicken Brillengläsern war vor einer mächtigen Baumgruppe stehen geblieben und blickte sich um. Das nahende Unwetter schien ihn nicht zu beunruhigen. Er klatschte in die Hände. Das Rascheln in einer Gruppe Ginstersträucher übertönte das Grollen des Donners und das beständige Rauschen der dichten Baumkronen.
„Strolch“, rief der Junge und breitete die Arme aus, in die sich mit einem letzten Sprung ein geflecktes Bündel Hund warf. Wie immer war das Tier im nahen Eichengehölz den tiefen Furchen der Wildschweinrotten gefolgt, die den weichen Waldboden auf der Suche nach Essbarem durchpflügt hatten. Wildschweinfährten waren für Strolch unwiderstehlich und die Konfrontation mit einem aufgescheuchten Keiler ein aberwitziges Vergnügen. Walther musste sich keine Sorgen um seinen Gefährten machen, denn das Schnappen, Bellen und Tollen gehörte zu dem Spiel, das Strolch mit Wildschweinen trieb. Die Schweine schienen sich für kurze Zeit auf die Herausforderung einzulassen, stellten drohend die Borsten auf, senkten die Schnauzen und brachen in Scheinangriffe aus. Dann aber verloren sie schnell das Interesse und trollten sich mit hochgereckten Schwänzen in geordnetem Galopp. Noch ein Krachen im Unterholz, ein letzter Blick auf die gedrungenen Leiber und sie waren verschwunden.
Es war nicht mehr weit bis zu dem überwucherten Platz mit den drei verwitterten Sandsteinplatten, die vor Jahrhunderten übereinander gefallen waren, sodass sich ein Unterschlupf bot. In der Schule hatte man im Fach Heimatkunde erwähnt, dass es im Wald Keltengräber gäbe, die mit Steinplatten gesäumt waren. Man vermutete dort Funde von altem Kunsthandwerk und Schmuck. Walther hatte bei der Lehrerin mehrfach nachgefragt und kam zu dem Entschluss, dass es sich um einen Schatz handeln musste. Schätze überall, irgendwo unter den Steinen, überwachsen von Moos und Baumschösslingen, unkenntlich für den Wanderer, aber Beute für Walther und Strolch.
Walther zog einen mehrfach gefalteten Zettel aus seiner Hose, nach dem Strolch aufgeregt schnappte. In energischen Druckbuchstaben hatte die Lehrerin ‚DOLMEN‘ darauf geschrieben. Sie hatte Walther verraten, dass es dieses alte Wort für solche Stellen gab und dass man dort mit viel Glück wertvolle Dinge finden konnte, die in alter Zeit begraben worden waren. ‚Dolmen‘ also hieß das Paradies für Schatzsucher und solche waren Walther und Strolch. Was konnte ihnen da ein Gewitter anhaben?
Walther war die wild mit Haselnuss- und Ahornschösslingen bewachsene Fläche nie aufgefallen. Die Sandsteine waren im Schatten der Bäume nur in vagen Umrissen zu erkennen und ruhten in ihrem Waldexil seit Urzeiten.
Es war Strolch zu verdanken, dass die Besonderheit des Fleckchens Erde offenbar wurde. Anfangs hatte sich Walther darüber gefreut, dass er bei den Sandsteinplatten immer Tiere sah. Dazu gehörte ein riesiger von Waldameisen zusammengetragener Bau aus trockenen Fichtennadeln. Eine Eule hockte stoisch auf einem der unteren Äste eines Ahorns und das immer gleiche Eichhörnchen verharrte mit aufmerksam auf die Ankömmlinge gerichteten Knopfaugen eng an den rissigen Stamm einer mächtigen Eiche geschmiegt. Es war, als ob die Tiere Wache hielten.
Walther stellte sich keine Fragen, warum der Ameisenbau aus Fichtennadeln so weit von der nächsten Fichtenschonung entstehen konnte. Er fragte sich auch nicht, warum ein Nachtvogel, wie die zur Skulptur erstarrten Eule, bei helllichtem Tag auf einem Ast ausharrte und er fragte sich auch nicht, weshalb Eule und Eichhörnchen sich nicht scheu davonmachten, sondern das Gebell seines Hundes ohne Regung ertrugen. Was ihn viel mehr interessierte, war das eigenartige elektrische Summen und Brummen dort bei den Steinriesen, das tief aus dem Inneren der Erde zu kommen schien und in einem pulsierenden Rhythmus an- und abschwoll. Er hätte schwören können, dass sich das schwach durch das Blätterwerk tastende Sonnenlicht in Bodennähe grünlich verfärbte, aber er war sich nicht sicher.
Sicher war er, dass Strolch sich jedes Mal setzte, sein aufgeregtes Bellen einstellte und um sich sah. Dann stieß er ein klägliches Jaulen aus und bedeckte seine Schnauze mit den Pfoten. Walther tätschelte das Tier und nahm seinen Hund auf den Arm. Strolch zitterte. Ob vor Angst oder Erregung konnte Walther nicht sagen. Unschlüssig stand er da und verwarf jedes Mal den Gedanken, die Stelle hinter den Baumtrieben und Dornenranken genauer zu untersuchen.
Am 25. August war es die Gewitterfront, die den beiden die Entscheidung abnahm. Das Prasseln des Regens auf den Blättern über ihnen verhieß nichts Gutes und die Sandsteine versprachen Schutz. Entschlossen stapfte Walther vorwärts. Seine Brille war beschlagen und er spürte, wie das Gestrüpp seine nackten Beine peitschte. Der Hund hatte die Rute eingezogen und sah sich noch einmal um. Es war dunkel geworden. Augenpaare fixierten den Jungen und seinen Hund. Mit gesträubtem Fell und einem tiefen Knurren stürzte Strolch vorwärts. Walther hatte sich bis zu den Steinen vorwärts gekämpft. Noch wenige Schritte und sie würden trocken und sicher sein.
Die schräge, mit Grasbüscheln und Moos bewachsene Öffnung sah er nicht. Ein hohes Sirren erfüllte die Luft. Mit einem Bein geriet der Junge in die Öffnung der Röhre. Fast mühelos glitt er hinein. Aus dem Dunkel drang das Sirren, ein lang gezogener Schrei und die Andeutung eines grünen Flimmerns. Dann ein Hundekörper, der sich im Sprung in das Loch katapultierte.
Eine Kaskade von Blitzen erhellte die Szene und inmitten des Donnerschlages brach ein Ast von einem nahen Baum und fiel auf die Erdöffnung. Der schwere Regen hatte mittlerweile seinen Weg zum Waldboden gefunden. Er löschte alle Spuren aus, so wie es seine Pflicht war.
Beim nächsten Blitz erwachten die Zeugen des Vorfalls aus ihrer Starre und suchten Unterschlupf. Das Eichhörnchen und die Eule waren verschwunden.
2. Kapitel Die Suche
Der 27. August begann, wie der 25. geendet hatte. Eine flirrende Sonne stand über dem Tal und stach zwischen tanzenden Schatten auf die Siedlung nieder, die sich schon lange ergeben hatte. Die Nacht hatte Regen gebracht und die Sonnenstrahlen brachten die Erde zum Dampfen. Felder und Wald schwitzten aus, was an Wasser dicht unter der Oberfläche eingedrungen war und es schien, als seien in der Landschaft zahlreiche Feuer entzündet worden, die sich nur aus Rauch nährten. Es war schwül und Linderung nicht zu erwarten.
Seit zwei Tagen hatte man nichts von dem Jungen gehört. Langsam war die Nachricht in das Dorf gesickert und hatte sich rasch verbreitet. Der Junge war von einem seiner einsamen Spaziergänge nicht zurückgekehrt. Als seine Mutter mit Panik in der Stimme und wehendem Haar in das Wirtshaus stürmte, hefteten sich die Augen der Kartenspieler wortlos an ihr exotisches Äußeres. Die Frau, die dem Dorf fremd geblieben war, hatte ihr Madonnenlächeln verloren. Sie warf eine Handvoll Münzen auf den Tresen und bat darum telefonieren zu dürfen. Ihre Stimme hatte einen gehetzten Klang.
Als sie die Wählscheibe in Bewegung setzte, neigten sich alle Ohren im Raum in ihre Richtung. Die Frau schien es nicht zu bemerken. Sie nagte nervös an ihrer Unterlippe, während sie auf ihre Verbindung wartete. Dann sprudelte es aus ihr heraus. Ihre schmalen Hände tanzten und ihr Kopf geriet in Bewegung, als sie schilderte, dass ihr Sohn Walther verloren gegangen war. Nur kurz unterbrach sie sich. Nein, antwortete sie mit einem unwilligen Kopfschütteln. Das sei noch nie vorgekommen. Walther sei ein braves Kind. Niemals würde er über Nacht wegbleiben. Abermals lauschte sie angestrengt in den Hörer und schüttelte den Kopf. Nein, es gebe keinen Grund, weshalb Walther weggelaufen sein sollte. Außerdem sei Strolch bei ihm. Sie unterbrach sich und nickte. Ja, Strolch sei ein kleiner Mischlingshund, der Walther nie alleine lassen würde. Auch er sei verschwunden. Finde man den Hund, wäre auch Walther nicht weit. Noch einmal horchte die Frau und nickte zustimmend. Dann legte sie den Hörer auf.
Die Gesichter der Kartenspieler drehten sich weg und Männerhände griffen nach Biergläsern. Die Ohren hatten genug gehört.
Die Frau lächelte flüchtig dem Wirt zu, der um einen gleichgültigen Gesichtsausdruck bemüht war. Noch ehe es ihm gelang, sein stoppelbärtiges Doppelkinn in wohlwollende Falten zu legen, war die Frau mit wehenden Röcken verschwunden.
Die Saat war gelegt und die Nachricht galoppierte von Haus zu Haus. Frauen tuschelten unter Wäscheleinen. Männer tauschten sich auf dem Weg zu den Feldern aus. Die einzige Bushaltestelle des Ortes war stärker frequentiert als üblich und auffällig oft kamen Radfahrer und Spaziergänger an dem Aussiedlerhof vorbei, der zuvor vom Dorf gemieden worden war. Mit eigenen Augen hatten die Dörfler die zwei Polizeifahrzeuge gesehen, die vor dem verwinkelten Gebäude der Rumänen parkten.
Viele nahmen an, dass es Rumänen waren. Andere glaubten, es seien Bulgaren. Fremde eben. Nicht ordentlich. Das konnte man schon an der Kleidung sehen und am Zustand des Hauses. Keine Deutschen jedenfalls.
Olivfarbene Haut, unpassende Kleidung und Gaunereien im Sinn. Jeder hatte eine Meinung. Jeder trug ein Bröckchen bei. Bis weitschweifige Anekdoten entstanden. Im Grunde hatte man es geahnt. Es musste so kommen.
Walther. Kein Name für ein Ausländerkind. Anmaßend. Als ob ein deutscher Name aus dem Jungen einen Einheimischen machen würde. Kein Vater natürlich. Nur eine vor sich hinbrütende Großmutter in bunten Gewändern und ein abgerissener Vogelstimmenmann, der mit einem zerbeulten Lastwagen Schrott sammelte, den die Leute an den Straßenrand schleppten, wenn die blecherne Melodie aus dem Lausprecher sein Kommen ankündigte. „Lumpen, Alteisen, Knochen, Lumpen“, begleitete eine heisere Männerstimme im leiernden Rhythmus die langsame Vorbeifahrt. Die Dörfer erduldeten solche Existenzen, aber sie akzeptierten sie nicht. Sie würden es niemals tun.
Und dann noch das affektierte ‚h‘ im Namen. Typisch für die ‚Madonna vom Altenhof‘, wie die Frauen des Ortes Ellen nannten. Rote Lippen, rote Fingernägel, glänzende Spangen in geflochtenen Haaren, der aufreizend aufrechte Gang, das Wippen und das unergründliche Lächeln. Oh ja, das Lächeln, das sie jedem Mann entgegenstreckte wie eine Opfergabe. Ganz heiß wurde es den Männern unter den Hemdkrägen, die solcherlei Morgengaben von ihren mürrischen Hausdrachen nicht gewohnt waren. Männer konnten durch derlei frivole Aufmerksamkeiten den Verstand verlieren. Bei einem war es bereits passiert. Das ganze Dorf wusste davon.
Maler war der Mann. Er war immer in fleckiger weißer Arbeitskleidung unterwegs. Oft, zu oft fand man ihn im Wirtshaus neben einem Glas Bier und einer Sammlung Schnapsgläser. Mit Alkohol kämpfte er gegen den Trübsinn seines häuslichen Lebens an und der Alkohol drohte zu gewinnen.
Eines Tages schenkte ihm Ellen ihr Lächeln, als sie auf dem Weg zum Dorfladen war. Er fing das Lächeln auf und erlebte ein Stück vom Glück. Bald fand man ihn nüchtern und aufmerksam immer in der Nähe des Lächelns. Er bot an, ein volles Einkaufsnetz zu tragen, wehrte bescheiden ab, wenn ihm Ellen ein kleines Handgeld überreichen wollte und winkte der aufrechten Frauengestalt schüchtern nach, wenn sie um die Ecke bog. Worte wurden kaum gewechselt, aber das kindische Benehmen des Malers erregte Aufmerksamkeit.
Dies war besonders bei seiner Frau der Fall, einer untersetzten und breitschultrigen Bauerntochter, die es längst bereut hatte, einen der Dorfsäufer geheiratet zu haben. Eines Nachmittags erschien sie wie eine Furie in der Kneipe, gerade als ihr angetrunkener Ehemann zum wiederholten Male davon fantasierte, wie es sich anfühlen müsse, wenn man den wohlgeformten Hintern der Fremden mit beiden Händen umfasste und drückte. Stunden später wurde der Maler von einem Krankenwagen abgeholt. Seine Frau lamentierte, dass er gestürzt sei und sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hätte. Das Dorf schwieg dazu. Jeder glaubte, was er glauben wollte. Nur eine Tatsache blieb. Die Fremden waren Störenfriede.
Jetzt war der Junge verschwunden. Kein Wunder, meinten die einen. Walther sei ein zurückgebliebener, eulengesichtiger Bub, der sich schwerfällig bewegte und noch schwerfälliger redete. Man könne doch ein solches Kind nicht unbegleitet mit seinem Hund in den Wald laufen lassen. An dem Tag habe der Wetterbericht schwere Gewitter vorausgesagt und man wisse doch, wie leicht man sich in den dichten Wäldern rund um das Dorf verirren konnte. Vielleicht sei das Kind von einem Blitz getroffen worden. Vielleicht habe es sich versteckt und irre jetzt orientierungslos herum. Man habe auch schon davon gehört, dass die Wildschweine auf Eindringlinge losgegangen seien und diese verletzt hätten. Immer wieder gingen Kinder verloren, über die keine ordentliche Aufsicht herrschte. Es gäbe Fremde, die mit ihren Autos an den Waldrändern und auf einsamen Wegen entlangfuhren und Kinder aufklaubten, die nie wieder auftauchten.
Man raunte dieses, vermutete hinter vorgehaltener Hand jenes, aber sachdienliche Hinweise, die die Polizei auf einem Handzettel unter dem körnigen Schwarz-Weiß-Foto des kleinen Jungen, der kurzsichtig und ernst in die Kamera blickte, erbat, waren rar gesät.
Ein Bauer aus dem Nachbardorf war der erste, der einen brauchbaren Hinweis gab. Er erinnerte ich am fraglichen Tag vom Rand des Rapsfeldes, als er sein Mittagessen verzehrte, einen Hund gesehen zu haben, der unvermittelt aus dem Gebüsch nahe des Feldweges auftauchte. Dann habe er noch Gebell gehört. Einen Jungen habe er nicht gesehen, aber der Hund sei zielstrebig den Weg entlanggelaufen, als ob er einer Spur folgte. Auf einer Karte markierte der Bauer die Stelle.
Als Gerüchte die Runde machten, die Großmutter des Jungen habe alle Zigeuner, Gaukler und Taugenichtse zu Hilfe gerufen und eine Flut von Fuhrwerken und schweren Limousinen sei kurz davor, das Dorf zu überrollen, machte sich ein Trupp widerstrebender Freiwilliger auf, um sich einer Suchaktion nach dem Verschwundenen anzuschließen. Es war die Christenpflicht eines jeden einzelnen, sich in der Not auszuhelfen und verschaffte ein gutes Gewissen. Eine Handvoll Frauen ging sogar soweit, Kuchen, Schmalzgebäck und Eintopf zu dem Aussiedlerhof zu karren und ihre geheuchelte Anteilnahme in viele Worte zu kleiden.
Die mürrische Großmutter stand bedrohlich wie ein Racheengel auf den ausgetretenen Steinstufen des Hauses und schwieg zu den Beistandsbeteuerungen der Frauen. Ellen hingegen lächelte mit schwermütiger Süße und hieß alle willkommen. Sie brachte fein bestickte Kissen heraus, die sie um eine großblättrige Esche legte, drückte Hände und schenkte eine Limonade aus, die so würzig und Zungen schnalzend gut war, wie keine der Frauen sie jemals zuvor gekostet hatte. „Aus der Heimat“, hatte Ellen leichthin gesagt und die Frauen nickten wissend. Man unterhielt sich mit ausgesuchter Höflichkeit und kostete die mitgebrachten Speisen.
Die Frauen versicherten, dass man die Familie schon immer ins Herz geschlossen habe. Ein Dorf stelle hohe Anforderungen an den Fleiß und die Duldsamkeit der Bewohner, sodass man Solidarität eher im Stillen zeige. Jetzt allerdings sei der Punkt gekommen, wo man offene Tatkraft beweisen müsse. Dezent geschminkte Münder täuschten Herzlichkeit vor und scherten sich wenig um das Gebot, dass man kein falsches Zeugnis ablegen solle.
Ellen bedankte sich für das erwiesene Mitgefühl und die mitgebrachten Dinge und entließ die Frauen mit dem erleichternden Gefühl, das Ihre getan zu haben. Das Dorf und die Fremden waren sich ein Stück nähergekommen. Als Nächstes würden sie sich gemeinsam auf die Suche begeben.
Eine derart geballte Aktivität hatte der Wald noch nicht erlebt. Viele Bäume führten ein geruhsames Dasein und ließen die Jahreszeiten mit stoischer Gelassenheit an sich vorüberziehen. Lediglich der Besuch des Försters brachte eine gewisse Unruhe. Dann rückten Holzfäller mit Kettensägen und Spaltwerkzeug an und lichteten den Wald aus. Wenn die Stämme geschält und portioniert waren und der Wind das Sägemehl verblasen hatte, ließ sich der Wald in den Dämmerschlaf zurückfallen, der ihm eigen war. Die harmlosen Spaziergänger mit ihren gelegentlichen Rufen, die vom Dickicht aufgesogen und erstickt wurden, waren nicht der Erwähnung wert. Sturm, Regen und Schnee konnten wie Urgewalten den Baumbestand durchrütteln. Borkenkäfer und andere Schädlinge waren eine Last, die man schultern musste. Insgesamt jedoch war der Wald ein langsam atmendes Wesen, das seine Kräfte auf die übertrug, die ihn bewohnten.
Jetzt war es anders. Mehrere Menschenketten und eine Hundestaffel durchkämmten den Wald. Stöcke klopften gegen Baumstämme, Wild flüchtete in alle Richtungen. Bis weit hinaus zum Hundsbrunner Tal und hinauf zum gut bewachten Areal der Raketenstation ertönten die Rufe nach Walther. Manchmal hielt der Lärm inne und verfiel in ein kollektives Lauschen. Der Wald antwortete mit majestätischem Rauschen, dem Knacken von Ästen und dem Rascheln unbekannter Lebewesen im Unterholz.