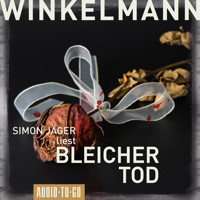Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Adam will irgendwann den höchsten berg der Welt besteigen. Um diesen Traum zu verwirklichen, fährt er Taxi. Allerdings ein ganz spezielles. Mit seiner Krebskarosse bringt er Patienten zur Chemo- und Strahlentherapie. Eines Tages steigt Jessi zu ihm in den Wagen. Sie ist jung und bezaubernd - und todkrank. Adam verliebt sich in sie. Daran ändert sich auch nichts, als er erfährt, dass Jessi vielleicht nur noch wenige Wochen zu leben hat. Als sie ihm erzählt, dass sie es bereut, etwas Bestimmtes nie getan zu haben, setzt Adam alles daran, diesen Traum für sie wahr werden zu lassen, und erkennt dabei, dass er seine eigenen Ziele nicht auf "irgendwann vielleicht" verschieben sollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Text: © Copyright by Andreas Winkelmann
Umschlaggestaltung: © Copyright by Nina Winkelmann
Verlag:
Andreas Winkelmann
C/O Agentur Schlück
Hohenzollernstraße 56
30161 Hannover
www.andreaswinkelmann.com
www.instagram.com/winkelmann.andreas.autor
www.facebook.com/andreas.winkelmann.schriftsteller
www.tiktok.com/@andreas.winkelmann.autor
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Andreas Winkelmann
DIE
ANTWORT
AUF
VIELLEICHT
Roman
Für Steffi, um einen lang ersehnten Wunsch zu erfüllen.
Tag X
Die Planungen und Vorbereitungen waren erledigt, die geheimen, geradezu konspirativen Treffen vorbei, die Koffer gepackt, die Lügen gelogen, es gab keine Hindernisse mehr. Doch alles, was sich in der Theorie so bestechend logisch angehört hatte, machte mir plötzlich Angst. Natürlich hatte es Stimmen gegeben, die Bedenken geäußert hatten, am Ende waren sie jedoch alle überzeugt oder zumindest beruhigt gewesen. Nun schien es, als sei ausgerechnet mir diese Überzeugung abhandengekommen, als hätte ich zu viel davon fortgegeben.
Es konnte einiges schiefgehen.
Es konnte in einer Katastrophe enden.
In diesem Fall würde alle Schuld mich treffen.
Mit derselben Angst, wie ich sie seit Wochen spürte, betrachtete ich die Klingeln. Nichts daran war besonders. Die übliche rechteckige Form mit einem Feld für den Namen und einem Taster, dem man ansah, wie häufig er benutzt worden war. Analog zur Anzahl der Wohnungen dieses langweiligen Mietshauses gab es sechs Klingeln, zwei Reihen mit je drei Stück untereinander. Die, die mein Leben anhaltend verändert hatte und wegen der ich heute meinen Job aufs Spiel setzte, befand sich in der rechten Reihe oben. Mit leicht geschwungener Schrift war der Name per Hand auf ein unsauber ausgeschnittenes Stück Papier geschrieben worden.
Bischoff
Ich hatte Angst vor diesem Klingelknopf. Angst davor, ihn zu betätigen. Seit sechs Wochen stand ich beinahe jeden Morgen um Viertel nach acht hier, und meine Hand zitterte, sobald ich sie ausstreckte. Aber die Qual begann schon lange vorher. Sie begann mit dem Läuten des Weckers auf meinem Nachtschrank. Ich bin einer dieser Menschen, die sofort hellwach sind. Wecker klingelt, Augen auf, hallo, hier bin ich! An schönen Tagen ist das toll, aber in den letzten Wochen war natürlich sofort die Besorgnis miterwacht, und ich hatte feststellen müssen, dass es einem ganz ordentlich den Tag vermiesen kann, wenn der erste Gedanke angsterfüllt ist. Hoffnung weicht der Wahrheit aus, die Tanzfläche ist zu klein für beide, und egal, wie positiv das eigene Wesen ist - und ich habe mich stets als positiven Menschen begriffen -, steht man angesichts verifizierter Fakten ganz schnell mit dem Rücken zur Wand. Keine Chance mehr auszuweichen.
Ich atmete tief durch und drückte auf den Knopf. Die Klingel selbst konnte ich nicht hören, da die Wohnung im zweiten Obergeschoss lag; die darauffolgende Wartezeit dehnte sich schier endlos aus. Die Geräusche der Straße hinter mir nahm ich kaum noch wahr. Dafür umso deutlicher das Läuten des Diensthandys in der Freisprecheinrichtung des Wagens.
Ich zuckte zusammen. Warum rief die Zentrale mich ausgerechnet jetzt an? Waren unsere Vorbereitungen doch nicht unbemerkt geblieben? Hatte von der Handvoll Eingeweihter jemand getratscht?
Noch war der Wagen nicht geklaut, in wenigen Minuten aber würde er es sein. Zum allerersten Mal in meinem Leben beging ich eine Straftat, wurde zum Dieb, stahl ein Auto und wusste nicht, wie ich dem Besitzer jemals wieder unter die Augen treten sollte, wenn das herauskam.
Noch ein paar Minuten.
Die letzte Chance, doch noch einen Rückzieher zu machen.
Ich schämte mich für den Gedanken, konnte ihn aber nicht verhindern.
Plötzlich knackte es im Lautsprecher der Gegensprechanlage, so wie immer, wenn oben jemand den Hörer abnahm, und der Moment der Unsicherheit war vorüber.
„Wir kommen.“
Sofort löste sich mein Magen aus der Umklammerung der Angst, mein Herz nahm seinen normalen Rhythmus auf, und ich fühlte mich von einer Sekunde auf die andere besser.
Offenbar ging es ihr gut. Selbst an der durch die Sprechanlage verzerrten Stimme erkannte ich mittlerweile die feinen Nuancen, die mir Auskunft über ihren Zustand gaben. Schmerz oder Unsicherheit hätte ich sofort herausgehört, doch da war nichts als Vorfreude.
Sie war bereit für das Abenteuer.
Sechs Wochen zuvor
Zwei Glatzen
Zwei schöne runde und glatte, im Morgenlicht wie poliert schimmernde Glatzen.
Zu der einen gehörte ein schmales Gesicht mit allerhand Metall darin. Ein silberner Ring in der Nasenscheidewand, in jedem Nasenflügel ein Piercing, auch in den Brauen, die Ohrläppchen überfrachtet mit Ringen unterschiedlicher Größe. Ich schätzte das Alter des Mädchens auf höchstens achtundzwanzig, wenngleich das echt schwierig war. Leute mit Glatze wirkten jünger, fand ich. Sie war klein, vielleicht eins sechzig, sehr schlank und komplett in Schwarz gekleidet. Schwarze Leggins, so enganliegend wie eine zweite Haut, ein schwarzes Langarmshirt, die Ärmel bis in die Ellenbogen hochgeschoben. Dazu schwarze Springerstiefel, die an diesen dünnen Beinen zu schwer und zu groß wirkten. In der Taille schnürte ein mit Nieten besetzter Gürtel das Shirt, an den Handgelenken fanden sich passende Armbänder dazu. Die Tattoos an den Unterarmen rankten sich um ein einziges Grundmotiv: den Totenkopf.
Aus leicht schlafmützigen braunen Augen sah mich das Mädchen abschätzig an und kaute dabei auf einem Kaugummi herum. Sie trug einen Jutebeutel mit dem stilisierten Aufdruck eines Orcas auf der Vorderseite, oben schaute ein Handtuch heraus.
Unter meinen Kollegen hatte sich der Ausdruck „Handtuchfraktion“ breit gemacht, weil alle eines dabeihatten. Es war bei der Behandlung verpflichtend vorgeschrieben, aber niemand trug es einfach so unter dem Arm, wie man es am Strand oder auf dem Weg in die Sauna tat, nein, sie versteckten es in Tüten, Taschen oder Beuteln. Vielleicht dachten sie, es verriete zu viel. Dabei wussten doch nur Eingeweihte wie ich, was diese Handtücher zu bedeuten hatten.
„Hey, ich bin Vero“, begrüßte sie mich.
„Adam Wondraschek“, stellte ich mich vor und schüttelte ihre Hand.
Obwohl sie so klein war, hatte sie einen kräftigen Händedruck.
„Ditt iss meene Freundin Jessi.“
Veros Berliner Akzent war nicht zu überhören.
Jessi trug eine olivfarbene Cargohose mit unzähligen kleinen und großen Taschen daran, dazu eine blaue Kapuzenjacke mit weißen Bändchen, beides eine bis zwei Nummern zu groß. Sie maß ungefähr eins fünfundsiebzig, hielt die Schultern gerade und machte einen fitten Eindruck. Ihr Gesicht war vollkommen anders als das ihrer Freundin. Zum einen fehlte das Metall, zum anderen war es ein klassisches Modelgesicht mit perfekten Proportionen und makellosen Zähnen. Die nicht vorhandene Frisur hob ihre femininen Züge nur noch mehr hervor. Ihre moosgrünen Augen waren groß und rund und verunsicherten mich.
„Hi.“
Ihr Händedruck war sanfter und weiblicher als Veros. Sie lächelte mich an dabei.
„Na dann, darf ich bitten?“
Ich öffnete die hintere rechte Tür und machte eine einladende Handbewegung. Totenkopf-Vero warf ihre Orca-Handtuchtasche in den Fond und krabbelte dann selbst hinein. Jessi folgte ihr. Bevor ich die Tür zuschlagen konnte, tuschelten die beiden miteinander und lachten.
Über mich?
Mit dem üblichen leichten Unwohlsein ließ ich mich in den Fahrersitz fallen und startete den Motor. Die allererste Fahrt war jedes Mal ein bisschen speziell. Man musste sich erst abtasten und herausfinden, mit wem man es zu tun hatte. Erste Fahrten mochte ich nicht besonders. Im Smalltalk war ich nie gut gewesen, es lag mir nicht, in Anbetracht der Umstände übers Wetter oder den Verkehr zu reden. Erst recht nicht, wenn ich eine Kundin im Wagen hatte, die noch nicht im Rentenalter war - und heute waren es gleich zwei davon!
Nur eine von beiden war die Patientin, aber ich wusste nicht, ob Jessi oder Vero. Warum hatten beide eine Glatze? Warum fuhren sie überhaupt gemeinsam zu diesem Termin? In meinem Fahrplan für heute stand nur ein Name. Bischoff. Dazu die Adresse und die Uhrzeit, aber kein Vorname.
Ich warf einen kurzen Blick in den Rückspiegel, dann wusste ich Bescheid.
Seit drei Jahren arbeitete ich bei einem kleinen Unternehmen, das sich auf den Transport von Krebspatienten spezialisiert hatte. Ich fuhr eine Krebskarosse. Ein sicheres und einträgliches Geschäftsmodell, da die Krankenkassen diese Fahrten bezahlten und es an Kundschaft nicht mangelte. Wie mein Chef Willi ein wenig schräg an einen bekannten Satz gelehnt sagte: „Krank geworden wird immer.“
Eigentlich handelte es sich um ein stinknormales Taxiunternehmen, der Bereich der Krankentransporte war aber immer stärker angewachsen und irgendwann ausgegliedert worden. Meine Chefin, die fünfundfünfzigjährige Silke Kahlfeld, kümmerte sich um den Taxibetrieb, während die Krankenfahrten von ihrem Mann organisiert und gelegentlich torpediert wurden. Willi hatte eigentlich ein gutes Herz (hoffte ich), war aber leider konfus, cholerisch und beratungsresistent. Alle Mitarbeiter, auch seine Frau, waren froh, wenn er sich nicht zu viel in den Tagesablauf einmischte. Sein Name im Display des Handys bedeutete immer Stress.
Wir fuhren alle möglichen Leute zur Strahlen- und Chemotherapie, zu Arztbesuchen, ins Krankenhaus, zur Apotheke - und, wenn es nötig war, auch zum Einkaufen.
All-Inclusive-Service bei Tag und Nacht. Eine Strahlentherapie dauerte in der Regel sechs bis acht Wochen, je nach Tumor. An fünf Tagen in der Woche mussten die Patienten in die Klinik für Nuklearmedizin, und es war egal, ob gerade Weihnachten, Ostern oder Silvester war. In der Klinik breiteten sie ihr Handtuch auf der Liegefläche des Bestrahlungsgerätes aus, legten sich darauf und ließen sich von einem Linearbeschleuniger zielgenau mit Photonen beschießen, die dem beschissenen Tumor den Garaus machen sollten. Medizinisch betrachtet wurden Tumorzellen dadurch zerstört und somit am Wachstum gehindert. Gesunde Zellen, die im Weg standen, mussten allerdings auch dran glauben, was als Kollateralschaden in Kauf genommen werden musste.
Wenn’s gut lief, waren das entspannte Fahrten mit netten Gesprächen.
Doch oft genug lief es nicht gut.
Über sechs bis acht Wochen täglich bis zu eine Stunde mit einem Menschen in der Enge eines Autos zu verbringen, schuf Nähe, ob man es wollte oder nicht. Da nützten die klugen Sprüche der Ärzte oder mancher Kollegen, man dürfe die Einzelschicksale nicht an sich heranlassen, so viel wie ein Kühlschrank in der Arktis. Gerade bei weiblichen Fahrgästen, die viel offener über ihre Erkrankung und die Lebensumstände sprachen, schaffte ich es nicht, auf Distanz zu gehen und lediglich über Kim Kardashians Hintern oder Donald Trumps Toupet zu quatschen.
„Und du fährst den lieben langen Tag Todeskandidaten durch die Gegend?“, fragte Vero, nachdem ich losgefahren war.
Ich fädelte mich in den Verkehr der Hauptstraße ein und ließ mir einen Moment Zeit mit einer Antwort. Was sie gesagt hatte, war ziemlich direkt und nicht gerade freundlich, allerdings auch nicht gänzlich falsch.
„So kann man es auch ausdrücken“, antwortete ich.
„Und wie sonst noch?“
„Dass ich den lieben langen Tag Leuten dabei helfe, gesund zu werden.“
Okay, das klang ein wenig schnippischer, als ich es gewollt hatte, aber Vero machte auf mich den Eindruck, als könne sie es vertragen. Typische Berliner Kodderschnauze mit dem Herz auf der Zunge. Mit einem schnellen Blick in den Rückspiegel überzeugte ich mich davon, dass ich richtig lag.
Sie erwiderte den Blick aus frechen, vielleicht sogar ein wenig listigen Augen. Die Schlafmützigkeit war verschwunden.
„Und? Schon mal zwei Glatzen im Wagen gehabt?“
„Nicht zusammen, nein.“
„Siehst jeschockt aus.“
„Echt? Das liegt an was anderem.“
„Mein Outfit, wa?“
„Dein Outfit ist cool. Nee, es liegt eher an der Zeit.“
„Wieso an der Zeit?“
„Ihr habt mich fast zehn Minuten warten lassen, jetzt muss ich versuchen, das irgendwie wieder aufzuholen. In der Klinik legen sie großen Wert auf Pünktlichkeit.“
Das stimmte zwar, aber die zehn Minuten waren kein Problem, da sie in der Tourenplanung mit einkalkuliert waren. Vero war eine gute Beobachterin, sie hatte mich durchschaut, aber ich wollte nicht zugeben, wie sehr die beiden mich irritierten.
„Ich leg beim Herrn Doktor ein jutes Wort für dich ein“, sagte sie nun, blies eine Kaugummiblase auf und ließ sie zerplatzen.
„Du kommst aus Berlin?“, versuchte ich das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
„Hört man irgendwie, wa?“
Vero zwängte sich zwischen die beiden Vordersitze, und ich bemerkte, dass sie nicht angeschnallt war.
„Ich fände es besser, wenn du dich anschnallst.“
„Wozu?“
„Weil es Leben rettet?“
Sie grinste.
„Bist der Beschützertyp, wa?“
„Bitte!“
„Okay, okay.“
Mit dem Habitus eines kleinen Kindes, das nur widerwillig tut, was es eigentlich nicht will, schnallte Vero sich an. Das hielt sie aber nicht davon ab, einen Moment später erneut zwischen den Sitzen aufzutauchen.
„Und? Was meenste? Wer von uns wird gleich verstrahlt?“
„Das ist leicht. Es ist Jessi.“
Ich griff nach dem Innenspiegel und drehte ihn so, dass ich ihre Freundin sehen konnte. Sie wich meinem Blick nicht aus. Ihr Gesicht war Lächeln vom Mund über die Augen bis zu den Ohren. Sehr ansteckend. Sie sagte nichts.
„Wie kommst du darauf?“
„Du hast Augenbrauen.“
Vero tastete mit den Fingern nach ihren Brauen, die weder aufgemalt noch tätowiert waren, sondern aus echten Haaren bestanden.
„Scheiße, ey, daran hab ich jarnich jedacht.“
Sie ließ sich in den Sitz zurückfallen.
„Okay, du hast jewonnen, Kleener. Ich bin nur heute dabei“, sagte sie. „Ab morgen fährst du meine Süße allein. Kriegste hin, oder?“
„Vero. Bitte“, sagte Jessi.
„Was denn? Muss den Typen doch abchecken, wa? Nachher ist der so ein Casanova, der dir an die Wäsche jeht.“
Jessi stieß einen Seufzer aus, der genervt und peinlich berührt gleichzeitig klang, und sah aus dem Seitenfenster.
„Biste ein Casanova?“
„In welcher Beziehung?“
„Wie, in welcher Beziehung? Mit Frauen und so.“
„Casanova war unter anderem Doktor der Rechtswissenschaften, Bibliothekar und vom Papst ernannter Ritter. Deshalb frage ich.“
„Oha, ein Klugscheißer, wa? Wie ein Rechtswissenschaftler siehste ma nich aus, und Ritter gibt’s keene mehr. Also entweder biste ein langweiliger Bücherfuzzi oder ein Schürzenjäger. Such’s dir aus, Kleener.“
„Vero, jetzt halt endlich die Klappe und lass ihn fahren.“
„Nee, lass ma. Wird doch gerade interessant.“
„Ich habe das zweite Staatsexamen in Jura“, antwortete ich und versuchte, ob der Lüge ernst zu bleiben.
„Gloob ick nich. Warum fährste dann Taxi?“
„Downsizing ist der neue Trend unter Akademikern.“
„Wie auch immer, auch Rechtsverdreher können pervers sein …“
„Oh Gott!“, stieß Jessi aus und unterbrach ihre Freundin.
„… können pervers sein, man sieht das ja keenem an, wa.“
„Da gebe ich dir vollkommen recht und zugleich zu, dass ich wegen meiner Vorstrafen nicht als Anwalt arbeite.“
„Wat für Vorstrafen?“
„Die Liste ist lang. Entführung und Zerstückelung von frechen Mädchen mit Berliner Akzent ist auch dabei, wird aber nur als leichtes Vergehen gewertet.“
Jessi lachte auf, und Vero kam wieder zwischen den Sitzen hervor.
Mr. Selbstbewusstsein
Wie immer gab es an der Klinik keinen Parkplatz.
Ich fuhr mit meinem unauffälligen schwarzen Skoda-Taxi direkt vor den Haupteingang, ließ die beiden Mädels aussteigen und beobachtete sie so lange, bis sie im Gebäude verschwunden waren. Die Fahrt hatte zwanzig Minuten gedauert, und es kam mir so vor, als hätte ich die ganze Zeit über die Luft angehalten. Okay, das war ein bisschen übertrieben, aber ganz sicher war ich angespannt und weniger locker beim Fahren gewesen als sonst, hatte mich fast krampfhaft auf den Verkehr konzentriert, so, als führe ich in Jakarta oder Rom, aber nicht im verschlafenen Bremen.
Vero und Jessi hatten sich miteinander unterhalten, ohne mich weiter einzubeziehen. Aus dem Gespräch hatte ich erfahren, dass Vero eigentlich in Berlin lebte und nur zu Besuch hier in Bremen war - ich vermutete, zur moralischen Unterstützung ihrer Freundin.
Vero war sehr speziell, aber mir gefiel sie. Rein optisch hätten die beiden Freundinnen nicht unterschiedlicher sein können, und nach dem, was ich bisher mitbekommen hatte, traf das auch auf ihren Charakter zu. Dennoch schienen sie ein Herz und eine Seele zu sein, und ich fand es anrührend, wie Vero sich um Jessi kümmerte. Die meisten Patienten hatten mehr Angst vor der Strahlentherapie als vor der Chemo, das schien bei Jessi auch so zu sein. Dabei war das völlig unbegründet. Nach allem, was ich in den drei Jahren von meinen Fahrgästen erfahren hatte, war die Strahlentherapie zwar nicht gerade eine Wellness-Session, aber sie hatte doch weit weniger Nebenwirkungen als die Chemo.
Wahrscheinlich lag es an dem Linearbeschleuniger. Ein wirklich angsteinflößendes Gerät, keine Frage. Groß, wuchtig und irgendwie außerirdisch, mutete er wie die Schlafkapsel einer Raumfähre an, die einen in den Hyperschlaf versetzte, damit man, ohne zu altern, die nächste Galaxie erreichen konnte.
Wäre Jessi allein im Taxi gewesen, hätte ich versucht, ihr die Angst zu nehmen. Darin war ich mittlerweile ziemlich gut, und ich wusste, wovon ich redete, denn das Personal der Strahlenklinik hatte allen Fahrern unseres Unternehmens, immerhin fünfzehn Leuten, den Beschleuniger erklärt. Grund dafür war Werner Rademacher gewesen, ein Rentner und ehemaliger Soldat, der sich mit der Fahrerei etwas Geld dazu verdient hatte. Eigentlich ein netter Kerl, aber er hatte den Patienten etwas von Brandlöchern in der Haut und partiellem Verlust der Hirntätigkeit als direkte Folge der Bestrahlung erzählt. Ich mochte mir nicht vorstellen, was für Horrorfahrten das gewesen sein mussten. Jetzt fuhr Werner keine Patienten mehr, sondern Schulkinder. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er dort besser aufgehoben war.
Auf dem gegenüberliegenden kleinen Parkplatz wurde eine Stellfläche frei. Ich fuhr hinüber, setzte den Skoda rückwärts hinein, stellte den Motor ab und stieg aus. Es war Mai, die Luft wurde täglich wärmer, das Grün an den Bäumen und Büschen war jung und frisch, voller Farbe und Leben. Alles, was in der Lage war Knospen zu bilden, schoss dieser Tage aus, es war eine wahre Blätter- und Blüteninvasion. Selbst hier in der Stadt.
Im Frühling fiel es mir schwerer als in anderen Jahreszeiten, acht Stunden am Tag im Auto zu verbringen. Kaum wärmte die Sonne die Luft, plante ich meine nächsten Abenteuer. Leider hatte ich erst Mitte Juli Urlaub, und die Zeit bis dahin würde noch lang genug werden. Ich sehnte den Tag herbei, an dem ich all das hier komplett hinschmeißen konnte.
Michael kam auf mich zu, einer unserer Fahrer. Er war groß, stark übergewichtig und ein unverbesserlicher Schlaumeier. Es gab kein Thema, zu dem er nichts zu sagen wusste, und er ließ den Rest der Menschheit gern an seinen Erkenntnissen teilhaben. Ich mochte ihn nicht, versuchte aber, immer schön freundlich zu bleiben. Schließlich waren wir Kollegen und mussten miteinander auskommen.
„Was hast du denn für eine geile Fuhre?“, rief er. „Ich darf immer nur die Omas und Opas fahren, und du bekommst gleich zwei junge Mädels auf einmal.“
Michael trug wie immer eine weit geschnittene Worker-Jeans und ein kariertes Kunststoffhemd, das zwei Nummern zu groß war.
„Die eine ist nur heute dabei“, sagte ich, ohne ihn anzusehen, und trat gegen den Autoreifen, als müsste ich den Luftdruck prüfen. Profis machen das so.
„Welche?“
„Die mit dem langen Haar.“
Darüber dachte er tatsächlich einen Moment nach.
„Ha, ha, sehr witzig. Jetzt mal im Ernst, die sind doch nicht älter als dreißig, oder?“
„Nehme ich an, ja.“
„In dem Alter sind die Tumoren echt aggressiv. Keine guten Aussichten. Was hat sie denn? Brust, Gebärmutter oder was noch Krasseres? Hirn vielleicht?“
„Ich fahre sie zum ersten Mal heute.“
„Ja und? Ich frage meine immer sofort. Dann weiß ich, woran ich bin.“
Ich begriff einfach nicht, wie mein Kollege so vollkommen ohne Scheu und Skrupel mit diesem Thema umgehen konnte. Er sprach über Krebs und die verschiedensten Tumorarten wie ein Heizungsbauer über Überwurfmuttern, Absperrhähne und Doppelmuffen - was möglicherweise daran lag, dass er Heizungsbauer war. Ich hatte ihn einen Patienten fragen hören, ob ihm die Strahlendosis für heute reichte oder sie auf dem Rückweg noch beim Sonnenstudio Halt machen sollten. Solche Zoten riss er dauernd, aber bisher hatte sich kein Patient über ihn beschwert. Mein Chef hielt ihn sogar für seinen besten Mann. Willi setzte leider immer auf die falschen Pferde.
Mein Ding war diese Art von Humor nicht. Dafür ging mir das alles viel zu nah.
„Morgen fahr ich die beiden, dann weiß ich Bescheid“, sagte Michael. „Ist ja auch endlich mal was zum Hingucken.“
Ungeachtet seines Übergewichtes und seiner ständig feuchten Achseln hielt Michael sich für einen echten Womanizer. Zu meiner Überraschung kam er auch gut bei Frauen an, zumindest hatte er ständig eine neue Freundin. Keine Ahnung, wie er das machte.
„Das ist meine Tour“, sagte ich ernst.
„Alter Egoist.“ Er schlug mir auf die Schulter. „Aber ich versteh schon. Würde ich an deiner Stelle genauso machen. Ich hol mir einen Kaffee. Kommst du mit runter?“
„Ich warte lieber hier.“
Aus Sicherheitsgründen befand sich der Linearbeschleuniger im Keller des Gebäudes. Die Architekten des Neubaus waren aber emphatisch genug gewesen, den Keller nach hinten hin durch eine große Glasfront zu öffnen. Sobald man aus dem Fahrstuhl trat, bot sich einem der Blick auf einen kleinen Wasserfall und den dahinterliegenden Patientengarten, sodass man glatt vergessen konnte, wo man sich befand und aus welchem Grund. Es war schön da unten, keine Frage, aber in der Regel blieb ich lieber draußen, auch wenn es gern gesehen wurde, wenn die Fahrer die Patienten nach unten begleiteten, zumindest die ersten paar Mal, bis sie sich eingewöhnt hatten.
Der Praxis angegliedert war das kleine fensterlose Büro unseres Fahrdienstes, in dem Willi-Chef, wie wir ihn nannten, die meiste Zeit des Tages hockte, mit zu viel Kaffee seine Cholerik dopte, abwechselnd entweder hochrot oder blass wurde und sich über jedes Gespräch mit Nicht-Patienten freute.
Ich hatte vorgehabt, Jessi und Vero zu folgen, aber das ging jetzt nicht mehr. Wegen Michael. Ich ärgerte mich über mich selbst. Wieso schaffte dieser Kerl es immer wieder, dass ich mich ihm unterlegen fühlte?
Es war zwar noch etwas früh für mein Training, aber ich musste mich jetzt abreagieren.
Also schlenderte ich zum Gebäude hinüber, betrat es durch den Haupteingang, wandte mich nach rechts und öffnete die Tür zum Treppenhaus, einem gläsernen Turm. An sonnigen Tagen war es knallheiß darin, jetzt, am frühen Morgen, war die Temperatur aber noch angenehm. Sieben Stockwerke, immerhin.
Ich lief los. Zuerst langsam, dann immer schneller, bis ich mit alarmierend schnell klopfendem Herzen oben ankam. Sofort machte ich mich an den Abstieg und lief dann noch ein weiteres Mal hinauf. Jetzt brannten die Oberschenkel, aber ich war zufrieden, schließlich begann ich erst mit dem Training. Mein Ziel war es, ohne Pause sechsmal hintereinander hinauf zu laufen.
Während ich im siebten Stockwerk darauf wartete, wieder zu Atem zu kommen, fragte ich mich, ob Vero immer eine Glatze trug oder ob sie sie sich zugelegt hatte, um Jessi einen Gefallen zu tun.
Ich lehnte an dem metallenen Handlauf und blickte durch die Glasscheibe auf den Parkplatz hinab. Sah dort Michael mit einem Kaffeebecher in der Hand mit einer Krankenschwester flirten, die sich in ihrer Pause eine Zigarette gönnte. Sie lachte und strich sich das Haar zurück.
Plötzlich traten Vero und Jessi Arm in Arm aus dem Gebäude. Von hier oben erkannte ich sie nur aufgrund ihrer Glatzen. Sofort setzte Michael sich in Bewegung und hielt auf die beiden zu, die etwas verloren herumstanden.
So schnell wie nie zuvor spurtete ich die Treppen hinunter, berührte die Stufen kaum. Dennoch kam ich zu spät.
Michael hatte auf dem Taxistreifen direkt vor der Tür geparkt, was uns eigentlich verboten war, und sein Wagen mit Vero und Jessi darin rollte bereits davon, als ich aus dem Eingang stolperte.
Der Womanizer hatte wieder zugeschlagen.
Oma Olga
Ich wohnte bei meiner Oma.
Okay, auf den ersten Blick war das uncool für einen Sechsundzwanzigjährigen, aber es hatte viele Vorteile.
Einer war finanzieller Natur.
Denn Oma Olga besaß ein altes Reihenendhaus in Bremen, das für sie allein viel zu groß war. Früher hatte sie mit ihrem Mann und ihren drei Kindern - darunter mein Vater - darin gelebt, es bot also Platz genug. Opa Fritz war schon lange tot. Er war im Containerhafen im Morgengrauen über die Kaikante ins eiskalte Wasser gefallen und ertrunken, vier Jahre, bevor er in Rente gegangen wäre. Mein Vater war auch tot, seine beiden Schwestern waren längst in alle Himmelsrichtungen verstreut. Nun bewohnte ich zwei der ehemaligen Kinderzimmer, hatte ein eigenes Bad und brauchte keine Miete zahlen. Nur deswegen kam ich mit dem aus, was ich als Taxifahrer verdiente und konnte auch noch jeden Monat etwas zurücklegen für meinen großen Traum.
Unabhängig davon wohnte ich aber auch gern bei meiner Oma. Mit fast neunzig war sie nicht mehr so gut zu Fuß, und ihr Verstand wurde täglich löchriger, aber ihr spezieller Humor war legendär. In einem alten, faltigen Gesicht wie dem ihren wirkte ein verschmitztes Lächeln wie eine Ode ans Leben. Wenn man bei allen Schicksalsschlägen und Gebrechen, die sich in neunzig Jahren ansammelten - Oma Olga und ihr Mann Fritz waren aus Polen geflohen, hatten also das Grauen des Krieges erlebt -, noch herzhaft Lachen und schamlos über Politik und Nachbarn herziehen konnte, musste das Leben an und für sich doch schön sein, oder?
Wir verstanden uns gut. Ich erledigte ihre Einkäufe oder ging mit ihr gemeinsam in den Supermarkt, wenn ihr danach war. Sie kochte für mich. Ich hätte unterwegs jede Menge Fast Food essen können, aber für Oma Olga wäre es eine riesige Enttäuschung gewesen, wenn sie mich nicht mehr hätte verköstigen können. Essen bedeutete viel für sie, und sie schimpfte mit mir, weil ich nicht dicker wurde.
„Immer dieser Sport, das kann doch nicht gesund sein. Ein Mann braucht Speck auf den Rippen. Iss dich an, Junge!“
Diese halbe Stunde jeden Abend, die ich an ihrem kleinen Tisch mit der alten Wachsdecke in der Küche verbrachte, war für uns beide wichtig. Solange Oma Olga fit genug war, um zu kochen, würde ich davon nicht ablassen. Bequem war es für mich natürlich auch.
Heute lag ein Brief von den Stadtwerken auf dem Tisch.
„Die erhöhen schon wieder die Preise für Gas“, schimpfte sie und lud mir den Teller voll.
Es gab Kartoffeln mit Gulasch und grünen Bohnen. Da Oma stets große Portionen kochte, würde es das Gericht auch die nächsten beiden Tage noch geben.
Kauend überflog ich das Schreiben.
„Ich schaue später online mal nach anderen Anbietern.“
„Daran ist nur der Putin schuld. Tut so, als wäre das sein Gas. Dabei hat Gott es für uns alle gemacht. Du musst dir nur seine Augen anschauen, dann weißt du Bescheid.“
„Was ist denn mit Putins Augen?“
„Ist dir das noch nicht aufgefallen? So gucken kleine Kinder, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen. Bockig bis unter die Lider. Wenn der allein ist, wirft er sich auf den Boden und strampelt mit den Beinen. Wie früher dein Vater im Supermarkt. Da geh ich jede Wette ein.“
„Ich würde ja mit dir wetten, Oma, aber die Beweisführung dürfte schwierig werden, fürchte ich.“
„Vielleicht bestelle ich wieder Kohle, so wie früher“, überging sie meinen Einwand.
„Oma, die Heizung funktioniert nicht mehr mit Kohle.“
„Ich habe Fritz damals schon gesagt, das ist ein Fehler, diese Abhängigkeit. Kohle konnte er immer billig aus dem Hafen mitbringen. Versuch mal, Gas in Säcke zu stecken. Funktioniert nicht.“ Sie dachte kurz nach. „Können wir nicht Gasflaschen aus dem Baumarkt nehmen?“
„Nein, das funktioniert auch nicht. Aber ich gebe dir gern etwas zu den Gaskosten dazu.“
Sie schüttelte den Kopf, wie immer, wenn ich dieses Thema anschnitt.
„Du sparst so eisern für dein großes Ziel. Nee, lass mal, das klappt schon. Ich freue mich ja schon so auf die Karten, die du mir dann schickst.“
Oma Olga wusste, dass ihre Restzeit auf Erden begrenzt war. Dennoch ging sie hartnäckig davon aus, dass sie es noch erleben würde, wie ihr Enkel ihr von den entlegensten Orten dieser Welt Ansichtskarten schickte. Sie war ein großer Fan von Postkarten, aber heute versendete ja niemand mehr welche. Manchmal kaufte ich in der Stadt eine, schrieb liebe Grüße drauf und versandte sie mit der Post. Das war aber natürlich nicht dasselbe wie eine Karte aus Ecuador oder Nepal.
„Erzähl mir noch mal, was Himalaya heißt“, bat sie und bekam einen verträumten Blick.
„Der Name setzte sich aus den Begriffen ‚hima‘ für Schnee und ‚alaya‘ für Ort oder Wohnsitz zusammen.“
„Ja“, sagte sie leise. „Ort im Schnee.“
Irgendetwas löste diese Erklärung in ihr aus. Ich vermutete, es hatte mit ihrem Geburtsort zu tun, aus dem sie wegen des Krieges flüchten musste. Bis dahin hatte sie in einem kleinen Dorf am Fuße der Hohen Tatra gelebt, der zuverlässig jeden Winter im Schnee versank. In Bremen schneite es so gut wie nie, und wenn, dann war der Schnee nicht weiß und trocken, sondern braun und matschig. Eine Zumutung für sie. Für mich übrigens auch. Ich war ein Wintermensch. Etwas, was uns beide verband.
„Und die Eisige Frau?“, fragte Oma Olga.
„Was ist damit?“
„Von dort will ich auch eine Karte.“
„Bekommst du, ich verspreche es.“
Sie löste sich aus ihrer romantischen Träumerei, nahm meinen Teller, den ich noch nicht einmal zur Hälfte geleert hatte, ging zum Herd, füllte ihn wieder auf und stellte ihn vor mich hin.
„Was machen deine Kranken?“, fragte sie, setzte sich zu mir an den Tisch und aß mit mir.
Ich berichtete ihr von den beiden glatzköpfigen Mädchen, die ich heute zum ersten Mal gefahren hatte. Dass Michael mich ausgetrickst und sie mir ausgespannt hatte, erwähnte ich nicht.
„Herr im Himmel! So jung!“ Oma Olga schüttelte den Kopf. „Können die Ärzte denn etwas für sie tun?“
Ich zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß es nicht.“
„Fährst du sie morgen wieder?“
„Wahrscheinlich.“
„Ich packe etwas von dem Gulasch ein. Wir haben ja genug, und so, wie du es erzählt hast, braucht das Mädchen etwas Ordentliches in den Bauch.“
Dagegen zu protestieren war sinnlos. Oma Olga würde die Tupperware mit Gulasch eigenhändig in mein Taxi legen, wenn ich sie nicht freiwillig mitnahm. Sie glaubte felsenfest daran, dass ihre eigene Gesundheit vom guten und regelmäßigen Essen herrührte. Mit einem Teller heißer Suppe konnte Oma Olga alles heilen. Erkältungen kannte sie nur vom Hörensagen, weil sie jeden Tag einen Liter Brennnesseltee trank - ein furchtbares Gesöff, das ich auch nach mehreren Versuchen nicht hinunter bekam.
Ich würde das Gulasch unterwegs selbst essen. Kalt.
Was blieb mir anderes übrig?
Später saß ich mit dem Laptop auf den Oberschenkeln auf dem Bett. Draußen war es längst dunkel geworden. Oma schlief vermutlich bereits.
Ein Güterzug donnerte vorbei. Gefühlt rollte er direkt auf der anderen Wandseite meines Schlafzimmers entlang, und es dauerte ewig, bis er endete. Ja, es gab auch einen Nachteil an meiner Wohnsituation. Oma Olga behauptete, sie würde die Züge nicht mehr hören, doch das konnte einfach nicht sein. Das Gleis lag keine zwanzig Meter vom Haus entfernt, in den Vitrinen wackelte das Porzellan, und der Putz hatte überall Risse von den Erschütterungen. Wenn ich fernsah, musste ich immer die Fernbedienung in der Hand behalten, um bei einem vorbeifahrenden Zug die Lautstärke hochzudrehen. Sonst fehlten mir dauernd die wichtigsten Stellen der Dialoge.
Auf dem Bildschirm des Laptops vor mir sah ich den Chimborazo, jenen inaktiven Vulkan in Ecuador und höchster Berg des Landes. Er war 6267 Meter hoch, ragte aus dem ihn umgebenden Hochland aber nur 2500 Meter empor. Für gute Bergsteiger mit Gletschererfahrung in zwei Tagen machbar.
Mein großes Ziel.
Nicht erst, seitdem ich Oma Olga jede Menge Postkarten für Miete und Heizkosten schuldete.
Ob die normale Route, die Whimper-Route oder die direkte Route - ich hatte sie alle im Kopf, war sie Dutzende Male in meiner Fantasie durchstiegen, kannte die Gefahren und die Schlüsselstellen. Extreme Kälte, Lawinengefahr, unberechenbares Wetter, Gletscherspalten, so tief wie Häuser, und Sauerstoffmangel hatten schon vielen Bergsteigern das Leben gekostet. Mich schreckte all das nicht.
Was fehlte, waren allein Geld und Zeit. Die Reise war teuer, die Ausrüstung ebenfalls, und um das Geld dafür zusammenzubekommen, musste ich arbeiten. Als Taxifahrer verdiente ich gerade mal den Mindestlohn, deswegen dauerte es so lange, die Kohle anzusparen. Ich war von Beruf Tischler, da hätte ich mehr verdienen können, doch Ikea hatte fast alle Jobs in der Branche vernichtet, und Pressholzmöbel in lichtlosen Betonbunkern zusammenzuschrauben kam für mich überhaupt nicht infrage. Lieber wartete ich ein wenig länger. Kein Problem. Ich war jung und hatte Zeit.
Meine Gedanken schweiften ab. In meiner Fantasie wiederholte sich ein ums andere Mal der Blick in den Rückspiegel des Taxis heute Morgen. Ich sah Jessi Bischoffs moosgrüne Augen, ihr einladendes Lächeln - und ihre Glatze. Es schnürte mir die Kehle zu. Vielleicht sollte ich ihr Omas Gulasch wirklich geben, statt es selbst zu essen.
Ich schloss die Augen und ließ die ganze Situation noch einmal Revue passieren. Leider schob sich sofort Michael ins Bild. Der dicke, selbstbewusste Michael, der sich nicht infrage stellte, einfach war, wie er war, unverstellt, ungekünstelt, authentisch.
Ich klappte den Laptop zu, legte ihn beiseite, schnappte mir die Fernbedienung des Fernsehers, schaltete ihn ein und startete die DVD an der Stelle, an der ich gestern ausgestiegen war.
Irgendwie war mir jetzt nach The Walking Dead.
Nach Zombies, die aussahen wie Michael.
Allein mit Jessi
In der Nacht hatte ich einen erbaulichen Traum. Daryl Dixon hetzte mit seiner Armbrust den dicken Michael durch einen dschungelartigen Wald und jagte ihm einen Pfeil in die linke Arschbacke. Als der Wecker klingelte, war ich dankbar dafür, mich an den Traum erinnern zu können. Ich war ein großer Walking-Dead- Anhänger und liebte diese Fan-Fiction, auch wenn sie nur in meinem Kopf stattfand.
Nachdem ich geduscht und mich angezogen hatte, wartete in der Küche bereits das Frühstück auf mich. Oma Olga stand sogar noch vor mir auf, obwohl sie so früh am Tag überhaupt nichts zu tun hatte. Lange auszuschlafen war eine Einladung an den Tod, meinte sie. Ich konnte rein gar nichts dagegen tun, dass der Kaffee bereits fertig war und meine spezielle Müslimischung mit Joghurt auf dem Tisch stand.
Wie jeden Tag trug Oma Olga eine blaue Kittelschürze, deren Farbe verblichen war wie ihre Jugend. In aller Herrgottsfrühe hatte sie sich diese altmodischen Lockenwickler ins spärliche Haar gedreht, die aussahen wie aufgerollte Igel. Die bunten Farben waren lustig, alles in allem sah es aber erschreckend aus.
Ebenfalls auf dem Tisch stand eine Tupperdose, die sonst nicht dort stand. Ich ahnte, was sie enthielt.
„Für deine Krebskranke“, sagte Oma Olga. „Damit sie wieder zu Kräften kommt.“
Ich nahm es hin und hoffte auf den Tag, da irgendein Patient oder eine Patientin durch das mitgebrachte Essen meiner Oma eine Spontanheilung erlebte. Warum passierte so etwas eigentlich nicht? Welcher Beamte verwaltete das Schicksal und entschied sich immer wieder für die ganze negative Scheiße? Ich würde eine eigene Klinik eröffnen und dort Anti-Krebs-Essen verkaufen. Hier bitte schön, einmal Nudeln mit Gulasch gegen Leberkrebs. Oder hier, ganz neu, Erbsensuppe mit Speckschwarte gegen Prostatakrebs.
Auf dem Weg zu Jessi Bischoff fragte ich mich, ob ich den Job vielleicht schon zu lange machte. Konnte man eigentlich einen Tumor bekommen, wenn man zu oft an Krebs dachte?
Um acht Uhr zehn, fünf Minuten vor der Zeit, ließ ich den Wagen am Bordstein vom Taubenweg 11 ausrollen. Jessi Bischoff wohnte in einem langweiligen Mietshaus an einer viel befahrenen Straße. Ich stieg aus und trat vor die Eingangstür. Hinter mir der Lärm des Berufsverkehrs, vor mir das Klingelschild mit dem Namen Bischoff darauf. Dass er handgeschrieben war, wirkte irgendwie vorübergehend oder als sei sie gerade erst hier eingezogen. Ich schellte, zog mich einen Schritt von der Tür zurück und steckte die Hände in die Taschen.
„Ja?“, kam es leise aus der Gegensprechanlage.
Ich beugte mich vor.
„Das Taxi ist da.“
„Ich komme.“
Zwei Minuten später sah ich sie durch die gläserne Eingangstür langsam die Treppen hinuntersteigen. Sie trug dieselben übergroßen Klamotten wie gestern. Dazu die Jutetasche mit dem Orca darauf und dem Handtuch darin.
„Hey“, begrüßte sie mich lächelnd. „Überaus pünktlich.“
„Wir geben unser Bestes.“
Ich öffnete die hintere Tür des zivilen schwarzen Taxis.
Sie zögerte.
„Darf ich vorn sitzen?“
„Aber sicher.“
Ich war nicht schnell genug, um ihr auch diese Tür aufzuhalten, konnte sie aber immerhin noch schließen, während sie den Gurt um ihren Körper raffte.
Als ich einsteigen wollte, fuhr ein UPS-Lieferwagen mir um Haaresbreite die Tür ab. Meine Schuld. Ich hatte ihn nicht gesehen. Der Fahrer hupte, es klang wütend. Zu Recht.
„Das war knapp“, sagte Jessi.
Sie sah erschrocken aus.
„Alles klar mit dir?“
„Alles bestens. Ich mach das morgens immer so. Hilft mir, wach zu werden.“
„Versuch’s doch mal mit Kaffee“, schlug sie vor.
„Habe ich. Es ist aber die Kombi von beidem, die mich wirklich durchstarten lässt.“
Ich stieg ein, schnallte mich an, fuhr los und versuchte, mir den Schreck nicht anmerken zu lassen.
„Sorry wegen Vero gestern“, sagte Jessi.
„Kein Problem. Ist sie immer so direkt?“
„Du machst dir kein Bild.“
„Doch so schlimm.“
„Schlimmer. Sie kann echt furchtbar anstrengend sein, aber ich hatte nie eine bessere Freundin. Ich liebe sie. Sie hat sich meinetwegen eine Glatze schneiden lassen, dabei hatte sie so wundervoll langes schwarzes Haar. Sie würde alles für mich tun.“
„Klingt toll.“
„Manchmal ist es das … und manchmal auch nicht.“
An dieser Stelle fehlten mir zwar nicht die Worte, aber ich fand, es stand mir nicht zu, zu fragen, warum es manchmal nicht toll war, Vero zur Freundin zu haben.
„Du hast jeden Tag mit Krebskranken zu tun?“, fragte Jessi.
Ich nickte.
„Jeden Tag.“
„Reden die darüber? Über die Krankheit, meine ich.“
„Manche ja, andere nicht. Ist ganz verschieden.“
„Ich nerve dich sicher nicht damit.“
„Du würdest mich nicht damit nerven. Ehrlich.“
„Kann schon sein, aber je weniger ich drüber rede, umso besser geht’s mir. Vero hat es nett gemeint mit der Glatze, das weiß ich, aber immer, wenn ich sie anschaue, sehe ich mich.“
„Verstehe“, sagte ich und konzentrierte mich aufs Fahren, denn jetzt fehlten mir wirklich die Worte.
Bei jedem Abbiegen wandte ich übertrieben den Kopf, so wie man es damals in der Fahrschule tun musste, behielt ständig die anderen Verkehrsteilnehmer im Blick und sah dauernd in den Rückspiegel, so als würden wir verfolgt. Ich war vollauf mit Fahren beschäftigt und stellte mir die Frage, was Michael in dieser Situation wohl sagen würde …
Und, was für einen Krebs hast du? Brust oder Gebärmutter? Oder irgendwas noch Fieseres? Ich will nicht taktlos sein, ich weiß halt nur gern, woran ich bin. Wie lange haben dir die Ärzte noch gegeben?
Irgendwas in der Richtung vermutlich. Alles indiskrete Fragen, die ich niemals über die Lippen bringen würde.
„Ich ging gestern davon aus, du würdest uns auch wieder zurückfahren“, sagte Jessi Bischoff und rettete uns beide aus dem peinlichen Schweigen.
„Eigentlich war das auch so geplant, aber dann ist … in letzter Sekunde etwas dazwischengekommen“, log ich.
„Und heute?“
„Fahre ich dich auf jeden Fall zurück. War mein Kollege nett?“
„Schon, ja. Er hat Musik von Conny Frei gehört, das war ein gefundenes Fressen für Vero. Nachdem sie ihn sich vorgenommen hatte, hat er dann auch den Mund gehalten.“
„Mag Vero die Musik von Conny Frei etwa nicht?“
Die Schlagersängerin war in aller Munde und sehr erfolgreich.
„Vero hasst Schlagermusik!“
„Überrascht mich nicht. Und du?“
„Ach, so schlimm find ich die Frei gar nicht. Sie textet gut.“
„Vero und du, ihr seid so unterschiedlich. Woher kennt ihr euch eigentlich?“
Endlich war mir eine halbwegs vernünftige Frage eingefallen, die nichts mit der Krankheit zu tun hatte.
„Bis vor einem halben Jahr habe ich in Berlin gelebt. Vero und ich haben uns auf der Arbeit kennengelernt.“
„Und was machst du jetzt hier?“
„Meine Eltern leben hier.“
Und schon waren wir wieder beim Thema. Natürlich wollte Jessi Bischoff in dieser schwierigen Situation ihre Eltern um sich haben, und ihre Eltern wollten für sie da sein. Verständlich.
„Ich wollte hier neu anfangen. Außerdem sollte Leonie Oma und Opa in der Nähe haben.“
Zwischen den beiden Sätzen hatte sie eine große Pause gemacht. Was da alles hineinpasste, wirbelte meine Gedanken durcheinander, sodass ich nicht gleich verstand, wie das mit Leonie und Oma und Opa zusammenhing.
„Meine Kleine wird bald fünf“, schob Jessi nach.
„Du hast eine fünfjährige Tochter?“
„Da bist du überrascht, was?“
„Ein wenig“, gab ich zu.
„Ist das nicht eine geile Geschichte?“, fragte sie mit vor Sarkasmus triefender Stimme. „Da entschließe ich mich endlich, zurück aufs Land zu ziehen, alle Zelte hinter mir abzubrechen und noch einmal neu anzufangen, und noch bevor ich einen Job finde, bekomme ich eine Krebsdiagnose.“
„Darf ich fragen, was für einen Tumor du hast?“
„Was ganz Exotisches. Er sitzt neben der Luftröhre und klettert wie Efeu an einem Baum daran hoch. Ohne Behandlung würde er nach und nach meine Luftröhre zusammenquetschen und mich ersticken. Und weil ich so jung und kräftig bin, wächst er doppelt so schnell wie bei anderen. Soweit die Diagnose der Ärzte.“
„Gibt es noch eine andere?“
„Ja, meine. Die ganze Scheiße, die ich in Berlin erlebt habe, ist mir im buchstäblich im Hals stecken geblieben. Aber keine Bange, ich sorge dafür, dass ich sie wieder loswerde. Oh Mann, jetzt reden wir ja doch über den Krebs! Ich hatte doch gesagt, ich nerve dich nicht damit.“
„Das ist wirklich in Ordnung. Ich würde mich sonst die ganze Zeit fragen, warum du es nicht tust.“
„Okay, das war’s dann aber auch. Ich hätte da aber noch eine Bitte.“
„Schieß los!“
„Meine Mama hat Leonie gestern und heute in den Kindergarten gebracht, aber das klappt nicht immer, da sie arbeiten muss. Wäre es vielleicht möglich, wenn wir die Kleene hin und wieder vorher zum Kindergarten mitnehmen? Es ist auch fast kein Umweg.“
„Klar, kein Problem“, sagte ich leichthin.
Erst danach wurde mir bewusst, wie schnell es bei unserem eng getakteten Zeitplan eben doch zu einem Problem werden konnte.
Dass es aus einem ganz anderen Grund zu einem Problem werden würde, konnte ich ja nicht ahnen.
Willi-Chef
„Fahrstuhl oder Treppe?“, fragte ich Jessi.
„Treppe“, antwortete sie.
Ich hielt ihr die Tür auf, sie bedankte sich mit einem Lächeln, und nebeneinander liefen wir die Stufen in den Keller hinunter. Unten angekommen, war sie ein wenig außer Atem, versuchte aber, es sich nicht anmerken zu lassen. Die doppelflügelige Tür zur Klinik öffnete sich automatisch, und wir betraten das Reich von Carl dem Großen.
Der Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie war Professor Carl Urban. Weil er annähernd zwei Meter groß war, lag es nahe, ihm diesen Spitznamen zu verpassen. Er ging stets leicht gebückt und litt wohl unter Rückenschmerzen. Ich konnte den Mann nicht wirklich einschätzen. Im Umgang mit Patienten schien er sensibel und freundlich zu sein, aber ich hatte ihn auch wütend erlebt, wenn irgendwas nicht rund lief oder wir unsere Fahrgäste nicht pünktlich zur Bestrahlung anlieferten. Die Klinik war von morgens acht bis abends sechs geöffnet, und die beiden Weltraum-Linearbeschleuniger arbeiteten ohne Pause durch. Doch das reichte nicht, es gab eine Warteliste mit Patienten. Die ganze Welt, so erschien es mir, war krebsverseucht.
Draußen im Patientengarten plätscherte der Wasserfall. Die morgendlichen Sonnenstrahlen fielen schräg durch das zwei Stockwerke umfassende Panoramafenster in ein Atrium, in dem um eine nur wenige Zentimeter tiefe Wasserfläche Sitzgruppen platziert waren. In großen Terrakottatöpfen standen drei bis vier Meter hohe Palmen herum, alle paar Minuten stießen aus der Wasserfläche kleine Geysire empor, und das sanfte Geräusch sprudelnden Wassers hallte zwischen den Wänden wider. Dies war der extravaganteste und teuerste Warteraum, den ich je gesehen hatte, und nach dem, was ich gehört hatte, war er auf Wunsch Carls des Großen entstanden. Er wollte seinen Patienten die Wartezeit so angenehm wie möglich gestalten. Das fand ich nobel. Man konnte aber andererseits auch denken, die Arbeit mit Krebspatienten brachte zu viel Geld ein.
An der rechten Seite befand sich die Anmeldung mit dem langen Tresen aus glänzendem Holz. Heute hatte Anna-Lena Frühdienst. Sie wünschte uns beiden einen guten Morgen.
Statt sich zu setzen, ging Jessi bis an das Panoramafenster vor und sah hinaus. Ich stand hinter ihr und kam nicht umhin, zu bemerken, wie das Sonnenlicht auf ihrer Glatze schimmerte. Ich fand es gut, dass sie kein Tuch trug, so wie die meisten anderen Frauen, denen durch die Chemo das Haar ausgefallen war.
„Ist schon krass, dass man erst todkrank werden muss, um so etwas Schönes zu sehen zu bekommen“, sagte Jessi.
„Taxifahren reicht auch“, erwiderte ich.
Sie drehte sich zu mir um.
„Ja, du hast den absoluten Traumjob.“
Dann wandte sie sich wieder dem Ausblick zu.
„Wenn ich reich und berühmt bin, will ich auch so einen Wasserfall vor dem Wohnzimmerfenster.“
In diesem Moment hatte ihr Blick etwas Sehnsüchtiges.
Aus den Lautsprechern, die überall im Atrium verteilt waren, erklang eine sanfte Stimme.
„Frau Bischoff, bitte in Kabine eins.“
„Man verlangt nach mir“, sagte Jessi, ging auf die Kabine zu und warf einen Blick über die Schulter zurück. „Nicht wieder weglaufen.“
Würde ich nicht.
Auf gar keinen Fall!
Ich nutzte die zehn Minuten für ein Gespräch mit Willi-Chef.
Die Klinik stellte uns ein Büro zur Verfügung, damit die Wege zwischen Personal, Patienten und Fahrdienst kurzgehalten werden konnten. Die kleine fensterlose Kammer war eigentlich ein Behandlungsraum mit allen dafür notwendigen Vorrichtungen und Anschlüssen, wurde zurzeit aber für diese Zwecke nicht gebraucht. Aus diesem Grund war die Büroeinrichtung aus Schreibtisch, Aktenschrank, zwei Besucherstühlen und einer staubigen Plastikpalme provisorisch. Das Licht war kalt und hart, die Lüftung schlecht, alles in allem überhaupt kein Vergleich zu dem Atrium vorn.
Es roch nach Kaffee und Mettbrötchen, als ich den Raum betrat. Willi-Chef hockte blass und hohlwangig und mit krummem Rücken vor dem PC. In puncto Größe konnte er es mit Professor Urban aufnehmen, doch Willi war viel dünner, geradezu dürr, mit Armen und Beinen wie Bambusstangen. Wie er in diesem kalten Licht dahockte, sah er aus wie ein Krebskranker im Endstadium.
Wir begrüßten uns mit dem obligatorischen „Moin“.
„Kaffee?“, fragte Willi.
„Hast du ihn gekocht?“
„Selbstredend.“
„Dann lieber nicht.“
Er trank einen Schluck und warf mir über den Rand des Bechers einen gequälten Blick zu. Ich ließ mich in einem der Besucherstühle nieder.
„Ich bin mit Jessi Bischoff hier“, sagte ich, obwohl er das natürlich wusste, schließlich machte er die Planung.
Ich erzählte ihm von Jessis Bitte, ihre Tochter hin und wieder morgens am Kindergarten abzusetzen.
„Ich hasse Sonderwünsche“, sagte Willi-Chef. „Wie viel Kilometer?“
„Wie bitte?“
„Wie viele Kilometer beträgt der Umweg?“
„Höchstens einen, aber das spielt doch wohl keine Rolle.“
„Natürlich spielt es eine Rolle, weil er nicht von der Krankenkasse bezahlt wird. Geht also auf unsere Kosten.“
„Das ist jetzt nicht dein Ernst?!“
„Du willst doch am Ende des Monats auch dein Geld, oder nicht?“
„Ja, sicher, aber wir reden hier über ein paar Hundert Meter.“
„Jaja, schon gut. Solange du vorher keine Tour hast, sollte das klappen“, sagte Willi-Chef. „Musst dann halt früher dort aufschlagen.“
„Das bekomme ich hin.“
Ich fragte ihn, ob es möglich wäre, mich für die gesamte Dauer von Jessi Bischoffs Bestrahlung als einzigen Fahrer einzusetzen. Keine Ahnung, warum ich das tat. Ich wollte wohl einfach nicht, dass Michael sie vollquatschte.
Mein Chef nickte.
„Habe ich ohnehin so eingeplant. Carl der Große hat mich darauf hingewiesen, hier einen sensiblen Fahrer einzusetzen.“
„Wirklich?“
Ich wusste bisher nicht, dass ich in diesem Unternehmen als sensibel eingestuft wurde. Diverse Streite mit Willi-Chef waren nicht gerade höflich und respektvoll verlaufen. Viel interessanter war aber, warum Carl der Große überhaupt einen bestimmten Fahrertypus für Jessi Bischoff verlangte. Es war mir nicht bekannt, dass er dergleichen vorher schon einmal getan hatte.
„Warum?“, fragte ich.
Willi sah nicht vom PC-Bildschirm auf, als er antwortete. Buchstabenreihen spiegelten sich auf seinen Brillengläsern.
„Weil es sein kann, dass sie die sechs Wochen Strahlentherapie nicht überlebt.“
Knochenbrecher-Ingo
Die Route hieß „Knochenbrecher“ und war als glatte Sechs eingestuft.
Sie lag in der südwestlich ausgerichteten Wand und damit den gesamten Nachmittag in der bereits kräftigen Maisonne. Als ich am frühen Abend meine Hand an die raue Betonwand des Bunkers legte, strahlte sie enorme Wärme ab.
Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs hatte dieses monströse Bauwerk dem Schutz von Material und Menschen gedient, nun war es ein Eldorado für Kletterfreaks wie mich. Bremen in der norddeutschen Tiefebene war arm an natürlich Felswänden, wir nahmen daher alles, was wir kriegen konnten. Wie die meisten, die hierherkamen, kletterte auch ich lieber in den Wänden der Dolomiten oder Alpen, wo es fantastische Ausblicke gab, doch die waren weit entfernt und für mich nur zweimal im Jahr erschwinglich - wenn überhaupt. Vom Bunker aus hatte man nur Ausblick auf die umliegenden, ein wenig deprimierend wirkenden Häuser und von ganz oben auf die Autobahn. Deren stetiges Rauschen gehörte hier einfach dazu.
„Alles klar?“, fragte Ingo.
Ingo Schneider war mein Kletterbuddy. Mein Sicherungspartner. Mein Freund. Mit Ingo hatte ich die Grundschule und die Realschule durchgestanden sowie alle Partys und die unvermeidlichen Bewährungsproben für jede echte Männerfreundschaft: Mädchen. Nichts von alledem hatte uns auseinanderbringen können. Unsere Bande waren fest, und das gemeinsame Interesse am Klettern sorgte dafür, dass sie es blieben. Einmal die Woche trafen wir uns am späten Nachmittag am Bunker. Wenn man gut sein und besser werden wollte, musste man regelmäßig trainieren. Außerdem begann jetzt die Vorbereitung für die Alpentouren im Sommer. Und zwar nicht nur für uns, sondern für alle anderen Kletterer der Stadt ebenso, dementsprechend voll war es am Bunker.
„Kann losgehen“, sagte ich mit Entschlossenheit in der Stimme.
Am Knochenbrecher war ich bereits zweimal gescheitert. Eine glatte Sechs war eine glatte Sechs, da gab es nichts zu beschönigen. War man nicht fit und fokussiert, kackte man ab. Bei den vielen Blicken der Zuschauer, die dank des guten Wetters auf dem Rasen ringsherum lagen und saßen, wäre ein erneutes Versagen äußerst peinlich.
„Na dann, lass knacken!“, forderte Ingo mich auf.
Ein letztes Abklatschen.
Ich griff in den Magnesiumbeutel, der hinten im Rücken an meinem Sicherungsset befestigt war, puderte meine Hände und schloss kurz die Augen, um mich zu konzentrieren. Sofort sah ich Jessi Bischoff, wie sie mit glänzender Glatze und sehnsüchtigem Blick vor dem Wasserfall im Atrium der Klinik stand.
Ich schüttelte das Bild ab, packte den ersten Griff und stieg in die Route ein. Vor mir lagen zwanzig Meter Aufstieg. Die ersten zwei waren von den Erbauern der Route nicht ernst gemeint, sie sollten einen in Sicherheit wiegen oder verarschen, je nachdem, wen man fragte, aber danach ging es ans Eingemachte. Die Griffe wurden kleiner, glatter, lagen weiter auseinander, die Fußarbeit wurde wichtiger. Sechs Meter schaffte ich in geschmeidigen Bewegungen ohne Pause, dann stoppte ich, puderte meine Hände erneut und sah hinauf. Noch zwei Meter bis zum Überhang. Weiße Magnesiumspuren zeugten von den vielen Versuchen, ihn zu überwinden. Auf diese Schlüsselstelle sollte ich mich fokussieren, nur darauf.
Aber mein Kopf beschäftigte sich mit Jessi Bischoff.
Oder besser, mit dem, was Willi-Chef gesagt hatte.
Während der Rückfahrt hatte ich mich nicht getraut, Jessi zu fragen, ob es stimmte. Sie selbst hatte das Krebsthema nicht erneut angeschnitten, aber ich hatte das Gefühl gehabt, es sei allgegenwärtig, lauere hinter jedem Wort, jeder Geste, jedem Lächeln. Jessi hatte viel gelächelt auf der Rückfahrt und von Leonie gesprochen, ihrer kleinen Tochter. Offenbar ein Wildfang und Sonnenschein zugleich. Über Leonies Vater hatte sie hingegen kein Wort verloren …
„Soll ich dir eine Tasse Tee bringen?“, kam es von unten.
Ingo stand mit in den Nacken gelegtem Kopf da und starrte hinauf. Seine Hände lagen am Sicherungsseil.
„Ich genieße die Aussicht.“
„Ja, ich auch … auf deinen Arsch, also sieh zu, dass du weiterkommst.“
Bereits am Beginn des Überhangs schmerzten meine Arme, und die Finger in der rechten Hand waren nahe an einem Krampf. Ich lockerte sie, kundschaftete mit Blicken die Route aus und machte mich an die Arbeit. Meine Muskeln schrien und zitterten, aber ich kam voran. Dann packte ich einen Griff, der streng genommen keiner war, ein Nichts, an dem man sich festhalten sollte. Meine Fingerspitzen suchten die kleinen Vertiefungen auf der Innenseite, krallten sich hinein, doch als ich mein Gewicht verlagerte, rutschte ich ab.
Sturz.
Zwei Meter.
Ingo hatte wie immer gut aufgepasst und fing mich sanft ab.
Ich schrie meine Wut hinaus, während er mich an der Wand herabließ.
Danach war ich mit Sichern an der Reihe. So war unsere Regel. Wer stürzt, darf es nicht sofort noch einmal versuchen. Irgendeine Strafe, wenn schon nicht den Tod, sollte so ein Sturz wenigstens nach sich ziehen, fanden wir. Ingo war schnell und souverän und brachte den Knochenbrecher ohne Probleme hinter sich. Er konnte schon immer besser klettern als ich, aber heute wurde der Klassenunterschied besonders deutlich.
Nachdem er unten angekommen war, setzten wir uns ins Gras und sahen anderen Kletterern dabei zu, wie sie sich abmühten.
„Was war los?“, stellte Ingo die unvermeidliche Frage.
„Nicht mein Tag.“
Er reichte mir die Wasserflasche, ich nahm sie und trank.
„Habe ich gleich gemerkt. Willst du drüber reden?“
Das war so eine Sache, die zwangsläufig mit einer jahrelangen guten Freundschaft einherging. Man konnte sein Gefühlsleben kaum verstecken. Ingo hatte ein gutes Gespür dafür, wie es mir ging. Und umgekehrt war es genauso. Aus Gründen, die ich nicht verstand, war ich aber nicht bereit, mit ihm über Jessi Bischoff zu sprechen. Mir schien es, als versuchte ich, sie dadurch für mich zu behalten. Total beknackt, irgendwie.
„Die Arbeit“, sagte ich ausweichend.
Einen Moment beobachteten wir, wie ein junges Mädchen mit brünettem Haar, höchstens sechzehn Jahre alt, den Überhang am Knochenbrecher mit Leichtigkeit meisterte. Sie bewegte sich, als würde sie tanzen, es war ein Fließen und Gleiten, sie war eins mit dem Fels … oder vielmehr mit der Betonwand des Bunkers.
„Alter, wie lange willst du den Scheiß noch machen?“, fragte Ingo. „Das hält doch auf Dauer keiner aus. Du bist der Chauffeur der Toten.“
„Die leben alle.“
„Ja, gerade noch so.“
„Man merkt, du bist ein Roadie.“
Ingo hatte eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker gemacht, war also streng genommen gar kein Roadie. Zwar baute er immer noch eigenhändig Ton- und Lichttechnik auf, die wirklich harte Arbeit machten aber die schweren Jungs mit dem langen Haar und den tätowierten Armen. Ingo war gefragt und bekam immer öfter Aufträge von richtigen Stars, oder solchen, die es mal gewesen waren. Er hatte in der Stadthalle die Showtechnik für Boss Hoss, Wincent Weiss und Sarah Connor gemacht und - für mich besonders hart - für Reinhold Messner, als der im Pier Eins sein neues Buch vorgestellt hatte. Klar war ich auch dort gewesen, aber im Publikum, während Ingo dieser Legende ganz nahegekommen war.
„Ich sag’s dir noch mal. Du kannst jederzeit bei mir anfangen.“
Das Angebot machte Ingo mir, seitdem er sich selbstständig gemacht hatte, und ich nach meiner Ausbildung zum Tischler keinen richtigen Job mehr gefunden hatte.
„Hast du nicht gesagt, Janet Jackson hätte dir in den Schritt gefasst?“
„Na und?“
„Mann, die ist voll alt. Nee, danke, da fahre ich lieber die Todgeweihten.“
„Fang dir bloß nichts ein.“
„Krebs ist nicht ansteckend.“
„Schlechte Laune aber schon.“
„Ich habe keine schlechte Laune.“
Die hatte ich wirklich nicht. Ich war nachdenklich und traurig, aber schlechte Laune hatte ich nicht. Dafür war die Erinnerung an Jessis Lächeln viel zu intensiv.
Das Mädchen, das mir vorgemacht hatte, wie man gut kletterte, sprang auf den Boden und hakte sich aus dem Sicherungsseil aus.
Ingo klatschte Beifall, und sie sah herüber.
„Hätte ich die als Kletterpartnerin, müsste ich nicht immer auf deinen hässlichen Arsch starren. Weißt du eigentlich, wie beängstigend es ist, wenn der auf einen zugestürzt kommt?!“
Ich verpasste ihm einen Faustschlag gegen die Schulter.
Oma wird vergesslich
Als ich um halb acht nach Hause kam, hockte Oma Olga auf der untersten der drei Stufen, die zur Haustür hinaufführten. Sie trug ihren blauen Arbeitskittel, die frisch gedrehten Locken standen wie Draht von ihrem Kopf ab.
„Oma? Warum sitzt du vor dem Haus?“