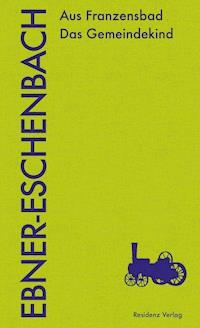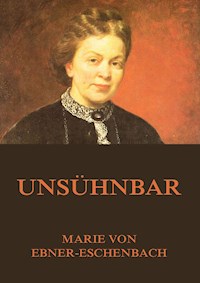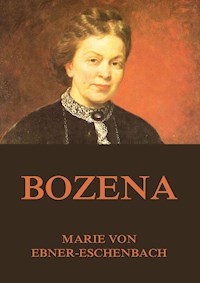Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Marie von Ebner-Eschenbachs Werk "Die arme Kleine" ist eine bewegende Erzählung, die das Leben einer jungen Waise im 19. Jahrhundert porträtiert. Der literarische Stil des Buches ist geprägt von Einfühlsamkeit und feiner Beobachtungsgabe. Ebner-Eschenbach gelingt es, die sozialen Verhältnisse und die harten Lebensbedingungen jener Zeit realistisch darzustellen. Mit einer starken Charakterzeichnung und einem fesselnden Erzählfluss entführt die Autorin die Leser in die Welt der Protagonistin und lässt sie an deren Schicksal teilhaben. Dieses Werk steht im literarischen Kontext des Realismus und kritisiert auf subtile Weise gesellschaftliche Missstände.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die arme Kleine
Books
Inhaltsverzeichnis
1.
Im Jänner, am Tage, an dem der Bauernregel nach die erste Regung des Lebens in den erstarrten Bäumen erwachen soll, wurde die Kleine geboren. Ihre Eltern hatten schon drei Söhne, Leopold, Josef und Franz. Drei Riesen. Der älteste, der große Junge mit den reichen, braunen Haaren, den dunklen Augen, den schönen regelmäßigen Zügen, glich dem Vater. Der zweite, mit dem lichtbraunen Gelock und den blaugrauen Augen, hatte kein Vorbild in der Familie, entwickelte sich auf seine eigene Art zu einem kühnen, prächtigen Menschenexemplar. Der dritte sah der Mutter ähnlich, hatte ein sanftes Gesicht und war hellblond.
»Wenn wir noch einen kriegen,« sagte Herr von Kosel, »und wenn es so weiter geht in der Schattierung, kommt er mit weißen Haaren zur Welt.«
Er hätte sich übrigens wenig daraus gemacht, wenn einer mit feuerroter Perücke erschienen wäre. Die Angelegenheiten anderer, auch die seiner Kinder, berührten ihn nicht tief; alle lebhaften Interessen, deren er fähig war, konzentrierten sich auf sein eigenes und auf sein zweites Ich, seine Frau.
Die hatte schon ihren dritten Jungen ohne besonderes Entzücken begrüßt. Sie wünschte sich ein Mädchen, ein Kind wenigstens, von dem sie mehr gehabt hätte als nur das Glück, ihm das Dasein zu schenken und es zu betreuen, bis es laufen konnte. Einmal so weit gebracht, waren die Buben ihr auch schon entwachsen und: »Von da an,« meinte sie, »ist die freiwillige Rettungsgesellschaft im stande, mich bei ihnen zu ersetzen.« Ihr Jüngster war eben vier Jahre alt geworden, als das ersehnte Töchterlein erschien, langerwartet und – unerwartet. Ende Februar hätte sie kommen sollen, zu Fabian und Sebastian war sie da. Man hatte noch keine Vorbereitungen zu ihrem Empfang getroffen und mußte die Überbleibsel der Säuglingsgarderobe ihrer Brüder für sie verwenden. Die kleinste Haube, das winzigste Hemdchen wurden hervorgesucht, sie verschwand in ihnen wie auf Nimmerwiedersehen.
Ihrer Mutter traten Tränen in die Augen, als man ihr die Neugeborene brachte.
»Du arme Kleine!« sagte sie.
Das war die Vortaufe des Kindleins: »Die arme Kleine« hieß es fortan, und der schöne Name Angelika, den es drei Tage später durch den Priester in der Schloßkapelle erhielt, blieb ein Paradename, dessen man sich nur bei feierlichen Gelegenheiten bediente.
An die Lebensfähigkeit der überzarten, unreifen Menschenfrucht glaubte anfangs niemand. Nur Apollonia Budik, die Milchschwester und Jugendgespielin Kosels, die schon die drei Löwen oder Bären, wie die jungen Herrchen abwechselnd genannt wurden, aufgezogen hatte, prophezeite: »Sie wird wachsen und gedeihen.«
Die Besorgnisse um das Kind lenkten sich allmählich auch auf seine Mutter. Sie war nach der Geburt eines jeden ihrer Söhne in verjüngter Schönheit wieder aufgeblüht; seit der Geburt der Kleinen kränkelte sie und konnte sich nicht erholen.
»Es wäre Zeit, daß sie endlich gesund würde,« sagte ihr Mann, und der Arzt erwiderte, das denke er schon ein Jahr lang. Er hätte gern noch etwas hinzugesetzt, aber der Herr winkte halb ängstlich, halb ärgerlich ab, und so trat ein Schweigen ein, das die beiden sogleich unterbrachen, um einander mit der Hoffnung auf den herannahenden Frühling zu trösten. Aber auch dieser brachte keine Besserung. Der Sommer kam, warm, mild und wonnig, ein schöner Herbst folgte ihm. Täglich wurde die Kranke in den Garten getragen und lag dort stundenlang auf einem Ruhebett im Schatten würziger Nadelbäume. Neben ihr stand der Korbwagen der Kleinen, und zu ihren Füßen saß Frau Apollonia und strickte. Auf der Wiese jenseit des Weges in gehöriger Entfernung spielten und balgten sich ihre ehemaligen Zöglinge, von einer handfesten Magd überwacht. Sie hatte dafür zu sorgen, daß die Buben die Grenzen ihres Bereichs nicht überschritten und nicht einbrachen in das der Mutter und Schwester. Es mißlang aber oft, die Jungen waren zu neugierig, die arme Kleine zu sehen, zu sehnsüchtig, die Mutter zu umarmen, von der man sie immer ängstlicher ferne hielt. Sie fühlten sich zurückgesetzt, bestraft, und gerade in der letzten Zeit waren sie doch immer brav gewesen und hatten sich nicht, wie sonst, des Ungehorsams gegen die Mama, sondern nur gegen Apollonia und die Magd schuldig gemacht. Der Papa kümmerte sich um sie weniger denn je. Er ging mit zerstreuter Miene umher, rauchte viel, las ein halbes Dutzend Zeitungen und antwortete jedem der Hausleute und jedem seiner Untergebenen, der von ihm eine halbwegs wichtige Entscheidung verlangte: »Das werden wir bestimmen, wenn die gnädige Frau wieder gesund sein wird.« Zehnmal im Tage ging er zu ihr hinüber, setzte sich auf ihr Bett, versicherte, daß sie recht gut aussehe, empfahl sich wieder und vergaß regelmäßig, die Tür zu schließen.
Auf den Wunsch des Doktors berief Kosel einen Professor aus Wien, der allerlei Ratschläge gab. Sie wurden befolgt, aber ohne den geringsten Nutzen.
Herr von Kosel ließ sich trotzdem in seiner Zuversicht, daß es endlich doch besser werden müsse, nicht irre machen und fragte ganz naiv, wenn der Arzt schwere Besorgnisse äußerte: »Ich bitte Sie, was soll ihr denn geschehen?«
Eines Morgens fühlte sich die Kranke nach einer schlechten Nacht besonders schwach, verlangte aber doch, in den Garten getragen zu werden. »Denn,« sagte sie, »ins Zimmer läßt man mir meine lieben, wilden Buben nicht, und ich möchte sie doch wenigstens sehen.«
Als sie dann mit Apollonia und mit der Kleinen auf ihrem gewohnten Platz untergebracht war und die drei Jungen von weitem herüberwinkten und grüßten, begann sie flehentlich zu bitten: »Gute Poli, hol sie mir herüber, meine Rangen! Ich glaube, daß ich heute nicht geschlafen habe aus Sehnsucht, sie wieder einmal in meinen Armen zu halten und nach Herzenslust zu küssen. Und die Kleine lege mir auf den Schoß, ich möchte sie ihnen zeigen.«
Apollonia gab nach, allen empfangenen Verhaltungsmaßregeln zum Trotz. Sie brachte den Buben die Botschaft der Mutter, hielt ihnen aber dabei die geballte Faust entgegen: »Ihr dürft kommen, einen Augenblick. Wer Lärm macht, der kann sich freuen! Vor der Mutter sag ich nichts, aber was dann geschieht, darauf wartet.«
Ein toller Jubel brach aus: »Zur Mutter, zur Mutter und zur armen Kleinen!«
»Ruhig!« wetterte Apollonia, »wer nicht ruhig ist, kehrt gleich wieder um. Ihr geht hinten mir.«
Die Jungen brachten es in der Selbstbeherrschung so weit, eine Weile, nicht gerade hinten Apollonia, aber doch neben ihr einher zu schreiten. Plötzlich guckten sie einander an – ein Augenwink und vorwärts, alle drei zugleich, wie der Sturm, und die gute Frau Budik schrie und drohte und lief ihnen nach, ohne die geringste Hoffnung, sie einzuholen.
Josef war zuerst am Ziele. Fast sprachlos vor Seligkeit umschlang er den Hals seiner Mutter, eifersüchtig drängten sich die jüngeren Brüder heran, und der Kranken verging der Atem unter den leidenschaftlichen Liebkosungen ihrer Kinder. Ihre Arme lösten sich, die Kleine geriet in Gefahr, zu Boden zu gleiten. Franz fing sie auf und rief triumphierend: »Ich hab sie, ich hab sie!« Die Kleine schlug die Augen auf und sah das dicke, rote Gesicht, das sich über ihr winziges beugte, ruhig und wißbegierig an. »Was bist denn du für ein Ungeheuer?« schien sie zu fragen. Keuchend kam Apollonia herbei, nahm das Kind, legte es in den Korb und ermahnte die Buben, den Rückweg anzutreten. Aber sie schenkten ihr kein Gehör, sie umstanden die Mutter, sie küßten ihre Wangen, ihre Hände, und sie lächelte ihnen zu, versuchte zu sprechen, vermochte es nicht, und jedem der Knaben war, als habe sie zuerst ihn und dann das Kindchen im Korbe angesehen mit einem inständig flehenden Blick, der es ihm, besonders ihm, seinem Schutze empfahl. Sie riefen wie aus einem Munde: »Ich tu ihr nichts!« Die Mutter lächelte, ein Schauer durchrieselte ihre Glieder.
»Um Gotteswillen, sie stirbt!« schrie Apollonia auf. Auch die Knaben schauderten vor der plötzlichen Veränderung in den Zügen der Kranken. »Lauf ins Schloß, lauf um den Doktor!« befahl Apollonia der Magd, die ihr gefolgt war.
Vom Schlosse her kamen Leute, allen voran eilte Kosel. In Verzweiflung warf er sich neben der Entseelten nieder, weinte, schluchzte, beschwor sie um ein Lebenszeichen, um ein Wort. Vergeblich. Ihre letzte, stumme Bitte war zu ihren Kindern gesprochen worden, ihr letzter Blick hatte auf ihren Kindern geruht.
Die grausamste Antwort auf seine ständige Frage: »Was soll ihr denn geschehen?« hatte Felix Kosel jetzt erhalten. Er empfand den Tod seiner Frau als das größte Unglück, das ihn treffen konnte, und war doch gar nicht darauf eingerichtet, Unglück zu ertragen.
Das Schicksal war ihm bisher immer mild gewesen, er hatte seine Kindheit und seine Jugend zwischen einer zärtlichen Mutter, zwei begeisterungstrunkenen Tanten und seiner Milchschwester verlebt, dieser klugen, braven Apollonia, die ihn im geheimen allerdings manchmal prügelte, aber dennoch mithalf, ihn herzlich zu vergöttern. Der Vater lachte, schimpfte wohl auch über die Weiberwirtschaft, ließ sie aber weiter florieren. Er war ein Mann von rastloser Tätigkeit, dem wenig Zeit übrig blieb für die Familie. Später, wenn sein Sohn die Kinderschuhe ausgetreten haben würde, sollte alles anders werden, dann gedachte er ihn in die Hand zu nehmen. Felix hatte aber sein zehntes Jahr noch nicht ganz erreicht, als Herr von Kosel bei einer Eisenbahnkatastrophe ums Leben kam. Die Feldwirtschaft seines Gutes Velice wurde einstweilen verpachtet, die Familie zog nach der Provinzhauptstadt, wo Felix erst eine Vorbereitungsschule und dann, ein paar Jahre später als gewöhnliche Menschenkinder, das Gymnasium besuchte. Er machte es durch, ohne Glanz und ohne besondere Schmach, wiederholte nur die dritte und die achte Klasse, beging nicht einen dummen Streich, schloß auch keine Freundschaft. Die Mutter, die Tanten unterließen es nie, ihn vor den »Buben in der Schule« zu warnen wie vor Klapperschlangen in Jacken und Hosen.
Nachdem er das Gymnasium absolviert hatte, trat er sein Freiwilligenjahr an. Eine schwere Zeit im Leben seiner Götzendienerinnen! Zum Regimente konnten sie ihm nicht folgen. Aber einen alten Diener – er hieß Kopetzky und war des Schreibens mächtig – gab Frau von Kosel ihm mit, einen ehrlichen Spion, der täglich über das Befinden des jungen Herrn, über sein Tun und Lassen nach Velice berichten mußte. Dort saßen die Damen nun wieder alle beisammen und warteten auf die Rückkehr des Lieblings.
Er kam heim. »Ganz unverändert!« triumphierte seine Mutter. »Ganz der Alte, Gott sei Lob und Dank!« sagte ihre jüngere Schwester, die fromme Renate.
Nur Charlotte, die jüngste, der Feuergeist in der Familie, die Menschenkennerin, behauptete, einen Reflex von militärischem Wesen an ihm wahrzunehmen, und wer weiß? – vielleicht hatte er Erfahrungen gemacht.
Nun, davon hatte Kopetzky nichts geschrieben, und die Worte ihrer Schwester machten keinen Eindruck auf Frau von Kosel. Es gab etwas anderes, das sie peinigte, ihr den Schlaf raubte und den Appetit. Felix schenkte in neuester Zeit seiner Milchschwester eine auffallende Aufmerksamkeit, hatte Rücksichten für sie, die ihr vermöge ihrer Stellung als »Stütze der Hausfrau« gar nicht zukamen, war in ihrer Gegenwart heiter und aufgeräumt – ja gesprächig. Sobald sie das Zimmer verlassen hatte, war seine gute Laune dahin. Frau von Kosel machte nun ganz plötzlich die Entdeckung, daß Apollonia zu einem bildschönen Mädchen aufgeblüht war, mit dem unter einem Dache zu leben eine große Gefahr für die Gemütsruhe eines jungen Mannes bedeuten konnte. Sie faßte einen raschen Entschluß. Eines Abends kam Felix von einem dreitägigen Jagdausflug zurück und fand Apollonia nicht mehr im Hause. Sie hatte sich entschlossen, den Bitten einer alten Tante nachzugeben, die schon oft nach ihr verlangt hatte. »Wie du weißt,« sagte Frau von Kosel.
Er wußte es nicht, er wurde feuerrot und runzelte die Stirn. Das hätte er seiner Jugendgespielin nicht zugetraut, daß sie im stande wäre, ihn zu verlassen ohne ein Abschiedswort. Eine große Bitterkeit gegen sie ergriff ihn, nach und nach fielen ihm aber eine Menge Entschuldigungen ihrer Handlungsweise und ebensoviele Anklagen gegen seine Mutter ein. Er sprach nicht eine aus, er würgte seinen Groll hinunter. Er wurde nur noch stiller und mehr in sich gekehrt, als man in Velice erfuhr, der armen Apollonia sei es bei ihrer Tante so schlecht gegangen, daß sie sich aus Verzweiflung entschlossen habe, den Heiratsantrag eines alten Steuerbeamten, eines Witwers mit fünf Kindern, anzunehmen.
Frau von Kosel erwartete, daß ihr Sohn mit ihr darüber sprechen, ihr vielleicht Vorwürfe machen würde. Er blieb stumm, und das beunruhigte sie mehr, als der ärgste Zornesausbruch getan hätte.
Die kühle, trockene Frau, der niemand imponierte, die sich nie um die Meinung anderer gekümmert, sich in ihrem Urteil nie hatte beeinflussen lassen, kam dem schönen schweigsamen Sohn gegenüber um alle Sicherheit. Sie hatten ihr ihn doch sehr entfremdet in dem einen Jahre. Er sprach nicht, aber er handelte ihr jetzt oft entgegen und beharrte auf seinen Beschlüssen mit dem Eigensinn des Schwachen.
Stille Jahre verflossen.
Einige Monate brachte Kosel regelmäßig auf Reisen oder in Wien zu, den Rest der Zeit in Velice. Er ließ das Gut durch seine Beamten bewirtschaften, ging auf die Jagd, las Zeitungen und fand sich des Abends am Spieltisch seiner Mutter und seiner Tanten ein. Die Damen würden das Whist erfunden haben, wenn es nicht ein anderer vor ihnen getan hatte, vermochten aber trotz aller Mühe nicht, Felix in die Feinheiten dieses edlen Spieles einzuweihen.
»Er hat keinen Spielgeist,« meinten seine Mutter und Renate. Charlotte allein wußte: er hat auch keinen andern. Diese Erkenntnis schädigte ihre Liebe für ihn aber nicht im geringsten.
Jedesmal, bevor er verreiste, ermahnten ihn die Tanten: »Komm als Bräutigam zurück!« Sie wußten, es war der innigste Wunsch seiner Mutter. Er überlegte lange, bevor er ihn erfüllte, und als es endlich geschah und er heimkehrte und ihr die große Nachricht brachte, bebte seine Stimme:
»Bevor der Fasching zu Ende geht, bin ich verheiratet, liebe Mama. Mit Fräulein Friederike Beckmann. Die Tochter des Arztes. Ja, Mama, du kennst ihn. Im ganzen Land kennt man ihn und achtet ihn.«
Frau von Kosel lehnte sich zurück in ihre Sofaecke, zum erstenmal in ihrem Leben wandelte es sie an, als ob die Sinne ihr vergehen wollten. »Eine Doktorstochter? . . . Das kann ja nicht sein. Das kann dein Ernst nicht sein.« Angstvoll starrte sie ihn an. Er hielt ihren Blick nicht aus. Der seine flackerte scheu umher, aber die zuckenden Lippen sprachen mit wohlbewußter Grausamkeit:
»Es ist. Und die kannst du nicht verschwinden lassen.«
Das traf sie ins Innerste. So hatte er ihr nicht verziehen, so trug er ihr durch all die Jahre nach, daß sie ihm die Gelegenheit zu einer törichten Liebelei aus dem Wege geräumt hatte? Und hatte geschwiegen die ganze lange Zeit, und hatte seinen Groll in sich verschlossen, und der Groll hatte die Liebe und das Vertrauen ausgezehrt! Sie empfand das als ein furchtbares Unrecht, das er ihr antat, und wie kindischen Trotz, daß er sein Herz wieder an eine Unebenbürtige hing, eine Unebenbürtige zur Frau wählte. Aber sie hatte sich daran gewöhnt, ihm nachzugeben, und seinen Eigensinn so lange genährt, bis er sich beinahe zu einer Willenskraft herangebildet hatte. Die starke Frau war ohnmächtig geworden, dem schwachen Sohn gegenüber. Sie beugte ihr Haupt, sie fügte sich, sie sprach: »Bring sie mir.«
Eine unbezwingliche Rührung ergriff sie: »Bring mir aber auch meinen Sohn, den ich verloren habe, wieder.«
Er stand auf, küßte ihr die Hand und sagte in seiner abgebrochenen Weise und eher befangen als bewegt: »Ich danke dir . . . ich werde ihr gleich schreiben . . . ihr gleich die gute Nachricht geben.«
Er ging aber nicht geraden Weges nach seinen Zimmern, sondern über den Bogengang zum Turm an der Ecke des Schlosses, in dem die Tanten sich sehr traulich und mit vielem Geschmack eingerichtet hatten. Den Sibyllenturm nannte ihn Frau von Kosel.
Ein Freudenschrei aus zwei Kehlen empfing Felix, als er in den Salon der Tanten trat. Renate strickte eben Jagdstrümpfe für ihn, Charlotte kopierte seine letzte Photographie wunderhübsch in Ölminiatur.
Der bequemste Fauteuil wurde an den Tisch gerückt für den Herzensliebling, der nach einigen einleitenden: »Wie geht's? Ah schön!« nicht ohne Stocken seine große Neuigkeit vorbrachte.
Die Tanten hatten ihm mit unbeschreiblicher Spannung zugehört und nicht gleich gewußt, ob er im Ernst oder im Spaß spräche.
»Eine Doktorstochter?« rief Renate mit den Worten ihrer Schwester. »Ach geh!«
Er aber versetzte: »Wartet nur, gute Tanten, wartet, ihr werdet schon sehen!« Und als er ihnen so herzlich, als er's überhaupt zuwege brachte, seine Braut empfahl, kamen Renaten Tränen der Rührung in die Augen. Charlotte liebte seine Erwählte jetzt schon und versprach, sie gegen die ganze Welt in Schutz zu nehmen.
Als die zukünftige Herrin von Velice drei Tage später dort erschien, in Begleitung ihrer Eltern, am Arme ihres Verlobten, der die Reisenden an der Eisenbahnstation abgeholt hatte, war der erste Eindruck auf alle Damen der einer grenzenlosen Überraschung. Die Doktorstochter, das wurde ihnen klar auf den ersten Blick, bedurfte ihres Schutzes nicht.
Die drei, die ihr mit so verschiedenen Gefühlen entgegengegangen waren, standen vor einer wahrhaft sieghaften Überlegenheit. Sogar Frau von Kosel gestand sich, daß von Herablassung, der Braut ihres Felix gegenüber, nicht die Rede sein könne. Sie war schön, gewinnend, wohlerzogen und bewegte sich in ihrer Wohlerzogenheit nicht wie im Staatsgewande, sondern wie im Alltagskleide.
Die Ehe Felix Kosels wurde sehr glücklich. Es dauerte lange, bis Friederike zur Erkenntnis kam, daß sich hinter der männlichen und adligen Erscheinung ihres Mannes ein zaghaftes und dürftiges Wesen verbarg, und da sie sich keiner Täuschung mehr über ihn hingeben konnte, war ihre starke und treue Zuneigung schon zu tief eingewurzelt, um erschüttert zu werden, nur einen anderen Charakter nahm sie an. Aus einer Liebe voll Bewunderung und Erwartung wurde eine nachsichtige und fürsorgliche und auch eine dankbare Liebe. Er hatte nicht viel zu geben; aber alles, was er hatte, gab er ihr. Für andere blieb allerdings nichts übrig.
Er fühlte kaum eine Lücke in seinem Leben, als seine Mutter nach kurzer Krankheit starb und die Tanten Velice verließen.
Sie waren nach dem Tode ihrer Schwester mit bleichen Gesichtern und rotgeweinten Augen vor ihren Neffen und vor ihre Nichte getreten, und Charlotte hatte gesprochen:
»Ihr wendet gewiß viele Kinderchen bekommen und viel Platz für sie brauchen und Gesellschaft genug haben an euch selbst und an ihnen. Wir wollen fort, meine Teuren, wünschen uns schon lange, die Welt zu sehen; wir sagen euch Lebewohl.«
Herr von Kosel war erstaunt und auch ein wenig betrübt, Frau von Kosel schloß eine der Schwestern nach der andern ans Herz.
»Geht, wenn die Wanderlust euch treibt. Eure Wohnstätte in der Heimat werdet ihr deshalb nicht verlieren. So lang ihr die Augen offen habt, seid ihr Herrinnen im Sibyllenturm, und wer ihn betritt, ist euer Gast.«
Dabei blieb's. Die zwei Schwestern erlangten nach und nach in der Kunst zu reisen eine solche Virtuosität, daß sie mehr als einmal für Engländerinnen gehalten wurden.
Jedesmal, wenn wieder eine Taufe in Aussicht stand, kamen sie nach Velice zurück und fanden ihr Zuhause immer aufs liebevollste gepflegt und aufs schönste zu ihrem Empfange geschmückt. Eine freudige Überraschung war es für sie, nach der Geburt Josefs, Frau Apollonia Budik als oberste Leiterin im Kinderzimmer angestellt zu finden. Ihr Mann war in den letzten Jahren völlig schwachsinnig geworden, und ihre Stieftöchter hatten sie vor die Tür gesetzt. Sie blieb ihnen zeitlebens dankbar dafür; sie hatte nur heimzukehren, nur einige Wochen im Schlosse zuzubringen gebraucht, um das Vertrauen Frau von Kosels zu erringen und von ihr in das verantwortliche Amt eingesetzt zu werden, das sie vortrefflich verwaltete.
Auch bei der Taufe der armen Kleinen waren die zwei Tanten zugegen gewesen und hatten dann für noch längere Zeit als gewöhnlich Abschied genommen. Der Ehrgeiz, auch fremde Erdteile kennen zu lernen, war in ihnen erwacht. Eine Pilgerfahrt nach Jerusalem bildete den Schluß ihrer größten Reise. Und dort lagen sie vor dem Heiligen Grabe auf ihren Knieen, im heißen Gebete für die Ihren, zur selben Stunde, zu der im Garten von Velice das Leben erlosch, auf das sie alle Segnungen des Himmels herunter flehten.
Wenige Wochen später hielt eines Vormittags ein geschlossener Mietswagen vor dem Portal des Schlosses. Der Kutscher knallte mit der Peitsche, um Leute herbeizurufen, es kam aber niemand. Er mußte vom Bocke steigen und den Schlag öffnen. Zwei alte Damen verließen das Gefährt und glitten leise und schweigend wie Schatten durch die Halle über den Gang mit den vergitterten Fenstern und den großen, feuchten Flecken an den Mauern. Vor der Treppe hielten die beiden einen Augenblick an. Sie bebten vor unterdrückter Gemütsbewegung und atmeten schwer. Langsam ging's die Stufen hinauf, an der Tür vorbei, die zu den Gemächern der verstorbenen Herrin führte, weiter bis zur Wohnung Kosels. Noch immer ließ niemand sich blicken. Im Vorzimmer begegneten die Schwestern der ersten menschlichen Seele. Ihre irdische Hülle hatte den Umfang eines mäßigen Bierfasses, trug ein braunes Jackett, eine weiß und rot gestreifte Weste und chamoisfarbige Filzpantoffeln. In einen großen Lehnsessel zurückgelehnt, schlief sie, schon bei hellem Tage, den süßen Domestikenschlaf.
Charlotte streifte die kolossale Gestalt mit einem mißbilligenden Blick und sagte: »Natürlich,« und als sie in das nächste Zimmer kam, das kläglich unaufgeräumt war und in dem alles nach Besen und Staubtuch schrie, sagte sie abermals: »Natürlich!«
Renate aber seufzte schmerzlich: »Armer Mensch, wie es bei ihm aussieht!«
Nun rührte sich's im großen, anstoßenden Wohngemach, zu dem die Flügeltür offen stand; ein Sessel wurde gerückt, Felix erschien auf der Schwelle.
»O, o, die Tanten!« sprach er halblaut und verneigte sich höflich und fremd. Sein schönes Gesicht war dunkelrot, er befand sich in der peinlichen Verlegenheit, die ihn beim Wiedersehen nach längerer Trennung, auch von seinen nächsten Verwandten, ergriff.
Die Schwestern ließen ihre Rührung nicht aufkommen, stellten einige gleichgültige Fragen und verlangten dann, die Kinder zu sehen.
»Die Kinder?« In dem Augenblick schien er sich zu besinnen, daß er welche hatte. »Die Kinder, ja. Die Buben – wo die nur sein mögen? Im Garten oder im Meierhof vielleicht. Kopetzky weiß es vielleicht und ist vielleicht so gut und holt sie.«
Kopetzky war sehr überrascht, als er hereingerufen und als ihm mitgeteilt wurde, welche Erwartung man auf ihn setzte. Er versprach gar nichts, und als die Damen, von Kosel begleitet, sich auf den Weg machten, um die Kleine zu besuchen, blickte der treue Diener ihnen voll stiller Empörung nach und murmelte: »Jetzt geht die Weiberwirtschaft und 's Putzen wieder an.«
Um zu der Kleinen zu kommen, mußte man eine lange Zimmerreihe durchschreiten. Den Saal, der fünf hohe Bogenfenster hatte und vortrefflich gemalte Säulenstellungen, grau in grau, und dazwischen allerlei mythologische, etwas gespensterhaft dreinschauende Figuren. Das Musikzimmer, den großen Salon und dann den kleinen, in dessen einem Fenster der Schreibtisch Friederikes stand. Kein zierliches Möbelstück, ein Schreibtisch, an dem ernst gearbeitet worden war, auf dem noch die großen Wirtschaftsbücher lagen, die sie gewissenhaft und genau geführt hatte und die gewiß seit ihrem Tode nicht aufgeschlagen worden waren. Im Schlafzimmer nebenan alles noch wie einst. Das Doppelbett unter dem seidenen Baldachin, die Toilette ihm gegenüber, der Ankleidespiegel in der Ecke. Dieses Zimmer war besser gehalten als die übrigen, man sah auch, daß es in Benützung stand.
»Du schläfst noch hier?« fragte Charlotte.
»Immer noch,« erwiderte er und errötete neuerdings.
»Und die Kleine wohnt nebenan, wie früher?«
»Wie früher.«
»Stört sie dich nicht?«
»Die hört man gar nicht, die ist sehr still, wird bald ganz still sein,« versetzte er und machte dazu seine gewöhnliche Miene sorgenvoller Heiterkeit, wegen der seine Frau ihn oft geneckt hatte.
»Armer Mensch, armer Mensch!« flüsterte Renate, erschrak über die unwillkürliche Äußerung ihrer Teilnahme und schritt rasch auf die Tür des Kinderzimmers zu. Sie öffnete sich, ein Schrei des Jubels erscholl. Apollonia rannte den alten Damen entgegen, küßte ihre Hände, konnte sich vor Freude nicht fassen.
»Daß Sie nur endlich da sind! Mit welcher Sehnsucht hab ich Sie erwartet! Endlich, endlich! Wie oft hab ich gedacht: Wenn Sie sie nur noch am Leben treffen!« – Sie deutete auf Elika, »die Kleine, Gott im Himmel . . .« rief sie und brach in lautes Schluchzen aus.
»Ja, Poli, ja,« sagte Kosel, »aber geben Sie acht, sehen Sie die arme Kleine.«
Die arme, ja wirklich, die arme Kleine.
Sie saß, schneeweiß gekleidet, auf einem Teppich in der Mitte ihrer wohlausgepolsterten Gehschule. In ihrem durchsichtig bleichen Kindergesichtchen sprach sich Schrecken und Empörung über den lärmenden Freudenausbruch ihrer Wärterin aus. Ihre großen, blaßblauen Augen betrachteten die schreiende Apollonia strafend und vorwurfsvoll, aber sie regte sich nicht, und es kam kein Laut über ihre schmalen, bleichen Lippen. Sie war so schwach und so winzig! Die Kopfhaut schimmerte durch die spärlichen, hellblonden, an den Enden leicht gelockten Haare, der Mund, die feine Nase, die hohe Stirn waren merkwürdig ausgebildet, was bei dem kümmerlichen kleinen Wesen den Eindruck der Zwerghaftigkeit machte. Noch seltsamer, unheimlich fast, war die nachdenkliche, frühreife Klugheit, die aus den Zügen des zarten Antlitzes leuchtete, und das resignierte Leiden, das über ihnen lag wie ein trübender und – verklärender Hauch.
Bei den alten Damen löste sich jede Empfindung, die das Kind ihnen einflößte, in grenzenloses Mitleid auf. Sie knieten nieder und sprachen zu der Kleinen liebreich und zärtlich. Elika hatte den Kopf gesenkt, warf von unten herauf einen scheuen Blick nach ihnen und bedeckte plötzlich die Augen mit den Händen, deren gelbliche dünne Fingerchen an die Klauen eines jungen Vogels mahnten.
»Nicht anschauen die arme Kleine,« sagte sie, »nicht anschauen!«
Die Schwestern gingen in den Sibyllenturm. Ihre Reiseeffekten waren inzwischen hinaufgeschafft worden; der Schloßwärter und seine Frau schossen herum und bejammerten, daß die Damen ihre Ankunft nicht angekündigt hatten, sie würden zu ihrem Empfang alles bereit gefunden haben.
Während die Leute die Zimmer im zweiten Stocke bewohnbar machten. warteten Renate und Charlotte im ersten, in dem schönsten Gelaß des Turmes. Ein hoher, ovaler, edel gewölbter Raum, der seinen schlanken Pilastern und den zierlichen Stukkaturen an den Wänden und an der Decke ein festliches Aussehen verdankte. Jetzt freilich sah es darin nicht sehr einladend aus. Die köstlichen Empiremöbel in der Mitte zu einem Berg aufgeschichtet, die Friese und Säulenkapitäle von Guirlanden aus Spinnenweben umrankt. Und die Luft, halb Rumpelkammer- und halb Kellerluft, war dumpf und muffig, und es roch nach Mäusen.
Charlotte langte einen Sessel vom Möbelberg herunter, staubte ihn, so gut es ging, mit dem Taschentuche ab und stellte ihn für die Schwester hin.
»Ich wollte nichts sagen,« sprach Renate, sich setzend, »um niemand Unannehmlichkeiten zu machen, aber das Erstaunen über unser Kommen ist kurios.« Sie gebrauchte da, was sie ungern tat, einen ihrer stärksten Ausdrücke: »Es kam mir schon ganz eigen vor, daß wir keinen Wagen aus Velice auf der Station fanden. Wir haben uns doch bei Felix angesagt, du und ich.«
»Er wird unsere Briefe nicht gelesen haben,« erwiderte Charlotte. »Ich habe auf seinem Schreibtisch einen Haufen uneröffneter Briefe liegen gesehen. Die unsern werden dabei sein.«
Renate schüttelte den Kopf: »Das kann ich nicht glauben. Für so gleichgültig und herzlos kann ich ihn nicht halten, den Armen.«
»Arm, ja, das ist er! und überhaupt – eine Armut herrscht in dem Hause, seit sie fort ist, die den andern so viel gegeben hat, daß man sie alle für reich halten konnte . . . Sie fort! . . . der Kopf, das Herz, die Seele tot. Warum? warum hat dieses schöne Lebenslicht erlöschen müssen? – Damit ein trübes Flämmchen entfacht werde, das keinem zur Freude und sich selbst zum Leid kurze Zeit hindurch ein armseliges Flackerdasein führen könne auf der Welt . . . Wer auch da eine weise und gütige Vorsehung anzubeten vermag . . .«
»Charlotte!« fiel die Schwester ihr ins Wort. »Ein Menschenauge und Gottes unerforschliche Wege . . . wie du nur . . .«
Sie wurde unterbrochen. Auf der Treppe war's plötzlich laut geworden. Es polterte, es dröhnte, es kam im Sturmgalopp heraufgesprengt in nägelbeschlagenen Schuhen. Die Tür öffnete sich, drei rosige, pausbäckige Kindergesichter guckten herein. Die Buben stürzten mit ausgebreiteten Armen auf die Tanten zu und riefen durcheinander:
»Grüß euch Gott, grüß euch Gott, alte Tanten. Wir haben uns schon so gefreut!«
»Ihr kommt aber spät,« sagte Josef und hatte auf einmal die Miene eines Richters angenommen.
»Sehr spät,« wiederholte Leopold voll einschmeichelnder Liebenswürdigkeit, und der kleine Franz stotterte mit schwerer Zunge:
»Ja, sej spät!«
Ein neuer Anprall von Zärtlichkeiten stürmt los, die Fräulein haben Mühe, ihm standzuhalten. Noch größere Mühe haben sie, nicht auszubrechen in helle Wonnetränen. Ein Vermächtnis der Verstorbenen, diese in den Herzen der Kinder wach erhaltene Liebe zu den alten Verwandten. Den Schwestern ist, als sei der warme, leuchtende Frühling eingezogen in die trübselige Stube.
Und wie der wirkliche Frühling meistens pflegt, war auch dieser sinnbildliche auf feuchten Sohlen gekommen. Die drei Jünglinge hatten an den ihren pfundschwere Stücke des fruchtbaren Lehmbodens von Velice hereingetragen, und sie selbst waren von unten bis oben mit Lehmspritzern bedeckt.
»Woher kommt ihr?« fragte Renate, und ihre Stimme bebte vor Rührung. »Ihr seid voll Lehm, geliebte Kinder.«
Woher sie kamen? Nun, aus dem Meierhof. Im Meierhof wird der Brunnen repariert, da haben sie mitgeholfen.
»Das heißt,« sagt Josef, »Leopold und ich haben mitgeholfen. Der Kleine hat sich nur wichtig machen wollen. Immer will er sich wichtig machen. Bei einem Haar,« und um die Feinheit dieses Haares recht zu bezeichnen, sprach er im höchsten Falsett, »bei einem Haar wär er ins Wasser geplumpst. Aber der Brunnenmeister hat ihn noch erwischt.«
»Überall plumpst er hinein,« versicherte Leopold. »Vorgestern in den Teich, weil er eine Katz, oder wer weiß was, hat herausziehen wollen.«
Josef lachte: »Und dann hat er sich an einen Baum angehängt und hat sich geschaukelt zum Trocknen.«
Der Kleine hatte den Spott seiner Brüder mit scheinbar philosophischer Ruhe hingenommen. Im Wortstreit zog er immer den kürzeren und pflegte auch meist nur handgreifliche Argumente vorzubringen. Während Josef und Leopold sprachen, hatte er sie abwechselnd angesehen, als ob er mit sich zu Rate ginge. Plötzlich schoß ein heißer Blick aus seinen dunklen, tiefliegenden Augen, er war entschieden, sprang den Ältesten, Stärksten an und schlug ihm mit der kleinen, breiten Faust, so derb er konnte, ins Gesicht.
Die Tanten erschraken, Josef zuckte die Achseln. Er hatte den Knirps ausgelacht, der Knirps hatte sich gerächt, jetzt war alles in Ordnung.
Bald darauf herrschte Frieden, und die Kinder richteten alles zu einem behaglichen Plauderstündchen ein. Die Glastür des schmalen, runden Balkons wurde geöffnet und Fauteuils für die Tanten zu ihr hingerückt. Sie müssen doch sehen, wie die Bäume des Gartens ihnen »Grüß Gott« zunicken, und die Aussicht müssen sie genießen, auf den Hostein, auf dem vielleicht schon in einigen Jahren eine große Kirche erbaut werden wird. Der Herr Pfarrer glaubt es, und der Herr Kaplan weiß es bestimmt.
Vom Dorfe her ertönte fein und hell das Geläute der Aveglocke. Die Drei erhoben sich zugleich und verrichteten ihr Gebet, nicht gerade in Andacht hinschmelzend, aber in guter Haltung und mit großem Ernste.
Nachdem die religiöse Pflicht erfüllt war, machte Franz einen Freudensprung; Leopold rief:
»Ach, was wir froh sind, daß ihr wieder da seid, liebe Tanten!« und Josef versicherte:
»Wir haben, seit die gute Mama tot ist, niemand und niemand.«
Wieso? Sie hatten den Papa. – Ach, von dem Besitz schienen sie nicht viel zu halten! Und mit Elika wird's nächstens aus sein, und der Herr Kaplan und der Lehrer, keins kann eine Geschichte erzählen und ein Märchen schon gar nicht, wie Tante Charlotte fünfzigtausend weiß. Die Poli höchstens so ein paar alte Geistergeschichten . . .
»Pah!« Leopold machte eine wegwerfende Handbewegung – »bei denen einem nicht einmal gruselt.«
Franz hatte die Arme gekreuzt und machte sein trotzigstes Gesicht. Ein Bild der Kraft, das derbe Bürschlein, und komisch der Kontrast zwischen seiner keimenden Männlichkeit und seiner lallenden Sprache: »Gjuselt einen nicht einmal!«
»Aber Kinder,« meinte Charlotte, »wenn ihr Geschichten und Märchen gern habt, nehmt doch ein Buch und lest!«
Die Buben hoben die Köpfe. Ein Lächeln blitzte über drei Gesichter, ein dreifaches: »Ach nein!« wurde mehr gegähnt als gesprochen, und Franz erklärte aus seiner eigenen und der Seele seiner Brüder heraus:
»Tante, lesen, das intejessit uns absolut nicht!«
So? und was interessierte sie denn? –
Was? – Alles! Sie wurden ungeheuer mitteilsam und schwatzten sich satt. Sie erzählten vom Tod der guten Mama, und wie schön sie im Sarge war. Ihren Ring hat sie am Finger gehabt, und wie man ihr ihn hat wegnehmen wollen, hat der Papa geschrieen, so laut wie er nie schreit: »Lassen, lassen!« So ist die gute Mama mit ihrem Ring begraben worden. Und die Leute haben gesagt: »Die Kleine sollte man ihr auch mitgeben, die ist so schwach, die wüßte von nichts, möchte am Herzen der Mutter einschlafen und im Himmel aufwachen. Aber das ging doch nicht, und man muß warten, bis sie von selbst stirbt, und so lange sie noch lebt, muß man halt alles tun, was sie will. Und wenn man's einmal nicht tut, o, da wird die Poli gleich grob! Und neulich hat die Kleine fahren wollen, und Josef hat sie gezogen – im Garten, im Korbwagen, und nie war's der Kleinen schnell genug. So ist Josef gerannt, immer schneller, immer schneller, bis er umgeworfen hat.«
»Den Wagen?« rief Renate, »und die Kleine war drin im Wagen?«
»Nein,« erwiderte Josef sehr gelassen, »wie ich umgeworfen hab, war sie nicht mehr drin.«
»Sie ist herausgestürzt und hat sich weh getan und hat geweint?«
»Weh getan, ja, sie hat ein ganz kleines, rosenfarbiges Blutstropferl gehabt, da auf der Wange . . . Aber geweint? o, die! gelacht, mich ausgelacht . . . O, die! wie die einen auslachen kann, wie die lustig sein kann!«
Franz hatte so angestrengt nachgedacht, daß es ihm augenscheinlich weh tat. Jetzt stieß er einen tiefen Seufzer aus und sagte:
»Sie weiß, daß sie bald stejben muß, da will sie geschwind noch ein bissel lustig sein.«
Einige Tage später sagte Charlotte zu ihrem Neffen: »Lieber Felix, deine Buben sind famose Buben. Sie kennen alle Vögel, Bäume, Pflanzen, jeder von ihnen ist eine kleine wandelnde Naturgeschichte. Sie können ackern, mauern, tischlern, sägen, striegeln, satteln, aber lesen und schreiben können sie nicht.«
Nicht lesen und schreiben? Wie meinte das die Tante? Wie sollten sie nicht lesen und schreiben können, da ihnen der Schullehrer schon seit mehreren Jahren Unterricht gibt? Und so oft Herr von Kosel den Mann zufällig begegnet und ihn fragt: »Sind die Buben brav?« erhält er zur Antwort: »Sehr brav.«
Charlotte beschloß, einmal an einer Lehrstunde teilzunehmen, und führte am nächsten Tage ihren Vorsatz aus.
Schloß Velice bildete ein regelmäßiges, einstöckiges Viereck; in der Ecke, dem Sibyllenturm schräg gegenüber, befand sich das riesige sogenannte »Bubenzimmer«. Es hatte einen tiefen Alkoven, in dem, durch Waschtische getrennt, die Betten der drei standen, und glich am Morgen, nach der beendigten Toilette seiner Bewohner, mehr einem See als dem Aufenthaltsort auf dem Festland lebender Wesen. Der vordere Wohnraum bot den Anblick chaotischer Zustände. Auf den ersten Blick entwirren, was da alles durcheinander lag und hing und hervorquoll aus den offen stehenden Schränken und Laden, war unmöglich. Werkzeuge und Spielsachen hielten Rast in verschiedenen Winkeln auf dem Fußboden, oder nahmen Platz auf den wenigen Möbeln, die noch heile Beine hatten, neben Mineralien, getrockneten Pflanzen, aufgespießten Käfern und Schmetterlingen. An dem breiten Pfeiler zwischen den Fenstern, links vom Alkoven, lehnte ein Kanapee und diente in diesem Augenblick dem Schullehrer als Lagerstätte. Er war ein mittelgroßer, derb gebauter Mann, mit kurzem Hals und wuchtigem Kopf, von dem die Ohren wie ein paar Fledermausflügel abstanden. In seinem flachen Gesichte fehlte nicht eine Schattierung vom lichten bis zum gebrannten Ocker; er sah verbittert und böse und sehr gescheit aus. Seinen Anzug bildeten weite, dunkle Beinkleider, eine abgetragene Czamara und ein rotgestreiftes Flanellhemd mit tintenbeklecksten Manschetten. Er las laut aus einer böhmischen Grammatik vor, indes seine Zöglinge munter Federball spielten. Sie zählten eben hundert, als Charlotte eintrat, und begrüßten sie voll Freude und riefen ihr zu:
»Spiel mit, Tante! spiel mit!«
Sie dankte, sie war nicht gekommen, um sich zu unterhalten, sondern um der Unterrichtsstunde zu assistieren.
Die arme Tante, der Unterrichtsstunde? O je, da kam sie zu spät, die Unterrichtsstunde war gleich vorbei.
»Wir sind fertig,« sagte der Lehrer, der aufgestanden war, und klappte sein Buch zu.
»War das jetzt eine Unterrichtsstunde?«
»Zu dienen, Gnädige.«
Die Buben warfen ihre Raketten hin und stürmten in den Garten. Gern wäre der Lehrer nun entschlüpft, doch bequemte er sich, zu bleiben, weil ihn das Fräulein so sehr höflich darum bat. Um aber seine Ungeduld und das Opfer, das er brachte, zu markieren, warf er fortwährend sehnsüchtige Blicke nach der Tür.