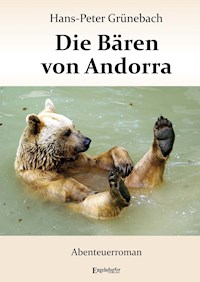
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Georgia gerät leichtfertig in eine Bärenfalle. Sie wird verschleppt. In den Pyrenäen begegnet sie dem Problembären Bruno und erlebt manch Abenteuer. Als Georgia später mit ihren Zwillingen Basti und Lorena in einer Sennerhütte Chaos hinterlässt, wird sie verfolgt und nach einem Eklat im Wanderzirkus „Hokuspokus“ gefangen. Zwei Kinder aus Deutschland öffnen beim Camping an der Costa Brava eine Flaschenpost mit einer geheimnisvollen Nachricht. Die führt sie in den Zwergstaat Andorra zu Ramon und zur Bärin Lorena. Deren Drillinge sind plötzlich wichtiger als Homeschooling. Die Kinder sind Feuer und Flamme und wollen nicht nach Deutschland zurück. Ein spannender Jugendroman, der Kinder und Erwachsene zum Lesen, Vorlesen und Nachdenken anregt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Peter Grünebach
DIE BÄREN VON ANDORRA
Abenteuerroman
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2022
Eine abenteuerliche Bärengeschichte
In den Julischen Alpen lebt Bärenmutter Adelina mit zwei Bärenjungen. Die honighungrige Georgia gerät leichtfertig in eine Bärenfalle. Sie wird Teil eines Bärenschutzprogrammes in den Pyrenäen. Dort begegnet sie dem ehemaligen Problembären Bruno, der ihr über seine Abenteuer berichtet. Mit ihren Zwillingen, dem Imitationskünstler und Akrobaten Basti und der brudergenervten Lorena begegnet Bärenmutter Georgia einem gut informierten Mufflon, dem Besitzer von Fischteichen, Fischotter „Fingfang“ und dem verantwortungsvollen Biberburgherren „Plattschwanz Riesenzahn“. Als die drei Bären in der Vorratshütte des Senners Sebastiano bei einer Honig-Einwegobst-Branntwein-Orgie Chaos hinterlassen, werden sie verfolgt. Im Wanderzirkus „Hokuspokus“ nimmt das Schicksal seinen Lauf. Wenige Jahre später öffnen zwei Kinder aus Deutschland beim Camping an der Costa Brava eine Flaschenpost mit einer geheimnisvollen Nachricht. Die führt sie in den Zwergstaat Andorra, zu Ruben und zur Bärin Lorena, die im Naturpark Drillinge zur Welt bringt. Die Kinder sind Feuer und Flamme.
Bibliografische Information durch die Deutsche
Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2022) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Bärenfotos im Inhalt von Hans-Peter Grünebach
Titelbild © Krawuzikabuzi [Adobe Stock]
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Alle Geschöpfe der Erde fühlen wie wir, alle Geschöpfe streben nach Glück wie wir. Alle Geschöpfe der Erde lieben, leiden und sterben wie wir, also sind sie uns gleich gestellte Werke des allmächtigen Schöpfers – unsere Brüder.
Es werden mehrere Jahrtausende von Liebe nötig sein, um den Tieren ihr durch uns zugefügtes Leid heimzuzahlen!
zugeschrieben
Franz von Assisi (1182 – 1226)
Geboren als Giovanni Bernadone, katholischer Heiliger, Stifter des Franziskanerordens.
Inhalt
1. Teil: Die Entführung der slowenischen Bärin Georgia und ihre Abenteuer in den Pyrenäen
Georgia in der Falle
Die Pyrenäen
Die slowenischen Bärenjäger
Die Fahrt und ein unbekannter Ort in Frankreich
Auf der Suche
Auf zu neuen Abenteuern
Die Orgie und ihre Folgen
Gejagt
Basti und der Zirkus „Hokuspokus“
Georgia erneut in Gefangenschaft
Die erste Nacht allein
Getrennte Wege
Teil II: Kyon und Feli, eine Flaschenpost und die Bären von Andorra
Das Geheimnis der Flaschenpost
Auf nach Andorra
Im Naturlandia-Zoo
Bärenkinder
Mit dem Fernsehteam bei den Bären
Über den Autor
Nachwort
Georgia mit Basti und Lorena
Die Entführung der slowenischen Bärin Georgia und ihre Abenteuer in den Pyrenäen
GEORGIA IN DER FALLE
Die junge Bärin Georgia wollte nicht hören.
Im Gegensatz zu ihrem ängstlicheren Bruder, der seiner Mama nicht von der Seite wich, setzte sich Georgia gerne ab.
Sie liebte es, die Gegend zu erkunden, ohne ständig belehrt und ermahnt zu werden.
Die Fürsorge ihrer Mama war Georgia lästig.
Wenn sie etwas nicht verstanden hatte, konnte sie allerdings bei ihrer Mama nicht nachfragen; die war zu weit weg.
Georgia war nicht wehleidig, sie weinte auch nicht, wenn ihr etwas nicht gelang. Das Weinen hätte Mutter Adelina auf Georgias Probleme aufmerksam gemacht. Das wollte Georgia auch nicht.
Oft probierte sie etwas aus, dachte aber nicht nach, wie sie es hätte besser machen können.
Zum Beispiel hatten Wildbienen Georgia arg zugerichtet. Sie hatten ihr die empfindliche Nase zerstochen. Warum? Weil sie die Schnauze in einen Stock gesteckt hatte, der noch am Baum hing. Ihre Mama Adelina hätte die Waben erst mit der Tatze vom Baum geholt, damit die Bienen vom Leckerbissen getrennt waren und ihre Nase weg von den Bienen.
Georgia mochte den süßen Honig, mehr noch als ihr Bruder, ihre Mama und mehr als alle anderen Bären in den slowenischen Bergen, die sie kannte.
Sie mochte den Honig so gerne, dass sie eines Tages alle Achtsamkeit vergaß und dem Geruch einer Honigwabe nachging. Die Bienenwabe lag in einer Art Tonne.
Als sie daran zu schlecken begann, machte es „Klick“ und ein Stößel löste einen Mechanismus aus. Hinter ihr rutschte ein Gitter mit rostigem Quietschen durch Führungsschienen hinab und krachte auf den metallenen Boden der Tonne. Das Gitter versperrte die Tonne.
Giorgia erschrak.
Sie war gefangen.
Georgia versuchte mit aller Kraft das verdammte Gitter wegzudrücken.
Kein Wehklagen, kein Brüllen, kein Kratzen, kein Schlagen half. Alle Anstrengungen waren vergeblich.
Georgia blieb in der Tonne eingesperrt.
Weil sie hungrig war und weil ein voller Bauch beruhigte, fraß sie die Wabe ratzeputz auf.
Dann blieb ihr nichts anderes übrig als zu warten.
Sie klagte: „Hilfe! Hilfe! – Mama, hilf!“
Adelina und Bruder Hugo hörten sie.
Sie näherten sich dem Tonnenungetüm vorsichtig, ständig um sich blickend.
Ihre Nasen witterten in alle Richtungen und vermuteten in der Nähe Menschen, die das Teufelswerk dort platziert hatten.
Doch Menschen waren keine in der Nähe.
Mama Adelina versuchte mit den Krallen die Gitterstäbe herauszureißen.
Dann warf sie ihren massigen Körper gegen die Tonne, um ihn vom Trailer stoßen. Das Monster würde so zerbrechen, glaubte sie.
Wie sie es an Imker-Hütten schon geschafft hatte, versuchte sie mit der Tatze den Verschlussriegel zu heben; Fehlanzeige.
Auch Bruder Hugo wollte helfen. Er steckte die Krallen beider Tatzen in das feinmaschige vordere Gitter und rüttelte daran, um es im Wechsel herauszuheben oder einzudrücken; kein Erfolg.
Schwester Georgia schaute ihn mit traurigen Augen an; Tränen kullerten.
Mutter und Bruder blieben die ganze Nacht bei Georgia. Als es wieder hell wurde hörten sie ein Motorengeräusch.
Ein Jeep kam angefahren. Ein Mann und eine Frau stiegen aus. Der Mann trug ein Gewehr.
Die beiden Menschen schienen sich über ihren Fang zu freuen. Der Mann legte sein Gewehr in das Auto zurück und holte dafür einen Sack mit Futter.
Beide sprachen beruhigend auf Georgie ein und steckten ihr Heidelbeeren, Haselnüsse und Birnen durch die Gitterstäbe. Als die gefangene Bärin ruhig blieb und sogar zu fressen begann, schoben sie noch eine Schüssel mit Wasser durch eine Klappe.
Diese Menschen schienen Georgia nichts Böses anhaben zu wollen.
Ohne Eile wuchteten sie den Trailer auf die Anhängerkupplung des Zugfahrzeugs und fuhren mit der Bärenfalle und mit Georgia davon.
Nicht sichtbar für die beiden Menschen versuchten Bärenmutter Adeline und Bruder Hugo mit dem Jeep Schritt zu halten, bis die Tonne mit der gefangenen Georgia eine Asphaltstraße erreichte und ihren Blicken entschwand.
„Hättest du doch auf mich gehört“, rief Mutter Adelina Georgia nach.
Georgia hatte ihre Freiheit für eine Honigwabe aufgegeben. Sie sollte Mutter und Bruder nie wieder sehen.
DIE PYRENÄEN
Die Pyrenäen sind eine mächtige, über vierhundert Kilometer lange Bergkette im Südwesten Europas.
Geografisch hat dieser Höhenzug mehrere wichtige Aufgaben: Er bildet eine natürliche Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Darüber hinaus trennt er die Iberische Halbinsel vom Rest Europas, und er scheidet das Wetter.
Weil er sich mit seinen Dreitausendern wie ein Riegel den Wolken, die sich über dem Atlantik gebildet haben, entgegenstellt, zwingt er sie aufzusteigen. Es kann also im Norden regnen oder schneien, während südlich von seinem Hauptkamm die Sonne scheint.
So ist es in den südlichen Pyrenäen trockener und wärmer.
Weil es wärmer ist, wurzeln noch auf zweitausend Meter Kiefern und Fichten. Bis in 1700 Meter Höhe wachsen Pinien, Buchen und Eichen. Auch die Kastanie wirft dort ihre Schatten.
Manche Wildtiere wandern mit der Vegetation, also mit den Jahreszeiten.
So fressen sich im Herbst Braunbären ihren Winterspeck unter anderem mit Pilzen, Pinienkernen, Eckern, Eicheln und Kastanien an, bevor sie sich zur Winterruhe in ihre Höhlen begeben.
Auch Eichhörnchen, Wildschweine, Rehe und Hirsche sind in den Pyrenäen auf leckere Baumfrüchte aus.
Während sich Hirsche und Rehe dort gut merken müssen, wo später unter dem Schnee noch eine Kastanie zu finden wäre, legen Eichhörnchen für den Winter Vorratslager an.
Luchse und Wölfe sind in den Pyrenäen eine Gefahr für die putzigen Murmeltiere.
Aber Aufpasser der drolligen Bergbewohner warnen ihre Sippschaft durch lautes Pfeifen, und in Windeseile verschwinden dann alle Müßiggänger in ihren weit verzweigten Bauten unter den Alpmatten.
Murmeltiere werden auch von den majestätischen Adlern gejagt.
Der noch größere Bartgeier bringt es auf eine Flügelspannweite von drei Meter.
Geier ernähren sich in den Pyrenäen aber ausschließlich von verstorbenen oder abgestürzten Gämsen.
Gämsen sind manchmal auch die Beute von Menschen.
Wenn der Jäger eine angeschossene Gämse nicht finden kann, und das Tier in unwegsamen Geländen verendet, dann stillen Kaiseradler und Geier den Hunger ihrer Jungen in den aussichtsreich gebauten Horsten mit Teilen des Kadavers; so ist der Kreislauf.
Die meisten Menschen, die über die hohen Berge der Pyrenäen wandern, freuen sich über die Farbenvielfalt der Wiesen und Almen, über die weiße Narzisse, die Silberdistel, den blauen Eisenhut, die Mehlbeere, den wilden Enzian, und manchmal über die Begegnung mit einem Auerhahn, einer Wildziege oder einem Fischotter.
Brenzlig kann es für Fremde werden, wenn sie eine Bache mit ihren Frischlingen stören oder wenn sie Bärenjungen zu nahekommen.
Bären waren in den Pyrenäen eigentlich schon ausgestorben. Die „Neuen“ kamen aus Slowenien.
DIE SLOWENISCHEN BÄRENJÄGER
In den Julischen Alpen siedelte vor Kurzem noch die stärkste Population von Braunbären in Westeuropa.
Slowenien, das dicht bewaldete Land am Rande des Balkans, zählte über sechshundert Bären.
Weil es so viele waren, wurden sie bejagt.
Als Frankreich Bären für ihre Pyrenäenberge suchte und deshalb bei den Slowenen um Hilfe anfragte, begann man dort Bärenfallen aufzustellen.
Bärenfänger legten nicht etwa metallene Scharnierkrallen aus, die zuklappten, wenn ein Bär hineintappt. Die hatten Wilderer für die verbotene Jagd benutzt, damit Wildhüter und die Polizei sie nicht auf frischer Tat ertappten.
Bären rochen Jäger und Wilderer lange bevor diese sie sahen.
Da Jäger und Wilderer nicht auf der Speisekarte von Bären standen, gingen sie ihnen aus dem Weg.
Eine Begegnung war selten und für die Menschen nur eine Gefahr, wenn sich der Bär bedroht fühlte.
Da Jäger und Wilderer den Tieren mit solchen Bärenfallen unnötiges Leid zufügten, waren die Scharnierkrallen verboten. Man sah ein, dass der Bär, wenn er mit einem Fuß in der Kralle gefangen war, sich an den scharfen Eisenzacken tiefe Wunden zufügte, je heftiger er daran zog.
Weil in vielen Ländern Westeuropas nur noch wenige Bären leben, wurden sie in diesen Ländern unter Artenschutz gestellt.
Wie bei Igel, Milan, Storch oder Biber wollten Tierschützer auch den Bestand der Bären in den Pyrenäen vergrößern.
„Selten kommen Bären in die Nähe menschlicher Siedlungen. Wenn Sie persönlich einen Braunbären in dessen Revier überraschen sollten, dann machen Sie ihn am besten durch lautes Reden und mittels Armbewegungen auf sich aufmerksam“, hieß es in einem Ratgeber. „… Der Bär wird, ohne weiter von Ihnen Notiz zu nehmen, davon trotten. Er ist misstrauisch und scheu.“
So warben die Befürworter für ein Miteinander mit den Bären und deren Nachwuchs.
In den slowenischen Regionen Notranjska und Kocevska postierten die Jäger also keine Bärenkrallen, sondern Lebendfallen. Schilder waren daran angebracht: „Danger Bear Traps“, damit Menschen gewarnt waren; Bären konnten den Hinweis leider nicht lesen.
Große Leichtmetallröhren, wie man sie für den Kanalisationsbau nutzte, waren auf Trailern montiert, so dass man einen gefangenen Bären rasch mitsamt der Falle wegtransportieren konnte. Nach Frankreich waren es immerhin tausendsechshundert Kilometer.
Vorne begrenzte ein Gitter die Röhre, und – wie schon bekannt – an den Gitterstäben gab es eine Halterung für den Köder, feinster Honig.
Nach hinten war die Röhre offen.
Ein Fallgitter sorgte für den automatischen Verschluss. Der Bär war dann gefangen und hatte eine lange Reise vor sich.
Doch nicht jeder Bär ließ sie durch Honig hinein locken.
Für die Braunbärin Adelina zum Beispiel, die Mutter von Georgia und Hugo, war der Mensch immer schon eine Bedrohung gewesen, denn ein Trophäenjäger hatte ihre Cousine Valeria erschossen.
Valerias Nachwuchs, zwei Bärenbuben, hatten Glück. Sie hatten von ihrer Mutter bereits gelernt, wie man im Wald überlebt.

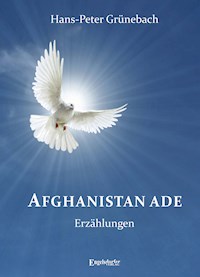
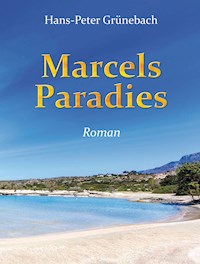
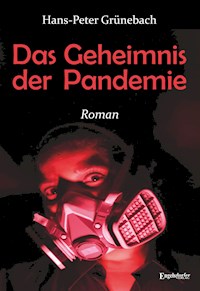













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











