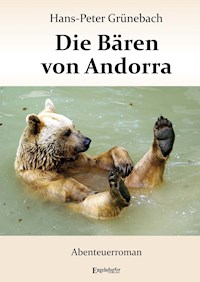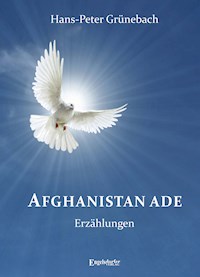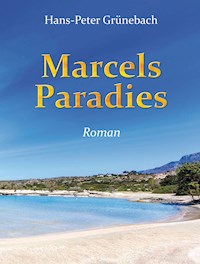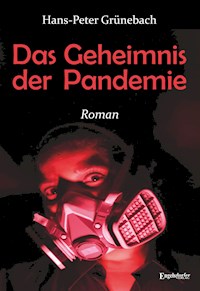Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Désirée, die tablettensüchtige Besitzerin einer Trachtenmodenkette, heiratet den traumatisierten, kletterbegeisterten Münchner Modenfrey-Erben Klement. Die Ehe steuert bald in die Katastrophe. Klement stürzt fragwürdig am Klettersteig in den Tod. Désirée tröstet sich mit ihrem spielsüchtigen Personenschützer und mit einem charmanten Berufskavalier, einem Franzosen; mit tödlichen Folgen für sie und für ihre Männer. Hauptkommissar Beppo Steinbeis ermittelt. Der Leser attestiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Hans-Peter Grünebach (Jahrgang 1948) ist neben dem Bücherschreiben passionierter Sportler. Er lebte berufsbedingt u. a. in München, Mannheim und Berlin, in den Niederlanden und Italien, zeitweise in Bosnien-Herzegowina, in Mazedonien und Afghanistan. Neben den Ländern Europas und Amerikas bereiste er studienhalber auch Russland und China. Mit „Begegnungen auf dem Balkan“ machte Grünebach 2001 auf sich aufmerksam. Heute begeistert er seine Leser mit politischen Gedichten, Theaterstück, Lyrik, Kurzgeschichten und Romanen. Er lebt im Kloster- und Künstlerdorf Polling in Oberbayern.
Hans-Peter Grünebach
Die Männer der Désirée
Roman
Engelsdorfer VerlagLeipzig2021
Dies ist ein Roman, der einst als Kurzgeschichte begann. Mögliche Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und Handlungsorten sind zufällig und nicht beabsichtigt, wenn nicht ausdrücklich benannt.
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2021) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Lektorat: Dr. Barbara Münch-Kienast
Titelbild © ullision [Adobe Stock]
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
I Klement Freys Leben und Sterben
Prolog
Alpenglühen
Badalona
Cassiopeia
Dolorosa
Engelblitz
Frederica
Gott sei Dank
Henriette
Isabella
Johannina
Küchenschürze
Landestracht
Magdalena
II Der mysteriöse Tod der Désirée Annabel v. Waller-Frey
Prolog
Anakonda
Basilisk
Chupacabra
Draugluin
Erdhenne
Feuerputz
Garuda
Hypokamp
Illuyanka
Jabberwocky
Klabautermann
III Boris Nikolaj Schafirow und der Goldschatz
Prolog
Arsamas
Borodino
Charabali
Dalmatowo
Elektrostal
Frolowo
Gorbatow
Iwanowo
Epilog
Zeittafel
Danksagung
IKlement Freys Leben und Sterben
PROLOG
Das Pflaster vor dem Polizeipräsidium war nass. Es nieselte. Schon konnte Hauptkommissar Beppo Steinbeis im Musikladen gegenüber dem Verkauf von Liederbüchern, Notenheften und Blockflöten zusehen. Die Straßenbeleuchtung spiegelte sich im Asphalt. Der November hatte etwas Unfreundliches an sich. Zu viel Grau, zu viel Regen, zu früh dunkel. Den Radlern mutete er zunehmend frostige Fahrten zu.
Steinbeis könnte für die vier Kilometer zum Dienst in die Ettstraße und abends zurück in sein Apartment in der Schwabinger Ainmillerstraße auch die U-Bahn nehmen. Doch weil er bei der Kripo viel Zeit am Bildschirm verbringen musste, gönnte er sich die tägliche Strampelei. Die Bewegung tat dem 42-Jährigen gut. Seit seiner Versetzung von Garmisch nach München vor zwei Jahren waren es nur dienstliche Einsätze, Blitzeis und unzumutbare Baustellen, die ihn daran hinderten. Sogar am Tag der Beförderung hatte er seinen Drahtesel entlang von Leopold- und Ludwigstraße und durch den verkehrsberuhigten Teil der Innenstadt zur Dienststelle gelenkt. Sehr praktisch, denn der Polizeipräsident gab ihm damals nach der Zeremonie frei. Weil eine Kollegin im Einsatz erschossen worden war, war niemandem nach Feiern zumute.
So erreichte Beppo Steinbeis an jenem Tag im April 2006 mit dem Rad sogar die 9.32-Uhr-Bahn, entrichtete bei der Kontrolleurin seinen Obolus und überraschte seine Frau Ilona noch vor 11 Uhr beim Sprachtraining „Chinesisch für Anfänger“.
Zusammen mit den Schwiegereltern Christian und Monika hatten sie sich von ihrem Zweifamilienhaus in Murnau-Weindorf aufgemacht und Sohn Tobias an der Schule aufgepickt.
Sie waren in der Fußgängerzone zusammen Pizza essen gegangen. Der achtjährige Tobi war überglücklich, nicht Schulbus fahren zu müssen und den „Wochenendpapa“, wie er seinen Vater oft nannte, früher als sonst um sich zu haben.
Der Schwiegervater des Kommissars, Christian, hatte damals gedankenvoll sein Weinglas erhoben und gesagt: „Wir gratulieren, Beppo! Hochverdient! Deine Eltern wären stolz auf dich!“
Beppo hatte sich mit einem Toast auf die Gratulanten bedankt und auch seiner Eltern gedacht. Die waren sechs Jahre zuvor bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Sie wollten unbedingt einmal mit einer Concorde über den Atlantik fliegen. Den Enkel konnten sie noch kennenlernen. Doch seinem Aufwachsen zuzusehen und es zu begleiten, das blieb ihnen verwehrt.
Es klopfte.
Beppo Steinbeis, derzeit allein im Büro – Kollege Fred Käferlein hatte Urlaub –, wandte sich vom Fenster zur Tür.
„Herein!“
Frau Bukowski brachte mit dem Handwagen die Post. Den „Rolli“ gab es noch im Präsidium, denn die Akten hatten manchmal beträchtliche Umfänge, Gewicht und Vertraulichkeit. Auch der nostalgische Paternoster hatte die Veränderungen auf der Welt überlebt. Er bot Platz für den Personentransport, für sensible Akten und ihre Bewacherin. Mit Augenmaß und einer gewissen Sportlichkeit konnte sie die Dienstpost zwischen den Stockwerken des Altbaus auf diese Weise schnell verteilen.
Es war Frau Bukowski, die zu Beppo Steinbeis mit nachhaltiger Ignoranz stets „Herr Steinbeißer“ sagte, obwohl der richtige Name auf der Post zu lesen war. Auch hatte er ihr einst geduldig erklärt, dass die Namen zwar den gleichen Ursprung hätten, beide kämen sie von „Steine beißen“, aber sein Name ohne scharfes oder doppeltes s geschrieben würde. Sogar den Verbreitungsraum, Deutschland–Österreich– Frankreich–Großbritannien, hatte er erwähnt – und dass es Blaublütige unter den Steinbeis’ gäbe.
„Leider nicht in Russland bekannt“, entschuldigte sie sich damals. Frau Bukowski war Russlanddeutsche und vertrat im Krankheitsfall Frau Schmidbauer. Der häufte sich, da Frau Schmidbauer 61 Jahre alt war und unter einer Hüftarthrose litt.
Frau Bukowski hatte diesmal nur einen einzigen Aktenordner, ein paar Briefe und eine Umlaufmappe in den Eingangskorb gelegt, der auf dem Sideboard zu seinem Schreibtisch auf Arbeitszugang wartete. Mit einem diensteifrigen „Einen schönen Tag, Herr Steinbeißer“, hatte sie das Zimmer verlassen und die Tür wieder geschlossen.
Der Kommissar nahm den neuen Aktenordner zur Hand. Er war für sein Referat gekennzeichnet. Darüber hinaus stand darauf: „Klement Frey“. Der Polizeipräsident hatte einen Vermerk angeheftet: „Wichtig – bitte Rücksprache!“
ALPENGLÜHEN
Ein Fluch schien Menschen ein Ende setzen zu wollen, die glaubten, mit Familiengründung, Hauseigentum und Wunschkind ihr Glück gefunden zu haben.
Von der Côte d’Azur hatten sie die Route Napoleon gewählt und den Rosenduft geatmet, der über der Ebene von Grasse lag. Im Tal des Flusses Verdon tobten sie Wassergumpen leer. Danach röhrte der Motor mehrmals beim Erklimmen schwindelnder Höhen. Das Auto zwängte sich durch beängstigende Felsformationen und stürzte sich über endlose Serpentinen wieder hinab ins grüne Tal. Ein Adler schwebte auf meterbreiten Schwingen auf der Suche nach Beute über ihm. Der Junge auf dem Rücksitz bewunderte die Grazie seiner Kreise.
Noch in Frankreich war ein Unwetter über die zwei Erwachsenen und das Kind hereingebrochen.
Die Kleinfamilie wartete das Ende der Dusche unter einer alten Brücke ab. Deren bemooste Steinquader ließen die drei Münchner vermuten, dass bereits Hannibal über sie geritten war. Auch seine Kampfelefanten hat sie getragen.
„Klement …“, rief der kleine Mann laut seinen Namen. „… ent“ schallte es zurück.
„Wenn eine Brücke ein Echo hat, dann muss sie wirklich sehr groß und sehr alt sein“, wusste der Vater.
„Oder sie muss verwunschen sein – dann antwortet dir jemand aus dem Reich der Toten“, fügte die Mutter geheimnisvoll hinzu.
Es war Abend geworden. Die Landstraße spiegelte die Lichter der über sie brausenden Fahrzeuge. Die Natur wollte eigentlich schlafen gehen, aber der Vater klammerte sich an das Steuer und zwinkerte mit müden Augen.
Klements Papa wollte noch tanken und dann einen Espresso trinken.
Klements Mutter hatte am Beifahrersitz den Kopf auf ein Hörnchenkissen gebettet, wo er sich im Rhythmus des Asphalts bewegte. Licht- und Schattenspiele wanderten über ihre Silhouette.
Den Körper in eine Decke gewickelt, hatte es sich Klement auf der Rückbank gemütlich gemacht. Gegen Fahrgeräusche und Lichtreflexe, besonders die bei Ortsdurchfahrten und in Tunnels, hatte er ein Badehandtuch um den Kopf geschlungen. So schlief er ein.
Er träumte von seiner Modelleisenbahn, von seinem Kater Hadubald, den eine Nachbarin versorgte, und freute sich – völlig gegen die Regel – auf den Wiederbeginn der Schule.
In etwa einer Stunde würden sie die Schweizer Grenze passiert haben und spät nachts noch ihr Haus in Daglfing erreichen.
Das war der Plan, denn morgen, am Sonntag, würden sie sich ausruhen und von der Fahrt erholen können, hatte der Vater bei der Abfahrt in Nizza gesagt.
Die Hände taten weh vom Griff am Lenkrad. Der Rücken schmerzte vom stundenlangen Verharren in dem eigentlich bequemen Sitz des Citroën.
Den hatten sie gekauft, weil in ihm Platz für Zelt, Zweiflammenkocher und für Klements Gummiboot war und weil das hydraulische Auf und Ab vor und nach der Fahrt Klement so faszinierte, dass Papa manchmal das Auto nur für ihn anlassen musste. Dann lachte er und war glücklich.
Die Lautstärke des Radios hatte Klements Vater aus Rücksicht auf die Schläfer gedrosselt.
Noch immer spiegelten Scheinwerfer sich in dem nassen Straßenbelag. Wasser spritzte. Es blendeten Fernlichter und es senkten sich die Lider vor Müdigkeit. Schlaf reizte. Trägheit war über Klements Papa hergefallen. Die Achtsamkeit war reduziert und Alarmmechanismen waren ausgeschaltet.
Schon sah er die Leuchtreklamen der Tankstelle weit vor sich, als die Gefahr mit Blitzesschnelle nahte.
Ein gleißendes Licht brach in seine Müdigkeit ein. Schreck und Hitze übermannten ihn. Ein überholendes Fahrzeug kam ihm entgegen. Seine Muskeln zuckten. Reifen pflügten das Bankett. Bremsen quietschten. Das Auto schlingerte. Die Bremsen blockierten. Es rauchte und stank nach Gummi. Der Wagen schleuderte. Ein Baum setzte vorbei. Die Mutter schrie. Am Fuße des Abhangs katapultierte der Bug hoch. Das Auto prallte auf die Fahrerseite. Das Steuer brach. Alles drehte sich, einmal, ein zweites Mal, ein drittes Mal. Sie glitten auf dem Dach über Steine. Funken stoben. Die Uferböschung schlitterten sie hinunter ins Wasser. Das brach ein. Es wurde dunkel, nass und kalt. Oben nur ein Blubbern. Die Mutter hauchte: „Klement!“
Das Letzte, was Klement in seinem Leben von den leiblichen Eltern gehört hatte, war ein Entsetzensfluch des Vaters und ein Angstschrei der Mutter. Es war ihm, als hätte ihn jemand aus dem Auto geworfen. Danach umgaben den Jungen schützende Finsternis und eine tödliche Stille.
BADALONA
Egmont Frey und Hannelore Frey-Hornung saßen beim Frühstück und lasen die Süddeutsche Zeitung.
„Hast du Töne“, kommentierte Egmond Frey eine Notiz aus den Vereinigten Staaten. „In Florida wurde ein Mafioso, der zur Ermordung von John F. Kennedy aussagen sollte, tot in einem Ölfass vor der Küste aufgefunden. Die Mörder haben ganze Arbeit geleistet. Sie wollten wohl nicht das mindeste Risiko eingehen. Er wurde erdrosselt und erschossen. Zudem waren seine Beine abgesägt, als hätten die Meuchler Angst gehabt, dass ihnen die Leiche im letzten Moment noch davonläuft.“
„Ich finde sein Schicksal, was immer er getan hat, bedauernswert und gar nicht lustig. Dass du dich über solche Nachrichten amüsieren kannst? Typisch Mann, empathielos und ignorant!“
Für Egmont Frey war solche Kritik seiner Frau eine, die er mit Stillschweigen ertrug. Er fragte sich jeweils, ob es sich lohnte zu intervenieren. Egal wie er antwortete, ein Streitgespräch wäre die Folge, das er nur verlieren konnte. Wenn der Streitwert für ihn hoch war, ließ er sich auf eine Debatte ein, dann aber mit Konsequenzen. Aber bei solch unsachlicher Rhetorik machte eine Auseinandersetzung für Egmont keinen Sinn. Er schwieg. Es vergingen Minuten, bis Hannelore Frey-Hornung, den Vorwurf der mangelnden Seriosität zurückgestellt, erneut das Wort ergriff: „Hast du den Bericht über das Münchner Ehepaar gelesen, das in Frankreich bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist?“
„Ja, gestern gab es dazu eine Schlagzeile. Das Kind soll einen mächtigen Schutzengel gehabt haben. Wenn ich richtig gelesen habe, dann war ‚das Wunder von Annecy‘ nicht angeschnallt gewesen, oder?“
„Dafür kann doch der Junge nichts.“
„Gilt nicht seit 1. Januar eine Anschnallpflicht?“
„Ja, sicher, aber willst du den Eltern deswegen einen Vorwurf machen? Das würde aus zweierlei Gründen keinen Sinn ergeben: Erstens könnte er sich ja von den Eltern unbemerkt selbstständig abgeschnallt haben. Zweitens hatte der Junge ein Riesenglück, dass er nicht angeschnallt war. Er scheint so rechtzeitig aus dem Auto gefallen zu sein, dass er den Crash gar nicht mitbekommen hat. Man fand ihn auf einer Wiese und nicht im Autowrack, heißt es im heutigen Bericht. Das Auto haben sie aus dem Fluss bergen müssen. Der Junge ist zehn Jahre alt und soll ins Freimanner Knabenheim. Nur Waisen und Halbwaisen gibt es dort, in riesigen Schlafsälen zusammengepfercht. Mir tut der Bub leid.“
Egmont Frey schwieg.
Seine Frau fragte, ohne ihn dabei anzusehen: „Erinnerst du dich? Wir hatten vor Jahren einmal eine Patenschaft dorthin und lassen dem Heim zu Weihnachten jedes Jahr eine Spende zukommen; sie läuft über das Unternehmen. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Summe ist, weißt du es?“
„Nein, aber warum interessiert dich der Fall so sehr? Weil der Junge dir leidtut? Sag es frei heraus!“
„Die Firma Modenfrey wird irgendwann einen Erben benötigen“, sagte Hannelore ohne jegliche Sentimentalität; eher so, als handele es sich um eine Angelegenheit der Firmenraison.
Ihr Mann wurde hellhörig.
Ja, sie hatten keine Kinder und konnten keine bekommen. Die Möglichkeiten, ein Kind zu adoptieren, hatten sie des Öfteren schon erörtert, mit den Jahren auch weniger sentimental, pragmatischer. Was sie bislang von einer Adoption abgehalten hatte, war der unbestimmbare Ausgang. Die Adoption eines Kindes aus Asien war zwar leichter zu bewerkstelligen als die eines deutschen, aber das Ergebnis war schwerer vorhersehbar. Immer wieder hatten sie das Thema vertagt. Gegen eine schnelle Sache mit einem asiatischen Baby hatten sie einige Vorbehalte. Bei einem kulturell entwurzelten Kind wisse man nie, welchen Widerständen es später ausgesetzt sei. Sein Anderssein würde es ja nicht verstecken können. Und niemand könne seine Veranlagung vorhersagen – vom Wunderkind bis zu einem Kind mit geistiger Behinderung. Würde man in letzterem Fall das eigene Leben neuen Umständen anpassen, Lebensträume und berufliche Ziele zurückstellen? Was, wenn die Begabung nicht für eine höhere Schule und ein Studium ausreichte?
Vielleicht könnte man mit einem schon grundentwickelten deutschen Kind besser in die Zukunft schauen? Er oder sie hätten bereits Schulzeugnisnachweise und Erzieher, die Auskunft zu Charakter und Eignung geben können.
Egmont Frey war Pragmatiker. Wenn seine Frau in ein Thema so einstieg, hatte sie ihm Kenntnisse voraus.
„Können wir Näheres zu dem Jungen erfahren?“
„Du weißt ja, dass auf ein Kind sieben Bewerber kommen. Sollten wir eine Adoption wollen, gilt es keine Zeit zu verlieren. Wir müssten nachweisen, dass wir die ‚bestgeeigneten Adoptiveltern‘ sind. Deshalb hab ich im Heim angerufen und Auskunft bekommen, da wir dort bekannt sind. Der Knabe Klement hat gute Schulnoten und er ist technisch interessiert. Beim Jugendamt wäre man sehr glücklich über eine rasche Adoption, der Junge braucht neue Eltern und eine therapeutische Begleitung seines Traumas. Eine Elternschaft, die Zeit für ihn hat und für Ablenkung sorgt, täte ihm gut.“
„Du hättest mich vorher fragen sollen!“
„Sei nicht kleinlich. Es ist ja nichts passiert und ein Kontakt mit dem Jungen hat nicht stattgefunden. Ich habe nur recherchiert. Was ich noch herausgefunden habe: Den Jungen hat der ADAC in Annecy bereits abgeholt und ins Schwabinger Krankenhaus überführt. Wir könnten ihn besuchen. Er wird dort auf der Kinderstation mehr wegen des traumatischen Erlebnisses überwacht. Er hat offensichtlich keine Brüche, nur ein paar Schrammen und kann sich erinnern. Es liegt also keine Amnesie vor. Er sagt, er habe auf der Rückbank geschlafen und sich dazu in Decken eingewickelt. Ob die Eltern bemerkt hatten, dass er sich abgeschnallt hatte, das wisse er nicht. Der Bub macht sich Sorgen um seine Katze; sie heißt Hadubald. Woher der Name kommt? Ich weiß es nicht. Wir könnten das Tier in Pflege nehmen. Das würde einen ersten Kontakt schaffen. Noch eine Sache könnte für uns von Interesse sein: Die verstorbenen Eltern sind die Besitzer des großen Trachtenladens im Tal, du weißt schon. Grundsätzlich erlöschen ja bei Adoption die alten Verwandtschaftsverhältnisse des Kindes zu seiner Herkunftsfamilie und die damit verbundenen Rechte und Pflichten. Andere würden den Laden und das Vermögen erben. Es gibt keine Geschwister, aber die verstorbenen Eltern haben je eine Schwester. Man müsste den Verwandten ein gutes Angebot unterbreiten, das sie annehmen. Es gälte, eine Situation herzustellen, als wäre er Alleinerbe der Adoptiveltern. Alles würde dann zum Wohl des Kindes gereichen und das Jugendamt und den bestellten Vormund überzeugen. Als seine Adoptiveltern könnten wir diesen Erbteil so regeln, dass wir das Geschäft bis zu seiner Volljährigkeit für ihn weiterführen. Eventuelle Kredittilgungen müssen wir übernehmen. Die Geschäftsgewinne geben wir auf ein Treuhandkonto, auf das er am Tag seiner Volljährigkeit Zugriff hat, wie auch auf den Laden. Nach dem Abitur kann er bereits sein Studium selbst finanzieren. Die frühe Verantwortung wäre eine gute Schule für einen selbstständigen Unternehmer. Für den Eintritt in das Geschäftsleben bei Modenfrey hat er, in Verbindung mit einem Betriebswirtschaftsstudium und einem Volontariat, dann die passenden Voraussetzungen. Das wäre auch im Sinne des Unternehmens und für ihn eine fürsorgliche Lebensplanung. Was hältst du von der Idee?“
Egmont Frey hatte es die Sprache verschlagen. Was sollte er noch sagen? Seine Frau hatte ihm einen Plan ausgebreitet, wie er ihn nicht besser hätte strukturieren können.
„Lass uns eine Nacht darüber schlafen! Was ist, wenn er sich gegen das Unternehmen entschiede? Ich brauche Bedenkzeit.“
Egmont Frey wich einer sofortigen Entscheidung aus Prinzip aus. Er hatte mit dem Verfahren der Vierundzwanzig-Stunden-Denkpause gute Erfahrungen gemacht.
Seine Frau Hannelore hatte aus Mimik und Art der Antwort längst entnommen, dass ihr Mann im Prinzip einverstanden war. Er wird wohl auf einer Pflegeprobezeit bestehen. Die ist sowieso verpflichtend. Ganz sicher wird er den Jungen ein Wochenende bei sich zu Hause haben wollen, bevor er zustimmt.
Am nächsten Morgen trat ein, was Hannelore Frey-Hornung von ihrem Mann erwartet hatte.
Es verging ein Monat. Dann kam das Wochenende, an dem sie aneinander Gefallen fanden.
Die Freys, beide Mittdreißiger, zeigten dem Jungen ihre Münchner Produktions- und Verkaufsstätten. Klement fand zur Freude von Egmont und der Belegschaft Interesse an den Webmaschinen. Er kannte ja nur die Produkte im Laden der Eltern.
Sie machten einen Ausflug nach Hellabrunn in den Tierpark. Den Kater Hadubald hatten die Freys schon in Pflege genommen, als Klement in den langen Fluren der Klinik herumsprang. Oft musste er von den Schwestern eingefangen werden wie in einem Versteckspiel. Die orthopädische Abteilung, die mit den vielen geschienten Beinen und Armen und dort besonders die Patienten mit einem Thorax-Gips nach einer Schulterverletzung, hatte es ihm angetan. Kurzzeitig wollte er Chirurg werden. Wenig später hatte er sich für den verantwortungsvollen Beruf des Pflegers entschieden, dann wieder besann er sich auf Geschäftsführer im Trachtenmodeladen der verstorbenen Eltern. Das würden Papa und Mama von ihm erwarten. Und sie sähen ihm ja aus dem Himmel zu.
Als Klement das erste Mal in der Frey-Villa zu Besuch war, begeisterte ihn, dass es Hauspersonal gab und er deshalb niemals mehr allein sein würde. Auch könne er von der Osterwaldstraße aus mit dem Rad in die Schule fahren, wenn er demnächst ins Gymnasium ging, erzählte er der Tante vom Jugendamt.
Als Klement später mit den neuen Adoptiveltern, dem amtlichen Vormund, der Tante vom Jugendamt, dem Hausnotar von Modenfrey und einem juristischen Erbenvertreter der verstorbenen Eltern beim Aushandeln von irgendwelchen Urkundentexten saß, langweilte er sich sehr.
Er hatte seinen Kater auf dem Schoß und blickte schon auf Erinnerungen mit den neuen Eltern zurück. Sie konnten ihm seine alten nicht ersetzen; oft noch war er sehr traurig. Aber der Trip mit ihnen nach Garmisch in der Limousine mit Chauffeur, die Fahrt mit der Kabinenbahn aufs Kreuzeck und die Bergtour zu den Osterfelderköpfen war Spitze. Mama Hannelore hatte ihn auf einem Felsen mit der dreieckigen Alpspitze im Hintergrund fotografiert. Das Bild hing jetzt in seinem Zimmer an der Wand. Er durfte in den Restschnee springen, mit Egmont Schneebälle werfen und auf der Suche nach seinem Echo „Klement“ rufen.
Diese Bilder standen auf dem Nachttisch und begleiteten ihn in den Schlaf. Vom Gipfel hatte er auf eine nie zuvor gesehene Welt von Bergspitzen, Kars und Tälern geblickt. Der Himmel war blau. Die Sonne wärmte und warf Farben und Schatten auf Felsen und Schneefelder. Mit dem Fernglas konnte er an der Riffelscharte Gämsen beobachten.
Das war es, was er wieder machen wollte: auf Berge steigen und die Welt dort oben erkunden.
In der Hochalm gab es feinen Kaiserschmarren.
Sie ruhten in hölzernen Liegestühlen aus Segeltuch.
Ein Raubvogel hatte über Klement seine Kreise gedreht. Verschwommen war die letzte Autofahrt mit Papa und Mama wieder aufgetaucht, mit dem Adler, am Pass.
Wie in einer Bobbahn glitt das Auto ins Tal. Wie von unsichtbarer Hand gehoben, flogen sie plötzlich dahin. Der Adler hatte das Auto in seine Fänge genommen. Für eine geraume Weile schwebten sie in einer Gondel. Der Adler krächzte, dass das Gummiboot zu schwer sei. Er müsse sie sofort loslassen. Sie stürzten und wieder hörte Klement den Schrei seiner Mutter.
Hadubald miaute. Klements Augen blickten erschrocken in die Runde.
Die Erwachsenen hatten ihre Urkunden unterzeichnet und lachten. Sie lachten über ihn.
Er war wieder hellwach.
Von nun an hieß er Klement Frey.
CASSIOPEIA
Hasdrubal war ein Sohn des Hamilkar Barkas. Nach seinem Bruder Hannibal, dem Sieger der Schlacht von Cannae, war er der mutigste und tüchtigste der karthagischen Feldherren im Zweiten Punischen Krieg.
Als Klement zu seinem dritten Geburtstag 1969 ein achtwöchiges, schwarz-weißes Katerlein geschenkt bekam, schlug sein leiblicher Vater, ein Freund der klassischen Antike, vor, ihn Hasdrubal zu nennen. Klement hatte jedoch Schwierigkeiten mit dem s und sprach „Hadubal“.
„Hadubal ist kein Name!“, befand der Vater. Er heißt Hadubald. Das ist Althochdeutsch und verbindet ‚Kampf‘ mit ‚Kühnheit‘“. Dem kleinen Klement war es recht, kein Einwand von der Mutter, dabei blieb es.
Irgendwie passte Kampf und Kühnheit zu dem aufmüpfigen Kater, dem kein Baum zu hoch, kein Gegner zu frech, keine Maus zu flink sein konnte.
Den sechzehnten Geburtstag seines langjährigen Freundes sollte Hadubald nicht mehr erleben. Seine Reflexe waren nicht mehr die von einst. Beim nächtlichen Strawanzen wurde er ein Opfer seiner Kühnheit. Er hatte das Duell „Blaumetallic Suzuki RV 50 gegen Schwarz-Weiß Kampfkühn“ verloren. Die Katzenwelt Schwabings pries seine Taten. Hadubald fand seine letzte Ruhestätte im Schatten einer mächtigen Blutbuche auf dem Grundstück der Freys und nicht nur Klement weinte um ihn, sondern auch Eveline, ein Au-pair-Mädchen aus Île-Tudy in der Bretagne.
Da die sanfte Eveline nicht viel älter war als der frühreife Klement und 1413 Kilometer weg von ihrem Zuhause, saßen die beiden öfter zusammen und hörten den „Kommissar“ von Falco, „Femme que j’aime“ von Jean Luc Lahaye, „Ein bißchen Frieden“ von Nicole, „Chacun fait c’qui lui plaît“ von Chagrin d’Amour oder „It’s raining again“ von Supertramp.
Klement wäre nicht Klement, der lebensneugierige Junior von Modenfrey, wenn er nicht die Chance erkannt hätte, gegebenenfalls sein erstes amouröses Abenteuer auf heimischem Terrain einzufädeln. Dabei hoffte er auf Evelines Erfahrung und dass sie ihm Bereitschaft signalisierte. Als die Signale ausblieben, begann er eine Offensive und legte seinen Arm um ihre Schultern, wie zufällig. Sie saßen über seinen Französischhausaufgaben. Die Berührung brachte seinen ganzen Körper in Aufregung. Es begann mit einem Kribbeln.
Pech, dass sich die Sanftmütige in eine wehrhafte Bretonin mit Erwachsenenanspruch verwandelte, als er sie bedrängte. Wie zufällig hatte er eine Hand auf ihre Brust gelegt und erntete eine Ohrfeige. Es war eine leichte Ohrfeige, die ihr gutes Verhältnis nicht nachhaltig trübte. Aber sie stand zwischen ihnen. Eveline, deren Name sich ihrer Aussage nach von dem altfranzösischen Aveline ableitete, wusste um die Gefahren innerfamiliärer Beziehungen. Sie gehörte ja für ein Jahr zur Familie und wollte Deutsch lernen. Madame Frey hatte sie auch mit einem Schmunzeln vor Klements beginnendem „Sturm und Drang“ gewarnt.
Aber Eveline war oft allein, sie hatte wenige Kontakte und Heimweh stellte sich ein. Klement konnte zuhören, er war intelligent, vielseitig interessiert, sportlich, aus gutem Hause und er sah gut aus. Sie würde noch ein Dreivierteljahr in München sein und vielleicht hier auch studieren wollen. Nichts hatte Eile.
Auch Klement hatte Zeit. Zunächst brauchte er eine gute Französischnote.
Seinen Pragmatismus hatte sich Klement bei Egmont und Hannelore abgeschaut, wie er so vieles in den ersten sechs Jahren seines neuen Lebens von ihnen lernte.
Die erste Zeit war hart gewesen; Einstieg ins Gymnasium, neue Gesichter, neue Lehrer, erste Fremdsprache, die leiblichen Eltern tot. Das Schlimmste war aber, dass er so oft darauf angesprochen wurde. Mitleid wollte er nicht.
Die Adoptiveltern trugen große Verantwortung für viele Menschen, waren häufig unterwegs zu Konferenzen und Modewochen und nahmen Anteil am gesellschaftlichen Leben. Sie waren politisch interessiert und banden ihn in die Tagesereignisse ein, solange sie jugendfrei waren.
Früh lernte er, sich selbst zu informieren. Er fragte andere zum Thema aus, suchte in verschiedenen Zeitungen Berichte und hörte Nachrichten. So lernte er von den täglichen Ereignissen viel über die Vergänglichkeit. Er sah sich zunehmend kritisch inmitten einer fragilen Weltsituation mit Mord und Todschlag, Terrorismus, Katastrophen und Kriegen.
Die Vergangenheit war für ihn wichtig. Wichtig war auch die Zukunft. Das Wichtigste aber, fand er, war die Gegenwart. In der wuchs er auf und sie atmete er. Sie konnte aber auch jede Minute enden, sodass sie vor dem Ende für Schönes genutzt werden musste, so dachte er.
Egmont hatte ihm empfohlen, als Erinnerungsstütze das Wichtigste aufzuschreiben. Er hatte ihm dazu eine ledergebundene Kladde mit Schloss geschenkt.
Darin fand sich neben Persönlichem zum Beispiel für das Jahr 1977 der Eintrag: „Entführung der Landshut nach Mogadischu. Blutigstes Jahr des Terrors. 159 Opfer von Terroranschlägen, dabei 100 beim Absturz von Flug 635 der Malaysia Airline.“
Alles war in sauberer Handschrift niedergeschrieben.
Für 1978 war vermerkt: „Papst Paul VI. stirbt nach 15 Jahren Pontifikat. Nachfolger Papst Johannes Paul nach nur 33-tägiger Amtszeit tot. Nachfolger wird der bisherige Erzbischof von Krakau, Polen, Karol Wojtyła; er nennt sich Papst Johannes Paul II. Der italienische Ministerpräsident Aldo Moro wird von den Roten Brigaden entführt und umgebracht.“
Unter 1980 gab es nur zwei Notizen: „Oktoberfest-Attentat. 1. Golfkrieg zwischen Iran und Irak.“
Für 1981 hatte Klement festgehalten: „Der ägyptische Präsident wird bei einem Attentat getötet. Blume des Jahres ist die Gelbe Narzisse. Als Vogel des Jahres ist der Schwarzspecht gewählt worden. Gründung der Partei Die Grünen aus der Umweltschutz- und Atomkraftbewegung. Start des Space Shuttle Columbia. Interessiert mich sehr.“
Und für das laufende Jahr hatte er schon vermerkt, dass Helmut Kohl Bundeskanzler geworden ist und man auf den Falklandinseln und im Libanon Krieg führt.
Freimütig hatte er Eveline einmal sein Tagebuch gezeigt. Sie wollte erst nicht darin lesen und sagte: „Das ist dein kleines Geheimnis, Klement! Ich würde mein Tagebuch niemandem zeigen, nicht einmal meiner Mutter.“
„Das sind nur Notizen von Tagesgeschehnissen, von Vorgängen in der Firma und technische Details, keine Geheimnisse. Es ist kein Poesiealbum, dem man seine Träume anvertraut, in das kleine Mädchen Bilder und Texte aus der Bravo kleben und Gedichtchen von Klassenkameradinnen sammeln. Nicht dergleichen ist mein Tagebuch.“
Eveline staunte über die Ernsthaftigkeit des Inhalts; alle Eintragungen schienen für einen späteren Nutzen, wenn es sein musste für andere, bestimmt. Nichts war unnütz festgehalten.
In der Schule ließ Klement nichts anbrennen. Er passte im Unterricht auf und sparte sich so manches Nachlernen zu Hause. Ganz wichtig dabei war, dass er am Wochenende Zeit für seine Berge hatte. Sein Verhältnis zu den Adoptiveltern war auch deshalb ungetrübt, weil Egmont und Hannelore ihm jeden Weg ins Gebirge öffneten. Sie hatten ihn beim Alpenverein eingeschrieben und wenn sie einmal selbst keine Zeit hatten, mit ihm einen Gipfel zu besteigen, dann organisierten sie ihm die Bergtour auf andere Weise.
„Der höchste Berg der Bretagne, der Roc’h Ruz, ist nur 385 Meter hoch“, berichtete Eveline. Dort war sie gewesen und zweimal in Albertville zum Skikurs. Mehr Bergerfahrung hatte sie nicht. Trotzdem fand sie an den Gebirgswanderungen der Freys Gefallen. Sie war nicht unsportlich, doch lebte sie direkt am Atlantik und war die Höhe nicht gewöhnt. Also war sie oben kurzatmig. Die anderen mussten auf sie warten.
Höhepunkt ihres München-Aufenthalts sollte ein gemeinsames verlängertes Wochenende in den Alpen sein. Die Eltern hatten ein Panoramahotel am Reschenpass ausgesucht, von dem aus man beim Anblick des Ortlers Ausflüge auf die umliegenden Spitzen machte. Zudem konnten sie mit Leihrädern den See umrunden, den aus den Wassern ragenden Kirchturm von Graun fotografieren und von Graun aus auch die zehn Kilometer des Langtauferer Tals bis auf 1915 Meter hochfahren. Vom Talende aus hätte man einen gigantischen Rundblick auf die Ötztaler Alpen und ihre Gletscher. So hatte Egmont das Vorhaben angekündigt.
Die Zimmer waren gebucht, doch mussten Egmont und Hannelore im letzten Augenblick umplanen und einen Geschäftstermin wahrnehmen. Die Vorfreude der Jugend sollte nicht enttäuscht werden. Der Chauffeur fuhr Klement und Eveline nach Reschen und sollte sie dort drei Tage später wieder abholen.
Noch am Tag der Ankunft bestiegen sie die Cima Dieci, die Zehnerspitze. Es war oben eine steile und rutschige Angelegenheit und Eveline hatte Angst, aber Klement sicherte sie ritterlich am Seil. Eveline fasste Vertrauen. Klement war keine sechzehn mehr. Sie sah ihn plötzlich in einer anderen Rolle, als ihren Beschützer.
Am nächsten Tag strahlte die Sonne und sie brachen mit dem Rad auf, Schwimmsachen im Rucksack. Die Fotos am Grauner Kirchturm sollten Evelines Eltern überraschen und sie mit dem Frey-Erben zeigen. Die deutsche Touristin, die sie ablichtete, sagte: „Ein schönes Paar. Viel Glück zusammen!“
Sie lachten eine Weile über die Bemerkung und radelten zurück nach Reschen.
Unterhalb des Hotels war eine Badestelle.
Eveline war immer ein hübscher Anblick. Die fliehenden blonden Haare, das Sommersprossengesicht mit dem dunklen Teint, der wassergewohnte, mädchenhafte Körper im sportlich geschnittenen Arena-Badeanzug machten sie extrem anziehend.
Der Abendwind wehte kühl. Die Wassertemperaturen stiegen auch im Sommer nicht über siebzehn Grad. Demensprechend kurz fiel die Schwimmeinlage aus.
Klamm kletterten sie über das steinige Steilufer zum Lagerplatz. Es war ihnen kalt.
Ausgelassen schlugen sie sich mit den Hotelhandtüchern und rubbelten sich gegenseitig ab.
Sie beschlossen, ins Warme, in die hoteleigene Sauna zu gehen.
Auch in den Küstenorten der Bretagne war man in jenen Jahren nicht prüde. Obwohl man sich in Italien befand, wo normalerweise getrennt und mit Handtuch sauniert wird, gab es hier eine Gemeinschaftssauna. Um diese Tageszeit war sie leer. Die gesamte Saunalandschaft hatte eine verglaste Front mit Blick auf den See.
Dort schlug der Wind weiße Pfötchen und der Ortler-Gletscher schimmerte rötlich im letzten Sonnenlicht.
Als sie nach dem Saunagang im Ruheraum saßen, zog ein schmales Nebelband vom Pass und weiter am gegenüberliegenden Ufer entlang. Es wurde immer länger und fixierte ihre Blicke.
„Die Reschenschlange!“, stellte Klement vor.
Sie folgten gebannt ihrem Lauf. Schließlich verschwand die Schlange hinter der Staumauer, über die sie heute geradelt waren, und strömte hinunter ins Vinschgau Richtung Meran.
„Die Reschenschlange ist gefährlich. Sie verschlingt Touristen, die nur wegen eines Fotos ins Vinschgau kommen. Nur Liebespaare stehen nicht auf ihrer Speisekarte.“
Klement musste seinen Satz wiederholen. Als sie verstanden hatte, lachte Eveline lauthals und umarmte ihn.
Sie schlug vor, in ihrem Zimmer ein gemeinsames Nickerchen zu machen, bevor sie sich zum Vier-Gänge-Menü wieder unter die Leute mischten. Und sie ergänzte, sie nähme die Pille. Klements Herz begann zu hämmern.
Obwohl Klement seitdem die ein oder andere Nacht von Eveline träumte und ihm beim Gedanken an ihre Berührung heiß wurde, kam es immer noch vor, dass er schweißgebadet aufwachte, weil er gerade wieder einmal mit dem Auto die Serpentinen hinunterfuhr, die Bremsen versagten und das Auto unten im Fluss Fillière versank, begleitet vom Entsetzensschrei der Mutter.
DOLOROSA
1987 war Klement 21 Jahre alt. Mit seinem Studium der Betriebswirtschaft kam er gut voran. Er hatte das Grundstudium abgeschlossen und beschlossen, sich eine Auszeit zu gönnen.
Tagebuch führte er noch und die düsteren Eintragungen dieses Jahres waren bisher: „Im belgischen Hafen Zeebrugge kentert am 6. März die britische Fähre ‚Herald of Free Enterprise‘. Mehr als 200 Menschen ertrinken.“ Dahinter hatte Klement Bemerkungen angefügt, die zynisch klangen; ein noch unbekannter Zug an ihm.
Zum Jahresende sollte es noch schlimmer kommen: Mehr als 4300 Menschen ertranken bei der Havarie einer philippinischen Fähre. Zuvor hatte es im eigenen Land einen Politskandal gegeben, der Aufsehen erregte und mit einem Suizid endete: der Fall Barschel.
Am 11. Oktober wurde der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins in der Badewanne eines Genfer Hotelzimmers tot aufgefunden. An seinem Selbstmord blieben Zweifel. Auch Nachfolger Engholm hatte kein Glück. Er musste später aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit von allen Ämtern zurücktreten.
Klement hatte genug zu schreiben. Das Lebensrisiko hatte sich für ihn verschärft. Er glaubte der Statistik.
Seit Beginn des Studiums wohnte er in einer WG in der Türkenstraße. Die Mitbewohner wussten nichts von dem Geschäft im Tal, nichts vom Reichtum der Freys. Klement wollte leben wie andere Studenten auch.
Er tingelte mit ihnen durch die Studentenkneipen Tomate, Laila – später Alfonso’s, 111 Biere, zischte Bierchen und trank Persiko, hörte im Song Parnass Fredl Fesls Liedern zu und konnte nicht umhin, die eine oder andere Zigarette mitzurauchen. In den verqualmten Kneipen machte Rauchen und Nichtrauchen ohnehin keinen Unterschied.
Hannelore hatte vehement über seine stinkenden Klamotten geschimpft; mit ein Grund für Klement, auszuziehen und sich eine Bude zu suchen.
Natürlich gelangte er auch in Schwabinger Zirkel, in denen der selbst gedrehte Joint reihum ging. Er hielt das – wie Rauchen in Gruppen – eher für ein soziales Muss. Was, wenn man den Joint oder eine angebotene Zigarette ausschlug?
Einmal probierte er Meskalin, das ihm kanadische Hippies angedreht hatten. Klement hatte keine Ahnung von Drogen. Er fragte herum: Den Peyote-Kaktus konnte man kaufen, der Konsum war verboten. Das Verbotene lockte auch in Studentenkreisen, vor allem wenn es kostenlos war. Sein Kanadier hatte sich sogar eine Kapselmaschine gekauft. Zuerst schnitt er den Kaktus in hauchdünne Scheiben, trocknete diese auf Zeitungspapier auf dem Schrank und zerstampfte sie dann in einem Mörser zu Pulver. Mit der Waage berechnete er grob den Bedarf und füllte das Pulver in Kapseln. Die verschloss er maschinell.
Klement hatte die chemische Formel für Meskalin nachgeschlagen: C11H17NO3. Der Siedepunkt lag bei 312 Grad Celsius. Doch was nützte ihm das?
Nichts!
Diese Kapsel lag nun auf Klements Hand.
Da ihm der alleinige Konsum zu heiß schien, fragte er in seiner WG, wer bei einem Drogentest dabei sein wollte. Er brach die längliche Kapsel in zwei Teile und verteilte den pulvrigen Inhalt auf zwei Blätter Löschpapier.
Zu zweit wollten sie das Pulver schlucken. Der Dritte im Bunde sollte auf sie aufpassen, alles beobachten und hinterher berichten, was war.