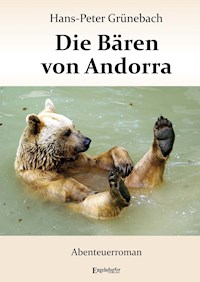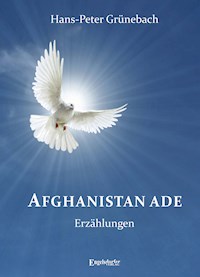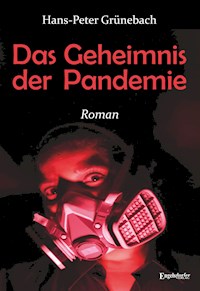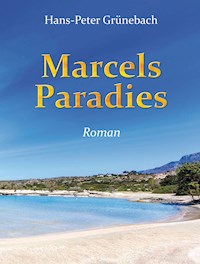
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der liebesenttäuschte Nachwuchsjournalist Marcel flüchtet mit seinem vierbeinigen Freund im 2CV nach unterhaltsamen Umwegen an die Algarve und findet dort schließlich sein privates Paradies. Eine erfrischend undogmatische Geschichte über die spirituelle Sinnsuche ganz unterschiedlicher Menschen, die mehr vom Leben erwarten als ein »all inklusive Buffet« am Rande des Jakobswegs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Hans-Peter Grünebach ist 1948 in Bogen an der Donau geboren und in Garmisch-Partenkirchen und München aufgewachsen. Berufliche Stationen führten ihn u. a. nach Berlin, in die Niederlande, nach Italien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Afghanistan. Ziele von Studienreisen waren China, Russland und die USA. Neben Lyrik und Prosa in zahlreichen Anthologien und Literaturzeitschriften sind von ihm Kurzgeschichten, Theater, Romane und Gedichtbände erschienen. Er lebt heute im Kloster- und Künstlerdorf Polling bei Weilheim in Oberbayern.
Hans-Peter Grünebach
Marcels Paradies
Roman
Engelsdorfer VerlagLeipzig2021
Alle Personen und Namen innerhalb dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Der Roman »Marcels Paradies« ist eine überarbeitete Ausgabe von »Sir Archibalds Seelenreise« erschienen 2012 im ehemaligen AAVAA-Verlag, Berlin.
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2021) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Dramaturgische Beratung: text & geschick, Wiesbaden
Lektorat: Marianne Kräft-Grünebach
Titelbild © Aliaksandr [Adobe Stock]
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
»Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar«
(Antoine de Saint-Exupéry)
KAPITEL 1
Beim Finanzamt München Mitte firmierte ich unter »Sir Charlie Douglas«. Alle Hunde der Bouchards zuvor waren adelige »Douglas« gewesen, eine Dackelhierarchie in der x-ten Generation.
Ich aber verzichtete Zeit meines Lebens auf das »Sir«, denn mein Vorname kam ganz gutbürgerlich von Scharlatan, französisch Charlatan. Der soll ich als Welpe gewesen sein, hatten mir Marcels Eltern beständig vorgebetet.
Das »Sir« blieb für mich deshalb gefälliger, aber unredlicher Beischmuck. So hörte ich nur auf »Charlie« und wenn mich jemand mit »Sir Charlie Douglas« zu sich rief, stellte ich mich einfach tot. Schließlich hatten es die Menschen verstanden. Man rief: »Charlie«.
Charlie der Erste, der Zweite oder der Dritte, das hing von der Phase meines Seins, oder, verständlicher, von der Reinkarnationsstufe meines Seins ab.
Inzwischen war ich ein in die Jahre gekommener Dackelrüde aus gutbürgerlichem Hause, der seit Marcels Kindertagen gut behandelt wurde und entsprechend unentbehrlich fühlte ich mich auch; bis Marcel eines Tages eine Geigerin nach Hause brachte, Isabell.
Zugegeben, sie roch zauberhaft nach Lavendel und Rosenöl. Wenn sie sich zu mir herunterbeugte, dann umhüllten mich ihre Locken zärtlich wie die Mähne einer mir bekannten Collie-Dame. Pure Sinnlichkeit spürte ich, wenn sie »braver Charlie« sagte. Und wenn sie mich mit ihren Elfen gleichen Fingern hinter den Ohren kraulte, dann verdrehte ich vor Lust die Augen und warf mich in ihren Schoß.
Meine Begeisterung für Isabell hielt so lange an, bis sie in Marcels Wohnung einen schmalen Koffer öffnete, ein Gerät mit einem lackierten Holzkorpus mit langem Hals hervorholte und begann, mit einem Stock aus Pferdehaaren über Darm- und Stahlsaiten zu kratzen. Das war nichts für mich und meine Schlappohren. Isabell musste weg.
Marcel hatte wohl ähnliche Gedanken, denn auf diese Zwei- Ebenen-Reise auf die Iberische Halbinsel nahm er nicht Isabell mit, sondern mich. An einem Sommertag nahm die Geschichte ihren Anfang.
Marcel saß in seiner kleinen Wohnung im Gärtnerplatzviertel beim Frühstück und las laut die Tageszeitung: »Eine schwergewichtige Ehefrau soll zusammen mit ihrer undankbaren Brut den Hoftyrannen zerstückelt und Teile des ehemals mächtigen Landwirtleibs an Hunde verfüttert haben? – Wie unappetitlich!«, murmelte Marcel vor sich hin und zog dann zweifelnd die jungenhafte Stirn kraus.
Er fragte sich, zu welchem Zeitpunkt die Seele des Malträtierten ihren irdischen Leib verlassen haben könnte, falls die Geschichte wahr wäre? – Ferner hätte er gerne auch erfahren, in welcher neuen Gestalt der getötete Bauer der Fortsetzung dieser Schlachtplatte hätte zusehen können.
Marcel musste lachen. Er glaubte natürlich nicht an Reinkarnation, wie angeblich die Mehrheit der Deutschen. Dennoch war es ihm manchmal, als wenn zwei Menschen in ihm um die Vorherrschaft rangen: Einer, der ihn an die Vergangenheit band, und ein zweiter, der ihn nach vorne schauen ließ.
Dem zukunftsgerichteten fühlte er sich meistens näher. Aber derjenige, der ihn an Gewesenes erinnerte, prägte ihn und bekam in Träumen ein Gesicht. Im Traum befand er sich meist in vergangenen Epochen. Manchmal hatte er im Schlaf eine Gestalt vor Augen, die einer ihm vertrauten, ähnlich war. Hie und da glaubte er sogar ihre Stimme zu hören, die ihn aufforderte: »Flieg, Marcel, flieg!«
Die Stimme war ihm aber fremd. Er konnte sie nicht zuordnen.
Einmal hatte er seiner Mutter von seinen Träumen erzählt. Sie holte sich sogleich Rat beim Vater.
»Er ist eben ein fantasievoller Junge. Vielleicht wird er einmal fantastische Geschichten schreiben wie Hugo, Balzac oder Maupassant; oder er wird gar ein Märchen-Poet wie der fliegende Saint-Exupéry«, hörte er aus dem Nebenraum.
Die Mutter unterbrach den Vater streng und wies ihn tadelnd/entrüstet auf Saint-Exupérys mysteriösen Flugzeugabsturz hin.
»Ja, natürlich starb der Autor des ›Kleinen Prinzen‹ zu früh«, war die Antwort, »aber möglicherweise ist die Seele des Schriftstellers ja um Marcel herum und unser Sohn ahnt etwas davon – wer weiß?«
Es war Marcel damals nicht klar, ob Vater scherzte. Auch verstand er nicht, warum Vater so betonte, dass er zu solchen Phänomenen nichts Erhellendes sagen könne. Parapsychologie und alle Formen der Esoterik waren, Vaters Meinung nach, Sache von Frauen. Überhaupt sei Mutter in Sachen »Mystisches« kompetenter als er, hörte Marcel ihn sagen.
Die Eltern sprachen manchmal über den Tod und über das religiöse Jenseits, ohne sich in den Unterschieden ihrer ursprünglichen Konfessionen – er Protestant, sie Katholikin, ihm zuliebe konvertiert – zu verlieren.
Robert Bouchard war bodenständig, für das Diesseits, für das Beweisbare zuständig. Das verlangte auch sein Beruf als Mathematik- und Physiklehrer an einem musischen Gymnasium in München.
Marcels Vater entstammte einer französischen Hugenottenfamilie. Seine Urururur-Großmutter Beatrice Croimare, die von 1632 bis 1730 lebte, heiratete einen Gaston Bouchard aus Marville an der Othain. Sie selbst kam aus Saint-Jean-lès-Longuyon, einer kleinen Gemeinde östlich von Marville. Von den drei Söhnen hieß einer Daniel. Dieser wurde Spitzenfabrikant in Paris. Er siedelte 1715 nach Bayreuth um.
Daniel Bouchard floh nicht aus religiösen Gründen. Das landesweite Pogrom an französischen Protestanten, welches als »Bartholomäusnacht« bekannt wurde, ereignete sich 143 Jahre vor Daniels Entschluss, ins Fränkische zu ziehen. Von seinem Ahn Daniel wusste Robert Bouchard nicht viel mehr. Aber, dass Daniels Sohn, Peter, Theaterintendant am Hofe zu Kulmbach-Bayreuth wurde, das stand in der Familienchronik.
Man kann annehmen, dass Peters Gönnerin Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen, die Schwester Friedrichs des Großen, war. Neben ihrer Rolle als Regentin war die eingeheiratete Marktgräfin auch Kunstmäzenin, Komponistin und Opernintendantin und prägte das kulturelle Leben der Stadt Bayreuth nachhaltig. Zur napoleonischen Zeit waren die Kirchen entmachtet, ihr Einfluss gering. Religiöse Fehden mussten hinter militärischen Waffengängen und einer politischen Neuordnung in Europa zurückstehen. Das Markgraftum Bayreuth, ehemals Preußen, war 1807 französisch geworden. Nach dem Tiroler Aufstand von Andreas Hofer gegen die Rekrutierungen für Napoleons »Grande Armée« wurde es im Pariser Vertrag von 1810 dem jungen Königreich Bayern zugesprochen. Dadurch unterhielt Bayreuth weiterhin gute Beziehungen zu Frankreich und Hugenotten machten Karriere. Nachzulesen war, dass Peters Sohn Friedrich Wilhelm bis zu seinem Tod 1825 Prediger zu Berlin, Professor für Mathematik und Direktor eines Erziehungsinstituts für adelige Zöglinge war. Weiterhin, dass von dessen sieben Kindern einer Steuerrat zu Köln und ein Enkel Direktor der Bergakademie in Berlin wurde. Alwine, die Frau dieses Enkels namens Wilhelm, hatte dem Stammbaum nach neun Kinder, von denen Sohn Oskar Sanitätsrat in München wurde. Danach hatten sich bis zu Robert alle männlichen Bouchards, wie Ahn Friedrich Wilhelm, der Mathematik verschrieben und hielten München die Treue.
Im Laufe der Generationen hatten die Bouchards gelernt, sich durch gesunden Realismus den bayerischen Gepflogenheiten anzupassen.
Immer aber hatten sie sich abstammungsbezogene Leidenschaften erhalten. Marcels Mutter nannte diese Neigungen »Vaters Marotten«.
So zog Vater die französischen Romantiker, Naturalisten und Realisten den deutschen vor, wie er es auch mit den alten Meistern der Malerei hielt, als gehörten sie zu seinem Familienverband.
Dass er zudem nur Briefmarken und Münzen der »Grande Nation« sammelte und nur Anzüge, Schuhe, Uhren aus »La France« trug, gaben ihm das Image eines Individualisten mit einem, von einigen belächelten, ganz persönlichen »französischen Stil«.
Dabei war Robert durchaus stolz, Münchner zu sein. Er kannte alle drei Strophen des Bayernliedes und hatte die bayerische Hymne sogar ins Französische übersetzt. Aber er konnte auch die Marseillaise schmettern.
Nur einen einzigen deutschsprachigen Autor verehrte er sehr: Theodor Fontane. Ob es an dem Nachnamen lag?
Den John Maynard rezitierte er immer, wenn sie auf dem Starnberger See oder auf dem Ammersee mit dem Ausflugsdampfer unterwegs waren. Auf Effi Briests Wandlung kam er meist zu sprechen, wenn der Haussegen schief hing. Den Archibald Douglas sang er an, wenn Mutter zu kritisch mit seinen Marotten ins Gericht ging, oder wenn ihm nach Singen zumute war. Marcels Dackel wurde nach ihm benannt.
Jeden Herbst zur Obsternte erinnerte Vater seine Familie beim Spazierengehen an Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Havelland und an dessen Birnbaum im Garten.
Einmal konnte Marcel seinem Vater zuhören, wie der sich politisch ereiferte. Es war schon spät am Abend. Vater hatte Kollegen zu Gast. Jemand war auf das militärische Engagement der Sowjetunion am Hindukusch zu sprechen gekommen. Da zitierte Vater aus dem Stegreif Fontanes »Trauerspiel von Afghanistan«: »Wir waren dreizehntausend Mann/ Von Kabul unser Zug begann/ Soldaten, Führer, Weib und Kind/ Erstarrt, erschlagen, verraten sind/.
Zersprengt ist unser ganzes Heer/ Was lebt, irrt draußen in Nacht umher/ Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt/ Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt.«
Vater hatte volle Aufmerksamkeit und nutzte diese, um schnell noch mit bebender Stimme den letzten Vers nachzuschieben: »Die hören sollen, sie hören nicht mehr/ Vernichtet ist das ganze Heer/ Mit dreizehntausend der Zug begann/ Einer kam heim aus Afghanistan.«
Das Gespräch verstummte. Bald danach verabschiedeten sich die Gäste.
Vater liebte Fontane nicht nur, weil der auch hugenottenstämmig war, sondern, wie er sagte, weil Fontane zu seiner Zeit in Dichtung und Prosa Zusammenhänge überblicken und Probleme wirklichkeitsnah beschreiben konnte.
Mutter hatte Marcel damals in den Arm genommen. »Solche Träume sind nicht ungewöhnlich«, sagte sie und forderte ihn auf, ihr von seinen nächtlichen Erlebnissen zu berichten; »Träume muss man aufarbeiten!«
Dem folgte er anfangs und fühlte, ihr körperlich nahe, auch eine tiefe seelische Verbindung. Später, mit der Pubertät, wuchs die Distanz zur Mutter, und mit zunehmendem Abstand nahm die Häufigkeit ihrer Gespräche zu diesem Thema ab.
Marcel hielt seine Träume später für »Kinderei«; sie wurden ihm peinlich. Er begann darüber zu grübeln, was mit ihm nicht stimmte. Im Ergebnis fühlte er sich richtig krank. So wie die Träume kamen und gingen, kamen Depressionen auf und verschwanden wieder.
Mutter hatte seinetwegen ihr Soziologie-Studium an der LMU abgebrochen. Sie wollte nur ein Kind und das kam zu früh für eine berufliche Karriere. Da die eigenen Eltern weiter weg wohnten und die Münchner Schwiegereltern schon gestorben waren, hatte sie von dort keine Hilfe zu erwarten. So hatte sie sich für Marcel entschieden. Sie wollte für ihn da sein und seine Entwicklung mitgestalten.
Ihr Mann hatte sie nicht zu diesem Entschluss gedrängt. Er war geduldig und bemüht, Lebensräume anderer zu respektieren. Allerdings war Robert, trotz Marcels früher Ankunft, auch nicht unfroh über den Gang der Dinge. Die nicht berufstätige Ehefrau gab ihm Rückhalt und Ausgleich. Sein Leben verlief so harmonischer. Er war dadurch weniger der »Sonderling«. Zu Hause war sie der Fixstern, um den alles kreiste, und nicht er.
Mutter nahm Marcel früh mit ins Theater, in Konzerte und mit zum Sport. Sie selbst belegte Sprach- und Malkurse und beschäftigte sich in einer »Autorenwerkstatt« mit kreativem Schreiben.
Oft durfte Marcel dabei sein. So begann für ihn schon früh die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Genres der Literatur. Er begann Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben.
Mutter selbst verfasste ein Kinderbuch, in dem sie über die Abenteuer der Hundedame »Josephine«, deren Sohn »Arthur« und das Feldhasen-Waisenkind »Blitz« schrieb und es selbst illustrierte.
Marcel erschien der Plot weit hergeholt. »Blitz« nahm in dem Buch die Seele von »Arthur« in sich auf, als dieser versehentlich von einem Jäger erschossen worden war. Marcel glaubte, dass seine Mutter versucht hatte, einzelne Erlebnisse mit ihm und seine Charakterzüge darin zu verarbeiten. Das Werk war ihm gewidmet. Seine Mutter hatte ihn mit dem goldgeprägten, in hellrotem Iris-Leinen gebundenen Buch zu Weihnachten überrascht.
Der Inhalt erschloss ihm mehr vom Inneren der Mutter und offenbarte ihre Neigung, Tieren menschliche Eigenschaften und Sprache zu geben. War ihr Glauben an die Reinkarnation ernst? War sie von der Wanderung der Seelen überzeugt oder spielte sie das Seelenwandern nur mittels ihrer Sprache?
Derlei Überlegungen hatte der kindliche Marcel natürlich noch nicht angestellt. Mutter hatte Marcel vom Leben und Sterben der griechischen Götter erzählt. Sie war damals für ihn Hera, Pallas Athene und Aphrodite zugleich. Später war sie seine Vertraute, wenn er von seinem Wunsch sprach, fliegen zu lernen. Sie hatte eingeschränkt: »Aber nicht wie Ikarus!«
Sie und sein Onkel Paul waren die Einzigen, die sein Faible für alles, was flog, ernst nahmen. Das schloss Flugzeuge, Vögel und Insekten ein.
Er sammelte Schmetterlinge, bastelte Cessna-Modelle, fuhr mit dem Fahrrad zum Flughafen und malte sich mit den Starts und Landungen die Länder und Städte aus, von denen die Flugzeuge kamen und zu denen sie flogen.
Der Onkel hatte ihn als kleiner Junge einmal auf den Besucherhügel mitgenommen und ihm von seinem fliegenden Großvater, aber auch von Antoine de Saint-Exupéry, von »Wind, Sand und Sterne«, dem »Flug nach Arras« und vom »Kleinen Prinzen« erzählt.
Mutter hatte Marcel die Bücher gekauft, als er ihr von dem Gespräch mit Onkel Paul berichtet hatte.
Erst als er sich selbst zunehmend analytisch orientierte fiel ihm auf, dass seine Mutter in einer ganz anderen Welt unterwegs war. Das fand er einerseits peinlich, anderseits aber auch mutig.
Mutter hatte sich irgendwann verstärkt für paranormale Phänomene interessiert, solche, welche die Naturwissenschaften nicht beweisen konnten.
Sie stritt mit Vater häufiger über Telepathie, und der riet ihr heftig ab, zu den Sitzungen zu gehen, bei denen sie lernen wollte, Gedanken zu lesen. Dann nahm sie gar an einem Hellseher-Zirkel teil; und lernte, mit Pendel, Tarot-Karten und Glaskugel in die Zukunft zu blicken.
Eines Tages fand Marcel auf der Suche nach einem Fotoalbum seines Urgroßonkels mit Luftbildaufnahmen aus dem ersten Weltkrieg in Mutters Regal ein Buch mit düster-rotem Cover, das einen Satanshimmel beschrieb. Das Lesezeichen markierte das Kapitel »Hypnose und Suggestion in der Liebe«. Er blätterte und erschrak bei dem Gedanken, in welch wirklichkeitsfremder Welt sich seine Mutter bewegte. Andererseits bewunderte er ihre Neugier, an einem literarischen Hypnoselehrgang teilzunehmen. Dabei ging es um Schwarze Magie und Hexenrituale.
Marcel konnte nicht anders, als den Band an sich zu nehmen, in der Hoffnung, seine Mutter würde bei so vielen Büchern dieses eine nicht vermissen.
Noch in der Nacht schmökerte er darin und fand den Unterschied zwischen Magie und Zauberei erklärt, dazu praktische Beispiele. Er staunte über Anleitungen zum Tischrücken und ohne Hilfsmittel zu schweben. Manches überflog er nur, anderes las er genauer. Er bekam eine Vorstellung, wie man die Zukunft mittels Buchstechen vorhersagte. Er erfuhr, dass es im 13. Jahrhundert einen Codex Gigas, eine Teufelsbibel, gegeben haben soll, und wie man Merkmale für die Anwesenheit des Satans erkennen könne. Auch las er in dem Buch über die Sieben Todsünden und ihre Zuordnung zu den Dämonen, eine Anleitung zur Geisterbeschwörung, über den historischen Doktor Faustus und seinen Teufelspakt mit Mephistopheles. Natürlich war Goethe zitiert.
Das Zauberbuch »Clavicula Salomonis« erregte seine augenblickliche Neugierde. Über die Bedeutung der mathematischen, geometrischen Zeichen »Siegel«, »Charaktere«, »Signaturen«, konnte er später mit seinem Vater reden. Allerdings hatte auch der nur eine blasse Ahnung von den Bedeutungen; versprach aber, sich zu informieren.
Das Siegel eines Geistes sei bei einer Beschwörung die Hauptsache, hieß es in Mutters Buch; daher müsse die Bedeutung des Siegels vorher genau studiert werden. Mit Hilfe eines solchen Zeichens könne man sogar Erzengel auf die Erde herabziehen und diese durch Zauberworte beeinflussen. Was bei den Beschwörungsformeln zu beachten sei, und was Wörter wie »Shemhamphorash« in der Magie bedeute, verwirrte Marcel. Letztendlich schlug er den Satanshimmel ermattet zu. Er schlief trotzdem traumlos und stellte das Werk zwei Tage später unauffällig an seinen Platz zurück.
Schon früher hatte seine Mutter eine Zeitlang Kontakte zu einer spirituellen Gruppe gepflegt, die ihre Reinkarnationserfahrungen untereinander austauschten, sich auch zu Geheimsitzungen trafen.
Marcels Mutter muss von den mysteriösen Stimm-Erscheinungen ihres damals vierzehnjährigen Sohnes erzählt haben. Als er seine Mutter das nächste Mal zu einer nicht geheimen Sitzung begleitete, wollten einige Teilnehmer von seinen Erscheinungen »aus erster Hand« hören. Er tat ihnen den Gefallen, fühlte sich dabei aber seelisch ausgezogen. Obwohl er das zustimmende Nicken des einen oder anderen wahrnahm, war es ihm, als würden ihn manche für einen Aufschneider halten. Er spürte die Röte im Gesicht. Sein Herz pochte und seine Hände wurden feucht. Sie zitterten. Wieder einmal glaubte er, krank zu sein.
An jenem Abend war auch eine mollige Juliane zugegen, deren Hund kurz zuvor an Krebs gestorben war. Sie behauptete, ihre tiefe seelische Beziehung zu dem verstorbenen Vierbeiner habe die Seele ihres Rüden reisen und in ihre neue Hündin »Lisa« schlüpfen lassen. »Lisa« sei ein Charakter-Spiegelbild des alten Weggefährten.
Es folgte eine einstündige Diskussion zu den Möglichkeiten und Bedingungen, unter denen Julianes Annahme zutreffen könnte.
Während dieser Debatte war es Marcel langweilig geworden. Er war an der Seite seiner Mutter eingenickt, bis sie ihm einen Stups verpasste. Alle blickten auf ihn. Er rappelte sich in seinem Stuhl hoch. Die Situation war ihm hochpeinlich.
KAPITEL 2
Marcels Schulzeit war ohne größere Schwierigkeiten verlaufen. Was hätte bei solchen Eltern auch passieren können. Sein sehnlichster Wunsch, fliegen zu lernen, wurde schon als Jugendlicher wahr. Die Eltern hatten ihm den Segelflugschein finanziert.
Aber erst als Erwachsener hatte er mit Hilfe seines Onkels Paul seine Pilotenprüfung für Motorflugzeuge ablegen können. Marcels Lieblingsonkel war bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hatte Marcel Geld für die Fluglizenz hinterlassen. Die fünfundvierzig Flugstunden waren Marcels Erbanteil.
Seine Mutter schenkte Marcel als Anerkennung zur bestandenen Prüfung einen Ring mit einer Triskele. Das Motiv darauf stellte ein keltisches Sonnenrad dar. Mutter erklärte den dreifachen Wirbel dieses Symbols als Glücksbringer, als »Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft« auch »Dreieinigkeit von Körper-Geist-Seele«, »Geburt-Leben-Tod« oder »Werden-Sein-Vergehen«. Die Triskele sollte Marcel als Schutzamulett gegen negative Kräfte dienen und ihn stets heil auf die Erde zurückbringen.
Marcel traute der Schutzwirkung des Ringes wohl nicht ganz. Auf seinen Flügen nahm er neben »Headset«, Luftfahrtkarten, Flugbuch und Lizenzmappe, Mutters Triskele und zusätzlich eine Taschenbuchausgabe des »Kleinen Prinzen« mit. Dessen Autor Antoine de Saint-Exupéry war dem »Kleinen Prinzen« schließlich nach einem glücklich überlebten »Crash« begegnet. Das Büchlein war deshalb sein »geheimer Talisman«.
Danach gefragt, betonte er stets, nicht abergläubisch zu sein.
Für Marcel waren Glaube, Aberglaube und Reinkarnation keine neuen Themen. Er schloss die Vererbung von Seelen in seiner Lebenswelt nicht aus. Aber es fehlte ihm die letzte Überzeugung. Diese machte er abhängig von Beweisen. In seinem pragmatischen Denken war er doch ganz nach dem Vater geschlagen.
Zwar zweifelte er an der göttlichen Offenbarung von Bibel, Talmud und Koran, aber er war als Journalist neugierig genug, sich für die monotheistischen Weltkirchen und ihre noch gültigen oder gewesenen Seelenwanderungslehren zu interessieren. Immerhin standen auch seine Vorväter im frühen Christentum Wiedergeburtslehren nahe. Religionen, die das Vorhandensein einer Seele voraussetzten, beschäftigten sich immer auch mit deren Präexistenz. Wo Präexistenz möglich erschien, war das Weiterleben nach dem Tod im Himmel oder in der Hölle nah.
So wurde der »Siebte Himmel« im Talmud beschrieben.
Die einstige Rabbiner-Lehre ging in den Koran über und fand durch ihn weite Verbreitung. Der »Siebte Himmel« erhielt sich in Sprichwörtern christlicher Kulturkreise.
»Ich fühle mich wie im siebten Himmel!«, hatte Marcel schon öfter ausgerufen, auch in seiner ersten Liebesnacht.
Sie hieß Lucy. Sie hatte ihn verführt, und er hatte ihrem reifen Körper keinen Widerstand entgegengesetzt.
Lucy hatte rot leuchtende Haare wie Milva und duftete nach erfahrener Frau. Die selbstbewusste Lucy war mit ihren sechsunddreißig Lenzen auch ungebunden glücklich. Sie wollte die Gegenwart genießen und von einem Vor- oder Nachleben nichts wissen.
Lucy freute sich über seinen »Siebten Himmel« wollte ihn aber nicht auf Dauer mit Marcel teilen.
Ein ganz anderer »Siebter Himmel« beschäftigte ihn nun als Hort des Rechts, des Gerichts und der Gerechtigkeit auch beruflich, denn er sollte einen Essay zum religiösen Hintergrund derjenigen verfassen, die unter Berufung auf Gott, inmitten einer Menschenmenge Sprenggürtel, Minen oder Bomben zündeten. Er musste über Djihadisten und Märtyrer, wie sie die eine Seite bezeichnete, über islamischen Terroristen, wie sie die »Westliche Welt« nannte, schreiben und in vier Wochen ein ausgewogene Text dazu abliefern. Den Großteil der Recherche hatte er bereits ausgedruckt und wasserdicht verpackt.
Marcel überflog nochmals die Notiz über die »Schlachtplatte« auf dem Bauernhof und beendete die Beschau mit der gleichen banalen Frage, die sich wohl alle Leser dieses Artikels stellten: »Wer macht denn sowas?« Er nahm die Scheibe Toast aus dem Brotröster, bestrich sie und kaute nachdenklich auf dem angekokelten Stück herum. Er legte das Thema Inkarnation vorläufig zur Seite und begann, situationsbedingt, über die Krebsgefährdung durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe zu grübeln.
Marcel bewegte die bittere Süße der Quitten-Marmelade mit der Zunge hin und her – als nähme er an verschiedenen Stellen des Gaumens Geschmacksproben. Sollte in seinem Hals ein Geschwür heranwachsen, wie er aufgrund häufiger Heiserkeit hypochondrisch spekulierte, so wäre ihm das jetzt egal. Die fruchtige Quitte aus Mamas Produktion überdeckte die bitteren Rußpartikel des Toasts, so dass Marcel seine tiefsitzende Sterbensangst vergaß, ein »Running Gag«, wie er im Münchner Mittelstand häufiger vorkommt; wohl eine der sozialen Folgen eines aus dem Ruder gelaufenen Millionendorfs.
Er las weitere Weltnachrichten, die ihm den Atem stocken ließen, wie die Opferzahlen der Flut-Katastrophe in China, die eines Erdbebens in Indonesien und die einer Kampfdrohne im pakistanischen Grenzgebiet.
Jemand schlug mit dem Klöppel an seine »Berta«, die Glocke, die einst einer Braungefleckten am Ende einer Ledermanschette am Hals hing. Marcel hatte einst mit seinen Eltern Ferien auf einem Bauernhof gemacht. Wegen seuchenhaften Klauenbefalls wurde seine Lieblingskuh Berta zum Schlachten geführt. Marcel war noch ein Kind und weinte um Berta. Die Bäuerin hatte Mitleid mit ihm und ihm ihre Glocke vermacht. »Immer wenn du diese Glocke hörst, schaut dir Berta aus dem Himmel zu«, sagte sie. Seitdem war das Allgäuer Souvenir seine Verbindung zum Himmel.
Die Türklingel, wie sie der durchschnittliche Münchner besitzt, hatte Marcel wegen des, seiner Meinung nach, unnötigen Stromverbrauchs abgeklemmt. Seitdem störte seine mit Klee und Gänseblümchen bemalte Berta zwar die Hausbewohner, das Almgeläut erreichte Marcel aber auch dann im Tiefschlaf, wenn er eine ganze Flasche Châteauneuf-du-Pape geleert hatte, ein Tropfen, der ihn normalerweise in seinen Siebten Himmel beförderte.
In der Annahme, es wäre die Nachbarin, Frau Kostanidis, von der er ein Moussaka-Rezept erwartete, wickelte er seinen blau-weißgestreiften Morgenmantel enger.
Die warmherzige Archäologin Dr. Irene Kostanidis hatte ihn bei einer Führung durch die Glyptothek in ihren Bann gezogen. Dort erst fanden sie heraus, dass sie Nachbarn waren. Sie könnten sich ja ergänzen, befanden sie.
Sich der Gleichfarbigkeit bayerischer und hellenischer Farben seiner Oberbekleidung bewusst, zog er den Gürtel zusammen und schlurfte in seinen Lederpantoffeln zur Wohnungstür.
Aus dem Gemenge dahinter hörte er nicht den Stakkato-Sopran von Frau Kostanidis, sondern eine kräftige Frauenstimme mit einem ihm bekannten Akzent: »Hallo, Marcel. Wir sind es, Adri und Trijnie. Können wir dich besuchen?«
Marcel war perplex; ohne Anruf, ohne Ankündigung, so früh am Tag? Er öffnete die Tür. Da standen tatsächlich seine niederländischen Freunde.
»Die Maastrichter sind an Spontanität ja nicht zu überbieten. Was macht ihr denn hier?«
»Wir sind immer für unsere Freunde da, besonders für die aus München«, lachte Trijnie, »du weißt doch, Marcel, wir mögen mit unseren Freunden gerne trinken und lachen. Sind wir fruh? Schleepst du nok?«
»Nein, nein, kommt rein. Ich freu mich!«
Da waren sie nun, der Lulatsch und seine über einen Kopf kürzere pausbäckige Freundin, suchten Quartier und breiteten die Arme aus.
Marcel vermied normalerweise Körperkontakt, gerade, wenn er noch nicht rasiert und angezogen war.
Trijnie jedoch ahnte davon nichts, als sie ihn umarmte und ihm je zweimal links und rechts einen Kuss auf die Wangen drückte. Der schlaksige Adri gab ihm die Hand und lächelte, die Schultern zuckend, verlegen.
Marcel winkte die beiden durch den dunklen Garderobenflur in sein Wohn-Esszimmer.
In der Kochnische warteten Geschirr und Gläser des Vorabends auf Abwasch. Marcel kippte das Fenster zur Straße, ließ Verkehrslärm ein und das Gemisch aus abgestandenem Wein, verbranntem Toast und Damenbesuch hinaus.
Den für seine jungen Jahre und der fast rheinischen Frohnatur mit runden zwei Metern alles überragenden Adri und die spontane, rotblondgelockte Trijnie mit üppiger Oberweite, hatten Marcel und Isabell vergangenes Jahr am freien Strand von Les-Saintes-Maries de la Mer kennengelernt. Ein Unwetter und beider Kult-Enten hatten sie zusammengeführt.
Der Plage Libre war überflutet. Das Wasser hatte alle Camper mit ihren nicht weggeschwemmten Zeltutensilien zum Rückzug auf den trockenen Hauptplatz an der Promenade gezwungen. Durchnässt und übernächtigt fanden sich die Havarierten zu einem gemeinsamen Rührei-Frühstück zusammen.
Die feuchten Klamotten waren zwischen den Autos auf Zeltspannschnüren zum Trocknen aufgehängt. Die Gestrandeten überboten sich gegenseitig an optimistischen Wetterprognosen, obwohl die Regenwolken weiterhin beängstigend tief über sie hinwegfegten. Es sah eher aus, als ob der Regen die Camargue für alle Zeit in ein Aquarium verwandeln wollte.
»Ich will nach Südfrankreich, diesmal aber auf die Atlantikseite«, erzählte Marcel, nachdem er den beiden eine Flache Sprudel und zwei Gläser hingestellt hatte. »Leider will Isabell nicht mit. Wir haben uns zerstritten.«
»Das ist aber schade; wegen der Geige?«, fragte Trijnie mit einem Augenzwinkern.
»Nein! Die Geige macht mir wenig aus. Die mag nur Charlie nicht. Er ist gerade bei ihr. Ich werde ihn mitnehmen.« »Was ist dann passiert?« Trijnie wollte es genau wissen.
»Isabell hat mir gestern Nacht erklärt, dass sie auf die Reise verzichten werde. Dem war eine heftige Debatte um die Wegstrecke und die Art der Unterkünfte vorausgegangen. Während ich von Roncesvalles-Novarra auf dem bekannten Camino Francés zu Fuß nach Santiago de Compostela zum Grab des heiligen Jakobus wandern, in Pilgerherbergen nächtigen, und mit Zug oder Bus an den Ausgangspunkt zurückfahren wollte, favorisierte Isabell den Camino de la Costa, das Auto als Transportmittel. Und sie bestand auf vorgebuchte Hotels.«
»Du wolltest deine Charleston-Ente stehen lassen?« Adri konnte nicht glauben, dass Marcel zu Fuß pilgern wollte.
»Isabell meinte, dass genügend Schriftsteller bereits über die überfüllten Massenunterkünfte geschrieben, und dass die Reiseplanung der Vorjahre ein Fehlschlag gewesen war. Und, dass man doch erkannte Fehler nicht wiederholen müsse. Und dann sagte sie noch, dass meine Planung doch keine sehr intelligente Lösung sei. Außerdem habe sie Angst, sich bei den Kletterabschnitten die Hände zu verletzen; die brauche sie aber für ihr Spiel, hatte sie geklagt. Isabell befürchtete zudem, den Anstrengungen der Gepäckmärsche nicht gewachsen zu sein.«
»Da war Isabell aber viel zu streng mit dir, Marcel«.
Trijnie streichelte Marcel wie zum Trost über die Schulter. »Da mein Einkommen als Jungredakteur große Sprünge neben dem Hobby ›Fliegen‹ derzeit ausschließt, meine jüngsten Ersparnisse in Waschmaschine und Mobiliar stecken, stand Isabells Statement ›Dann fahr ich eben nicht mit!‹ am Diskussionsende unüberbrückbar zwischen uns.«
»Und das war alles? Für ein Ende zwischen euch genug?«
Trijnie fasste es nicht, bis Marcel die Situation klärte: »Nun, es hatte auch noch andere Differenzen gegeben. Eigentlich wollten wir gemeinsam pilgern, um die Festigkeit unserer Beziehung zu prüfen. Aber Isabell war nach der Debatte so erregt, dass sie sich grußlos aufmachte und, neben ihrem Geigenkasten, nur wenig Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft hinterließ.«
Noch einmal streichelte Trijnie Marcel tröstend, diesmal seine Hand, die ihr nahe war. Adri schaute verlegen. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Ihm lag ein Sprichwort auf der Zunge, das er einer deutschen Mitschülerin einmal in ihr Poesiealbum geschrieben hatte: »Eine Freundschaft die ein Ende fand, niemals echt und rein bestand.« Doch er sagte nichts.
KAPITEL 3
Marcel war inzwischen rasiert, in seine Jeans geschlüpft und hatte drei Tassen Café Crema aus seiner Kaffeemaschine in Becher mit kitschigen Hundemotiven laufen lassen.
Dann überließ er die beiden eine Weile einer Mittelmeer-Fotoshow des vergangenen Jahres auf seinem voluminösen Laptop.
Adri und Trijnie fanden sich dort beim Beach Volleyball und als Schiffsbrüchige bei Spiegeleiern mit Speck wieder.
Marcel klingelte bei seiner griechischen Nachbarin: »Könnten Sie mir bitte Milch für den Kaffee borgen, liebe Frau Kostanidis?«
»Ich kann Ihnen doch keine Bitte abschlagen, Herr Marcel, und warten Sie einen Augenblick, ich bringe Ihnen auch das versprochene Moussaka-Rezept.«
Marcel wartete kurz, bis sie auch das versprochene Kochrezept gebracht hatte.
Marcel warf Frau Kostanidis ein Luftküsschen zu und kehrte zu seinen Gästen zurück.
Später knurrte Adri hörbar der Magen. Die Drei verständigten sich, etwas essen zu gehen. Adri und Trijnie waren nachts gefahren und kämpften tapfer gegen Hunger und Müdigkeit. Der Kühlschrank des Junggesellenhaushalts war wegen der anstehenden Reise leer.
»Auf dem Viktualienmarkt könnten wir Matjes essen«, schlug Adri vor.
»Besser, wir machen eine typisch bayerische Brotzeit – ihr sollt etwas von der bayerischen Seele erfahren«, entgegnete Marcel.
Adri fügte sich. Er war neugierig.
Es war nur eine Viertelstunde Weg von Marcels Mansardenwohnung in der nahe an der Isar gelegenen Kohlstraße bis zum »Spöckmeier«.
Dorthin führte Marcel routinemäßig Freunde, die von auswärts kamen. Es war für ihn ein Ritual, das ihn nicht viel Kraft kostete.
Marcel hatte sich als Student durch Altstadtführungen manche Mark mit Gruppen erwandert und sich dadurch mehr leisten können als seine Kommilitonen.
Für ausländische Freunde war der Gang mit ihm also ein »Muss«.
»Ihr wisst, dass ich als Fremdenführer vielen Touristen München gezeigt habe. Ich bin ›Altstadtprofi‹ und auf Leute wie euch programmiert«. Er lachte. »Beim ›Spöckmeier‹ gibt es jedenfalls die besten Weißwürste Münchens«. Adri und Trijnie zogen mit.
Sie gingen über den Isartorplatz, durchs »Tal« vorbei am »Alten Peter« und am Rathaus mit seinem Glockenspiel. Das war leider vorbei.
Vom Marienplatz wandten sie sich links zur Rosenstraße. An der Fassade des Sporthauses Schuster erinnerte eine Metalltafel an die Familie Spitzweg. Gegenüber lud ein in schlichtes Schmiedeeisen eingerahmtes »Paulaner München«-Wappen mit einem bescheidenen Schriftzug in blau zum »Spöckmeier« ein.
Das Traditionswirtshaus bayerischer Gaumenfreuden betraten sie durch dessen blaugestrebte Glastür, welche die ehemals massive Holztür ersetzt hat, um mehr Licht einzulassen und um dem angewachsenen Kundenverkehr gerecht zu werden.
Marcel steuerte auf das »Weißwurst Stüberl« zu.
Adri tat mit seinem belustigenden Akzent kund, dass er schon über die »Münchner Weißwurst« gelesen habe. Seine Erinnerungen seien jedoch bruchstückhaft und bräuchten unbedingt eine Auffrischung. »Wir brauchen da etwas Nachhilfe«, sagte er.
»Daran soll es nicht mangeln!« Marcel bemühte sich, dem erhöhten Geräuschpegel gerecht zu werden.
»Mit nur einer Unterbrechung in Paris habe ich meine gesamte Schul- und Studienzeit in München verbracht. Ich werde euren Wissensdurst stillen können.«
Sie hatten Platz genommen.
»Die wichtigste Frage, die ich mir selbst stelle, ist, warum wir diese Würste so gerne essen, wenn achtundfünfzig Prozent der Bayern an Reinkarnation glauben und in jedem Schwein, in jedem Rind, in jedem Kalb die Wiedergeburt von König Ludwig dem Zweiten, Heinrich dem Löwen oder Ludwig dem Bayer stecken könnte. Müssten wir dann nicht beim Vertilgen von Schweinsbratwürstchen, Rinderfilets oder Kalbshaxen mehr Hemmungen haben; so auch beim Verzehr von Weißwürsten, oder?«
Marcel erwartete keine Antwort.
Sie hatten den mittleren Vierertisch auf der rechten Seite belegt, unweit des blauen Kachelofens. Der Platz ließ den Blick auf die Schiebetür zu, durch die Kellner mit schwarzen Hosen, weißen Hemden und rosa-, oder grüngemusterten Westen und Bedienungen in blauen Dirndln, weiße Blusen darunter und Schürzen mit feinen rot-weißen-Karos darüber, ein und aus gingen.
Marcel deutete auf die Fotogalerie vor der Holzvertäfelung und forderte die beiden auf, das Geschehen Drumherum im Auge zu behalten, um die »Bayerische Seele« in sich aufnehmen zu können.
Adri und Trijnie ließen die Stimmung auf sich wirken.
»Bayerische Seele?« Trijnie deutete fragend auf den Nachbartisch.
In der Mitte des Raumes wartete eine gemischte Gruppe junger, italienischer Touristen, gegen die ihnen sonst nachgesagten Gewohnheiten, andächtig-ehrfurchtsvoll auf ihre bayerische Kultwurst und wusste nicht, was sie mit dem vor ihnen stehendem Weißbier anfangen sollten. Der Kellner erlöste sie, indem er Berge von Brezeln vor ihnen aufbaute.
Auf der Kachelofenbank versuchte eine schlanke Business-Dame im marineblauen Modell-Kostüm und flinken Augen, sicher Assistentin einer Geschäftsleitung in Mutterschaftsurlaub, Pflichten gegenüber dem Baby und Manager-Aufgaben in Einklang zu bringen. Die schöne Erscheinung hielt mit einer Hand ein Skript, las einen Vortrag und versuchte mit der anderen ihrem Kind, das aus einer noblen Karosse bisher nur in den hölzernen Himmel des Weißwurst-Stüberls blicken konnte, einen Schnuller in den Mund zu stecken.
Die oder der Kleine schien nicht einverstanden zu sein; das Kind begann zu plärren. Nun erst wurde die Mutter gewahr, dass hier jemand schrie, der seine eigenen strengeren Maßstäbe anlegte und Aufmerksamkeit einklagte.
Die Mama legte ihren Vortrag zur Seite, hob das Kind aus dem Wagen und legte es sich an die Brust.
Das milliardenfach erprobte Mittel wirkte; aber Trijnie schüttete sich aus vor Lachen.
Das war ihr dann so peinlich, dass sie schnell in Richtung einer gastwirtlichen Darstellung an der Gegenwand zeigte, um von dem Dürer-Motiv »Maria und Kind« abzulenken.
Nun drehten sich andere Gäste um, schüttelten fragend die Köpfe und wollten wohl wissen, was an der Relieftafel »Der Götter Bachus & Gambrinus X Gebote« oder an der bemalten Sieger-Holzscheibe eines Schützenwettbewerbs aus dem Jahre 1891 wohl so lustig sei?
Marcel bestellte.
Rechts von ihnen saß ein Alter mit Hut, eine Krücke neben sich, beim Tee. Das war für diesen Schankraum schon merkwürdig. Auch verrieten das runde unglückliche Gesicht mit seinen roten Flecken und der enorme Bauch, dass sein Träger sich bislang ganz anderen Getränken gewidmet hatte. Die Gewohnheit und die Erinnerung an bessere Zeiten führten ihn wohl weiterhin zum »Spöckmeier«. Die ärztliche Empfehlung zwang ihn wohl zu dem Kulturbruch mit einem magenfreundlichen, grünen Tee.
Adri klagte über hölzerne Tischbeine, die im Weg standen, die das Geraderenken seiner Beine verhinderten. Auch war ihm das Pölsterchen auf der Sitzbank nur ein Hilfsmittel beim Verrutschen niederländischer Hünenknochen.
Über den Tischen lag das Aroma von Hopfen, Laugenteig und Brühe. An den Wänden zogen verblichene Fotografien von Wirtshausmotiven an den Hungrigen vorbei und erweckten Halluzinationen.
Auf den Tischen sorgten Stiefmütterchen für Andersfarbigkeit. Servietten und Platzdeckchen zeigten ihre kitschigen weiß-blauen Muster. Sie reklamierten bayerisches Selbstverständnis und Landesstolz.
Das Warten überbrückte Marcel durch seine Version der Geschichte der Münchner Weißwurst: »Adri, du hast doch gelesen, dass die Weißwurst mit süßem Senf gegessen wird; dazu Brezeln und Weißbier. Aber wisst ihr auch, wie sie entstanden ist?«
»Natuurlijk niet, Marcel, je moet dat vertellen!«
Das Thema schien Trijnie wachzuhalten. Sie rutschte auf ihrem Stuhl nach vorn, setzte beide Ellenbogen auf, so wurde ihr rosa Korallenarmband und ein Ornamente-Tattoo sichtbar, stemmte die Hände unter das blondflaumige Kinn und schürzte die sinnlichen Lippen.