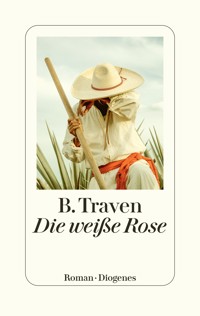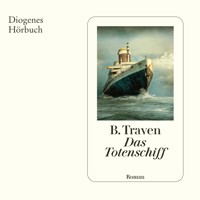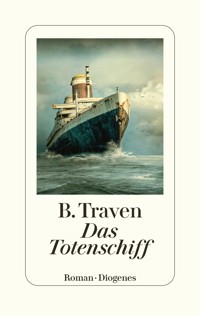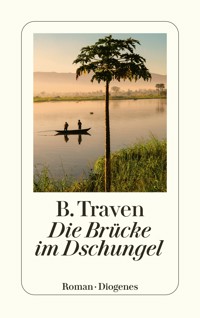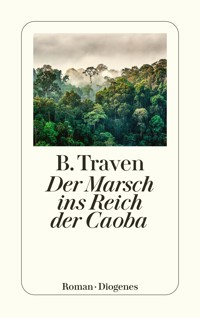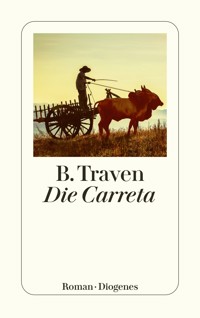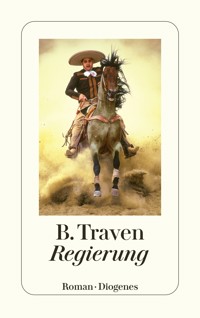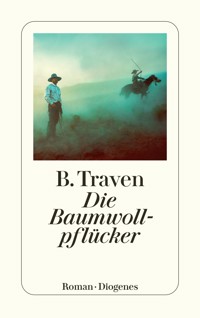
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der US-Amerikaner Gales schlägt sich als einziger Weißer in einer Truppe von Wanderarbeitern im Mexiko der 1920er-Jahre mit schlecht bezahlten Jobs durch – und gibt alles für einen Teller Bohnen und einen Schlafplatz. Als Baumwollpflücker, Öl-Bohrer, Bäcker und Cowboy erfährt er die Ausbeutung der ungelernten Arbeiter. Ein hoch spannender, sozialkritischer Abenteuerroman über den Vorabend der mexikanischen Revolution.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
B. Traven
Die Baumwollpflücker
roman
Diogenes
Gesang der Baumwollpflücker in Mexiko
Es trägt der König meine Gabe,
Der Millionär, der Präsident,
Doch ich, der lump’ge Pflücker, habe
In meiner Tasche keinen Cent.
Trab, trab, aufs Feld!
Gleich geht die Sonne auf.
Häng um den Sack,
Zieh fest den Gurt!
Hörst du die Waage kreischen?
Nur schwarze Bohnen sind mein Essen,
Statt Fleisch ist roter Pfeffer drin,
Mein Hemde hat der Busch gefressen,
Seitdem ich Baumwollpflücker bin.
Trab, trab, aufs Feld!
Gleich geht die Sonne auf.
Häng um den Sack,
Zieh fest den Gurt!
Hörst du die Waage brüllen?
Die Baumwoll’ stehet hoch im Preise,
Ich habe keinen ganzen Schuh,
Die Hose hängt mir fetzenweise
Am Ursch, und ist auch vorn nicht zu.
Trab, trab, aufs Feld!
Gleich geht die Sonne auf.
Häng um den Sack,
Zieh fest den Gurt!
Hörst du die Waage wimmern?
Und einen Hut hab ich, ’nen alten,
Kein Hälmchen Stroh ist heil daran,
Doch diesen Hut muss ich behalten,
Weil ich ja sonst nicht pflücken kann.
Trab, trab, aufs Feld!
Gleich geht die Sonne auf.
Häng um den Sack,
Zieh fest den Gurt!
Siehst du die Waage zittern?
Ich bin verlaust, ein Vagabund,
Und das ist gut, das muss so sein,
Denn wär’ ich nicht so’n armer Hund,
Käm’ keine Baumwoll’ rein.
Im Schritt, im Schritt!
Es geht die Sonne auf.
Füll in den Sack
Die Ernte dein!
Die Waage schlag in Scherben!
Erstes Buch
1
Ich stand auf der Station und sah mich um, wen von den wenigen Eingeborenen, die dort herumlungerten oder auf dem nackten Erdboden hockten, ich hätte nach dem Wege fragen können.
Da kam ein Mann auf mich zu, den ich schon im Zuge gesehen hatte. Braun verbrannt im Gesicht und am Körper. Vierzehn Tage nicht rasiert. Einen alten, breitrandigen Strohhut auf dem Kopfe. Einen roten Baumwollfetzen, der offenbar einmal ein richtiges Hemd gewesen war, am Leibe. Eine an fünfzig Stellen durchlöcherte gelbe Leinenhose an den Beinen und an den Füßen die landesüblichen Sandalen.
Er stellte sich vor mich hin und sah mich an. Sicher wusste er nicht, in welche Form und Reihenfolge er die Worte bringen sollte für den Satz, den er mir sagen wollte.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte ich endlich, als es mir zu lange dauerte.
»Buenos dias, Señor!«, begann er. Dann gluckste er ein paarmal und kam endlich heraus: »Könnten Sie mir vielleicht sagen, auf welchem Wege ich nach Ixtilxochitchuatepec zu gehen habe?«
»Was wollen Sie denn da?«, platzte ich heraus.
Die Unhöflichkeit, nach seinen persönlichen Angelegenheiten zu fragen in einem Lande, wo es taktlos, beinahe beleidigend ist, jemand nach Namen, Beruf, Woher und Wohin auszuforschen, kam mir gleichzeitig zum Bewusstsein. Deshalb fügte ich rasch hinzu: »Dort will ich nämlich auch hin.«
»Dann sind Sie wohl Mr. Shine?«, fragte er.
»Nein«, sagte ich, »der bin ich nicht, aber ich will zu Mr. Shine, Baumwolle pflücken.«
»Ich will auch Baumwolle pflücken bei Mr. Shine«, erklärte er nun und heiterte auf; zweifellos, weil er einen Weggenossen gefunden hatte.
In diesem Augenblick kam ein langer und stark gebauter Neger auf uns zu und sagte: »Señores, wissen Sie den Weg zu Mr. Shine?«
»Cotton picking?«, fragte ich.
»Yes, feller. Ich habe seine Adresse bekommen von einem andern schwarzen Burschen in Queretaro.«
So weit waren wir, als ein kleiner Chinese auf uns zugetrippelt kam. Er lachte uns breit an und sagte: »Guten Molgen, Señoles, Gentlemen! Ich will dolthin und möchte Sie flagen, wo ist del Weg.«
Umständlich brachte er ein Notizblättchen heraus, las und sagte dann: »Mr. Shine in Ixtilxo –«
»Stopp!«, unterbrach ich ihn laut lachend. »Wir wissen ja schon, wohin Sie wollen, verrenken Sie sich nur nicht die Zunge. Wir wollen auch dorthin.«
»Auch cotton pickin’ dolt?«, fragte der Chinc.
»Ja«, antwortete ich, »auch. Sechs Centavos für das Kilo.«
Durch diese meine Äußerung war auch mit dem Chinc das kameradschaftliche Band hergestellt. Die proletarische Klasse bildete sich, und wir hätten gleich mit dem Aufklären und dem Organisieren anfangen können.
Auf jeden Fall fühlten wir uns alle vier so wohl wie Brüder, die nach langer Trennung sich plötzlich unerwartet an irgendeinem fremden fernen Punkt der Erde getroffen haben.
Ich könnte nun noch erzählen, in welcher Form ein zweiter Neger, nur halb so lang wie sein Rassenvertreter, aber ebenso pechschwarz wie jener, auf uns zu schlenderte und mit welcher Sorglosigkeit und mit welchem Reichtum an Zeit ein schokoladenbrauner Indianer auf uns zusteuerte, beide mit dem gleichen Ziel der Reise: Mr. Shine in Ixtilxochitchuatepec, Baumwolle pflücken für sechs Centavos das Kilo.
Keiner von uns wusste, wo Ixtil… lag.
Die Station war inzwischen so leer geworden, lag so einsam und verträumt in der tropischen Glut, wie eben nur eine Station in Zentralamerika zehn Minuten nach Abfahrt des Zuges daliegen kann.
Den Postsack, fünfmal mehr Quadratzoll Leinen als Quadratzoll Inhalt, selbst wenn man alle Briefe und Umschläge auseinanderfaltete, hatte irgendein Jemand, den kein vernünftiger Mensch für einen Postbeamten gehalten hätte, mitgenommen.
Das Frachtgut: Eine Kiste Büchsenmilch, zwei Kannen Gasolin, fünf Rollen Stacheldraht, ein Sack Zucker und zwei Kisten Bonbons, lag herrenlos auf dem glühenden Bahnsteig.
Die Bretterbude, wo die Fahrkarten verkauft und das Gepäck abgewogen wurde, war mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen. Der Mann, der alle diese Amtshandlungen vorzunehmen hatte, zu denen auf einer europäischen Bahnstation wenigstens zwölf gut gedrillte Leute notwendig sind, hatte die Station schon verlassen, als der letzte Wagen des Zuges noch auf dem Bahnsteig war. Selbst die alte kleine Indianerin, die zu jedem Zug erschien mit zwei Bierflaschen voll kaltem Kaffee und in Zeitungspapier eingewickelten Maiskuchen, was sie alles in einem Schilfkorb trug, schlich bereits durch das mannshohe Gras in ziemlicher Entfernung heimwärts. Sie hielt stets am längsten auf dem Bahnsteig aus. Obgleich sie nie etwas verkaufte, kam sie doch jeden Tag zum Zuge. Wahrscheinlich war es vier Wochen lang immer derselbe Kaffee, den sie zur Bahn brachte. Und das wussten offenbar auch die Reisenden. Andernfalls hätten sie in der Hitze wohl wenigstens hin und wieder einmal der Alten etwas zu verdienen gegeben. Aber das Eiswasser, das in den Zügen kostenlos gegeben wurde, war ein zu starker Konkurrent, gegen den ein so kleines Kaffeegeschäft nicht aufkommen konnte.
Meine fünf proletarischen Klassengenossen hatten sich gemütlich auf den Erdboden neben der Bretterbude gesetzt. In den Schatten. Freilich, da jetzt die Sonne senkrecht über uns stand wie mit dem Lot gerichtet, gehörte schon eine lang ausprobierte Übung dazu herauszufinden, wo eigentlich der Schatten war.
Zeit war ihnen ein ganz und gar unbekannter Begriff; und weil sie wussten, dass ich ja auch dorthin wollte, wo sie hinwollten, überließen sie es mir, den Weg auszukundschaften. Sie würden gehen, wenn ich ging, nicht früher; und sie würden mir folgen, und wenn ich sie bis nach Peru führte, immer in der Gewissheit lebend, dass ich ja zum gleichen Ort müsse wie sie.
2
Wenn ich nur wüsste, wo Ixtil… zu finden sei. In der Nähe der Station war kein Haus zu sehen. Die Stadt, zu der die Station gehörte, musste irgendwo im Busch versteckt liegen. Ich machte nun den Vorschlag, dass wir erst einmal in diese Stadt gingen, wo sicher jemand zu finden sein würde, der den Weg wisse.
Nach einer Stunde kamen wir in die Stadt. Zwei Häuser nur waren aus Brettern. In dem einen wohnte der Stationsvorsteher. Ich ging hinein und fragte ihn, wo Ixtil… liegt. Er wusste es nicht und erklärte mir höflich, dass er den Namen nie gehört habe.
Fünfhundert Meter von diesem Holzhaus entfernt war das andere ›moderne‹ Brettergebäude. Es war der Kaufladen. Er war gleichzeitig Postamt, Billardsalon, Bierwirtschaft, Schnapsausschank und Agentur für alle möglichen Dinge und alle möglichen Unternehmungen.
Ich fragte den Inhaber, aber er kannte den Ort auch nicht und sagte mir, innerhalb fünfzig Kilometer im Umkreis sei er sicher nicht, denn da kenne er jeden Platz und jeden Farmer.
Da kam einer von den Billardspielern, die ebenso zerlumpt aussahen wie wir, an den Ladentisch, setzte sich darauf, drehte sich eine Zigarette, wobei er den Tabak in ein Maisblatt wickelte, zündete sie an und sagte: »Den Ort kenne ich nicht. Aber die einzigen Baumwollfelder, die hier in dem ganzen Staat überhaupt sind, liegen in jener Richtung.«
Dabei streckte er den Arm ziemlich unbestimmt nach jener Gegend aus, die er meinte.
»Von dorther«, fügte er hinzu, »ist vor drei Jahren einmal ziemlich viel Baumwolle hier verladen worden. Die Farmer kamen mit Autos, also wird wohl noch etwas Weg übriggeblieben sein. Ob einer von den Farmern Mr. Shine hieß, weiß ich freilich nicht, ich habe nicht nach den Namen gefragt, ich habe nur beim Verladen mitgearbeitet.«
»Wie weit kann es denn sein?«, fragte ich.
»Wenigstens achtzig Kilometer von hier, vielleicht neunzig. So genau weiß ich es nicht. Die kamen mittags an und sind sicher frühmorgens abgefahren.«
»Dann müssen wir also in jene Richtung gehen, wenn in einer andern Richtung keine Baumwolle gebaut wird.«
»Ich glaube sicher«, sagte er dann, »dass einer von den Farmern Mr. Shine heißen kann, alle sind Gringos.«
›Gringo‹ ist in Lateinamerika der Spottname für Amerikaner. Er hat ungefähr dieselbe missachtende Bedeutung wie ›Boche‹ in Frankreich für Deutsche. Aber die Amerikaner, die viel zu viel unzerstörbaren Humor besitzen, um sich so lächerlich leicht beleidigt zu fühlen und sich dadurch das Leben schwer zu machen, haben diesem Spottnamen die ganze Schärfe dadurch genommen, dass, wenn in Lateinamerika gefragt, was für Landsleute sie seien, sie sich selbst ›Gringos‹ nennen. Und sie sagen das mit einem so heiteren Lächeln, als ob es der schönste Witz wäre.
Die übrigen Gebäude der Stadt, etwa zehn oder zwölf, waren die üblichen Indianerhütten. Sechs rohe Stämme senkrecht auf den Erdboden gestellt und ein Dach aus trocknem Gras darüber. Die besseren hatten Wände aus dünnen Stämmchen, aber nicht dicht aneinandergefügt. Keine Türen, keine Fenster. Alles, was in der Hütte vor sich ging, konnte man von außen sehen. Die einfacheren Hütten, wo ärmere oder bequemere Mexikaner wohnten, hatten nicht einmal diese angedeuteten Wände, sondern oben um das Dach herum hingen einige große Palmblätter, um die Strahlen der Sonne, wenn sie in den frühen Vormittagsstunden und am späten Nachmittag schräger einfielen, abzuschatten.
Das Vieh und das Hühnervolk hatten keine Ställe. Die Schweine mussten sich draußen im Busch irgendwo und irgendwie das Futter zusammensuchen. Die Hühner saßen nachts in dem Baum, der der Hütte am nächsten stand. Eine alte Kiste oder ein durchlöcherter Schilfkorb hing an einem Ast, wo die Hühner brav ihre Eier hineinlegten.
Rund um die Hütten standen Bananenstauden, die, ohne jemals gepflegt zu werden, ihre Früchte in reichen Mengen spendeten. Die kleinen Felder, wo nur gesät und geerntet, sonst kaum etwas getan wird, lieferten Mais und Bohnen, mehr als die Bewohner aufbrauchen konnten.
In einer dieser Hütten nach dem Wege zu fragen war zwecklos. Wenn eine Auskunft überhaupt zu erhalten war, so war sie sicher falsch. Nicht falsch gegeben mit der Absicht, uns irrezuführen, aber aus purer Höflichkeit, irgendeine beliebige Auskunft zu geben, um nicht ›Nein‹ sagen zu müssen.
3
So wanderten wir denn frischweg los in jener Richtung, die uns im Postamt von dem Billardspieler genannt worden war und die ich für die einzig glaubwürdige hielt. ›Achtzig Kilometer‹, war uns gesagt worden. Also werden es wohl hundertzwanzig oder hundertfünfzig sein. Wir waren unser sechs.
Da war der Mexikaner Antonio, spanischer Herkunft, der mich zuerst angesprochen hatte. Dann kam der Mexikaner Gonzalo, indianischer Abstammung. Er war nicht ganz so zerlumpt wie Antonio und hatte ein Bündelchen, eingewickelt in eine alte Schilfmatte, und eine schöne, nach mexikanischer Art farbenfreudig gemusterte Decke, die er über der Schulter trug. Der Chinese Sam Woe war der eleganteste Bursche unter allen. Der Einzige, der ein Neues und frisch gewaschenes Hemd trug, heile Hosen hatte, gute Straßenstiefel, seidene Strümpfe und einen runden städtischen Strohhut. Er hatte zwei Bündel, ziemlich reichlich gepackt. Sie schienen gar nicht so leicht zu sein.
Er hatte immer die praktischsten Ideen und Ratschläge, lächelte immer, konnte das ›R‹ nicht aussprechen und war scheinbar immer guten Mutes. Es wurde mit der Zeit unser größter Kummer, dass wir ihn mit nichts, was immer wir auch taten, wütend machen konnten. Er hatte in einem Ölfeld als Koch gearbeitet und gut verdient. Sein Geld hatte er vorsichtig auf einer chinesischen Bank in Guanajuato hinterlegt, was er uns gleich erzählte, nur damit wir nicht etwa denken sollten, er trüge es bei sich und könnte dafür geopfert werden.
Baumwolle pflücken war ja nicht gerade seine große Leidenschaft – meine noch viel weniger –, aber weil es nicht so sehr außerhalb seines Weges lag, wollte er die sechs bis sieben Wochen Verdienst noch mitnehmen. Er hoffte dann zum Herbst ein kleines Restaurant – ›comida corrida 50‹ – zu eröffnen. Er war der Einzige unter uns, der wohldurchdachte Pläne für die Zukunft hatte. Sobald wir an den Busch gekommen waren, schnitt er sich ein dünnes Stämmchen, hängte über jedes der beiden Enden eines seiner Bündel und legte sich das Stämmchen über die Schultern. Während er bisher mit uns im gleichen Schritt gegangen war, begann er nun mit kurzen, raschen Schrittchen zu trippeln. In diesem Trippelschritt hielt er den ganzen Marsch durch, ohne je langsamer oder schneller zu gehen und ohne jemals zu ermüden. Wenn wir uns zur Rast niedersetzten oder niederlegten, tat er es auch, war aber jedes Mal erstaunt, dass wir ›schon wieder‹ ausruhen mussten. Wir schimpften ihn dann aus, dass wir richtige Christenmenschen seien, während er als verdammter Chinc von einem gelben, fratzenhaften Drachenungeheuer ausgebrütet worden wäre und dass darin die übermenschliche Ausdauer seiner stinkigen und uns widerlichen Rasse zu suchen sei. Er erklärte darauf heiter lächelnd, dass er nichts dafür könne und dass wir alle von demselben Gott geschaffen seien, aber dass dieser Gott gelb sei und nicht weiß. Da wir keine Missionare waren und auf dem Gebiete der Bekehrung auch keine Lorbeeren ernten wollten, ließen wir ihn in seinem finstern Unglauben.
Der hünenhafte Neger, Charley, passte mit seinen Lumpen und seinem in fettigem und zerrissenem Papier verschnürten Bündel, das unzählige Male auf dem Marsche aufging, viel besser in unsre Gesellschaft als der elegante Chinc. Charley behauptete, aus Florida zu sein. Aber da er Englisch weder geläufig sprechen noch verstehen konnte, auch nicht den amerikanischen Niggerdialekt sprach, konnte er mich von seiner Herkunft nicht überzeugen. Vielleicht war er von Honduras oder von St. Domingo. Aber er sprach auch nur sehr unbeholfen ein notdürftiges Spanisch. Ich habe nie erfahren können, wo er eigentlich hingehörte. Nach meiner Meinung war er entweder aus Brasilien heraufgekommen, oder er hatte sich von Afrika herübergeschmuggelt. Er wollte sicher nach den States, und für ihn als Nigger mit etwas Englisch war es leichter, sich über die Grenze nach den States zu schmuggeln, als für einen Weißen, der gut Englisch sprechen konnte. Er war der Einzige, der offen erklärte, dass er Baumwollpflücken als die schönste und einträglichste Arbeit betrachte.
Dann war noch der kleine Nigger da, Abraham aus New Orleans. Er hatte ein schwarzes Hemd an. Weil nun seine Hautfarbe ebenso schwarz war wie das Hemd, konnte man nicht so recht erkennen, wo die letzten Überreste des Hemdes waren und wo die Haut war, die bedeckt werden sollte. Er als Einziger hatte eine Mütze, wie sie von den Heizern und Maschinenschmierern auf den amerikanischen Schiffen getragen wird. Dann trug er eine weiß und rot gestreifte Leinenhose, Lackhalbschuhe und weiße Baumwollstrümpfe.
Er hatte kein Bündel, sondern trug einen Kaffeekessel und seine Bratpfanne an einem Bindfaden über der Schulter und in einem Säckchen seinen Bedarf an Lebensmitteln.
Abraham war der echte dummschlaue, gerissene, freche und immer lustige amerikanische Nigger der Südstaaten. Er hatte eine Mundharmonika, mit der er uns das blöde ›Yes, we have no bananas‹ so lange vorspielte, bis wir ihn am zweiten Tage weidlich verprügeln mussten, um damit vorläufig nur zu erreichen, dass er es wenigstens nur sang oder pfiff und dazu, während des Marsches, tanzte. Er stahl wie ein Rabe – der Vergleich war von Gonzalo, ich weiß nicht, ob er richtig ist – und log wie ein Dominikanermönch. Am dritten Abend des Marsches erwischten wir ihn, wie er einen dicken Streifen getrocknetes Rindfleisch, das Antonio gehörte, stahl. Wir nahmen ihm den Raub wieder ab, bevor er ihn in der Pfanne hatte, und wir erklärten ihm ganz ernsthaft, dass, wenn wir ihn noch einmal beim Stehlen ertappten, wir Buschrecht an ihm ausüben würden. Wir würden eine Gerichtssitzung abhalten und ihn dann, nach gefälltem Urteil, mit der Schnur, die sein Couleurbruder Charley um sein Bündel geschnürt habe, am nächsten besten Mahagonibaum aufhängen, mit einem Zettel auf der Brust, wofür er gehängt sei.
Da sagte er ganz frech, wir sollten ja nicht versuchen, ihn auch nur anzutasten, er sei amerikanischer Bürger, ›native born‹, und wenn wir ihm nur das allergeringste Leid täten, so würde er das an die Regierung nach Washington berichten, und die werde dann mit einem Kanonenboot und dem Sternenbanner kommen und ihn blutig rächen; er sei ein freier Bürger ›of the States‹, und das könne er durch ›c’tificts‹ beweisen, und als solcher habe er das Recht, vor ein ordentliches Gericht gestellt zu werden. Als wir ihm nun erklärten, dass wir ihm keine Zeit lassen und keine Gelegenheit geben würden, nach Washington einen Bericht zu schicken, und dass wir auch nicht glaubten, dass ein amerikanisches Kanonenboot mit dem Sternenbanner in den Busch fahren würde, sagte er: »Well, Gentlemen, Sirs, berühren Sie mich nur mit der Fingerspitze, dann werden Sie sofort erleben, was geschieht.«
Wir erwischten ihn auch richtig einige Tage später, als er dem Chinc eine Büchse Milch stahl und frech erklärte, es sei seine eigne, er habe sie in Potosi im American Store gekauft. Er wurde daraufhin so windelweich gedroschen, dass er keinen Finger krumm machen konnte, um nach Washington zu schreiben. Bei uns hat er dann nicht mehr gestohlen, und was er bei umliegenden Farmern zusammenstahl, ging uns nichts an.
Dann war ich noch, Gerard Gales, über den ich weniger zu berichten weiß, da ich mich in der Kleidung von den Übrigen nicht unterschied und zum Baumwollpflücken, einer zeitraubenden und schlechtbezahlten Arbeit, auch nur ging, weil eben keine andre Beschäftigung zu haben war und ich bitter notwendig ein Hemd, ein Paar Schuhe und eine Hose brauchte. Vom Althändler! Denn vom Neuhändler sie zu kaufen, dazu hätte selbst die Arbeit von vierzehn Wochen auf einer Baumwollfarm nicht gelangt.
Eine Jacke besaßen nur der Chinc und Antonio. Warum Antonio den Fetzen eigentlich ›seine Jacke‹ nannte, ist mir nie klargeworden. Sie mag vielleicht einmal, in weit zurückliegenden Zeiten, lange vor der Entdeckung Amerikas, die Ähnlichkeit mit einer Jacke gehabt haben. Das will ich nicht bestreiten. Aber heute sie Jacke zu nennen war nicht Übertreibung, sondern sündiger Hochmut, für den Antonio dereinst wird büßen müssen.
4
Wir wanderten lustig drauflos.
Über uns die glühende Tropensonne, zu beiden Seiten neben uns der undurchdringliche und undurchsichtbare Busch. Der ewig jungfräuliche tropische Busch mit seiner unbeschreiblichen Mystik, mit seinen Geheimnissen an Tieren der fantastischsten Art, mit seinen traumhaften Formen und Farben der Pflanzen, mit seinen unerforschten Schätzen an wertvollen Steinen und kostbaren Metallen.
Aber wir waren keine Forscher, und wir waren auch keine Gold- oder Diamantengräber. Wir waren Arbeiter und hatten mehr Wert auf den sicheren Arbeitslohn zu legen als auf den unsichtbaren Millionengewinn, der vielleicht links oder rechts von uns im Busch verborgen lag und auf den Entdecker wartete.
Die Sonne stand schon sehr tief, und es musste ungefähr fünf Uhr sein. Wir sahen uns deshalb nach einem Lagerplatz um. Bald fanden wir eine Stelle, wo seitlich in den Busch hinein hohes Gras stand. Wir rissen so viel von dem Gras aus, wie wir Platz zum Lagern brauchten. Dann zündeten wir ein Feuer an und brannten den Rest des Grases nieder, wodurch wir uns Ruhe vor Insekten und kriechendem Getier für die Nacht verschafften. Eine frisch gebrannte Grasfläche ist der beste Schutz, den man haben kann, wenn man nicht mit den Ausrüstungsstücken eines Tropenreisenden wandert.
Ein Campfeuer hatten wir, aber es gab nichts zum Kochen, denn wir hatten kein Wasser.
Da kam der Chinc mit einer Literflasche voll kaltem Kaffee hervor. Wir wussten nichts davon, dass er einen so wertvollen Stoff mit sich führte. Er machte den Kaffee heiß, und bereitwillig bot er uns allen zu trinken an. Aber was ist ein Liter Kaffee für sechs Mann, die, ohne einen Schluck Wasser zu haben, einen halben Tag in der Tropensonne gewandert sind, vor morgen früh um sieben oder acht Uhr ganz bestimmt auch nichts Trinkbares haben werden und vielleicht die nächsten sechsunddreißig Stunden genauso wenig Wasser finden werden, wie sie heute Nachmittag gefunden haben. Der Busch ist das ganze Jahr hindurch grün, aber Wasser findet man dort nur in der Regenzeit an günstigen Stellen, wo sich Tümpel bilden können.
Nur wer selbst im tropischen Busch gewandert ist, weiß, was für ein Opfer es war, das der Chinc uns bot. Aber keiner sagte ›Danke!‹; jeder betrachtete es als ganz selbstverständlich, dass der Kaffee in Teile ging. Wahrscheinlich hätten wir es genauso selbstverständlich gefunden, wenn der Chinc den Kaffee allein getrunken hätte. Nach einem halben Tag Wanderung in wasserlosem Landstrich raubt man noch nicht für einen Becher Kaffee; aber am dritten Tage beginnt man ernsthaft auf Mord zu sinnen im Busch für eine kleine rostige Konservenbüchse voll stinkender Flüssigkeit, die man Wasser nennt, obgleich sie keine andre Ähnlichkeit mit Wasser hat, als dass sie eben Flüssigkeit ist.
Antonio und ich hatten etwas hartes Brot zu knabbern.
Gonzalo hatte vier Mangos und der große Nigger einige Bananen. Der kleine Nigger aß irgendwas ganz verstohlen. Was es war, weiß ich nicht. Der Chinc hatte ein Stück Zelttuch, das er über seinen Schlafplatz spannte. Dann wickelte er sich in ein großes Handtuch ein, auch den Kopf, und begann zu schlafen.
Gonzalo hatte seine schöne Decke, in die er sich einrollte, sodass er wie ein Baumstamm aussah.
Ich wickelte meinen Kopf in einen zerlumpten Lappen ein, den ich stolz ›mein Handtuch‹ nannte, und schlief los. Wie sich die Übrigen einrichteten, weiß ich nicht, weil die noch lange um das Feuer herumsaßen und rauchten und schwatzten.
Vor Sonnenaufgang waren wir schon wieder auf dem Marsch. Abzukochen gab es nichts, und zu waschen brauchte man sich auch nicht. Denn womit hätte man es tun sollen?
Der Weg durch den Busch war weite Strecken hindurch schon wieder zugewachsen. Der Nachwuchs der jungen Bäume reichte uns oft bis über die Schultern, und der Grund war mit Kaktusstauden so dicht bewachsen, dass diese stachligen Pflanzen zuweilen beinahe die ganze Breite des Weges einnahmen. Meine nackten Unterschenkel waren bald so zerschnitten, als wenn sie durch eine Hackmaschine gezogen worden wären. Gegen Mittag kamen wir an eine Stelle, wo sich rechts des Weges ein Stacheldrahtzaun hinzog, der uns die Gewissheit gab, dass hier eine Farm liegen müsse.
Nachdem wir etwa zwei Stunden lang, immer den Stacheldrahtzaun zur rechten Hand, gewandert waren, kamen wir an eine weite offene Stelle im Busch, die mit hohem Gras bewachsen war. Als wir den Platz absuchten, fanden wir auch eine Zisterne. Aber sie war leer. Einige morsche Pfähle, alte Konservenbüchsen, verrostetes Wellblech und ähnliche Überbleibsel einer menschlichen Behausung offenbarten uns eine verlassene Farm.
Über eine solche Enttäuschung muss man rasch hinwegkommen. Farmen werden hier gegründet, zehn, auch zwanzig Jahre lang bewirtschaftet und dann aus irgendeinem Grunde plötzlich aufgegeben. Fünf Jahre später, oft schon früher, ist kein Zeichen mehr davon vorhanden, dass hier jemals Menschen gelebt und gearbeitet haben. Es erweckt den Anschein, als seien es hundert Jahre her, seit jemand hier gelebt hat. Der tropische Busch begräbt rascher, als Menschen bauen können, er kennt keine Erinnerung, nur Gegenwart und Leben.
Aber um vier Uhr kamen wir doch an eine lebende Farm. Hier wohnte eine amerikanische Familie.
Ich wurde im Haus gut bewirtet und fand auch ein Lager innerhalb des Hauses. Die Übrigen als Nichtweiße wurden auf der Veranda beköstigt und durften in einem Schuppen übernachten. Sie bekamen alle reichlich zu essen, aber ich war der eigentliche Gast. Mir wurde aufgetischt, wie eben nur in einem so menschenarmen Lande einem Weißen von weißen Gastgebern aufgetischt werden kann. Drei verschiedene Fleischgänge, fünf verschiedene Beigerichte, Kaffee, Pudding und abends heißen Kuchen.
Am nächsten Morgen bekamen wir alle ein reichliches Frühstück; ich wieder am Tisch des Farmers.
Der Farmer hatte genügend leere Flaschen, und so bekam jeder von uns eine Literflasche kalten Tee mit auf den Weg.
Er kannte Mr. Shine und sagte uns, dass wir noch etwa sechzig Kilometer zu marschieren hätten. Kein Wasser am ganzen Weg; die Straße an verschiedenen Stellen kaum noch erkennbar, weil sie seit drei Jahren nicht mehr benutzt worden sei.
Um neun Uhr hatte der kleine Nigger Abraham seinen Tee schon ausgetrunken und die Flasche fortgeworfen. Es war ihm zu lästig, sie zu tragen. Wir erklärten ihm, dass er unter diesen Umständen von uns nichts zu erwarten habe, und falls er versuchen sollte, auch nur einen Schluck zu stehlen, würden wir ihn braun und blau schlagen.
An diesem Abend im Lager war es, wo er zwar keinen Tee stahl, aber jenen Streifen getrocknetes Rindfleisch, das Antonio gehörte. Da sich unsre Drohung nur auf Tee bezog, ließen wir ihn laufen mit der Warnung, dass von nun an jeder Raub in unsre Drohung einbegriffen sei. Den folgenden Tag gegen Mittag kamen wir bei Mr. Shine an.
5
Mr. Shine empfing uns mit einer gewissen Freude, weil er nicht genügend Leute zum Baumwollpflücken hatte. Mich nahm er persönlich ins Gebet. Er rief mich ins Haus und sagte zu mir: »Was! Sie wollen auch Baumwolle pflücken?«
»Ja«, sagte ich, »ich muss, ich bin vollständig ›broke‹, das sehen Sie ja, ich habe nur Fetzen am Leibe. Arbeit ist in den Städten keine zu haben. Alles ist überschwemmt mit Arbeitslosen aus den States, wo die Verhältnisse augenblicklich auch nicht rosig zu sein scheinen. Und wo man wirklich Arbeiter braucht, nimmt man lieber Eingeborene, weil man denen Löhne zahlt, die man einem Weißen nicht anzubieten wagt.«
»Haben Sie denn schon mal gepickt?«, fragte er.
»Ja«, antwortete ich, »in den States.«
»Ha!«, lachte er, »das ist ein ander Ding. Da können Sie etwas dabei werden.«
»Ich habe auch ganz gut dabei verdient.«
»Das glaube ich Ihnen. Die zahlen viel besser. Die können’s auch. Die kriegen ganz andre Preise als wir. Könnten wir unsre Baumwolle nach den States verkaufen, dann würden wir noch bessere Löhne zahlen; aber die States lassen ja keine Baumwolle herein, um die Preise hoch zu halten. Wir sind auf unsern eignen Markt angewiesen, und der ist immer gleich gepackt voll. Aber nun Sie! Ich kann Sie weder beköstigen noch in meinem Hause unterbringen. Aber ich brauche jede Hand, die kommt. Ich will Ihnen etwas sagen; ich zahle sechs Centavos für das Kilo, Ihnen will ich acht zahlen, sonst kommen Sie auf keinen Fall auf das, was die Nigger machen. Selbstverständlich brauchen Sie das den andern nicht zu erzählen. Schlafen könnt ihr da drüben in dem alten Haus. Das habe ich gebaut und mit meiner Familie zuerst darin gewohnt, bis ich mir das neue hier leisten konnte. Well, das ist dann abgemacht.«
Das Haus, von dem der Farmer gesprochen hatte, lag etwa fünf Minuten entfernt. Wir machten uns dort häuslich, so gut wir konnten. Das Haus, aus Brettern leicht gebaut, hatte nur einen Raum. Jede der vier Wände hatte je eine Tür, die gleichzeitig als Fenster diente. Der Raum war vollständig leer. Wir schliefen auf dem bloßen Fußboden. Ein paar alte Kisten, die vor dem Haus herumlagen, im Ganzen vier, benutzten wir als Stühle. Dicht bei dem Haus war eine Zisterne, die Regenwasser enthielt, das ungefähr sieben Monate alt war und von Kaulquappen wimmelte. Ich berechnete, dass etwa hundertzwanzig Liter Wasser in der Zisterne seien, mit denen wir sechs Mann sechs bis acht Wochen auskommen mussten. Der Farmer hatte uns schon gesagt, dass wir von ihm kein Wasser bekommen könnten, er wäre selbst sehr kurz mit Wasser dran und habe noch sechs Pferde und vier Maultiere zu tränken. Waschen konnten wir uns einmal in der Woche und hatten dann noch zu je drei Mann dasselbe Waschwasser zu gebrauchen. Es sei aber immerhin möglich, fügte er hinzu, dass es in dieser Jahreszeit alle vierzehn Tage zwei bis vier Stunden regne, und wenn wir die Auffangrinnen reparierten, könnten wir tüchtig Wasser ansammeln. Außerdem sei ein Fluss nur etwa drei Stunden entfernt, wo wir baden gehen könnten, falls wir Lust dazu hätten. Vor dem Hause richteten wir ein Lagerfeuer ein, zu dem uns der nahe Busch das Holz in reicher Menge hergab. Auf die recht nebelhafte Möglichkeit hin, dass es vielleicht innerhalb der nächsten drei Wochen regnen könnte, wuschen wir uns zunächst einmal in einer alten Gasolintonne. Seit drei Tagen hatten wir uns nicht gewaschen.
Ich rasierte mich. Es mag mir noch so dreckig gehen, Rasiermesser, Kamm und Zahnbürste habe ich immer bei mir.
Auch der Chinc rasierte sich.
Da kam Antonio auf mich zu und bat mich um mein Rasiermesser. Er hatte sich seit beinahe drei Wochen nicht rasiert und sah aus wie ein fürchterlicher Seeräuber.
»Nein, lieber Antonio«, sagte ich, »Rasierzeug, Kamm und Zahnbürste verpumpe ich nicht.«
Und der Chinc, mutig gemacht durch meine Weigerung, sagte lächelnd, dass sein schwaches Messer bei diesem starken Bart sofort stumpf werde und er hier keine Gelegenheit habe, es schleifen zu lassen. Er selbst hatte nur dünne Stoppeln.
Antonio gab sich mit diesen beiden Weigerungen zufrieden.
Wir kochten unser Abendessen, ich Reis mit spanischem Pfeffer, der andre schwarze Bohnen mit Pfeffer, der Nächste Bohnen mit getrocknetem Rindfleisch, ein Vierter briet einige Kartoffeln mit etwas Speck. Da wir am nächsten Morgen schon um vier Uhr zur Arbeit gingen, bereiteten wir auch noch unser Brot für den nächsten Tag, das wir in unsern Pfannen buken.
Als wir gegessen hatten, hängten wir unsre armseligen Lebensmittel an Bindfaden an den Querbalken im Hause auf, weil uns die Ameisen und Mäuse über Nacht sonst alles fortgeholt hätten, wenn wir diese Vorsorge nicht getroffen hätten.
Etwas nach sechs Uhr ging die Sonne unter. Eine halbe Stunde später war rabenschwarze Nacht.
Glühwürmchen, mit Lichtern so groß wie Haselnüsse, flogen um uns her. Wir krochen in unser Haus, um zu schlafen.
Der Chinc war der Einzige, der ein Moskitonetz hatte. Wir andern wurden von dem Viehzeug grässlich geplagt und schimpften und wüteten, als ob sich diese Gesandten der Hölle etwas daraus machen würden. Die beiden Nigger, die Seite an Seite schliefen, sich vor dem Einschlafen entsetzlich zankten und sich handfeste Backpfeifen anboten, schienen von den Biestern nicht gestört zu werden. Ich entschloss mich, diese Qual für die Nacht zu erdulden, aber morgen für irgendeine Abhilfe zu sorgen. Noch vor Sonnenaufgang waren wir auf den Beinen. Jeder kochte sich etwas Kaffee, aß ein Stückchen Brot dazu, und fort ging es im halben Trab. Das Baumwollfeld war eine halbe Stunde entfernt.
Der Farmer und seine zwei Söhne waren schon dort. Wir bekamen jeder einen alten Sack, den wir uns umhängten, dann wurde der Gürtel festgezogen, damit wir die Fetzen nicht verloren, und dann ging es an die Arbeit. Jeder nahm eine Reihe.
Wenn die Baumwolle schön reif ist und man den Griff erst weghat, bekommt man jede Frucht mit einem einzigen Griff. Da aber die Knollen, die ähnlich aussehen wie die Hülsen der Kastanien, nicht alle die gleiche Reife haben, muss man doch bei der Hälfte einige Male gut zupfen, ehe man die zarte Frucht aus der Hülse gerissen hat und sie in den Sack tun kann. Bei guter Reife, und wenn die Stauden gut stehen, kann man, sobald man die Übung hat, gleichzeitig mit beiden Händen an verschiedenen Stellen rupfen. Aber bei Mittelernte und bei schlechten Stauden muss man dafür oft beide Hände brauchen, um eine Frucht zu kriegen. Obendrein muss man sich auch noch unaufhörlich bücken, weil die Früchte nicht alle in bequemer Höhe am Strauch hängen, sondern oft bis dicht über dem Boden wachsen und, wenn unerwartet starker Regen kommt, die Früchte auch noch in den Boden gehauen sind, wo man sie rausklauben muss. Je weiter es gegen Mittag geht, desto höher steht die Sonne und desto mühseliger wird die Arbeit. Man trägt nichts weiter am Leibe als Hut, Hemd, Hose und Schuhe, aber der Schweiß rinnt in Strömen an einem herab. Sehr kleine lästige Fliegen, die einem unausgesetzt in die Ohren kriechen, und Moskitos machen einem das Leben recht schwer. Kommt ein leichter Wind auf, der die Moskitos verscheucht, geht es noch; aber bei völliger Windstille wird die Qual mit jeder Stunde größer. Gegen elf Uhr, nach beinahe siebenstündiger ununterbrochener Arbeit, kann man nicht mehr.
Wir suchten den Schatten einiger Bäume auf, die mehr als zehn Minuten entfernt waren. Wir aßen unser trockenes Pfannenbrot, das, bei mir wenigstens, ganz verbrannt war, und legten uns dann hin, um zwei Stunden zu schlafen, bis die Sonne anfängt, wieder abwärts zu wandern. Wir bekamen furchtbaren Durst, und ich ging zum Farmer, um ihn um Wasser zu bitten.
»Es tut mir leid, ich habe keins. Ich sagte Ihnen doch schon gestern, dass ich selber sehr kurz mit Wasser bin. Gut, heute will ich euch noch etwas geben, von morgen ab müsst ihr euch euer Wasser selbst mitbringen.«
Er schickte einen seiner Söhne mit dem Pferd nach Hause, der dann bald mit einer Kanne Regenwasser zurückkam.
Baumwolle ist teuer. Das lernt jeder bald, wenn er sich einen Anzug, ein Hemd, ein Handtuch, ein Paar Strümpfe oder nur ein Taschentuch kauft. Aber der Baumwollpflücker, der wohl die härteste und qualvollste Arbeit für die Stoffe leistet, die ein König oder ein Milliardär oder ein einfacher Landmann trägt, hat an dem hohen Preis des Anzuges den allergeringsten Anteil.
Für ein Kilogramm Baumwolle pflücken bekamen wir sechs Centavos, ich ausnahmsweise acht. Und ein Kilo Baumwolle ist beinahe ein kleiner Berg, den zu schaffen man unter ständigem Bücken in der mitleidlosen Tropensonne zweihundert bis fünfhundert Knollen auszupfen muss. Dazu eine Nahrung, die als die allerbescheidenste angesehen werden darf, von der Menschen irgendwo auf Erden leben. Den einen Tag schwarze Bohnen mit Pfeffer, den nächsten Tag Reis mit Pfeffer, den übernächsten wieder Bohnen, dann wieder Reis; dazu Brot, selbst gebacken aus Weizen- oder Maismehl, entweder kleistrig oder zu Kohle verbrannt, monatealtes, abgestandenes Regenwasser, Kaffee, gekocht aus selbst gerösteten Kaffeebohnen, auf einem Stein zerrieben und gesüßt mit einem billigen, übel riechenden schwarzbraunen Rohzucker in kleinen Kegeln. Das Salz, das man verwendet, ist Meersalz, das man sich selbst vor dem Gebrauch erst reinigen muss. Ein paar Kilogramm Zwiebeln in der Woche hinzugekauft ist bereits Delikatesse, und ab und zu ein Streifen getrocknetes Fleisch ist schon ein Luxus, der, wenn man ihn sich zu oft leistet, vom Lohn nicht einmal das Reisegeld bis zur nächsten größeren Stadt, wo man neue Arbeit finden könnte, übriglässt. Bei sehr fleißiger Arbeit verdient man in einer Woche gerade so viel, dass man sich, wenn man keinen Centavo für Essen ausgibt, das billigste Paar Schuhe kaufen kann, das man im Laden vorfindet.
Der Baumwollfarmer verursacht auch nicht immer die hohen Preise der Fertigware. Er ist oft tief verschuldet und kann in vielen Fällen die Pflückerlöhne nur auszahlen, wenn er auf die Ernte einen Vorschuss nimmt.
6
Um vier Uhr nachmittags machten wir Schluss, um noch bei Tageslicht nach Hause zu kommen und unser Essen zu kochen. Ich quartierte mich aus. In der Nähe des Hauses, nur etwa zweihundert Meter entfernt, hatte ich eine Art Unterstand entdeckt. Welchen Zwecken er diente oder gedient haben mochte, wusste ich nicht. Er hatte ein Dach aus Wellblech, aber keine Wände, es wäre denn, dass man einige Baumstämme, die an der einen Seite gegen das Dach gelehnt waren, als Wand bezeichnen will.
In diesem Unterstand war eine Art Tisch. Es waren vier Pfähle in die Erde gerammt, und auf den Pfählen lagen ein paar Platten Wellblech. Diesen Unterstand wählte ich als Behausung und den Tisch als Bett. Der große Nigger wollte den Unterstand mit mir teilen. Er kam hin, sah sich die Sache an, und es gefiel ihm.
Plötzlich rief er: »A snake! A snake!«
»Wo?«, fragte ich.
»Da, dicht vor Ihren Füßen.«
Richtig, da wand sich eine Schlange auf dem Boden hin, eine feuerrote, etwa einen Meter lang.
»Macht nichts«, sagte ich, »die wird mich nicht gleich auffressen, die Moskitos sind schlimmer.«
Der Nigger zog wieder ab.
Nach einer Weile kam Gonzalo. Die rote Schlange war inzwischen verschwunden.
Es gefiel ihm sehr, und er fragte mich, ob ich etwas dagegen habe, wenn er auch hier schliefe.
»Nein«, sagte ich, »schlafen Sie ruhig hier, mir ist das ganz egal.«
Da starrte er auf den Boden.
Ich folgte seinem Blick.
Es war wieder eine Schlange. Diesmal eine schöne grüne. »Ich will doch lieber im Haus schlafen«, sagte nun Gonzalo, »ich mag Schlangen nicht.«
Ich mache mir nichts aus Schlangen. So leicht werden sie ja wohl kaum auf den Tisch kommen; und wenn sie sich wirklich hinaufringeln sollten, was sie zuweilen tun, so werden sie ja nicht gleich beißen, und wenn sie beißen sollten, so werden sie wohl nicht gleich giftig sein. Wären sie alle giftig und würden sie alle einen schlafenden Menschen, der ihnen nichts zuleide tut, beißen, wäre ich längst nicht mehr am Leben. Da dieser Unterstand höher lag als das Haus, keine Wände hatte, jedem kleinen Windzug freieren Durchgang ließ in der Nähe auch kein Strauchwerk war und er weit genug von der Zisterne und dem ausgetrockneten Tränkepfuhl entfernt war, hatte ich hier in der Tat beinahe gar nicht unter den Moskitos zu leiden.
Am nächsten Morgen kamen noch etwa zwölf Eingeborene zur Mitarbeit. Die wohnten ziemlich weit entfernt in einem Dorf, das irgendwo im Busch liegen mochte. Sie kamen auf Maultieren geritten; manche hatten weder Sattel noch Steigbügel. Andre hatten wohl einen Holzsattel, aber keinen Zaum; anstelle des Zaumes war den Tieren ein Strick um das Maul gebunden.
Diese Leute waren an die Feldarbeit in den Tropen besser gewöhnt als wir, die wir, mit Ausnahme des großen Niggers, alle Städter waren. Aber sie schafften viel weniger als wir und mussten eine viel längere Mittagspause machen. Jedoch das ging uns nichts an, und darüber nachzudenken lohnte sich auch nicht recht.
Am Samstag kriegten wir ausbezahlt. Wir ließen uns von den paar Kröten, die wir in so mühseliger Arbeit verdient hatten, gerade so viel geben, wie wir brauchten, um Lebensmittel für die nächste Woche einzukaufen. Den Rest ließen wir beim Farmer stehen, denn auch nur einen Nickel in der Tasche zu haben ist nichts als Versuchung für andre. Selbstverständlich arbeiteten wir sonntags auch. Der brachte dann knapp ein Kilo Speck ein oder fünf Kilo Kartoffeln; weil wir an dem Tage schon um drei Uhr Schluss machten, um uns wenigstens einmal in der Woche waschen zu können und um das verschwitzte Zeug, das man Tag und Nacht auf dem Leibe hatte, durchs Wasser zu ziehen.
Der Chinc und Antonio waren in den nächsten Laden gegangen, der etwa drei und eine halbe Stunde entfernt lag, um für uns alle das einzukaufen, was jeder ihnen auf ein Maisblatt aufgeschrieben hatte. Die Hieroglyphen, die auf jenen Maisblättern standen, waren nur von den Einkäufern zu entziffern, denen wir mündlich die Bedeutung der fantastischen Zeichen ausführlich hatten erklären müssen. Den nächsten Sonntag hatten dann ich und Charley einkaufen zu gehen.
An diesem Sonntag war Charley schon um zwei Uhr von der Plantage verschwunden. Er war mit seinem Sack Baumwolle zur Waage gegangen und nicht zurückgekommen.
Als wir zum Hause kamen, waren Sam und Antonio schon mit den Gütern angelangt.
»Eine elende, nichtswürdige Schlepperei«, sagte Antonio.
»Ach, das war nicht so schlimm!«, begütigte Sam.
»Ruhig, du gelber Heidensohn, du natürlich, mit deiner Lastträgervergangenheit, was verstehst du von Schleppen?«, rief Antonio, während er sich auf eine Kiste hinsetzte, die auch noch unter ihm zusammenbrach und seine Laune durchaus nicht besserte.
»Hören Sie, Antonio, warum haben Sie denn nicht Mr. Shine um eine Mula oder einen Esel gebeten?«, fragte ich.