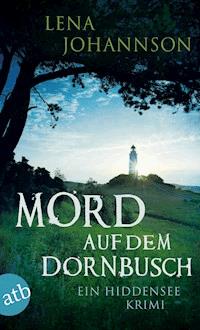6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Zauber des Bernsteins und eine Frau, die mutig ihren Weg geht Lübeck zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die kleine Johanna wächst wohlbehütet bei ihren Großeltern auf. Von ihren Eltern weiß sie nur, dass die Mutter wenige Tage nach Johannas Geburt gestorben ist. Als Johanna erwachsen wird, soll sie eine Ausbildung als Bernsteinschnitzerin machen – und versteht absolut nicht, warum sie als Mädchen in eine handwerkliche Lehre gehen muss. Sollte ihr Schicksal wirklich an den geheimnisvollen Bernsteinanhänger gebunden sein, den ihre Mutter ihr hinterlassen hat? Die Bernsteinheilerin von Lena Johannson: historische Romane im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Lena Johannson
Die Bernsteinheilerin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Zauber des Bernsteins und eine Frau, die mutig ihren Weg geht
Lübeck zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die kleine Johanna wächst wohlbehütet bei ihren Großeltern auf. Von ihren Eltern weiß sie nur, dass die Mutter wenige Tage nach Johannas Geburt gestorben ist. Als Johanna erwachsen wird, soll sie eine Ausbildung als Bernsteinschnitzerin machen – und versteht absolut nicht, warum sie als Mädchen in eine handwerkliche Lehre gehen muss. Sollte ihr Schicksal wirklich an den geheimnisvollen Bernsteinanhänger gebunden sein, den ihre Mutter ihr hinterlassen hat?
Inhaltsübersicht
Prolog
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Epilog
Glossar
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danksagung
Prolog
Sie war hungrig. Sehr hungrig. Schon viel zu lange hatte sie nicht mehr gegessen. Jedenfalls nicht genug. Nicht so viel, dass ihr Körper kräftig und voller Energie hätte sein können. Es war heiß. Die Sonne brannte an diesem Tag besonders erbarmungslos auf den Wald nieder. Nicht weit von dem Platz, an dem sie sich vor den sengenden Strahlen verbarg, plätscherte ein Fluss. Schon der Klang war die Verheißung von Abkühlung und Erfrischung. Doch sie fühlte sich nicht stark genug, um die mehreren hundert Meter zurückzulegen. Es wäre gewiss klug gewesen, in einer Höhle Schutz zu suchen, bis der Abend dämmerte. Nur musste sie essen, und zwar bald. Also ging sie auf die Jagd. Sie beobachtete aufmerksam die Ahornbäume, Stechpalmen und Kiefern um sich herum und den weichen Waldboden, auf dem niedrige Myrte und haarige Brennnessel wuchs, ob sich irgendwo etwas bewegte, ob sich eine lohnende Beute sehen ließ. Sie konnte nur regungslos verharren in der Hoffnung, eine Kreatur, vielleicht auf dem Weg zum Fluss, käme an ihr vorüber. War die leichtsinnig genug, sich in ihre Nähe zu wagen, wäre ihre Stunde gekommen. Blitzschnell würde sie zuschlagen, wie sie es schon oft getan hatte. Sie war eine gute Jägerin, die es bisher stets verstanden hatte, sich reichlich zu versorgen, und der es gleichzeitig immer gelungen war, den Gefahren des Waldes aus dem Weg zu gehen. Und die gab es nicht zu knapp. Es waren mehr Räuber unterwegs, als ihr lieb sein konnte. Auch war die Zahl derer groß, die auf die gleiche Beute aus waren wie sie selbst. Sie gehörte keiner Gemeinschaft an, die sie in schlechten Zeiten hätte ernähren können. Sie war allein und ganz auf sich selbst und ihre Fähigkeiten gestellt. So war es schon immer.
Die Hitze war kaum mehr zu ertragen. Ohne den Wald mit seinem Schatten wäre sie verloren. Ihr war, als würde sie innerlich ausdorren, als würde ihr die Haut auf dem Leib brennen. Sie hatte kein Empfinden dafür, wie lange sie bereits wartete, und es kümmerte sie auch nicht. Sie lauerte, matt, von der Entbehrung gezeichnet und dennoch aufmerksam. Sie würde so lange aushalten, bis sich eine Gelegenheit ergab.
Endlich war diese gekommen. Eine fette Made kroch über die Rinde einer Kiefer nur wenige Zentimeter von ihr entfernt. In dem Moment, in dem sie die Insektenlarve entdeckte, wusste sie, dass diese ihr nicht entrinnen konnte. Mit ihren kurzen, kaum erkennbaren Beinen, mit denen sie sich vorwärtsschob, war sie viel zu langsam.
Die Eidechse würde leichtes Spiel haben, die Made endlich wieder eine lohnende Mahlzeit abgeben. Vögel zwitscherten, der Fluss klang mit einem Mal munter und fröhlich, und kam da nicht auch ein laues Lüftchen auf, das in den Blättern rauschte und Abkühlung versprach? Nur noch wenige Sekunden, dann konnte sie sich am Fleisch ihrer Beute laben. Die Augen der Eidechse, kupferfarben und erhaben wie die Köpfe kleiner Nägel, schnellten von einer Seite zur anderen, kontrollierten die Umgebung. Jetzt durfte niemand mehr den Fang gefährden. Der geschuppte Körper regte sich keinen Deut. In dem Moment, als er sich anspannte, um sich mit einem Satz auf die Made zu stürzen, wurde er vom Baum geschleudert. Ein dicker Tropfen, zäh wie fester Honig, hüllte den Kopf der Eidechse ein. Die Zunge, schon vorgestreckt, um die Larve zu fangen, ließ sich nicht mehr bewegen. Das kleine Herz pochte wild, die Knöpfchenaugen waren weit aufgerissen, als die Eidechse im Harz der Kiefer ganz langsam zu ersticken begann.
I
Johanna Luise streckte sich unter ihrem dicken Daunenbett. Sie mochte die Augen nicht öffnen, denn sie hatte einen herrlichen Traum gehabt, in dem sie gerne noch verweilen wollte. Sie war wieder zu Hause bei ihren Großeltern Hanna und Carsten Thurau in Lübeck. Der französische Weinhändler Luc Briand war mit seiner Frau und seinem Sohn Louis zu Besuch, und Johanna hatte ihm soeben das Versprechen abgenommen, die Familie bald auf dem Weingut vor den Toren von Bordeaux besuchen zu dürfen. Bei dem Gedanken an die geliebte Hansestadt, in der sie aufgewachsen war, seufzte sie tief und wurde vollends wach. Sie rieb sich die Augen. Ein weiterer Seufzer entwischte ihrer Brust. Wie sehr sie sich nach zu Hause sehnte. Johanna schlüpfte aus dem Bett, ging ans Fenster und öffnete es. Sie hörte den Vögeln zu, die den Tag mit zwitscherndem Gesang begrüßten, blinzelte in die Sonne und schaute über die Straße zur Marienkirche. Der Anblick schenkte ihr Trost, erinnerte sie das Gotteshaus doch ein wenig an die gleichnamige Kirche in Lübeck. Dort, in der Wehde zu St. Marien, war sie bis zu ihrer Konfirmation zur Lehranstalt für Mädchen gegangen. Vor allem Handarbeiten hatten auf dem Plan gestanden. Und auch über die Tiere und Pflanzen ihrer Heimat hatte Johanna viel gelernt. Sie wurde wehmütig bei dem Gedanken an die unbeschwerte Zeit, die sie mit ihren Freundinnen verbracht, und an die Abende mit ihrer Großmutter Hanna, die sie die französische Sprache gelehrt hatte.
Johanna schüttelte die Traurigkeit ab. Noch einmal führte sie sich ihren Traum vor Augen. Wie merkwürdig, dass sie ausgerechnet von Besuch aus Frankreich geträumt hatte. Es war schon lange her, dass sie Louis Briand zum letzten Mal gesehen hatte. Damals war sie noch ein Kind von vierzehn Jahren gewesen. Louis war drei Jahre älter als sie. Sie erinnerte sich an sein störrisches dunkelblondes Haar und die grauen Augen, die ihr so gut gefielen. Viel geredet hatten sie bei keiner ihrer Begegnungen. Johanna hatte ihre Freundinnen und Louis kein Interesse an kleinen Mädchen.
Das Haus des Stolper Bernsteindrehers Johann-Baptist Becker, bei dem sie seit zwei Jahren in die Lehre ging, lag in der Neuthorschen Straße an der Ecke zur Kirchhofsstraße. Gerade rumpelte eine Droschke die Neuthorsche entlang und verschwand aus Johannas Blick in den Abschnitt, den man die goldene Gasse nannte, weil dort die Bernsteinmeister ansässig waren, die aus dem Gold der Ostsee feinsten Schmuck und auch Gegenstände des täglichen Lebens machten wie Schalen oder Brieföffner. Von ihrem Fenster konnte sie nicht nur die Kirche sehen, sondern auch das Haus des Brauers Scheffler. Seine Tochter wohnte ihr direkt vis-à-vis. Die Vorhänge waren an diesem Morgen aufgezogen. Ein gutes Zeichen. Johanna konnte Trautlind in ihrem Bett sitzen sehen. Sie wusste nicht viel von ihr, nur dass man sie meist hinter geschlossenen Vorhängen versteckte, weil sie angeblich eine hässliche Nervenkrankheit hatte, und dass sie derartig auf dem Klavier zu spielen vermochte wie kein Zweiter in der ganzen Stadt. Nur selten hatte Johanna einen freien Blick in Trautlinds Zimmer. Manchmal winkten die jungen Frauen sich kurz zu, dann wieder blieb es nur bei einem Lächeln. Gewiss würde Trautlind an diesem Tag noch musizieren, und Johanna konnte ihr ein wenig zuhören, wenn sie in der Gasse die Frühlingssonne genoss, die bereits jetzt einige Kraft hatte.
Es muss schon spät sein, schoss es ihr durch den Kopf. Ihr Onkel Johann-Baptist würde enttäuscht sein, dass sie wieder einmal nicht mit ihm und seiner Frau Bruni gefrühstückt hatte. Er würde nicht verstehen, dass sie ihren Traum bis zum letzten Moment hatte auskosten wollen. Und er würde nie begreifen, dass es ihr einfach keine Freude machte, Tag für Tag in seine Werkstatt zu kommen und aus unförmigen Bernsteinbrocken die abenteuerlichsten Figuren zu schnitzen. Sosehr sie sich auch mühte, gelangen ihr doch nicht die Kunstwerke, die man offenbar von ihr erwartete. Warum also sollte sie es immer wieder aufs Neue probieren? Welchen Grund gab es, jeden Morgen das warme Bett zu verlassen? Nur weil ihre Mutter eine Künstlerin gewesen war, musste sie nun ein Handwerk erlernen, das doch für gewöhnlich Männern vorbehalten blieb. Keine ihrer Freundinnen in Lübeck musste in eine Lehre gehen. Sie wurden von ihren Müttern oder Ammen darauf vorbereitet, einen Haushalt zu führen. Johanna hatte nicht einmal eine Mutter. Die war gleich nach ihrer Geburt gestorben. Doch kurz vor ihrem Tod, so predigte man es Johanna wieder und wieder, hatte sie den dringenden Wunsch geäußert, ihre Tochter möge bei dem Bernsteindreher in Stolp in die Lehre gehen. Johanna hatte sich mit aller Kraft dagegen gewehrt – ohne Erfolg.
»Es ist so beschlossen«, hatte Großvater Carsten sie wissen lassen.
Und Großmutter Hanna hatte ergänzt: »Wir haben es deiner Mutter versprochen.«
Johanna steckte das lange braune Haar zu einem lockeren Knoten und kleidete sich an. In der Küche würde ihr das Dienstmädchen etwas Gutes zum Frühstück zubereiten, wie so oft, wenn Johanna wieder einmal spät dran war. In der Werkstatt dann würde Johann-Baptist sie schweigend und mit vorwurfsvollem Blick erwarten, doch es kümmerte sie nicht sehr. Sie wollte nicht hier sein. Und sie wollte nicht schnitzen. Wenn ihr mangelndes Talent und ihr fehlender Eifer ihrem Onkel so zu schaffen machten, sollte er sie doch endlich nach Hause schicken. Gerade wollte sie ihre Kammer verlassen, als es klopfte, gleich darauf die Tür aufflog, noch ehe Johanna etwas sagen konnte, und das Dienstmädchen Marija hereinkam. Sie war klein, drall und hölzern in ihrer Bewegung.
Marija machte einen umständlichen Knicks und verlor fast die Balance, so war sie in Eile. »Der Herr Becker wünscht Sie in der Stube zu sehen, Fräulein«, sagte sie.
»Er ist nicht in der Werkstatt?«, fragte Johanna erstaunt.
»Nein, er hat ausdrücklich gesagt, Sie sollen in die Stube kommen«, antwortete Marija und sah dabei aus, als müsste sie sich sehr konzentrieren, um sich an die Worte des Hausherrn zu erinnern.
»Na schön«, meinte Johanna leichthin. Sie fürchtete sich nicht vor einer Standpauke, die ihr bevorstehen mochte. Es wäre nicht die erste und gewiss auch nicht die letzte.
Die gute Stube war leer, als Johanna eintrat. Also nutzte sie die Zeit, um die neue Standuhr zu betrachten, die kürzlich aus Amsterdam geliefert worden war. Sie liebte das aus Messing gefertigte Zifferblatt. Dabei war es weder der Glanz des polierten Metalls, den sie so mochte, noch interessierte sie sich für die Anzeige von Datum und Wochentag, von Monat oder Sternbild. Ihr Blick war fest auf die bemalten Metallschiffe gerichtet, die in zwei Reihen oberhalb des Zifferblatts auf den Wellen erstarrt waren. Nur noch zwei Minuten, dann würde die Uhr die volle Stunde schlagen, und die Schiffe würden über das metallene Meer tanzen. Sooft sie das seit der Ankunft der Uhr auch schon gesehen hatte, so sehr konnte der Anblick sie immer wieder erfreuen und ihre Phantasie beflügeln, sich Geschichten über kühne Seefahrer und wilde Piraten auszudenken. Sie starrte gebannt hinauf. Schon war ihr, als würden sich die Segel im Wind blähen. Doch wenige Sekunden bevor der Minutenzeiger auf die Zwölf rückte und die Mechanik sich in Bewegung setzte, betrat Johann-Baptist den Raum, und Johanna fuhr zu ihm herum. Obwohl er längst ein alter Mann war, der sich zur Ruhe setzen sollte, machte er mit seiner kräftigen Statur und dem vollen grauen Haar und ebensolchem Bart noch immer eine gute Figur, die einen jeden beeindruckte. Hinter Johanna schlug die Standuhr zehn, und ein leises Surren verriet, dass das Schauspiel der Schiffe begann. Sie ärgerte sich, dass sie es dieses Mal verpasste, verzichtete jedoch darauf, ihrem Onkel den Rücken zu kehren.
»Setz dich, mein Kind«, sagte er. Er klang ein wenig müde, ließ aber nicht erkennen, ob er böse auf sie war.
Johanna nahm in einem Sessel nahe dem Kamin Platz und ließ sich von den Wandbehängen ablenken, die Gondeln auf den Kanälen Venedigs zeigten. Wenn wie jetzt Sonnenstrahlen auf dem feingearbeiteten Stoff tanzten, schienen auch die sonderbaren Schiffchen auf dem Wasser zu hüpfen.
Johann-Baptist holte tief Luft und begann: »Du weißt, Johanna, dass du bei uns bist, weil deine Mutter, meine Nichte, es sich so gewünscht hat. Sie hat dir einen für eine Frau ungewöhnlichen Lebensweg aufgebürdet. Da sie aber ein so großes Talent für das Bernsteinschnitzen hatte, haben wir gehofft, du hättest dieses ebenfalls. Wir haben dich gern bei uns aufgenommen und waren allerbester Hoffnung.«
»Die ich nicht erfüllt habe«, sagte sie trotzig, als er Atem holte.
»Das ist wahr.«
Johanna schnappte nach Luft, um sich zu rechtfertigen, doch sie ließ es gut sein. Viel zu oft schon hatten sie darüber gestritten. Diesmal sah ihr Onkel traurig und grau aus. Sie wollte ihm keinen Kummer bereiten, denn im Grunde hatte sie ihn gern. Er war stets gut zu ihr gewesen.
»Das ist wahr«, wiederholte er. »Nur darf ich dir daraus keinen Vorwurf machen. Ich hätte wissen müssen, dass das Talent deiner Mutter einzigartig war. Sie hatte es bereits von ihrer Mutter, meiner geliebten Schwester, geerbt, und es war bei der Tochter noch größer, noch wunderbarer als bei der Mutter. So glaubte ich wohl, bei dir würde sich die Reihe fortsetzen.« Er schwieg und sah sie an. In seinem Blick lag Erschöpfung, die Lider schienen ihm schwer zu sein. Doch auch die Liebe, die er für seine Nichte empfand, strahlte aus seinen Augen. »Du weißt, dass Vincent von Anfang an dagegen war, dich in die Lehre zu nehmen. Er sollte längst allein die Geschäfte führen. Einzig deinetwegen habe ich ihm das Zepter noch nicht in die Hand gegeben, denn ich bin sicher, ihr hättet einander das Leben zur Hölle gemacht.« Er lachte leise in sich hinein.
Johanna und ihr Cousin Vincent waren wahrhaftig wie Hund und Katze. In ihm hatte sich ein Groll auf seine Tante entwickelt, den er vom ersten Tag an auf Johanna übertragen hatte. Und dann auch noch ein Mädchen in einem Handwerk, das schlug doch wohl dem Fass den Boden aus. Ihr mangelndes Talent und fehlendes Interesse taten das Übrige. Vincent wollte nur eins, Johanna loswerden. Sie wiederum war gegen ihren Willen in Stolp. Da war ihr einer, der ihr offen seine Abneigung zeigte, nur recht, um ihren Zorn gegen ihn zu richten. Onkel und Tante waren stets freundlich, ließen ihr vieles durchgehen und verwöhnten sie. Ihnen konnte Johanna nicht zornig begegnen. Also galt dem Cousin all ihre Ablehnung.
»Es ist so schön, dich hier zu haben«, sagte Johann-Baptist. »Deine Großmutter habe ich verloren, und die Zeit mit deiner Mutter war gar zu kurz.« Er seufzte bei der Erinnerung und machte wieder eine lange Pause.
Für Johanna war Hanna Thurau aus Lübeck ihre Großmutter, doch sie wusste, dass sie nicht ihre leibliche Großmutter war. Das nämlich war Luise gewesen, die Schwester von Johann-Baptist, die mit jungen Jahren von der Familie fortgegangen war und deren Namen sie als zweiten Namen trug. Luise hatte irgendwann ein Mädchen zur Welt gebracht, Johannas Mutter. So viel immerhin wusste sie. Doch das war schon fast alles. Viel mehr erzählte man ihr nicht.
»Warum ist meine Großmutter damals fortgegangen, und warum war meine Mutter nur kurze Zeit bei euch?«, fragte sie darum in der Hoffnung, endlich Antworten zu erhalten.
»Das sind lange Geschichten, mein Kind.«
»Ich weiß, denn das ist jedes Mal deine Antwort. Warum erzählst du mir diese Geschichten nicht endlich? Denkst du nicht, ich bin alt genug?« Sie wollte ihm keinen Kummer bereiten, doch wie so oft ereiferte sie sich immer mehr.
»Es ist keine Frage des Alters«, beschied Johann-Baptist sie. Seine Stimme verriet, dass auch sein Ärger und seine Ungeduld wuchsen. »Du bist jetzt achtzehn Jahre alt, doch auch mit achtundzwanzig würdest du es nicht verstehen. Es ist keine Geschichte für eine junge Frau.«
»Aber es ist meine Geschichte«, beharrte sie.
»Sei endlich still!« Er hatte die Stimme erhoben und musste aufgrund der plötzlichen Anstrengung husten. Etwas leiser fuhr er fort: »Bruni und ich haben uns gestern beraten und beschlossen, dass es keinen Zweck hat, dich weiter hierzubehalten.«
Johanna sah ihren Onkel mit großen Augen an. Sollte das wirklich heißen, dass sie zurück nach Lübeck gehen durfte? Würde sie ihre Großeltern und die geliebte Hansestadt bald wiedersehen, so wie in ihrem Traum? Sie konnte ihr Glück kaum fassen.
»Wir sind dem Wunsch deiner Mutter nachgekommen, aber dir fehlt das Talent zum Schnitzen. Warum also sollten wir dich weiter quälen? Du wirst es nie zu mehr bringen als zur gewöhnlichen Paternostermacherin. Du kannst einfache Arbeiten erledigen, ja, aber dabei wird es auch bleiben.«
»Es tut mir leid, dass ich euch so enttäuscht habe«, sagte Johanna aufrichtig. Wenn sie auch die Zusammenhänge nicht kannte, so war ihr doch seit langem klar, wie groß die Hoffnung war, die ihr Onkel in sie gesetzt hatte. Es musste ihm sehr weh tun, diese Hoffnung nun in Scherben zu sehen. Doch neben dem Bedauern keimte ein anderes Gefühl in Johanna auf. Es musste herrlich sein, ein besonderes Talent zu haben. Sie verfügte über keinerlei Talent, sie war nur gewöhnlich, wie ihr Onkel gesagt hatte. Ohne erklären zu können, warum sie so betrübt darüber war, spürte sie, wie diese Aussage an ihr zu nagen begann. Sehr schwer fiel es ihr freilich nicht, den Stachel zu ignorieren, der nun in ihrem Fleisch steckte. Die Freude über die baldige Abreise ließ alle anderen Empfindungen in den Hintergrund treten.
»Es ist nicht deine Schuld, mein Kind.« Johann-Baptist fuhr sich mit der Hand über die Augen. »Wie auch immer, Vincent wird endlich die Geschäfte übernehmen, du gehst zurück nach Lübeck, und ich kann mir mit Bruni die Zeit angenehm gestalten, die uns noch bleibt.«
Nun hielt es Johanna nicht mehr in dem Sessel. Sie sprang auf, fiel ihm um den Hals und drückte ihn fest an sich. »Ich danke dir, Onkel. Ganz gewiss ist das die richtige Entscheidung. Meine Mutter hätte sicher ebenso entschieden«, fügte sie hinzu, ohne auch nur eine Ahnung von dem zu haben, was ihre Mutter getan oder gelassen hätte. Sie kannte sie ja nicht, wusste kaum etwas von ihr. So oft hatte sie als Kind am Grab gestanden und gehofft, bald wieder spielen gehen zu können. Sie hatte keine Trauer empfunden und keine Sehnsucht. Ihre Mutter war nur ein Name für sie. Ihr Onkel dagegen vermisste seine Nichte schmerzlich. Er hatte sie gekannt und ihr ihren letzten Wunsch erfüllt. Für ihn war es von Bedeutung, ob sie seine Entscheidung gutgeheißen hätte oder nicht.
Statt etwas darauf zu erwidern, seufzte er nur und tätschelte Johanna die Wange.
»Wann werde ich reisen?«, fragte sie aufgeregt.
»Der Wagen ist morgen früh für dich bereit, wenn du willst.«
»Und ob ich will«, jubelte sie. Als sie seinen betrübten Blick sah, fügte sie schnell hinzu: »Ich komme euch ganz bestimmt besuchen. Das verspreche ich.«
»Ja, gewiss«, sagte Johann-Baptist und lächelte nachsichtig.
Sie blinzelte in die Sonne, als sie aus dem Haus trat. Noch musste man einen leichten Mantel über dem Kleid tragen, doch der Sommer des Jahres 1824 schickte schon seinen Duft voraus und würde bald in die Stadt kommen. Johanna wollte sich von den Gassen verabschieden, die ihr für zwei Jahre ein Zuhause, aber niemals eine Heimat geworden waren. In der Sonne zeigten die roten Backsteine, aus denen die meisten Häuser gemacht waren, ihre ganze Pracht. Sie schimmerten orange, gelb, braun und sogar violett, was ihr besonders gut gefiel. Wie schön würde es sein, schon bald die Backsteingebäude von Lübeck begrüßen zu können.
Auch Marcus Runge, dem Apotheker, wollte sie Lebewohl sagen. Er war ihr einziger Freund in Stolp. Nie würde sie vergessen, wie sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Johanna war kaum zwei Wochen bei ihrem Onkel gewesen, als es zum ersten Streit gekommen war. Vincent hatte ihr vorgeworfen, dass sie sich ungeschickt anstelle, wie ein Esel, dem man das Tanzen beibringen wolle, ein Wort hatte das andere gegeben, bis sie schließlich auf und davon gelaufen war. Nicht ohne einen Brocken Bernstein und ein Schnitzmesser in die Tasche ihrer Schürze verschwinden zu lassen. Sie würde es ihrem hochnäsigen Cousin schon zeigen. Wenn ihre Mutter eine solch grandiose Künstlerin war, wie man ihr stets unter die Nase hielt, dann musste sie doch wenigstens einen Funken dieses Talents in sich tragen.
Sie stand am Brunnen vor dem Haus von Brauer Scheffler und lächelte bei dem Gedanken an damals. Wie starrköpfig sie doch gewesen war. Sie war die Kirchhofsstraße entlanggerannt, um das Spritzenhaus herum bis zur Mittelstraße, von wo sie schließlich den Marienkirchhof betreten hatte. In einer Nische, die der mächtige Kirchenbau bildete, blieb sie stehen, holte Bernstein und Messer hervor und begann mit ihrem törichten Tun. Ihre Hände zitterten von der Aufregung, und ihre Konzentration war nicht bei dem Material, wie ihr Onkel sie immer wieder ermahnt hatte, sondern bei der dreisten Beleidigung ihres Cousins. Sie mit einem Esel zu vergleichen war eine Frechheit, die sie sich nicht gefallen lassen musste. Sie würde ihm schon zeigen, wer hier der Esel war. Mit aller Wut setzte sie das Messer an und trieb es ohne jegliches Fingerspitzengefühl in den dunkelbraunen Klumpen in ihrer linken Hand.
»Niemals den Stein in der Luft halten«, hörte sie ihren Onkel predigen. »Der Bernstein muss immer fest aufliegen, wenn du ihn bearbeiten willst.«
Johanna wusste es besser. Für sie galten die Regeln nicht, denn sie hatte die einzigartige Begabung ihrer Mutter geerbt. Es musste so sein. Mit dem Amulett, in dem eine Eidechse eingeschlossen war und das einmal ihrer Mutter gehört hatte, musste sie auch das Talent geerbt haben.
Dass Bernstein ein weiches Material sein sollte, wollte ihr nicht in den Kopf. Dieser Brocken hier war es jedenfalls nicht. Keinen Millimeter drang die scharfe Klinge vor. Auch diesem sturen Stein würde sie es zeigen. Sie würde ihn in genau die Form zwingen, die sie sich ausgedacht hatte. Wieder setzte sie das Messer an, legte alle Kraft hinein, rutschte ab und spürte einen brennenden Schmerz zwischen Mittel- und Zeigefinger. Das Werkzeug steckte in ihrer Hand, Blut quoll an beiden Seiten der Klinge hervor. Ihr wurde übel und schwarz vor den Augen.
»Ein junges Mädchen und ein so scharfes Messer, das konnte nicht gutgehen.«
Johanna fragte sich, woher der Mann mit den runden Augengläsern und dem schütteren schwarzen Haar auf einmal gekommen war.
»Was erlauben Sie sich?«, sagte sie noch immer aufgebracht, während er ein großes Leinentuch um ihre Hand wickelte. »Warum hacken überhaupt alle auf mir herum? Ich bin ja erst seit zwei Wochen hier. Da kann man doch nicht erwarten, dass ich schon eine Meisterin bin!«
»Da haben Sie allerdings recht. Kommen Sie, und halten Sie die linke Hand schön hoch, wenn Sie können.« Er brachte sie zu einem kleinen Gebäude, dessen Rückseite direkt auf den Marienkirchhof ging. Vor dem Haus verlief die Mittelstraße. Er schob sie zwei Stufen hinauf und führte sie in einen Raum, der nach Kamille, Minze und Hoffmannstropfen roch. Johanna ließ sich auf einen Stuhl fallen und kämpfte gegen die Übelkeit.
»Es wird gleich ein bisschen weh tun«, kündigte der Mann an.
»Es tut jetzt schon sehr weh«, gab sie zurück.
»Ja, das kann ich mir denken. Wollen Sie etwas haben, auf das Sie beißen können?« Er nahm ihre Hand und legte drei Finger um den hölzernen Griff des Messers.
»Wird es so schlimm?«, fragte sie mit vor Entsetzen geweiteten Augen. Sie hatte noch gar nicht ausgesprochen, da hatte er mit einem Ruck das Messer aus ihrer Hand gezogen.
Johanna schrie auf.
»Schon geschafft«, beruhigte er sie.
Doch das war eine glatte Untertreibung, denn nun holte er eine Schüssel, hielt die verletzte Hand darüber und goss aus einem Krug kaltes sauberes Wasser über die Wunde. Das brannte, war jedoch gar nichts im Vergleich zu dem Schmerz, den Johanna ertragen musste, als er den Schnitt mit einem in einer scharf riechenden Flüssigkeit getränkten Tuch betupfte.
»Sind Sie Arzt?«, fragte sie, als der schlimmste Schmerz vorbei war und in ein dumpfes Pochen überging.
»Fast«, erwiderte er konzentriert. »Ich bin Apotheker.« Fachmännisch legte er ihr einen Verband an. »Bewegen Sie einmal die Finger«, bat er und betrachtete aufmerksam das, was aus dem weißen Mull hervorsah.
Johanna beugte und streckte alle Finger nacheinander.
»Gut. Wie es aussieht, haben Sie keine Sehne durchtrennt. Sie werden mit etwas Glück nicht einmal eine Narbe behalten.«
Noch immer stand Johanna am Brunnen und dachte an diese erste Begegnung. Sie lauschte dem Klavierspiel von Trautlind, das aus dem Hause Scheffler zu hören war. Der Apotheker hatte sich ihr als Marcus Runge vorgestellt, sie hatte ihm erklärt, warum sie nach Stolp gekommen war. Zwei Tage später war sie mit Johann-Baptist und Bruni zu ihm gegangen, um sich für seine Hilfe zu bedanken. Die Wunde heilte schnell, er hatte alles richtig gemacht. Der Bernsteindreher Becker und der Apotheker Runge waren gut miteinander bekannt. Marcus, der einzige Sohn der Runges, hatte recht früh die Apothekerskunst seines Vaters erlernt und die Geschäfte übernommen. Er galt in der Stadt als fleißiger und anständiger Mann, und so hatte Johann-Baptist nichts dagegen, dass seine Nichte hin und wieder zu ihm ging. Marcus war knapp zehn Jahre älter als Johanna. Sie waren wie Feuer und Wasser. War sie wild und ungestüm, so war er ruhig und meist ernst. Dennoch schien er sich über ihre Besuche in der Apotheke stets zu freuen. So würde es sicher auch an diesem Tag sein, an dem sie ihm die gute Nachricht bringen konnte, dass sie endlich nach Hause durfte.
Johanna riss sich von den Klängen einer Symphonie los und spazierte zwischen den Häusern des Buchbinders, des Schuhmachers und des Küsters bis zur großen Bäckerei, an die sich die alte Apotheke lehnte. Sie betrat die Diele, die am Tage für die Kranken offen stand, und klopfte an die Tür zu seinem Kontor, wie es alle taten, die eine Arznei gemischt haben wollten.
»Nur herein!«, rief Marcus von drinnen.
»Guten Tag.«
»Ah, Sie sind es, Johanna. Gut, Sie haben kein Messer in der Hand«, scherzte er, wie immer, wenn sie sich trafen. Darüber hinaus war Humor nicht seine Sache.
»Nein, und Sie brauchen sich darum auch keine Sorgen mehr zu machen.«
Er stellte eine Dose hin, aus der er gerade getrocknete Blüten, Wurzelstücke und Stengel in ein Säckchen gefüllt hatte. »So? Haben Sie sich entschieden, die Schnitzerei aufzugeben?« Durch seine Gläser wirkten die Augen größer, als sie in Wirklichkeit waren.
»Die Wahrheit ist, mein Onkel hat es mit mir aufgegeben.« Sie strahlte ihn an. »Er lässt mich endlich wieder nach Hause gehen.«
»Oh.« Marcus nahm die Brille ab und steckte sie gedankenverloren in die Dose zu den Pflanzenteilen. »Sie gehen fort?«
Johanna lachte schallend und schlug sich dann rasch eine Hand vor den Mund. Es gehörte sich nicht, beim Lachen derart die Zähne zu entblößen, das wusste sie natürlich. Zudem lachte sie ihn aus, wenn man es genau nahm, doch das war keinesfalls böse gemeint.
»Haben Sie sich denn hier kein bisschen wohl gefühlt?«, fragte Marcus, der ihr Gelächter offenbar falsch deutete. »Freut es Sie so sehr, uns und unsere Stadt zu verlassen?«
Sie kicherte noch immer und deutete auf seine Gläser, die aus den würzig duftenden getrockneten Pflanzenteilen ragten.
»Oh.« Er zog die Brille heraus und rieb sie lange an seinem Ärmel.
»Sie wissen doch, wie wenig mir die Schnitzerei liegt«, sagte Johanna und griff nach einer Büchse, auf der Arnica montana geschrieben stand. Sie öffnete sie und schnupperte, während sie weitersprach: »Und dann die ewigen Streitereien mit meinem Cousin Vincent. Das Schlimmste daran ist, dass er ja recht hat. Ausgerechnet Vincent und ich müssten uns geradezu lieben, denn wir wollen doch beide dasselbe.«
Marcus zog die Augenbrauen hoch.
»Aber gewiss. Wir wollen beide, dass ich die Finger vom Bernstein lasse und nach Lübeck fahre, wohin ich gehöre.«
»Dann haben Sie jetzt ja beide, was Sie wollen«, stellte er fest.
Johanna war überrascht. Er kannte alle Geschichten, alle Vorkommnisse, die ihr das Leben in Stolp so schwer machten. Zu ihm war sie gekommen, wenn sie sich wieder einmal schrecklich über Vincent geärgert hatte oder über sich selbst, weil sie ihrem Onkel gar zu großen Kummer machte. Warum nur konnte er sich nicht mit ihr freuen? Sie verstand die Welt nicht mehr.
»Ja«, rief sie, »schon morgen kann ich nach Hause reisen.«
»Morgen schon?« Jetzt sah er wirklich betroffen aus.
Johanna begriff. Er mochte sie, und es war ihm nicht einerlei, dass er sie verlieren würde. Es gab nicht viel Zerstreuungen in seinem Leben. Schon oft hatte Johanna Onkel und Tante darüber reden hören, wie ganz und gar unverständlich es sei, dass eine Partie wie er noch immer keine Braut an seiner Seite habe. Doch daran schien er nicht interessiert zu sein. Johannas Interesse an all den Tiegeln und Fläschchen, den Kräutern und Tinkturen seiner Apotheke hingegen machte ihm große Freude. Fast immer, wenn sie zusammen waren, erklärte er ihr mehr seiner Heilkunde, und sie lernte dazu und wurde von Mal zu Mal wissbegieriger. Wenn sie an die gemeinsamen Stunden dachte und daran, wie viel er ihr noch hätte beibringen können, wurde ihr das Herz schwer.
»Ja, morgen«, sagte sie. »Ich bin so glücklich. Lübeck ist die schönste Stadt der Welt. Sie müssen mich unbedingt dort besuchen kommen.«
»Würde Ihnen das Freude machen?«
»Aber natürlich!« Johanna strahlte ihn an. »Sie werden sehen, Travemünde ist noch schöner als Stolpmünde, und gewiss kann mein Großvater arrangieren, dass Sie sich die Löwenapotheke ansehen. Schon das alte Haus mit seinen Treppengiebeln würden Sie lieben. Ein goldener Löwe liegt über der Tür im Portal zur Johannisstraße. Und wenn Sie erst den Apotheker kennenlernen. Er ist ein angesehener Kaufmann und hat dafür gesorgt, dass es eine ganze Reihe von Privatapotheken in der Hansestadt gibt.«
»Das wäre nett«, meinte er zurückhaltend. Wenn er so traurig dreinblickte, sah er aus wie ein Feldmäuschen, fand sie, mit der kleinen spitzen Nase, dem spitzen Mund und den feinen Lippen.
»Also, dann …«, sagte sie etwas unentschlossen.
»Ja«, erwiderte er, »dann …« Erneut rieb er die Brillengläser an seinem Ärmel.
»Dann ist es wohl Zeit, Abschied zu nehmen.« Sie streckte ihm die Hand hin. »Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie mich besuchen, ja?«
Zögernd nahm er ihre Hand. »Kann ich Sie morgen noch sehen, bevor Sie abreisen?«
Johanna freute sich. »Aber natürlich, warum nicht?«
»Gut.« Jetzt drückte er ihre Hand kräftig. »Dann bis morgen.«
»Bis morgen«, sagte sie und huschte zur Tür hinaus.
Sie nahm denselben Weg zurück, den sie gekommen war. Als sie fast das Haus ihres Onkels erreicht hatte, trat Frau Scheffler, die Frau des Braumeisters, auf die Straße.
»Fräulein Johanna?«
»Ja?«
»Guten Tag, meine Liebe.« Frau Scheffler, eine schlanke Dame mit farblosem Schopf und bleicher Haut, kam auf sie zu. »Ich wollte Sie schon längst einmal ansprechen«, begann sie und lächelte freundlich. »Ich habe bemerkt, dass Sie und Trautlind einander hin und wieder grüßen.«
»Ja«, sagte Johanna. Sie deutete an der Fassade des Giebelhauses hinauf zu dem weißgerahmten Fenster, hinter dem eine weiße Spitzengardine zu erahnen war. »Mein Zimmer ist gleich dort oben, genau gegenüber von dem Ihrer Tochter.«
Frau Schefflers Gesichtsausdruck wurde mit einem Mal ernst und fast ein wenig ängstlich. Sie blickte sich rasch um und sah nach der Haustür, doch dort war kein Mensch zu sehen.
»Leider müssen wir die Vorhänge oft geschlossen halten. Trautlind leidet unter furchtbaren Kopfschmerzen und kann das Sonnenlicht nur schwer vertragen«, log sie. »Doch ich habe bemerkt, dass es ihr so viel Freude macht, Sie zu sehen. Wenn Sie ihr winken, dann spricht sie manchmal sogar.«
»Ach, spricht sie denn nicht immer?«, fragte Johanna überrascht.
Frau Scheffler senkte den Kopf. »Nein, sie spricht kaum ein Wort«, sagte sie, und der Kummer ließ ihre Stimme brüchig klingen wie dünnes Glas.
»Was fehlt ihr denn?«, wollte Johanna wissen.
Wieder schaute sich Frau Scheffler um. »Es sind die Nerven«, flüsterte sie. »Nur wenn sie am Klavier sitzt, scheint sie sich wohl zu fühlen. Dann ist sie in ihrer eigenen Welt und ist glücklich.« Sie lächelte versonnen. »Sonst starrt sie oft stundenlang vor sich hin, oder sie ordnet Dinge.«
»Sie ordnet Dinge? Welche Dinge denn?«
»Alles. Alles muss für sie eine bestimmte Ordnung haben. Wenn ich eine Stickarbeit liegen lasse oder wenn ein Sessel nicht exakt an dem Platz steht, an den er in ihren Augen gehört, dann muss sie die Ordnung wiederherstellen, verstehen Sie?«
»Ja«, sagte Johanna, obwohl sie das beschriebene Verhalten keinen Deut verstand.
»Nun, ich dachte mir, weil Trautlind doch keine Freundin hat, Sie aber zu mögen scheint, vielleicht möchten Sie sie einmal besuchen und ihr zuhören, wenn sie spielt.«
»Liese!« Das war die Stimme des Braumeisters.
»Ich komme!«, rief Frau Scheffler, und zu Johanna sagte sie: »Mögen Sie es sich überlegen?« Dann raffte sie ihr Kleid und wollte zum Haus laufen.
»Ich kann nicht«, entgegnete Johanna eilig. »Morgen reise ich ab, nach Lübeck, nach Hause.«
»Oh, dann vielleicht, wenn Sie zurück sind, ja?« Sie hob die Hand zu einem raschen Gruß und verschwand im Haus.
»Aber ich komme nicht zurück. Jedenfalls nicht so bald«, rief Johanna ihr hinterher, wusste aber nicht, ob sie sie noch gehört hatte. Ratlos stand sie auf dem Pflaster, das in der Sonne glänzte. Sie zuckte mit den Schultern und ging langsam auf das Haus ihres Onkels zu. An der schweren Haustür angekommen, drehte sie sich noch einmal um und sah hinauf zu Trautlinds Zimmer. Das Mädchen stand am Fenster und schaute hinunter. Johanna winkte ihr zu, doch Trautlind reagierte nicht. Sie schien durch Johanna hindurchzublicken.
Von der Diele lief Johanna die kunstvoll gedrechselte Treppe hinauf. Sie wollte in ihr Zimmer gehen, doch aus dem Salon, an dem sie vorbeikam, hörte sie ein Stimmengewirr, das ihr sonderbar erschien. So blieb sie kurz stehen und lauschte.
»Aber Sie können ihn doch nicht so einfach mitnehmen. Das kann doch nur ein furchtbarer Irrtum sein.« Das war die Stimme von Johann-Baptist.
»Sollte ein Irrtum vorliegen, wird sich das zeigen«, erwiderte jemand, den Johanna nicht erkannte. »Die Hinweise, die wir haben, wiegen schwer, die Indizien sind erdrückend.«
»Hinweise«, schnaubte jemand, der sehr nach Vincent klang. »Dass ich nicht lache! Sie sagen ja nicht einmal, von wem Sie diese vermeintlichen Hinweise haben.«
»Aus gutem Grund«, gab der Fremde zurück. »Wenn Sie reinen Gewissens sind, können Sie mir jetzt ja ohne großes Aufheben folgen. Dann wird sich alles rasch klären, und Sie können wieder nach Hause gehen. Aber darüber habe ich nicht zu entscheiden.«
»Sie können doch nicht …«, setzte Johann-Baptist noch einmal an, wurde dann aber offenbar unterbrochen.
Johanna hörte ein Poltern und Rumpeln, dann schwere Schritte, und schon flog die Tür zum Salon auf, so dass sie einen Satz zur Seite machen musste.
Vincent, die Hände auf den Rücken gebunden, stolperte heraus. Er warf ihr einen Blick zu, in dem Hass und Verzweiflung lagen, die diesmal jedoch kaum ihr galten. Ein Uniformierter schob ihn vor sich her. Er nickte Johanna kurz zu und trieb Vincent dann die Treppe hinunter und aus dem Haus.
»Was um Himmels willen war das?«, fragte sie ihren Onkel, der im Sessel zusammengesackt war. Sein Gesicht war so grau wie sein Bart und sein dichtes Haar.
»Vincent«, stammelte er. »Sie haben ihn einfach mitgenommen.«
»Das habe ich gesehen. Aber warum denn nur?«
Er atmete schwer. »Er soll ein Schmuckstück gefälscht haben.«
»Was?«
»Ja«, keuchte er, »einen Einschluss.«
Johanna machte sich ernstlich Sorgen um ihren Onkel. Er sah aus, als würde er jeden Moment zu Boden sinken.
»Das kann doch nicht sein.« Was auch immer sie von ihrem Cousin hielt, ein Gauner und Betrüger war er ganz gewiss nicht. Dafür würde sie ihre Hand ins Feuer legen. Nur, wie konnte sie das beweisen?
»Du kannst nicht gehen«, sagte Johann-Baptist schnaufend. »Wir brauchen dich. Wir brauchen jede helfende Hand, solange Vincent nicht da ist.«
Femke Thurau war überglücklich, wieder in Lübeck zu sein. Obwohl die Reise von Wolgast nach Hause beschwerlich war, hatte sie kaum etwas davon bemerkt. Es war ihr erschienen, als wäre der Wagen ihres Vaters nur so dahingeflogen. Endlich hatte sie mit Johannes über alles reden können, was sie beide in der langen Zeit der Trennung erlebt hatten. Sie hatte ihm berichtet, wie sie sich mit ihren und seinen Eltern in dem feuchten Weinlager vor den Franzosen versteckt hatte. Sie konnte über ihre Angst sprechen, die von ihr Besitz ergriffen hatte, nachdem sie unabsichtlich Generalleutnant Blücher, der den preußischen Truppen vorstand, zur Flucht verholfen hatte. Gemeinsam erinnerten sie sich daran, wie sie damals in das Lager der Franzosen gegangen war, ihnen Wein gebracht hatte, nicht gerade viel, aber doch genug, um die ausgezehrten, erschöpften Soldaten betrunken zu machen. Als diese dann von ihrem Rausch in den Schlaf fielen, hatte Johannes mit seinen Kameraden fliehen können. Dass auch Blücher sich den Flüchtenden anschloss, hatte nicht zum Plan gehört und die Hansestadt in große Gefahr gebracht.
Johannes schilderte ihr den beschwerlichen Fußmarsch von Jena bis nach Lübeck, während dessen es bereits immer wieder zu Kampfhandlungen mit den überlegenen Franzosen gekommen war. Sie sprachen auch über die erste Zeit ihrer Trennung, in der sich beide über ihre Gefühle füreinander klargeworden waren. Es erschien ihnen wie ein Wunder, dass zwei Menschen wahrhaftig füreinander bestimmt sein konnten. Als Johannes nach Jena gehen musste, um dort die Rechte zu studieren, war Femke noch ein Kind und zwischen ihnen nichts als unschuldige Freundschaft gewesen. Sie begannen sich Briefe zu schreiben, und ihre Sehnsucht war von Tag zu Tag gewachsen. Als sie sich schließlich wiedersahen, war beiden klar, dass sie sich liebten und für immer zusammengehörten. Nur waren sie nicht mehr die Kinder von einst, sondern zwei Erwachsene, die endlich ihre gemeinsame Zukunft planten.
Das Wiedersehen mit Hanna und Carsten war tränenreich gewesen. Femke musste erschrocken feststellen, wie die Sorge der Eltern um sie Spuren in ihre Gesichter gezeichnet hatte. Obwohl sie nur einige Monate fort gewesen war, sahen Mutter und Vater um Jahre gealtert aus.
Dennoch ließen sie es sich nicht nehmen, zu einem Fest zu laden. Die Nebbiens, Johannes’ Eltern, waren natürlich zu Gast und auch Gärtner Fricke mit seiner Frau, Senator Brömse, Korkenschneider Mommsen und andere Geschäftsfreunde des Weinhändlers Thurau. Es war keine offizielle Verlobungsfeier. Die sollte es geben, wenn Femke sich von den Torturen der vergangenen Wochen erholt hatte. Aber immerhin traten sie und Johannes nun zum ersten Mal als Paar in Erscheinung.
Johanna tobte vor Wut und Enttäuschung. Sie schlug ungeduldig eine lange Strähne ihres Haares aus dem Gesicht, die sich aus dem Knoten gelöst hatte und sie nun ständig an der Oberlippe kitzelte.
»Ein einziger Tag«, schimpfte sie. »Hätten die nicht einen Tag später kommen und Vincent mitnehmen können? Dann wäre ich weg gewesen. Dann hätten sie eben einen Bernsteinschnitzer in Stellung nehmen müssen.«
»Ich bitte Sie, Johanna, reden Sie doch nicht so. Sollten Sie sich nicht wünschen, dass die ihn gar nicht abgeholt hätten?« Marcus Runge sah sie vorwurfsvoll an. Er hatte ihnen einen Tee gemacht, mit dem sie nun in seiner bescheidenen Stube saßen. Obwohl er es sich hätte leisten können, verzichtete er auf kostbare Teppiche oder teure Möbel. Sie saßen auf dem alten Sofa seiner Eltern, das längst in die Jahre gekommen war. Es gab einen kleinen Tisch, die Teekanne war bereits angeschlagen, und auch eine Tasse hatte einen Sprung, doch derartige Kleinigkeiten schien Marcus nicht zu bemerken. Meist war er viel zu sehr damit beschäftigt, die alten Bücher, darunter Folianten und Aufzeichnungen, zu studieren, die in großer Zahl die einfachen Regale ringsum an den Wänden füllten. Er las alte Rezepte, machte sich über die Heilmethoden der alten Ägypter und Griechen kundig und probierte eigene Rezepturen aus.
»Aber sie haben ihn nun einmal abgeholt. Der fromme Wunsch würde mir nichts nützen.«
»Sicher kommt alles recht bald in Ordnung, und dann können Sie nach Lübeck fahren«, versuchte er sie zum wiederholten Male zu beschwichtigen.
»Recht bald«, schnaubte sie. »Wann soll das sein?« Sie hielt ihre linke Hand hoch, in der bei ihrer ersten Begegnung das Messer gesteckt hatte, Zeigefinger und Daumen nur einen Hauch voneinander entfernt. »So nah habe ich meine Abreise vor mir gesehen. So nah … Und jetzt?« Sie ließ die Hände enttäuscht in den Schoß sinken.
»Sie könnten Ihren Onkel doch gar nicht im Stich lassen, Johanna. Das mag ich nicht glauben. Sie würden bleiben und ihm helfen, auch wenn er Sie gehen ließe.«
»Warum sollte ich wohl?«, fuhr sie ihn an. »Er hat mir doch oft genug bescheinigt, dass ich nichts kann, zu nichts nutze bin in seiner Werkstatt. Wieso sollte ich ihm jetzt eine Hilfe sein?« Böse starrte sie vor sich hin. Sie war wütend darüber, dass Marcus recht hatte. Natürlich würde sie jetzt nicht gehen, selbst wenn es ihr freigestellt wäre. Obwohl sie tatsächlich nicht wusste, ob ihre Arbeit ihrem Onkel in irgendeiner Weise nützlich sein konnte. »Ich verfluche den Bernstein!«, sagte sie finster. »Er hat mein ganzes Leben verdorben.«
»Wenn ich mich nicht irre, schlagen Sie sich erst seit zwei Jahren damit herum. Ist es nicht ein wenig übertrieben, da von Ihrem ganzen Leben zu sprechen?« Er hatte schon wieder recht. Und er blieb die Ruhe in Person, ließ sich von ihrer Wut und ihrem Temperament in keiner Weise anstecken. Es war zum Aus-der-Haut-Fahren. »Wissen Sie denn nicht, dass Bernstein ein ganz wundervolles Heilmittel ist?«, fragte er. »Ich beschäftige mich seit geraumer Zeit damit und bin guten Mutes, dass man damit viele Krankheiten lindern kann.«
Johanna sah ihn ungläubig an. »Sie treiben Scherze mit mir.«
»Ich bitte Sie. Denken Sie das wirklich?«
»Nein«, antwortete sie. »Wofür man Sie auch halten mag, aber bestimmt nicht für einen Scherzbold.«
»Aber für gänzlich humorlos halten Sie mich doch auch nicht, oder?« Er sah sie so ernst und fast ein wenig erschrocken an, dass sie lächeln musste.
»Ihre herausragendste Eigenschaft scheint der Humor jedenfalls nicht zu sein. Doch nun verraten Sie mir lieber, was es mit der Heilkraft des Bernsteins auf sich hat. Niemand in der Werkstatt hat je davon gesprochen, und selbst mein Onkel hat es nie erwähnt.«
»Das überrascht mich nicht.« Er griff nach seinen Augengläsern und stand auf. »Kommen Sie!«
Sie gingen in sein Kontor, wo sie sich meistens aufhielten. Von einem Regal sehr weit oben nahm er ein braunes Fläschchen. Ol. Succini stand darauf geschrieben.
»Georgius Agricola ist es gelungen, Bernstein durch ein wissenschaftliches Verfahren in seine Bestandteile zu zerlegen: Öl, Harz und Säure. Hier haben wir das Öl.« Er zog den Glasverschluss von der Flasche und hielt sie ihr hin.
Johanna schnupperte und rümpfte die Nase. »Das riecht wie … nach …« Es wollte ihr nicht einfallen.
»Es riecht metallisch, nicht wahr? Nach der Technik, die als Segen der Zukunft gepriesen wird.«
»Natürlich, Sie haben recht!« Johanna erinnerte sich, woher sie diesen kräftigen Geruch kannte. Ihre Großeltern hatten sie einmal mit nach Frankreich genommen. Sie war damals acht Jahre alt, und Großvater Carsten wollte, dass sie einen großen historischen Moment ihres jungen Lebens nicht verpasste, wie er sich damals ausgedrückt hatte. Es war die Ankunft der Elise in Le Havre, eines Schiffes, das nicht von der Kraft des Windes, sondern von einer sogenannten Dampfmaschine angetrieben wurde. Johanna konnte sich gut entsinnen, dass es ein schrecklich kalter Märztag war. Frierend hatten sie zu dritt im Hafen gestanden und gewartet. Und endlich traf die Elise wirklich ein und hatte damit zur größten Überraschung der zahlreichen Spötter die Überquerung des Kanals geschafft. Das Schiff ließ ein triumphierendes Tuten hören, als es, einen Schleier aus stinkendem schwarzem Rauch hinter sich herziehend, den Hafen erreichte.
»Die Säure hat einen noch intensiveren Geruch«, sagte Marcus in ihre Gedanken hinein. »Aber ich habe keine da. Man bekommt nicht immer welche, dabei ist der Säuregehalt des Bernsteins, der hier vor den Küsten gefischt wird, recht hoch.« Er holte eine Büchse hervor, die ihren Platz in dem Regal neben dem Fläschchen hatte. Darin befand sich ein sehr feines Pulver, das Johanna sofort an die Werkstatt erinnerte.
»Das ist Bernsteinstaub«, stellte sie fest. »Wir haben ihn überall auf den Tischen und Schemeln, selbst auf dem Boden und in den Regalen, wenn wir geschliffen haben. Jeden Abend wischen wir ihn fort, bevor wir die Werkstatt verlassen.«
»Sie sollten ihn besser zusammenkehren, anstatt ihn achtlos fortzuwischen«, tadelte er sie. »Dieser Staub, wie Sie ihn nennen, ist fein geriebenes Bernsteinpulver. Ich unternehme gerade einen Versuch, um herauszufinden, ob sich damit der Haarwuchs anregen lässt.« Er hüstelte verlegen und wurde sogar ein wenig rot. Johanna vermutete, dass er diesen Versuch weniger aus beruflichem als aus ganz eigenem Interesse unternahm. »Ich habe davon gelesen, dass das Pulver den Wuchs fördern soll. Die Damen in Stolp würden es mir aus den Händen reißen, wenn sich diese Vermutung bestätigt.« Johanna lächelte spöttisch. »Vor allem ist es aber hilfreich gegen Steine«, sprach er hastig weiter. »Mit etwas Wein vermischt, lindert es Gallen-, Nieren- und auch Blasensteine.« Er schraubte die Büchse wieder zu und stellte sie an ihren Platz. Auch das Fläschchen verschloss er sorgfältig. »Hätte ich schon Bernsteinpulver gehabt, als Sie sich damals die Hand verletzten, hätte ich es mit einer Salbe vermischt auf den Verband gegeben, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Bedauerlicherweise habe ich mich zu der Zeit noch nicht damit beschäftigt.« Er lächelte sie entschuldigend an.
»Die Wunde ist auch so rasch geheilt, ohne Narben zu hinterlassen«, sagte sie fröhlich und streckte die linke Hand vor. »Wie kamen Sie überhaupt darauf, Bernstein in Ihrer Apotheke zu untersuchen?« Sie sah ihm zu, wie er die Flasche zurück in das Regal stellte. Wieder huschte leichte Röte über seine blassen Wangen.
»Nun, wir hatten uns kennengelernt, und Sie haben so viel über Ihre Arbeit und den Bernstein erzählt.« Er hüstelte wiederum und schien nach Worten zu suchen. »Und ich hatte schon manches darüber gelesen«, ergänzte er rasch. »Es gibt so vieles zu lernen. Doch irgendwann konnte ich mir endlich die Zeit nehmen, mich mehr damit zu beschäftigen.«
Johanna nickte. »Gegen Kopfschmerzen oder Nervenkrankheiten hilft der Stein wohl nicht zufällig?« Trautlind war ihr wieder eingefallen. Wenn sie schon in Stolp bleiben musste, konnte sie Frau Scheffler den Gefallen tun und ihre Tochter einmal besuchen. Es wäre sicher nett, ihr beim Klavierspiel nicht nur zuzuhören, sondern sie auch dabei zu sehen.
»Über eine Wirkung bei Nervenkrankheiten ist mir nichts bekannt. Aber gegen Schmerzen hilft für gewöhnlich das Einatmen des Bernsteinrauches. Warum fragen Sie danach?«
»Ich habe gerade an jemanden gedacht. Warum weiß mein Onkel nichts von den wunderbaren Eigenschaften des Bernsteins? Tante Bruni ist oft nicht wohl. Vielleicht könnte er ihr helfen. Er könnte den Staub in der Werkstatt zusammenkehren und Ihnen bringen.«
»Oh, Ihr Herr Onkel weiß gewiss um die Wirkung.« Er nahm seine Gläser ab und rieb sie an seinem Ärmel. »Immerhin waren es die Bernsteinhandwerker drüben in Danzig oder Königsberg und anderen Orten, die allesamt die Pest überlebten. Matthäus Praetorius berichtet in seinen Schriften davon, dass sie regelmäßig Brocken als Räucherwerk benutzten und so die Luft von der Pestkrankheit reinigen konnten. Das ist nicht nur in der Zunft bekannt.«
»Warum nutzen die Handwerker ihr Wissen dann nicht? Das begreife ich nicht.«
»Nun, sie fürchten wohl die Macht des Steins. Sie müssen das verstehen, die Männer wollen keinen Fehler machen und die Kraft des Bernsteins womöglich im Negativen zu spüren bekommen. In nahezu allen Pflanzen stecken Ingredienzen, die eine Heilkraft besitzen. Jede Köchin geht täglich mit unzähligen Pflanzen um, ohne sie jedoch zur Heilung von Kranken zu verwenden. Das überlassen sie besser denen, die etwas davon verstehen. Und so machen es auch Ihr Onkel und seine Zunftbrüder.«
Als Johanna zum zweiten Mal an diesem Tag die Apotheke verließ, erschien es ihr nicht mehr gar so schrecklich, dass aus ihrer Heimreise nun doch nicht so bald etwas würde. So blieb ihr immerhin noch Zeit, mehr über die heilende Wirkung des Materials zu lernen, das sie jetzt mit ganz anderen Augen sah. Außerdem konnte sie Trautlind einen Besuch abstatten. Es hatte ihr schon sehr leidgetan, Frau Scheffler diesen Wunsch abschlagen zu müssen. Und schließlich würde der Aufschub gewiss nicht von langer Dauer sein. Vincent hatte nichts Unrechtes getan, dessen war sie sicher. Es musste doch mit dem Teufel zugehen, wenn sich das nicht bald herausstellen sollte.
II
So einfach, wie Johanna es sich vorgestellt hatte, war die Sache indes nicht. Die Tage verstrichen, ohne dass Vincent in die Werkstatt zurückkam. Damit nicht genug, es gab überhaupt keine Neuigkeiten. Johanna mühte sich redlich, eingehende Aufträge zu erledigen. Was wahrer Schnitzkunst bedurfte, musste jedoch Johann-Baptist übernehmen, der von Stunde zu Stunde grauer und erschöpfter zu werden schien. Wie gerne hätte sie es ihm leichter gemacht, doch sosehr sie es auch versuchte, vermochte sie doch kein ebenbürtiger Ersatz für Vincent zu sein. Bald wurde ihr klar, dass es so nicht weitergehen konnte.
Sie nahm sich ein Herz und sprach ihren Onkel am Abend nach einem weiteren langen Arbeitstag an. »Gibt es Neuigkeiten von Vincent, Onkel?«
»Nein.« Er stocherte in dem Fleisch auf seinem Teller herum und schien kein weiteres Wort für sie übrig zu haben.
Auch Bruni rührte ihr Essen kaum an und starrte angestrengt und mit vor unterdrückten Tränen glasigen Augen auf die weiße Damastdecke, die auf dem großen Eichentisch lag. Die Standuhr schlug neun. Johanna kümmerte es nicht. Sie hatte keinen Blick für das Auf und Ab der Schiffe, das mit leisem Schnarren ablief. Auch die bunten Wandbehänge und das flackernde Kerzenlicht konnten sie nicht ablenken. Zu schwer drückte die Stimmung in diesem Raum auf ihr Gemüt. Onkel und Tante ergaben sich offenkundig in ihr vermeintlich unausweichliches Schicksal. Johanna konnte kaum atmen, so schlug ihr der Kummer und die lähmende Verzweiflung der beiden entgegen. Sie hielt es nicht mehr aus.
»Wenn die Beamten nicht von allein darauf kommen, dass Vincent unschuldig ist, dann müssen wir es ihnen klarmachen.«
Bruni seufzte. Eine Träne schaffte es nun doch und rollte über ihre Wange. Es schmerzte Johanna, sie derart in Sorge zu sehen. Gleichzeitig war sie fassungslos, dass niemand es für möglich hielt, dem Verdächtigen zu helfen.
»Und wie sollen wir das anstellen?« Johann-Baptist sprach leise, aber dennoch war seine Wut nicht zu überhören. »Der Handschuhmacher Olivier ist ein ehrbarer Kaufmann. Er hat das Schmuckstück bei meinem Sohn bestellt und bezahlt.«
»Nein!«, rief Johanna aufgebracht. »Das behauptet er zwar, aber es kann nicht wahr sein. Ein Bernstein, in dem eine Biene eingeschlossen ist, das ist doch etwas ganz Außergewöhnliches. Aber weder kannst du dich an diesen Auftrag erinnern, noch kann Vincent es.«
»Natürlich können wir uns nicht erinnern, weil es diesen Auftrag niemals gab und sich der Stein mit der Biene nie in unserem Besitz befunden hat.«
»Also konntet ihr ihn auch schwerlich verkaufen!«
»Ich weiß das, Johanna, aber ich kann es nicht beweisen. Olivier hat das Papier, auf dem geschrieben steht, dass er dieses Schmuckstück von uns erworben und was es ihn gekostet hat. Der Anhänger ist exakt beschrieben, es ist die Handschrift meines Sohnes, und es ist das Papier aus meinem Kontor.«
»Also hat jemand das Papier gestohlen und die Schrift gefälscht. Es kann nicht anders sein.« Johanna hatte mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen und erschrak selbst über den dumpfen Laut und das feine Klirren der Gläser, die mit einem Mal den Salon erfüllten. Bruni schreckte zusammen und hielt sich dann die Hände vor den Leib.
»Hast du schon wieder Schmerzen?«, fragte Johann-Baptist sie, beugte sich zu ihr hinüber und streichelte über ihren Arm.
»Das Ganze ist mir wohl auf den Magen geschlagen. Ich werde zu Bett gehen, dann ist es morgen gewiss vorüber.« Sie stand auf.
»Ich werde Apotheker Runge nach einer Arznei fragen. Sicher kennt er eine Mixtur, die dir helfen wird.«
»Das ist eine gute Idee, mein Kind.« Bruni tätschelte ihr die Schulter und verließ das Zimmer.
Auch Johanna war der Appetit gründlich vergangen. Sie schob den Teller, auf dem sich noch eine gute halbe Lammkeule befand, von sich weg. Seit sie hier war, hatte sie wieder nach Hause fahren wollen. Doch so unwohl wie jetzt hatte sie sich nie zuvor gefühlt. Mit einem Schlag war es wirklich von Bedeutung, ob sie passable Brieföffner, Broschen oder Intarsien zustande brachte oder nicht. War es ihr in der letzten Zeit gleichgültig gewesen, ob ihr Onkel an ihrem Talent verzweifelte, so spürte sie jetzt einen Druck auf sich lasten, mit dem sie nicht umzugehen wusste. Und dann auch noch diese schreckliche Atmosphäre, die seit Vincents unfreiwilligem Fortgang im Hause herrschte. Jeder Raum schien auf einmal dunkler und unfreundlicher geworden zu sein, jedes Geräusch erschien unschicklich laut, jedes Lachen fehl am Platze. Johanna kam sich vor wie in einem Trauerhaus. Dabei war doch niemand gestorben. Erneut regte sich ihr Widerstand gegen die stumpfe Ergebenheit von Johann-Baptist und Bruni.
Bevor sie jedoch Pläne mit ihrem Onkel schmieden konnte, wie sich der wahre Schuldige finden ließe, sagte er: »Wir sollten auch zu Bett gehen. Ich will morgen noch eine Stunde früher anfangen. Ich weiß nicht, wie ich die Schnitzarbeiten sonst bewältigen soll.«
»Noch eine Stunde früher?« Johanna war entsetzt. Schon jetzt mutete er sich mehr zu, als er verkraften konnte. Wenn Johann-Baptist den Bogen überspannte und auch noch ausfiel, waren sie verloren.
»Das gilt ja nicht für dich«, erwiderte er böse. »Du bist mir in der Werkstatt ohnehin keine große Hilfe, da tut es nichts zur Sache, ob du eine Stunde früher oder später erscheinst.« Er stand auf und löschte die Kerzen, die in silbernen Leuchtern auf dem Tisch standen.
»Dann musst du eben einen Gesellen in Dienst nehmen, wenn ich denn zu gar nichts nütze bin. Ich habe von Anfang an nicht begriffen, warum du das nicht tust, sondern dich auf mich verlässt, obwohl du doch weißt, dass ich nicht ein solches Wunderkind bin, wie meine Mutter es war.« Sie musste hart schlucken, um nicht an dem Kloß in ihrem Hals zu ersticken.
»Das würde ich nur zu gern«, sagte er matt, »aber leider hat mir die Zunft weitere Gesellen versagt. Das habe ich dem Wunderkind, deiner Mutter, zu verdanken.« Damit ließ er sie allein im Salon zurück.
Nur noch die Kerzen in den Leuchtern an der Wand neben der Tür brannten. Die Standuhr hatte plötzlich etwas Bedrohliches, und auch die Kanäle Venedigs, die im schummrigen Licht eben noch auszumachen waren, wirkten fremd und unheimlich. Betrübt schlich Johanna in ihre Kammer. Johann-Baptist hatte ihren Einwand gründlich missverstanden. Sie hätte ihm das sagen sollen. Nun glaubte er, sie scheute das frühe Aufstehen. Dabei hatte sie doch nur Sorge, dass er seine Gesundheit über die Maßen strapazierte. Sie musste ihm sagen, dass es sich um ein dummes Missverständnis handelte. Sie würde sich bei ihm entschuldigen, gleich morgen früh. Doch es war auch an ihm, sie um Verzeihung zu bitten. Sie ließ sich auf ihr Bett fallen und atmete tief durch. Es war nicht richtig, wie er ihr gleich über den Mund gefahren war. Er hatte ihr ja nicht einmal die Möglichkeit gegeben, sich zu erklären. Stattdessen hatte er sie beleidigt. Und nicht nur sie, sondern auch ihre Mutter. Johanna musste an seinen letzten Satz denken. Es war das erste Mal, dass Johann-Baptist schlecht über seine geliebte Nichte gesprochen hatte. Was um Himmels willen hatte sie getan, dass die gesamte Zunft den Bernsteindreher Becker offenbar bestrafte? Oder hatte sie das falsch verstanden?
Am nächsten Morgen war Johanna die Erste in der Werkstatt. Gleich nach ihr erschien Johann-Baptist. Er hob nur die Augenbrauen, als er sie sah, sagte aber nichts. Um die Mittagszeit taten Johanna die Hände vom Halten der Schale weh, in die sie mit Hilfe einer Schablone Blumenornamente ritzen musste. Auch das Halten der Nadel und das Führen des Werkzeugs mit kontrolliertem Druck ließen die Finger schmerzen. Sie brauchte eine Pause. Vor allem aber wollte sie dem Handschuhmacher Olivier einen Besuch abstatten. Sie würde nicht wie alle anderen untätig warten, bis sich Vincents Unschuld durch ein Wunder von selbst zeigte oder er gar verurteilt und viele Jahre weggesperrt wurde. Sie würde diesen feinen Herrn zur Rede stellen.
»Ich möchte rasch zu Apotheker Runge wegen einer Arznei für Tante Bruni laufen. Ist das recht, Onkel?«, fragte sie deshalb.
Johann-Baptist schnitzte gerade an einem Familienwappen. Er sah auf und rieb sich die müden Augen. »Ja, geh nur.« Schon wendete er sich wieder seiner Arbeit zu.
»Wenn ich schon da bin, könnte ich uns etwas von Bäcker Schroth mitbringen. Die Backstube ist ja gleich nebenan.« Sie wollte ihren Onkel so gern ein wenig aufheitern.
Der alte Geselle Schneider, ein kleiner Mann mit breiten Schultern, einem kleinen Bauch und rötlichem Haar, der sich sicher bald auf das Altenteil zurückziehen würde, lächelte ihr aufmunternd zu. Der Bursche, der Handreichungen und Botengänge erledigte und wegen seiner schnellen Füße von allen Flitzebein genannt wurde, verbrannte sich beinahe die Finger am Ofen, auf dem er gerade ein heißes Wasserbad vorbereitete. Er sah mit glänzenden Augen zu ihr hinüber. Es war nicht schwer zu erraten, dass er auf eine Leckerei von Schroth hoffte. Johann-Baptist dagegen zeigte keinerlei Begeisterung, sondern brummte bloß etwas, das Johanna nur mit viel gutem Willen als Zustimmung deuten konnte.
Sie schlüpfte in ihren Mantel und trat hinaus auf die Straße. Wolken verdeckten die Sonne. Nicht einmal Trautlinds Klavierspiel war zu hören. Als ob sich die ganze Welt von der Traurigkeit anstecken ließe, dachte Johanna. Sie nahm nicht den kürzesten Weg zur Apotheke, sondern ging geradeaus, bis in die Butterstraße, wo der Lederhandschuhmacher sein Kontor und seine Werkstatt hatte. Es waren nicht viele Schritte bis dorthin. Als die Witwe Wegner ihr entgegenkam, senkte Johanna den Kopf. Sie wollte hier lieber nicht gesehen werden. Doch die alte Dame war ohnehin wie meist tief in Gedanken versunken und schlurfte an ihr vorbei, ohne sie zu bemerken.
Dachte Johanna zunächst noch voller Wut daran, wie sie Olivier so lange bedrängen würde, bis er ihr verriet, wer ihm in Wahrheit das Schmuckstück gegeben hat, wuchsen ihre Zweifel mit jedem Pflasterstein, den sie unter ihren Füßen hinter sich ließ. Als ob es so einfach wäre. Gewiss, es war festzustellen, ob ein Einschluss echt oder falsch war. Eine Fälschung mit einer Quittung über den Kaufpreis war ein erdrückender Beweis. Es lag also nahe, dem Stolper Kaufmann Glauben zu schenken. Dennoch hatte man ihm ganz bestimmt die eine oder andere Frage gestellt, bevor man Vincent abgeholt und eingesperrt hatte. Der angeblich Betrogene musste sich eine sehr gute Geschichte ausgedacht haben, die er auch Johanna erzählen würde. Oder erwartete sie etwa, dass er bei ihrem Anblick erweichen oder gar ihren Zorn fürchten würde? Wohl kaum. Je mehr sie darüber nachdachte, desto törichter erschien ihr ihr Tun. Sie wurde immer langsamer. Vor dem Haus des Handschuhmachers angekommen, blieb sie einen Moment unschlüssig stehen. Dann machte sie kehrt und eilte in die Kirchhofsstraße. Der Anblick der dicken Mauern der Marienkirche zu ihrer Linken brachte sie auf einen Gedanken. Sie musste mit Vincent sprechen. Es musste einen Grund dafür geben, dass man ihn angeschwärzt hatte, dass gerade er jetzt hinter dicken Mauern gefangen saß. Immerhin gab es noch einige Bernsteindreher in der Stadt. Warum war keiner von ihnen beschuldigt worden? Hier draußen an der frischen Luft, fern von der betrübten Tante und dem verbitterten Onkel, fühlte Johanna neue Energie in sich aufsteigen. Sie würde herausfinden, wer ihrem Cousin diesen Schlamassel eingebrockt hatte. Auf dem Weg zum Landarbeiterhaus, das man eingerichtet hatte, um Personen, die durch Müßiggang, Bettelei oder verbotene Gewerbe der bürgerlichen Gesellschaft zur Gefahr werden könnten, in Gewahrsam zu nehmen, zögerte sie kurz. Immerhin lag es ein gutes Stück von hier entfernt. Es würde lange dauern, bis sie dort war, mit Vincent gesprochen hatte, falls man sie überhaupt zu ihm ließ, bis sie dann wieder hier war, in die Apotheke und zum Bäcker ging und schließlich in die Bernsteinwerkstatt zurückkehrte.
Und wenn schon. Hatte ihr Onkel ihr nicht am vergangenen Tag erklärt, dass es ohnehin keine Bedeutung habe, ob sie in der Werkstatt sei oder nicht. Soll er doch sehen, wie er ohne mich zurechtkommt, dachte sie trotzig.
Das Landarbeiterhaus, das im Grunde nichts anderes war als ein Gefängnis, stand wie ein behäbiger Riese hinter einem hohen schmiedeeisernen Zaun, dessen Stäbe nach oben dornig zuliefen wie Speerspitzen. Johanna wurde schwach ums Herz. Noch nie in ihrem Leben war sie in einem Gefängnis oder einer vergleichbaren Einrichtung gewesen. Sie kannte nicht einmal jemanden, der dies von sich behaupten konnte. Sie atmete tief durch und schüttelte über sich selbst den Kopf. Dann drückte sie den Rücken durch. Vincent würde ihr gewiss nichts antun, und die anderen Strolche oder ebenso Unglückseligen, die unschuldig hinter diesen Mauern ihr Dasein fristeten, würden dort schließlich nicht frei herumlaufen. Sie hatte also nichts zu befürchten.