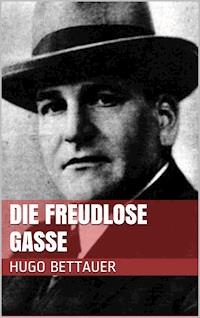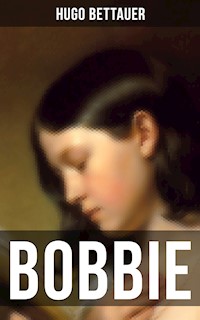Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Sammlung 'Die besten Romane von Hugo Bettauer: Antisemitismus und Sozial-Krimis' präsentiert eine ausgewählte Zusammenstellung von Bettauers bedeutendsten Werken, die sich mit den Themen Antisemitismus und sozialen Konflikten im frühen 20. Jahrhundert auseinandersetzen. In einem packenden und provokativen Stil beschreibt Bettauer die gesellschaftlichen Missstände seiner Zeit und führt den Leser tief in die Psyche der Charaktere. Seine Romane zeichnen sich durch ihre realistische Darstellung der Wiener Gesellschaft aus und vermitteln ein eindringliches Bild von Ungerechtigkeit und Vorurteilen. Bettauers Werke werden oft als Vorläufer des psychologischen Realismus angesehen, und seine detaillierte Sprache lässt den Leser tief in die Welt seiner Geschichten eintauchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1607
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die besten Romane von Hugo Bettauer: Antisemitismus und Sozial-Krimis
Books
Inhaltsverzeichnis
Hemmungslos
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
I. Teil
Inhaltsverzeichnis
I. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Koloman Freiherr von Isbaregg oder Kolo Isbaregg, wie er sich seit der Neuordnung der Dinge nach dem Umsturz kurz nannte, ging langsam, schlaff, schleppend über den Graben und hatte Hunger. Er spielte förmlich mit diesem Bewußtsein des Hungerns, verstrickte sich in den Gedanken, nun schon den zweiten Tag nichts gegessen zu haben, und verhöhnte sich selbst damit. „Ich Kretin, ich Trottel hungere,“ sagte er in sich hinein und machte dabei ein böses, hartes Gesicht.
Immerhin, als im Menschengewühl ein schönes, blondes Mädchen, das förmlich nach Eleganz roch und eine Wolke von Anmut mit sich trug, an ihm vorbeischritt und ihn dabei unwillkürlich leicht streifte, da richtete er sich auf, straffte seine müden, ein wenig zusammengesunkenen Glieder, drehte sich um und schritt der Reizvollen nach. Aber die Gedanken kehrten zum Refrain „Ich hungere“ zurück und er verlor die Gestalt aus den Augen und blieb müde an der Ecke des Equitable-Gebäudes stehen, griff mit der schlanken, schmalen Hand nach der Schläfe und fühlte, wie der Hunger aus den Gedärmen und dem Magen nach oben in den Schädel kroch, wo er sich durch dumpfes Pochen und leichte Stiche bemerkbar machen wollte.
Kolo lachte so laut auf, daß Vorübergehende neugierig nach ihm starrten. Es fiel ihm ein, daß er eigentlich schon recht oft gehungert habe, länger und schmerzlicher sogar, aber doch ganz anders als heute. In den Wintertagen des Jahres 1915 war er mit seinem ganzen Regiment bei irgend einem furchtbaren Kampf um eine Karpathenhöhe drei Tage ohne Nahrung geblieben und dann wieder einmal auf der Hochfläche von Asiago und einmal bei einem Vormarsch in Albanien und ganz zum Schluß des Weltkrieges in der Höhe von fast 3000 Metern in den Tiroler Alpen. Aber was war das für ein Hunger gewesen! Ein herrlicher, heroischer Soldatenhunger und man war umgeben von Kameraden und Soldaten, die ebenso hungerten. Es war ein Hunger, dem man laut fluchen und zürnen durfte und für den man Gott und die Welt, den blöden Generalstab und vor allem das Vieh von einem Divisionär verantwortlich machen konnte! Jetzt aber war das ein schäbiges, erbärmliches, einsames Hungern, das man verbergen mußte, wollte man sich nicht zum Straßendreck legen!
Und wie er so gewissermaßen mit seinem Hunger haderte und Zwiegespräche hielt, glitt die Vergangenheit an ihm vorbei und er kaute sich die eigene Lebensgeschichte vor, wie es immer nur Menschen zu tun pflegen, wenn sie an Qualen würgen. Niemals beschäftigt man sich in den frohen und großen Augenblicken des Lebens mit der Vergangenheit.
Koloman Freiherr von Isbaregg war der letzte Sprosse eines vornehmen, alten Geschlechtes, das sich im Laufe der Jahrhunderte mit böhmischem und magyarischem, mit polnischem und sogar türkischem Blut gemischt hatte. Je seltsamer und exotischer aber die Frauen beschaffen waren, die sich den steierischen Baronen zu Isbaregg ins Ehebett legten, desto fahriger, toller und hemmungsloser wurden die nachkommenden Männer, bis Gut auf Gut, Schloß auf Schloß und Kleinod auf Kleinod ihren Händen entschwand, und schließlich von Kaiser Josefs Zeiten an die Isbareggs als tapfere Offiziere in der jeweiligen kaiserlichen Armee ihr ehrenvolles, aber karges Brot verdienten. Und da wurde denn schließlich das Blut ruhiger und dünner und von den letzten drei lsbaregg brachte es einer nach dem anderen zu hohem militärischen Rang. Kolomans Vater war sogar als Feldzeugmeister gestorben, und seine Frau, eine rötlichblonde Böhmin, konnte es gar nicht fassen, als nach dem großartigen Leichenbegängnis des Exzellenzherrn der kleine, eben zehn Jahre alt gewordene Kolo ihr mit fast wilder Entschlossenheit sagte: „Ich will nicht Offizier werden, ich will reich werden und in die Welt hinaus gehen!“ Ein alter Onkel aber, der zum Vormund bestellt war, willigte kurz entschlossen ein. „Wenn ein lsbaregg mit zehn Jahren etwas will und dabei mit dem Fuß aufstampft,“ meinte er, „dann ist er eben ein lsbaregg, wie sie früher gewesen sind, und man kann ihn brechen, aber nicht biegen!“ Und kopfschüttelnd blätterte der alte pensionierte General in einer Mappe, die die Kopien der längst verkauften und in alle Welt verstreuten Gemälde derer von Isbaregg enthielt, so lange, bis er den kleinen Kolo in einem alten Raubritter aus dem vierzehnten Jahrhundert wieder fand. Dieselben glutvollen, schwarzen Augen, derselbe feingeschwungene, harte und energische Mund, die leichtgebogene schmale Nase und dieselbe hohe, trotzige Stirn.
So kam denn Koloman nicht in die Kadettenschule, sondern in das Theresianum, wo er einen Freiplatz erhielt, während seine Mutter sich in das billige behagliche Pensionopolis Graz zurückzog und starb, gerade als Koloman mit Auszeichnung maturierte. Der junge Herr hatte aber inzwischen seine Vorliebe für die technischen Wissenschaften entdeckt und mit Einwilligung des Vormundes verwendete er die paar tausend Kronen, die ihm die Mutter hinterlassen, um sich privat für die Realschul-Matura vorzubereiten und dann die Technische Hochschule zu absolvieren.
lsbaregg ging in der warmen Maisonne fröstelnd die Kärtnerstraße entlang, murmelte wieder wütend sein „Ich hungere“ in sich hinein und haspelte die vergangenen Jahre weiter ab. Kaum hatte er die Technik hinter sich, als er sich auch schon dem Leben mit offenen Armen entgegenwarf. Der Rektor, der die außerordentliche Begabung und die zähe, fast brutale Energie des jungen Mannes schätzte, verschaffte ihm eine Anstellung in einer schottischen Maschinenfabrik. Und Kolo stählte sich am Leben, arbeitete, jagte den Fußball über den Grund, lernte Boxen wie ein Matador, leistete Ersprießlichstes in seinem Beruf und — begann zu entdecken, daß es außer Macht, Reichtum und Freiheit noch eines gab, was das Leben köstlich macht: das Weib! Der schöne schlanke Jüngling mit dem exotischen, brünetten Gesicht und den immer wie im Fieber glimmernden schwarzen Augen, die überlange Wimpern seltsam beschatteten, gefiel den jungen Mädchen und den reifen Frauen in Edinburgh wie in London, in Dublin wie in Glasgow, und mit unersättlicher Gier, der nur sein überlegener Zynismus die Balance hielt, stürzte er sich in tolle Abenteuer, aus denen er sieghaft, die Frauen mit bitterem Schmerz hervorgingen. Mit dreiundzwanzig Jahren folgte der junge Ingenieur, dessen bedeutende Befähigung in Fachkreisen bekannt wurde, einem Ruf nach Paris; dort blieb er zwei Jahre, arbeitete tagsüber wie ein Zugtier, trank, spielte und jubelte nachts wie ein privatisierender Lebemann und trat dann eine leitende Stellung in Kanada, in Toronto, an.
Dort überraschte ihn nach drei Jahren der Krieg. Und statt ruhig von stolzen Frauen geliebt, von den Männern geachtet, in Kanada zu bleiben, ließ er sich, vom furor teutonicus ergriffen, geweckt und getrieben von der Stimme seiner rauflustigen Ahnen, nicht halten, fuhr nach New York, schlug sich auf abenteuerliche Weise mit falschen Papieren nach Holland durch und konnte schon im November als Leutnant bei den Kaiserjägern die erste Schlacht in den Karpathen mitmachen. Kühnes Draufgängertum, gepaart mit kaltem, nüchternem Urteil, Todesverachtung und zähe Widerstandsfähigkeit trugen ihre Früchte, und als Koloman Freiherr von Isbaregg im Oktober 1918 als Hauptmann sein Bataillon von Italien heimwärts brachte, da schmückte seine Brust ein Dutzend der höchsten österreichischen, deutschen, bulgarischen und türkischen Tapferkeitsmedaillen.
„Und jetzt hungere ich und kann verrecken wie ein Hund oder mit Zeitungen hausieren wie ein arbeitsloser Ziegelschupfer,“ murmelte Kolo halblaut und würgte den Hunger zurück, der ihm in den trockenen Gaumen trat.
Der Zusammenbruch der Monarchie war auch sein Niederbruch. Zuerst lebte er wie in dumpfer Betäubung in den Tag hinein. Ein paar Monate bekam er noch die Gage, dann die Abfertigung, dann ließ sich ein Diamantring vorteilhaft verkaufen, dann die goldene Uhr, eine Nadel, schließlich der Feldstecher und die Kamera. Bis nichts mehr zum Verkaufen da war und er eines Tages buchstäblich als Bettler in seinem möblierten Zimmer erwacht. Und nicht mehr Koloman Freiherr von Isbaregg hieß er, sondern einfach lsbaregg, denn der Adel war eben abgeschafft und verboten worden. Unmöglich, in dem verarmten, kohlen-und industrielosen Land eine Stellung zu bekommen, unmöglich, dem Käfig zu entrinnen und auszuwandern, nichts mehr an Hab und Gut als die verschlissene feldgraue Uniform ohne Distinktion, keine Verwandten, die helfen konnten, die alten Kameraden in ähnlicher Armut wie er. Allerdings — in der aufstrebenden Tschechoslowakei hätte es für den tüchtigen Ingenieur bald Arbeit genug gegeben. Aber auch dieser neue Staat blieb ihm verschlossen, dort stand er auf der Proskriptionsliste, derer, die mehrfach tschechischen Meuterern mit der Pistole entgegengetreten waren und rasche Feldjustiz auf eigene Faust geübt hatten.
Gestern hatte ihm die Zimmervermieterin mit aufrichtigem Bedauern mitgeteilt, daß sie ihm nicht länger Kredit gewähren könne, sondern gezwungen sei, sein Zimmer anderweits zu vergeben, wenn er nicht sofort bezahlen würde. Wie ein geprügelter Hund war er davongeschlichen, als Pfand den Handkoffer mit ein paar Stücken schmutziger Wäsche zurücklassend. In der Tasche noch etliche Kronen. Die lauwarme Nacht hatte er in einem Park auf einer Bank zugebracht, die paar Kronen nach schwerem Kampf heute beim Barbier gelassen. Und nun war es Mittag, er hatte seit vierundzwanzig Stunden nichts gegessen und rief sich brutale Schimpfworte, wie Trottel, Vieh dummes, patriotischer Kretin, zu. Und dachte: „Nun habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich gehe in den Stadtpark und schieße mir unter einem Baum eine Kugel durch den blöden Kopf oder ich verkaufe die Pistole, esse mich satt und gehe dann zu einer Zeitung, um mich als Kolporteur anwerben zu lassen. Man soll davon leben können, besonders wenn man den ehemaligen Offizier herauskehrt. Ich kann mir das Eiserne Kreuz erster Klasse und den Leopolds-Orden anstecken, das wird Eindruck machen. Halt, das kann ich nicht, denn die Orden liegen in der Lederergasse bei meiner Wirtin und die gibt sie sicher nicht heraus, bevor ich zahle.“
Kolo schlenderte die Kärntnerstraße zurück, ging über den Graben und blieb vor der Auslage eines Delikatessengeschäftes stehen. Sardinenbüchsen, Spargel, Feigen, Mandeln, Orangen und allerlei Backwerk lagen da ausgebreitet und er fühlte, wie ihm schwarz vor den Augen wurde. „Ich könnte ja auch in den Laden treten, rechts und links Fausthiebe austeilen, Eßbares an mich reißen und mich dann verhaften lassen. Das würde Aufsehen machen und die „Neue Freie Presse“ würde vielleicht einen Leitartikel schreiben und sagen „es brennt in den Eingeweiden unserer Helden“ und eine Sammlung veranstalten. Aber ich glaube, es geht nicht, weil ich mich sehr schwach fühle und die Verkäufer mich verprügeln würden.“
Während er noch immer in die Auslage starrte und seine Augen sich an einem Topf voll Thunfisch in Öl festsaugten, verließ eine Dame, beladen mit kleinen Paketchen, das Geschäft. Eines der Päckchen entglitt ihren Händen, Kolo sprang hinzu, hob es auf und reichte es ihr. Die Dame dankte und sah ihn an und ihre feuchten, ein wenig hervorquellenden Augen blieben mit Wohlgefallen auf dem schlanken, sehnigen Körper des hochgewachsenen Offiziers haften und bekamen etwas Gieriges, als sie das scharfe, bleiche Gesicht mit dem brennenden Blick überflogen. Sie selbst war klein, vollbusig, ein wenig geschminkt und sicher gut zehn Jahre älter, als sie erscheinen wollte.
Kolo Isbaregg erwiderte den Blick mit weit weniger Wohlgefallen. „Widerliches Judenweib,“ dachte er und ging. Aber sie, die vor ihm herschritt, drehte sich um und sah ihm mit dem schamlosen Blick des alternden, von unbefriedigter Sinnlichkeit verwüsteten Weibes voll ins Gesicht. Das Wort vom „Augenwerfen“ wurde da fast sinnfällig. Sie stielte förmlich die feuchten Augen und Kolo hatte das Gefühl, als wenn sie ihn bittend und heischend abtasten würden. Da vereinigten sich der wütende Hunger und die Einsamkeit und auch die geschmeichelte Eitelkeit und trieben ihn an, der vollbusigen kleinen Dame, die in allem das Gegenteil seines die Schlanken und Feinen verehrenden Geschmackes war, nachzugehen.
Sie schritt die Kärntnerstraße abwärts und blieb plötzlich vor einer Auslage stehen. Kolo, dicht neben ihr, fühlte ihren heißen Atem und den weichen, vollen Arm, der sich unauffällig an ihn drängte. Und da war sein Entschluß gefaßt. „Geh,“ sagte er sich, „greif zu, das Weib hat Geld, wahrscheinlich viel Geld und vielleicht eine schöne Wohnung, in der du ausruhen und essen kannst.“ Essen, ja essen, Himmel, der Speichel sammelte sich im Mund vor Hunger und es dröhnte ihm in den Ohren. Ja, aber, sie wird ihren Lohn verlangen, wird sich in seinen Armen wälzen und an seinen Lippen festsaugen wollen. Brr, wie grauslich! Aber essen können und ausruhen und vielleicht ein Bad nehmen und Geld, Geld… „Zuhälter!“ rief es ihm zu. „Koloman Freiherr von Isbaregg, weißt du, wie du früher über Männer, die Liebe für Geld verkaufen, gedacht hast?“ „Quatsch,“ antwortete Kolo sich. „Das war der Baron mit den vielen Ahnen und der großen Karriere vor Augen! Heute bin ich der obdachlose Isbaregg, der seit vierundzwanzig Stunden nichts gegessen hat und die Welt von unten aus ansieht. Essen muß der Mensch, essen und sich ausruhen und Geld haben — alles andere ist Wurst! Geh‘ mit, iß dich an und spiel‘ dann den Zechpreller! Das kann lustig werden — hui, wird die Jüdin toben!“
Kolo schmunzelte vergnügt, und die Dame, die sich immer wieder umsah, fing das Grinsen geschmeichelt auf, sie hielt es für eine Huldigung und quittierte mit einladendem Lächeln.
Bei der Oper blieb sie stehen und wartete auf eine Elektrische. Kolo geriet in Verlegenheit. Er konnte nicht mitfahren, weil er keinen Heller besaß! Aber an der Haltestelle lagen zahllose weggeworfene Umsteigkarten, die er kurz entschlossen zusammenraffte und in die Tasche steckte. Eine würde schon gültig sein und wenn nicht — ach, was sich den Kopf zerbrechen — er mußte ja mitfahren, er mußte essen!
Bumvoll kam der Wagen an und die Dame drängte sich mühsam hinein. Kolo dicht hinter ihr. Eng aneinandergepreßt standen sie auf der Plattform und sie wich nicht aus, sondern preßte sich gegen ihn, schmiegte den Busen an seine Hüfte. Kolo begann an dem Abenteuer Gefallen zu finden. Seine Hand glitt die feisten Hüften entlang, preßte die bebenden Schenkel, fühlte die Hitze, die aus dem dünnen Seidenrock strömte. Und die Dame schloß die Augen und lehnte sich tief atmend ganz gegen ihn.
Der Schaffner kam und Kolo reichte ihm eine ganze Hand voll zerknüllter Zettel. „Einer muß der richtige sein,“ murmelte er. Er hatte Glück, gleich die erste Karte wurde für gut befunden. Die Dame vereinigte die vier oder fünf Päckchen mühsam und zitternd unter einem Arm, öffnete das goldene Täschchen, entnahm ihm eine Damenbrieftasche und dieser einen Zweikronenschein. Unwillkürlich hatte Kolo die Prozedur beobachtet und er sah in der Tasche Banknoten, viele Banknoten. Er hielt den Atem an und befeuchtete mit der Zunge die trockenen, brennenden Lippen. Und seine Hand glitt wieder abwärts und blieb an dem fetten Frauenschenkel unter der Goldtasche haften. Noch mehr Leute stiegen ein und die Frau konnte sich unauffällig noch enger an ihn drängen, er noch fester mit den Fingern das Fleisch betasten.
Der Wagen war auf dem Rainerplatz angelangt und sie traf Anstalten, auszusteigen. Sie schob sich zum Trittbrett hin und sah Kolo lächelnd und siegessicher an. „Du kommst mit, schöner Mann,“ sprach ihr Auge. In Isbaregg wurde aber im Bruchteil einer Sekunde eine flüchtige Idee zum Entschluß und der Entschluß zur Tat. Er drängte nach, blitzschnell öffnete er mit zwei Fingern den Bügel der Goldtasche, der er langsam das Portefeuille entnahm. Hochrot schritt die Dame dem Brahmsplatz zu, sie merkte nicht, daß die Goldtasche offen stand, sie merkte nicht einmal, daß eines der Päckchen abermals zu Boden fiel und von einem halbwüchsigen Burschen rasch aufgehoben wurde, sie sah sich nur immer wieder nach dem schlanken, großen Mann mit den sehnigen Gliedern und der kühnen, edlen Hakennase um.
Kolo ging jetzt in respektvoller Entfernung nach, wartete, bis sie um die Ecke bog, machte kehrt und eilte mit Riesensätzen die Wiedner Hauptstraße entlang, bis ihn das Menschengewühl verschlungen hatte. Bei der Oper erst verlangsamte Kolo sein Tempo, sah sich rasch um und betrat eines der Kaffeehäuser. Er begab sich, ohne die Verbeugung des Kellners zu beachten, direkt in den Toiletteraum, verriegelte die Türe hinter sich und riß das Portefeuille aus der Hosentasche. In seinen Fingern knisterten die Scheine. Da, in diesem Fach lagen schmutzige, abgebrauchte, erbärmliche Zwanzig-, Zehn-und Zweikronenscheine, da aber wuchsen ihm Tausender und Hunderter entgegen. Und Kolo, in dessen Hand die Pistole niemals gezittert hatte, wenn er beim Angriff an der Spitze seiner Leute mit langen Sätzen hinüber zum feindlichen Drahtverhau gestürmt war, mußte sich gewaltsam zur Selbstbeherrschung aufraffen, mußte drei-, viermal beginnen, bevor er ruhig zählen konnte. Dreißig Stück Tausender, vier Hunderter und die kleinen Noten — das war die Beute!
„Beute,“ dachte er. Und es fiel ihm ein, daß vor noch gar nicht langer Zeit das Wort Beute eine ganz andere Bedeutung gehabt hatte, einen ordentlichen Amtscharakter, daß es Beutezüge, Beuteverteilungsstellen und sogar Beuteprämien gegeben. Jetzt hatte er Beute auf eigene Faust gemacht!
II. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Nun aber essen, essen! Kolo warf dem Kellner einen Zweikronenschein zu, verließ das Café und begab sich zu Hartmann, wo er früher, wenn er in Wien auf Urlaub gewesen war, so gerne gespeist hatte. „Kellner, rasch eine Suppe und dann einen Fisch und dann irgendeinen Braten mit Salat und Kompott, nur rasch, rasch, wenn Sie ein gutes Trinkgeld haben wollen!“ Und er aß langsam mit Beherrschung und trank in kleinen, vorsichtigen Schlücken den Wein und schlürfte mit unendlichem Behagen den Mokka und blies mit sybaritischer Wollust den Rauch der importierten Zigarette vor sich hin, zahlte und ging. Nicht mehr müde und gebeugt und kraftlos, sondern aufrecht, gestählt, voll Leben. Ging mit federnden Schritten den Ring entlang, freute sich unterwegs des Maiengrüns der Ahornbäume und lachte laut auf, wenn er an die vollblütige Dame dachte, der ihr Mittagmahl wesentlich weniger gut geschmeckt haben mochte als ihm.
Seine Wirtin in der Lederergasse begrüßte ihn mit verlegener Zurückhaltung, die aufrichtiger Freude Platz machte, als ihr lsbaregg frohgelaunt zurief: „Die Rechnung, liebe Frau, ich will meine Schuld begleichen und mich dann ausruhen!“ Und um ihre Neugierde zu befriedigen, erklärte er leichthin: „Endlich habe ich im Kriegsministerium meine rückständigen Gebühren bekommen, nun kann man eine Zeitlang wieder existieren!“
In seinem Zimmer allein, untersuchte Kolo nochmals die Brieftasche. Aus drei gleichen Visitenkarten konnte er den Namen der getäuschten Frau entnehmen, Selma Rosenzweig, Kommerzialratswitwe. „So sieht sie aus, ganz so!“ Ein Posterlagschein, eine quittierte Rechnung und da in der Ecke ein silbernes Zweikronenstück. Er lächelte: „Silbergeld, das hat man hier lange nicht gesehen, wahrscheinlich als Talisman aufbewahrt. Na, hoffentlich bringt es mir mehr Glück als der geliebten Selma!“ Und er schob die Münze in die Westentasche. Das Papiergeld steckte Kolo in seine eigene Brieftasche, die der Frau Rosenzweig warf er in den Ofen, gab Papier dazu und ließ sie in Asche aufgehen.
Es wird oft und gerne behauptet, daß dieser oder jener Mensch durch die Schrecken eines Abenteuers, durch gewaltigen Schmerz, durch eine furchtbare seelische Erschütterung ganz plötzlich, über Nacht, grau wurde oder sogar innerhalb einer Stunde weiße Haare bekommen habe. Und es ist ein beliebtes Ausfluchtsmittel für Romanschriftsteller, ihre Helden eine völlige Umwandlung des Charakters erleben zu lassen, als Folge einer bösen Enttäuschung oder argen Kränkung. Beides wird so oft erzählt, daß es allgemein geglaubt wird, und doch wird sich schwerlich jemand melden können, der dergleichen selbst erlebt, erfahren oder wenigstens persönlich beobachtet hat. Und wenn sich auch solche Fälle ereignen, so wird die exakte Untersuchung immer ergeben, daß es sich eigentlich nur um die Beschleunigung eines ohnedies schon wirkenden Prozesses gehandelt hat. Der Mann, der im Urwald, von wilden Bestien bedroht, weiße Haare bekommt, wäre sicher auch ohne dieses Ereignis sehr bald weiß geworden, weil eben sein Haarboden krank war. Und die Frau, die die Untreue des Geliebten bösartig, gemein, schamlos und grausam macht, die war eben nie so sanftmütig und edel, wie es der Schriftsteller glauben machen will, sondern alle die peinlichen Eigenschaften waren längst in ihr, kamen aber nicht zum Ausbruch, weil kein Anlaß dafür vorhanden war, und die Untreue und Kränkung hat sie nicht erzeugt, sondern nur geweckt.
Auch Kolo Isbaregg, der gestern noch ein tadelloser Ehrenmann gewesen war, hätte den Taschendiebstahl des heutigen Tages sehr. gut und gerne mit seiner grausamen Notlage, der Verwirrung und Erschütterung seiner Sinne durch den erlittenen Hunger entschuldigen können, wenn er ein kleiner Dutzendheuchler gewesen wäre. Er hatte aber gar keine Lust, sich vor sich selbst zu entschuldigen, sondern betrachtete seine Handlungsweise als ganz vernünftig und berechtigt, als moralisch sogar, wenn man den Trieb, sich selbst zu erhalten, als normal und zulässig anerkennt.
Er legte sich auf die mit einem schäbigen, geflickten Teppich bedeckte Chaiselongue, kreuzte die Arme unter dem Kopf und gab sich einer gründlichen Aussprache mit selbst hin, die zugleich programmatische Bedeutung hatte.
Und er spann folgenden Gedanken aus: „Daß alle Moral ein vollständig labiler Begriff ist, haben die Moralpächter der ganzen Welt, die Führer, Lenker und Lehrer der Menschheit am lautesten bewiesen. Plötzlich wurde aus dem Mord eine Tugend, aus dem Diebstahl eine Selbstverständlichkeit, und Brandlegung, Raub, Entführung, Erpressung und Gewalttätigkeit waren ganz ihres verbrecherischen Charakters entkleidet worden und wandelten sich zu lustigen Streichen oder Beweisen von Schneidigkeit und Energie. Die ganze christliche Heilslehre wurde mit einem Schlag beiseite gelegt, ja, jemand, der es wagte, noch weiterhin als Christ leben zu wollen, wurde als Verbrecher gemartert, eingekerkert oder gar aufgehängt. Weil nämlich an Stelle des Christentums der Patriotismus getreten war. Das führte zu einem konstanten Selbstbetrug drolligster Art und wandelte sonst ganz vernünftige Leute in Kretins. Der russische Bauer, der für eine Handvoll Kronen sein Vaterland verriet und uns die Stellungen seiner Landsleute offenbarte, war ein anständiger, braver Kerl, dem man zärtlich die Schulter klopfte. Und wir alle waren von der Bravheit dieses Mannes überzeugt und bereit, den, der an seine Anständigkeit nicht glauben wollte, einen vaterlandslosen Gesellen zu nennen. Der ruthenische Bauer aber, der nach den Gesetzen der Grenzpfähle ein sogenannter Österreicher war, wurde, wenn man erfuhr, daß er eine russische Patrouille geführt, glattweg für einen elenden Schurken erklärt und aufgehängt.
Die Labilität aller Moralbegriffe wurde aber auch weiterhin und in sehr lustiger Weise erhärtet. Hätte ich am 29. September 1918 in anständiger Gesellschaft erklärt, daß ich den Kaiser Karl für einen charakterlosen Menschen halte und ich mir wegen lstrien nicht einen Fingernagel krümmen lassen wolle, so wäre ich als Lump und ehrloser Geselle betrachtet worden. Hätte ich aber fünfzig Tage später in derselben Gesellschaft erklärt, daß ich kaisertreu bin und bereit, für den Besitz von Cattaro zu sterben, so würde man mich als suspektes Individuum und als Trottel ebenso verachtet haben. Es ist also gar nicht wahr, daß man überhaupt nicht stehlen, morden, Eide brechen darf, sondern es ist das alles eine schöne Tugend, wenn es von irgend jemandem, der sich geschickt in den Vordergrund gestellt hat, erlaubt wird. Nicht Gott, nicht Christus, nicht eine höhere übersinnliche Macht diktiert die Moralbegriffe, sondern einzig und allein die Zweckmäßigkeit der Stunde, vom Standpunkt des Herrn Meier oder Müller betrachtet oder einer Gruppe Meiers oder Müllers.
Auf diesen Schwindel, auf diesen faulen Handel mit Moral möge nun die große Menschenherde ruhig eingehen; tut es der einzelne nicht, so riskiert er zwar, von den Müllers und Meiers totgeschlagen zu werden, aber er hat gar keine Ursache, sich vor sich selbst zu schämen und Reue zu empfinden. Diese Erkenntnis weist mir den Weg für die Zukunft. Ich werde das Risiko, von den Meiers erschlagen zu werden, nach Tunlichkeit vermeiden, aber sonst nach meinen eigenen Zweckmäßigkeitsbegriffen leben. Ich werde mich nicht mehr durch die alten Ammenmärchen narren lassen, denn ich habe hinter die Kulissen geschaut und weiß jetzt, daß die frommen Biedermannsbärte nur aufgeklebt und die heiligen Mienen geschminkt sind. Man spielt heute Christus und morgen den Judas. Tell und Geßler sind ein und dieselbe Person, und das Weib, das heute das Gretchen spielt, mimt morgen die Salome. Das Publikum wird immer Beifall brüllen, wenn nur gut gespielt wird. Nun, ich werde gut spielen!“
Der nächste Tag war ein sehr geschäftiger. Kolo kaufte sich einen Sommeranzug, Wäsche, Schuhe, Hut; er wandelte sich aus einem Heimkehrer in einen eleganten Herrn und zog am Nachmittag in die Pension Metropolis am Schwarzenbergplatz, wo er für ein elegantes Zimmer samt Verpflegung den stattlichen Preis für einen Monat voraus erlegte. Es blieb ihm von dem der aufgeregten Kommerzialratswitwe abgenommenen Geld nur mehr eine recht bescheidene Summe, aber ein Monat anständigen Lebens war gesichert und in dieser Zeit konnte manches geschehen.
III. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Die Pension Metropolis nahm eine ganze Etage des Wohnpalastes auf dem Schwarzenbergplatz ein und war berühmt wegen ihrer guten Küche und der exquisiten Gesellschaft, die sie beherbergte. jetzt allerdings gehörte die Mehrzahl der Pensionäre zu den Versprengten, zu Leuten, die ihr Heim irgendwo in Galizien, in Ungarn, in Dalmatien oder Bosnien gehabt hatten und nun in Wien die neue Zeit, die Möglichkeit der Rückkehr oder der Gründung eines eigenen Hausstandes abwarteten. Schwere Kriegsgewinner hausten neben Leuten, die ihr letztes Bankdepot verzehrten, Künstler, die in Wien gastierten, junge Ehepaare, die keine eigene Wohnung finden konnten, Junggesellen, die wohlhabend waren, aber doch die enormen Gasthauspreise nicht erschwingen konnten und nebenbei junge, schöne Frauen, denen von weiß wem die Pension bezahlt wurde. Allerdings hielt Frau Doktor Schlüter, die norddeutsche Inhaberin der Pension Metropolis, strenge auf Sauberkeit. Herrenbesuche waren für Damen, Damenbesuche für Herren nur in den Gesellschaftsräumen zulässig, und Damen, die die Grenze von der ganzen zur halben Welt allzu deutlich überschritten, wurden nicht aufgenommen oder auf diskrete Weise zum Auszug bewogen.
Sonst aber ging es in der Metropolis recht behaglich zu. Nach dem Souper versammelten sich die Pensionäre gewöhnlich in dem Salon, es wurde musiziert, geplaudert, geraucht und oft genug kam es vor, daß lange nach Mitternacht die guten, wenn auch sehr kostspieligen Weine aus dem Keller der Pension batterieweise anmarschieren mußten.
Kolo Isbaregg wurde allgemein als sehr angenehmer Zuwachs betrachtet. Der schöne, große Mann mit den energischen, feinen Gesichtszügen gefiel den Männern und entfesselte Brände in den Herzen der Damen, denen der ehemalige Offizier aus dem altadeligen Geschlecht mit dem Nimbus der Vornehmheit, aber auch des Romantisch-Abenteuerlichen umflossen schien. Als gar das Fräulein Cleo Holthaus, eine ältliche, ununterbrochen Stilleben malende Jungfrau, die alle Skandalgeschichten von Wien kannte und ein unheimliches Gedächtnis für Namen, Telephonnummern und andere Nebensächlichkeiten besaß, sich erinnerte, in der „Neuen Freien Presse“ seinerzeit von der abenteuerlichen Flucht des Baron lsbaregg aus Kanada gelesen zu haben, da begannen die Herzen all der schönen und weniger schönen Frauen und Mädchen, die an der großen hufeisenförmigen Tafel saßen, heftig zu schlagen, wenn Kolo erschien und sich nach einer vollendet weltmännischen Verbeugung zwischen der zaundürren Konsulsgattin und einer geschiedenen jungen Frau Albari, die rassig und pikant aussah, niederließ.
Im Salon wurde Kolo Isbaregg ganz von selbst, ohne sein Zutun, ja trotz seiner merklichen Zurückhaltung der Mittelpunkt, um den sich alles gruppierte. Sogar der amerikanische Heldentenor der Oper, Mr. William Williams, ein gewaltiges Stimmvieh und sonst ein recht gutmütiger Tölpel, wurde von ihm in den Hintergrund gedrückt, und der Maler Horatius Schreigans, der in der Sezession die ungeheuerlichsten Erotika ausstellte, zählte überhaupt nicht mehr, seitdem Isbaregg die Unterhaltung beherrschte oder wenigstens durch seine witzigen und boshaften Bonmots würzte.
So verbrachte Kolo nun schon einen halben Monat recht behaglich in der Pension Metropolis und er hätte gerne noch recht lange Zeit die Tage und Nächte müßig verbummelt — um so mehr, als die Türe der jungen geschiedenen Frau nachts für ihn offen zu bleiben pflegte, aber sein Geld schmolz dahin und er wußte, daß er eine neue Tat unternehmen müsse, wollte er nicht wieder in die Not und Armut der vergangenen Wochen zurückversinken.
Ihm gegenüber saß am Tisch der Pension Metropolis der alte Herr Geiger, ein Schieber und Kriegsgewinner schlimmster Sorte, ein Harpagon, wie ihn Molière nicht drastischer entwickeln konnte. Dieser Herr Geiger hatte durch dubiose Vermittlungsgeschäfte zu den Millionen, die er schon früher besessen, ein Dutzend weitere errafft; mit dem Scharfsinn des Menschen, dessen ganzes Gefühlsleben auf den Gelderwerb gerichtet ist, hatte er den unausbleiblichen Zusammenbruch der österreichischen Valuta vorausgesehen, in Devisenspekulationen abermals Millionen verdient und rechtzeitig den größten Teil seines mobilen Vermögens mit Hilfe gefälliger diplomatischer Agenten, wie sie damals von einer von Gott und jeder Vernunft verlassenen Regierung dutzendweise verwendet wurden, rechtzeitig nach der Schweiz gebracht und so vor der Vermögensabgabe gerettet. Was ihn nicht abhielt, über jede Besteuerung, der er sich nicht entziehen konnte, herzerweichend zu klagen, wie er sich überhaupt aus Mißtrauen und wohl auch aus Aberglauben gerne für einen ruinierten alten Mann ausgab, der im Begriff sei, den Rest seiner Habe in der sündhaft teueren Pension zu verzehren. Dabei kam er mehr als alle anderen Pensionäre auf seine Rechnung, denn zwischen seinen billigen falschen Zähnen verschwanden die größten Portionen, jede Schlüssel mußte ihm zweimal gereicht werden, und seine Tischnachbarn schworen, daß er regelmäßig Tortenstücke und andere eßbare Dinge in den weiten Taschen seines schäbigen Lüsterrockes verschwinden lasse. Frau Dr. Schlüter hätte denn auch den unbequemen, ewig nörgelnden Gast, den niemand leiden mochte, am liebsten vor die Türe gesetzt, wäre nicht jetzt eben der Sommer nah gewesen und in dieser Zeit ohnedies immer mehrere Zimmer leer gestanden.
Isbaregg begann sich zu dieser Zeit mit Herrn Geiger näher zu befassen. Nach Tisch ließ er sich mit ihm in politische und finanzielle Auseinandersetzungen ein, und der alte Mann fand an diesen Gesprächen um so mehr Gefallen, als Kolo sich als aufmerksamer Zuhörer erwies, selbst ein sehr scharfes Urteil entwickelte und den zynisch. exzentrischen Lebensanschauungen des Millionärs gerne beipflichtete. Isbaregg wieder profitierte von den gründlichen Kenntnissen des anderen, der in allen finanzpolitischen Fragen zu Hause und in nationalökonomischen Dingen von profunder Bildung war. Über sich selbst schwieg sich Geiger gründlich aus, nur ganz flüchtig erwähnte er einmal, daß er seinen armen Verwandten zum Trotz noch recht lange zu leben beabsichtige. Mit einem hämischen Lachen fügte er hinzu: »Und wenn ich auch das bißchen Geld, das ich habe, nicht in den Sarg mitnehmen kann, so werde ich schon dafür sorgen, keine lachenden Erben zu hinterlassen. Man kann ja auf dem Totenbett Kavaliersanwandlungen haben und eine wohltätige Stiftung gründen, zum Beispiel ein luxuriöses Asyl für alternde Droschkenpferde oder ein Sommerheim für Berufsathleten.“
Eines Nachmittags, als Kolo gerade nach Hause kam, hörte er aus dem Zimmer Geigers heftigen Wortwechsel. Die Türe ging auf und heraus trat ein junges, hübsches Mädchen, das schluchzend ein Tuch vor die Augen drückte und dem Ausgange der Wohnung zueilte. In diesem Augenblick tauchte auch Frau Schlüter aus dem Halbdunkel der Vorhalle auf, und als sie das verwunderte Gesicht lsbarregs sah, winkte sie ihn in den Salon und erklärte die Situation.
„Ich muß gestehen, daß ich unwillkürlich gehorcht habe, und was ich hörte, ist wirklich dazu angetan, meine Antipathie gegen den alten Geizhals noch zu vergrößern. Das Mädchen, das ihn jetzt verließ, ist seine Nichte, die Tochter seiner verwitweten armen Schwester, die von ihrer elenden Lehrerpension lebt. Das Mädchen ist seit Jahren mit einem armen, aber braven und tüchtigen jungen Menschen, der eben Arzt geworden ist, verlobt und bat den Onkel unter Tränen, ihr ein paar tausend Kronen zu borgen, damit sie heiraten und einen Hausstand begründen könne. Wissen Sie, was dieses alte Tier ihr geantwortet hat? Ein so hübsches Mädchen wie du braucht keinen armen Schlucker zu heiraten! Wenn du willst, so schenke ich dir Geld für ein hübsches Kleid, damit du in Gesellschaft gehen und auf vernünftigere Weise Karriere machen kannst.“
Kolo schüttelte sich, begab sich nach seinem Zimmer und ging dort lange auf und ab. Sein Entschluß war gefaßt und etwaige Bedenken zerstreute er im Verlaufe seiner Unterhaltung mit sich selbst, die in folgender Betrachtung gipfelte:
„Dieser Herr Geiger ist vor Gott und den Menschen ein Ehrenmann. Er hat sein ganzes Leben lang geraubt, gewuchert und betrogen, aber immer im Rahmen der Gesetze und sicher niemals einer Dame das Portemonnaie gezogen. Infolgedessen ist er dem Staat heilig und unantastbar, und wenn ich anderer Meinung bin und ihn als schädliches Insekt vertilge, so wird man mich, wenn ich mich dabei erwischen lasse, als Mörder verurteilen. Ich füge mich aber dieser abstrus und toll gewordenen Logik nicht, werde ihn zu meinem Heil und zu dem anderer vernichten und mich eben nicht erwischen lassen.“
Am selben Abend zog sich Kolo Isbaregg mit Herrn Geiger nach Tisch in eine Ecke zurück und sagte ganz leichthin:
„Ich habe heute durch meinen Vetter, den Unterstaatssekretär im Finanzdepartement, etwas erfahren, was auch Sie interessieren dürfte. Natürlich kann ich Ihnen, wenn ich meinem Vetter nicht Ungelegenheiten bereiten will, die Sache nur sehr vertraulich mitteilen. Es steht nämlich die Vermögensabgabe unmittelbar bevor und in den nächsten Tagen schon wird wieder eine allgemeine Bankkonto-und Safe-Sperre verfügt werden.“
Geiger wurde ganz zitterig und nervös, der Speichel trat ihm in den Mund und geifernd fragte er:
„Ist das auch ganz ‘sicher, was Sie da sagen?“
„Herr, ich bin ja kein dummer junge! Wenn ich etwas sage, so weiß ich, was ich rede! Übrigens müssen Sie es ja nicht glauben!“
„Gut, gut,“ begütigte der Alte. „Natürlich glaube ich es, ich muß es um so eher glauben, als ja die Finanzen dieses gottverlassenen Staates so sind, daß irgend ein neuer Gewaltstreich wirklich unausbleiblich ist.“ Und dann mit trockenem Lachen: „Wieder ein Glück, wenn man nichts hat! Mir wird man nichts mehr wegnehmen können.“
Geiger blieb aber verstimmt und einsilbig und begab sich frühzeitig auf sein Zimmer, während Kolo sich den Damen zuwendete und durch sein bestrickend liebenswürdiges Wesen Gluten um sich her verbreitete. Zu ihrer schmerzlichen Enttäuschung ließ aber Frau Albari ihre Schlafzimmertür diesmals vergebens offen.
IV. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Am nächsten Morgen frühstückte Kolo Isbaregg sehr frühzeitig und begab sich dann nervös und erregter, als er sich es hätte eingestehen wollen, in das im selben Haus befindliche Cafe, wo er einen Fensterplatz wählte. Nicht lange blätterte er in den Zeitungen herum, als Herr Geiger, eine umfangreiche Aktentasche in der Hand, das Haustor verließ. Kolo, der schon gezahlt hatte, lächelte selbstsicher vor sich hin und folgte dem gebückt einherschreitenden Mann in angemessener Entfernung. Bei der Oper zögerte Geiger, trat an einen Chauffeur heran, es enspann sich ein Zwiegespräch, das damit endete, daß der Geizhals erbost und ersichtlich zornentbrannt weiter zu Fuß die Kärntnerstraße entlang schritt, Isbaregg immer hinter ihm her. Im Gebäude des Bankvereins verschwand Geiger und Kolo konnte nun eine ganze Stunde lang ungeduldig auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf und ab schreiten, bevor der alte Mann endlich wieder erschien. Jetzt war die Aktentasche zum Bersten voll, der Alte preßte sie förmlich inbrünstig an sich und bestieg diesmal ohne Pourparlers ein Auto.
Kolo wußte genug, es war so gekommen, wie er vorausgesehen: Geiger hatte, von Panik über die kommende neue Vermögensabgabe ergriffen, sein Depot behoben, etwaige Aktien in Bargeld umgetauscht und würde nun den Betrag zu Hause verbergen.
Isbaregg hatte nun allerlei Besorgungen zu machen. Er begab sich nach einer stillen Seitengasse der Kärntnerstraße zu einem Schuster, dessen Spezialität orthopädische Schuhe waren, und bestellte mit schnarrender, norddeutscher Aussprache ein Paar Stiefel für seinen Bruder, Nr. 43 Länge, 5 Breite. Der rechte Schuh müsse einer Verkürzung des Beines halber drei Zentimeter höher sein als normal. „Postarbeit, bitte, spätestens übermorgen brauche ich die Schuhe, weil ich sie dann sofort wegschicken muß.“ Er erlegte sofort eine Anzahlung und kaufte in einem Gummigeschäft einen Pfropfen für einen Spazierstock, wie ihn Hinkende zu benützen pflegen. Dann begab er sich nach der Elisabethstraße, wo er den Laden eines Theaterfriseurs betrat. Dort verlangte er für das Kostümfest, das demnächst im Stadtpark stattfinden sollte, einen schwarzen Knebelbart. In einem Farbwarengescbäft erstand er eine Tube schwarzer flüssiger Farbe, bei einem Optiker eine schwarze Brille, bei Gerngroß einen mächtigen schwarzen Schlapphut, wie man ihn kaum noch trug, und einen dünnen Wettermantel mit einer Pelerine.
Mit Paketen beladen, begab sich Kolo nach Hause, ging aber gleich wieder fort und studierte in einem Haustor die Annoncen des „Neuen Wiener Tagblattes“, aus dem er sich mehrere Adressen aufnotierte. Eine halbe Stunde später hatte er in der Apfelgasse, also in nächster Nähe des Schwarzenbergplatzes, ein diskretes Absteigequartier mit separatem Eingang von der Treppe aus auf vierzehn Tage gemietet und vorausbezahlt. Da solche Absteigequartiere nur für galante Stunden vermietet werden, frägt man nicht nach dem Namen, sondern begnügt sich, den Mieter mit Herr Doktor anzureden. Er nahm den Zimmerschlüssel an sich, versicherte, daß er das Zimmer nur selten und immer auf ganz kurze Zeit benützen würde, und hatte die Gewißheit, daß die wackere Zimmervermieterin diskret und froh sei, wenn sie mit ihrem jeweiligen Herrn nichts weiter zu tun habe.
Zwei Tage später erzählte Frau Dr. Schlüter abends ihren Gästen, daß ein neuer und recht interessanter Herr bei ihr eingezogen sei. „Ein Spanier in diplomatischen Diensten. Er spricht kein Wort deutsch, aber natürlich vollkommen französisch. Er heißt Doktor Diego Alvarez und macht einen höchst distinguierten Eindruck. Morgen zieht er schon hier ein, wird aber erst nach einer Woche mit uns speisen, da er vorläufig in der Familie des spanischen Botschafters Tischgast ist.“
Fräulein Holthaus schrie entzückt auf: „Ein Spanier, Gott, wie interessant!“ Während Frau Albari unter allgemeiner Spannung fragte, ob dieser Spanier ein so schöner Mann sei, wie man es von Spaniern vorauszusetzen pflege. Wobei sie Kolo einen koketten Blick zuwarf. Lachend erklärte Frau Dr. Schlüter:
„Nun, da müssen Sje Ihre Erwartungen schon herabstimmen! Er hat einen schwarzen, abscheulichen Knebelbart, dunkle Brillen, trägt einen unmöglichen Kalabreser und hinkt außerdem recht heftig.“
„Der Arme!“ seufzte die Stillebenmalerin und nahm sich vor, gegen den unglücklichen Krüppel recht sanft und zuvorkommend zu sein, während Herr Holthaus, der erotische Sezessionist, trocken meinte:
„Solche Leute pflegen Glück bei Frauen zu haben. Merkwürdigerweise löst Krüppelhaftigkeit bei hysterischen Weibern starke erotische Reizungen . .
Frau Dr. Schlüter räusperte sich energisch mit einem Blick auf einen Backfisch, der bedenklich zu kichern begann, und lenkte das Gespräch auf die allgemeine Ernährungslage. Von da an sprach man nicht mehr von dem Spanier, der mit einem umfangreichen Handkoffer seinen Einzug hielt und vorläufig nur morgens und abends beim Verlassen und Kommen, aber auch dann nicht regelmäßig, vom Stubenmädchen gesehen wurde.
V. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
So waren etwa acht Tage vergangen, die Pfingstwoche war gekommen und der Spanier sagte abends, als er nach Hause kam, der Frau Dr. Schlüter, er werde über die Feiertage nach dem Semmering fahren, und zwar schon morgen mit dem ersten Frühzug, eine Mitteilung, die weiter nicht aufregend war. Kolo Isbaregg blieb wie immer, wenn er keinen Bummel vorhatte, bis gegen Mitternacht im Salon, war scheinbar heiter und aufgeräumt wie gewöhnlich und zog sich dann, als alles schlafen ging, auf sein Zimmer zurück. Hier legte er sich auf den Diwan und dachte, indem er sich zu eiserner Ruhe zwang, logisch, klar und scharf über all das nach, was die nächsten Stunden bringen mußten.
Um zwei Uhr morgens — das ganze Haus lag im tiefsten Schlaf — zog er die Schuhe aus, steckte ein Universalwerkzeug aus Nickel in kleinem Format, das er noch aus Kanada her besaß, zu sich, zog den Krummhaken hervor, mit dem auch gute Schlösser leicht aufzusperren sind, wenn man, wie er, damit umgehen konnte, und öffnete seine schon am Tage vorher eingeölte Tür, die nach dem Korridor führte.
Totenstille, nichts regte sich, er konnte fast das Klopfen des eigenen Herzens hören. Ein paar Schritte nur und er stand vor der Tür des Herrn Geiger. Er preßte das Ohr an das Schlüsselloch und hörte das Schnarchen des alten Mannes. Nun vorsichtig, den Krummhaken angesetzt. Halt! Ein Widerstand! Verflucht! Der Schlüssel steckt ja von innen! Kolo verlor nur einen Augenblick die Fassung, dann zog er aus dem zusammengeklappten Werkzeug eine lange Nadel, wie man sie zum Bohren eines Loches in Lederzeug braucht, führte sie geräuschlos in das Schlüsselloch ein und stieß behutsam den Schlüssel hinaus, daß er drinnen im Zimmer auf die Erde fiel. Wohl war der Boden mit einem Teppich belegt, aber ein gewisses Geräusch, durch das Aufschlagen des Schlüssels bewirkt, hatte sich doch nicht vermeiden lassen. Mit angehaltenem Atem horchte Kolo. Der alte Mann hatte aufgehört zu schnarchen, warf sich unruhig von einer Seite auf die andere, dann trat wieder tiefe Stille ein. Eine volle Minute, die einer Ewigkeit glich, wartete Kolo Isbaregg noch, dann schob er den Krummhaken ein und mit leichter Mühe — er hatte den Versuch oft genug an dem eigenen Türschloß gemacht — drehte er die Zunge des Schlosses um. Fast ganz geräuschlos öffnete sich die Türe und der Eindringling stand nun tief gebückt in dem fremden Raum. Ein Druck auf die kleine elektrische Taschenlampe und er hatte volle Orientierung gewonnen. Im nächsten Augenblick mußte sich alles entscheiden. Würde Geiger erwachen oder auch nur Zeichen von Unruhe von sich geben, so müßte er sich mit einem Ruck über das Bett werfen und mit seinen behandschuhten Händen jeden Laut und jedes Leben ersticken. Auf allen Vieren kriechend, schlich sich Kolo dicht vorwärts, so daß zu seiner rechten Seite das große Doppelfenster, zu seiner linken das Bett lag. Geiger rührte sich nicht und gab nur die sägenden Laute des tief Schlafenden von sich. Also konnte die Arbeit der eigenen Hände wohl vermieden werden!
Beim Fenster richtete sich Kolo halb auf, um mit einem einzigen Schnitt der haarscharfen Messerklinge, die er nun aus dem Werkzeug zog, einen erheblichen Teil der Rouleauxschnur abzuschneiden. Rasch knüpfte er eine Schlinge, wie er es bei den Jagdausflügen in den kanadischen Wäldern gelernt hatte, und kroch wieder tief gebückt, die Schlinge in der linken Hand haltend, an das Bett heran.
Nun mußte es getan werden. Durch den Bruchteil einer Sekunde ließ er das Licht der Taschenlampe aufblinken, Hier saß der Kopf an dem dürren Hals des Greises. Jetzt keine Bedenken! Die Schlinge blitzschnell über den Kopf gezogen. Geiger wacht auf, hebt den Schädel schlaftrunken. Macht nichts — zu spät! Mit beiden Händen zieht Kolo bei voller, brutaler Kraftentwicklung an den Enden der Schnur — ein heiseres Gurgeln und kein Laut mehr! Fester und fester zieht er an, und das Dunkel der Nacht verbirgt ihm den grauenhaften Anblick, den der häßliche tote Greis bietet. Minutenlang verharrt er so, dann läßt er los, tastet nach der Bettdecke und zieht sie der Leiche über den Kopf. Richtet sich hoch auf, horcht wieder aufmerksam nach außen, tappt die Wand entlang, bis er den Anschalter gefunden hat, und nun steht er, von dem vollen Licht des elektrischen Kronleuchters umbrandet, da. Sieht
sich im Spiegel und fühlt ein leichtes Frösteln. Ein bleicher fremder Mann, den er nicht kennt, von dem er nichts weiß, scheint ihm entgegenzustarren. „Bin ich es, bist du es?“ Er faßt sich an die feuchte Stirne, krallt die Hand im Handschuh in die Herzgrube und schließt die Augen, bis das Blut wieder ruhiger durch die Adern fließt und sein Verstand Oberhand über das dunkle Gefühl gewinnt, das emportauchen wollte. Kolo hob den Schlüssel auf, versperrte die Türe hinter sich, drehte den Kronleuchter ab und die Lampe auf dem Nachtkästchen an und begann zu suchen. Im Kleiderkasten, im Schreibtisch, der nicht ihm gehörte, dürfte Geiger schwerlich die große Aktentasche verwahrt haben. Wohl aber hier in dem großen, schweren Lederkoffer, der in einer Fensternische stand. Wo waren aber die Schlüssel zu diesem Koffer? Sicher unter dem Kopfpolster Geigers. Kolo zögerte. Sollte er unter dieses Kissen, auf dem der Erwürgte lag, greifen? Er hatte im Felde Schrecklicheres gesehen und getan und doch — nein — es ließ sich ja vermeiden! Wieder zog Kolo Isbaregg das Nickelwerkzeug aus der Hosentasche, fixierte ein kleines Stemmeisen und schraubte, brach und hob die beiden Schlösser heraus. Nun war der Koffer offen — obenauf lag ein Anzug, dann kam der Pelz, den Geiger, um die Aufbewahrungsgebühr zu sparen, den Sommer über im Koffer hielt — und unter ihm — ja, da lag die schwarze Aktentasche. Ein Ruck und auch sie war offen und es quoll förmlich aus ihr hervor. Ein Banknotenpäckchen und noch eines und wieder eins und noch und noch. Zehn Pakete zu je hundert Tausendkronenscheinen, die Kolo in die Taschen und unter seine Weste schob.
Bevor er das Zimmer verließ, sah er sich sorgfältig um. Nein, es blieb keine Spur hinter ihm, er hatte nicht, wie es in den Detektivgeschichten vorkam, sein Werkzeug oder ein Taschentuch oder einen Manschettenknopf zurückgelassen, nichts als eine gewisse Unordnung, den erbrochenen Koffer, die auf den Teppich geworfene Aktenmappe und — die Leiche! Kolo drehte das Licht ab, horchte wieder angespannt nach außen, sperrte auf, verließ das Zimmer und verschwand lautlos hinter der eigenen Türe. Halb drei — genau eine halbe Stunde hatte alles gedauert.
Und nun wieder leise den Weg in das benachbarte Zimmer des Spaniers. Dort konnte er ausruhen, eine Stunde vor sich hinsinnen, dann die Verwandlung vornehmen. Rasch den schwarzen Knebelbart angepickt, der in dem Handkoffer
verwahrt lag, die Brillen vor die Augen, den Kalabreser auf den Kopf, den Radmantel umgeworfen, nachdem er noch die Stiefel, von denen der eine den Klumpfuß markierte, angezogen hatte. Den Stock mit dem Gummipfropfen in der einen Hand, den Handkoffer in der anderen, verließ nun Diego Alvarez, nachdem er unten den Portier geweckt und sich hatte aufsperren lassen, das Haus, und das milde Frühlicht eines jungen Junitages umfing ihn.
VI. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Es war halb fünf, als Kolo Isbaregg in der Verkleidung vor dem schäbigen, das billige Laster verratende Haus in der Apfelgasse erschien. Weit und breit keine Menschenseele, ungesehen konnte er das Haustor aufschließen, unbemerkt sein Absteigequartier erreichen und sich dort wieder zum normalen Menschen wandeln. Rasch hatte er sich umgekleidet, aber nun galt es noch Wichtiges zu erledigen. Mantel, Hut, die orthopädischen Schuhe, der Bart, das Werkzeug, die Brillen und der Pfropfen des Stockes — das alles ließ sich leicht in dem Handkoffer unterbringen. Was aber mit ihm tun? Ihn einfach in dem Zimmer stehen lassen, auf die Gefahr hin, daß die Vermieterin ihn nach einigen Wochen öffnen und den verräterischen Inhalt der Polizei bringen würde? Nein, das ging nicht, dazu waren die Einkäufe vor allzu kurzer Zeit gemacht worden! Ein neues Absteigequartier mieten und dort den Koffer einstellen? Nicht übel, aber doch riskant! Vielleicht würden in der nächsten Zeit die Gäste der Pension Metropolis überwacht werden und man ihm nachspüren, wenn er so ein neues Absteigquartier betrat! Noch eine Idee: Den Koffer nach einem Bahnhof bringen und ihn in Aufbewahrung geben, um ihn natürlich niemals abzuholen. Aber auch das hatte seine Bedenken. Wer weiß, nach wie kurzer Zeit man den nicht abgeholten Koffer öffnen würde? Aber ein anderer, absolut sicherer Ausweg ergab sich und zu ihm entschloß er sich.
Langsam schlenderte Isbaregg gegen den Südbahnhof zu, wo sich schon Ausflügler zu Hunderten eingefunden hatten und reges, geschäftiges Treiben herrschte. Er ließ sich im Bahnhofrestaurant nieder, verzehrte ruhig sein Frühstück, las Zeitungen, bis es sieben Uhr geworden war und das Bahnpostamt die Schalter öffnete. Nun ließ er sich einen Frachtbrief geben, füllte ihn aus und gab den Handkoffer als Postkolli nach Graz, bahnpostlagernd, auf, als Absender einen Johann Merker, Wien, I., Annagasse 4, bezeichnend. So, nun würde dieses Kolli monatelang in Graz umherliegen, dann nach Wien zurückgeschickt, werden, wo man den Herrn Merker natürlich nicht fand, es würde also nach dem Hauptpostamt wandern und wieder ungezählte Monate unter anderem Gerümpel verstauben.
Jetzt nur noch eines: die zehn Pakete mit den Tausendkronenscheinen konnte er natürlich nicht länger mit sich herumtragen. Kolo kaufte in einem Laden einen Bogen Packpapier und eine Schnur, zog sich in den Toiletteraum eines Kaffeehauses zurück und packte die Banknoten, von denen er drei Stück in seine Brieftasche steckte, sorgfältig zusammen. Dieses Paket gab er auf einem anderen Postamt als rekommandierte Sendung an sich selbst, hauptpostlagernd, auf. Dazu schrieb er den Vermerk: „Bitte einen Monat lagern zu lassen!“ So — und damit war nach den Gesetzen der Logik und Wahrscheinlichkeit alles vermieden, was auch nur den Schein eines Verdachtes auf ihn lenken konnte.
VII. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Es war acht Uhr vorüber, als Kolo die Pension Metropolis wieder betrat. Hätte ihn ein Stubenmädchen oder ein Mitbewohner gesehen, so würde er getan haben, als wenn er eben die Pension hätte verlassen wollen und zurückgekehrt sei, um einen vergessenen Gegenstand zu holen. Aber der Zufall war ihm günstig. Die Vorhalle war leer, niemand hatte ihn kommen gesehen und unbemerkt konnte er sein Zimmer betreten, wo er sich zu Bett legte, um endlich zu schlafen und die müden Glieder auszuruhen.
Es war aber kaum elf Uhr vormittags, als er von gehenden Schreien, lautem Rufen, dem Knallen zugeschlagener Türen und aufgeregten Gesprächen geweckt wurde. „Herr Geiger ist ermordet worden!“ Mit diesem Ruf empfingen ihn die Dienstboten, die Pensionäre und Frau Schlüter, als er in halber Bekleidung sein Zimmer verließ, und schon raunte, wisperte, flüsterte es von Mund zu Mund: „Der Spanier, wo ist der Spanier…?“
Darüber, daß nur der ominöse Spanier der Täter sein konnte, war von allem Anfang an in ganz Wien kein Zweifel. Polizei, Presse und Publikum waren ausnahmsweise einig: nur der Spanier kam in Betracht, nur er konnte den alten Mann ermordet haben. Und Jeremias Finkelstein, der findige Lokalreporter der „Wiener Morgenpost“, brachte über die Erhebungen der Polizei und seine eigenen Nachforschungen einen fulminanten, reich illustrierten Artikel, der die ganze Sachlage erschöpfend darlegte. Zunächst schilderte Finkelstejn das vornehme Milieu der Pension Metropolis, flocht rühmende Worte über die tüchtige, gebildete Besitzerin Frau Dr. Schlüter ein — vorher hatte er für sich vom nächsten Herbst ab einen außerordentlich billigen Mittagstischpreis ausbedungen — führte sämtliche Pensionäre, unter ihnen natürlich auch Kolo Isbaregg, namentlich an, vergaß die zwei Köchinnen und die Stubenmädchen nicht zu erwähnen, pries in plastischen Worten die Pracht der Zimmereinrichtungen, wobei er Empire mit Barock heftig verwechselte, um dann mit kühnem Schwung und einer saftigen Wetterbetrachtung auf den verhängnisvollen Junitag überzugehen.
„Der angebliche Spanier hatte frühmorgens, vor fünf Uhr noch, mit seinem Handkoffer das Haus verlassen, angeblich, um auf den Semmering zu fahren. Dem Portier, der ihm das Haustor geöffnet hatte, war an ihm durchaus nichts aufgefallen, es sei denn eine gewisse Hast und Nervosität. In der Nacht war der gute Schlaf der Pension Metropolis in keiner Weise gestört. worden. Weder Schreie noch verdächtige Fußtritte wurden gehört, obwohl sich die in den besten Wiener Gesellschaftskreisen wohlbekannte Malerin Cleo Holthaus eines außerordentlich leichten Schlafes rühmen kann.
Unter den Pensionären befand sich, wie schon erwähnt, Herr Leo Geiger, der frühere Chef des Bankhauses Geiger & Co., ein alleinstehender Herr von 68 Jahren, der mehrere Millionen besitzen soll und seines gediegenen, ruhigen Charakters halber sich großer Beliebtheit erfreute. Er bewohnte das Zimmer Nr. 8, mit der Aussicht auf den Schwarzenbergplatz und hatte sich nach angeregter Unterhaltung im Musiksalon gegen Mitternacht zur Ruhe begeben. Er pflegte sonst gegen acht Uhr aufzustehen und dann um die neunte Stunde herum im Frühstückzimmer zu erscheinen. Als es aber an dem verhängnisvollen gestrigen Tag zehn Uhr geworden war, befahl Frau Dr. Schlüter dem aufwartenden Mädchen, leise an die Türe Geigers zu klopfen. Dies geschah, es erfolgte aber keine Antwort, und so nahm man denn an, daß der alte Herr länger schlafe. Um elf Uhr wurde aber Frau Dr. Schlüter ängstlich und sie klopfte jetzt, vom Stubenmädchen begleitet, selbst energisch und mehrmals hintereinander an. Es kam aber wieder keine Antwort und die Dame drückte nun auf die Türklinke, die zu ihrer Verwunderung, da sie wußte, daß Geiger immer hinter sich abzusperren pflegte, nachgab. Frau Dr. Schlüter betrat das Zimmer und drehte das Licht an, da die Jalousien herabgelassen waren.
Sofort fiel ihr der geöffnete Koffer auf, und da das Bett leer zu sein schien, dachte sie, Herr Geiger wäre, ohne jemanden zu verständigen, fortgefahren. Da stieß das Stubenmädchen einen gellenden Schrei aus. Es war an das Bett getreten, hatte die Decke gelüftet und der Anblick, der sich nun den beiden Frauen bot, war so furchtbar, daß sie beide schreiend aus dem Zimmer stürzten und um Hilfe riefen. Unser großer amerikanischer Heldentenor Mister Williams eilte aus seinem Zimmer herbei; Frau Albari, eine bekannte Wiener Schönheit, trat hinzu, auch das übrige Gesinde schloß sich an. Gemeinsam begaben sich diese Personen nach dem Zimmer Geigers, um endgültig festzustellen: Herr Leo Geiger war tot, aber nicht auf natürliche Weise gestorben, sondern das Opfer eines entsetzlichen Verbrechens geworden. Seine Augen waren aus den Höhlen getreten, die Zunge hing aus dem Munde heraus und das Gesicht des Greises war bläulich gefärbt. Um den Hals aber hing eine grüne Schnur.
Nunmehr hatte Frau Dr. Schlüter sich wieder gefaßt und zeigte eine bewunderungswürdige Haltung. Sie veranlaßte alle Anwesenden, das Zimmer zu verlassen, verschloß es und ersuchte Herrn Kolo Isbaregg, der, vom Lärm geweckt, aufgestanden war, sich auf einen Stuhl vor die Türe zu setzen und bis zum Eintreffen der Polizei niemanden das Totenzimmer betreten zu lassen. Hierauf verständigte sie telephonisch das Polizeikommissariat von dem furchtbaren Geschehnis, das sofort drei Polizisten nach der Pension schickte und seinerseits die Verständigung des Polizeipräsidiums unternahm.
Im Verlauf von wenig mehr als einer Viertelstunde hatte sich der Chef der Sicherheitspolizei, Dr. Zwanziger, mit mehreren Beamten, Detektivs, Schutzleuten und dem Polizeiarzt Dr. Kratochwill eingefunden. Der Arzt konstatierte, daß der Tod des Herrn Geiger vor etwa acht bis neun Stunden eingetreten sei, und zwar infolge gewalttätiger Strangulierung mittelst der noch um den Hals gewundenen Schnur. Die Polizeibeamten aber stellten folgendes fest:
Die zum Morde verwendete Schnur war ein Teil der Jalousieschnur, der im Zimmer des Ermordeten, möglicherweise unmittelbar vor der Tat, vielleicht aber auch schon viel früher, mit einem scharfen Messer abgeschnitten worden war. Der große Lederkoffer in einer Fensternische war durch Herausstemmen der beiden soliden Schlösser geöffnet, sein Inhalt durcheinandergeworfen worden. Eine sehr umfangreiche, schwarze Aktentasche lag geöffnet und leer auf dem, Teppich neben dem Koffer. Uhr, zwei Ringe und eine Krawattennadel, alles von ziemlich bedeutendem Wert, lagen unbeachtet auf dem Nachtkästchen neben dem Bett. Der oder die Mörder hatten es also nicht auf diese Schmucksachen, sondern auf einen Teil des lnhaltes des Koffers, vielleicht der Aktentasche, abgesehen gehabt.
Einer der anwesenden Detektivs, dessen Spezialität die Begutachtung von Schlössern und Schlüsseln ist, machte nach sorgfältiger Untersuchung des Türschlosses folgende Feststellungen:
Das Schloß der Zimmertüre war vom Korridor aus mittelst eines sogenannten Dietrichs geöffnet worden, was nicht schwer fallen konnte, weil Schloß und Schlüssel ganz primitiver Natur sind. Der Täter mußte daher nach vollbrachtem Morde den Schlüssel, der wahrscheinlich beim Aufschließen herausgefallen war, aufgehoben und ins Schloß gesteckt haben, was auf Kaltblütigkeit und Ungestörtheit schließen läßt. Weitere positive Beobachtungen waren vorläufig nicht zu machen.
Sämtliche Pensionäre und die Hausgehilfinnen wurden einem Verhöre unterzogen, das ergebnislos blieb. Sie hatten nichts gesehen und nichts gehört, und um ihre Meinung befragt, erwiderten sie alle, die einen zögernd, die anderen dezidiert:
‚Der Spanier …‘
Natürlich hatte auch Polizeirat Dr. Zwanziger sofort seine volle Aufmerksamkeit diesem mysteriösen spanischen Diplomaten Dr. Diego Alvarez zugewendet und die mit allem Eifer angestellten Recherchen ergaben folgendes:
Im Zimmer des Spaniers befand sich buchstäblich nichts, aber auch gar nichts; kein Wäschestück, kein Papierfetzchen. Er hatte also scheinbar alles in seiner Handtasche für die angesagte Fahrt auf den Semmering mitgenommen. Ein Beamter begab sich nun schleunigst in das spanische Botschafterpalais, wo er bei dem Botschafter persönlich Erkundigung einzog. Das Resultat war das erwartete: Es gab dort keinen Diego Alvarez, man kannte auch niemanden dieses Namens und konnte mit Bestimmtheit versichern, daß sich im Dienste des spanischen Auswärtigen Amtes eine solche Person nicht befindet. Daraufhin wurde telephonisch in sämtlichen Hotels und Pensionen des Semmering mit negativem Resultat angefragt und eine ebenfalls telephonisch herbeigeführte Unterredung mit dem Kondukteur des Frühzuges der Südbahn, der inzwischen in Graz seine Reise beendigt hatte, ergab ebenfalls, daß sich im Zuge niemand befunden hatte, auf den die markante Personsbeschreibung des hinkenden, bebrillten, bärtigen Mannes mit Schlapphut und Radmantel gepaßt hätte.
Es konnte sonach nicht der geringste Zweifel bestehen, daß der Mörder in der Person des hinkenden Fremden zu suchen sei.
Immerhin nahm unsere Polizei mit anerkennenswerter Umsicht die Erhebungen nach einer ganz anderen Richtung auf. Herr Koloman lsbaregg, dessen Heldentaten während des Weltkrieges des öfteren in der ‚Morgenpost‘ rühmende Erwähnung gefunden hatten, erzählte dem Chef der Sicherheitspolizei anläßlich seines Verhöres, daß er vor etwa vierzehn Tagen Zeuge gewesen sei, wie ein junges Mädchen nach einem heftigen Wortwechsel das Zimmer des Herrn Geiger weinend verlassen hatte. Frau Dr. Schlüter habe ihm erzählt, daß dies die Nichte des Ermordeten sei, die sich vergeblich an ihren Onkel um materielle Hilfe gewendet habe. Frau Dr. Schlüter bestätigte dies und fügte hinzu, daß das Mädchen um eine kleine Mitgift zur Gründung eines Hausstandes, da sie sich verheiraten wollte, gebeten habe, aber ziemlich schroff abgewiesen worden sei. Dieses junge Mädchen wurde im Laufe des Nachmittages unschwer zur Stelle gebracht. Es ist dies die einundzwanzigjährige Grete Altmann, ein zartes, hübsches Mädchen mit gewinnenden Manieren. Sie lebt mit ihrer Mutter, der verwitweten Beamtensgattin Anna Altmann, in recht bescheidenen Verhältnissen und gibt Klavierunterricht, da die Pension der Mutter zum Leben nicht ausreicht. Fräulein Altmann war über das schreckliche Ende ihres Onkels ersichtlich erschüttert und gab ohneweiters zu, in tiefstem Groll von ihm geschieden zu sein, nicht so sehr, weil er ihr die erbetene Hilfe abgeschlagen hatte, sondern wegen der zynischen Art und Weise, wie er dies getan. Ihr Bräutigam sei der Arzt Dr. Heinrich Thalmann, der seit einem Monat im Sanatorium Tobelbad eine Stellung als Assistenzarzt bekleide. Eine sofortige telephonische Anfrage in diesem bekannten Sanatorium ergab, daß Dr. Thalmann seit Antritt seiner Stellung die Anstalt noch nie verlassen und in der gestrigen Nacht bei einer schwierigen Unterleibsoperation assistiert habe.
Jeder, auch nur der leiseste Verdacht muß also nach dieser Richtung als beseitigt erklärt werden, und die Polizei hat nunmehr ihren ganzen Apparat in Tätigkeit gesetzt, um des angeblichen Spaniers habhaft zu werden. Heute, wenn unsere Leser diese Zeilen zu Gesicht bekommen, werden schon in ganz Deutschösterreich die Steckbriefe des Mörders verbreitet und überall Plakate affichiert sein, die eine Belohnung von 5000 Kronen für die Ergreifung des ruchlosen Gesellen ankündigen.“
VIII. Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Dies war der erste Bericht der „Morgenpost“, der in ganz Wien enormes Aufsehen erregte und zu einer wahren Panik in allen Fremdenpensionen führte. Die Mittagsausgabe des Blattes brachte aber einen weiteren umfangreichen Bericht, der auf die Sensationslust der Massen noch anregender wirkte. Der zweite Artikel, der ebenfalls der Feder des Reporters Finkelstein entstammte, hatte folgenden Wortlaut:
„Während wir in unserer Morgenausgabe als das einzige Wiener Blatt einen lückenlosen Bericht über den grauenhaften Mord in der vornehmen Pension Metropolis veröffentlichen konnten, sind wir jetzt in der Lage, auf Grund der Erhebungen der Polizei wie der privaten Nachforschungen unseres Spezialberichterstatters neue Mitteilungen über die Person des Ermordeten, Herrn Geiger, zu bringen, die der ganzen düsteren Affäre ein noch sensationelleres und aufregenderes Gepräge geben. In den späten Abendstunden des gestrigen Tages wurden die Effekten, Briefe und Geschäftspapiere des Ermordeten einer genauen Durchsicht unterzogen und das Resultat war nach mehr als einer Richtung verblüffend. Es ging nämlich aus aufgefundenen Briefen, Notizen und Kopien abgeschickter Briefe hervor, daß Herr Geiger in der Schweiz ein Vermögen besitzt, das er jeder Abgabe und Besteuerung auf geradezu raffinierte Weise zu entziehen wußte. Die Höhe dieses Vermögens wird auf etwa fünf Millionen Franken beziffert. Es fand sich aber in dem Nachlaß noch etwas vor, was von den Polizeibeamten als ganz unwesentlich und nicht beachtenswert beiseite gelegt wurde, in Wirklichkeit aber den wichtigsten Fingerzeig über das Motiv zur Ermordung Geigers und die Höhe der Beute bildet. Es ist dies nämlich eine Quittung des Wiener Bankvereines über die Bezahlung der Miete eines Tresorfaches per Monat Mai. Unser Spezialberichterstatter begab sich sofort in das Gebäude des Bankvereines, wo er folgende sensationelle Tatsachen erfuhr: Herr Geiger hatte sich genau acht Tage vor seiner Ermordung in der Tresorabteilung der Bank eingefunden, die gesamten Wertpapiere, Aktien und Pfandbriefe, die in seinem Fach lagen, mit sich genommen, sich sodann nach der Wechselstube im selben Gebäude begeben und dort die Papiere für den Gesamtbetrag von rund einer Million Kronen verkauft. Diesen großen Betrag barg er nach übereinstimmender Aussage des Kassiers wie eines Bankdieners in einer mitgebrachten schwarzen Aktentasche, sicher derselben, die nach der Ermordung auf dem Teppich neben dem erbrochenen Koffer lag.