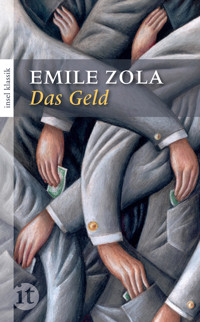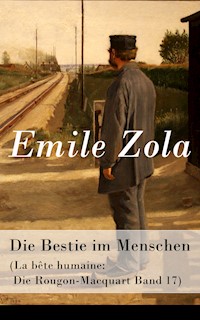
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Die Bestie im Menschen (La bête humaine: Die Rougon-Macquart Band 17)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Die Bestie im Menschen oder auch Das Tier im Menschen ist ein Roman von Émile Zola. Er bildet den siebzehnten Teil des Rougon-Macquart-Zyklus. Die Handlung trägt sich größtenteils auf der Eisenbahnstrecke zwischen Paris und Le Havre sowie im Bahnhofsbereich zu. Zola vollendete den Roman, inspiriert durch die Züge, die er von seinem Wohnhaus in Médan aus beobachten konnte, im Frühjahr 1890. Im Zentrum der Handlung stehen Roubaud, der Stationsvorsteher von Le Havre, seine Frau Séverine und der Eisenbahner Jacques Lantier. Der Lokführer Jacques Lantier spürt in sich das Bedürfnis, eine Frau mit einem Messer zu töten. Er fürchtet sich vor der Versuchung und führt ein isoliertes Leben. Er empfindet eine tiefe Zuneigung zu seiner Lokomotive La Lison. Zu Beginn des Romans entdeckt der Stationsvorsteher Roubaud, dass seine Frau Séverine in ihrer Kindheit eine Affäre mit Grandmorin, dem Präsidenten der Eisenbahngesellschaft, hatte. Infolgedessen werden er und seine Frau von der Gesellschaft protegiert. Auf einer Zugfahrt von Paris nach Le Havre töten Roubaud und Séverine Grandmorin und werfen ihn aus dem fahrenden Zug. Anschließend klettern sie, während sich der Zug in voller Fahrt befindet, in ein anderes Abteil. Émile Édouard Charles Antoine Zola (1840-1902) war ein französischer Schriftsteller und Journalist. Zola gilt als einer der großen französischen Romanciers des 19. Jahrhunderts und als Leitfigur und Begründer der gesamteuropäischen literarischen Strömung des Naturalismus. Zugleich war er ein sehr aktiver Journalist, der sich auf einer gemäßigt linken Position am politischen Leben beteiligte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Die Bestie im Menschen (La bête humaine: Die Rougon-Macquart Band 17)
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Roubaud war in das Zimmer getreten und stellte einen Laib Brod, die Fleischpastete und eine Flasche Weißwein auf den Tisch. Mutter Victoire hatte am Morgen, ehe sie sich auf ihren Posten begab, das Feuer im Ofen mit einer so dicken Kohlenstaubschicht belegen zu müssen geglaubt, daß jetzt die Hitze im Zimmer geradezu erdrückend war. Der Bahnhofs-Unterinspector öffnete daher das Fenster und lehnte sich hinaus.
Das Haus, in welchem er sich befand, war ein hohes Gebäude, und zwar das letzte auf der rechten Seite in der Sackgasse Amsterdam. Es gehörte der Gesellschaft der Westbahn und wurde von bestimmten Beamten derselben bewohnt. Das Fenster befand sich im fünften Stockwerk, gerade an der Ecke des hier endigenden Mansardendaches und führte auf den Bahnhof, der ein breites Loch in das Quartier de l'Europe riß, so daß sich eine weite Fernsicht aufrollte, die an jenem Nachmittage ein nebliger Februarhimmel, von einem feuchtwarmen, vom Sonnenschein durchblitzten Grau noch gewaltiger erscheinen ließ.
Vor ihm drängten sich und verschwanden leichthin die Häuser der Rue de Rome. Zur Linken öffneten die bedeckten Hallen ihre angerauchten Riesenglasdächer, das Auge tauchte tief in die ungeheure Halle für den Fernverkehr, welche die Baulichkeiten für die Post und das Wärmrohrmagazin von den anderen kleineren Hallen für den Verkehr nach Argenteuil, Versailles und der Ringbahn trennten. Rechts dagegen überwölbte der Pont de l'Europe mit seinem eisernen Stern die tiefe Furche, die man jenseits wieder erscheinen und von dort bis zum Tunnel von Les Batignolles heranreichen sah. Gerade unter dem Fenster, welches dieses ganze, mächtige Feld beherrschte, theilten sich die drei doppelten Schienenstränge, die unter der Brücke hervorkamen, in zahlreiche andere, die fächerartig auseinander liefen, und ihre vervielfachten, zahllosen, metallenen Arme verloren sich sofort unter den Glasdächern der Hallen. Die drei Weichenstellerhäuschen diesseits der Brückenbogen zeigten ihre öden Gärtchen. Mitten in dem konfusen Gewirr der auf den Schienen umherstehenden Waggons und Maschinen schimmerte ein rothes Signallicht verletzend durch den bleichen Tag.
Einen Augenblick fesselte Roubaud dieses Bild; er stellte Vergleiche mit seinem Bahnhof in Havre an. Jedesmal, wenn er einen Tag in Paris zubringen mußte und bei Mutter Victoire abstieg, ergriff ihn von Neuem das Interesse an seinem Beruf. Unter dem Dache der Fernverkehrhalle hatte die Ankunft eines Zuges von Nantes den Bahnsteig belebt. Seine Blicke folgten der kleinen Rangirmaschine mit den drei niedrigen und gekoppelten Räderpaaren, welche mit der Ausrangirung des Zuges begann und flink und behutsam die Waggons auf die Remisenstränge führte und stieß. Eine andere, viel mächtigere Lokomotive als jene, eine Eilzugslokomotive mit zwei großen gefräßigen Rädern, stand wartend allein; dichter, schwarzer Rauch stieg aus ihrem Schornstein ruhig und kerzengerade in die Luft. Seine ganze Aufmerksamkeit aber wurde jetzt von dem nach Caen bestimmten drei Uhr fünfundzwanzig Zug in Anspruch genommen, der schon mit Reisenden besetzt war und die Vorlegung der Lokomotive erwartete. Diese selbst konnte man noch nicht sehen, da sie jenseits des Pont de l'Europe festgehalten wurde, dagegen hörte man sie durch eiliges, halblautes Pfeifen ihrem Wunsche nach freier Fahrt Ausdruck geben, wie Einer, den die Ungeduld treibt. Jetzt schrie Jemand laut einen Befehl, sie antwortete durch einen kurzen Pfiff, daß sie verstanden hätte. Ehe sie sich in Bewegung setzte –einen Augenblick Stille, dann aber wurden die Ventile geöffnet und mit betäubendem Zischen streifte der Dampf den Erdboden. Dann sah man unter der Brücke eine weiße Masse aufquellen, die erst sich aufblähte und dann wie schneeweiße Flaumfedern umhergewirbelt, unter den eisernen Rippen der Brücke in Nichts zerflatterte. Ein großer Theil der Strecke wurde plötzlich in weiße Wolken gehüllt, während die dichter gewordene Rauchsäule der anderen Lokomotive ihren schwarzen Schleier ebenfalls ausbreitete. Aus ihm heraus erschallten die langgedehnten Töne des Signalhorns, Befehle, das Dröhnen der Drehscheiben. Der Rauchschleier zerriß und er unterschied einen Zug von Versailles und einen von Auteuil, die sich soeben bei der Ankunft des einen und der Abfahrt des andern gekreuzt hatten.
Roubaud wollte gerade das Fenster verlassen, als eine Stimme, die seinen Namen rief, ihn veranlaßte, sich noch weiter hinauszubeugen. Er bemerkte unter sich, auf dem Balkone des vierten Stockwerkes einen jungen Mann von vielleicht dreißig Jahren, Henri Dauvergne. Dieser war Zugführer und wohnte dort mit seinem Vater, einem Assistenten für den Fernverkehr und mit seinen zwei Schwestern, Claire und Sophie, zwei reizenden Blondinen von achtzehn und zwanzig Jahren, welche mit den Einkünften der beiden Männer im Betrage von sechstausend Franken, ewig heiter gelaunt die Wirthschaft führten. Man hörte soeben wieder die Aeltere lachen, während die Jüngere sang und überseeische Vögel in ihrem Käfige um die Wette mit ihr ihre Triller und Läufe schmetterten.
»Guten Tag, Herr Roubaud, Sie in Paris? ... Ganz recht, wegen des Vorfalls mit dem Unterpräfecten!«
Der Unterinspector blieb deshalb in seiner Haltung und erzählte, daß er diesen Morgen mit dem Schnellzuge um sechs Uhr vierzig Minuten von Havre abgefahren sei. Ein Befehl des Vetriebsdirectors habe ihn nach Paris gerufen und er hätte sich soeben eine tüchtige Nase geholt. Er sei zufrieden, daß man ihm nicht gleich sein Amt genommen habe.
»Und wie geht es Madame?«
Seine Frau war ebenfalls mitgekommen, Einkäufe halber. Er erwartete sie jetzt hier in dem Zimmer der Mutter Victoire, die ihnen jedesmal, wenn sie nach Paris kamen, den Schlüssel zu diesem Raume einhändigte, woselbst sie ungestört und unter vier Augen frühstücken konnten, während die brave Frau unten in den Bedürfnißanstalten ihr Amt versehen mußte. Heute hatten sie schon in Mantes ein kleines Frühstück eingenommen, um zuerst ihre Besorgungen abmachen zu können. Jetzt aber war drei Uhr schon vorüber und er kam vor Hunger fast um.
Henri wollte sich von einer liebenswürdigen Seite zeigen und fragte lächelnd nach oben:
»Bleiben Sie über Nacht in Paris?«
Nein, keineswegs. Sie führen schon mit dem Schnellzuge um sechs Uhr dreißig nach Havre zurück. Urlaub, damit käme er schön an! Ja, wenn sie Einem den Stuhl vor die Thür setzen wollen, da sind sie gleich bei der Hand!
Die beiden Männer nickten mit dem Kopf und blickten sich verständnißinnig an. Aber sie hörten sich nicht mehr, denn ein verteufeltes Piano setzte alle Register ein. Die beiden Schwestern paukten gemeinsam auf die Tasten, ihr Lachen aber übertönte das Instrument, wahrscheinlich wollten sie die Vögel im Käfige in noch größere Aufregung versetzen. Der junge Mann erheiterte sich ebenfalls, er grüßte und ging in das Zimmer hinein. Die Augen des allein gelassenen Unterinspectors hafteten eine Minute an dem Balkone, von welchem diese jugendliche Fröhlichkeit herauftönte. Dann erhob er die Blicke und sah, daß die Lokomotive ihre Ventile geschlossen hatte und der Weichensteller sie auf den Zug nach Caen dirigirte. Die letzten Flöckchen des weißen Rauches verflüchtigten sich unter den dicken Wirbeln des schwarzen Qualms, der den Himmel besudelte. Und nun trat auch er in das Zimmer zurück.
Vor der Kukuksuhr angelangt, die auf drei Uhr zwanzig Minuten zeigte, machte Roubaud eine Bewegung verzweifelter Ungeduld. Wie, zum Teufel, konnte sich Séverine nur so lange aufhalten lassen? Wenn sie einmal in einem Laden war, konnte man sie garnicht wieder herausbringen. Um sich selbst über den Hunger hinwegzutäuschen, der seinen Magen marterte, kam er auf den Einfall, den Tisch zu decken. Er war in dem mächtigen, zweifenstrigen Zimmer, das mit seinen Nußbaummöbeln, dem Bett mit den rothkattunenen Bezügen, dem Anrichteschrank und runden Tische, seinem normandiesischen Geschirrschrank gleichzeitig als Schlaf-, Speisezimmer und Küche diente, wie zu Hause. Er entnahm den Schränken Servietten, Teller, Gabeln und Messer und zwei Gläser. Das ganze Geschirr war von einer peinlichen Sauberkeit. Seine wirthschaftlichen Sorgen belustigten ihn und er fühlte sich glücklich über das Weiß des Leinens, bis über die Ohren verliebt in seine Frau. Er mußte selbst laut lachen, dachte er an das schöne, frische Lachen, in das sie ausbrechen würde, wenn sie zur Thür hereinkäme. Als er die Fleischpastete auf den Teller gelegt und die Flasche Weißwein daneben gestellt hatte, suchten seine Augen etwas. Dann zog er hastig zwei vergessene Päckchen aus der Tasche, eine kleine Büchse Sardinen und etwas Schweizerkäse.
Es schlug halb. Roubaud marschirte abwechselnd durch die Länge und Breite des Zimmers und lauschte bei dem geringsten Geräusch auf der Treppe. Als er während seines müßigen Wartens beim Spiegel vorüberkam, blieb er stehen, um sich zu betrachten. Er alterte nicht, er war schon der Vierzig nahe, ohne daß das brennende Roth seiner krausen Haare zu bleichen begonnen hätte. Sein sonnenblonder Bart blieb dicht. Seine Figur war nur mittelgroß, aber ließ außerordentliche Körperkräfte ahnen. Er gefiel sich, er schien von seinem ein wenig flachen Haupte, der niedrigen Stirn, dem Stiernacken und seinem runden, blutvollen Gesicht, welches zwei große, lebhafte Augen erhellten, sehr befriedigt. Seine Augenbrauen liefen ineinander.
Er hatte eine um fünfzehn Jahre jüngere Frau geheirathet. Es war ihm daher ein Bedürfniß, öfter den Spiegel zu Rathe zu ziehen, und was er dort erblickte, gab ihm die Ruhe wieder zurück.
Man hörte das Geräusch nahender Schritte. Roubaud öffnete eilig die Thür etwas. Es war eine Zeitungsverkäuferin des Bahnhofs, die ihr nebenan gelegenes Zimmer aufsuchte. Er wandte sich in das Zimmer zurück und interessirte sich zunächst für eine auf dem Anrichteschrank stehende Muschelschachtel. Er kannte sie sehr gut, denn es war ein Geschenk von Séverine an die Mutter Victoire, ihre Amme. Dieser kleine Gegenstand rief ihm sofort die Geschichte seiner Heirath in's Gedächtniß. Bald war es drei Jahre her. Er selbst war im Süden, in Plassans als Sohn eines Kärrners geboren. Aus dem Militärdienst schied er mit dem Grade eines Feldwebels. Dann war er lange Zeit Bahnpostbeamter auf dem Bahnhof zu Mantes, aus welcher Stellung er in die eines Oberbahnpostbeamten in Barentin überging. Hier hatte er seine theure Frau kennen gelernt, als sie in Begleitung von Fräulein Berthe, der Tochter des Präsidenten Grandmorin von Doinville kam, um in Barentin den Zug zu besteigen. Séverine Aubry war allerdings nur das jüngste Kind eines im Dienste des Grandmorin gestorbenen Gärtners, aber der Präsident, ihr Pathe und Vormund, bevorzugte sie in so auffälliger Weise –sie blieb die Gefährtin seiner Tochter, mit der zusammen sie in das Pensionat in Rouen geschickt wurde –und sie selbst war von solcher ihr angeborner Vornehmheit, daß Roubaud lange Zeit sich mit keinem Wörtchen ihr zu nahen wagte und sie mit der Leidenschaft eines Grobarbeiters, den ein zierliches, von ihm für kostbar gehaltenes Juwel lockt, aus der Entfernung anschmachtete. Das war der einzige Roman seines Lebens. Er würde sie geheirathet haben, auch wenn sie keinen Pfennig besessen hätte, lediglich aus Freude an ihrem Besitz, und als er sich endlich erkühnt hatte, übertraf die Verwirklichung weit den Traum: außer Séverine und einer Mitgift von zehntausend Franken hatte der Präsident, der sich bereits zur Ruhe gesetzt und Mitglied des Aufsichtsrathes der Westbahn-Gesellschaft war, ihn unter seine Protection genommen. Auf diese Weise kam er am Tage nach seiner Hochzeit als Bahnhofs-Unterinspector nach Havre. In ihm steckte jedenfalls das Zeug zu einem guten Beamten, er war solide, pünktlich, gewissenhaft, hatte einen etwas beschränkten, aber sehr rechtschaffen denkenden Geist, kurz, er besaß alle Eigenschaften, welche die sofortige Erfüllung seines Gesuches und die Schnelligkeit seiner Laufbahn erklärlich machten. Ihm war aber der Gedanke lieber, daß er Alles seiner Frau zu verdanken habe. Er anbetete sie geradezu.
Nachdem Roubaud noch die Sardinenbüchse geöffnet, verlor er vollends die Geduld. Um drei Uhr hatte man sich treffen wollen. Wo nur konnte sie stecken? Sie sollte ihm nicht damit kommen, daß der Einkauf von einem Paar Schuhe und sechs Hemden den ganzen Tag koste. Als er sich von Neuem dem Spiegel gegenüber sah, bemerkte er, daß seine Augenbrauen sich sträubten und eine tiefe Falte die Stirn durchfurchte. In Havre war ihm nie ein Verdacht in den Sinn gekommen. In Paris aber schuf seine Einbildung alle möglichen Arten von Gefahren, Listen, Vergehen. Ein Blutstrom ergoß sich in sein Gehirn und die Fäuste des ehemaligen Bahnarbeiters ballten sich, wie zu jener Zeit, als er noch die Waggons rangiren half. Er wurde wieder zum Vieh, das seiner Kräfte nicht bewußt ist, er würde seine Frau in einem Anfall blinder Wuth zermalmt haben.
Die Thür flog auf und Séverine betrat frisch und fröhlich das Zimmer.
»Da bin ich ... Du hast gewiß geglaubt, ich bin verloren gegangen?«
In dem Jugendreiz ihrer fünfundzwanzig Jahre hielt man sie zuerst für groß, schlank und sehr geschmeidig, und doch war sie rund, denn ihre Knochen waren sehr zart. Auch war sie auf den ersten Blick nicht niedlich, denn sie hatte ein längliches Gesicht, einen stark entwickelten Mund, der indessen prächtige Zähne sehen ließ. Aber wenn man sie näher betrachtete, verführte sie durch einen eigenthümlichen Reiz und auch durch den Blick ihrer großen blauen Augen unter ihrer vollen schwarzen Haarkrone.
Als ihr Gatte, ohne ein Wort zu erwidern, fortfuhr, sie mit dem wirren, unstäten Blick zu examiniren, den sie so gut kannte, setzte sie gleich hinzu:
»O, wie bin ich gelaufen ... stelle Dir vor, daß kein Omnibus zu haben war. Für einen Wagen aber wollte ich kein Geld ausgeben und daher bin ich zu Fuß gekommen ... Sieh nur, wie heiß mir ist.«
»Du wirst mir doch nicht einreden wollen,« erwiderte er heftig, »daß Du jetzt aus dem »Bon marché« kommst.«
Aber schon hing sie mit der schmeichlerischen Zärtlichkeit eines Kindes an seinem Halse und legte ihm ihre reizende, kleine, fleischige Hand ans den Mund.
»Schweige, schweige. Du schlechter Mensch! ... Du weißt doch, wie lieb ich Dich habe.«
Ihre Persönlichkeit strömte eine so ehrliche Aufrichtigkeit aus, er hatte ein so untrügliches Gefühl, daß sie rein und rechtschaffen geblieben war, daß er sie wie toll in seine Arme schloß. Das war das gewöhnliche Ende seiner Verdächtigungen. Sie wehrte ihm nicht, denn sie ließ sich gern hätscheln. Er bedeckte ihr Gesicht mit Küssen, die sie nicht zurückgab. Auch dieser Umstand, diese passive, töchterliche Neigung dieses großen Kindes, das sich nicht in die Liebende verwandelte, ließ eine dunkle Ungewißheit nicht von ihm weichen.
»Du hast den »Bon marché« also ausgeplündert?«
»O ja ... Ich erzähle Dir Alles ... Erst aber wollen mir essen ... Habe ich einen Hunger! .. Halt und höre, ich habe Dir etwas mitgebracht. Du mußt aber erst sagen: mein schönes Geschenk.«
Sie stand dicht vor ihm und lachte ihm ins Gesicht. Sie hatte ihre rechte Hand in die Tasche gesenkt und hielt in ihr einen Gegenstand, den sie aber nicht herauszog.
»Sage flink: mein schönes Geschenk.«
Er lachte ebenfalls und that ihr als gutmüthiger Kerl den Gefallen.
»Mein schönes Geschenk.«
Sie hatte als Ersatz für ein vor vierzehn Tagen verloren gegangenes und von ihm bejammertes Messer ihm ein neues gekauft. Er stieß einen Freudenschrei aus und erklärte dieses schöne neue Messer mit seinem Elfenbeinheft und der leuchtenden Klinge für vortrefflich. Er wollte es sofort in Gebrauch nehmen. Sie war entzückt von seiner Freude und bettelte ihm einen Sou ab, damit ihre Freundschaft nicht zerschnitten würde.
»Essen, essen,« rief sie. »Nein, nein, ich bitte Dich, schließe das Fenster noch nicht. Mir ist noch zu warm.«
Sie war zu ihm an das Fenster getreten und betrachtete dort, an seine Schulter gelehnt, während einiger Minuten den mächtigen Bahnkörper. Die Rauchwolken hatten sich jetzt verzogen, die wie Kupfer erglühende Sonnenscheibe versank drüben hinter den Häusern der Rue de Rome im Nebel. Unten führte eine Rangirmaschine den Zug nach Mantes, der um vier Uhr fünfundzwanzig Minuten abgehen sollte, schon fertig rangirt, herauf. Sie stieß ihn auf den Strang neben dem Abfahrtssteig der Halle und wurde dann losgekoppelt. Das Zusammenstoßen der Puffer, das aus dem Waggonschuppen der Ringeisenbahn heraufschallte, belehrte, daß man vorsorglich mit der Ankoppelung von Waggons beschäftigt war. Einsam inmitten der Schienenstränge aber stand mit ihrem vom Staub der Fahrt geschwärzten Führer und Heizer eine schwerfällige Bummelzuglokomotive unbeweglich, als wäre ihr Athem und Kraft entschwunden, nur ein dünnes Rauchfädchen entströmte einem ihrer Ventile. Sie wartete, daß man ihr die Stränge zur Rückkehr in das Depot von Les Batignolles frei mache. Jetzt klappte ein rothes Signal auf und verschwand wieder. Die Lokomotive fuhr davon.
»Sind diese kleinen Dauvergnes vergnügt!« fagte Roubaud beim Verlassen des Fensters. »Hörst Du, wie sie auf dem Piano herumpauken? ... Ich sah vorhin Henri, der mir seine Empfehlungen an Dich auftrug.«
»Zu Tisch, zu Tisch!« rief Séverine.
Sie machte sich sofort an die Sardinen, die sie fast herunterschlang. Schon lange her, seit man in Mantes gefrühstückt! Wenn sie nach Paris kam, war sie wie berauscht. Jede ihrer Fiebern zuckte aus dem Glücksgefühl heraus, wieder über das pariser Pflaster gelaufen zu sein und von ihren Einkaufen im »Bon marché« fieberte sie noch. Alles, was sie im Winter erübrigt hatte, gab sie dort im Frühjahr auf einmal wieder aus. Sie liebte es, alles dort zu kaufen, denn sie behauptete, dadurch schlüge sie die Reisekosten vollständig wieder heraus. Den Mund stets voll, konnte sie nicht genug davon schwatzen. Ein wenig verwirrt und rot geworden, gestand sie endlich die Totalziffer ihrer Einkäufe ein, über Dreihundert Franken.
»Teufel!« sagte Roubaud bestürzt, »Du führst Dich ja als Frau eines Unterinspectors recht gut auf ... Ich dachte, Du hättest nur ein Paar Stiefel und sechs Hemden zu kaufen?«
»Aber diese nicht wiederkehrenden Gelegenheiten, mein Freund! ... Entzückender, gestreifter Seidenstoff, ein geschmackvoller Hut, der reine Traum! Fertige Unterröcke mit gestickten Volants! In Havre hätte ich das Doppelte bezahlen müssen ... Man war gerade dabei, es für mich zu expediren. Du wirst ja sehen.«
Er zog es vor zu lachen; in ihrer Freude und ihrer Miene einer verwirrt nach Vergebung Haschenden sah sie zu niedlich aus. Und dann war auch dieses improvisirte kleine Diner in diesem Zimmer, in dem sie sich allein befanden und besser als im Restaurant aufgehoben waren, zu reizend. Sie trank gewöhnlich nur Wasser, heute aber ließ sie sich gehen und schlürfte, ohne es zu wissen, ihr Glas Weißwein. Die Sardinenbüchse war geleert und sie zerlegten nun die Fleischspeise mit dem schönen neuen Messer. Ein Triumph für Séverine, daß es so gut schnitt.
»Und Du, wie steht es mit Deiner Angelegenheit?« fragte sie. »Du läßt mich schwatzen und erzählst mir garnicht, wie Deine Sache wegen des Unterpräfecten geendet hat?«
Er erzählte ihr nun die Einzelheiten seines Besuches beim Betriebsdirector. O, man hätte ihm nach allen Regeln den Kopf gewaschen. Er hätte ihm die reine Wahrheit erzählt, wie diese Krabbe von Unterpräfecten mit seinem Hunde durchaus in ein Koupé erster Klasse gewollt habe, trotzdem ein Waggon zweiter Klasse, der nur für die Jäger und ihre Köter reservirt gewesen, im Zuge war, von dem entstandenen Streite und welche Worte gefallen wären. Der Chef gäbe ihm im Grunde genommen Recht, denn auch ihm sei daran gelegen, daß der Beamte respectirt würde. Aber das Schreckliche an der Sache sei, daß der Director zu ihm gesagt habe: »Ihr werdet nicht immer die Herren bleiben!« Er stehe im Verdachte eines Republikaners. Die bemerkenswerthen Reden bei Beginn der Session des Jahres 1869 und die dumpfe Furcht vor den nächsten allgemeinen Wahlen hätten die Regierung mißtrauisch gemacht. Ohne die ausgezeichnete Empfehlung des Präsidenten Grandmorin würde man ihn zweifellos schon seines Amtes enthoben haben. Schließlich hätte er doch den von dem Letzteren gerathenen und aufgesetzten Entschuldigungsbrief unterschreiben müssen.
»Also? Hatte ich nicht Recht, ihm zu schreiben und ihm heute früh mit Dir einen gemeinsamen Besuch zu machen, ehe Du Deine Wäsche erhieltest?« unterbrach ihn lebhaft Séverine. »Ich wußte ganz genau, daß er uns aus der Klemme ziehen würde.«
»Ja, er liebt Dich sehr,« antwortete Roubaud, »und sein Arm reicht weit in unserer Gesellschaft ... Was hat das nun für einen Nutzen, ein tüchtiger Beamter zu sein? Natürlich hat man mir auch Schmeicheleien gesagt: ich hätte zwar nicht genug Initiative, aber ich führte mich gut, sei gehorsam und entschlossen. Und trotzdem sage ich Dir, meine Theure, wärest Du nicht meine Frau und Grandmorin nicht aus Freundschaft für Dich für mich eingetreten, so hätte ich meine Strafversetzung nach einer kleinen Station in der Tasche gehabt.«
»Zweifellos, sein Arm reicht weit,« wiederholte Séverine, als spräche sie zu sich selbst, während ihre Augen die Leere suchten.
Es herrschte Schweigen, Séverine verharrte mit ihren sich vergrößernden und wie abwesend starrenden Augen in derselben Stellung und hörte mit dem Essen auf. Sie rief sich jedenfalls die Tage ihrer Kindheit in die Erinnerung, die sie dort unten in Schloß Doinville, vier Meilen von Rouen entfernt, zugebracht hatte. Sie hatte nie ihre Mutter gekannt. Ihr Vater, der Gärtner Aubry, starb gerade, als sie ihr dreizehntes Lebensjahr begann. Schon damals hatte der Präsident, der Wittwer war, sie seiner Tochter Berthe beigesellt und unter die Obhut seiner Schwester, Madame Bonnehon, der Gattin eines Kaufmannes und ebenfalls Wittwe, heute Besitzerin des Schlosses, gestellt. Berthe, die zwei Jahre älter war als sie, hatte sechs Monate nach ihr einen Herrn von Lachesnaye, Rath beim Gerichtshof in Rouen, ein dürres, gelbes Männchen, geheirathet. Im vergangenen Jahre stand der Präsident noch diesem Gerichte vor. Dann hatte er sich nach einer brillanten Carrière in den Ruhestand zurückgezogen. Im Jahre 1804 geboren, Substitut in Digne zu Beginn des Jahres 1830, dann in Fontainebleau und Paris, später Procurator in Troyes, Generaladvocat in Rennes, wurde er schließlich erster Präsident in Rouen. Mehrfacher Millionär, gehörte er dem Generalrath seit 1855 an und war am Tage seines Abschieds zum Kommandeur der Ehrenlegion ernannt worden. Soweit sie zurückdenken konnte, sah sie ihn noch als untersetzten, kräftig gebauten Mann, dessen bürstenförmig stehende Haare schon frühzeitig eine weiße Färbung zeigten und zwar dieses goldne Weiß, wie es aus dem einstigen Blond hervorgeht, den Backenbart glatt abrasirt bis auf die Fraise, ohne Schnurrbart, mit einem eckigen Gesicht, welches die ein hartes Blau weisenden Augen und die stark entwickelte Nase streng erscheinen ließen. Er machte alles um sich herum erzittern.
»He! An was denkst Du?« mußte Roubaud zweimal laut fragen.
Sie fuhr zusammen und ein leiser Schauder überlief sie, als schüttele sie ein jäher Schrecken.
»O, an gar nichts.«
»Du issest nicht, hast Du keinen Hunger mehr?«
»O doch ...Du sollst gleich sehen.«
Séverine lehrte ihr Glas Wein und vollendete dann die Zerlegung der Fleischspeise auf ihrem Teller. Jetzt gab es aber einen Aufstand: sie hatten mit dem Laib Brod schon vollständig aufgeräumt und es blieb ihnen keine Krume mehr für den Käse. Erst Geschrei, dann Gelächter, als sie, nachdem sie alles durchsucht hatten, im Buffet der Mutter Victoire ein Stück altbackenes Brod entdeckten. Obgleich das Fenster offen stand, war es noch immer heiß im Zimmer und die junge Frau, welche gerade vor dem Ofen saß, kühlte sich kaum ab, sondern wurde immer rother und aufgeregter durch das Unerwartete dieses durchschwatzten Frühstücks in diesem Zimmer. Bei der Erwähnung der Mutter Victoire kam Roubaud nochmals auf Grandmorin zu sprechen: auch eine, die Jenem ein freundliches Loos verdankte! Sie war eine Verführte, deren Kind starb, dann Amme von Séverine, deren Geburt ihrer Mutter das Leben kostete; später, als Frau eines Heizers der Gesellschaft, ernährte sie sich in Paris elend mit Nähen, denn ihr Mann verzehrte die ganzen Einkünfte, bis die Wiederbegegnung mit ihrem Milchkinde die alten Bande auf's Neue knüpfte und Séverine auch Jene zu einem Schützlinge des Präsidenten machte. Und heute hatte sie durch seine Vermittlung den Posten in der Bedürfnißanstalt und zwar als Wärterin des Extracabinets in der Damenabtheilung inne, die beste Stelle. Die Gesellschaft gab ihr nur hundert Franken jährlich, sie machte aber daraus mit Hilfe der Trinkgelder an vierzehnhundert, ohne ihre Wohnung, dieses Zimmer, zu rechnen, dessen Heizung sie sogar frei hatte. Alles in Allem also eine sehr angenehme Situation. Und Roubaud rechnete aus, daß, wenn Pecqueux, ihr Gatte, seine zweitausendachthundert Franken Fixum und Prämien mit in die Wirthschaft stecken würde, anstatt sie auf beiden Endstationen der Linie in Flüssigkeiten umzusetzen, das Ehepaar mehr als viertausend Franken verdienen würde, das heißt also das Doppelte von seinem Einkommen als Unterinspector des Bahnhofs in Havre.
»Selbstverständlich,« schloß er, »kann man nicht jeder Frau eine Dienstleistung in den Bedürfnißanstalten zumuthen, aber gar so albern ist auch dieses Amt noch nicht.« Inzwischen hatten sie ihren mächtigsten Hunger bereits gestillt und sie aßen nur noch mechanisch; sie schnitten den Käse in kleine Stückchen, um das Mahl in die Länge zu ziehen. Auch ihre Worte flossen langsamer von ihren Lippen.
»Da fällt mir gerade ein,« rief er, »ich habe Dich zu fragen vergessen, warum hast Du die Einladung des Präsidenten zu einem zwei- oder dreitägigen Besuch in Doinville ausgeschlagen?«
Sein Geist führte in dem Wohlgefühle der Verdauung ihm soeben noch einmal den Besuch vor Augen, den sie heute früh dicht beim Bahnhof in dem Hotel der Rue du Nocher abgestattet hatten. Er sah sich wieder in dem großen ernsten Kabinet, er hörte den Präsident ihnen erzählen, daß er am nächsten Tage nach Doinville reisen würde. Dann hatte Jener unter einer plötzlichen Eingebung ihnen angeboten, noch heute Abend mit ihnen gemeinsam den sechs Uhr dreißig Zug zu benutzen, um in Person sein Pathchen zu seiner Schwester zu bringen, die schon lange nach ihr Sehnsucht habe. Die junge Frau aber hatte alle möglichen Verhinderungsgründe vorgeschützt.
»Ich kann in diesem kleinen Ausfluge nichts Schlimmes finden,« fuhr Roubaud fort. »Du hättest bis zum Donnerstag dort bleiben können, ich würde mich schon bis dahin allein beholfen haben ... Du mußt doch zugestehen, daß wir in unsrer Stellung Jene nöthig haben. Ich finde es nicht sehr geschickt, ihre Höflichkeiten abzuweisen, umsomehr als Deine Weigerung ihm sichtlich nahe ging ... Ich habe auch erst aufgehört in Dich zu dringen, als Du mich am Paletot zupftest. Dann stimmte ich Dir bei, aber ohne zu begreifen ... Nun warum wolltest Du nicht?«
Séverine, deren Augen unstät umherwanderten, machte eine Bewegung der Ungeduld.
»Kann ich Dich denn so allein lassen?«
»Das ist kein Grund ... Seit unsrer Hochzeit vor drei Jahren warst Du schon zweimal in Doinville und hast dort eine ganze Woche zugebracht. Ich sehe keinen Hinderungsgrund, auch zum dritten Male dorthin zu reisen.«
Die Verwirrung der jungen Frau wuchs, sie mußte den Kopf abwenden.
»Es sagte mir nicht zu. Du wirst mich doch nicht zu Dingen zwingen wollen, die mir mißfallen.«
Roubaud öffnete die Arme gleichsam als Zeichen dafür, daß er sie zu nichts zwänge, sagte aber dennoch:
»Halt! Du verbirgst mir etwas ... Hat Dich Frau Bonnehon das letzte Mal nicht gut aufgenommen?«
O doch. Frau Bonnehon wäre stets die Güte selbst gewesen. Diese liebenswürdige, große, kräftige Dame mit herrlichen blonden Haaren war trotz ihrer fünfundfünfzig Jahre noch eine Schönheit. Seit ihrer Wittwenschaft und selbst zu Lebzeiten ihres Mannes soll sie, wie man sich erzählte, ihr Herz oft verschenkt haben. In Doinville war sie der Abgott. Sie wandelte das Schloß in ein Paradies um. Die ganze Gesellschaft von Rouen, namentlich die Beamten waren dort ständige Besucher. Frau Bonnehon suchte ihre Freunde namentlich unter den Beamten.
»Dann gestehe, daß die Lachesnaye Dich kühl behandelt haben.«
Seit ihrer Ehe mit Herrn von Lachesnaye war Berthe Séverine gegenüber zweifellos eine andere geworden. Diese arme, unbedeutende Berthe mit ihrer rothen Nase wäre allerdings nicht mehr so gütig wie früher. Die Damen in Rouen lobten sie sehr ihrer Distinktion wegen. Ein so garstiger, trockener, geiziger Gatte wie der ihrige, schiene wirklich wie geschaffen, um seiner Frau seinen Charakter aufzuprägen und sie schlecht zu machen. Aber trotzdem, auch Berthe's Benehmen ihrer ehemaligen Genossin gegenüber hatte nichts zu wünschen übrig gelassen, Séverine könnte auch ihr keinen direkten Vorwurf machen.
»Dann mißfällt Dir also der Präsident dort unten?«
Séverine, die bis dahin langsam und monoton geantwortet hatte, machte abermals eine ungeduldige Bewegung.
»Ei! Welch ein Einfall!«
Und sie sprach weiter in kurzen, nervös abgebrochenen Sätzen. Man bekäme ihn im Schlosse kaum zu Gesicht. Er hätte sich in Doinville einen Pavillon reserviren lassen, dessen Thür auf eine öde Landstraße führe. Er ginge und käme, ohne daß Jemand es erführe. Seine Schwester wüßte nie genau zu sagen, wann er käme. In Barentin nähme er einen Wagen und ließe sich Nachts bis Doinville fahren; dort lebe er, von Niemandem gesehen, tagelang in seinem Pavillon. O, er würde dort am allerwenigsten Jemand belästigen.
»Es fiel mir gerade ein, weil Du mir gewiß an zwanzig Male schon erzählt hast, daß er Dir in Deiner Kindheit stets die blasse Furcht einflößte.«
»Die blasse Furcht! Du übertreibst wie gewöhnlich ... Gewiß, er lachte kaum. Er sah uns mit seinen großen Augen so durchdringend an, daß man sofort den Kopf senkte. Ich habe Leute vor ihm zittern und nicht ein Wort über die Lippen bringen gesehen, so sehr imponirte er ihnen durch den weitverbreiteten Ruf seiner Strenge und Weisheit ... Aber mich selbst zankte er nie aus, ich habe immer gefühlt, daß er eine Schwäche für mich hatte ...«
Ihre Stimme sank abermals zum Flüstern herab und ihre Augen suchten die Leere.
»Ich erinnere mich noch ganz gut ... Ich war noch ein kleines Ding und spielte mit meinen Freundinnen in den Alleen. Sobald er kam, versteckten sich alle, selbst seine Tochter Berthe, die unaufhörlich vor Furcht zitterte, eine Sünde begangen zu haben. Ich dagegen erwartete ihn ganz ruhig, und wenn er mich lächelnd mit verzogenem Mündchen dort stehen sah, gab er mir beim Vorübergehen einen kleinen Backenstreich ... Später, als ich sechzehn Jahre alt war, mußte ich ihm stets die Bitte vortragen, wenn Berthe irgend eine Vergünstigung von ihm haben wollte. Ich sprach mit ihm, senkte aber nie die Blicke, so daß ich die seinen mir bis unter die Haut dringen fühlte. Ich machte mir aber nicht viel daraus, wußte ich doch, daß er mir alle Wünsche bewilligen würde ... Ja, ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran! Dort unten giebt es kein Plätzchen im Park, keinen Korridor, kein Zimmer, das mir nicht wieder vor die Erinnerung tritt, sobald ich die Augen schließe.«
Sie schwieg, ihre Lider hatten sich gesenkt und über ihr geröthetes und aufgedunsenes Gesicht schien ein Schauer der Erinnerung an die Dinge von ehedem zu gleiten, Dinge, von denen sie nicht gesprochen hatte. Einen Augenblick blieb sie in dieser Haltung, ihre Lippen öffneten sich etwas, als verursachte das plötzliche Zucken eines Muskels ihr eine schmerzliche Empfindung am Mundwinkel.
»Er war gewiß sehr gütig zu Dir,« begann Roubaud. der sich soeben eine Pfeife angezündet hatte, von Neuem, »er hat Dich nicht nur als vornehmes Fräulein erziehen lassen, sondern auch Deine paar Pfennige weise verwaltet, schließlich hat er auch noch die Summe abgerundet, als wir uns verheiratheten ... Dabei rechne ich noch gar nicht, daß er Dir etwas hinterlassen will, wie er mir selbst gesagt hat.«
»Ja,« sagte Séverine leise, »das Häuschen in la Croix-de-Maufras, den von der Eisenbahn durchschnittenen Besitz. Wir haben früher dort öfter eine ganze Woche zugebracht ... Ich rechne noch gar nicht darauf, denn die Lachesnaye werden doch die Erbschaft hintertreiben. Ich würde es auch vorziehen, nichts nehmen zu müssen!«
Sie hatte die letzten Worte so lebhaft hervorgestoßen, daß er mit seinen runden, sich vergrößernden Augen erstaunt die Sprecherin anblickte und die Pfeife aus dem Munde nahm.
»Bist Du komisch! Man erzählt sich, daß der Präsident Millionär sei. Was ist also dabei so Schlimmes, wenn er auch seine Pflegetochter in seinem Testament bedenkt? Das würde Niemand überraschen und unsern Verhältnissen käme es gut zu statten.«
Dann ließ ihn ein durch den Kopf gehender Gedanke laut auflachen.
»Du befürchtest doch nicht, für seine leibliche Tochter gehalten zu werden? ... Du weißt doch, daß man sich vom Präsidenten trotz seiner eisigen Miene nette Sachen erzählt? Selbst zu Lebzeiten seiner Frau soll kein Mädchen verschont geblieben sein. Das ist ein Spitzbube, der noch heute bei der Frau seinen Mann steht.. Großer Gott, wenn Du wirklich seine Tochter wärest?«
Séverine war unwillig aufgesprungen, ihr Gesicht flammte und das Feuer ihrer blauen Augen unter dem schweren schwarzen Haar leuchtete unstät.
»Seine Tochter, seine Tochter! ...Ich will nicht, daß Du mich damit neckst, verstanden? Wie könnte ich seine Tochter sein? Sehe ich ihm ähnlich? ... Genug davon, sprechen wir von etwas Anderem. Ich will einfach deshalb nicht nach Doinville fahren, weil ich es vorziehe, mit Dir nach Havre zurückzukehren,«
Er wiegte beruhigend den Kopf. Wie ihr das im Augenblick in die Nerven gefahren war! Er lächelte, denn er hatte sie noch nie so aufgeregt gesehen, das machte wahrscheinlich der Weißwein. Es lag ihm daran, sie wieder gut zu stimmen und so ergriff er abermals das Messer, wobei er nochmals seiner Bewunderung einen lauten Ausdruck gab und reinigte es sorgfältig. Dann verkürzte er sich die Nägel, um zu zeigen, daß es wie ein Rasirmesser schnitt.
»Schon vier und ein viertel Uhr,« bemerkte Séverine leise vor der Kukuksuhr. »Ich habe noch einige Wege ... Wir müssen an unsern Zug denken.«
Doch ehe sie sich an die Ordnung des Zimmers machte, wollte sie sich erst noch etwas beruhigen und trat an das Fenster. Er ließ Messer Messer, Pfeife Pfeife sein, stand ebenfalls vom Tische auf, näherte sich ihr und nahm sie sanft in seine Arme. Er zog sie fest an seine Brust, drückte das Kinn auf ihre Schulter und preßte seinen Kopf an den ihren. Keines von Beiden rührte sich, ihre Augen suchten den Fernblick.
Zu ihren Füßen kamen und gingen die kleinen Rangirlokomotiven noch immer rastlos; man hörte sie, gerade wie gewandte und kluge Wirtschafterinnen, kaum bei ihrer Thätigkeit, ihre Räder schienen umwickelt, ihr Pfiff ertönte discret. Die eine von ihnen verschwand jetzt unter dem Pont de l'Europe mit einem von Trouville gekommenen Zuge, dessen Waggons in die Schuppen gebracht wurden. Dort unten, jenseits der Brücke, kreuzte sie sich mit einer Lokomotive, die wie eine einsame Spaziergängerin, allein vom Depot kam; ihre Achsen und Kupfertheile leuchteten, als hatte sie soeben frisch und keck sich zur Reise angekleidet. Die große Maschine hielt jetzt und forderte durch zwei kurze Pfiffe den Weichensteller auf, die Geleise passirbar zu machen; dieser that es sofort und die Lokomotive rollte auf den in der Halle für den Fernverkehr abgangsbereit stehenden Zug zu. Es war der vier Uhr fünfundzwanzig Zug nach Dieppe. Ein Strom von Reisenden drängte durcheinander. Man hörte das Rollen der mit Gepäck beladenen Karren, die Gepäckträger beförderten Stück für Stück in die Waggons. Inzwischen war die Lokomotive mit ihrem Tender auf den Stirnwagen des Zuges aufgefahren, was einen dumpfen Krach gab und man sah einen Arbeitsmann die Koppelung aufwinden. Gegen Batignolles hin hatte sich der Himmel umdüstert; ein aschfarbenes Halbdunkel tauchte die Umrisse der fernen Gebäude in seine Schatten und schien schon über den sich ausbreitenden Fächer der Schienen zu kriechen. Und in diesem Dunkel kreuzten sich unaufhörlich die ankommenden und abfahrenden Züge des Ring- und Vorortverkehrs. Hier die düsteren Reihen der großen Glashallen, dort über dem verschleierten Paris röthliche, vielgezackte Rauchwolken.
»Nein, nein, lasse mich,« sagte Séverine leise.
Sein Athem strömte ihr in den Nacken. Allmählich war seine Zärtlichkeit eine innigere geworden; die Wärme ihres jungen, von ihm so eng umschlungenen Körpers brachte sein Blut in Wallung. Der von ihr ausgehende Duft berauschte ihn und das abwehrende Drängen ihrer Glieder fachte seine Wünsche vollends an. Mit einem Ruck hatte er sie vom Fenster los, dessen Flügel er schloß. Sein Mund fand den ihrigen, fast biß er ihre Lippen wund und mit unwiderstehlicher Gewalt drängte er sie zum Bett.
»Nein, nein, wir sind nicht zu Hause,« wiederholte sie. »Ich bitte Dich, nicht hier in diesem Zimmer!«
Sie fühlte sich ebenfalls durch die reichliche Sättigung und das genossene Getränk wie berauscht, und ihre Sinne waren von dem fieberhaften Sturmlauf nach Paris noch in Aufruhr. Dazu dieses überheizte Zimmer, diese überreiche Tafel, die Plötzlichkeit der Reise, die einen so guten Ausgang zu nehmen schien, alles das erhitzte ihr Blut und kitzelte ihre Nerven. Trotzdem weigerte sie sich, sie widerstand ihm und stemmte sich mit Leibeskräften gegen das Holzgestell des Bettes in einer Anwandlung von ihr selbst nicht erklärlicher Furcht.
»Nein, nein, ich will nicht.«
Er, das Blut im Gesicht, hielt sie mit seinen mächtigen brutalen Fäusten wie in einem Schraubstock.
»Dummes Ding! Wer weiß es? Wir bringen ja das Bett wieder in Ordnung!«
In Havre bildete, da er Nachtdienst hatte, die Zeit nach Tisch ihr gewöhnliches Kosestündchen, dem sie sich auch mit gefälliger Folgsamkeit nicht zu entziehen pflegte. Die Sache machte ihr zwar keinen Spaß, aber sie fühlte sich glücklich und behaglich bei dem Gedanken, auf ihr eigenes Vergnügen ihm zu Liebe verzichten zu können. In diesem Augenblick aber machte es ihn toll, daß er sie so feurig, von Leidenschaft durchzittert fühlte, wie er sie nie zuvor gekannt hatte. Der dunkle Wiederschein ihres Haares ließ die sonst so kühlen Augen unergründlich tief erscheinen, ihr stark entwickelter Mund schimmerte wie Blut in dem sanften Oval ihres Gesichts. Er hatte mit einem Male eine Frau vor sich, die er noch nie gesehen. Warum willfahrte sie ihm nicht?
»Warum, sprich? Wir haben noch Zeit.«
In ihrer unerklärlichen Angst, in dem Kampf, der sie hinderte, die Dinge klar zu erkennen, als wenn sie selbst sich als eine Andere erschiene, entfuhr ihr ein Schrei wirklichen Schmerzes, der ihn veranlaßte, sich ruhiger zu verhalten.
»Ich beschwöre Dich, lasse mich! ... Schon der bloße Gedanke, in diesem Augenblick, erwürgt mich ... Das würde zu nichts Gutem führen.«
Beide saßen jetzt auf dem Rande des Bettes. Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, als wollte er das siedende Gefühl von dort verwischen. Als sie ihn wieder vernünftig geworden sah, beugte sie sich liebenswürdig zu ihm und gab ihm einen derben Kuß auf die Backe, als Beweis, daß sie ihn trotzdem lieb hätte. Sie blieben dann einen Augenblick unbeweglich und lautlos sitzen. Er hatte ihre rechte Hand ergriffen und spielte mit einem alten Goldreif einer Schlange mit einem Köpfchen von Rubinen, den sie seit ihrer Hochzeit stets an demselben Finger trug. Stets halte er ihn dort gesehen.
»Meine kleine Schlange,« sagte Séverine wie im Traume befangen; sie glaubte, er betrachte den Ring und sie empfand das dringende Bedürfniß zu reden. »In la Croix-de-Maufras wurde er mir geschenkt als ich sechzehn Jahre alt war.«
Roubaud erhob überrascht den Kopf.
»Wer hat ihn Dir geschenkt? Der Präsident?«
Als sie die Augen ihres Mannes auf sich ruhen fühlte, war es ihr, als würde sie plötzlich aus dem Traume gerissen. Ein kaltes, eisiges Gefühl überlief ihre Wangen. Sie wollte antworten, fand aber nicht gleich die Worte, ihr schien, als hätte eine jähe Lähmung sie ergriffen.
»Aber Du hast mir doch immer erzählt,« fuhr er fort, »Deine Mutter hätte Dir den Ring hinterlassen?«
Noch in diesem Augenblick hätte sie den Eindruck der ihr in einem Moment völliger Geistesabwesenheit entschlüpften. Aeußerung wieder verwischen können, wenn sie gelacht oder die Zerstreute gespielt hätte. Aber nein, sie war wie verbohrt, als hätte sie keine Macht mehr über sich.
»Ich habe Dir nie gesagt, mein Schatz, daß mir meine Mutter diesen Ring vermacht hat.«
Roubaud sah ihr scharf in das Gesicht, auch er wurde bleich.
»Nie? Du hast mir das nie gesagt? Nicht einmal, sondern zwanzigmal! ... Warum sollte Dir der Präsident auch keinen Ring schenken? Ich finde dabei nichts, er hat Dir ja so Manches geschenkt ... Aber warum hast Du es mir verheimlicht? Warum logst Du und schobst Deine Mutter vor?«
»Ich habe meine Mutter nicht erwähnt, mein Lieber, Du irrst Dich.«
Dieses hartnäckige Leugnen war eine Dummheit, Sie sah, daß sie sich selbst auslieferte, daß er ihr die Wahrheit von der Stirn las; sie hätte jetzt gern ihre Worte wieder zurückgenommen oder ihre Bedeutung vermischt, aber jetzt war es zu spät. Sie fühlte, wie ihre Züge eine andere Gestaltung annahmen, das Geständniß ihrer Schuld offenbarte in diesem Augenblick gegen ihren Willen ihre ganze Persönlichkeit. Die Kälte in ihren Wangen hatte ihr ganzes Gesicht überzogen, ein nervöses Zucken zerrte an ihrem Munde. Ihm dagegen hatte das Entsetzen das Blut emporgetrieben, daß man fürchten mußte, seine Adern würden platzen. Er hatte ihre Handgelenke umschlungen und stand dicht vor ihr, um aus dem Widerspiegeln des Schreckens in ihren Augen lesen zu können, was sie nicht laut gesagt hatte.
»Verflucht,« würgte er heraus, »verflucht!«
Sie drückte furchtsam das Gesicht unter ihren Arm, denn sie ahnte den Schlag mit der Faust schon, der kommen mußte. Dieser kleine, elende, unbedeutende Umstand, das Vergessen einer an diesen Ring sich knüpfenden Lüge hatte nach wenigen Worten diese furchtbare Situation geschaffen. Nur eine Minute, dann warf er sie mit einem Stoß auf das Bett und bearbeitete sie auf das Gerathewohl mit den Fäusten. Während dreier Jahre hatte er sie nicht ein Mal geschlagen, jetzt aber war die Brutalität Herrin über ihn geworden, blind und trunken vor Wuth hieb er mit seinen groben Arbeiterfäusten, die früher die Waggons geschoben hatten, auf sie ein.
»Verfluchte Dirne! Du warst mit ihm zusammen ... mit ihm zusammen ... mit ihm zusammen!«
Die Wiederholung der Worte stachelte seine Wuth noch mehr an; bei jeder Wiederholung sauste ein Faustschlag nieder, als wollte er ihr die Worte für immer einbläuen.
»Du die Geliebte eines Greises, Du verfluchte Dirne! ... Du warst mit ihm zusammen ... mit ihm zusammen!«
Der Zorn erstickte seine Stimme, sie kam ihm schon pfeifend aus dem Munde und versagte schließlich ganz. Er hörte jetzt erst, wie sie, windelweich unter den Schlägen geworden, »nein« rief. Sie fand kein anderes Wort der Vertheidigung, sie leugnete, um nicht von ihm getödtet zu werden. Diese Ausrede, diese lügnerische Verbohrtheit machte ihn nur noch rasender.
»Gestehe, daß Du mit ihm zusammen warst!«
»Nein und nein.«
Er hatte sie aufgerafft und sie zu sich emporgezogen; er verhinderte das arme Geschöpf, daß der Kopf sich in die Kissen vergrub und zwang sie, ihm in das Gesicht zu sehen.
»Gestehe!«
Im Augenblick hatte sie sich gewandt seiner Umarmung entzogen und wollte zur Thür eilen. Doch ebenso schnell war er hinter ihr her und wieder schwebte seine Faust in der Luft; dicht neben dem Tisch streckte sein Schlag sie zu Boden. Er warf sich an ihre Seite und packte sie an den Haaren, so daß sie sich nicht rühren konnte. Ohne zu sprechen und ohne zu athmen, blieben sie so, Auge in Auge, auf dem Boden liegen. Und durch diese schreckensvolle Stille schallte das Singen und Lachen der Damen Dauvergne, deren Piano glücklicherweise einen solchen Lärm vollführte, daß man das Toben des sich über ihnen abspielenden Kampfes nicht vernahm. Claire sang Kinderlieder und Sophie spielte die Begleitung mit aller Macht.
»Gestehe!«
Sie wagte nicht nein zu sagen und schwieg.
»Gestehe, daß Du mit ihm zusammenwarst, oder ich schlage Dich todt!«
Er würde sie getödtet haben, sie las es in seinem Blick. Sie hatte beim Fallen das aufgeklappt auf dem Tisch liegende Messer gesehen. Das Schimmern der Klinge kam ihr in die Erinnerung, sie glaubte schon, daß er den Arm danach ausstrecke. Nun überkam sie ein Gefühl der Feigheit, eine Gleichgiltigkeit gegen sich und alles, der Wunsch, endlich mit Allem zu Rande zu kommen.
»Nun ja, es ist wahr, nun lasse mich aber gehen.«
Ein fürchterlicher Augenblick. Dieses Geständniß, von ihm in so grausamer Weise erpreßt, es glich einem Schlag, den er mitten in das Gesicht erhielt; es schien ihm unmöglich, ungeheuerlich. Eine solche Schändlichkeit hätte er nie für möglich gehalten. Er packte ihren Kopf und schlug ihn gegen ein Tischbein. Als sie sich sträubte, schleifte er sie an den Haaren durch das Zimmer, wobei er mit ihrem Körper die Stühle anrannte. So oft sie den Versuch machte, sich aufzurichten, warf er sie durch einen Faustschlag wieder zu Boden. Sein Athem flog und mit zusammengepreßten Zähnen tobte er wie ein Wilder und Thor zugleich in diesem Kampf. Der Tisch hätte beinahe den Ofen umgeworfen. Haare und Blut klebten an einer Ecke des Büffets. Als sie von diesem eklen Auftritte noch bebend wieder zu Athem kamen, müde vom Schlagen und der erhaltenen Prügel, befanden sie sich wieder neben dem Bett, sie noch immer in einem schweinartigen Zustande auf der Erde liegend, er auf ihr kauernd und sie an den Schultern gepackt haltend. Beide stöhnten. Unten ertönte noch immer die Musik und kräftiges, lustiges Lachen schallte herauf.
Mit einem Ruck hob Roubaud Séverine vom Boden und drängte sie gegen die Bettwand. Er blieb vor ihr auf den Knieen liegen und stemmte sich mit der ganzen Kraft seines Oberkörpers gegen sie. Jetzt konnte er endlich sprechen. Er schlug sie nicht mehr, er quälte sie mit seinen Fragen, in der heißen Begier, alles wissen zu wollen.
»Du hast Dich ihm also hingegeben, Dirne? ... Wiederhole es mir, daß Du diesem alten Menschen gefällig warst ... Wie alt warst Du, als es geschah? Ganz jung noch, nicht wahr, ganz jung?«
Ein plötzlicher Thränenausbruch ihrerseits, ein Schluchzen hinderten sie zu antworten.
»Himmel und Hölle, willst Du sprechen? ... He? Noch nicht zehn Jahre alt warst Du, als Du den Alten schon amüsirtest? Deshalb also hat er Dich wie eine vornehme Dame erziehen lassen, damit er unauffällig seine Schweinereien treiben konnte? Rede, sage ich, oder ich fange von vorn an!«
Sie weinte und brachte kein Wort über die Lippen. Er erhob die Hand und eine abermalige Ohrfeige betäubte sie. Das geschah dreimal, ebenso oft als er fragte und keine Antwort erhielt.
»Sprich, in welchem Alter geschah es?«
Warum den Kampf fortsetzen, sie fühlte ja ohnehin ihr ganzes Leben dahinschwinden. Er würde ihr mit seinen steifen Arbeiterfingern das Herz aus dem Leibe gerissen haben. Sein dringliches Fragen begann von Neuem und nun erzählte sie ihm in der Ohnmacht ihrer Schande und Furcht Alles. Ihre Worte wurden so leise geflüstert, daß sie kaum ihm verständlich waren. Seine wilde Eifersucht sog neue Nahrung aus dem Leiden, welches ihm die ihr entlockten Bilder schufen: er konnte nicht genug hören, er zwang sie, keine Einzelheit zur Vervollständigung der Thatsachen zu übergehen. Das Ohr auf die Lippen der bedauernswerthen Frau gepreßt, lechzte er wie ein Fiebernder nach dieser Beichte, deren Abbrechen seine aufgehobene Faust verhinderte, die jeden Augenblick bereit zum Niederfahren war.
Ihr ganzes vergangenes Leben in Doinville zog so noch einmal an ihm vorüber, ihre Kindheit, ihre Jugend. War das Unerhörte im Dunkel der Baumgruppen des Parks oder in einem verlorenen Winkel eines Korridors im Schlosse geschehen? Hatte der Präsident es schon auf sie abgesehen, als er sie nach dem Tode seines Gärtners zu sich in sein Haus nahm und sie mit seiner Tochter erziehen ließ? Begonnen hatte die Geschichte zweifellos schon zu jener Zeit, als die anderen Mädchen aus ihren Spielen heraus vor ihm flüchteten, wenn er plötzlich auftauchte, sie dagegen mit verzogenem Mündchen lächelnd auf ihn wartete, um von ihm im Vorübergehen auf die Backe geklopft zu werden. Und später, wenn sie ohne die Augen niederzuschlagen mit ihm zu sprechen wagte und von ihm jede Vergünstigung bewilligt erhielt, hatte sie sich nicht damals schon als die Herrin über ihn gefühlt, der, Anderen gegenüber so würdig und streng, durch seine Nachgiebigkeit von ihr sich das Anrecht auf alle Glückseligkeiten erwarb? O, über diesen schmutzigen Handel, diesen elenden Greis, der sich wie ein Großvater hätscheln ließ, das kleine Mädchen heranwachsen sah, fast stündlich dem Wachsthume ihres Körpers nachfühlte und die Zeit nicht erwarten konnte, bis die Frucht reif war.
Roubaud stöhnte.
»Wiederhole, in welchem Alter geschah es?«
»Als ich sechzehn und ein halbes Jahr alt war.«
»Du lügst.«
Leugnen, mein Gott, warum jetzt noch? Ihre Schultern zuckten im Gefühle unermeßlicher Oede und Schwäche.
»Und wo zum ersten Male?«
»In la Croix-de-Maufras.«
Er zögerte einen Augenblick, seine Lippen bewegten sich krampfhaft und ein gelblicher Schein flackerte in seinen Augen.
»Und es hatte Folgen?
Sie blieb stumm, doch als er die Faust schwang, sagte sie:
»Du würdest mir ja doch nicht glauben.«
»Sprich nur ... Also keine Folgen?«
Sie antwortete durch ein Schütteln mit dem Kopfe. So war es am besten. Er aber ließ nicht locker, er wollte die Szene bis in alle Einzelheiten kennen lernen. Aus anzüglichen Worten und gemeinen Redensarten bestand sein Fragen. Sie brachte die Zähne nicht mehr auseinander, sie blieb dabei, durch Zeichen mit dem Kopfe ja und nein zu sagen. Vielleicht hätte es beiden einige Linderung verschafft, wenn sie alles gestanden haben würde. Sie fürchtete aber durch Wiedergabe der Einzelheiten keine Erleichterung, sondern noch größeres Ungemach. Und auch ihn würden die haarsträubendsten Thatsachen nicht so gepeinigt haben, wie jetzt die Einbildung. Dieses wollüstige Wühlen aber nach der Wahrheit nährte und trieb die vergifteten Wogen der Eifersucht in seiner Brust wieder zur Empörung. Es war nun geschehen. So lange er lebte, konnte er jetzt nicht mehr diese abscheuliche Vorstellung aus seinen Gedanken bannen.
Das Schluchzen würgte sie fast.
»Ah, verflucht ... ah, verflucht ... nein, das kann nicht möglich sein, das ist zu viel, das kann nicht möglich sein!« Von Neuem schüttelte er sie.
»Warum hast Du mich dann geheirathet. Du gottvergessene Dirne? ... Wie ehrlos, mich so hintergangen zu haben! Die Verbrecherinnen im Gefängnisse sind nicht so schuldbelastet wie Du ... Du verachtetest mich also, Du liebtest mich gar nicht? ... He, warum hast Du mich geheirathet?«
Sie machte eine flüchtige Bewegung. Wußte sie es in diesem Augenblicke selber? Als sie ihn heirathete, fühlte sie sich glücklich, war es doch nun mit dem Andern zu Ende. Giebt es doch so viele Dinge, die man nicht thun möchte und doch thut, weil es noch das Vernünftigste ist. Nein, sie liebte ihn nicht. Sie hütete sich aber, ihm zu sagen, daß sie ihn nie geheirathet haben würde, wenn ihre Vergangenheit eine andere gewesen wäre.
»Ihm lag natürlich daran. Dich zu versorgen, nicht? Er fand auch solch ein gutes Schaf ... Er wollte Dich versorgen, um auch das Spiel fortzusetzen, nicht? ... Und Ihr habt es fortgesetzt –bei Deinen zweimaligen Besuchen. Deshalb hat er Dich damals eingeladen?«
Ein Nicken mit dem Kopfe bestätigte es.
»Und auch heute aus demselben Grunde? ... Bis in alle Ewigkeiten also dieses kothige Treiben! Und wenn ich Dich nicht erwürge, geht die Geschichte weiter!«
Seine krampfhaft zuckenden Hände tasteten schon nach ihrer Kehle. Aber diesmal schwieg sie nicht.
»Da sieht man, wie ungerecht Du bist. Ich war es, die sich weigerte, dorthin zu reisen. Du wolltest mich sogar schicken, worüber ich so ärgerlich war, wie Du Dich erinnern wirst ... Du siehst also, daß ich nicht mehr wollte, und nie wieder würde ich gewollt haben.«
Er fühlte, daß sie die Wahrheit sagte, aber eine Erleichterung verschaffte ihm dieses Geständnis nicht. Das Eisen saß zu fest in seiner Brust, das, was zwischen ihr und jenem Manne geschehen, war nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Seine Ohnmacht, daß er nichts zur Ausmerzung des Geschehenen unternehmen konnte, peinigte ihn entsetzlich. Ohne sie freizulassen, näherte er sein Gesicht abermals dem ihrigen; er schien von ihrem Anblick wie behext, ihm war, als könnte er sich nicht eher losreißen, als bis er aus dem Blut ihrer blauen Äderchen ihr ganzes Geständniß herausgelesen hätte.
»In la Croix-de-Maufras, in dem rothen Zimmer,« murmelte er wie von einer Vision gepackt. »Ich kenne es, das Fenster führt auf den Bahndamm, das Bett steht dem Fenster gegenüber ... Ich verstehe, warum Du das Haus erben sollst. Du hast es Dir ja verdient. Er hatte gut über Deine Ersparnisse wachen und Dir die Aussteuer bereiten –das war Deine Gefälligkeit schon werth ... Er, ein Richter, ein Millionär, so geachtet, gebildet und so erhaben! Da soll Einem nicht den Kopf drehen ... Und vielleicht ist er auch noch Dein Vater?«
Séverine stand mit einem Sprunge auf den Füßen. Angesichts ihrer Schwäche als armes unterlegenes Wesen, zeugte der Stoß, mit dem sie ihn zurückwarf, von einer außergewöhnlichen Kraft. Sie protestirte energisch.
»Nein, nein, das nicht! Alles was Du willst, nur das nicht. Schlage mich, tödte mich ... Aber sage das nicht. Du lügst.«
Roubaud hielt noch eine ihrer Hände fest.
»Was weißt Du davon? Du selbst zweifelst daran, das ist Dein einziger Trost.«
Als sie ihm ihre Hand entziehen wollte, fühlte er den Ring, die kleine Schlange mit dem Rubinenkopfe an ihrem Finger. Er entriß ihn ihr und zerstampfte ihn in einem abermaligen Wuthanfalle mit dem Absatz auf der Diele. Dann schritt er stumm und aufgeregt durch das Zimmer.
Sie ließ sich, gleichfalls stumm, auf den Rand des Bettes fallen und blickte ihm mit ihren großen starren Augen nach. Das schreckliche Schweigen hielt an.
Die Wuth Roubauds wollte sich nicht legen. Kaum schien sie etwas nachzulassen, gleich war sie wieder da, wie die Trunkenheit, und zwar in großen, noch einmal so ungestümen Wogen und ihr Wirbel riß ihn haltlos dahin. Er hatte keine Macht mehr über sich; der heftige Wind seiner ihn peitschenden Leidenschaft trieb ihn nach allen Richtungen durch die Leere seines Innern, in welchem kein andres Bedürfniß lebte und sich erneute, als die heulende Bestie in ihm zu stillen. Der Durst nach Rache war ihm ein physisches Bedürfniß, das seinen ganzen Körper marterte und sie ahnte, daß sie vor ihm nicht eher Ruhe finden würde, als bis dieses Rachegefühl befriedigt war.
Ohne in seinem Sturmmarsche innezuhalten, hämmerte er mit seinen Fäusten an die Schläfen.
»Was soll ich jetzt beginnen?« stöhnte er mit angsterfüllter Stimme.
Hatte er seine Frau nicht sofort getödtet, jetzt würde er es nicht mehr können, das fühlte er. Seine Feigheit, sie am Leben zu lassen, dämpfte seinen Zorn; es war feige, sie nicht erwürgt zu haben, als sie, die Dirne, vor ihm lag. Natürlich konnte sie nicht mehr bei ihm bleiben. Er würde sie also fort, auf die Straße jagen müssen und sie nie wiedersehen können. Ein neuer Strom tiefen Leides überfluthete ihn, eine verwünschte Uebelkeit stieg ihm in die Kehle bei dem Gedanken, daß er selbst das zu thun nicht im Stande sei. Was also schließlich? Es erübrigte nur noch, den Schimpf auf sich zu nehmen, mit ihr noch Havre zurückzureisen und das ruhige Leben an ihrer Seite fortzusetzen, als wenn nichts geschehen wäre. Nein, nein, eher den Tod, Beiden den Tod und sofort! Es überkam ihn eine so ungeheure Trostlosigkeit, daß er noch lauter schrie:
»Was soll ich jetzt thun?«
Séverine folgte vom Bette aus mit ihren großen Augen seinen Bewegungen. Sie hatte stets eine kameradschaftliche Neigung für ihn empfunden und sein maßloser Schmerz that ihr wehe. Sie würde die Schimpfworte und Schläge entschuldigt haben, aber dieser wahnsinnige Jähzorn kam ihr so überraschend, daß sie sich von dieser Ueberraschung noch immer nicht erholen konnte. Ihr, die in ihrer frühesten Jugend den Wünschen eines Greises nachgegeben hatte, die sich später heirathen ließ, einfach um den Dingen eine Wendung zum Bessern zu geben, war in ihrer Gleichgiltigkeit und Folgsamkeit ein solcher Ausbruch von Eifersucht, längst verjährter Vergehen halber, die sie in der That bereute, durchaus unverständlich. Frei von irgendwelchem Laster oder fleischlicher Lust, in ihrer fast mädchenhaften unbewußten Handlungsweise, keusch trotz Allem, verfolgte sie das Hin- und Herlaufen ihres Mannes, seine wilden Wendungen gerade so wie sie einen Wolf, ein Wesen einer andren Rasse betrachtet haben würde. Was in aller Welt lebte eigentlich in ihm? Sie fühlte mit Schrecken die Bestie in ihm; ihr Vorhandensein hatte sie innerhalb der drei Jahre schon öfter geahnt, ihr dumpfes Knurren von Zeit zu Zeit hatte es errathen lassen, heute aber sah sie die Bestie losgelassen und in ihrer Wuth zum Beißen bereit. Was sollte sie ihm sagen, um ein Unglück zu verhüten?
Dicht beim Bett, vor ihr kehrte er regelmäßig um. Als er wieder in ihre Nähe kam, wagte sie ihn anzureden:
»Höre, mein Freund ...«
Aber er hörte nicht, sondern lief auf die andere Seite des Zimmers, wie ein vom Sturm fortgewehter Strohhalm.
»Was jetzt beginnen? Was soll ich thun?«
Endlich gelang es ihr, sein Handgelenk zu ergreifen und ihn einen Augenblick festzuhalten.
»Höre, mein Freund, war ich es nicht, die nicht mehr dorthin wollte? ... Ich würde nie, nie wieder dorthin gereist sein. Dich allein liebe ich.«
Sie zog ihn zärtlich zu sich herab und reichte ihm ihre Lippen zum Kusse. Er fiel neben sie auf das Bett, stieß sie aber sogleich mit einer Gebärde des Abscheus von sich.
»O Du Dirne, jetzt möchtest Du ... Vorhin wolltest Du nicht, weil Du kein Verlangen nach mir hattest ... Und jetzt willst Du, um mich wieder zu versöhnen, he? Wenn man einen Mann dabei hat, dann hält man ihn fest, denkst Du ... Verbrennen würde ich, wenn ich zu Dir käme, ja, das Gift würde mir meine Eingeweide verzehren, ich fühle es!«
Ihn schauderte. Der Gedanke, sie in den Armen zu haben, das Bild ihrer beiden Körper in einem gemeinsamen Bette durchzuckte ihn wie eine Flamme. Und aus der wirren Nacht seiner Seele, aus seinem verletzten, beschmutzten Verlangen heraus wuchs plötzlich die Vorstellung von der Unvermeidlichkeit des Todes.
»Bevor ich Dich umbringe, verstehst Du, muß ich Jenen umbringen ... Ich muß ihn umbringen, ich muß ihn umbringen!«
Seine Stimme kehrte wieder. Er wiederholte den Ausruf, während er scheinbar noch größer geworden, wieder vor ihr stand. Es schien als hätte ihm dieses Wort, das einem Entschlüsse gleich war, endlich seine Ruhe wieder gegeben. Weiter sagte er nichts. Dann schritt er langsam zum Tische und betrachtete dort das Messer, dessen große, offene Klinge ihm entgegenleuchtete. Mechanisch klappte er es zu und schob es in die Tasche. Mit herabhängenden Armen, mit den Augen in die Leere starrend, blieb er an derselben Stelle stehen. Er überlegte. Zwei große Falten zeigte seine Stirn, ein Zeichen, daß gewisse Hindernisse ihn keinen Entschluß fassen ließen. Um zu einem solchen zu kommen, trat er an das Fenster, er öffnete es und lehnte sich an das Fensterkreuz, um sein Gesicht dem kühlen Luftzuge der Dämmerung darzubieten. Seine Frau hatte sich nun ebenfalls erhoben und stand von Furcht gepackt, hinter ihm. Sie wagte nicht ihn zu fragen, sondern versuchte zu errathen, was in diesem harten Schädel vorging. So wartete sie stehend im Angesicht des weiten Himmels.
In dem herniedersinkenden Abend spiegelten sich die fernen Häuser nur noch in schwarzen Umrissen wieder; über den mächtigen Eisenbahndamm lag ein violetter, dichter Nebel. Namentlich nach les Batignolles zu war die Strecke wie in Asche getaucht, durch welche die Eisenrippen des Pont de l'Europe nur noch undeutlich herüberschimmerten. Der über Paris noch schwebende letzte Wiederschein des untergegangenen Tages reflectirte auf den Scheiben der großen Ankunftshallen, während sich unter ihnen die Finsternis; immer massiger ansammelte. Jetzt blitzten kleine Lichtpunkte auf, man zündete die Gaskörper längs der Bahnsteige an. Auch ein mächtiger, weißer Lichtschein war vorhanden, die Laterne der Lokomotive eines Zuges nach Dieppe, dessen Koupeethüren schon geschlossen waren. Der Maschinenführer wartete nur noch auf das Zeichen des diensthabenden Unterinspectors. Es war da etwas nicht in Ordnung gewesen, der Weichensteller hatte durch ein rothes Signal mitgetheilt, daß der Fahrweg noch nicht offen sei; eine Rangirmaschine hatte erst einige Waggons fortholen müssen, welche durch ein schlecht ausgeführtes Manöver mitten auf der Hauptader stehen geblieben waren. Unaufhörlich sausten zwischen dem unentwirrbaren Knäuel von Rädern hindurch und an den auf den Wartesträngen unbeweglich stehenden Waggonreihen vorüber Eisenbahnzüge durch das starker und stärker werdende Dunkel. Einer ging nach Argenteuil, ein andrer nach Saint-Germain; nach langer Fahrt traf ein dritter von Cherbourg ein. Die Signale, das Gepfeife, die Töne der Signalhörner folgten sich ununterbrochen; von allen Seiten tauchten nacheinander rothe, grüne, gelbe und weiße Lichter auf; es herrschte um diese unbehagliche Zeit ein Chaos im Bahnbetriebe, daß es aussah, als müßte alles aufeinanderrennen. Aber alles ging glatt vorüber, mit der stets gleichen sanften, in der Dämmerung nur halb erkennbaren Bewegung wickelte sich das Knäuel immer wieder auf. Das rothe Signal des Weichenstellers erlosch jetzt, die Lokomotive pfiff und der Zug nach Dieppe setzte sich in Bewegung. Vom weiten, grauen Himmel begannen vereinzelte Regentropfen zu fallen. Es schien eine regnerische Nacht werden zu wollen.
Als Roubaud sein Gesicht zurückwandte, sah es finster und verbissen aus, als hätte die Nacht da draußen auch auf sein Antlitz ihre Schatten gesenkt. Er war mit sich einig, sein Plan gemacht. Durch das Halbdunkel spähte er nach der Kukuksuhr.
»Fünf Uhr zwanzig Minuten,« sagte er.
Er war betroffen: in knapp einer Stunde hatten sich so viele Dinge abgespielt! Ihm kam es vor, als hätten sie sich hier seit Wochen gegenseitig aufgefressen.
»Fünf Uhr zwanzig Minuten. Wir haben also noch Zeit.«
Séverine wagte nicht ihn zu fragen, doch ihre angsterfüllten Blicke wichen nicht von ihm. Sie sah ihn im Schranke wühlen und Papier, ein Fläschchen Dinte und einen Federhalter hervorziehen.
»Du wirst jetzt schreiben.«
»Wem?«
»Ihm natürlich. –Setze Dich.«
Sie hielt sich instinctiv von einem Stuhle fern, ohne recht zu wissen, was er wollte. Er aber packte sie, führte sie an den Tisch und drückte sie dort mit solcher Wucht auf den Stuhl nieder, daß sie sich nicht wieder erhob.
»Schreibe: »»Reisen Sie heute Abend mit dem Schnellzuge um sechs Uhr dreißig Minuten und zeigen Sie sich erst in Rouen.««
Sie hielt wohl die Feder, aber ihre Hand zitterte, ihre Furcht vermehrte die unbekannte Absicht ihres Mannes. Was bezweckte er mit diesen beiden nichtssagenden Zeilen? Sie wagte sogar, fragend den Kopf zu ihm zu erheben.
»Was willst Du beginnen? ... Ich bitte Dich, erkläre mir ...«