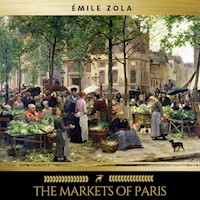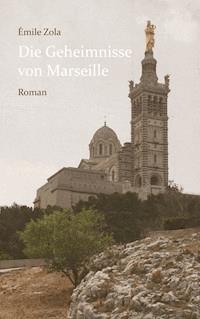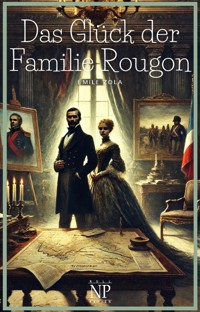Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zolas zweiter Roman aus dem Rougon-Macquart-Zyklus, der mit satirischen Mitteln die Bourgeoisie kritisiert und als Affront gegen die Sittlichkeit angesehen wurde: Mit 19 Jahren heiratet die aus reichem Elternhaus stammende Renée den älteren Witwer Aristide Rougon. Sie genießt das Luxusleben in vollen Zügen, und beginnt dann mit 30 ein Verhältnis mit ihrem 20-jährigen Stiefsohn Maxime. Aber findet sie so wirklich ihr Glück?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emile Zola
Die Beute
Saga
Die BeuteOriginalLa curéeCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1871, 2020 Emile Zola und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726683332
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
KAPITEL I
Auf dem Rückweg mußte die Kalesche in der Menge der Wagen, die am Seeufer entlang heimkehrten, Schritt fahren. Einmal wurde das Gedränge so groß, daß sie sogar halten mußte.
Die Sonne ging in einem hellgrauen Oktoberhimmel unter, der am Horizont von schmalen Wolken gestreift war. Ein letzter Strahl, der zwischen den fernen, dichten Baumgruppen beim Wasserfall hindurchglitt, lief die Allee entlang und überflutete die lange, jetzt unbewegliche Wagenreihe mit einem blassen gelbroten Licht. Der goldene Schimmer, die lebhaften Lichtreflexe, die von den Rändern zurückgeworfen wurden, schienen an den strohgelben Zierkanten der Kalesche hängengeblieben zu sein, in deren dunkelblauen Seitenflächen sich Ausschnitte der umgebenden Landschaft spiegelten, und darüber, im vollen rötlichen Abendschein, der sie von hinten her beleuchtete und die Kupferknöpfe ihrer halb zusammengefalteten, vom Sitz herabhängenden Mäntel aufglänzen ließ, hielten sich der Kutscher und der Diener in ihrer tiefblauen Livree, ihren beigefarbenen Beinkleidern und schwarzgelbgestreiften Westen starr aufgerichtet, ernst und geduldig wie Lakaien eines vornehmen Hauses, die durch kein Wagengedränge aus der Ruhe zu bringen sind. Ihre mit einer schwarzen Kokarde geschmückten Hüte wirkten sehr würdig. Nur die Pferde, ein Gespann herrlicher Brauner, schnaubten vor Ungeduld.
„Sieh da“, sagte Maxime, „dort in dem Kupee 1 sitzt Laure d’Aurigny . . . Schau doch mal hin, Renée!“
Renée richtete sich leicht auf und blinzelte mit der reizenden Schmollmiene, die sie der Schwäche ihrer Augen verdankte. „Ich glaubte, sie sei durchgebrannt“, entgegnete sie. „Hat sie nicht die Haarfarbe gewechselt?“
„Ja“, antwortete Maxime lachend. „Ihr neuer Geliebter kann Rot nicht ausstehen.“
Die Hand auf den niedrigen Wagenschlag der Kalesche gestützt, beugte sich Renée vor und sah hinüber, erwacht aus dem traurigen Traum, der sie seit einer Stunde schweigen ließ, tief in den Fond des Wagens zurückgelehnt, wie eine Genesende auf ihrem Ruhebett. Über einem malvenfarbenen Seidenkleid mit Tunika und lose herabfallender Vorderbahn, das mit breiten plissierten Volants garniert war, trug sie einen kleinen, sehr auffallenden Mantel aus weißem Tuch mit malvenfarbenen Samtaufschlägen. Ihr eigenartig mattblondes Haar, dessen Farbe an feine Butter erinnerte, wurde von dem Hütchen, das ein Tuff Bengalrosen zierte, kaum bedeckt. Sie blinzelte immer noch und hatte dabei ihr gewohntes keckes Jungengesicht, dessen reine Stirn von einer großen Falte durchfurcht war und dessen Mund mit der vorspringenden Oberlippe dem eines schmollenden Kindes glich. Weil sie schlecht sah, ergriff sie jetzt ihr Lorgnon, ein in Schildpatt gefaßtes Herrenlorgnon, und indem sie es frei in der Hand hielt, ohne es auf die Nase zu setzen, musterte sie mit vollendetem Gleichmut die rundliche Laure d’Aurigny, die sich offenbar recht wohl fühlte.
Noch immer kamen die Wagen nicht von der Stelle. Inmitten der gleichmäßigen, dunkelgetönten Flecken, welche die an diesem Herbstnachmittag im Bois de Boulogne äußerst zahlreichen Fahrzeuge bildeten, blitzten hier die Ecke eines Spiegels, die Kandare eines Pferdes auf, dort die silberne Fassung einer Laterne oder die Tressen eines Bedienten hoch oben auf seinem Sitz. Hie und da leuchtete aus einem offenen Landauer ein Stück Stoff hervor, ein Stück von einem Frauenkleid aus Seide oder Samt. Nach und nach hatte sich eine große Stille auf all diesen zur Unbeweglichkeit erstarrten Trubel gesenkt. Man hörte jetzt vom Wagen aus die Unterhaltung der Spaziergänger. Stumme Blicke wurden von Wagenschlag zu Wagenschlag gewechselt, und niemand sprach mehr bei diesem allgemeinen Warten, das nur durch das Knirschen des Zaumzeugs und den ungeduldigen Hufschlag eines Pferdes unterbrochen wurde. In der Ferne verloren sich die verworrenen Stimmen des Bois.
Trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit war ganz Paris hier versammelt: die Herzogin de Sternich in einem achtfedrigen Wagen; Frau de Lauwerens in einer ganz vorschriftsmäßig bespannten Viktoria; die Baronin Meinhold in einem entzückenden rotbraunen Cab; die Gräfin Vanska mit ihren schwarz und weiß gescheckten Ponys; Frau Daste und ihre berühmten schwarzen Stepper; Frau de Guende und Frau Teissière in einem Kupee; die kleine Sylvia in einem dunkelblauen Landauer. Außerdem Don Carlos, in Trauer, mit seiner altmodischen, feierlichen Dienerschaft; Selim Pascha mit seinem Fez und ohne seinen Erzieher; die Herzogin de Rozan in ihrer einsitzigen Kutsche, mit weißgepuderten Lakaien; der Graf de Chibray im Dogcart; Herr Simpson in einem Vierspänner allerschönster Ausstattung; ferner die gesamte amerikanische Kolonie. Zum Schluß zwei Mitglieder der Akademie in Droschken.
Die vordersten Wagen lösten sich jetzt, und bald begann die ganze Reihe langsam dahinzurollen. Es war wie ein Erwachen. Tausend Lichter fingen an zu tanzen, plötzliche Blitze kreuzten sich in den Rädern, Funken sprühten aus dem Zaumzeug, wenn sich die Pferde schüttelten. Das Funkeln der Geschirre und Räder, das Aufflammen der lackierten Wagenteile, darin die rote Glut der untergehenden Sonne glomm, die lebhaften Farbtöne der glänzenden Livreen, die sich vom Himmel abhoben, und der reichen Toiletten, die aus den Wagenschlägen quollen, all das wurde davongetragen in einem dumpfen, anhaltenden Rollen, das der Schritt der Gespanne rhythmisch unterbrach. Und dieser Zug bewegte sich voran unter den gleichen Geräuschen, den gleichen Lichtern, unaufhörlich und im gleichen Strom, als hätten die ersten Wagen alle übrigen nach sich gezogen.
Renée hatte dem leichten Stoß, mit dem die Kalesche sich wieder in Bewegung setzte, nachgegeben; sie hatte das Lorgnon sinken lassen und sich abermals tief in die Wagenkissen zurückgelehnt. Fröstelnd zog sie einen Zipfel des Bärenpelzes an sich, der seine Decke seidigen Schnees im Wagen ausbreitete. Ihre behandschuhten Hände verloren sich in der Weichheit des langhaarigen, lockigen Fells. Jetzt kam Nordwind auf. Der laue Oktobernachmittag, der dem Bois de Boulogne einen neuen Frühling gebracht und die Damen der großen Welt im offenen Wagen ins Freie gelockt hatte, drohte nun in jäher Abendkühle zu enden.
Einen Augenblick verharrte die junge Frau zusammengekauert, genoß wieder die Wärme ihrer Wagendecke und ließ sich wohlig einwiegen vom Geräusch der vielen Räder, die vor ihr herrollten. Dann wandte sie sich zu Maxime, dessen Blicke in aller Gemütsruhe die Frauen entkleideten, die in den benachbarten Kupees und Landauern prangten.
„Sag doch“, fragte sie, „findest du diese Laure d’Aurigny wirklich hübsch? Du hast ja neulich eine Lobrede auf die gehalten, als der Verkauf ihrer Diamanten bekanntgegeben wurde! Hast du übrigens den Halsschmuck und die Aigrette gesehen, die mir dein Vater dort gekauft hat?“
„Gewiß, er tut manches“, sagte Maxime mit einem boshaften Lachen, ohne auf ihre Frage zu antworten. „Er findet Mittel und Wege, Laures Schulden zu bezahlen und seiner Frau Diamanten zu schenken.“
Die junge Frau bewegte leicht die Schultern.
„Du Nichtsnutz!“ murmelte sie lächelnd.
Doch der junge Mann hatte sich vorgebeugt und verfolgte mit den Blicken eine Dame, deren grünes Gewand ihn interessierte. Renée hatte den Kopf wieder angelehnt und schaute aus halbgeschlossenen Augen lässig nach beiden Seiten der Allee, ohne wirklich etwas zu sehen. Rechts glitten still Gebüsche und niedriger Wald mit rötlichem Laub und dünnem Astwerk vorüber; zuweilen galoppierten auf dem Reitweg Herren mit schlanker Taille vorbei, und ihre Tiere wirbelten Wölkchen feinen Sandes auf. Links, am Fuß der schmalen, abschüssigen Wiesen, die von Blumenrabatten und Baumgruppen unterbrochen waren, schlief in kristallener Reinheit der See, ohne jeden Schaum und als hätten die Gärtner seine Ufer säuberlich mit dem Spaten abgestochen. Und jenseits dieses klaren Spiegels reckten die beiden Inseln, zwischen denen die Brücke, die sie verbindet, jetzt einen grauen Strich bildete, ihre reizenden Uferklippen empor und reihten vor dem blassen Himmel gleich Fransen geschickt am Horizont drapierter Vorhänge die kulissenhaften Zeilen ihrer Tannen auf, ihrer Bäume mit bleibendem Laub, dessen schwärzliches Grün das Wasser widerspiegelte. Dieser Naturwinkel, diese Theaterdekoration, die wie frisch gemalt aussah, schwamm in leichtem Schatten, in bläulichem Dunst, der der Ferne einen erlesenen Reiz verlieh, eine Atmosphäre entzückender Unwirklichkeit. Das Inselschlößchen am anderen Ufer glänzte wie ein neues Spielzeug, das erst gestern lackiert worden war. Und diese Bänder von gelbem Sand, diese schmalen Gartenwege, die sich durch die Wiesen schlängeln und, von künstlichen gußeisernen Zweigen eingefaßt, um den See laufen, hoben sich zu dieser späten Stunde noch merkwürdiger vom zärtlichen Grün des Wassers und des Rasens ab.
An die kunstvolle Anmut dieser Aussicht gewöhnt und wieder von Müdigkeit ergriffen, hatte Renée die Augenlider völlig gesenkt und betrachtete nur noch ihre schlanken Finger, die einander mit den langen Haaren des Bärenfells bewickelten. Plötzlich aber gab es einen Ruck im regelmäßigen Trab der Fahrzeuge. Sie hob den Kopf und grüßte zu zwei jungen Damen hinüber, die in verliebter Lässigkeit nebeneinander in einem achtfedrigen Wagen lehnten, der soeben unter großem Aufsehen das Seeufer verließ, um sich durch eine Seitenallee zu entfernen. Die Marquise d’Espanet, deren Gatte, damals Generaladjutant des Kaisers, sich höchst geräuschvoll der Entrüstung des schmollenden alten Adels angeschlossen hatte, war eine der glänzendsten Weltdamen des zweiten Kaiserreichs; die andere, Frau Haffner, hatte einen bekannten Fabrikanten aus Colmar geheiratet, einen zwanzigfachen Millionär, den das Kaiserreich zum Politiker gemacht hatte. Renée hatte die beiden „Unzertrennlichen“, wie man sie vielsagend titulierte, im Pensionat kennengelernt, sie nannte sie beim Vornamen: Adeline und Suzanne. Und als sich die junge Frau, nachdem sie ihnen zugelächelt hatte, gerade wieder zusammenkuscheln wollte, wandte sie auf ein Lachen von Maxime hin den Kopf.
„Nein, ich bin wirklich traurig, du darfst nicht lachen, es ist mir Ernst damit!“ sagte sie, als sie sah, wie der junge Mann sie spöttisch betrachtete und sich über ihre gebeugte Haltung lustig machte.
Maxime schlug einen scherzenden Ton an.
„Wir hätten also einen schweren Kummer, wir wären am Ende eifersüchtig?“
Sie schien völlig überrascht.
„Ich?“ fragte sie. „Warum denn eifersüchtig?“
Dann fügte sie, als erinnere sie sich plötzlich, mit ihrer verächtlichen Schmollmiene hinzu: „Ach ja, die dicke Laure! An die denke ich gar nicht. Wenn Aristide, wie ihr alle mir zu verstehen geben wollt, dieser Person die Schulden bezahlt und ihr dadurch eine Reise ins Ausland erspart hat, so heißt das nur, daß er weniger am Geld hängt, als ich glaubte. Das wird ihn bei den Damen wieder in Gunst setzen . . . der gute Mann, ich lasse ihm volle Freiheit!“
Sie lächelte, sie sagte „der gute Mann“ in einem Ton freundschaftlicher Gleichgültigkeit, und auf einmal wurde sie wieder sehr traurig, schaute umher mit dem verzweifelten Blick der Frauen, die nicht mehr wissen, welcher Zerstreuung sie sich hingeben könnten, und murmelte: „Oh, ich möchte . . . Doch nein, ich bin nicht eifersüchtig, ganz und gar nicht eifersüchtig.“
Sie hielt inne, zögerte.
„Siehst du, ich langweile mich“, sagte sie endlich mit rauher Stimme.
Darauf schwieg sie mit zusammengekniffenen Lippen.
Immer noch glitt die Wagenreihe den See entlang, in gleichmäßigem Schritt, mit dem eigentümlichen Geräusch eines fernen Wasserfalls. Soeben tauchten links, zwischen dem Wasser und der Allee, Gruppen kleiner immergrüner Bäume auf, deren dünne, gerade Stämmchen merkwürdige Säulenbündel bildeten. Rechts hatten die Gebüsche und der niedrige Wald aufgehört; der Bois hatte sich zu breiten Wiesen aufgetan, zu unendlichen Grasteppichen, auf denen hier und da Gruppen alter Bäume standen; die grünen Flächen folgten einander in leichten Wellen bis zur Porte de la Muette, deren niedriges Gitter, das einem Stück dicht über dem Boden ausgespannter schwarzer Spitze glich, man von sehr weit her sehen konnte; und an den Hängen, dort, wo sich die Bodenwellen vertieften, war das Gras ganz blau. Renée starrte vor sich hin, als brächten ihr dieser weiter gewordene Horizont, diese weichen, von der Abendluft durchhauchten Wiesen die Leere ihres Daseins noch schmerzlicher zum Bewußtsein.
Nach einem Stillschweigen wiederholte sie im Ton dumpfen Zorns: „Oh, ich langweile mich, ich langweile mich zum Sterben.“
„Weißt du auch, daß du nicht gerade amüsant bist?“ sagte Maxime ruhig. „Du bist wieder einmal gereizt, soviel ist sicher.“
Die junge Frau warf sich in die Wagenkissen zurück.
„Ja, ich bin gereizt“, erwiderte sie trocken.
Dann wurde sie mütterlich.
„Ich werde alt, mein liebes Kind; ich bin bald dreißig. Das ist schrecklich! Ich habe an nichts mehr Spaß . . . Du mit deinen zwanzig Jahren kannst nicht wissen . . .“
„Hast du mich etwa mitgenommen, um mir eine Beichte abzulegen?“ unterbrach sie der junge Mann. „Das würde verteufelt lange dauern.“
Sie nahm diese Frechheit mit einem leichten Lächeln hin, wie die Unart eines verzogenen Kindes, dem alles erlaubt ist.
„Du hast allen Grund, dich zu beklagen“, fuhr Maxime fort, „für deine Toiletten gibst du jährlich mehr als hunderttausend Francs aus, du bewohnst ein fürstliches Haus, hast herrliche Pferde, deine Launen werden zu Gesetzen, und die Zeitungen berichten über jede deiner neuen Roben wie über ein Ereignis von höchster Wichtigkeit; die Frauen beneiden dich, und die Männer würden zehn Jahre ihres Lebens hingeben, um dir auch nur die Fingerspitzen küssen zu dürfen . . . Stimmt’s?“ Sie nickte zustimmend, ohne zu antworten. Die Wimpern gesenkt, hatte sie von neuem begonnen, sich die Haare des Bärenfells um die Finger zu wickeln.
„Geh, sei nicht bescheiden“, sprach Maxime weiter, „gib rundweg zu, daß du eine der Stützen des zweiten Kaiserreichs bist. Unter uns können wir ja von diesen Dingen reden. Überall, in den Tuilerien, bei den Ministern, bei den simplen Millionären, von oben bis unten regierst du als unumschränkte Herrscherin. Es gibt kein Vergnügen, das du nicht in vollen Zügen genossen hättest, und wenn ich es wagte, wenn der Respekt, den ich dir schulde, mich nicht zurückhielte, würde ich sagen . . .“
Er schwieg einige Augenblicke und lachte; dann vollendete er ritterlich seinen Satz: „Dann würde ich sagen, du hast bereits alle Früchte gekostet.“
Sie verzog keine Miene.
„Und dabei langweilst du dich noch!“ begann der junge Mann erneut mit spaßhaftem Eifer. „Aber das ist ja eine Sünde! Was willst du eigentlich? Wovon träumst du?“
Sie zuckte mit den Achseln, um anzudeuten, daß sie es selber nicht wisse. Obwohl sie den Kopf gesenkt hielt, sah Maxime ihr Gesicht jetzt so ernst, so traurig, daß er schwieg. Er betrachtete die Wagenreihe, die, am Ende des Sees angelangt, sich auseinanderzog und die breite Straßenkreuzung füllte. Die Fahrzeuge, nun weniger beengt, schwenkten in prachtvollen Kurven ein; der raschere Hufschlag der Gespanne hallte auf dem harten Boden.
Um sich einzureihen, fuhr die Kalesche jetzt einen großen Bogen, und ihre schwingende Bewegung erfüllte Maxime mit einer unbestimmten Wollust. Er gab dem Verlangen nach, Renée mit Vorwürfen zu überhäufen.
„Hör mal“, sagte er, „du verdientest eigentlich, in einer Mietskutsche zu fahren! Das geschähe dir recht! . . . Sieh doch diese Menschenmenge an, die nach Paris zurückkehrt, diese Menge, die dir zu Füßen liegt. Man grüßt dich wie eine Königin, und wenig fehlt, daß dein guter Freund, Herr de Mussy, dir Kußhände zuwirft.“
In der Tat wurde Renée soeben von einem Reiter gegrüßt. Maxime hatte in einem Ton erheuchelten Spotts gesprochen. Doch Renée wandte sich kaum um, zuckte nur mit den Achseln. Diesmal war es der junge Mann, der eine verzweifelte Bewegung machte.
„Sind wir wirklich schon so weit? Aber, mein Gott, du hast alles, was willst du denn noch?“
Renée hob den Kopf. Ein heißer Glanz lag in ihren Augen, ein brennendes Begehren voll ungestillter Neugier.
„Ich will etwas anderes“, antwortete sie leise.
„Aber da du bereits alles hast“, entgegnete Maxime lachend, „gibt es eben nichts anderes mehr . . . Was soll das heißen: etwas anderes?“
„Was das heißen soll . . .?“ wiederholte sie.
Damit brach sie ab. Sie hatte sich vollständig umgedreht und betrachtete das eigenartige Bild, das allmählich hinter ihr verblich. Es war beinahe Nacht geworden; wie feine Asche senkte sich langsam die Dämmerung herab. In dem bleichen Tageslicht, das noch auf dem Wasser lag, rundete sich der See, den man nun von vorn her überblickte, zu einer riesigen Zinnplatte; die Wäldchen aus immergrünen Bäumen, deren dünne, gerade Stämme der schlafenden Wasserfläche zu entwachsen schienen, nahmen jetzt das Aussehen blaßvioletter Säulenreihen an, die mit ihrer regelmäßigen Architektur die kunstvollen Krümmungen der Ufer nachzeichneten; im Hintergrund stiegen dichte hohe Bäume empor, schlossen mächtige, verworrene Laubmassen, große dunkle Flecken den Horizont ab. Hinter diesen Flecken schimmerte die Glut eines fast erloschenen Sonnenuntergangs, der nur noch einen Zipfel der grauen Unendlichkeit beleuchtete. Über dem regungslosen See, dem niedrigen Wald, über dieser so besonders ebenen Aussicht öffnete sich das Himmelsgewölbe unendlich, tiefer und weiter. Dieses große Stück Himmel über diesem kleinen Stückchen Natur hatte etwas wie ein Erschauern an sich, eine unbestimmte Traurigkeit; und aus diesen immer fahler werdenden Höhen fiel solche herbstliche Schwermut, eine Nacht von so herzzerreißender Süße herab, daß der Bois de Boulogne, immer dichter in ein Leichentuch von Schatten gehüllt, seine mondäne Anmut verlor und, grenzenlos geworden, ganz vom mächtigen Zauber der Wälder erfüllt war. Das Rollen der Equipagen, deren lebhafte Farben in der Dunkelheit erloschen, glich fernen, von oben kommenden Stimmen rauschender Blätter und strömender Wasser. Alles schwand, alles erstarb. In dem allgemeinen Verlöschen hob sich das lateinische Segel des großen Vergnügungsschiffes mitten im See scharf und kräftig von der Glut des Abendhimmels ab. Und nun sah man nichts mehr als dieses Segel, dieses ins Unendliche vergrößerte Dreieck aus gelber Leinwand.
Angesichts dieser Landschaft, die Renée nicht mehr wiedererkannte, dieser so kunstvoll verfeinerten Natur, aus der die große, erschauernde Nacht einen heiligen Hain schuf, eine jener idealen Waldlichtungen, in deren Tiefen die alten Götter einst ihre gewaltigen Leidenschaften, ihren Ehebruch und ihre göttliche Blutschande verbargen, verspürte sie in ihrer Übersättigung eine eigenartige Anwandlung unnennbarer Wünsche. Und je weiter sich die Kalesche entfernte, um so mehr schien es der jungen Frau, als nähme die Dämmerung hinter ihr auf zitternden Flügeln dieses Traumland mit sich, diese heimliche und übermenschliche Stätte der Lust, wo ihr krankes Herz, ihr von Überdruß erfüllter Leib endlich gestillt worden wären.
Als der See und die Wäldchen, vom Schatten verschlungen, nur noch als schwarzer Strich am Himmelsrand sichtbar waren, wandte sich die junge Frau plötzlich um und nahm mit einer Stimme, aus der Tränen des Unwillens klangen, den unterbrochenen Satz wieder auf: „Was? . . . etwas anderes! Bei Gott! Ich will etwas anderes! Weiß ich denn, was? Wenn ich es wüßte . . . Aber, siehst du, ich habe die Bälle, die Soupers, all diese Festlichkeiten satt. Immer dasselbe! Es ist zum Davonlaufen . . . Die Männer sind zum Sterben langweilig, o ja, zum Sterben langweilig . . .“
Maxime fing an zu lachen. Heiße Begierden verrieten sich im aristokratischen Mienenspiel der großen Weltdame. Sie blinzelte nicht mehr; ihre Stirnfalte grub sich tief ins Fleisch; die schmollende Kinderlippe schob sich vor, voller Begehrlichkeit nach jenen Genüssen, die sie herbeisehnte, ohne sie nennen zu können. Zwar sah sie das Lachen ihres Begleiters, aber sie war zu aufgeregt, um sich zu beherrschen. Halb liegend überließ sie sich dem Schaukeln des Wagens und fuhr in kurzen, trockenen Sätzen fort: „Ja, gewiß, ihr seid zum Sterben langweilig . . . Damit meine ich nicht dich, Maxime, du bist noch zu jung . . . Aber wenn ich dir erzählen wollte, wie lästig Aristide mir anfänglich gewesen ist! Und gar die anderen, jene, die mich geliebt haben . . . Du weißt, wir sind zwei gute Kameraden, vor dir tue ich mir keinen Zwang an. Nun denn, es gibt Tage, an denen ich es so satt habe, das Leben einer reichen, vergötterten, überall beachteten Frau zu führen, daß ich gern eine Laure d’Aurigny wäre, eine jener Frauen, die wie Junggesellen leben.“
Und als Maxime noch lauter lachte, blieb sie hartnäckig dabei: „Jawohl, eine Laure d’Aurigny. Das muß weniger reizlos sein, weniger eintönig.“
Sie schwieg einige Augenblicke, als stelle sie sich das Leben vor, das sie führen würde, wenn sie Laure wäre. Dann sagte sie in entmutigtem Ton: „Schließlich werden auch diese Frauen ihre Sorgen haben. Es gibt nichts, was nur lustig ist, soviel ist sicher. Es ist zum Davonlaufen . . . Ich sagte dir schon, ich wünsche mir etwas anderes; du verstehst wohl, ich komme selbst nicht dahinter, aber etwas anderes, etwas, was nicht jedem passiert, was man nicht alle Tage erlebt, einen seltenen, unbekannten Genuß.“
Ihre Stimme war schleppend geworden. Die letzten Worte hatte sie stockend gesprochen, wie aus einem tiefen Traum heraus.
Die Kalesche fuhr jetzt die Allee hinauf, die zum Ausgang des Bois de Boulogne führt. Die Dunkelheit nahm zu. Das Buschwerk lief zu beiden Seiten hin wie graue Mauern; die gelbgestrichenen eisernen Stühle, auf denen sich an schönen Abenden die herausgeputzte Bürgerschaft zur Schau stellt, huschten ganz verlassen am Rand der Fußwege vorbei, mit der düsteren Melancholie von Gartenmöbeln, die vom Winter überrascht worden sind, und das Rollen, das dumpfe, taktmäßige Geräusch der heimkehrenden Wagen tönte wie eine traurige Klage durch die verödete Allee.
Ohne Zweifel empfand Maxime, daß es durchaus nicht zum guten Ton gehöre, das Leben lustig zu finden. Wenngleich er noch jung genug war, um sich einer Aufwallung glücklicher Begeisterung zu überlassen, so war er doch viel zu egoistisch, viel zu gleichgültig und spöttisch und bereits von zu viel echtem Überdruß erfüllt, um sich nicht für angeekelt, blasiert und völlig ausgehöhlt zu erklären. Gewöhnlich tat er sich auf dieses Geständnis sogar etwas zugute.
Er lehnte sich zurück wie Renée und sprach mit klagender Stimme: „Freilich, du hast recht, es ist entsetzlich. Sieh, ich amüsiere mich ebensowenig wie du; auch ich habe mir schon oft anderes erträumt . . . Nichts ist blödsinniger als reisen. Geld verdienen? Ich ziehe vor, es durchzubringen, obgleich auch das nicht immer so amüsant ist, wie man es sich zunächst vorstellt. Lieben, geliebt werden? Das steht einem bald bis an den Hals, nicht wahr? O ja, das steht einem bis an den Hals!“
Da die junge Frau nicht antwortete, fuhr er fort, in der Absicht, sie mit einer besonderen Ruchlosigkeit zu verblüffen: „Was mich betrifft, so möchte ich von einer Nonne geliebt werden. Das wäre doch vielleicht nicht schlecht! . . . Hast du selbst niemals davon geträumt, einen Mann zu lieben, an den du nicht denken dürftest, ohne ein Verbrechen zu begehen?“
Doch sie blieb düster, und als Maxime merkte, daß sie weiterhin schwieg, nahm er an, sie habe ihm nicht zugehört. Den Nakken an die gepolsterte Rückwand des Wagens gelehnt, schien sie mit offenen Augen zu schlafen. Sie träumte, regungslos ihren Phantastereien hingegeben, die sie derart bedrängten, daß von Zeit zu Zeit ein leichtes nervöses Zucken über ihre Lippen lief. Sie fühlte sich weich vom Schatten der Dämmerung umfangen; alles, was dieser Schatten an Traurigkeit, an geheimer Lust, an uneingestandener Sehnsucht in sich barg, drang in sie ein, hüllte sie in eine erschlaffende, krankhafte Atmosphäre. Zweifellos dachte sie, während sie mit starrem Blick den runden Rücken des Lakaien auf dem Bock betrachtete, an die Freuden von gestern, an jene Feste, die sie als so schal empfand und von denen sie nichts mehr wissen wollte. Sie sah ihr vergangenes Leben, die unverzügliche Befriedigung ihrer Wünsche, den Ekel, den der Luxus bei ihr zurückließ, die zermürbende Eintönigkeit der immer gleichen Zärtlichkeiten und des immer gleichen Betrugs. Dann stieg, wie eine Hoffnung, mit zitternder Begierde der Gedanke an dieses „andere“ in ihr auf, das sie trotz allem aufgewandten Scharfsinn nicht zu finden vermochte. Hier geriet sie mit ihrer Träumerei in die Irre. Sie gab sich alle Mühe, doch immer verbarg sich das gesuchte Wort in der herabsinkenden Nacht, verlor sich im unaufhörlichen Rollen der Wagen. Das weiche Wiegen der Kalesche vermehrte noch ihre Unsicherheit, hinderte sie, den klaren Ausdruck für ihr Sehnen zu finden. Und eine ungeheure Versuchung stieg aus diesem Ungreifbaren auf, aus dem vom Dunkel eingeschläferten Buschholz zu beiden Seiten der Allee, aus dem Geräusch der Räder und dem weichen Schaukeln, das sie so angenehm betäubte. Tausend kleine Schauer rieselten über ihre Haut: abgebrochene Träume, namenlose Lüste, verworrene Wünsche – alles, was eine Rückkehr aus dem Bois de Boulogne zur Stunde, da der Himmel verblaßt, an Köstlichem und Ungeheuerlichem im übersättigten Herzen einer Frau zu wecken vermag. Sie hatte beide Hände tief in das Bärenfell vergraben, es war ihr sehr heiß in ihrem weißen Tuchmantel mit den malvenfarbenen Samtaufschlägen. Als sie einen Fuß vorstreckte, um sich in ihrer Behaglichkeit zu dehnen, streifte sie mit ihrem Knöchel das warme Bein Maximes, der die Berührung nicht einmal beachtete. Ein Ruck durchfuhr sie und riß sie aus ihrem Halbschlaf. Sie hob den Kopf und richtete aus ihren grauen Augen einen merkwürdigen Blick auf den jungen Mann, der in vollendeter Eleganz lässig neben ihr lehnte.
In diesem Augenblick verließ die Kalesche den Bois. Die Avenue de l’Impératrice lief schnurgerade in die Dämmerung hinaus, begleitet von den beiden grünen Linien ihrer gestrichenen Holzgeländer, die sich am Horizont vereinigten. Auf der den Reitern vorbehaltenen Nebenallee durchbrach in der Ferne ein Schimmel den grauen Schatten mit einem hellen Flecken. Auf der anderen Seite wanderten hier und dort verspätete Spaziergänger die lange Straße entlang, Gruppen kleiner schwarzer Punkte, die sich gemächlich auf Paris zu bewegten. Und ganz oben, am Ende der wimmelnden, verworrenen Wagenreihe, hob sich schräg zur Blicklinie der bleiche Arc de Triomphe von einem riesigen, rußfarbenen Himmel ab.
Während die Kalesche in rascherem Trab dahinfuhr, betrachtete Maxime, vom englischen Stil der Landschaft entzückt, die Palais zu beiden Seiten der Allee, ihre launische Architektur, ihre Rasenflächen, die bis zu den Reitwegen herabreichen. Renée, noch befangen in ihren Träumereien, unterhielt sich damit, zuzusehen, wie unten am Horizont die Gaslaternen des Place de l’Étoile eine nach der andern aufleuchteten, und während die funkelnden Lichter den sterbenden Tag mit gelben Flämmchen tupften, glaubte sie heimliche Rufe zu vernehmen, schien es ihr, als beleuchte sich eigens für sie das strahlende Paris der Winternächte so festlich und halte für sie den noch unbekannten Genuß bereit, von dem sie sich Befriedigung erhoffte.
Der Wagen fuhr durch die Avenue de la Reine-Hortense und hielt dann am Ende der Rue Monceau, wenige Schritte vom Boulevard Malesherbes entfernt, vor einem großen Palais, das zwischen Hof und Garten lag. Jedes der beiden mit vergoldetem Zierat überladenen Gittertore, die in den Hof führten, war von zwei urnenförmigen, ebenfalls reich vergoldeten Laternen flankiert, in denen große Gasflammen brannten. Zwischen beiden Toren bewohnte der Pförtner ein zierliches Häuschen, das entfernt an einen kleinen griechischen Tempel erinnerte.
Als der Wagen in den Hof einbog, sprang Maxime leichtfüßig hinaus.
„Du weißt ja“, sagte Renée zu ihm und hielt ihn dabei mit der Hand zurück, „wir gehen um halb acht zu Tisch. Du hast mehr als eine Stunde zum Umkleiden. Laß nicht auf dich warten.“ Und mit einem Lächeln fügte sie hinzu: „Die Mareuils kommen . . . Dein Vater wünscht, daß du aufmerksam zu Louise bist.“
Maxime zuckte mit den Achseln.
„Das ist ja die reinste Fron!“ murmelte er verdrießlich. „Ich will ja gern heiraten, aber jemandem den Hof machen ist doch zu albern . . . Ach! es wäre reizend von dir, Renée, wenn du mir Louise heute abend vom Halse halten wolltest.“
Er spielte wieder den Komiker, ahmte in Ton und Grimasse Lassouche nach, wie jedesmal, wenn er einen seiner gewohnten Witze verzapfte: „Willst du, geliebte Stiefmutter?“
Renée schüttelte ihm die Hand wie einem guten Kameraden. Dann sprudelte sie in etwas gereiztem, keckem Ton spöttelnd hervor: „Sieh einer an! Wenn ich nicht deinen Vater geheiratet hätte, würdest du, glaube ich, mir den Hof machen!“
Der junge Mann mußte diesen Einfall sehr drollig finden, denn er war bereits um die Ecke des Boulevard Malesherbes, als er noch immer lachte.
Die Kalesche fuhr unterdessen in den Hof und hielt vor der Freitreppe.
Diese Freitreppe mit niedrigen, breiten Stufen hatte ein großes gläsernes Schutzdach, das ein Bogenbehang mit Fransen und goldenen Quasten umsäumte. Die beiden Stockwerke der Villa lagen über den Wirtschaftsräumen, deren knapp über dem Erdboden angebrachte kleine Fenster mit Mattscheiben versehen waren. Die vorspringende Vestibültür oben auf der Freitreppe war von schmalen, in die Mauer eingelassenen Säulen flankiert und bildete so eine Art Vorbau, der, in jedem Stockwerk von einem Rundfenster durchbrochen, bis zum Dach anstieg, wo er in einem dreieckigen Giebel endete. Die Stockwerke wiesen zu beiden Seiten je fünf Fenster auf, die sich in regelmäßigen Abständen an der Fassade entlangreihten und von einfachen Steinrahmen umgeben waren. Das Mansardendach hatte vier große, beinahe senkrechte Seitenflächen.
Auf der Gartenseite aber war die Fassade sehr viel prächtiger. Eine wahrhaft königliche Freitreppe führte zu einer schmalen Terrasse, die sich an der ganzen Länge des Erdgeschosses hinzog; die Terrassenrampe, im Stil der Gitter des Parc Monceau, war noch stärker mit Gold überladen als das Schutzdach und die Laternen des Hofes. Dahinter erhob sich das Palais, mit zwei Pavillons an den Ecken, turmartigen, halb in den Block des Hauses einbezogenen Vorbauten, die im Inneren runde Gemächer bargen. In der Mitte sprang ein noch tiefer eingelassenes Türmchen nur wenig vor. Die Fenster, an den Vorbauten hoch und schmal, an den flachen Teilen der Fassade weiter voneinander entfernt und fast quadratisch, hatten im Erdgeschoß steinerne Balustraden, in den oberen Stockwerken halbhohe Gitter aus vergoldetem Schmiedeeisen. Es war eine Schaustellung, eine Verschwendung, ein Übermaß von Reichtum. Das ganze Gebäude verschwand förmlich unter Skulpturen. Rings um die Fenster und an den Gesimsen entlang schlang sich Schnörkelwerk von Zweigen und Blüten; die Balkone glichen Körben voll Laub, die von großen nackten Frauengestalten mit verdrehten Hüften und straffen Brüsten emporgehalten wurden; außerdem waren allenthalben Phantasiewappen angebracht, Weintrauben, Rosen, alles, was man aus Stein oder Marmor erblühen lassen kann. Je höher man hinaufblickte, desto blühender entfaltete sich der Zierat. Rings um das Dach lief eine Balustrade, in regelmäßigen Abständen mit Urnen besetzt, aus denen steinerne Flammen emporloderten. Und hier, zwischen den runden Mansardenfenstern, die sich in einem unglaublichen Gewirr von Früchten und Blattwerk öffneten, thronten die Glanzstücke dieser erstaunlichen Dekoration, die Giebel der Pavillons, in deren Mitte abermals große nackte Frauengestalten erschienen, die, in den verschiedensten Stellungen, zwischen Binsenbüscheln, mit Äpfeln spielten. Das mit all diesem Schmuck beladene Dach, noch überragt von Galerien aus ausgezacktem Blei, zwei Blitzableitern und vier riesigen, symmetrisch angeordneten Kaminen, die wie alles übrige mit Skulpturen versehen waren, schien die Krönung dieses architektonischen Feuerwerks darzustellen.
Rechter Hand befand sich ein geräumiges Gewächshaus, eng an den einen Flügel des Palais gelehnt und durch die Glastür des Salons mit dem Erdgeschoß verbunden. Der Garten, den ein niedriges, durch eine Hecke verstecktes Gitter vom Parc Monceau trennte, war ziemlich abschüssig. Zu klein im Verhältnis zum Wohngebäude, so eng, daß nur ein Rasen und einige Gruppen immergrüner Bäume darin Platz fanden, war er lediglich ein Hügel, eine Art grünen Sockels, auf dem das Palais in seiner Galatoilette hochmütig thronte. Vom Park aus betrachtet, über den tadellos gehaltenen Rasen und die niedrigen Bäume hinweg, deren Laub wie lackiert glänzte, hatte dieser noch neue mattweiße Riesenbau mit seiner schweren Schieferkappe, seinem vergoldeten Gitterwerk, seiner Überfülle an Skulpturen das bleiche Gesicht, die üppige und alberne Aufdringlichkeit eines Emporkömmlings. Es war ein neuer Louvre in kleinerem Maßstab, eines der charakteristischen Musterbeispiele des Stils unter dem dritten Napoleon, jenes strotzenden Bastards sämtlicher Stile. An Sommerabenden, wenn die schrägen Sonnenstrahlen das Gold des Gitterwerks an der weißen Fassade aufleuchten ließen, blieben die Parkbesucher stehen und betrachteten die gerafften rotseidenen Fenstervorhänge des Erdgeschosses; und durch die großen, klaren Fensterscheiben, die, wie die Schaufenster der großen modernen Läden, dazu geschaffen schienen, den inneren Prunk nach außen zur Schau zu stellen, gewahrten die Kleinbürgerfamilien Teile von Möbeln, Stoffstücke, Ausschnitte der Zimmerdecken von so blendendem Reichtum, daß sie beim bloßen Anblick vor Bewunderung und Neid wie angewurzelt mitten auf der Allee stehenblieben.
Doch zu dieser Stunde sank die Dunkelheit von den Bäumen herab, die Fassade schlummerte. Drüben im Hof hatte der Kammerdiener Renée ehrerbietig aus dem Wagen geholfen. Die Stallungen, mit Streifen aus roten Ziegeln abgesetzt, öffneten rechts ihre braunen Eichentore zu einem verglasten Wagenschuppen hin. Zur Linken, wie um der Symmetrie Genüge zu tun, schmiegte sich an die Mauer des Nachbarhauses eine reichgeschmückte Nische, in der ständig Wasser aus einer Muschel herabfloß, die von zwei Amoretten mit gestreckten Armen gehalten wurde. Die junge Frau blieb einen Augenblick am Fuß der Freitreppe stehen und schlug leicht auf ihren Rock, der sich nicht glätten wollte. Der Hof, den eben noch das Pferdegetrappel erfüllt hatte, versank wieder in seine Einsamkeit, sein aristokratisches Schweigen, das nur die ewige Melodie des Wassers belebte. Und in der schwarzen Masse des Gebäudes, darin bald das erste der großen Herbstdiners die Kronleuchter entzünden sollte, flammten nur die unteren Fenster wie glühende Kohlen und warfen einen hellen Feuerschein auf das Kleinpflaster des Hofes, das regelmäßig und sauber war wie ein Damebrett.
Als Renée die Tür zum Vestibül öffnete, fand sie sich dem Kammerdiener ihres Mannes gegenüber, der gerade mit einem silbernen Kessel in die Wirtschaftsräume hinuntergehen wollte. Der Mann sah prächtig aus, ganz in Schwarz gekleidet, groß, kräftig, mit blassem Gesicht, dem tadellosen Backenbart eines englischen Diplomaten und der ernsten, würdevollen Miene eines Beamten.
„Baptiste, ist der Herr zu Hause?“ fragte die junge Frau.
„Ja, gnädige Frau, er kleidet sich um“, antwortete der Diener mit einem Neigen des Kopfes, um das ihn ein Fürst als Gruß für die Menge hätte beneiden können.
Langsam ging Renée die Treppe hinauf und zog dabei die Handschuhe aus.
Das Vestibül war von großer Pracht. Beim Eintreten empfand man eine leichte Beklemmung. Die dicken Teppiche, die den Boden bedeckten und sich die Stufen hinanzogen, die breiten roten Samtbehänge an Wänden und Türen erfüllten die Luft mit der lastenden Stille und dem erschlaffenden Wohlgeruch einer Kapelle. Die Vorhänge fielen von ganz oben herab, und die sehr hohe Decke war mit vorspringenden Rosetten geschmückt, die an einem Gitter aus Goldstäbchen saßen. Die Treppe, deren doppeltes weißes Marmorgeländer mit rotem Samt belegt war, teilte sich in zwei leicht gebogene Arme, zwischen denen sich im Hintergrund die Tür zum großen Saal befand. Auf dem ersten Treppenabsatz nahm ein riesiger Spiegel die ganze Wand ein. Unten, am Fuß der beiden Treppenarme, trugen zwei bis zum Gürtel nackte Frauengestalten aus vergoldeter Bronze, die auf Marmorsockeln standen, große fünfflammige Kandelaber, deren helles Licht von Mattglaskugeln gedämpft wurde. Und zu beiden Seiten reihten sich wundervolle Majolikakübel, in denen seltene Pflanzen blühten.
Mit jeder Stufe, die Renée hinaufstieg, wuchs ihre Gestalt im Spiegel, und mit dem Zweifel, der die gefeiertsten Schauspielerinnen befällt, fragte sie sich, ob sie wirklich so anziehend sei, wie man ihr sagte.
In ihren Räumen angelangt, die im ersten Stock lagen und deren Fenster auf den Parc Monceau gingen, klingelte sie nach Céleste, ihrer Kammerzofe, und ließ sich zum Diner ankleiden. Das dauerte fünf gute Viertelstunden. Als die letzte Nadel gesteckt war, öffnete sie ein Fenster, denn es war sehr heiß im Zimmer, stützte sich mit dem Ellbogen auf das Fensterbrett und versank in Nachdenken. Hinter ihr bewegte sich leise Céleste und räumte die Toilettengegenstände einen nach dem andern beiseite.
Drunten im Park wogte ein Meer von Schatten. Die hohen tintenschwarzen Laubmassen, von plötzlichen Windstößen geschüttelt, hatten das weite Wiegen wechselnder Gezeiten, begleitet vom Rascheln der dürren Blätter, das an das Auflaufen der Wellen an einem Kieselstrand erinnert. Durch diesen Wirbel von Finsternis fuhr nur hin und wieder ein lichter Streifen von den gelbleuchtenden Augen eines Wagens, die zwischen den Baumgruppen längs der großen Allee, die von der Avenue de la Reine-Hortense zum Boulevard Malesherbes führt, auftauchten und wieder verschwanden. Angesichts dieser herbstlichen Traurigkeit fühlte Renée, wie aller Gram erneut in ihrem Herzen aufstieg. Sie sah sich wieder als Kind im Hause ihres Vaters, in jenem stillen Palais auf der Ile Saint-Louis, das die Familie Béraud Du Châtel seit zwei Jahrhunderten mit ihrem düsteren Beamtenernst erfüllte. Dann dachte sie an ihre wie durch Hexerei zustande gekommene Heirat, an jenen Witwer, der sich für diese Heirat verkauft und seinen Namen Rougon gegen den Namen Saccard vertauscht hatte, dessen zwei trockene Silben ihren Ohren anfänglich wie das harte Kratzen von zwei Rechen klangen, die Gold zusammenscharren. Er ergriff Besitz von ihr, riß sie in dieses maßlose Leben, darin ihr armer Kopf von Tag zu Tag ein wenig wirr wurde. Dann begann sie, sich mit kindlicher Freude zu den schönen Federballspielen von einst mit ihrer kleinen Schwester Christine zurückzuträumen. Eines Morgens aber würde sie wohl aus dem Genußtraum, in dem sie seit zehn Jahren schwelgte, jäh aufwachen, halb verrückt, beschmutzt durch eine jener Spekulationen ihres Mannes, an der er selber zugrunde gehen würde. Es war wie eine blitzartige Vorahnung. Die Bäume klagten nun lauter. Geängstigt durch diese Gedanken an Schande und Strafe, gab Renée alten, ehrbaren Bürgerinstinkten nach, die tief in ihrem Innern schlummerten; sie gelobte der dunklen Nacht, sich zu bessern, nicht mehr soviel für ihre Toiletten auszugeben und irgendeinen unschuldigen Zeitvertreib zu suchen, wie in jenen glücklichen Tagen im Mädchenpensionat, wo die Schülerinnen sangen: „Wir gehen nicht mehr in den Wald“ und dabei friedlich unter den Platanen wandelten. In diesem Augenblick kam Céleste, die hinuntergegangen war, ins Zimmer zurück und flüsterte ihrer Herrin zu: „Der Herr läßt die gnädige Frau bitten, herunterzukommen. Es sind schon mehrere Gäste im Salon.“
Renée erschauerte. Sie hatte die scharfe Luft, von der ihre Schultern eiskalt geworden waren, gar nicht gespürt. Als sie an ihrem Spiegel vorüberkam, blieb sie mechanisch stehen und betrachtete sich. Unwillkürlich lächelte sie und begab sich dann nach unten.
Tatsächlich waren schon fast alle Gäste eingetroffen: ihre Schwester Christine, ein junges Mädchen von zwanzig Jahren, sehr schlicht in weißen Musselin gekleidet; ihre Tante Elisabeth, Witwe des Notars Aubertot, in schwarzer Seide, eine kleine sechzigjährige Alte von ausgesuchter Liebenswürdigkeit; Sidonie Rougon, die Schwester ihres Gatten, eine magere, süßliche Frau unbestimmbaren Alters, mit einem Gesicht wie aus weichem Wachs, das durch die fahle Farbe ihres Kleides noch erloschener wirkte; dann die Mareuils: der Vater, Herr de Mareuil – er hatte soeben die Trauer um seine Frau abgelegt –, ein großer, unbedeutender schöner Mann von ernsthaftem Wesen, der dem Kammerdiener Baptiste auffallend ähnlich sah, und die Tochter, „diese arme Louise“, wie man sie nannte, ein siebzehnjähriges schmächtiges, leicht buckliges Kind, das mit krankhafter Anmut ein weißes, rotgetupftes Foulardkleid trug; sodann eine ganze Anzahl würdiger Männer, reichlich mit Orden dekoriert, bekannte Persönlichkeiten, blaß und wortkarg; außerdem eine andere Gruppe, junge Leute, die Gesichter vom Laster gezeichnet, in tief ausgeschnittenen Westen; sie umringten fünf oder sechs Damen von erlesener Eleganz, unter denen die beiden Unzertrennlichen glänzten, die kleine Marquise d’Espanet ganz in Gelb und die blonde Frau Haffner in Lila. Auch Herr de Mussy, jener Reiter, dessen Gruß Renée nicht erwidert hatte, war zugegen, mit der erregten Miene eines Liebhabers, der seine Verabschiedung nahe fühlt. Und inmitten der langen Schleppen, die sich über den Teppich breiteten, tappten zwei Unternehmer, reichgewordene Maurermeister, Mignon und Charrier, mit denen Saccard am folgenden Tag ein Geschäft abschließen wollte, in ihren groben Stiefeln schwerfällig herum, die Hände auf dem Rücken, urkomisch in ihren Fracks.
Aristide Saccard, der nahe der Tür stand und in seinem gewohnten näselnden Ton mit seiner südländischen Lebhaftigkeit auf jene Gruppe ernster Männer einsprach, brachte es zuwege, gleichzeitig die ankommenden Gäste zu begrüßen. Er drückte ihnen die Hand, sagte ihnen Liebenswürdigkeiten. Klein, mit einem mageren, verschlagenen Gesicht, verbeugte er sich wie eine Marionette, und was an seiner gesamten hageren, listigen, schwärzlichen Erscheinung am meisten in die Augen fiel, war der rote Fleck des Bandes der Ehrenlegion, das er besonders breit trug.
Als Renée eintrat, erhob sich ein Gemurmel der Bewunderung. Sie war wirklich blendend schön. Über einem Tüllrock, der im Rücken mit einer Flut von Volants besetzt war, trug sie eine zartgrüne, mit breiter englischer Spitze umrandete seidene Tunika, von großen Veilchentuffs gerafft und gehalten; ein einziger Volant schmückte das Vorderteil des Rockes, auf dem durch Efeugirlanden verbundene Veilchenbuketts ein leichtes Mullgefältel festhielten. Kopf und Taille schwebten in köstlicher Anmut über den majestätischen Ausmaßen dieses Rockes, dessen Kostbarkeit etwas überladen wirkte. Bis an die Spitzen der Brüste ausgeschnitten, die Arme entblößt bis zu den Veilchenbuketts auf den Schultern, schien die junge Frau völlig unbekleidet ihrer Hülle von Tüll und Seide zu entsteigen, gleich einer jener Nymphen, deren Oberkörper heiligen Eichen entwächst; und ihr weißer Busen, ihr biegsamer Leib waren offensichtlich schon so glücklich über ihre halbe Freiheit, daß man jeden Augenblick darauf wartete, das Gewand allmählich herabgleiten zu sehen wie den Anzug einer Badenden, die sich an der eigenen Schönheit berauscht. Ihre hohe Frisur, ihr feines, zu einem goldenen Helm emporgekämmtes Haar, durch das sich ein mit Veilchen geschmückter Efeuzweig wand, betonte noch die Nacktheit, weil sie den Nacken frei ließ, auf den goldig schimmerndes Flaumhaar einen leichten Schatten warf. Um den Hals trug sie ein Edelsteingeschmeide von wunderbarem Glanz und über der Stirn eine Aigrette aus silbernen, mit Diamanten besetzten Halmen. So verharrte sie einige Augenblicke auf der Schwelle, hochaufgerichtet in ihrer herrlichen Toilette, die Schultern übersprüht von dem warmen Licht. Da sie rasch die Treppe herabgekommen war, atmete sie schnell. Ihre Augen, noch ganz erfüllt von den Schatten des Parc Monceau, blinzelten in diesem Meer jähen Lichts, was ihr das Zögernde einer Kurzsichtigkeit gab, das an ihr sehr reizvoll wirkte.
Als die kleine Marquise ihrer ansichtig wurde, erhob sie sich lebhaft, eilte auf sie zu, ergriff ihre beiden Hände, musterte sie von Kopf bis Fuß und flötete leise: „Ach, wie schön Sie sind, wie schön . . .“
Unterdessen war eine allgemeine Bewegung entstanden, alle Gäste kamen herbei, um „die schöne Frau Saccard“, wie man Renée in der Gesellschaft nannte, zu begrüßen. Sie reichte fast allen Herren die Hand. Dann umarmte sie Christine und erkundigte sich nach dem Befinden ihres Vaters, der nie in das Palais am Parc Monceau kam. Und so stand sie, lächelnd, nochmals mit einem Kopfneigen grüßend, die Arme sanft gerundet, vor dem Kreis der Damen, die neugierig den Halsschmuck und die Aigrette betrachteten.
Die blonde Frau Haffner vermochte der Versuchung nicht zu widerstehen; sie trat näher, musterte lange den Schmuck und sagte endlich in neidischem Ton: „Nicht wahr, das ist doch jenes Halsband und die Aigrette . . .?“
Renée nickte. Nun ergingen sich alle Frauen in Lobeserhebungen; die Schmuckstücke seien hinreißend, unvergleichlich; dann kamen sie mit neiderfüllter Bewunderung auf die Versteigerung bei Laure d’Aurigny zu sprechen, wo Saccard den Schmuck für seine Frau erstanden hatte; sie beklagten sich darüber, daß „diese Dirnen“ die schönsten Sachen an sich rissen, bald werde es für anständige Frauen keine Diamanten mehr geben. Und aus all ihren Klagen hörte man die Sehnsucht heraus, auf der eigenen nackten Haut eines jener Kleinodien zu fühlen, das ganz Paris am Halse irgendeiner berühmten Kokotte gesehen hatte und das ihnen vielleicht die schlüpfrigen Alkovengeschichten ins Ohr flüstern würde, bei denen die Träume der Damen von Welt so wohlgefällig verweilten. Sie kannten die hohen Preise, sie sprachen von einem wunderbaren Kaschmir, von herrlichen Spitzen. Die Aigrette hatte fünfzehntausend Francs gekostet, der Halsschmuck fünfzigtausend. Frau d’Espanet war ganz berauscht von diesen Zahlen. Sie suchte Saccard und rief ihm zu: „Kommen Sie doch her und lassen Sie sich beglückwünschen! Das nenne ich einen guten Ehemann!“
Aristide Saccard kam herbei, verbeugte sich, spielte den Bescheidenen. Doch sein grinsendes Gesicht verriet lebhafte Befriedigung. Und aus dem Augenwinkel sah er zu den beiden Bauunternehmern hinüber, den reichgewordenen Maurermeistern, die sich einige Schritte entfernt aufgepflanzt hatten und mit sichtlichem Respekt die Beträge von fünfzehn- und fünfzigtausend Francs zur Kenntnis nahmen.
In diesem Augenblick stützte sich Maxime, der wunderbar elegant in seinem eng anliegenden Frack, soeben eingetreten war, vertraulich auf die Schulter seines Vaters und sprach leise zu ihm wie zu einem Kameraden, wobei er ihn mit einem Blick auf die beiden Maurer aufmerksam machte. Saccard lächelte verhalten wie ein Schauspieler, dem Beifall gespendet wird.
Es kamen noch einige Gäste. Jetzt mochten mindestens dreißig Personen im Salon sein. Die Unterhaltung belebte sich wieder: in Augenblicken der Stille hörte man hinter den Wänden das leichte Klirren von Porzellan und Silberzeug. Endlich öffnete Baptiste eine Flügeltür und sprach voll Würde die geheiligten Worte: „Gnädige Frau, es ist angerichtet.“
Darauf begann langsam der Einzug in den Speisesaal. Saccard bot der kleinen Marquise den Arm; Renée nahm den eines alten Herrn, des Senators Baron Gouraud, vor dem alle Welt in Ehrfurcht erstarb; Maxime mußte Louise de Mareuil den Arm reichen; dann kamen die übrigen Gäste in langem Zug, und ganz zum Schluß die beiden Bauunternehmer mit baumelnden Armen.
Der Speisesaal war ein außerordentlich großer, viereckiger Raum, dessen glänzendes, dunkelgebeiztes, mit schmalen Goldleisten verziertes Getäfel aus Birnbaum bis zu Manneshöhe reichte. Die vier großen Wandflächen, offenbar für gemalte Stilleben vorgesehen, waren noch leer, weil der Hauseigentümer zweifellos vor einer lediglich der Kunst geltenden Ausgabe zurückschreckte. Man hatte sich mit einer tiefgrünen Samtbespannung begnügt. Die Möbel, Vorhänge und Portieren vom gleichen Stoff gaben dem Zimmer einen nüchternen, ernsten Charakter, darauf berechnet, allen Lichterglanz nur der Tafel zukommen zu lassen.
Und wirklich glich zu dieser Stunde die Tafel mitten auf dem großen dunkelgetönten Perserteppich, der das Geräusch der Schritte dämpfte, und umgeben von Stühlen, deren goldverzierte schwarze Lehnen sie mit einer dunklen Linie umrahmten, unter dem grellen Licht des Kronleuchters einem Altar, einem erleuchteten Katafalk, auf dessen blendend weißer Decke das Kristall und das Silber wie helle Flammen funkelten. Jenseits der geschnitzten Stuhllehnen war alles in Schatten getaucht, so daß man kaum das Wandgetäfel, ein großes, niedriges Büfett und ein paar schleppende Samtvorhänge wahrnahm.
Unwillkürlich wandten sich aller Augen zum Tisch zurück, um sich an seinem Glanz zu weiden. Ein wunderbarer mattsilberner Tafelaufsatz mit schimmernder Ziselierung nahm die Mitte der Tafel ein: er stellte eine Schar Faune dar, die flüchtenden Nymphen nachjagten, und über dieser Gruppe entquoll einem großen Füllhorn ein riesiger Strauß frischer Blumen, die in ganzen Büscheln herabhingen. An den beiden Tischenden standen ebenfalls mit Blumen gefüllte Vasen; zwei Kandelaber im Stil der Mittelgruppe, jeder einen dahineilenden Faun darstellend, der in einem Arm eine ohnmächtige Frau davontrug und mit dem andern einen zehnarmigen Leuchter emporhielt, vereinten den Glanz ihrer Kerzen mit dem strahlenden Licht des Kronleuchters. Zwischen diesen Hauptstücken waren symmetrisch große und kleine Wärmpfannen mit dem ersten Gang aufgereiht, flankiert von Muscheln, die die Nebengerichte enthielten, und getrennt durch Porzellankörbchen, Kristallschalen, flache Teller und hohe Kompottschüsseln, gefüllt mit jenem Teil des Desserts, der schon auf der Tafel zur Schau stand. Längs der Tellerreihe eine wahre Armee von Gläsern, Wein- und Wasserkaraffen, kleinen Salzfäßchen; alles Kristall war fein und leicht wie aus Musselin, ohne jeden Schliff und so durchsichtig, daß es keinen Schatten warf. Und der Mittelaufsatz und die beiden Kandelaber glichen Feuerspringbrunnen; Blitze liefen an den polierten Wärmepfannen entlang; die Gabeln, die Löffel, die Messer mit ihren Perlmuttergriffen glänzten wie Feuerstreifen; die Gläser schillerten in allen Regenbogenfarben, und inmitten dieses Funkenregens, dieses Feuermeers malten die Weinkaraffen rote Flecken auf das wie in Weißglut schimmernde Tischtuch.
Beim Eintreten hatten die Herren, die ihren Tischdamen zulächelten, den Ausdruck geheimer Glückseligkeit in den Zügen. Die Blumen brachten Frische in die schwüle Luft. Leichte Speisedünste mischten sich in den Duft der Rosen. Doch der herbe Krebsgeruch, das säuerliche Aroma der Zitronen herrschten vor.
Als dann alle Gäste ihre auf der Rückseite der Speisekarte vermerkten Namen gefunden hatten, gab es Stuhlrücken und ein großes Rauschen seidener Röcke. Die nackten, mit Diamanten besäten Frauenschultern, deren mattes Weiß durch die schwarzen Fräcke zu ihren Seiten noch besonders hervorgehoben wurde, fügten ihren milchigen Schimmer zum festlichen Glanz der Tafel. Das Mahl begann. Die Tischnachbarn lächelten einander zu, ihr halblautes Gespräch wurde nur unterbrochen vom gedämpften Klirren der Löffel. Baptiste versah das Amt des Haushofmeisters mit dem gewichtigen Ernst eines Diplomaten; außer den beiden Dienern des Hauses unterstanden ihm noch vier weitere Gehilfen, die er nur für die großen Diners heranzog. Bei jedem Gang, den er in Empfang nahm, um ihn im Hintergrund an einem Anrichtetisch aufzuteilen, gingen drei Bediente, jeder mit einer Schüssel in der Hand, lautlos um die Tafel herum und boten mit leiser Stimme die Gerichte an, wobei sie deren Namen nannten. Die anderen schenkten den Wein ein, sorgten für Brot und füllten die Karaffen. So ging das Aufund Abtragen der Vorspeisen und des ersten Ganges gemessen vor sich, ohne daß das perlende Lachen der Damen lebhafter geworden wäre.
Die Gäste waren zu zahlreich, als daß leicht eine allgemeine Unterhaltung hätte zustande kommen können. Beim zweiten Gang jedoch, als die Braten mit ihren Beilagen serviert wurden und die schweren Burgunderweine, Pomard und Chambertin, auf den Léoville und den Château-Lafitte folgten, nahm das Stimmengewirr zu, und schallendes Gelächter ließ das zarte Kristall erklingen.
Renée, an der einen Längsseite in der Mitte sitzend, hatte zu ihrer Rechten den Baron Gouraud, zu ihrer Linken Herrn Toutin-Laroche, einen ehemaligen Kerzenfabrikanten, jetzt Stadtrat, Direktor des Crédit viticole und Aufsichtsratsmitglied bei der Allgemeinen Marokkanischen Hafengesellschaft, einen hageren, beachtlichen Mann, den Saccard, der jenem gerade gegenüber, zwischen Frau d’Espanet und Frau Haffner, saß, mit schmeichelnder Stimme einmal „mein lieber Kollege“, ein andermal „unser großer Administrator“ nannte. Dann kamen die Männer der Politik: Herr Hupel de la Noue, ein Präfekt, der acht Monate des Jahres in Paris zu verbringen pflegte; drei Abgeordnete, darunter Herr Haffner mit seinem breiten Elsässergesicht; sodann Herr de Saffré, ein liebenswürdiger junger Mensch, Sekretär eines Ministers; Herr Michelin, Bürochef des Straßenbauamtes, und andere hohe Beamte. Herr de Mareuil, der ewig die Würde eines Deputierten anstrebte, machte sich breit vor dem Präfekten, um dessen Gunst er sich bewarb. Herr d’Espanet war nicht erschienen, er begleitete seine Frau niemals zu Gesellschaften. Die Damen der Familie saßen zwischen den einflußreichsten Persönlichkeiten. Seine Schwester Sidonie aber hatte Saccard für einen Vertrauensposten ausersehen, weil es galt, einen Sieg zu erringen: ihr Platz war weiter unten am Tisch zwischen den beiden Unternehmern, zu ihrer Rechten hatte sie Meister Charrier, zu ihrer Linken Meister Mignon. Frau Michelin, die Gattin des Bürochefs, eine hübsche rundliche Brünette, saß neben Herrn de Saffré, mit dem sie sich lebhaft, aber leise unterhielt. An den beiden Tafelenden hatte die Jugend Platz gefunden; Auditeure im Staatsrat, Söhne einflußreicher Väter, heranwachsende Millionäre, Herr de Mussy, der Renée verzweifelte Blicke zuwarf, Maxime zu seiner Rechten Louise de Mareuil, die ihn ganz für sich zu erobern schien. Allmählich begannen die beiden sehr laut zu lachen. Von ihnen gingen die ersten Heiterkeitsausbrüche aus.
Indessen fragte Herr Hupel de la Noue sehr höflich: „Werden wir das Vergnügen haben, Seine Exzellenz heute abend hier zu sehen?“
„Ich glaube nicht“, antwortete Saccard mit wichtiger Miene, hinter der sich geheimer Ärger verbarg. „Mein Bruder ist so sehr in Anspruch genommen! Er hat uns Herrn de Saffré, seinen Sekretär, geschickt, um sich entschuldigen zu lassen.“
Der junge Sekretär, den Frau Michelin energisch mit Beschlag belegte, hob den Kopf, als er seinen Namen hörte, und rief, in der Meinung angesprochen worden zu sein, auf gut Glück: „Ja, ja, um neun Uhr findet meines Wissens beim Siegelbewahrer eine Ministerkonferenz statt.“
Unterdessen fuhr Herr Toutin-Laroche, der unterbrochen worden war, so feierlich, als halte er Vortrag vor dem in gespanntem Schweigen lauschenden Rat der Stadt, in seiner Rede fort: „Die Ergebnisse sind ausgezeichnet. Diese städtische Anleihe bleibt einer der schönsten Finanzerfolge unserer Zeit. Ach, meine Herren . . .“
Doch hier wurde seine Stimme abermals von Gelächter übertönt, das plötzlich an einem Ende der Tafel ausbrach. Mitten aus diesem Heiterkeitssturm heraus hörte man die Stimme Maximes, der soeben eine Anekdote beendete: „Aber warten Sie doch, ich bin ja noch nicht fertig. Ein Chausseewärter hob die arme Amazone auf. Man behauptet, sie lasse ihm jetzt eine ausgezeichnete Erziehung geben, um ihn später zu heiraten. Sie will nicht, daß sich irgendein anderer Mann außer ihrem Ehegatten rühmen könnte, ein gewisses schwarzes Mal oberhalb ihres Knies gesehen zu haben.“
Das Gelächter brach von neuem los; Louise lachte aus vollem Halse, noch lauter als die Herren. Und ganz sacht schob sich, inmitten dieser Lachsalven, neben jedem Gast das ernste, blasse Gesicht eines Lakaien vor, der, wie taub gegen alles andere, mit leiser Stimme gebratene Wildentenscheibchen anbot.
Aristide Saccard war ungehalten über die geringe Aufmerksamkeit, die man Herrn Toutin-Laroche zollte. Um ihm zu zeigen, daß er ihm zugehört hatte, wiederholte er: „Die städtische Anleihe . . .“
Doch Herr Toutin-Laroche war nicht der Mann dazu, sich aus dem Konzept bringen zu lassen.
„Ach, meine Herren“, fuhr er fort, als sich das Gelächter gelegt hatte, „der gestrige Tag war ein großer Trost für uns, deren Geschäftsführung die Zielscheibe so vieler gemeiner Angriffe bildet. Der Magistrat wird beschuldigt, die Stadt in den Abgrund zu steuern, und – Sie sehen es alle – kaum schreibt die Stadt eine Anleihe aus, so bringt uns jedermann sein Geld, sogar diejenigen, die am meisten geschrien haben.“
„Sie haben Wunder vollbracht“, sagte Saccard. „Paris ist zur Hauptstadt der Welt geworden.“
„Ja, es ist wirklich erstaunlich“, unterbrach jetzt Herr Hupel de la Noue. „Denken Sie nur, daß selbst ich, ein alter Pariser, mich in meinem Paris nicht mehr zurechtfinde. Als ich gestern vom Hôtel de Ville zum Luxembourg gehen wollte, habe ich mich tatsächlich verlaufen. Es ist erstaunlich, erstaunlich!“
Es entstand eine Pause. All die ernsten Männer hörten jetzt zu.
„Die Umgestaltung von Paris“, redete Herr Toutin-Laroche weiter, „wird der Regierung zum Ruhm gereichen. Das Volk ist undankbar: es sollte dem Kaiser die Füße küssen. Noch heute morgen, als man von dem großen Erfolg dieser Anleihe sprach, habe ich im Stadtrat gesagt: Meine Herren, lassen wir diese Oppositionskrakeeler ruhig schreien; Paris auf den Kopf stellen heißt, es erst richtig zum Leben erwecken!ʻ “
Saccard lächelte und schloß dabei die Augen, als könne er so den Scharfsinn dieses Ausspruchs besser auskosten. Er beugte sich hinter dem Rücken von Frau d’Espanet zu Herrn Hupel de la Noue hinüber und sagte laut genug, um gehört zu werden: „Er ist wirklich geistreich!“
Während des ganzen Gesprächs über die öffentlichen Arbeiten in Paris hielt Meister Charrier den Hals vorgestreckt, als wolle er sich an der Unterhaltung beteiligen. Sein Kollege Mignon war unterdessen gänzlich von Frau Sidonie in Anspruch genommen, die ihm reichlich zu schaffen machte. Schon seit Beginn des Essens hatte Saccard die beiden Unternehmer heimlich beobachtet.
„Die Verwaltung“, sagte er jetzt, „hat von Anfang an so viel guten Willen vorgefunden! Jedermann wollte zu dem großen Werk beitragen. Ohne die reichen Aktiengesellschaften, die der Stadt zu Hilfe gekommen sind, hätte sie niemals so gut und so schnell arbeiten können.“
Dann wandte er sich um und fügte mit einer Art grober Schmeichelei hinzu: „Die Herren Mignon und Charrier könnten ein Lied davon singen. Sie hatten ihr gerüttelt Maß an Arbeit dabei und werden den entsprechenden Anteil an Ruhm ernten.“ Den reichgewordenen Maurermeistern ging diese Phrase sehr glatt ein.
Mignon, zu dem Frau Sidonie gerade in geziertem Ton sagte: „Ach, mein Herr, Sie wollen mir schmeicheln; nein, Rosa wäre doch zu jugendlich für mich . . .“, unterbrach sie mitten im Satz, um Saccard zu entgegnen: „Sie sind allzu gütig; wir haben unser Glück dabei gemacht.“
Doch Charrier hatte mehr Schliff. Er leerte sein Glas Pomard und brachte die Erwiderung zustande: „Die Arbeiten für Paris haben dem Arbeiter Brot gegeben.“
„Fügen wir hinzu“, warf Herr Toutin-Laroche ein, „daß sie den finanziellen und industriellen Unternehmungen einen großartigen Aufschwung gebracht haben.“
„Und vergessen Sie nicht die künstlerische Seite der Sache; die neuen Straßen sind wahrhaft imposant“, bemerkte Herr Hupel de la Noue, der sich etwas auf sein Kunstverständnis einbildete. „Ja, ja, das ist eine schöne Leistung“, murmelte Herr de Mareuil, nur um etwas zu sagen.
„Was die Kosten betrifft“, erklärte gewichtigen Tones der Abgeordnete Haffner, der den Mund nur bei besonderen Gelegenheiten aufzutun pflegte, „so werden unsere Kinder dafür aufkommen, das ist nur recht und billig.“
Und da er bei diesen Worten zu Herrn de Saffré hinübersah, mit dem die anmutige Frau Michelin seit kurzem zu schmollen schien, wiederholte der junge Sekretär, um zu beweisen, daß er dem Gespräch gefolgt war:
„Das ist wirklich nur recht und billig.“
Damit hatten alle aus der Gruppe der ernsten Männer, die den Mittelpunkt der Tafel bildete, ihre Meinung beigesteuert. Herr Michelin, der Bürochef, lächelte und wiegte den Kopf hin und her. Das war gewöhnlich seine Art, sich an der Unterhaltung zu beteiligen; er hatte für alles ein besonderes Lächeln, für den Gruß, für die Antwort, für die Zustimmung, für den Dank und für das Abschiednehmen – eine ganz hübsche Sammlung, und sein Lächeln enthob ihn fast immer der Notwendigkeit zu reden, was er zweifellos höflicher und für seine Beförderung vorteilhafter fand.
Ein anderer hatte gleichfalls geschwiegen, der Baron Gouraud, der mit gesenkten Augenlidern langsam kaute – wie ein Ochse. Bis jetzt schien er völlig in den Anblick seines Tellers versunken zu sein. Renée hatte für ihre kleinen Aufmerksamkeiten nur hin und wieder ein leichtes Knurren der Zufriedenheit von ihm vernommen. Um so erstaunter war man, als er jetzt den Kopf hob, sich die fettigen Lippen abwischte und erklärte: „Ich bin Hausbesitzer, und wenn ich eine Wohnung instandsetzen, neu streichen und tapezieren lasse, so steigere ich die Miete.“
Herrn Haffners Worte: „Unsere Kinder werden dafür aufkommen“, hatten den Senator munter werden lassen. Alle klatschten leicht in die Hände, und Herr de Saffré rief: „Ausgezeichnet, ausgezeichnet! Gleich morgen kommt dieser Ausspruch in die Blätter!“
„Sie haben wirklich recht, meine Herren, wir leben in einer guten Zeit“, sagte, gleichsam als Abschluß, der Maurermeister Mignon mitten in das Lächeln und die Bewunderung hinein, die die Worte des Barons hervorgerufen hatten, „ich kenne so manchen, der ein hübsches Vermögen dabei gemacht hat. Sehen Sie, alles ist schön und gut, wenn man dabei verdient.“
Diese letzten Worte ließen die ernsten Männer erstarren. Die Unterhaltung brach plötzlich ab, und jeder schien es zu vermeiden, seinen Nachbarn anzusehen. Die Äußerung des Maurers hatte die Herren so jählings getroffen wie der Steinwurf des Bären. Michelin, der gerade mit liebenswürdiger Miene Saccard angeblickt hatte, hörte auf zu lächeln, voller Angst, es habe eine Sekunde lang den Anschein haben können, als beziehe er die Worte des Unternehmers auf den Hausherrn. Dieser warf Frau Sidonie einen Blick zu, die erneut Mignon in Beschlag nahm, indem sie ihn fragte: „Sie lieben also die rosa Farbe, Herr Mignon?“ Jetzt machte Saccard Frau d’Espanet ein weitschweifiges Kompliment; sein schwärzliches, verschlagenes Gesicht berührte dabei fast die milchweiße Schulter der jungen Frau, die sich kichernd in ihren Stuhl zurücklehnte.
Man war beim Dessert angelangt. Lebhafter als zuvor eilten die Lakaien um den Tisch. Während die Tafel noch mit weiteren Früchten und Näschereien versehen wurde, trat eine Pause ein. An jenem Ende, wo Maxime saß, wurde das Lachen immer fröhlicher; man hörte Louises spitzes Stimmchen sagen: „Ich versichere Ihnen, daß Sylvia in ihrer Rolle als Dindonnette ein blaues Seidenkleid trug“; und eine andere kindliche Stimme ergänzte: „Ja, aber es war mit weißen Spitzen garniert!“ Es war heiß im Saal. Die nun rosiger gewordenen Gesichter hatten den weichen Ausdruck innigsten Wohlbehagens. Zwei Lakaien machten die Runde um die Tafel und gossen Alicante und Tokaier ein.
Schon seit Beginn des Diners schien Renée zerstreut zu sein. Sie erfüllte ihre hausfraulichen Pflichten mit einem mechanischen Lächeln. Bei jedem Heiterkeitsausbruch, der von dem Tischende herkam, wo Maxime und Louise Seite an Seite wie zwei gute Kameraden miteinander scherzten, schickte sie einen funkelnden Blick hinüber. Sie langweilte sich. Die ernsthaften Männer waren ihr unerträglich. Frau d’Espanet und Frau Haffner warfen ihr verzweifelte Blicke zu.
„Und wie lassen sich die bevorstehenden Wahlen an?“ fragte Saccard völlig unvermittelt Herrn Hupel de la Noue.
„Nun, ausgezeichnet“, antwortete dieser mit einem Lächeln. „Nur habe ich noch keine Kandidatenliste für mein Departement. Das Ministerium scheint noch zu zögern.“
Herr de Mareuil, der Saccard mit einem raschen Blick dafür dankte, daß er dieses Thema angeschnitten hatte, schien auf glühenden Kohlen zu sitzen. Er errötete leicht und verbeugte sich mehrmals verlegen, als der Präfekt, jetzt ihm zugewandt, fortfuhr: „Ich habe auf dem Lande wiederholt von Ihnen gehört, Herr de Mareuil. Ihre großen Besitzungen bringen es mit sich, daß Sie dort zahlreiche Freunde haben, und man weiß, wie sehr. Sie dem Kaiser ergeben sind. Sie haben also recht gute Aussichten.“
„Papa, nicht wahr, die kleine Sylvia hat 1849 in Marseille Zigaretten verkauft?“ rief in diesem Augenblick Maxime vom Tafelende herüber.
Und da Aristide Saccard so tat, als habe er nicht gehört, sagte der junge Mann etwas leiser: „Mein Vater hat sie gut gekannt.“ Gekicher entstand. Unterdessen hatte, während sich Herr de Mareuil noch immer nach allen Seiten verbeugte, Herr Haffner in feierlichem Ton weitergesprochen: „In diesen Zeiten eigennütziger Demokratie ist Treue zum Kaiser die einzig wahrhafte Tugend, der einzige wirkliche Patriotismus. Wer den Kaiser liebt, liebt Frankreich. Es würde uns mit aufrichtiger Freude erfüllen, wenn Sie unser Kollege würden.“
„Herr de Mareuil wird den Sieg erringen“, sagte nun seinerseits Herr Toutin-Laroche. „Die großen Vermögen müssen sich um den Thron scharen.“
Jetzt hielt Renée es nicht mehr aus. Auch die Marquise ihr gegenüber unterdrückte ein Gähnen. Und als Saccard gerade wieder das Wort ergreifen wollte, kam ihm seine Frau mit einem reizenden Lächeln zuvor: „Ich bitte Sie, mein Freund, haben Sie ein wenig Mitleid mit uns und lassen Sie die böse Politik beiseite.“