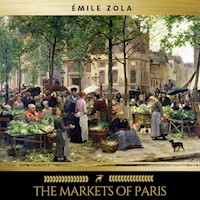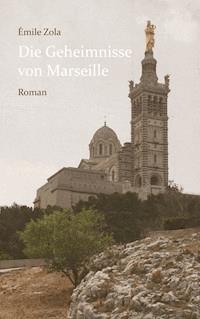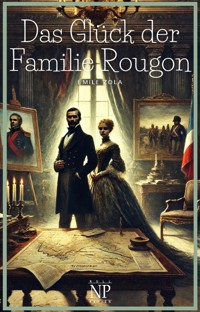Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rougon-Macquart
- Sprache: Deutsch
"Die Beute" (oder auch "Die Treibjagd") ist Émile Zolas zweiter Roman aus dem Rougon-Macquart-Zyklus. Er entstand zwischen 1871 und 1872 und liefert eine Darstellung der neureichen Gesellschaft im 2. Kaiserreich. Die Handlung setzt ein an dem Punkt, an dem der Vorgängerroman "Das Glück der Familie Rougon" endet. Nach dem politischen Aufstieg von Eugene Rougon will sein jüngerer Bruder Aristide dessen Beispiel folgen. Eugene erklärt sich bereit, seinen Bruder zu unterstützen. Um seine ehemals republikanische Gesinnung zu verbergen, nennt sich Aristide von nun an Aristide Saccard. Durch geschickte Manipulation und Heirat "nach oben" wird er zu einem habgierigen Grund- und Bodenspekulanten. Zolas Gesellschaftskritik ergeht sich in einer bitteren Betrachtung über die Heuchelei und Unmoral der neureichen Gesellschaft, die sich letztlich so wenig unmenschlich zeigt wie der aristokratische Stand. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Émile Zola
Die Beute
Émile Zola
Die Beute
(La curée)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Armin Schwarz EV: B. Harz, Berlin; Wien, 1923 2. Auflage, ISBN 978-3-954183-41-8
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die Bände des Zyklus der Rougon-Macquart
Autor
Werksauszug
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Das Buch
»Die Beute« (oder auch »Die Treibjagd«) ist Émile Zolas zweiter Roman aus dem Rougon-Macquart-Zyklus. Er entstand zwischen 1871 und 1872 und liefert eine Darstellung der neureichen Gesellschaft im 2. Kaiserreich.
Die Handlung setzt ein an dem Punkt, an dem der Vorgängerroman »Das Glück der Familie Rougon« endet. Nach dem politischen Aufstieg von Eugene Rougon will sein jüngerer Bruder Aristide dessen Beispiel folgen. Eugene erklärt sich bereit, seinen Bruder zu unterstützen.
Um seine ehemals republikanische Gesinnung zu verbergen, nennt sich Aristide von nun an Aristide Saccard. Durch geschickte Manipulation und Heirat »nach oben« wird er zu einem habgierigen Grund- und Bodenspekulanten.
Zolas Gesellschaftskritik ergeht sich in einer bitteren Betrachtung über die Heuchelei und Unmoral der neureichen Gesellschaft, die sich letztlich so wenig unmenschlich zeigt wie der aristokratische Stand.
*
Informationen über Gratisangebote und Neuveröffentlichungen unter:
www.null-papier.de/newsletter
Die Bände des Zyklus der Rougon-Macquart
Das Glück der Familie Rougon (La fortune des Rougon 1871)
Die Beute (La curée 1871)
Der Bauch von Paris (Le ventre de Paris 1873)
Die Eroberung von Plassans (La conquête de Plassans 1874)
Die Sünde des Abbé Mouret (La faute de l’Abbé Mouret 1875)
Seine Exzellenz Eugene Rougon (Son excellence Eugène Rougon 1876)
Der Totschläger (L’Assommoir 1877)
Ein Blatt Liebe (Une page d’amour 1878)
Nana (Nana 1880)
Ein feines Haus (Pot-Bouille 1882)
Das Paradies der Damen (Au bonheur des dames 1883)
Die Freude am Leben (La joie de vivre 1884)
Germinal (Germinal 1885)
Das Werk (L’Œuvre 1886)
Die Erde (La terre 1887)
Der Traum (Le rêve 1888)
Die Bestie im Menschen / Das Tier im Menschen (La bête humaine 1890)
Das Geld (L’argent 1891)
Der Zusammenbruch (La débâcle 1892)
Doktor Pascal (Le docteur Pascal 1893)
Autor
Émile François Zola (Geb. 2. April 1840 in Paris; Gest. 29. September 1902 ebenda) war ein französischer Schriftsteller und Journalist.
Zola gilt als einer der großen französischen Romanciers des 19. Jahrhunderts und als Leitfigur und Begründer der gesamteuropäischen literarischen Strömung des Naturalismus. Zugleich war er ein sehr aktiver Journalist, der sich auf einer gemäßigt linken Position am politischen Leben beteiligte.
Sein »Artikel J’accuse...!« (Ich klage an...!) anlässlich der Dreyfus-Affäre war ein wichtiges Element bei der schließlichen Rehabilitierung des fälschlich wegen Landesverrats verurteilten Offiziers Alfred Dreyfus.
Émile Zola wurde in Paris als Sohn des italienisch-österreichischen Eisenbahningenieurs Francesco Zola (eigtl. Zolla) geboren. Seine Mutter, Émilie Aurélie Aubert (1819--1880), war Französin.
Zola wuchs in Aix-en-Provence auf. In Aix war Zola mit dem späteren großen Maler Paul Cézanne und dem späteren Bildhauer Philippe Solari befreundet.
Sein Durchbruch wurde 1867 der Roman »Thérèse Raquin«, der eine spannende Handlung um die zur Ehebrecherin und Mörderin werdende Titelheldin mit einer ungeschönten Schilderung des Pariser Kleinbürgertums verbindet. Das Vorwort zur zweiten Auflage 1868, in dem Zola sich gegen seine gutbürgerlichen Kritiker und ihren Vorwurf der Geschmacklosigkeit verteidigt, wurde zum Manifest der jungen naturalistischen Schule, zu deren Oberhaupt Zola nach und nach avancierte.
Zu Zolas Lebzeiten am erfolgreichsten war »La Débâcle« (Der Zusammenbruch, 1892), dessen Handlung vor dem Hintergrund des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 und der blutig unterdrückten Pariser Commune spielt.
Heute noch gelesen werden vor allem die beiden Romane »L’Assommoir« (Der Totschläger, 1877), wo am Schicksal einer Wäscherin und ihrer Familie sehr eingängig die Auswirkungen des Alkoholismus im beengten und tristen Pariser Unterschichtenmilieu beschrieben werden, und »Germinal« (1885), das die dramatische Geschichte eines Bergarbeiterstreiks im Kräftefeld der wirtschaftlichen und ideologischen Antagonismen der Zeit darstellt.
Mehrere der Romane, unter anderem »Thérèse Raquin«, »Nana«, »L’Assommoir« und »Germinal«, wurden bald nach ihrem Erscheinen zu erfolgreichen Theaterstücken verarbeitet und später auch verfilmt.
Zola starb zu Beginn der Heizperiode im Herbst 1902 durch eine Kohlenmonoxidvergiftung in seiner Pariser Wohnung. Je nach politischem Standpunkt wurden Gerüchte über einen Selbstmord oder Mord geschürt. Eine Untersuchungskommission machte Experimente mit dem Ofen und kam zu dem Schluss, dass es sich um einen Unfall handelte. 50 Jahre später wurde berichtet, dass ein Schornsteinfeger, der Mitglied der nationalistischen »Ligue des Patriotes« war, einem Gleichgesinnten gegenüber angegeben habe, den Kamin verstopft zu haben.
Werksauszug
Das Glück der Familie Rougon (La fortune des Rougon 1871)
Der Bauch von Paris (Le ventre de Paris 1873)
Die Eroberung von Plassans (La conquête de Plassans 1874)
Seine Exzellenz Eugene Rougon (Son excellence Eugène Rougon 1876)
Der Totschläger (L’Assommoir 1877)
Nana (Nana 1880)
Das Paradies der Damen (Au bonheur des dames 1883)
Germinal (Germinal 1885)
Die Erde (La terre 1887)
Die Bestie im Menschen / Das Tier im Menschen (La bête humaine 1890)
Der Zusammenbruch (La débâcle 1892)
Doktor Pascal (Le docteur Pascal 1893)
I.
Bei der Heimkehr war das Gedränge der längs des Teichufers zurückfahrenden Wagen so stark, daß die Equipage im Schritt fahren mußte. Einen Moment lang war das Gewirr so arg, daß dieselbe anzuhalten gezwungen war.
Langsam sank die Sonne an dem Oktoberhimmel hinab, der von hellgrauer Farbe und an seinem Rande von leichten Wolken gestreift war. Ein letzter Strahl, der durch das ferne Dickicht am Wasserfall auf die Fahrstraße fiel, hüllte die lange Reihe der regungslos verharrenden Wagen in ein mattes, rötliches Licht. Die goldschimmernden Lichter und hellen Blitze, welche die Räder warfen, schienen an das strohgelbe Unterteil der Kalesche festgebannt, in deren dunkelblauen Feldern sich einzelne Stücke der umgebenden Landschaft widerspiegelten. Von dem rötlichen Lichte ganz umflossen, welches sie von rückwärts erhielten und die Messingknöpfe ihrer in faltenloser Glätte über den Sitz zurückgelegten Überröcke schimmern machte, verharrten Kutscher und Kammerdiener in ihrer dunkelblauen Livrée, ihren ockerfarbenen Beinkleidern und gelb und schwarz gestreiften Westen steif, gelassen und ernst auf ihrem erhöhten Sitze, wie es sich für die Dienstleute eines guten Hauses geziemt, die ein Wagengedränge nicht aus der Fassung zu bringen vermag. Ihre mit einer schwarzen Kokarde versehenen Hüte verrieten viel Würde. Nur die Pferde, herrliche Braune, zeigten eine große Ungeduld.
»Sieh ’mal!« sagte Maxime; »dort unten, in dem Coupé, sitzt Laura d’Aurigny. -- Sieh doch, Renée!«
Renée richtete sich ein wenig empor, wobei sie die Augen mit einer allerliebsten Grimasse zusammenkniff, um ihre schwache Sehkraft etwas zu unterstützen.
»Ich dachte, sie sei durchgebrannt«, erwiderte sie. »Sie scheint die Farbe ihrer Haare gewechselt zu haben, wie?«
»Ja«, bemerkte Maxime lachend; »ihr neuer Liebhaber mag die rote Farbe nicht.«
Nach vorne geneigt, mit auf dem niedrigen Wagenschlag ruhender Hand blickte Renée in die angedeutete Richtung, nachdem sie das traurige Sinnen von sich geschüttelt, in welchem sie wohl über eine Stunde versunken gewesen, während sie wie in einem Krankenstuhle, in den weichen Kissen ihres Wagens gelegen. Über dem mit einer Tunique, einem Vorderbesatz und breiten gepreßten Falten besetzten grauseidenen Kleide trug sie einen kurzen Paletot aus weißem Tuch mit grauen Überschlägen, welcher ihr ein vornehm-keckes Aussehen verlieh, während ihre Haare, deren blaßgelbe Farbe am ehesten mit der der Butter zu vergleichen war, von dem mit bengalischen Rosen besetzten kleinen Hütchen kaum bedeckt wurden. Sie fuhr fort, gleich einem kecken Knaben mit den Augen zu zwinkern, wobei sich eine Falte über ihre glatte Stirne legte und die Oberlippe hervortrat wie bei einem schmollenden Kinde. Da sie schlecht sah, nahm sie ihr in Schildpatt gefaßtes Binocle, wie es Männer zu tragen pflegen, hervor und es in der Hand haltend, ohne es auf die Nase zu setzen, betrachtete sie gemächlich, mit vollkommen ruhiger Miene die dicke Laura d’Aurigny.
Noch immer kamen die Wagen nicht vorwärts. Inmitten der langen, dunkeln Linie, welche die Equipagen bildeten, die sich an diesem Herbstnachmittage überaus zahlreich im Gehölz eingefunden hatten, erglänzten die Ecke eines Spiegels, das Gebiß eines Pferdes, der silberne Griff einer Laterne, die Tressen eines auf erhöhtem Sitze thronenden Lakaien. Hier und dort gewahrte man in einem offenen Landauer ein Stück Stoff, ein Stück Frauen-Toilette aus Sammt oder Seide. Allmählich hatte sich eine große Stille über dieses regungslos gewordene Gewirr herniedergesenkt und man vernahm vom Wagen aus das Gespräch der Fußgänger. Man tauschte Blicke mit einander von einem Wagen zum andern; doch sprach Niemand ein Wort inmitten der allgemeinen Erwartung, welche bloß von dem Reiben der Geschirre und dem Stampfen der Pferdehufe unterbrochen wurde. In der Ferne erstarben die verworrenen Stimmen des Gehölzes.
Trotz der vorgerückten Saison war ganz Paris da: die Herzogin von Sternich in ihrer Kalesche auf acht Federn; Frau von Lauwerens in einer tadellos bespannten Victoria; die Baronin von Meinhold in einem entzückenden braunroten Cab; die Comtesse Vanska mit ihren Ponyschecken; Frau Daste und ihre herrlichen Rappen; Frau von Guende und Frau Teissière im Coupé; die kleine Sylvia in einem dunkelblauen Landauer. Weiterhin Don Carlos in Trauer mit seiner feierlichen, altmodischen Livrée; Selim Pascha mit seinem Fez und ohne seinen Erzieher; die Herzogin von Rozan in einem kleinen Coupé, mit ihrer weiß bepuderten Dienerschaft; der Graf von Chibray im Dog-Cart; Herr Simpson in tadellosem Jagdwagen, sowie die ganze amerikanische Kolonie. Und zum Schluß zwei Akademiker im Fiaker.
Endlich konnten sich die ersten Wagen in Bewegung setzen und allmählich, einer nach dem andern, kam die ganze Linie ins Rollen. Es war wie das Erwachen aus einem Traum. Tausend tanzende Lichter sprühten auf, blitzend drehten sich die Räder und die von den Pferden geschüttelten Geschirre sandten Funken nach allen Richtungen. Über den Boden und die Baumstämme glitten spiegelnde Flächen dahin. Dieses Geräusch der Räder und Pferdegeschirre, das Schimmern der lackirten Wagenwände, in welchen sich die sinkende Sonne spiegelte, die heiteren Töne der reichen Livréen und der durch die Kutschenschläge sichtbaren prächtigen Toiletten, -- all’ Dies versank sozusagen in einem fortgesetzt dumpfen Getöse, welchem das Stampfen der Pferdehufe etwas Taktmäßiges verlieh. Und so zog die Wagenreihe unter demselben Geräusch, bei demselben Licht, ohne Unterbrechung dahin, als würden die ersten Wagen die übrigen nach sich ziehen.
Renée war der leichten Erschütterung des sich wieder in Bewegung setzenden Wagens gefolgt und ihr Binocle sinken lassend, lehnte sie sich von Neuem in die weichen Kissen zurück. Ein wenig fröstelnd zog sie einen Teil des Bärenfells über ihre Kniee, welches das Innere des Wagens wie mit weißer Seide erfüllte. Ihre feinbeschuhten Hände verschwanden in den langen, krausen Haaren des Fells. Ein leichter Wind hatte sich erhoben. Der laue Oktobernachmittag, der dem Bois etwas Frühlingsartiges verlieh und die vornehmen Damen verleitet hatte, in offenem Wagen auszufahren, drohte mit einem empfindlich kühlen Abend zu enden.
Eine Weile verharrte die junge Frau in sich zusammengekauert, die angenehme Wärme ihrer Ecke genießend und sich dem wohltuenden Gefühl überlassend, welches diese sich um sie her drehenden Räder in ihr erregten. Dann aber wendete sie sich zu Maxime, der kritischen Auges in aller Ruhe die Frauen entkleidete, die sich in den zahllosen Wagen seinen Blicken darboten.
»Ist es wahr«, fragte sie, »daß Du diese Laura d’Aurigny hübsch findest? Ihr habt sie ja neulich, als man von dem Verkaufe ihrer Diamanten sprach, in den Himmel gehoben!... Beiläufig, Du hast das Halsband und die Haarkrone nicht gesehen, welche Dein Vater bei diesem Verkaufe für mich erstand?«
»Ja, er macht seine Sache gut«, sagte Maxime mit einem häßlichen Lachen, ohne auf ihre Frage zu antworten. »Er bringt es zu Wege, Laura’s Schulden zu bezahlen und seiner Frau Diamanten zu schenken.«
Die junge Frau zuckte leicht mit den Schultern.
»Taugenichts!« murmelte sie lächelnd.
Der junge Mann aber hatte sich nach vorne gebeugt, um mit den Augen einer Dame zu folgen, deren grüne Toilette sein Interesse erweckte und Renée blickte mit zurückgelehntem Kopfe und halb geschlossenen Augen lässig um sich, ohne etwas zu sehen. Zur Rechten glitten Büsche und niedrige Hecken mit roten und gelben Blättern und verdorrenden Zweigen an ihr vorüber, zuweilen auch, auf dem für die Reiter reservierten Wege schlanke Herren, deren Pferde im Dahinsprengen feine Staubwolken aufwirbelten. Zur Linken, am Fuße der abfallenden und mit Sträuchern und Blumen bestandenen Rasenflächen lag der Teich regungslos, spiegelglatt, ohne jede Falte da, als hätte der Gärtner mit der Harke seine Grenzen gezogen. Am jenseitigen Rande dieser Kristallfläche sah man die beiden Inseln, zwischen welchen die sie verbindende Brücke wie ein grauer Balken erschien und deren Bäume sich wie eine Theaterdekoration von dem bleichen Himmel abhoben, während der Wasserspiegel die Äste derselben gleich einem gewandt angebrachten Vorhange erscheinen ließ. Dieser Winkel der Natur, der an eine frisch gestrichene Kulisse gemahnte, schwamm in leichtem Schatten, in einem bläulichen Dunst, der den köstlichen Reiz, die liebenswürdige Täuschung noch erhöhte. Auf dem anderen Ufer funkelte und glitzerte das Inselschloß gleich einem neuen Spielzeug, als hätte es gestern einen neuen Anstrich erhalten, während die mit gelbem Sand bestreuten Wege, die engen Gartenalleen, die sich über die Rasenflächen schlängelten und sich längs des Teiches hinzogen, dessen Uferränder mit einem Eisengitter umfriedet waren, sich zu dieser Stunde von dem zarten Grün des Wassers und des Rasens seltsam abhoben.
Renée, die an all’ die wohlberechneten Schönheiten dieses Anblickes gewöhnt war und sich jetzt willenlos ihren Träumereien hingab, hatte die Lider ganz über die Augen gesenkt und sah nur mehr das Spiel der schlanken Finger, die die langen Haare des Bärenfells um sich wickelten. Doch wieder trat mit einem Ruck ein kleiner Aufenthalt ein, der die Wagen für einen Moment anzuhalten zwang. Sie hob den Kopf und begrüßte mit einem Neigen desselben zwei junge Frauen, die neben einander behaglich ausgestreckt, in einer herrlichen Equipage lagen, die mit gedämpftem Rollen vom Teichrand abwich, um sich durch eine Seitenallee zu entfernen. Die Marquise von Espanet, deren Gatte, Flügeladjutant des Kaisers, sich zur Entrüstung des schmollenden Adels dem herrschenden Regime angeschlossen hatte, war eine der hervorragendsten Damen der vornehmen Welt unter dem zweiten Kaiserreich; die andere, Frau Haffner, hatte einen ungeheuer reichen Industriellen aus Colmar geheiratet, der unter dem Kaiserreich zum Politiker wurde. Renée, die die beiden Unzertrennlichen, wie man sie mit schlauer Miene nannte, noch aus der Pensionszeit kannte, bezeichnete sie nur mit ihren Taufnamen Adeline und Susanne, und als sie nach dem begrüßenden Lächeln sich wieder zurücklehnen wollte, ließ sie das Lachen Maxime’s diesem den Kopf wieder zuwenden.
»Nein, ich bin traurig, lache nicht, es ist Ernst«, sagte sie, als sie sah, daß der junge Mann sie spöttisch betrachte, belustigt über ihre sinnende Haltung.
»Wir haben also einen großen Kummer! Wir sind eifersüchtig?« fragte er mit komischer Betonung.
Sie schien im höchsten Grade überrascht.
»Ich?« fragte sie. »Weshalb sollte ich eifersüchtig sein?«
Und mit verächtlicher Miene, als würde sie sich mit einem Male erinnern, fügte sie hinzu:
»Ach ja! Die dicke Laura! Ich dachte gar nicht mehr an sie. Wenn, wie Ihr es mich glauben machen wollt, Aristide die Schulden dieser Person bezahlt und ihr derart eine Reise nach dem Auslands erspart hat, so beweist das bloß, daß er sein Geld nicht in dem Maße liebt, wie ich gemeint. Dies wird ihn wenigstens wieder bei den Damen in Gunst bringen... Ich beschränke ihn in nichts, den teuren Mann.«
Dabei lächelte sie und die Worte »den teuren Mann« sprach sie in einem Tone freundschaftlicher Gleichgültigkeit. Dann wurde sie wieder sehr traurig und mit dem verzweifelten Blick solcher Frauen um sich schauend, die nicht mehr wissen, welche Dinge ihnen noch Zerstreuung bieten können, murmelte sie:
»Oh, ich wollte schon... Doch nein, ich bin nicht eifersüchtig, nicht im entferntesten eifersüchtig.«
Unsicher hielt sie inne, um dann plötzlich hinzuzufügen:
»Weißt Du, ich langweile mich!«
Darauf schwieg sie mit zusammengekniffenen Lippen still. Immer noch rollten die Wagen in gleichmäßigem Tempo längs des Teiches dahin, mit einem eigentümlichen Geräusch, das dem eines seinen Wasserfalles gleicht. Nunmehr erhoben sich zur Linken, zwischen dem Teich und der Fahrstraße, kleine grüne Bäume mit schlanken, dünnen Stämmen, die an Säulenbündel erinnerten. Zur Rechten hatten die Gebüsche und niedrigen Hecken aufgehört; das Gehölz öffnete sich zu breiten Rasenflächen, zu einem mächtigen grünen Teppich, nur hier und dort mit einer Baumgruppe bestanden. Diese leicht gewellten grünen Flächen folgten einander bis zur Porte de la Muette, deren niedriges Gitter man gleich einem schwarzen Spitzenwerk schon von weitem emporragen sah. Auf den Abhängen, an solchen Stellen, wo zwei Wellenzüge des Hügellandes sich kreuzten, war der Rasen ganz blau. Starr blickte Renée vor sich hin, als brächte diese Erweiterung des Horizontes, diese von dem Abendtau benetzten Wiesenflächen sie noch deutlicher zum Bewußtsein der Leere ihres Daseins.
Nach einer Weile wiederholte sie mit dem Ausdrucke dumpfen Zornes:
»Oh! ich langweile mich, langweile mich zum Sterben!«
»Du bist heute gar nicht heiter«, sagte Maxime ruhig. »Du hast wohl wieder Deine Nervenzustände?«
Von Neuem warf sich die junge Frau in die Kissen zurück.
»Ja, ich habe meine Nervenzustände«, erwiderte sie trocken.
Darauf schlug sie eine mütterliche Saite an.
»Ich beginne alt zu werden, mein liebes Kind; bald werde ich meine wohlgezählten dreißig Jahre haben. Das ist schrecklich. Ich finde an gar nichts mehr Vergnügen... Mit zwanzig Jahren kannst Du freilich nichts wissen...«
»Hast Du mich mitgenommen, um eine Beichte abzulegen?« unterbrach sie der junge Mann. »Das würde lang dauern.«
Sie nahm diese freche Bemerkung mit einem matten Lächeln hin, wie die Ungezogenheit eines verhätschelten Kindes, dem Alles erlaubt ist.
»Du hast allen Grund, um Dich zu beklagen«, fuhr Maxime fort. »Für Deine Toilette gibst Du jährlich über hunderttausend Francs aus. Du bewohnst ein glänzendes Hotel, hast herrliche Pferde, Deine Launen sind Gesetze und über jede neue Toilette, die Du anlegst, berichten die Zeitungen wie über ein Ereignis von höchster Wichtigkeit. Die Frauen beneiden Dich, die Männer gäben zehn Jahre ihres Lebens darum, wenn sie Dir die Fingerspitzen küssen dürften... Hab’ ich Recht?«
Sie nickte zustimmend mit dem Kopfe, ohne eine Antwort zu geben und gesenkten Blickes fuhr sie fort, mit den Fingern durch die langen Haare des Bärenfells zu streichen.
»Sei nicht so bescheiden«, nahm Maxime von Neuem auf; »gestehe rund heraus, daß Du eine der Säulen des zweiten Kaiserreiches bist. Wenn man unter sich ist, so kann man unbehindert über diese Dinge sprechen. Überall, in den Tuilerien, bei den Ministern, bei den einfachen Millionären, in der Tiefe und in der Höhe, -- herrschest Du unbeschränkt. Es gibt kein Vergnügen, welches Du nicht genossen hättest und wenn ich den Mut hätte, wenn die Achtung, die ich Dir schuldig bin, mich nicht zurückhielte, so würde ich sagen...«
Lachend hielt er während einiger Sekunden inne, um dann rückhaltslos hinzuzufügen:
»So würde ich sagen, daß Du von allen Früchten verkostet hast.«
Sie zuckte mit keiner Wimper.
»Und Du langweilst Dich!« Hub der junge Mann mit komischer Hast von neuem an. »Das ist ja himmelschreiend! Was willst Du denn? Wovon träumst Du?«
Sie zuckte mit den Achseln, wie um anzudeuten, daß sie es selbst nicht wisse. Obschon sie den Kopf gesenkt hielt, sah Maxime, daß sie ernst und düster vor sich hinblicke, so daß er es für geraten hielt zu schweigen. Er beobachtete die Wagenreihe, die am Teichende angelangt, sich auflöste und zu verbreitern begann, den weiten Raum ganz erfüllend. Die sich jetzt freier bewegenden Wagen wendeten in tadellosen Kurven und der raschere Hufschlag der Pferde erklang lauter auf der harten Erde.
Die Equipage, die jetzt einen weiten Bogen beschrieb, wiegte, hob und senkte sich, was Maxime mit einem angenehmen Gefühl erfüllte. Etwas drängte ihn, Renée zu beschämen und so sagte er:
»Sieh, Du würdest verdienen, im Fiaker zu fahren! Das wäre nur gerecht... Betrachte doch diese Leute, die nach Paris zurückkehren, diese Leute, die zu Deinen Füßen liegen. Man grüßt Dich, als wärest Du eine Königin und es fehlt wenig, so würde Dir Dein guter Freund, Herr von Mussy, sogar Kußhände zuwerfen.«
Tatsächlich grüßte ein Reiter die junge Frau. Maxime hatte in heuchlerisch spöttischem Tone gesprochen, Renée aber mit den Achseln zuckend, kaum den Kopf gewendet. Nun machte der junge Mann eine Geberde der Verzweiflung.
»So steht es also?« fragte er. »Du lieber Gott, Du hast ja Alles; was willst Du denn noch?«
Renée hob den Kopf empor. Ihre Augen hatten einen warmen Glanz, ein heißer Ausdruck unbefriedigter Neugierde lag in denselben, als sie halblaut erwiderte:
»Ich will etwas Anderes.«
»Da Du aber Alles hast«, entgegnete Maxime lachend, »so bedeutet etwas Anderes gar nichts... Was ist dieses Andere?«
»Was?...« wiederholte sie.
Damit brach sie ab, Sie hatte sich ganz umgedreht und betrachtete das seltsame Bild, welches allmählich hinter ihr verschwand. Die Nacht war fast gänzlich hereingebrochen, langsam senkte sich die Dämmerung wie ein feiner Aschenregen herab. Bei dem noch auf dem Wasser schwebenden fahlen Tageslichte bot der von oben gesehene Teich den Anblick einer ungeheuren Zinnplatte; an seinen beiden Ufern nahmen die grünen Bäume, deren schlanke, dünne Stämme aus der schlummernden Erde emporzusteigen schienen, zu dieser Stunde das Aussehen violetter Säulen an, deren regelmäßige Architektur die wohlberechneten Krümmungen der Ufer schärfer hervortreten ließ; weiter im Hintergrund schlossen die dichten Baumgruppen gleich großen schwarzen Flecken den Horizont ab. Hinter diesen Flecken glühte die sinkende Sonne, deren Scheibe beinahe ganz versunken war und nur mehr eine Spitze des unendlichen Raumes erleuchtete. Über diesem regungslosen Teich, diesen niedrigen Hecken, diesem ganzen merkwürdigen Bilde wölbte sich das Himmelsgezelt in endloser Tiefe und Wette. Dieses große Stück Himmel über diesem Endchen Natur hatte etwas Trauriges an sich; aus diesen immer fahler werdenden Höhen senkte sich eine solch’ herbstliche Melancholie, eine so sanfte, betrübende Nacht hernieder, daß das Bois, welches allmählich in ein graues Leichentuch gehüllt ward, seine vornehme Anmut verlor, von dem mächtigen Reiz der Wälder erfüllt ward. Das Rollen der Equipagen, deren lebhafte Farben im Dunkel verblaßten, erinnerte an das ferne Rauschen der Bäume und das Plätschern der Flüsse. Alles Geräusch erstarb. Inmitten der allgemeinen Ruhe hob sich auf der Teichfläche bloß das Segel der großen Promenadenbarke kräftig und deutlich von dem leuchtenden Hintergrunde des Sonnenunterganges ab. Und dann sah man nichts weiter als dieses Segel, dieses anscheinend übernatürlich vergrößerte dreieckige Stück gelber Leinwand.
In ihrer Übersättigung empfand Renée eine Art unnennbaren Verlangens bei dem Anblicke dieses Landschaftsbildes, welches sie nicht mehr erkannte, dieser mit solcher Kunst verfeinerten Natur, aus welcher die anbrechende Nacht einen heiligen Forst, eine jener idealischen Waldlichtungen machte, in deren Tiefen die alten Götter ihren himmelstürmenden Liebesgefühlen, ihren ehebrecherischen und blutschänderischen Gelüsten fröhnten. Und in dem Maße, wie die Equipage weiterrollte, schien es ihr, als entführte die nächtliche Dämmerung hinter ihr, auf ihren zitternden Schwingen, das Traumland, den unzüchtigen, überirdischen Alkoven, in welchem ihr krankes Herz, ihr erschöpfter Leib endlich Befriedigung gefunden hätte.
Als der Teich und das kleine Gehölz im Schatten versanken und nur mehr als dunkler Streifen zu unterscheiden waren, wandte sich die junge Frau mit einem Male zurück und in einem Tone, in welchem Tränen des Zornes zitterten, nahm sie den unterbrochenen Satz von neuem auf:
»Was?... Etwas Anderes, ja! Ich will etwas Anderes. Weiß ich denn was? Wenn ich Das wüßte!... Allein, ich habe die Bälle, die Festlichkeiten, diese Soupers satt; die Sache bleibt sich immer gleich. Es ist zum Verzweifeln... Und die Männer... die Männer sind zum Sterben langweilig...«
Maxime begann zu lachen. Die aristokratischen Mienen der Weltdame verrieten heftige Begierden. Sie drückte die Lider nicht mehr zu, scharf trat die Falte auf ihrer Stirne hervor; ihre Oberlippe schob sich gleich der eines schmollenden Kindes begehrlich vor, unbekannte Genüsse heischend. Sie sah das Lachen ihres Begleiters, war aber schon zu erregt, um noch an sich halten zu können; halb liegend, den wiegenden Bewegungen des Wagens folgend, fuhr sie in kurzen, abgebrochenen Sätzen fort:
»Ja, ja, Ihr seid zum Sterben langweilig... Auf Dich, Maxime, hat Dies keinen Bezug, Du bist noch zu jung... Doch wenn ich Dir berichten wollte, wie lästig mir Aristide im Anfange war! Und erst die Anderen! Jene, die mich geliebt haben... Du weißt, wir sind zwei gute Kameraden; Dir gegenüber tue ich mir keinen Zwang an... Nun denn, es ist wahr, ich habe Tage, da ich es derart müde bin, das Leben einer reichen, geliebten, respektierten Frau zu führen, daß ich eine Laura d’Aurigny, eine dieser Damen zu sein wünschte, die ein förmliches Junggesellenleben führen.«
Und da Maxime noch lauter lachte, fügte sie hinzu: »Ja, eine Laura d’Aurigny. Das muß weniger langweilig, weniger gleichmäßig sein.«
Sie schwieg eine Weile, als vergegenwärtigte sie sich das Leben, welches sie führen würde, wenn sie Laura wäre. Sodann nahm sie entmutigten Tones von neuem auf:
»Übrigens mögen auch diese Damen ihre Stunden des Überdrusses haben, -- auch sie. Nichts ist kurzweilig. Es ist zum Verzweifeln... Ich sagte allerdings, ich wünschte etwas Anderes; Du verstehst vielleicht, ich selbst errate es nicht; etwas Anderes, was noch Niemandem widerfuhr, was man nicht alle Tage antrifft, was einen seltenen, einen unbekannten Genuß böte...«
Sie hatte immer langsamer gesprochen und die letzten Worte wie in tiefes Sinnen versunken geäußert. Der Wagen rollte durch die Allee, die nach dem Ausgang des Bois führte. Die Schatten wurden immer länger; gleich einer grauen Mauer glitten zu beiden Seiten die Hecken dahin; die gelb gestrichenen Stühle, auf welche sich an schönen Abenden die feiernden Bürgersleute niederlassen, standen leer längs des Fußweges, in die schwarze Melancholie der Gartenmöbel versunken, welche vom Winter überrascht werden und das Rollen, das dumpfe, gleichmäßige Geräusch der heimkehrenden Wagen klang gleich einer traurigen Klage durch die einsame Allee.
Gewiß war sich Maxime bewußt, wie unziemlich es war, das Leben heiter zu finden. Wenn er auch noch jung genug war, um sich einer glücklichen Begeisterung zu überlassen, so war sein Egoismus doch entwickelt, seine Gleichgültigkeit groß genug, sein Wesen von wirklichem Überdruß genügend erfüllt, um sich auch für übersättigt, für blasiert zu erklären. Gemeinhin legte er dieses Geständnis mit einiger Ruhmredigkeit ab.
Er streckte sich gleich Renée aus und schlug einen schmerzlichen Ton an, als er sagte:
»Ja, Du hast Recht; es ist abscheulich... Auch ich amüsiere mich nicht mehr als Du; auch ich habe häufig an etwas Anderes gedacht... Nichts ist dümmer als das Reisen. Geld erwerben? Da ziehe ich noch vor, solches auszugeben, obschon dies auch nicht immer so kurzweilig ist, wie man anfänglich glaubt. Lieben, geliebt werden, -- das hat man bald satt, nicht wahr?... Ach ja, das hat man sehr bald satt!«
Die junge Frau gab keine Antwort und er fügte hinzu, in der Absicht, durch eine Gottlosigkeit ihr Staunen zu erregen:
»Ich möchte von einer Nonne geliebt werden. Das wäre vielleicht drollig genug... Hast Du niemals davon geträumt, einen Mann zu lieben, an den Du nicht denken könntest, ohne ein Verbrechen zu begehen?«
Sie aber verharrte in düsterem Schweigen und da sie ihm keine Antwort gab, so glaubte Maxime, sie höre ihm nicht zu. Sie lehnte den Nacken gegen den gepolsterten Rand der Rückenlehne und schien mit offenen Augen zu träumen. Willenlos sann sie nach, den Träumen preisgegeben, die sie in ihrem Banne hielten und von Zeit zu Zeit erzitterten ihre Lippen nervös. Der Schatten der Abenddämmerung hielt sie weich umflossen; Alles, was diese Schatten an unbestimmter Traurigkeit, an uneingestandener Hoffnung und geheimer Wollust enthielten, bemächtigte sich ihrer und umgab sie mit einer erschlaffenden, schweren Atmosphäre. Während sie starr auf den runden Rücken des auf dem Bocke sitzenden Kammerdieners blickte, dachte sie an die Genüsse des gestrigen Tages, an diese Festlichkeiten, die ihr so inhaltslos dünkten und von denen sie nichts mehr wissen wollte. Ihr vergangenes Leben zog an ihr vorüber, die sofortige Befriedigung ihrer Wünsche, die bis zum Ekel gesteigerte Pracht, die ertötende Gleichmäßigkeit der gleichen Zärtlichkeiten und desselben Verrats. Sodann tauchte gleich einer Hoffnung, von dem leisen Schauer des Begehrens begleitet, der Gedanke an dieses »Andere« auf in ihr, -- dieses Andere, welchem ihr Geist keine Form zu geben vermochte. Bei diesem Punkte verwirrten sich ihre Träume. Sie erschöpfte sich in Anstrengungen, -- doch immer wieder entschwand ihr das gesuchte Wort in der sinkenden Nacht, verlor sich in dem unablässigen Wagenrollen. Das weiche Wiegen der Kalesche vermehrte noch das Zögern, welches sie hinderte, ihr Verlangen in Worte zu kleiden. Und eine unendliche Versuchung stieg aus diesem Chaos auf, aus diesem Rollen der Räder, dieser wiegenden Bewegung des Wagens, welche sie in eine köstliche Betäubung hüllte, aus diesen Hecken und Sträuchern, welche der Abend zu beiden Seiten in dunkle Schatten hüllte. Zahllose kleine Schauer glitten über ihren Leib: unterbrochene Träume, ungenannte Wollust, verworrene Wünsche, -- Alles, womit die Rückkehr aus dem Bois bei sinkender Nacht an köstlichen und ungeheuerlichen Empfindungen das übersättigte Herz einer Frau zu erfüllen vermag. Sie hatte beide Hände in das weiche Bärenfell vergraben und es war ihr sehr heiß unter dem Paletot aus weißem Tuch mit den grauen Sammtaufschlägen. Sie streckte einen Fuß aus, um sich behaglicher zu dehnen und dabei streifte ihr Knöchel das warme Bein Maxime’s, der die Berührung gar nicht beachtete. Ein unerwarteter Stoß des Wagens riß sie aus ihrem Halbschlummer. Sie hob den Kopf empor und blickte den in voller Eleganz da liegenden jungen Mann eigentümlich aus ihren grauen Augen an.
In diesem Augenblick verließ die Equipage das Bois. Die Avenue de l’Imperatrice dehnte sich schnurgerade in der Dämmerung hin; zu ihren beiden Seiten erstreckten sich die grün gestrichenen Holzbarrieren, die in weiter Ferne zu einem Punkte zusammenzufließen schienen. In der für Reiter bestimmten Seitenallee wurde ein weißes Pferd sichtbar, welches sich gleich einem lichten Fleck von den grauen Schatten abhob. Auf der anderen Seite, längs der Fahrstraße schritten verspätete Spaziergänger, Gruppen schwarzer Punkte vergleichbar, gemächlich der Stadt zu. Und ganz am Ende dieses Gewimmels von Menschen, Wagen und Pferden hob sich der schief gestellte Arc-de-Triumphe weiß vom schwarzen Nachthimmel ab.
Während der Wagen in rascherem Trabe dahinfuhr, betrachtete Maxime, dem der englische Anstrich des Bildes gefiel, rechts und links die niedlichen, bizarr erbauten und mit kleinen Vorgärten versehenen Hotels, die sich zu beiden Seiten der Avenue erhoben, während Renée sinnend die Gasflammen des Place de I’Etoile sich entzünden sah, die nach einander am Horizonte sichtbar wurden und in dem Maße, wie die flackernden Lichtblitze das Dunkel des sinkenden Tages durchbrachen glaubte sie geheime Stimmen zu vernehmen, schien es ihr, als erglänze dieses verführerische Paris für sie, als bereite es für sie die unbekannten Genüsse vor, nach welchen es sie verlangte.
Die Equipage schlug die Avenue de la Reine-Hortense ein und hielt am Ende der Rue Monceaux, einige Schritte vom Boulevard Malesherbes entfernt, vor einem zwischen Hof und Garten gelegenen großen Hotel. Die mit vergoldeten Verzierungen versehenen Flügel der Gittertür, die in den Hof führte, waren zu beiden Seiten von je zwei Laternen flankiert, die die Form einer Urne hatten, gleicherweise mit goldenen Verzierungen beladen waren und in welchen mächtige Gasflammen brannten. Seitwärts von der Gittertür hatte der Torwart einen eleganten Pavillon inne, der an einen kleinen griechischen Tempel erinnerte.
Als der Wagen in den Hof rollen wollte, sprang Maxime leicht zur Erde.
»Du weißt«, sagte Renée, ihn an der Hand zurückhaltend, »daß wir um halb acht Uhr zu Tische gehen. Du hast also mehr als eine Stunde für’s Umkleiden. Laß nicht auf Dich warten.«
Und mit einem Lächeln fügte sie hinzu:
»Wir haben die Mareuils zu Gast... Dein Vater wünscht, Du mögest Luisen gegenüber sehr galant sein.«
Maxime zuckte die Achseln.
»Das ist Frohndienst!« murmelte er ärgerlichen Tones. »Ich bin ja bereit, sie zu heiraten; doch ihr den Hof zu machen, ist zu dumm, wahrhaftig!... Ach, Renée, wie nett wäre es von Dir, wenn Du mir Luise heut Abend vom Halse schaffen wolltest.«
Er nahm seine drollige Miene, die Grimasse und den schmeichelnden Ton an, welchen er jedesmal ins Treffen führte, so oft er einen seiner gewohnten Scherze anbringen wollte und sagte:
»Willst Du, teure Stiefmama?«
Renée schüttelte ihm die Hand wie einem Kameraden und rasch, mit einer plötzlichen nervösen Kühnheit warf sie hin:
»Wahrlich, wenn ich nicht Deinen Vater geheiratet hätte, würdest Du mir, glaube ich, den Hof machen!«
Dem jungen Manne mochte diese Zumutung offenbar sehr drollig dünken, denn er war schon um die Ecke des Boulevard Malesherbes gekommen, als er noch immer lachte.
Die Equipage rollte in den Hof und hielt vor dem Perron.
Die Stufen desselben waren breit und niedrig; den Perron selbst überragte ein mit goldenen Fransen und Troddeln besetztes Schutzdach. Die beiden Stockwerke des Hotels erhoben sich über Kellerräumlichkeiten, deren mit matten Scheiben versehene viereckige Fenster sich dicht über dem Erdboden befanden. Vom Perron führte eine Tür ins Vestibül, welche auf beiden Seiten von schmächtigen Säulen flankiert war, die eine Art Vorbau bildeten, der sich auf jedem Stock wiederholend, bis zum Dache fortgeführt ward, wo er mit einem Delta abschloß. Auf beiden Seiten hatte jedes Stockwerk fünf Fenster in gleichmäßiger Entfernung von einander, die von einem einfachen steinernen Rahmen umgeben waren. Das steile Dach war in breite Felder geteilt und mit Fenstern versehen.
Auf der Gartenseite aber entfaltete die Fassade eine viel größere Pracht. Ein herrlicher Perron führte zu einer schmalen Terrasse, die sich längs des ganzen Erdgeschosses hinzog; die im Stile der Gitterarbeiten des Monceau-Parkes gehaltene Brüstung derselben war noch mehr mit Gold überladen, als das Schutzdach und die Laternen. Sodann kam das Hotel, zu beiden Seiten von zwei Pavillons wie von Türmen flankiert, die zur Hälfte dem Gebäude eingefügt waren und in ihrem Inneren runde Gemächer bargen. In der Mitte ragte ebenfalls ein bescheidenes Türmchen hervor. Die Fenster der Pavillons waren hoch und schmal, die der flachen Teile der Fassade hingegen geräumiger und beinahe quadratförmig; im Erdgeschoß waren sie mit steinernen Ballustraden und in den oberen Stockwerken mit Gitterwerk aus vergoldetem Schmiedeeisen versehen. Es war das eine geschmacklose Verschwendung, eine prahlerische Schaustellung des vorhandenen Reichtums. Das Hotel selbst verschwand unter der Menge der sein Mauerwerk bedeckenden Skulpturen. Um die Fenster, längs der Gesimse zogen sich Laub- und Blumenguirlanden hin; die Balcone glichen Fruchtkörben, die von großen nackten Frauen mit gespannten Hüften und hervorspringenden Brustwarzen gehalten wurden. Des Ferneren waren hier und dort Phantasie-Wappen angebracht: Weintrauben, Rosen, all’ das Pflanzenwerk, das in Stein gemeißelt werden kann. Und je höher das Auge kam, je blühender erschienen die Außenwände. Rings um das Dach zog sich eine Ballustrade hin, auf welcher in gleichmäßigen Abständen Urnen aufgestellt waren, in welchen Flammen aus Stein züngelten. Zwischen den Mansardenfenstern, um die sich eine unglaubliche Menge von Früchten und Blätterwerk schlängelte, breiteten sich die abschließenden Prunkstücke dieser erstaunlichen Verzierungsmanier aus: die Schlußkränze der Pavillons, zwischen welchen die großen nackten Frauen neuerdings zum Vorschein kamen, mit Äpfeln spielend oder sonstige Künste treibend. Das Dach, welches sich all’ diese Ornamente, zwei Blitzableiter und vier ungeheure Rauchfänge die ihrerseits reich verziert waren, gefallen lassen mußte, schien gleichsam die Krone dieses architektonischen Feuerwerkes zu sein.
Zur Rechten befand sich ein geräumiges Gewächshaus, welches sich eng an das Hotel anschmiegend, durch die Glastür eines Salons mit dem Erdgeschoß verbunden war. Der Garten, den ein durch eine Hecke verdecktes niedriges Gitter vom Park Monceaux schied, war ziemlich abschüssig. Zu klein für das Hotel, kaum groß genug, um einem Rasenplatz und einigen Baumgruppen Raum zu bieten, glich er einfach einem Erdhügel, einem grünen Sockel, auf welchem sich das Hotel stolz erhob. Vom Parke gesehen, über dieser tadellosen Rasenfläche, diesen Sträuchern, deren Blätterwerk leuchtete, erweckte dieses Gebäude, welches mit tausend Stimmen verkündete, daß es noch ganz neu sei, mit seinem schweren Schieferdach, seinem vergoldeten Gitterwerk und den überreichen Blumengewinden, ganz den Eindruck eines Emporkömmlings. Es war das ein neuer Louvre in kleinerem Maßstabe, eine der am meisten charakteristischen Stichproben des unter dem dritten Napoleon gebräuchlichen Stiles, welcher eben ein Bastard sämmtlicher Bauarten war. An den Sommerabenden, wenn die untergehende Sonne das Gold der Rampen, Gitter und Guirlanden erglänzen machte, blieben die Spaziergänger des Parkes stehen, betrachteten die roten Seidenvorhänge an den Fenstern des Erdgeschosses und durch die Fensterscheiben, die so groß und glänzend waren, wie die Glasscheiben der modernen Verkaufsläden und nur vorhanden zu sein schienen, um von außen auch das Innere sehen zu lassen, gewahrten die kleinen Bürgerleute Teile einzelner Möbelstücke, Gardinen, Stücke reichverzierter Zimmerdecken und von Neid und Bewunderung erfüllt, blieben sie inmitten des Weges stehen.
Heute aber senkte sich bereits tiefe Dunkelheit hernieder, die glänzende Außenseite schlief. Auf der anderen Seite, im Hofe, hatte der Kammerdiener Renée respektvoll geholfen, den Wagen zu verlassen. Zur Rechten sah man die gebräunten Eichentüren der Stallungen, einen weit geöffneten Wagenschuppen, zur Linken, gleichsam als Gegenstück, eine sich an die Mauer des Nachbarhauses lehnende reich geschmückte Nische, in welcher Tag und Nacht ein Wasserstrahl einer von zwei Amoretten gehaltenen Muschel entsprang. Einen Augenblick blieb die junge Frau auf dem Perron stehen, mit ihrer Toilette beschäftigt, die sich beim Absteigen vom Wagen ein wenig verschoben hatte. Der Hof versank wieder in seine, durch das Rollen des Wagens einen Augenblick unterbrochene aristokratische Stille, in welcher bloß das ewige Geplätscher der Wassermuschel vernehmbar war. Von der schwarzen Masse des Hotels, in welchem das erste der großen Herbstdiners alsbald die Kronleuchter entzünden sollte, hoben sich vorerst nur die erleuchteten Fenster des Erdgeschosses ab, die einen blendenden Schimmer auf das Pflaster des regelmäßigen Hofes warfen.
Als Renée die Tür des Vestibüls öffnete, befand sie sich dem Kammerdiener ihres Gatten gegenüber, der mit einem silbernen Teekessel in den Küchenraum hinabgehen wollte. Der Mann hatte ein tadelloses Äußeres; er war ganz in Schwarz gekleidet, groß, stark, hatte ein weißes Gesicht, mit dem korrekten Backenbart eines Engländers und der ernsten, würdevollen Miene einer Gerichtsperson.
»Baptiste«, sprach die junge Frau zu ihm; »ist mein Gemahl zu Hause?«
»Ja, Madame; er kleidet sich an«, erwiderte der Bediente mit einem Neigen des Kopfes, um welches ein Fürst, der die Menge grüßt, ihn hätte beneiden können.
Langsam stieg Renée die Treppe hinauf, während sie ihre Handschuhe auszog.
Im Vestibüle herrschte große Pracht. Beim Eintreten in dasselbe empfand man ein leichtes Gefühl der Dämpfung. Die dicken Teppiche, welche den Boden bedeckten und sich über die Stufen legten, die schweren Tapeten aus rotem Sammt, die Türen und Wände verhüllten, verliehen der Atmosphäre etwas Dumpfes, die schwüle Stille einer Kapelle. Aus der Höhe senkten sich Draperien herab und die sehr hohe Decke war mit vorspringenden Rosetten geschmückt, die auf einem Geflecht von Goldstäben saßen.
Die Treppe, deren doppelte Marmorballustrade mit rotem Sammt überzogen war, teilte sich in zwei leicht geschweifte Arme; zwischen welchen sich die Tür des großen Salons befand. Auf dem ersten Treppenabsatz bedeckte ein mächtiger Spiegel die ganze Wand. Am Fuße der beiden Treppenarme erhoben sich auf Marmorsockeln zwei Frauen aus Goldbronze, die nackt bis zu den Hüften, große Kandelaber mit fünf Flammen trugen, deren helles Licht durch matte Glaskugeln gedämpft wurde. Und zu beiden Seiten reihten sich herrliche Majolikagefäße, in welchen kostbare exotische Gewächse blühten.
Mit jeder Stufe, die Renée emporstieg, wurde ihr Spiegelbild größer und von den Zweifeln bewegt, welche die am meisten bewunderten Künstlerinnen beschleichen, fragte sie sich, ob sie wirklich so reizend sei, wie man ihr sagte.
In ihrem Appartement angelangt, welches im ersten Stock lag und dessen Fenster auf den Park Monceaux gingen, klingelte sie ihrer Kammerfrau Céleste und ließ sich zum Diner ankleiden. Dies währte gute fünf Viertelstunden. Nachdem auch die letzte Stecknadel angebracht worden, öffnete sie, da es in dem Zimmer zu heiß war, ein Fenster, lehnte sich hinaus und versank in tiefes Sinnen. Hinter ihr bewegte sich Céleste geräuschlos hin und her, mit dem Forträumen der verschiedenen Toilettegegenstände beschäftigt.
Unten im Park herrschte tiefstes Dunkel. Die schwarzen Massen des Laubes, durch die zeitweilig ein Windstoß fuhr, rauschten geheimnisvoll mit dem Rascheln der dürren Blätter, welche an das Verspritzen der Wogen an einem kiesigen Strande erinnern. Nur die zwei gelben Laternen eines Wagens, der durch die von der Avenue de la Reine-Hortense nach dem Boulevard Malesherbes führende lange Allee rollte, unterbrachen mitunter die Finsternis. Angesichts dieser herbstlichen Melancholie fühlte Renée all’ die Bitternis und Trauer ihres Herzens mit einem Male neuerdings erwachen. Sie sah sich wieder als Kind in dem Hause ihres Vaters, in diesem stillen Hotel der Insel Saint-Louis, in welchem die Béraud du Chàtels seit zwei Jahrhunderten ihre steife Richterwürde behaupteten. Sodann dachte sie an den Zauberschlag ihrer Verheiratung, an diesen Wittwer, der sich verkauft hatte, um sie heiraten zu können und der seinen Namen Rougon gegen Saccard vertauschte, gegen diesen Namen, dessen zwei trockenen Silben mit der Brutalität zweier Reichen, die Gold zusammenraffen, an ihr Ohr geschlagen hatten, als sie dieselben zum ersten Mal vernahm. Er nahm sie an sich und schleuderte sie in dieses aufreibende Leben, welches ihren armen Kopf mit jedem Tage mehr zerrüttete. Darauf dachte sie mit kindlicher Freude an die schönen Spiele, die sie einst mit ihrer jüngeren Schwester Christine gespielt. Und eines Morgens wird sie ja doch aus diesem Traume erwachen, welchen sie seit zehn Jahren träumt, beschmutzt, besudelt durch eine Spekulation ihres Gatten, welche ihm selbst noch den Untergang bringen wird. Es war das gleichsam ein flüchtiges Vorgefühl. Lauter wehklagten unten die Bäume. Verwirrt durch diese Gedanken der Schmach und Buße, gab Renée dem Instinkte der ursprünglichen und ehrbaren Bürgerin nach, der in ihr schlummerte und sie versprach der schwarzen Nacht, in sich zu gehen, nicht mehr so viel auf ihre Toilette zu vergeuden und nach einem unschuldigen Spiel zu suchen, welches sie zerstreuen könnte, gleichwie in den glücklichen Zeiten des Pensionats, als die Schülerinnen auf ihren unter der Obhut der Lehrerinnen unternommenen Spaziergängen sangen: »Wir gehen nicht mehr in den Wald.«
In diesem Augenblick kehrte Céleste, die hinabgegangen war, zurück und meldete ihrer Herrin mit gedämpfter Stimme:
»Der Herr läßt Madame bitten hinabzukommen. Es befinden sich bereits Gäste im Salon.«
Renée erschauerte. Sie hatte die scharfe Luft, die um ihre nackten Schultern spielte, gar nicht verspürt. Vor dem Spiegel blieb sie einen Augenblick stehen, um sich gleichsam unbewußt anzublicken. Sie lächelte unwillkürlich und stieg hinab.
Tatsächlich waren fast alle Gäste bereits angelangt. Da war vor Allem ihre Schwester Christine, ein Mädchen von zwanzig Jahren, in einer sehr einfachen Toilette aus weißer Mousseline; ihre Tante Elisabeth, die Wittwe des Notars Aubertot, in schwarzen Satin gekleidet, eine kleine alte Dame von sechszig Jahren und ausnehmender Liebenswürdigkeit; die Schwester ihres Gatten, Sidonie Rougon, eine magere, süßliche Frau in einem nicht näher zu bestimmenden Alter und mit einem Gesicht wie aus weichem Wachs, von welchem sich ihr verblaßtes Kleid kaum unterschied; sodann die Familie Mareuil: der Vater, Herr von Mareuil, der soeben die Trauer um seine Frau abgelegt hatte, ein großer schöner Mann, ernst, hohl, dessen Ähnlichkeit mit dem Kammerdiener Baptiste auf den ersten Blick auffiel; seine Tochter, die arme Luise, wie man sie gewöhnlich nannte, ein siebzehnjähriges Kind, schüchtern, ein wenig buckelig und mit krankhafter Grazie ein weißes Seidenkleid mit roten Punkten tragend; ferner eine Anzahl ernster Männer, lauter Herren die sich des Besitzes verschiedenster Auszeichnungen erfreuten, offizielle Persönlichkeiten, die nichts redeten und kahle Köpfe hatten; etwas entfernter von dieser Gruppe eine andere, von jungen Herren gebildet, die lasterhafte Mienen und tief ausgeschnittene Westen hatten und fünf oder sechs höchst elegante Damen umringt hielten, unter welchen sich auch die beiden Unzertrennlichen: die kleine Marquise vom Espanet in gelber und die blonde Frau Haffner in veilchenblauer Toilette befanden. Und inmitten der langen Schleppen auf dem Teppich promenierten zwei Unternehmer, zwei reich gewordene Maurermeister, die Herren Mignon und Charrier, mit denen Saccard am nächsten Tage eine Geschäftsangelegenheit erledigen sollte, mit schweren Stiefeln, auf den Rücken gelegten Händen auf und nieder und schienen sich dabei in ihren schwarzen Salonanzügen sehr unbehaglich zu fühlen.
In der Nähe der Tür stehend redete Aristide Saccard mit einer Gruppe ernster Männer in näselndem Tone und mit seiner ganzen südlichen Lebhaftigkeit, ohne dabei einen der ankommenden Gäste zu übersehen, so daß er jeden sofort begrüßen konnte. Er drückte den Leuten die Hand und richtete liebenswürdige Worte an sie. Klein, unansehnlich, bückte und verneigte er sich wie eine Marionette und was an seiner schmächtigen, schlauen, schwärzlichen Person am meisten ins Auge stach, war das rote Band der Ehrenlegion, welches breit und auffällig an seiner Brust prangte.
Als Renée eintrat, erhob sich ein Gemurmel der Bewunderung. Sie war in der Tat göttlich schön. Über einem, rückwärts mit einer Flut von Falten besetzten Mullrock trug sie eine Tunique aus zartgrünem Satin, welche eine hohe englische Spitze zierte, die von großen Veilchensträußen gehalten wurde; ein einziger Besatz befand sich am Vorderteil des Rockes, auf welchem mittelst Blumenguirlanden verbundene Veilchensträußchen eine leichte Mousselindraperie festhielten. Die Anmut des Kopfes und des Busens war bewunderungswürdig und kam über dieser Toilette, die von einer königlichen Fülle, vielleicht sogar etwas überladen war, voll zur Geltung. Das Kleid war bis zu den Brustwarzen ausgeschnitten, die Arme nackt und nur an den Schultern mit Veilchen besetzt, welche die Befestigung des Leibchens maskirten und so schien die junge Frau förmlich nackt aus ihrer Wolke von Tülle und Satin hervorzugehen, einer jener Nymphen vergleichbar, deren Oberleib aus den heiligen Eichen hervorragt. Der weiße Busen, der üppige Leib schienen bereits so erfreut über diese halbe Freiheit, daß der Blick darauf zu warten schien, das Mieder und die Röcke herabgleiten zu sehen, gleich den Kleidern einer Badenden, die sich am eigenen Fleische berauscht. Ihre hohe Frisur, die emporgekämmten blonden Haare, durch die sich ein Epheuzweiglein schlang, erhöhten noch den Eindruck der Nacktheit, da dadurch der ganze Nacken bloßgelegt wurde, den bloß einige krause Goldhärchen beschatteten. Um den Hals schlang sich ein reiches Diamantband, dessen Steine von bewunderungswürdigem Glanz und Reinheit waren und die Stirne zierte eine mit zahlreichen Diamanten besetzte silberne Krone. Einige Sekunden verharrte sie auf der Schwelle stehend, ihre herrliche Toilette den bewundernden Blicken preisgegeben, die zarten Schultern von dem blendenden Lichte bestrahlt. Da sie rasch herabgekommen, hob und senkte sich der volle Busen. Ihre Augen, die so lange in die Dunkelheit des Monceaux-Parkes gestarrt, zwinkerten in diesem Meer von Licht und verliehen ihr jene unsichere Miene der Kurzsichtigen, die ihr so gut stand.
Bei ihrem Anblicke erhob sich die kleine Marquise lebhaft, eilte auf sie zu, ergriff ihre beiden Hände und sie vom Kopf bis zu den Füßen einer scharfen Musterung unterziehend, murmelte sie süß wie Flötenton:
»Oh, meine Teure, wie schön sind Sie! Wie schön...«
Es war eine allgemeine Bewegung entstanden und Jedermann kam heran, um die schöne Frau Saccard zu begrüßen, wie Renée in der Gesellschaft genannt wurde. Sie reichte fast allen Herren die Hand. Sodann umarmte sie Christine und erkundigte sich nach ihrem Vater, der sich niemals in dem Hotel des Monceaux-Parkes blicken ließ. Und da stand sie nun aufrecht, lächelnd, mit dem Kopfe freundlich nickend, die Arme weich gerundet, vor diesem Kreise von Damen, die neugierig ihr Halsband und die Haarkrone musterten.
Die blonde Frau Haffner vermochte der Versuchung nicht zu widerstehen; sie trat dichter heran, betrachtete lange das Geschmeide und fragte neidischen Tones:
»Das ist wohl das Halsband und die Haarkrone, nicht wahr?«
Renée nickte zustimmend mit dem Kopfe und nun ergingen sich all’ diese Frauen in Lobeserherbungen: die Schmuckgegenstände wären herrlich, göttlich; darauf kamen sie voll neidischer Bewunderung auf den Verkauf zu sprechen, welchen Laura von Aurigny veranstaltet und bei welchem Saccard das Geschmeide für seine Frau erstanden hatte. Sie beklagten sich darob, daß ihnen diese Dirnen die schönsten Dinge raubten; bald würde es für ehrbare Frauen Diamanten gar nicht mehr geben. Und in diesen Klagen verriet sich der brennende Wunsch, auch auf ihrem nackten Leibe eines dieser Kleinode zu fühlen, welche ganz Paris an den Schultern und um dem Nacken einer bekannten Lebedirne gesehen und welche ihnen vielleicht einige Skandalgeschichten zuflüstern würden, die sich in den Schlafzimmern zugetragen und bei welchen ihre züchtigen Träume der ehrbaren Frau so gerne verweilen. Sie kannten die hohen Preise und führten ein herrliches Kaschmirtuch, wundervolle Spitzen an. Die Haarkrone hatte fünfzehntausend, das Halsband fünfzigtausend Francs gekostet. Frau von Espanet war hingerissen durch diese Zahlen. Sie suchte nach Saccard und rief ihm zu:
»Kommen Sie doch und lassen Sie sich beglückwünschen! Das ist ein guter Gatte! Ein seltener Ehemann!«
Aristide Saccard kam näher, verneigte sich und spielte den Bescheidenen, sein grinsendes Gesicht aber verriet die lebhafte Befriedigung, die ihn erfüllte. Dabei schielte er aus den Augenwinkeln zu den beiden Unternehmern, den zwei reich gewordenen Maurermeistern hinüber, die einige Schritte weit entfernt standen und die Ziffern fünfzehn- und fünfzigtausend mit sichtlicher Hochachtung nennen hörten.
In diesem Augenblick lehnte sich Maxime, der soeben eingetreten war und sich in seinem schwarzen Anzuge vorzüglich ausnahm, vertraulich an die Schulter seines Vaters und flüsterte ihm wie einem Kameraden etwas ins Ohr, wobei er den Maurern einen Blick zuwarf. Saccard lächelte still, wie ein Schauspieler, dem Beifall gespendet wurde.
Es langten noch einige Gäste an. Im Salon waren etwa dreißig Personen versammelt. Die Unterhaltung wurde ziemlich lebhaft geführt und während der eintretenden kurzen Pausen vernahm man trotz der trennenden Zwischenwände das leise Klirren des Porzellans und Silberzeuges. Endlich öffnete Baptiste eine breite Flügeltür und sprach die althergebrachten Worte:
»Es ist aufgetragen, Madame!«
Nun begann langsam der Zug nach dem Speisesaale. Saccard reichte der kleinen Marquise den Arm; Renée nahm den eines alten Herrn, eines Senators, des Barons Gouraud, dem Jedermann mit größter Ehrfurcht begegnete; Maxime war genötigt, seinen Arm Luise von Mareuil zu reichen und dann kamen die übrigen Gäste in langer Reihe, am Schlusse derselben die beiden Unternehmer mit lässig baumelnden Armen.
Der Speisesaal war ein geräumiges viereckiges Gemach, dessen dunkles Wandgetäfel Manneshöhe erreichte und mit dünnen Goldeinlagen verziert war. Die vier Wandfelder hätten ursprünglich bemalt werden sollen, dies war aber nicht geschehen, da der Eigentümer des Hauses offenbar vor einer rein künstlerischen Ausgabe zurückgeschreckt war. Sie waren also leer geblieben und bloß mit grünem Sammt überzogen worden. Die Möbel, Vorhänge und Portieren aus demselben Stoffe verliehen dem Raum ein ernstes Gepräge, welches den Zweck hatte, allen Glanz und Reichtum auf dem Tisch zu konzentrieren.
Und in der Tat glich der Tisch zu dieser Stunde, inmitten des großen persischen Teppichs, der den Schall der Tritte dämpfte, unter dem blendenden Lichte des Kronleuchters und von den Stühlen umgeben, deren mit Gold eingelegte schwarze Lehnen ihn mit einer dunkeln Linie umrahmten, einem Altar, einer leuchtenden Kapelle, wo inmitten der schneeigen Weiße des Tafeltuches die lichten Flammen des Kristalls und des Silbers schimmerten. Oberhalb der geschnitzten Lehnen, in wogendem Halbdunkel gewahrte man kaum das Wandgetäfel, ein großes niedriges Büffet, einzelne Zipfel von grünem Sammtstoff. Die Augen waren gezwungen, zu dem Tische zurückzukehren und sich an dessen Glanze zu weiden. Ein herrlicher Aufsatz aus mattem Silber mit meisterhaften Ciselierungen nahm die Mitte desselben ein; der Aufsatz selbst stellte eine Anzahl Faune dar, die Nymphen rauben und über diese Gruppe fielen aus einem mächtigen Füllhorn ganze Strähne von Naturblumen herab. Auf den beiden Tischenden trugen Vasen gleichfalls Blumen; zwei Kandelaber, deren Motiv mit dem des Mittelaufsatzes übereinstimmte, indem jeder derselben einen laufenden Satyr darstellte, der in einem Arm ein ohnmächtiges Weib, in dem anderen eine Fackel mit zehn Flammen trug, vermehrten mit ihrem Lichte das des Kronleuchters. Zwischen diesen Hauptstücken waren in symmetrischer Anordnung die den ersten Gang enthaltenden großen und kleinen Aufwärmer aufgestellt, daneben kleine Muscheln mit den Vorspeisen und getrennt durch Porzellankörbe, Kristallvasen, flache Teller und hohe Compotschüsseln, die den sich bereits auf den Tisch befindlichen Teil des Desserts enthielten. Längs der in schnurgerader Linie stehenden Teller ganze Armeen von Gläsern, Wasser- und Weinkaraffen und kleine Salzfäßchen; das gesamte Kristallzeug war dünn und leicht wie ein Hauch, ohne jede Verzierung und so durchsichtig, daß es nicht einmal einen Schatten warf. Der Mittelaufsatz und die anderen großen Stücke glichen Feuerquellen; Blitze zuckten aus dem blank gescheuerten Kupfer der Aufwärmer; die Gabeln, Löffel und Messer warfen Funkengarben, die Gläser und Pokale schillerten in allen Farben des Regenbogens und inmitten dieses Regens von Licht und Feuer warfen die Weinflaschen rote Schatten auf den Schnee des Tafeltuches.
Die Gäste, die den Damen zulächelten, die sie am Arme hatten, fühlten sich beim Eintritt in diesen Raum von einer behaglichen Empfindung erfaßt. Die Blumen verliehen der lauen Luft eine gewisse Frische. Schwacher Dunst vermengte sich mit dem Dufte der Rosen, mit dem herben Geruch der Krebse und der scharfen Säure der Zitronen.
Als Jedermann seinen am Rande der Speisekarte vermerkten Namen gefunden, gab es vorerst ein allgemeines Rücken der Stühle, ein helles Rauschen der seidenen Kleider. Die mit Diamanten bestreuten nackten Schultern, neben welchen sich der schwarze Frack bloß als Folie ausnahm, die jene mehr hervortreten ließ, erhöhten durch ihre Milchweiße den Glanz der Tafel. Inmitten des zwischen einzelnen Nachbarn gewechselten Lächelns, unter halblautem Gespräch, welches das gedämpfte Klappern der Löffel übertönte, begann das Mahl. Baptiste kam seinen Verrichtungen als Haushofmeister mit der ernsten Würde eines Diplomaten nach; außer zwei Bedienten standen ihm noch vier Gehilfen zur Seite, die er bloß bei großen Diners heranzog. Bei jedem Gange, welcher aufgetragen und im Hintergrunde des Saales auf einem Serviertische zerlegt wurde, schritten drei Bediente lautlos um den Tisch und boten die betreffende Speise bei ihrem Namen an. Die anderen gossen Wein ein und beaufsichtigten Brot und Flaschen. Auf- und Abtragen ging so geräuschlos von Statten, daß Niemand gestört wurde.
Die Gäste waren zu zahlreich, als daß die Unterhaltung eine allgemeine hätte werden können. Doch beim zweiten Gange, als Braten und süße Speise aufgetragen wurden und schwere Weine, wie Burgunder, Pomard, Chambertin an Stelle der leichteren Sorten, als Léoville und Chateau-Lafitte traten, nahm das Geräusch der Stimmen zu und das laute Lachen mochte den dünnen Kristall erbeben. Renée, die den Mittelsitz an der Tafel einnahm, hatte zu ihrer Rechten den Baron Gouraud, zu ihrer Linken Herrn Toutin-Laroche, einen ehemaligen Kerzenfabrikanten, späteren Munizipalrat und nunmehrigen Direktor des Credit Viticole, Mitglied des Aufsichtsrates der marokkanischen Hafengesellschaft, ein magerer, ansehnlicher Mann, den der ihm zwischen Frau von Espanet und Frau Haffner gegenübersitzende Saccard mit schmeichelnder Stimme bald »mein lieber Kollege«, bald »unser großer Administrator« ansprach. Sodann kamen die Männer der Politik: Herr Hupel de la Noue, ein Präfekt, der acht Monate des Jahres in Paris verbrachte; drei Abgeordnete, unter denen auch das breite elsässische Gesicht des Herrn Haffner glänzte; sowie Herr von Saffré, ein sehr liebenswürdiger junger Mann und Sekretär eines Ministers; Herr Michelin, Chef der Straßenbau-Verwaltung und noch andere hohe Beamte. Herr von Mareuil, der ewig die Deputiertenwürde anstrebte, dehnte und reckte sich dem Präfekten gegenüber, dem er einschmeichelnde Blicke zuwarf. Was Herrn von Espanet betraf, so begleitete er seine Frau niemals in Gesellschaft. Die zur Familie gehörenden Damen waren zwischen den bedeutenderen Persönlichkeiten untergebracht: nur Saccard hatte seine Schwester Sidonie etwas entfernter zwischen den beiden Unternehmern -- Herrn Charrier zur Rechten, Herrn Mignon zur Linken -- wie auf einen Vertrauensposten gepflanzt, wo es sich darum handelte, den Sieg zu erringen. Frau Michelin die Gattin des Büro-Chefs, eine hübsche, üppige Brünette, befand sich neben Herrn von Saffré, mit dem sie sich lebhaft und mit leiser Stimme unterhielt. An den beiden Enden der Tafel befand sich die Jugend: Auditore vom Staatsrate, die Söhne einflußreicher Väter, angehende Millionäre, Herr von Mussy, der Renée verzweifelte Blicke zuwarf und Maxime mit Luise von Mareuil zu seiner Rechten, die ihn ganz in Anspruch zu nehmen schien. Allmählich fingen sie sogar an laut zu lachen. Von dieser Stelle ging die Heiterkeit aus.
Herr Hupel de la Noue fragte zuvorkommend:
»Werden wir das Vergnügen haben, heut Abend Seine Exzellenz zu begrüßen?«
»Ich glaube nicht«, erwiderte Saccard mit wichtiger Miene, die einen geheimen Ärger verbarg. »Mein Bruder ist ungemein in Anspruch genommen!... Er schickte uns seinen Sekretär, Herrn von Saffré, damit er uns seine Entschuldigung überbringe.«
Der junge Mann, der Frau Michelin ganz in Beschlag genommen hatte, hob den Kopf empor, als er seinen Namen nennen hörte und in der Meinung, man habe zu ihm gesprochen, warf er auf gut Glück hin:
»Ja, ja; heute Abend um neun Uhr soll beim Justizminister eine Ministerkonferenz stattfinden.«
Während dieser Zeit fuhr Herr Toutin-Laroche, der unterbrochen worden, mit größtem Ernst zu sprechen fort, als hätte er bei gespanntester Aufmerksamkeit im Munizipalrat eine Rede gehalten:
»Die Ergebnisse sind vorzügliche. Diese Anleihe der Stadt wird stets eine der schönsten finanziellen Operationen unserer Zeit genannt werden. Ah! Meine Herren...«
Hier wurde seine Stimme abermals durch lautes Gelächter übertönt, welches mit einem Male an einem Ende der Tafel erscholl. Inmitten dieses Heiterkeitsausbruches konnte man die Stimme Maxime’s vernehmen, der eine begonnene Anekdote vollendete: »Warten Sie doch, ich bin noch nicht fertig. Ein armer Wegarbeiter hob die kühne Amazone auf. Man behauptet, sie habe ihn einer vortrefflichen Erziehung teilhaftig werden lassen, um ihn später zu heiraten. Sie will nicht, daß sich außer ihrem Gatten noch Jemand rühmen könne, ein gewisses schwarzes Mal oberhalb ihres Kniees gesehen zu haben.« -- Von Neuem erscholl lautes Lachen; auch Luise lachte unbefangen, lauter noch als die Herren. Und inmitten dieser Heiterkeit schob sich wie taub der ernste Kopf eines Bedienten neben jedem Gaste hin, um ihm leisen Tones getrüffeltes Huhn anzubieten.
Aristide Saccard war ungehalten über die geringe Aufmerksamkeit, welche man Herrn Toutin-Laroche zuteil werden ließ. Und um ihm zu beweisen, daß er ihm Gehör geschenkt, wiederholte er:
»Die städtische Anleihe...«
Herr Toutin-Laroche aber war nicht der Mann, der sich aus dem Konzepte bringen läßt und als sich das allgemeine Gelächter ein wenig gelegt hatte, nahm er von Neuem auf:
»Oh! meine Herren, der gestrige Tag brachte uns einen großen Trost, da ja unsere Verwaltung so vielen unlauteren Angriffen ausgesetzt ist. Man beschuldigt den Magistrat, die Stadt zu Grunde zu richten und nun sehen Sie, daß sobald die Stadt ein Anlehen aufnehmen will, uns von allen Seiten, selbst von den ärgsten Schreiern, Geld in Hülle und Fülle angeboten wird«
»Sie haben ein Wunder vollbracht«, sagte Saccard. »Paris ist die Hauptstadt der Welt geworden.«
»Ja, das ist wirklich wunderbar«, unterbrach ihn Herr Hupel de la Noue. »Denken Sie doch, ich, der ich ein alter Pariser bin, erkenne mein Paris nicht mehr! Als ich gestern vom Stadthause nach dem Luxembourg-Garten gehen wollte, verirrte ich mich. Erstaunlich, in der Tat!«
Eine Pause trat ein. Alle ernsten Herren hörten jetzt aufmerksam zu.
»Die gänzliche Umänderung der Stadt«, fuhr Herr Toutin-Laroche fort, »wird der Regierung zum Ruhme gereichen. Das Volk ist undankbar; es sollte die Füße des Kaisers küssen. Ich äußerte mich heute Morgens in diesem Sinne auch in der Magistratssitzung, wo man von dem großen Erfolge des Anlehens sprach. ›Meine Herren‹, sagte ich, ›lassen Sie diese oppositionellen Krakehler schreien; Paris umstürzen heißt dasselbe fruchtbar machen.‹«
Lächelnd schloß Saccard die Augen, wie um den geistreichen Sinn dieser Worte besser zu genießen. Er neigte sich hinter dem Rücken der Frau von Espanet zu Herrn Hupel de la Noue und bemerkte laut genug, daß es Jedermann vernehmen konnte:
»Er hat einen bewunderungswürdigen Geist.«
Seitdem von den öffentlichen Arbeiten der Stadt die Rede war, hielt Herr Charrier den Hals vorgestreckt, als wollte er an der Unterhaltung teilnehmen. Sein Verbündeter, Herr Mignon, der mit Frau Sidonie beschäftigt war, wurde von dieser entsprechend bearbeitet. Seit dem Beginn des Diners überwachte Saccard die beiden Unternehmer verstohlen.
»Die Stadtverwaltung hat viel guten Willen angetroffen«, sagte er jetzt, »Jedermann wollte das Seinige zu dem großen Werke beitragen. Ohne den ausgiebigen materiellen Beistand, welcher der Stadt von allen Seiten entgegengebracht wurde, waren diese Erfolge schwerlich erzielt worden.«
Er wandte sich zu den beiden Maurermeistern und fügte mit einer Art brutaler Schmeichelei hinzu:
»Die Herren Mignon und Charrier wüßten Einiges davon zu erzählen; sie, die ihren Anteil an der Mühe hatten, aber auch den Ruhm mitgenießen werden.«
Die reich gewordenen Maurer nahmen die Worte mit behaglichem Schmunzeln hin. Mignon, zu dem Frau Sidonie gerade gezierten Tones sagte: »Ach, mein Herr, Sie schmeicheln nur; die rosa Farbe wäre zu jugendlich für mich...« wandte sich inmitten des Satzes weg von ihr, um Saccard zur Antwort zu geben:
»Sie sind sehr gütig; wir haben unser Geschäft dabei gemacht.«
Charrier aber ging schlauer ins Zeug. Er leerte sein Glas Pomard und brachte die Phrase zu Stande:
»Die öffentlichen Arbeiten haben dem Arbeiter Brot gegeben.«
»Aber auch den finanziellen und gewerblichen Angelegenheiten einen herrlichen Aufschwung«, fügte Herr Toutin-Laroche hinzu.
»Die künstlerische Seite nicht zu vergessen! Die neuen Straßenanlagen sind majestätisch!« bemerkte Herr Hupel de la Noue, der sich etwas darauf zu Gute tat, daß er Geschmack hatte.
»Ja, ja, es ist ein schönes Stück Arbeit«, murmelte Herr von Mareuil, nur um auch etwas zu sagen.
»Und was die Ausgaben betrifft«, erklärte der Abgeordnete Haffner, der den Mund nur bei großen Anlässen öffnete; »so werden unsere Kinder für dieselben aufkommen und das wird nur recht und billig sein.«
Und da er bei diesen Worten Herrn von Saffré anblickte, mit dem die niedliche Frau Michelin seit einigen Minuten zu schmollen schien, so wiederholte der junge Sekretär, um zu beweisen, daß er dem Gespräche gefolgt war:
»In der Tat, das wird nur recht und billig sein.«