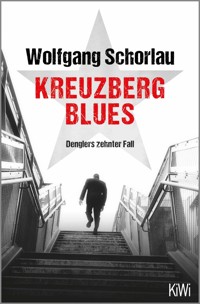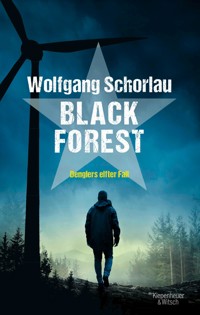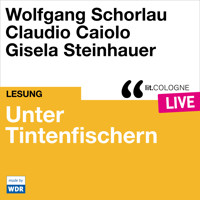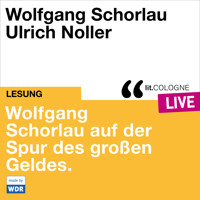9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dengler ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein Flugzeugabsturz, eine mysteriöse Liste und ein Privatdetektiv auf der Suche nach der Wahrheit – der fesselnde Auftakt der Krimi-Reihe von Wolfgang Schorlau. Privatdetektiv Georg Dengler, früher Zielfahnder beim BKA, nimmt einen scheinbar einfachen Fall an: Die Freundin eines Anrufers möchte wissen, warum ihr Vater vor zwölf Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, obwohl er sie zuvor angerufen hatte und sagte, er habe die Maschine verpasst. Doch als Dengler beginnt nachzuforschen, stößt er auf Verbindungen zu brisanten Ereignissen der deutschen Wendezeit. Der Vermisste war Mitarbeiter der Treuhand und Verfasser der »Blauen Liste« – eines Dokuments, das der Deutschen Vereinigung einen völlig anderen Weg wies. Je tiefer Dengler gräbt, desto gefährlicher wird es für ihn. Denn der Fall führt zurück zum Attentat auf den Treuhand-Präsidenten Rohwedder, zur RAF und zum mysteriösen Tod von Wolfgang Grams. Kann Dengler die Wahrheit aufdecken, bevor es zu spät ist? Wolfgang Schorlau verwebt in »Die blaue Liste« geschickt reale Ereignisse zu einem fesselnden Politthriller. Ein Muss für Fans intelligenter Krimis mit zeitgeschichtlichem Hintergrund. Alle Fälle von Georg Dengler: - Die blaue Liste - Das dunkle Schweigen - Fremde Wasser - Brennende Kälte - Das München-Komplott - Die letzte Flucht - Am zwölften Tag - Die schützende Hand - Der große Plan - Kreuzberg Blues - Black ForestDie Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Wolfgang Schorlau
Die blaue Liste
Denglers erster Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Wolfgang Schorlau
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Wolfgang Schorlau
Wolfgang Schorlau lebt und arbeitet als freier Autor in Stuttgart. Neben den acht »Dengler«-Krimis »Die blaue Liste« (KiWi 870), »Das dunkle Schweigen« (KiWi 918), »Fremde Wasser« (KiWi 964), »Brennende Kälte« (KiWi 1026), »Das München-Komplott« (KiWi 1114), »Die letzte Flucht« (KiWi 1239), »Am zwölften Tag« (KiWi 1337) und »Die schützende Hand« hat er die Romane »Sommer am Bosporus« (KiWi 844) und »Rebellen« (KiWi 1399) veröffentlicht und den Band »Stuttgart 21. Die Argumente« (KiWi 1212) herausgegeben. 2006 wurde er mit dem Deutschen Krimipreis und 2012 mit dem Stuttgarter Krimipreis ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Ein spannender Politthriller … eine echte Konkurrenz für Wallander & Co« Handelsblatt
Am 1. April 1991 wird Detlev Karsten Rohwedder, Präsident der Treuhandgesellschaft, erschossen. Seinem Tod folgt eine drastische Kurskorrektur und der Ausverkauf des Ostens. Sechs Wochen nach dem Attentat stürzt eine vollbesetzte Boeing der Lauda-Air über dem Dschungel Thailands ab; 223 Menschen sterben. Im Juni 1993 wird das RAF-Mitglied Wolfgang Grams auf dem Bahnhof von Bad Kleinen erschossen. Fast zehn Jahre nach seinem Tod behauptet das Bundeskriminalamt, er sei am Tatort des Mordes an Rohwedder gewesen. Tatsächlich wurden alle drei »Geschehnisse« nie wirklich aufgeklärt. Privatdetektiv Georg Dengler, früher Zielfahnder beim BKA, ist einem Fall auf der Spur, der fast zu brisant für ihn wird und zurückführt in die Zeit der Wende und der großen Gier …
»Wenn Polizei, Justiz und Politik versagt haben, muss es den Geschichtenerzählern erlaubt sein zu sagen: Es ist nur eine Geschichte, aber vielleicht war es so.«
Inhaltsverzeichnis
Disclaimer
Widmung
Motto
Erster Teil
Düsseldorf, 1. April 1991
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Zweiter Teil
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
Nachwort
Hilfen
Danke
Leseprobe »Black Forest«
Die Handlung des vorliegenden Romans ist fiktiv. Die Figuren, mit Ausnahme der Personen der Zeitgeschichte, sind erfunden. Sofern die Personen der Zeitgeschichte in diesem Buch handeln oder denken wie Romanfiguren, ist auch das erfunden (siehe auch das Nachwort zu diesem Buch).
Für David
Leave your ego, play your music
and love the people.
Luther Allison
Dennoch hat der Schriftsteller vor allem zu befürchten,
dass er, wenn er nichts mehr zu sagen hat,
auf einmal geistreich wird.
Imre Kertész
Erster Teil
Düsseldorf, 1. April 1991
Eine halbe Stunde vor Mitternacht betrat der Präsident sein Arbeitszimmer im ersten Stock.
Er fühlte sich sicher, denn schließlich war er einer der bestbewachten Männer Deutschlands. Vor der Eingangstür seines Hauses stand ein Polizeifahrzeug mit vier bewaffneten Beamten, die halbstündlich um sein Haus patrouillierten. Kurz nach seinem Amtsantritt waren die Fenster des Erdgeschosses seines Privathauses mit kugelsicherem Glas ausgestattet worden. Morgen früh um sieben Uhr würde ihn eine Eskorte bewaffneter Polizisten der Einsatzgruppe Bonn des Bundeskriminalamtes in einem gepanzerten BMW zum Flughafen Lohhausen fahren, und bei seiner Ankunft in Tegel würde ihn direkt auf dem Rollfeld eine weitere Kolonne von zivilen Polizeifahrzeugen erwarten, die ihn sicher zu seinem Berliner Amtssitz bringen würde.
Niemand hatte ihm jedoch gesagt, dass die Sicherheitsstufe für sein Düsseldorfer Wohnhaus herabgesetzt worden war, von der höchsten Stufe »Eins« auf »Zwei«, während die Vorkehrungen an seinem Berliner Arbeitsplatz auf der höchsten Ebene beibehalten worden waren. Diese Anweisung, deren Urheber man nie feststellen würde, führte auf dem üblichen Dienstweg zu der geänderten Vorschrift an die Besatzung des Streifenwagens: In Zukunft sei auf Kontrollen des Schrebergartenviertels zu verzichten, das seiner Wohnung gegenüberlag.
Deshalb blieben die beiden Männer ungestört, die sich dort in einem der Kleingärten aufhielten. Der Jüngere spähte unentwegt durch ein Fernglas zum schräg gegenüberliegenden Haus und gab seine Beobachtungen an einen hageren, durchtrainiert wirkenden Mann mit fahlgelbem Bürstenhaarschnitt weiter, der noch einmal den Sitz des Zielfernrohrs auf dem militärischen Präzisionsgewehr prüfte.
Der Präsident setzte sich in den wuchtigen, mit dunkelblauem Leder bespannten Sessel und zog sich mit einer schnellen Bewegung an den Schreibtisch heran. Er fand in der Dunkelheit die beiden Schalter für die Schreibtischleuchte und für die hinter einer Holzblende verborgenen Lampen des Bücherregals. Der Raum erleuchtete sich.
Vor ihm lag noch immer das Dokument, über das er seit drei Wochen unentwegt grübelte. Er hatte den Text so oft gelesen, dass er ihn nahezu auswendig konnte. Es waren sechs eng beschriebene, auf blaues Papier gedruckte Seiten, auf denen der Verfasser weder rechts noch links einen Rand für Notizen gelassen hatte, so als würde seine Beweisführung jeden schriftlichen Kommentar erübrigen.
Der Präsident, ein kräftiger, hoch gewachsener Mann mit zurückfliehendem Haaransatz, lehnte sich in seinem Sessel zurück. In der rechten Hand hielt er die Blaue Liste, wie er das Dokument insgeheim nannte, und dachte nach.
Für Detlef Karsten Rohwedder war die Präsidentschaft der Berliner Treuhandgesellschaft das dritte wichtige Amt, das er ausfüllte. Lange Jahre hatte er unter Bundeskanzler Helmut Schmidt als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium gearbeitet, bevor er sich hatte überreden lassen, den Chefposten im angeschlagenen Hoesch-Konzern zu übernehmen. In wenigen Monaten gelang ihm die Sanierung des Stahlunternehmens, ohne dass ein Arbeiter entlassen werden musste. Diese Meisterleistung, verbunden mit seiner politischen Erfahrung, war der Grund, warum ihn Helmut Kohl auf den Chefposten der Treuhandgesellschaft berief.
Die letzte Regierung der DDR hatte beschlossen, das produktive Eigentum des Staates in einer einzigen Gesellschaft zusammenzufassen. Die Treuhandgesellschaft wurde zu einem Superkonzern, der alle staatlichen Betriebe der DDR besaß. Unmittelbar nach der Wiedervereinigung hatte die Bundesregierung Rohwedder zu ihrem Präsidenten berufen.
Anfänglich schwebte ihm eine ähnliche Lösung vor, wie er sie für den Hoesch-Konzern angewandt hatte. Er plante, die maroden Betriebe zu sanieren, ohne die dort Beschäftigten zu Tausenden auf die Straße zu setzen. Als überzeugtem Sozialdemokraten widerstrebte ihm die Hau-Ruck-Methode mancher Manager, die mit möglichst wenig Arbeitern und Angestellten optimale Betriebsergebnisse erzielen wollten.
Rohwedder war sich jedoch darüber im Klaren, dass er sich mit seiner Haltung angreifbar machte. Im Verwaltungsrat der Treuhand saßen etliche Vertreter von Firmen aus dem Westen, die ihre östlichen Konkurrenten aufkaufen wollten, um sich deren Märkte anzueignen. Sie befürchteten, durch Rohwedders Kurs würden im Ostteil Deutschlands neue Wettbewerber herangezüchtet. Keiner sagte dem Präsidenten ins Gesicht, dass man gegen seine Linie opponierte, aber Rohwedder spürte genau, wie sein Einfluss schwand.
Vor einigen Wochen hatte die Leipziger Bevölkerung die Montagsdemonstrationen wieder aufgenommen, mit denen sie vor zwei Jahren Erich Honecker vertrieben hatte. Nun verlangten die Menschen die schnelle Angleichung ihrer Lebensbedingungen an die der westlichen Bundesländer. Diese Aktionen lösten im Bonner Bundeskanzleramt eine Welle aufgeregter Aktivitäten aus. Fast täglich riefen hohe Ministerialbeamte aus Bonn an und forderten ihn auf, etwas gegen diese Demonstrationen zu unternehmen. Diese Leute, so sagte einer von ihnen, haben schon einmal eine Regierung gestürzt; sie werden vor uns nicht Halt machen.
Nachdenklich betrachtete der Präsident die Blaue Liste auf seinem Schreibtisch. Wenn er den Vorschlägen des Dokumentes folgen wollte, müsste er jetzt handeln. Noch konnte er sich im Verwaltungsrat durchsetzen. Sein Deutschlehrer hatte oft Shakespeare zitiert: »Der bessere Teil der Tapferkeit ist die Vorsicht.« – Er würde geschickt vorgehen müssen.
Für eine flächendeckende Umsetzung des Konzeptes fände er keine Mehrheit im Verwaltungsrat. Alle Vorgespräche, die er mit Wirtschaftsvertretern und Beamten aus dem Kanzleramt führte, hatten ihm signalisiert, dem Konzept der Blauen Liste würde entschiedener Widerstand entgegensetzt, selbst wenn dies der einzige Weg war, die Betriebe des Ostens zu erhalten. Er wollte dem Gremium einen Testlauf vorschlagen: Mit nur wenigen, vielleicht mit den dreißig Betrieben, die in der Blauen Liste vorgeschlagen wurden, würde die Treuhand ein Experiment starten. Wenn es gelänge – daran zweifelte er nicht –, würde er den Versuch ausdehnen können.
Nun atmete er freier. So könnte es funktionieren. Mit der Rechten nahm er die Liste und las den Text erneut aufmerksam. Als er das letzte Blatt zur Seite legte, war er sicher, er konnte Tausende von Beschäftigten vor Arbeitslosigkeit und Abwanderung bewahren.
Doch er musste sich beeilen. Jetzt gleich wollte er die Beschlussvorlage für die Sitzung diktieren. Während er in Gedanken die ersten Sätze formulierte, sah er sich nach seinem Diktiergerät um und entdeckte es auf dem metallenen Regal hinter sich.
Er stand auf, lächelnd und zuversichtlich; mit der Blauen Liste in der Hand trat er zu dem Bücherbord und wandte dem Fenster seines Arbeitszimmers den Rücken zu.
Die Attentäter warteten bereits seit vielen Stunden in einem umzäunten Schrebergarten kaum hundert Meter von Rohwedders Haus entfernt. Die beiden Männer waren am Nachmittag erschienen und hatten den Eindruck erweckt, als ob sie zu einem gemütlichen Samstag in die Kleingartenanlage schlenderten, ausgerüstet mit einigen Dosen Bier in den beiden Kühltaschen und in Erwartung einer Radioübertragung des Spiels von Borussia Dortmund.
In den Taschen trugen sie jedoch kein Bier, sondern ein NATO-Präzisionsgewehr und, in ein Handtuch eingeschlagen, das Zielfernrohr.
Der Jüngere der beiden, der aussah, als habe er die dreißig noch nicht überschritten, legte das Bekennerschreiben, das er in eine Klarsichthülle gesteckt hatte, um es vor möglichem Frühjahrsregen zu schützen, neben den Campingstuhl, den er von der kleinen Terrasse des Gartenhäuschens geholt und wortlos aufgestellt hatte.
Der ältere, wesentlich sportlicher wirkende Mann hatte die Kühlboxen geöffnet und das Gewehr zusammengesetzt. Er sprach nur wenig. Er überwachte die Platzierung des Schreibens, ohne dass er es las, was den jüngeren irritierte, denn er hatte viele Stunden grübelnd über einem Schreibheft gehockt, bevor er mit dem Text zufrieden gewesen war. Jetzt befahl ihm der Ältere, das Fernglas zu nehmen und ihm seine Beobachtungen zuzuflüstern, während er selbst unbeweglich auf seinem Campingstuhl kauerte.
Erst als das Licht im Arbeitszimmer aufflammte, geriet der Fahlgelbe in Bewegung. Er stellte sich auf die Sitzfläche des Hockers und sah durch das Zielfernrohr hinüber zum Haus.
Das körnige Licht des Zielfernrohrs schuf eine seltsame Intimität zwischen dem Präsidenten und seinem Attentäter. Er konnte die gestreifte Struktur von Rohwedders Hemd erkennen, sah, wie sich die Falten seiner Stirn beim Lesen eines Schriftstücks zusammenzogen und wieder entspannten.
Als der Mann am anderen Ende der Schussbahn aufstand, um zum Bücherregal zu gehen, zielte sein Mörder auf jene Stelle im Rücken, auf die zu zielen man ihn gelehrt hatte.
Das Geschoss zerriss Luft- und Speiseröhre des Präsidenten, zerfetzte seine Aorta und das Rückgrat. Er war tot, noch bevor sein Körper auf dem Boden des Arbeitszimmers aufschlug.
Der Mann blieb auf dem Campingstuhl stehen. Durch das Präzisionsobjektiv sah er die Frau des Präsidenten ins Zimmer stürmen und verletzte sie mit einem zweiten Schuss am Arm. Als sie aus dem Zimmer floh, hob er die Waffe noch einmal an, zielte und setzte einen dritten Schuss in das Bücherregal. Dann erst stieg er herunter. Der Jüngere sammelte die drei Patronenhülsen auf und deponierte sie säuberlich nebeneinander geordnet auf der Sitzfläche des Campinghockers. Nun verließen sie auf vorher geplantem Weg den Tatort.
1
Das erste Licht verwandelte den Tisch, der unter dem Fenster stand, allmählich aus einem Schatten in ein Möbelstück zurück. Georg Dengler lag bereits eine Stunde wach.
Die Zeit der Morgendämmerung gefiel ihm. Er fand es fair, dass der Tag der zurückweichenden Nacht gestattete, das Gesicht zu wahren, und nur behutsam das Regime über die Gegenstände des Raumes übernahm. Die zwei überlangen Schatten an der Wand schrumpften zu den beiden Flaschen Merlot, die er gestern Abend getrunken hatte, und die dunklen Inseln auf dem Fußboden entpuppten sich innerhalb weniger Minuten als die achtlos hingeworfenen Kleidungsstücke, derer er sich gestern Abend hastig entledigt hatte.
Kaum fanden die Dinge im Zimmer ihre ursprünglichen Konturen wieder, rollte er sich noch einmal auf die Seite. Das Federbett wärmte ihn, und Dengler schloss mit dem Fuß eine Lücke zwischen Decke und Leintuch, durch die für einen Augenblick irritierend kalte Luft eingedrungen war.
In diesen frühen Stunden vermisste er die Nähe eines weiblichen Körpers. Er sehnte sich danach, sich an den Rücken einer schlafenden Frau zu schmiegen, und stellte sich vor, wie er seine Hand um ihre Taille legen, ihre Haut spüren und ihrem Atem lauschen würde. Er blätterte in seiner Erinnerung wie in einer erotischen Kartei, fand aber kein Vorbild für die Frau, die er sich in diesem Augenblick wünschte.
Ich will mich verlieben – dieser Gedanke gefiel ihm nicht. Gestern Abend war er noch spät in die Weinstube Fröhlich gegangen, um seine neue Freiheit mit einem Glas Grauburgunder zu feiern. Doch berührte ihn das Lächeln der jungen Frau, die ihm das Glas an den Tisch brachte, so unerwartet, dass er für einen Augenblick glaubte, es habe ihm selbst gegolten und sei nicht eine professionelle Mimik für den späten Gast. Unauffällig und ein wenig eifersüchtig hatte er beobachtet, ob sie den drei Studenten am Nachbartisch ein ähnlich offenes Lächeln schenken würde. Als sie es nicht tat, leerte er sein Glas in zwei Schlucken und zahlte bei ihrem Kollegen an der Theke.
Inzwischen lärmte auf der Straße die Müllabfuhr.
Georg Dengler wartete einen Augenblick, ob der fast schon vertraute, schmerzende Stich im Kreuz einsetzen würde. Doch heute schmerzte sein Rücken nicht, und so warf er schnell die Decke zurück. In zwei Schritten stand er vor dem CD-Spieler, drückte die Play-Taste, reckte sich und registrierte ungeduldig das kurze Grummeln, mit dem die Maschine sich in Gang setzte. Dann endlich sang Junior Wells einen Willie-Dixon-Blues. Seine raue Stimme füllte Denglers kleines Zimmer, und die Pianosoli von Otis Spann plätscherten durch den Raum.
I don’t want you
To be no slave
I don’t want you
To work all day
I don’t want you
’Cause I’m kind of sad and blue
I just want to make love to you
Dengler drehte den Ton lauter und begann mit den allmorgendlichen Liegestützen. Aus den Augenwinkeln sah er jedes Mal, wenn er sich vom Boden abstemmte, die Marienstatue an der Wand. Bald ist die Farbe völlig abgesprungen, dachte er, und tatsächlich war von dem ehemals blauen Umhang nur noch an wenigen Stellen die Farbe zu sehen. Dunkles Holz trat hervor, und der Heiligenschein war vollständig abgegriffen.
Nach dem dreißigsten Liegestütz schwitzte er. Und als er sich nach der sechzigsten Übung erhob, beobachtete ihn die Madonna immer noch. Junior Well’s Mundharmonika lieferte sich ein Duell mit Buddy Guys Gitarre. Er drehte die Musik noch lauter und ging ins Bad.
Nach dem Duschen zog er sich an und benötigte wie üblich zwanzig Minuten dafür. Die einfarbigen, dunkelblauen Boxershorts sollten zu den neuen Jeans passen, er wählte ein helles, leicht ockerfarbenes Shirt. Es passte zu dem dunkelblauen Jackett, in das er nun mit einer schnellen Bewegung schlüpfte.
Noch ohne Schuhe ging er in seinen Büroraum und fuhr den Rechner hoch. Als die Eingabeaufforderung für das Kennwort aufleuchtete, drückte Dengler mit der Esc-Taste dieses Fenster fort. Er brauchte kein Passwort. Über den Netscape-Navigator loggte er sich ins Internet ein und rief die Seite der Citibank auf.
Sein Guthaben betrug 4578,34 Euro. Das Bundeskriminalamt hatte ihm sein letztes Gehalt immer noch nicht überwiesen. In einer Woche würden Miete, Nebenkosten und die monatliche Überweisung ans Jugendamt fällig werden. Hoffentlich traf bis dahin das Geld ein. Er überlegte: Zwei oder drei Monate würde er mit diesem Betrag über die Runden kommen. Er musste unbedingt Geld verdienen. Dengler verließ das Internet, startete Word und begann, die Anzeige zu entwerfen.
Kurz vor neun Uhr nickte er zufrieden. Er las den Text noch einmal sorgfältig durch, korrigierte zwei Schreibfehler und druckte ihn aus. Das Blatt steckte er in die Innentasche seines Jacketts. Er zog ein paar schwarze Slipper an und verließ die Wohnung.
Nach drei Minuten erreichte er das Brenners. Mario saß bereits an einem kleinen Tisch an der Fensterfront des Lokals und rührte in einem Milchkaffee. Er winkte ihm zu. Als Dengler eintrat, nölte Bob Dylan mit ungewohnt engagierter Stimme aus den Lautsprechern:
You got gangsters in power
and lawbreakers making rules.
When you gonna wake up …
»Darf ich mich setzen?«
»Ich frühstücke nicht mit Bullen.«
»Ich bin kein Bulle mehr.«
»Einmal Bulle, immer Bulle.«
Beide lachten; dann lagen sie sich in den Armen.
Mario und Dengler stammten beide aus Altglashütten, einem kleinen Dorf im Südschwarzwald. Denglers Mutter bewirtschaftete nach dem Tod seines Vaters den kleinen Bauernhof alleine weiter, bis sie ihn vor einigen Jahren in eine Ferienpension umbauen ließ. Marios Mutter wohnte in einer Zweizimmerwohnung im ersten Stock des Dorfbahnhofes. Tagsüber arbeitete sie bei der Rhodia, einem Chemiewerk in Freiburg.
Sie hatte nie geheiratet, und niemand außer ihr wusste, wer Marios Vater war. Ein schöner Italiener – mehr gab sie nie preis.
Mario sah man seinen italienischen Vater sofort an. Er war nicht sonderlich groß gewachsen, maß sicherlich nur wenig über einen Meter siebzig. Die schwarzen Haare trug er schulterlang, streng nach hinten gekämmt und häufig mit einem Haarband mühsam gebändigt. Sein Vater hatte ihm das lebhafte Temperament vermacht, das Gestikulieren mit beiden Händen, das Argumentieren mit dem ganzen Körper.
Obwohl er drei Jahre jünger war als Dengler, wählte er sich damals den Älteren als Freund und ließ sich davon auch dann nicht abbringen, als Georg die Anhänglichkeit des Jüngeren unangenehm, ja ärgerlich wurde und er ihn fortschickte. Doch am nächsten Tag war Mario wieder da, als habe er das sichere Gefühl, dass sie, die beiden vaterlosen Außenseiter der Dorfgemeinschaft, letztlich für eine Freundschaft bestimmt seien, die mehr als nur den Altersunterschied überstehen würde. Irgendwann kapitulierte Georg und akzeptierte die Gefolgschaft des Jüngeren, zunächst nur als eine Art Eleve, den er mit kleineren Aufträgen und Diensten demütigte, doch schon bald als seinen besten und einzigen Freund anerkannte.
Später trennten sich ihre Wege, doch die Verbindung riss nie ab. Mario begann in Freiburg eine Anstreicherlehre, die er bald wieder abbrach. Danach malte er Bilder, immer Vater-und-Sohn-Motive, alle entweder in einem toskanischen Ocker gehalten oder in einer Farbsinfonie von Rot, Blau und Gelb. Dengler wusste, dass ein Sammler ihm ein- oder zweimal im Jahr ein Bild abkaufte, doch wer dieser Käufer war, verriet Mario niemandem, nicht einmal Georg.
Mit der gleichen Besessenheit, mit der Mario die großen Leinwände füllte, erschuf er sich seine italienische Identität, wie eine zweite, selbst erwählte Haut. Er erlernte die Sprache seines unbekannten Vaters mit einer Verbissenheit und Energie, die der grüblerische Dengler nie aufgebracht hätte. Du weißt, ich werde nie damit zufrieden sein, antwortete Mario jedes Mal, wenn Georg sich nach dem Fortschritt seiner Sprachstudien erkundigte.
Ebenso stürzte er sich mit einer nie enden wollenden Begeisterung aufs Kochen. Zunächst erlangte er eine reife Meisterschaft in allem, was er für italienische Küche hielt: Pasta in allen Varianten, Schwertfisch, Kalbfleisch in Zitronensauce. Dann erschloss er sich die badische, später die französische Küche. Obwohl er gerne las, erfreute ihn ein neues Kochbuch mehr als ein guter Roman.
Als Mario sich in Sonja verliebte, dämpfte dies seine manische Art, sich in einen echten Italiener zu verwandeln. Ihr zuliebe zog er nach Stuttgart, in eine kleine Wohnung im obersten Stockwerk eines großen Hauses in der Mozartstraße. Dort betrieb er nun in ihrem gemeinsamen Wohnzimmer ein Einzimmerrestaurant, das er halb Sonja, halb seinem Lieblings-Beaujolais zuliebe »St. Amour« nannte. Für siebzig Euro pro Person kochte er die besten Gerichte, die Dengler je aß, und die erlesensten Menüs, die in Stuttgart zu haben waren. Im Preis enthalten waren ausgewählter Wein und ein Glas besten Crèmants. Kein Wunder, Marios Wohnzimmer wurde bald zum Geheimtipp von Stuttgarts Künstlerszene.
»Es ist klasse, dass wir beide wieder in derselben Stadt wohnen«, sagte Mario, »warum hast du dir eigentlich Stuttgart ausgesucht?«
»Mein Sohn Jakob wohnt hier. Er ist jetzt bald alt genug zu entscheiden, wohin er nach Schulschluss geht. Und ich hoffe, er kommt hin und wieder zu mir.«
»Weißt du, Georg«, Mario wechselte rasch das Thema, als er sah, dass sein Freund nachdenklich auf die Tischdekoration starrte, »die Schwaben sind gar nicht so schlecht wie ihr Ruf.«
Sie wurden von der hübschen, rothaarigen Bedienung unterbrochen, die sie nach ihren Wünschen fragte. Mario empfahl Dengler Weißwürste. Bei Brenners gäbe es die besten der Stadt. Die Frau notierte ihre Bestellung.
»Als ich erst einige Wochen in Stuttgart wohnte, habe ich in der Straßenbahn das ganze Ausmaß der schwäbischen Subversivität kennen gelernt«, sagte Mario. »Interessiert es dich?«
Dengler nickte.
»Ich fuhr mit der Straßenbahn in die Stadt, um in dem kleinen Waschsalon am Hölderlinplatz meine Wäsche zu waschen. Sonja hatte mir einen Stapel Slips mitgegeben, die sie oben in die Tasche gelegt hatte. Da es nur ein paar Stationen waren, setzte ich mich nicht, sondern blieb an der Tür stehen und las in der neuen Ausgabe des Feinschmecker einen Artikel über die neue spanische Küche, von einem spanischen Superrestaurant bei Barcelona, heißt übrigens El Bulli – bei diesem Namen musste ich gleich an dich denken.«
Dengler seufzte nachsichtig; er hatte davon noch nie gehört.
»Plötzlich kippt meine Tasche um – und Sonjas Höschen purzeln durch die Straßenbahn. Ich musste sie vor aller Augen unter den Sitzen der Leute wieder aufsammeln.«
Mario nahm einen Schluck Kaffee und fuhr fort. »Und während ich zwischen den Sitzen umherkrieche und die Slips zusammensuche, fängt ein älterer Mann im Lodenmantel an, lautstark mich zu beschimpfen, ich sei ein perverses Schwein. Ich bin völlig verdutzt. Da springt mir eine Frau zur Hilfe. Sie legt ihre Hand auf meinen Arm und sagt in breitestem Schwäbisch: ›Sie müsset die Frauen wohl sehr lieben!‹«
Dengler lachte.
»Im gleichen Augenblick«, sagte Mario, »greift ein Typ in Anzug und Krawatte ganz nebenbei nach Sonjas String-Tanga und stopft ihn in die Innentasche seines Jacketts. Ich schreie ihn an, er solle das Höschen hergeben; wir hätten nicht so viel Kohle, um unsere Unterwäsche in der Straßenbahn zu verschenken. Und außerdem sieht Sonja in diesem Zeug ziemlich scharf aus. Als ich dann am Charlottenplatz aussteige, kommt plötzlich ein anderer Mann auf mich zu und flüstert im Verschwörerton: ›Hier, ich habe auch noch eines gefunden‹, und zieht einen weiteren Slip aus seiner Manteltasche und steckt ihn mir heimlich zu. – Und zum Schluss stellt sich heraus, dass immer noch zwei fehlten.«
Beide lachten, doch dann wurde Mario plötzlich ernst: »So, und jetzt erzähl, warum du kein Bulle mehr bist.«
»Weißt du«, Georg hielt einen Moment inne, »es hat mit einem Traum zu tun …«
»Erzähl! Ich nehme Träume ernst.«
»Ich werde verhaftet und lande in einer großen weißen Zelle, völlig ausgeleuchtet, ganz hell, wie man sie eher in einer Irrenanstalt als in einem Gefängnis finden würde, eine Fledermaus hängt kopfunter am Türrahmen und schaut mir zu. Ich werde an Händen und Füßen an ein Bett gebunden. Plötzlich steht die gesamte Führungsriege des BKA um mich herum. Der Präsident brüllt mich an: Sie haben heute noch nicht gelogen! Dann schreit der Abteilungsleiter: Sie haben heute noch nicht gelogen! Und zum Schluss grölen sie im Chor: Sie haben heute noch nicht gelogen! – so laut und so lange, bis ich aufwachte.«
Dengler fuhr fort: »Tatsache ist: Ich habe drei der meistgesuchten Terroristen verhaftet. Das ist nicht wenig für einen einzelnen Beamten. Aber bei den letzten Fällen wurde mir zunehmend unheimlich. Es gab immer wieder Hinweise, dass bestimmte Straftaten nur mit genauer Kenntnis der Polizeiarbeit begangen werden konnten. Doch jedes Mal, wenn ich in diese Richtung ermittelte, wurde ich zurückgepfiffen.«
»Warum?«
»Ermittlungsökonomie, wurde mir gesagt. Ich solle nicht Zeit und Geld in aussichtslose Ermittlungsstränge verschwenden. Jedes Mal, wenn sich die Dinge nicht in Richtung Terrorismus verdichteten, griffen die Vorgesetzten ein und stoppten die entsprechenden Projekte. Eine Zeit lang versuchte ich auf eigene Faust aufzuklären, aber das war schwer. Schließlich wurde mein direkter Chef, den ich eingeweiht hatte und der mir vertraute, in den Ruhestand versetzt. Dann verließ mich Hildegard mit dem Kleinen. Und dann kam dieser Traum.«
Beide schwiegen. Die Rothaarige brachte ihnen die Weißwürste. Sie aßen.
»Und nun willst du hinter untreuen Ehefrauen herjagen«, sagte Mario.
»Oder hinter untreuen Ehemännern.«
»Untreue Ehefrauen sind interessanter als untreue Ehemänner.«
»Das ist wahr.«
»Eigentlich ist das ungerecht. Wenn eine Frau fremdgeht, erntet sie Bewunderung: Sie verwirklicht sich selbst, bricht aus ihrem gewohnten Leben aus, ist eine Heldin. Betrügt jedoch ein Mann seine Frau, sagt jeder, das ist ein widerlicher geiler Sack. Wieder so ein Fall, in dem wir Männer benachteiligt sind.«
Dengler sagte: »Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe.«
»Wie meinst du das?«
»Wenn ein Tyrann einen Sklaven erschlägt, sagen wir zu Recht, er ist ein Verbrecher. Erschlägt jedoch ein Sklave den Tyrannen, so gilt ihm unsere Sympathie. Dem gesellschaftlich Schwächeren gilt unser Mitgefühl, wenn er einen Reichen oder gar die Obrigkeit betrügt. Dann kann das Verbrechen als eine Art ausgleichende Gerechtigkeit erscheinen. Wenn der Bankräuber seine Beute mit den normalen, einfachen Leuten teilt, wird er zum Helden. Aber solche Fälle gibt es schon lange nicht mehr.«
»Und die ehebrechende Frau ist uns sympathischer als der untreue Mann, weil die Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind.«
»So ist es.«
»Dem Verbrecher nutzt die Sympathie nichts. Wenn er geschnappt wird, wird er trotzdem bestraft.«
»Na ja, so einfach ist es nicht. Mein früherer Chef erzählte mir, die oberen Chargen in den siebziger Jahren hatten eine höllische Furcht davor, dass Baader-Meinhof nach einem Bankraub Geld auf der Straße an Passanten verteilten. Oder dass sie bei Entführungen verlangten, alle Sozialhilfeempfänger sollten 500 Mark bekommen oder solche Sachen. Wenn ein Verbrecher Ansehen in der Öffentlichkeit genießt, hat das für die Polizeiarbeit weit reichende Folgen. Es kann nötig sein, diese Zustimmung zu zerstören.« Er strich sich mit einer schnellen Bewegung ein paar Haare aus der Stirn: »Aber diese Sachen habe ich alle hinter mir.«
Dann zog er den Computerausdruck aus der Tasche und schob ihn zu seinem Freund über den Tisch.
»Das ist der Text für die Anzeige, die ich in den Stuttgarter Nachrichten aufgeben will.«
»Georg Dengler – Private Ermittlungen«, las Mario, »das hört sich an wie in einem amerikanischen Film. Hoffentlich gibt es viele betrogene Ehemänner in Stuttgart. Sonst helfe ich gern ein bisschen nach.«
Dengler lachte nicht.
Mario sagte: »Entschuldige, du weißt, wir Italiener können nichts anderes als blöde Witze machen.«
»Mario, das stimmt nicht: Ihr könnt auch Opern singen und Spaghetti kochen.«
Sie lachten.
Die rothaarige Bedienung räumte ihre leeren Teller ab. Dengler bestellte für sich einen doppelten Espresso mit ein bisschen Milch. Mario nahm noch einen Milchkaffee. Als beides vor ihnen stand, wurde Mario plötzlich ernst.
»Georg, ich habe eine Bitte.«
»Schieß los.«
»Du weißt doch – meine Mutter lag zehn Tage in der Uniklinik in Freiburg.«
Dengler nickte.
»In dieser Zeit habe ich etwas getan, dessen ich mich schämen sollte. Ich habe in ihren Unterlagen nach Hinweisen auf meinen Vater gewühlt – und ich fand ein Foto. Ein Foto von meinem Vater. Und einen Brief von ihm. Ich weiß, wie er aussieht, und ich weiß, wie er heißt: Caiolo, Stefano Caiolo.«
»Und?«
»Ich will ihn suchen. Ich habe im Internet gesucht. Es gibt einen Stefano Caiolo. In einem kleinen Dorf am Comer See.«
Georg sah Mario an. Er spürte eine Unsicherheit an seinem Freund, wie er sie zuvor noch nie an ihm beobachtet hatte. Es schien, als würde Mario innerlich zittern, und er kam Georg plötzlich dünn und durchsichtig vor. Merkwürdig, dachte er, nun sind wir beide erwachsene Männer, die Liebe und Tod erlebt haben, und trotzdem gibt es Dinge, die uns wieder zu den ängstlichen Buben machen, die wir einmal waren.
»Ich mache dir einen Vorschlag. Du gehst jetzt mit mir zu den Stuttgarter Nachrichten, damit ich meine Anzeige aufgebe, und ich begleite dich an den Comer See.«
»Die Weißwürste gehen auf meine Rechnung«, sagte Mario. Er zahlte, und sie verließen das Lokal.
»Das macht dann …«, die Frau am Schalter der Stuttgarter Nachrichten schob ihre Lesebrille, die an einer dünngliedrigen Messingkette um ihren Hals hing, auf die Nase, »513 Euro und 26 Cent.« Sie sah ihn über die Gläser hinweg an.
Mario stieß pfeifend die Luft aus.
Zum ersten Mal an diesem Tag peinigte Dengler sein Kreuz und schickte wellenförmig einen sanften Schmerz, den er bis zum Schulterblatt spürte. Sein Guthaben bei der Citibank schrumpfte.
»Wir nehmen auch die EC-Karte«, sagte die Frau, den Schock in seinem Gesichtsausdruck taxierend.
Dengler nickte, zog seine Karte aus dem Geldbeutel und reichte sie über die Theke zu der Frau. Sie zog die Plastikkarte mit dem Magnetstreifen nach unten durch einen kleinen blauen Apparat, der nach einer Sekunde Bedenkzeit zu rattern begann. Die Frau, deren Brille nun wieder vor ihrem Busen baumelte, rückte die Maschine vor Dengler zurecht, und Dengler tippte »1421« ein, seine Geheimzahl. Wieder schien die Maschine kurz nachzudenken, dann druckte sie einen kleinen Zettel aus, den die Frau ihm überreichte.
»Ich hoffe, die Anzeige bringt Ihnen Erfolg.«
»Das hoffe ich auch«, sagte Dengler und verließ den Tagblattturm, in dem sich die Anzeigenannahme der beiden großen Stuttgarter Zeitungen befand.
Am Freitag würde seine Annonce unter der Rubrik »Geschäftsverbindungen« erscheinen.
»Nun bist du die Hoffnung aller betrogenen Ehemänner«, sagte Mario.
Dengler fühlte sich nicht zu Scherzen aufgelegt.
»Komm am Samstagabend zu mir«, sagte Mario, »wir kochen etwas Besonderes.«
Dengler nickte, und dann verabschiedeten sie sich.
Er wartete, bis Mario im Verkehrsgewühl verschwand. Erst dann überquerte er die Rotebühlstraße und bog in die Fußgängerzone ein. Die Sonne kroch zwischen großen Wolkenbergen hervor und schuf die erste Frühlingsatmosphäre in der Stadt. Eine Amsel probte auf einem Verkehrsschild unsicher den ersten Gesang, und die Königstraße war belebt wie immer. Aus den umliegenden Büros und Ministerien drängten sich Angestellte und Beamte in die Mittagspause. Cafés und Restaurants servierten bereits im Freien.
Er ließ sich von dem Menschenstrom treiben. Er zog ihn mit sich, an dem kleinen Schlossplatz vorbei in Richtung Bahnhof.
Einer plötzlichen Eingebung folgend betrat er das Musikgeschäft Lerche. Dieser Laden unterhielt als Einziger ein eigenes Sortiment mit Bluesplatten, zwar nur im obersten Stockwerk und in der hintersten Ecke, aber immerhin. Er sah zunächst unter dem Buchstaben »W«, ob es eine neue Platte von Junior Wells gab, aber er fand nur die Aufnahme eines Chicagoer Live-Konzertes, die er schon besaß. Nun durchsuchte er systematisch das Regal und wurde unter »G« fündig. Von Buddy Guy gab es eine neue CD: »Sweet Tea« hieß sie. Er kaufte zwei Exemplare und ging wieder zurück auf die Königstraße.
Nur wenige Schritte weiter saugte der Kaufhof seine Kundschaft in zwei riesige Portale ein. Dengler brauchte einen Briefumschlag und fädelte sich in den Menschenstrom vor dem Warenhaus ein; doch dann überlegte er es sich anders, arbeitete sich aus der Menge heraus, bog in eine kleinere Gasse und dann nach links in die Lautenschlagerstraße. Nach einigen Schritten erreichte er einen kleinen Schreibwarenladen. Ein älterer Mann, dessen Gesicht mit unzähligen Altersflecken übersät war, verkaufte ihm missmutig einen DIN-A-4-Briefumschlag. Noch im Laden schrieb Dengler die Adresse auf das Kuvert. Er kannte sie auswendig: Roman Greschbach, Justizvollzugsanstalt Stammheim, Hochsicherheitstrakt A, 70439 Stuttgart. Einen Absender vermerkte er nicht.
2
»Wir haben den Tyrannen getötet«, sagte Uwe Krems, »jetzt können sich die Demonstrationen in Leipzig entfalten, und die Arbeiter werden zur direkten Aktion übergehen.«
Der Ältere verzog das Gesicht, als könne er das Gequatsche nicht mehr ertragen. Er klopfte sich eine neue Reval aus der Packung und steckte sie an.
Sie saßen nun schon drei Tage in der geräumigen Wohnung in Derendorf auf der anderen Seite des Rheins. Uwe wunderte sich, dass Heinz den ursprünglichen Plan geändert hatte. Zunächst sollte er mit Kerstin allein in dieser Wohnung bleiben. Geplant war, dass Heinz in die Eifel fahren sollte, um die Waffe zu zerstören. Doch Uwe schien es, als habe Heinz nicht damit gerechnet, dass die Polizei so schnell Straßensperren aufbaute, Brücken sperrte und Düsseldorf in ein Meer von Blaulicht tauchte. Heinz sagte, die hektische Aktivität diene nicht der Fahndung, sondern solle die Bevölkerung beruhigen. Die Staatsmacht zeige, sie habe die Dinge im Griff – und in ein, zwei Tagen würde alles wieder so sein wie zuvor.
Kerstin versorgte sie mit Brot, Fertigsuppen und Eiern. Sie hatte vor drei Wochen die Wohnung gemietet und mimte nun die brave, berufstätige Frau, die morgens das Haus verließ und abends um sechs Uhr zurückkam. Tatsächlich fuhr sie tagsüber nach Köln, wo sie eine Dauerkarte für den Zoo gekauft hatte. Der heftige Streit gestern Abend zwischen ihr und dem Genossen Heinz bedrückte Uwe. Kerstin wollte wissen, wie Heinz sie gefunden hatte, denn sie hatten sich nach zwei Jahren im Untergrund von den anderen Kommandos und von der Unterstützerszene zurückgezogen. Aus dem Überfall auf die Volksbank in Hochdorf waren noch zwanzigtausend Mark übrig, und mit diesem Geld wollten sie sich eine Weile ausruhen.
Sie mieteten damals eine Wohnung im Koblenzer Stadtteil Lützel. Hier vermutet uns niemand, sagte Kerstin. Inmitten dieser riesigen Garnisonsstadt mit acht Kasernen und dreißigtausend Soldaten fahndet das BKA sicher nicht nach uns.
Uwe hasste Koblenz vom ersten Tage an. Vielleicht hing das aber auch damit zusammen, dass er nun die Haare kurz tragen und dunkelbraun färben musste. Er schaute nur noch widerwillig in den Spiegel, aber Kerstin tat seine Bedenken mit einem Schulterzucken ab: Keine Ähnlichkeit mehr mit deinem Bild auf dem Fahndungsplakat.
Doch Heinz hatte sie trotzdem gefunden.
Er stand in der Bäckerei in der Löhrstraße plötzlich neben ihm und flüsterte ihm leise zu: »Nicht schießen – ich bin ein bewaffneter Kämpfer.« Trotzdem zuckte Uwes Hand zur 9mm-Walther, die in seinem Hosenbund steckte, aber er war viel zu langsam. Die Schrecksekunde dehnte sich endlos, und wären es Polizisten gewesen, die ihm hier auflauerten, läge er längst tot auf dem Boden neben den weggeworfenen Papiertüten im feinen Mehlstaub. So stockte seine Hand auf halbem Weg.
Der unbekannte Genosse deutete mit einer Kopfbewegung nach draußen. Mit einigem Abstand folgte ihm Uwe zu dem Parkplatz hinter dem Rhein-Mosel-Center.
Der Mann mit dem fahlgelben Haar stand neben einem Mercedes-Geländewagen und winkte ihn zu sich heran.
»Steig ein, wir fahren eine halbe Stunde durch die Gegend. Dann bringe ich dich wieder hierher.«
Uwe stieg ein, obwohl das allen abgesprochenen Vorsichtsregeln widersprach. Der Mann fuhr los und stellte sich als Heinz vor, ein Genosse aus Hamburg. Heinz trug einen blondgelben und trotzdem fahl wirkenden Bürstenschnitt, und Uwe wunderte sich, wie normal bei ihm diese militärische Frisur wirkte. Er hasste seine zur Tarnung kurz geschnittenen Haare und befürchtete insgeheim, irgendein Passant würde mit dem Finger auf ihn zeigen: Das da ist ein Terrorist; ich habe ihn sofort erkannt, er hat sich nur die Haare abgeschnitten und braun gefärbt! Bei Heinz schien das anders. Er trug den Bürstenschnitt mit einer solchen Selbstverständlichkeit, als wäre dies die Frisur, die er auch dann tragen würde, wenn er nicht im Untergrund leben würde.
Uwe sah sich mehrmals um, fast schon instinktiv, ob ihnen nicht ein anderes Auto folgte. Ihm fiel auf, dass Heinz die Situation besser im Griff hatte. Er blickte nur selten in den Rückspiegel, sondern beobachtete stattdessen ihn. Immer wieder sah Heinz vom fließenden Verkehr weg und musterte ihn, nicht aufdringlich, sondern eher prüfend, als ob er darüber nachdachte, ob er ihm die anstehenden Aufgaben anvertrauen könnte. Er will mich testen, dachte Uwe.
Heinz wirkte durchtrainiert, kräftiger Oberkörper, schmale Hüften und unter dem hellblauen Jeanshemd dehnten sich beachtliche Oberarmmuskeln. Die Hüfte wirkte selbst in der sitzenden Haltung schmal, und der Stoff der Wranglerjeans spannte sich um seine Oberschenkel.
Der Genosse treibt viel Sport, dachte Uwe, er hat sich für den bewaffneten Kampf fit gemacht. Uwe mochte keine körperliche Anstrengung. Schon in der Schule hatte er den geisttötenden Drill gehasst, aus dem der Sportunterricht bestand.
Der Daimler fuhr über die Moselbrücke in Richtung Autobahn, als Heinz das Schweigen brach.
»Wir sind das Kommando ›Andreas Baader‹, und wir haben eine Aktion vorbereitet, die dem Schweinesystem einen Schlag versetzt, einen richtigen Schlag, verstehst du, was ich meine?«
Uwe zuckte unmerklich zusammen. Wenn die Genossen ihr Kommando nach Andreas Baader benannten, planten sie eine große Aktion. Bisher hatte noch kein Kommando der RAF den Mut aufgebracht, sich nach Baader zu benennen.
»Wir haben alles vorbereitet«, fuhr Heinz fort, »doch jetzt ist uns das BKA auf der Fährte, verstehst du, was ich meine?«
Uwe nickte.
»Wir haben einen Plan; wir haben genau die richtige Waffe; wir haben die Fluchtwege. Nur können wir uns nicht mehr so frei bewegen, wie wir das gerne hätten. Deshalb müssen wir die Operation an andere Genossen abgeben, verstehst du?«
Uwe nickte wieder.
»Es ist eine ziemlich massenfreundliche Sache. Wir schaffen ihnen einen Tyrannen vom Hals, gegen den sie in Massen demonstrieren, es ist eine politisch unheimlich wichtige Sache, und wir brauchen jetzt euer Kommando, das die Operation weiterführt. Seid ihr bereit?«
Uwe überlegte.
»Wir müssen das diskutieren, aber wenn die Sache die Massen mobilisiert, dann sind wir dabei. Wir wollen nur keine abgehobene Sache mehr machen.«
Heinz lachte leise.
»Das ist eine der wichtigsten Aktionen, die je stattgefunden haben.«
Sie befanden sich mittlerweile auf der Straße, die zum Bauplatz des Kernkraftwerkes Mülheim-Kärlich führte. Heinz steuerte den schweren Mercedes auf eine Ausfahrt zu; sie verließen die Ausfallstraße an einem großen Möbelhaus, unterquerten sie und fuhren erneut, diesmal jedoch in Gegenrichtung, auf die große, sechsspurige Fahrbahn.
»Wir werden dich an der Waffe ausbilden«, sagte Heinz, »auch dazu haben wir einen idealen Platz organisiert. Wir wollen nicht, dass etwas schief geht.«
Uwe nickte.
Dieser Genosse wusste, was er wollte, und diese Bestimmtheit gefiel ihm. Drei Tage später gab ihm Heinz den ersten Schießunterricht.
3
Dengler verließ den Schreibwarenladen, überquerte die Bolzstraße und stand kurz danach vor dem Eingang der Hauptpost.
Der Briefmarkenautomat versteckte sich rechts neben dem zu groß geratenen Eingangsportal. Dengler zog eine Marke und ärgerte sich, als die Maschine das Wechselgeld in Form von weiteren Briefmarken zurückgab.
Er schob den Umschlag in den Briefkasten.
»Viel Spaß mit Buddy Guy!«
Jahrelang hatte das Foto von Roman Greschbach auf allen Fahndungsplakaten die Rangliste der gesuchten Terroristen angeführt. Mehr als eine Million Mal hing sein Bild an Plakatsäulen, Bahnhofshallen und Bankschaltern. Der Innenminister nannte ihn im Fernsehen einen Topgangster, den die Polizei unbedingt fassen müsse.
Georg Dengler jagte ihn zwei Jahre.
Greschbach wurde die Beteiligung an zwei Attentaten zur Last gelegt. In Heidelberg sprengten Unbekannte die Chrysler-Limousine des US-Generals Worst. Der General saß nicht im Wagen, als die ferngezündete Bombe hochging. Sein Fahrer, ein schwarzer Sergeant aus Seattle, starb am Tatort. Die zweite Bombe zündete nur einen Monat später auf dem Truppenübungsplatz Baumholder und zerfetzte während eines Manövers einen Jeep und dessen Insassen: den amerikanischen Panzergeneral Highcourt und seinen Adjutanten.
Beide Attentate riefen die amerikanische Regierung auf den Plan. Der US-Botschafter wurde im Kanzleramt vorstellig und verlangte ultimativ, die Schuldigen müssten umgehend gefasst werden. Die besten Fahnder sollten Roman Greschbach suchen, dessen Daumenabdruck in einer konspirativen Wohnung in Kaiserslautern gefunden wurde.
Die Leitung des Bundeskriminalamtes beauftragte Georg Dengler mit der Fahndung.
Diese Entscheidung erstaunte viele in der Wiesbadener Behörde. Zwar waren ihm mit den Festnahmen von Silke Meier-Kahn und Rolf Heisemann zwei spektakuläre Verhaftungen gelungen, aber jeder Fahnder wusste, Dengler war bei der Spitze des Amtes nicht sonderlich beliebt. Er galt als schwierig. Zu eigenbrötlerisch. Nicht kommunikationsfähig.
Als der Präsident das Amt mit Managementmethoden zu führen versuchte, wurden jährliche Personalgespräche eingeführt; sie waren bei den Beamten bald gründlich verhasst.
»Sie lassen sich nicht in eine einmal festgelegte Strategie einbinden«, erklärte Dr. Scheuerle, der Abteilungsleiter Terrorismus, gespreizt, ein ehrgeiziger Schwabe aus Pforzheim.
»Und Sie ändern die Strategie öfter, als sich irgendwer darauf einstellen könnte«, antwortete ihm Dengler.
Seitdem war er bei den Chefs unten durch.
Und doch brauchten sie ihn.
Dengler hatte Silke Meier-Kahn nach nur fünf Monaten Fahndung verhaftet. Scheuerle kam in die Tagesschau und gab Interviews. Er war selig. Aber nicht dankbar. Den schnellen Erfolg schob Dr. Scheuerle dem Glück des Anfängers zu. Er klopfte Dengler auf die Schulter und sagte ihm, ein Fahnder habe nur einmal im Leben solches Glück. Und am nächsten Vormittag rief er ihn in sein Büro und übertrug ihm die Fahndung nach Rolf Heisemann.
Damals mochte Dengler seinen Beruf. Er nahm ihn sportlich. Jedenfalls nannte er diese Zeit später so: meine sportliche Phase. In seinen Tagträumen sah er sich als Hochseefischer, auf der Pirsch nach einem seltenen und gefährlichen Hai. Oder er stellte sich als einsamen Jäger in der Savanne vor, der einen Menschen mordenden Leoparden zur Strecke bringen musste. Als eine Art Helden. Sein Wild war gefährlich – und ihm ebenbürtig. Und irgendwann würden sie sich gegenüberstehen. Er wusste nicht, wo das war, aber er würde diesen Ort finden. Deshalb studierte er jede Information; er wollte alles über sein Opfer wissen.
Drei Monate las er alle Akten und Dossiers über Heisemann. Er gab sich als Rechercheur des Spiegel aus und führte mit dieser Tarnung Gespräche mit Heisemanns Eltern, seinen Kumpeln und seiner damaligen Freundin, die ihm nicht in den bewaffneten Kampf hatte folgen wollen.
Von ihr bekam er den entscheidenden Hinweis.
Er traf sie im Café Starfisch in der Heidelberger Innenstadt. Sie saß an einem Tisch vor dem Fenster zur Straße und schien verhangen von hellbraunen Haaren, die sie offen und schulterlang trug. Die randlose Brille gab ihr einen intellektuellen Anschein, der jedoch in krassem Gegensatz zu ihren vollen Lippen stand, ein Gegensatz, der Dengler während des Gesprächs immer wieder verwirrte. Sie bemerkte es nicht, sondern schien froh zu sein, mit jemandem über ihren früheren Freund reden zu können.
Ein halbes Jahr lang habe sie versucht, ihn vom Sprung in den Untergrund abzubringen. Doch nun hat er gewählt, sagte sie bitter. Gründe, zur Waffe zu greifen, gäbe es in Deutschland genug, aber sie fände es aussichtslos, den Kampf auf militärischem Gebiet aufzunehmen.
»Man sollte einen übermächtigen Gegner nicht auf dem Gebiet bekämpfen, auf dem er tausendfach überlegen ist«, sagte sie nachdenklich und nahm einen Schluck Espresso, »man müsste eher seine Schwachstellen suchen.«
»Dann bräuchte Rolf sich jetzt nicht zu verstecken.«
»Ja – und wir wären noch zusammen«, sagte sie, »und wenn er Deutschland so hasst …«, sie ließ hilflos einen Arm auf die Lehne des Sessels fallen, »ich wäre mit ihm auch irgendwo anders hingegangen.«
»In ein anderes Land?«
»Ja.«
»Welches?«
»Bestimmt – Griechenland«, sagte sie.
»Warum?«
»Rolf reiste schon als Schüler nach Griechenland. Mit dem Rucksack. Er schwärmte von der Gastfreundschaft der griechischen Bauern, dem Meer und …«
Sie zögerte einen Augenblick: »In Athen lernten wir uns kennen. Er führte mich zwei Tage durch die Stadt, von Kneipe zu Kneipe, und überall kannte er Leute.«
Dengler verband diese Information mit einer anderen, die er den Akten entnahm. Seine Zielperson las regelmäßig die Süddeutsche Zeitung. Ein Anruf beim Süddeutschen Verlag in München ergab, in 271 Läden und Kiosken wurde das Blatt in Griechenland verkauft.
Auf dem nächsten Meeting der Fahndungsgruppen verlangte er die Überwachung aller 271 Verkaufsstellen. Dr. Schweikert, sein unmittelbarer Vorgesetzter, votierte dafür, doch der Präsident und Dr. Scheuerle lehnten rundweg ab: zu teuer, unabsehbarer Ärger mit der griechischen Polizei, der Umfang der Operation mache eine Geheimhaltung unmöglich. Dengler verließ wütend die Sitzung.
Später kam Dr. Schweikert zu ihm und schloss die Tür.
»Dengler, vertrauen Sie mir?«
Georg sah ihn erstaunt an: »Sie sind der einzig Vernünftige in diesem Laden.«
»Dann geben Sie mir ein bisschen Zeit – und ärgern Sie sich nicht mehr.«
Drei Tage später gab es grünes Licht für die Operation, ohne dass Dengler die Gründe für den Sinneswandel seiner Vorgesetzten erfuhr. Er plante zwei Monate, besprach sich mit den griechischen Kollegen, erstellte Excel-Tabellen mit Einsatzplänen und kümmerte sich um die Hotelzimmer der an der Aktion beteiligten Kollegen.
Am dritten Tag der Überwachung schlenderte Rolf Heisemann mit einer schwarzen Ray-Ban-Sonnenbrille und einem weißen Leinenanzug an einen Kiosk am Hafen von Saloniki und verlangte in holperigem Griechisch eine Süddeutsche Zeitung – vier Stunden später begleitete Dengler ihn zum Haftrichter in Karlsruhe.
Seither wurde er im BKA respektvoll »Dengler, der Denker« genannt. Dr. Scheuerle übertrug ihm nun den Fall Greschbach.
Dengler arbeitete sich systematisch durch zwölf Ordner Hintergrundmaterial, die das Bundeskriminalamt zusammengetragen hatte: Vernehmungsprotokolle der Eltern und der Schwester, der Lehrer und sogar seiner Kindergärtnerinnen. Es fanden sich Kopien seiner Schulaufsätze, lange Ausarbeitungen zweier V-Leute aus der Freiburger Szene, die Greschbach kannten, vier unterschiedliche psychologische Gutachten, die das BKA in Auftrag gegeben hatte, Abhörprotokolle von Telefonaten seiner Jugendfreunde, mit denen Greschbach fast zwei Jahre in einer Band spielte und die sich weigerten, gegenüber der Polizei auszusagen.
Lange studierte er die Kopien der Kontoauszüge: Sie sagen viel über den Menschen aus, dessen Leben man kennen lernen will. In Bankauszügen hinterlassen die Träume ihre Spuren – die verwirklichten, während sie über die unerfüllten freilich nichts aussagen. Dengler setzte zwei Beamte ein, die die Träume hinter den Zahlen dechiffrierten. Bei Hertie kaufte Greschbach sich eine Tauchausrüstung samt Schlauchboot und Harpune, vom vornehmen Herrenbekleider Bollerer stammten Jacketts – bis ins zweite Semester legte Greschbach Wert auf gute Kleidung und teuere Urlaube. Dann wurden die regelmäßigen Überweisungen der Eltern, die ihm pünktlich am Ersten eines jeden Monats gutgeschrieben wurden, am gleichen Tag abgehoben, und Dengler spürte das fühlbar Hektische, mit dem das Konto geplündert wurde.
Setz dich hin und denke nach.
Geld ist eine sichtbare und eine unsichtbare Größe, dachte er. Hinter jedem Gegenstand unseres Lebens steht eine unsichtbare Zahl. Hinter jeder Blume, die der Liebende seiner Geliebten bringt, steht eine Zahl. Hinter jedem Pullover und jeder Scheibe Brot – eine Zahl.
Denk weiter nach.
Was bedeuten diese unsichtbaren Zahlenreihen, die unser Leben begleiten? Sehen wir sie wirklich nicht oder nehmen wir sie nur unbewusst wahr, mit einem unbekannten Sinnesorgan? Sieht die Geliebte den verborgenen Preis der langstieligen Rose? Über was freut sie sich wirklich, wenn sie die Augen niederschlägt?
Vor seinem geistigen Auge verschwamm die Welt zu einer unendlichen Reihe von Skalen, von sichtbaren und unsichtbaren Preisen.
Denk weiter nach!
Auch die Polizei richtet sich nach diesen unsichtbaren Tabellen. Warum würde niemals eine Polizeistreife auf der Frankfurter Zeil ohne Grund von einem Mann in einem 2000-Euro-Anzug die Personalpapiere verlangen, während sie bei einem anderen, dessen Klamotten vom Roten Kreuz stammen könnten, sich geradezu zwingend zu einer Kontrolle veranlasst fühlt? Welche Bedeutung haben die unsichtbaren Preisschilder für unser Leben?
Seit diesem Abend, als er über den Fahndungsakten Roman Greschbachs gebrütet hatte, änderte Dengler seinen Kleidungsstil. Keine Jeans mehr oder Lederjacken aus der türkischen Boutique – niemand sollte seinen Status an seiner Kleidung erkennen. Seit diesem Tag trug er dunkelblaue Anzüge, und die erstaunten Blicke von Kollegen und Vorgesetzten überraschten ihn nicht.
Greschbach schien sich diesem System entziehen zu wollen. Sein Konto gab nun keine Hinweise mehr auf die unsichtbare Spur des Geldes.
Georg Dengler las die anderen Ordner, die speziell rot markierten Hefter mit den schrecklichen Fotos, mit den Berichten der Sprengstoffexperten und all die unzähligen technischen Gutachten, studierte eingehend die Bilder aus der illegalen Wohnung in Kaiserslautern.
Dengler saß bis spät in der Nacht in dem riesigen Büro der Fahnder, las und dachte nach. Er überließ sich den aus den Akten aufsteigenden Bildern und vergaß, wie sehr ihm die graue Atmosphäre des Büros zuwider war. Grau. Aus grauem Plastik bestand die Resopalplatte seines Schreibtisches. Grau war das Gehäuse des Computers. Grau der Bildschirm. Grau der Drucker. Hellgrau der Teppich und die Jalousie. Grau die genormten Bürostühle mit Armlehnen und hohen Rückstützen (die Sekretärinnen saßen auf gleich grauen Stühlen, jedoch ohne Armlehnen). Selbst die blauen Jeans, die einige der anwesenden Kollegen trugen, wirkten grau.
Hell allein war der Gedanke, der sich in seinem Hirn formte. Hell und orange. Dengler kannte das Gefühl, wenn sich ein wichtiger Gedanke Bahn brach. Es war zunächst nur ein kleiner Druck im Hinterkopf, der sich ausdehnte, sich nach vorne arbeitete und schließlich zu einem Begriff wurde. Er konnte warten, bis es so weit war, oder er konnte den Druck verscheuchen.
Setz dich hin und denk nach.
Wenn er dachte, verschwamm, was er sah: die Buchstaben der Akten, die Bäume draußen im Hofe des Amtes und sogar das Deep-Purple-Poster, das irgendein Kollege der Nachtschicht an die Trennwand geheftet hatte.
Er lehnte sich zurück, schloss die Augen und überließ sich dem werdenden Gedanken. Einen Augenblick überlegte er, ob er die Füße auf den Schreibtisch legen sollte, aber er blieb ruhig sitzen.
Denk nach!
Greschbachs Leben. Und sein eigenes. Der Gegenentwurf. Greschbachs Leben, das ihm aus all den Ordnern entgegenquoll, las sich wie ein ausgedachter Gegenentwurf seines eigenen Lebens.
War das wichtig? Er wusste es nicht.
Dengler richtete sich auf und nahm den ersten Ordner noch einmal in die Hand.
Greschbach war nur vier Jahre jünger als er, war nur wenige Kilometer entfernt von ihm aufgewachsen – und doch lagen unüberbrückbare Gegensätze zwischen ihnen. Nie wären sie sich begegnet. Seine Zielperson wuchs in Freiburg auf, einer Großstadt mit über 200 000 Einwohnern. Dengler wurde in Altglashütten geboren, einem Dorf mit wenigen hundert Bewohnern, fast alle Bauern. Greschbachs Vater hatte erklärt, er habe seinem Sohn schon mit vier Jahren eine feste Summe als Taschengeld ausbezahlt, damit der Junge den Umgang mit Geld trainieren könne. Dengler las die Stelle noch einmal, da stand tatsächlich »trainieren«. Wie sollte das gehen? Heute üben wir, zehn Mark für Eis auszugeben?
Georg hatte nie Taschengeld bekommen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich bis heute nicht mit Geld umgehen kann, dachte er.
Von klein auf hatte er auf dem Hof helfen müssen. Als kleiner Junge hütete er die Schweine der Mutter auf der Sommerwiese, nahe dem Dorf. Die Tiere suchten sich ihr Futter selbst, ernährten sich von Wurzeln oder dem Getier, das sie beim Aufwühlen der Wiese ans Tageslicht beförderten: Engerlinge, aber auch Mäuse, wenn sie nicht schnell genug flohen. Für die Mutter war es billiger, die Schweine auf eine Wiese zu führen, als sie im Stall zu füttern. Ein paar Pfennige verdiente er dazu, als er auch die Sauen des Birklerbauern mitnahm.
Es war eine einsame und anstrengende Arbeit gewesen, vor allem solange die Tiere Hunger hatten. Sie besaßen keinen ausgeprägten Herdeninstinkt, sondern jedes Schwein lief hierhin oder dorthin, und der kleine Georg, bewaffnet mit einer langen Gertenrute, rannte hinterher, um zu verhindern, dass sich eines aus dem Staub machte. Trotzdem gelang es hin und wieder einem Ferkel, seiner Aufsicht zu entkommen. Meist liefen sie nicht weit, doch die Gefahr war groß, dass die Herde sich auflöste, wenn er nicht jederzeit aufpasste. Deshalb umkreiste er rennend unaufhörlich die Herde, bis die Tiere endlich genug gefressen hatten und sich ins Gras niederlegten.
Er wunderte sich damals, die Tiere fraßen buchstäblich alles. Einmal erwischte er zwei Sauen, die einen toten Fuchs unter einem großen Weißdornbusch hervorzerrten und sich in aller Ruhe über den Kadaver hermachten. Widerlich, das schmatzende Geräusch der Tiere, das Krachen der Knochen; er erinnerte sich deutlich an den Ekel, den er beim Anblick der fressenden Viecher empfand. Damals konnte er nicht anders, er übergab sich, und sofort interessierte sich eine große Muttersau für seine Kotze. Voller Panik prügelte er auf die überrascht quiekenden Schweine ein und trieb sie ein Stück die Wiese hinauf, wo sie sich beruhigten und schließlich wieder den Boden auf der Suche nach Wurzeln aufrissen.
Erst wenn die Herde satt war, konnte er seinen eigenen Gedanken nachhängen. Das gefiel ihm. War er einsam gewesen? Dengler wusste es nicht mehr, aber erinnerte sich daran, dass er seit diesen Tagen das Gefühl der Einsamkeit nie wieder ganz verlor. Auch schien es ihm, er müsse länger als andere nachdenken, bevor er etwas sagen könne. Er bewunderte seinen Klassenkameraden, den Sohn des Apothekers, der einfach losredete, scheinbar ohne nachzudenken. Vielleicht konnte der aber nur schneller begreifen. Dengler konnte nie gleichzeitig reden und denken. Das war in der Schule schon so gewesen, und er hatte sich in diesem Punkt nicht geändert.
Hätte er Greschbach damals gekannt, wäre ihm dessen Leben wie das eines Prinzen vorgekommen. Seine Familie bewohnte ein dreistöckiges Haus im vornehmen Freiburger Stadtteil Herdern, zu dem ein verwilderter Garten gehörte. Aus dem Vernehmungsprotokoll des Vaters erfuhr Dengler, dass zum Geburtstag stets ein Kinderfest veranstaltet wurde, zu dem die Kinder aus der Nachbarschaft und der Verwandtschaft kamen. Es gab Fangspiele, Limonade; und am Abend wurde jedes Kind mit einem kleinen Lampion-Umzug nach Hause gebracht.
In den Vernehmungsprotokollen der Kindergärtnerin las Dengler, dass der Vater die zentrale Figur in Greschbachs Kindheit war. Er sei als Kind altklug gewesen, und »Mein Papa hat gesagt …« sei für Roman die höchste Form der Weisheit und Autorität gewesen, vergleichbar mit dem »Das hab ich im Fernsehen gesehen …« der heutigen Kinder.
Dengler erinnerte sich kaum noch an den eigenen Vater. Einige wenige Bilder gab es, die er sich oft ins Gedächtnis rief, wie einen Schatz, der sich verflüchtigt, wenn er nicht regelmäßig betrachtet wird. Da saß der Vater ruhig am frühen Morgen, nachdem er die Kühe gefüttert hatte und die Mutter nun im Stall war und molk – da saß er in seiner Arbeitshose am Küchentisch, am Oberkörper nur ein geripptes Unterhemd, über das breite, braune Hosenträger liefen, und er trank den Kaffee, den die Mutter vorher gekocht und auf die Herdplatte gestellt hatte. Georg durfte auf seinen Knien sitzen. Um den Vater war immer ein Geruch von Tabak und Heu, von Milch und Kühen, den er still genoss. Vater und Sohn sprachen nicht, sondern sahen dem Dampf zu, der aus dem Becher stieg, um sich in immer neuen Mustern aufzulösen. Diese Minuten der schweigenden Zugehörigkeit waren die beglückendste Erinnerung an seine Kindheit.
Sicher, es gab noch einige unklare Bilder vom sonntäglichen Kirchgang, die Unbehaglichkeit des Vaters in dem groben schwarzen Anzug. Wie er ihn an die Hand nahm, sie dann hinüber zur Kirche gingen und Georg sich immer allein auf der rechten, der Männerseite, in einer der vorderen Kirchenbänke einen Platz suchen musste, während der Vater sich hinter ihn setzte, zu den Männern des Dorfes. Wenn Georg sich dann herumdrehte, manchmal schnell und für den Vater unerwartet – immer ruhten dessen Augen auf ihm, und immer mit dem stillen Lachen, in dem er sich so zu Hause fühlte.
Sein Vater sprach nie über Gefühlsdinge, und doch hatte Georg von ihm die kleine Sprache der Liebe gelernt: den Blick, das Lächeln, die Geste, die Gewissheit.
Dann kam der Tag, den er vergessen möchte und den er manchmal, an glücklichen Tagen, tatsächlich vergaß. Aber schlimme Erinnerung lässt sich nicht tilgen, durch keine Anstrengung der Welt. Und die Erinnerung an das Unglück an jenem Tag beginnt mit dem warmen Geruch von Heu. Er kroch auf allen Vieren über die Tenne, spielte die grauweiße Katze, die sich regelmäßig auf den Scheunenboden zurückzieht, wenn sie Junge bekommt. Welch ein sicheres Gefühl das war, so hoch oben, wenn der Vater da war, der breitbeinig mit der Gabel das Heu für die Kühe aufspießte. Eine Drehung mit dem Oberkörper, sicher und elegant, dann warf er es durch eine der beiden offenen Dachluken hinunter auf den Scheunenboden. Ein Kindheitstraum. Georg rutschte auf dem Boden hin und her und wühlte sich durch das Heu, baute Gänge wie ein Maulwurf. Plötzlich schrie der Vater. Bleib stehen, schrie er, und rühr dich nicht! Und rannte zu ihm hin. Georg wusste nicht, warum er stehen bleiben sollte, deshalb blieb er nicht stehen, und der Vater rannte weiter und dachte nicht mehr an die zweite Luke.
Allein die Mutter beugte sich an jenem Abend über sein Bett, ganz dunkel wurde es über ihm und ihre Tränen trafen ihn wie Steine. Sie schmeckten bitter, er mochte das nicht, und später schämte er sich, weil er es nicht gemocht hatte.
Er schämte sich noch auf der Beerdigung. Er saß mit der Mutter in der ersten Reihe. Auf der Frauenseite. Er wollte nicht hier sein. Er spürte den harten Druck, weil die Mutter seine Hand nicht losließ. Er spürte Schmerz, aber nur in der Hand. Irgendwann zog sie ihn aus der Bank, und er stolperte. Gegen den Marienaltar im Seitenschiff der Kirche. Die Madonna mit dem blauen Mantel wankte, und er griff nach ihr mit der linken Hand. Doch die Mutter zog ihn weiter. So hielt er die Madonna fest umklammert in seiner Linken. Er schob sie unter seinen Sonntagsmantel, quetschte sie unter den Hosengürtel, wo sie ihn den ganzen Tag drückte, bis er sie am Abend hervorzog und in der großen weißen Kiste versteckte, direkt unter dem Märklin-Baukasten.
In der gleichen Nacht schlich er durch den dunklen, nach Kühen riechenden Flur bis zur Küchentür und wartete unschlüssig, ob er zu seiner Mutter und ihren drei Schwestern in die Küche gehen sollte. An ihren Stimmen hörte er, dass sie Wein getrunken und viel geweint hatten, und dann hörte er seine Mutter sagen, sie wolle das Kind nicht mehr sehen – für eine Weile. In diesen Sekunden wurde seine Seele für immer verletzt. Er schlich ins Bett zurück und konnte immer noch nicht weinen, er fühlte sich leer, und er fühlte sich schuldig an allem, was über die Familie gekommen war, am Tod des Vaters, am Unglück der Mutter und, vielleicht am schlimmsten, dass er darüber nicht weinen konnte. Diese dreifache Schuld spürte er noch heute. Damals erinnerte er sich an die Madonna unter dem Märklin-Baukasten – und er beschloss, sie nie mehr herzugeben.
Schmerz und Scham setzten unvermittelt mit der Erinnerung ein, so frisch und unvermittelt wie damals. Dengler nahm schnell einen neuen Ordner zur Hand und blätterte in Greschbachs Zeugnissen des Kepler-Gymnasiums. Er schien ein Musterschüler gewesen zu sein, Einser, Zweier, nur in Physik eine Vier.
Georg dachte an seine eigene Schulzeit: Der alte Lehrer Scharach unterrichtete alle Kinder Altglashüttens in einem einzigen Raum im Rathaus, die oberen Klassen vormittags und die Schüler bis zur vierten Klasse nachmittags. Später wurde eine neue Schule mit zwei Klassenzimmern gebaut, was einige im Ort für unnötigen Luxus hielten. Georg erinnerte sich an den Stolz, mit dem er sich in die eigene Schulbank setzte, die nun kein anderer Schüler vormittags benutzte.
Dengler überlegte, ob Greschbach als Kind sich wohl jemals Sorgen um die Existenz seiner Eltern machen musste. Wahrscheinlich nicht. Sein Vater war Professor für mittelalterliche Geschichte an der Freiburger Universität und galt dort, so eine Stellungsnahme des Dekanats der Uni, die er in den Akten fand, als herausragender Wissenschaftler auf diesem Gebiet.