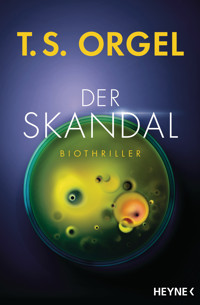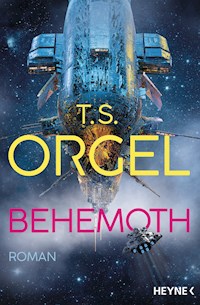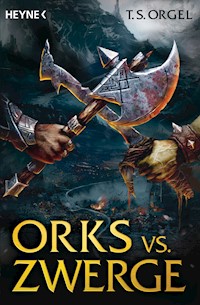11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Blausteinkriege
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
FÜRCHTE DIE MACHT DES BLAUSTEINS
Das Kaiserreich Berun ist in seinen Grundfesten erschüttert. Am Hof regieren Intriganten, der Kaiser ist schwach, und im Süden probt das Protektorat Macouban den Aufstand. In diesen Wirren schlägt die Stunde ungewöhnlicher Helden. Der Schwertmann Marten, die Spionin Sara und der in Ungnade gefallene Danil machen eine Entdeckung, die ihr Schicksal und das von Berun ins Ungewisse stürzen wird. Denn ihr wahrer Feind gibt sich jetzt zu erkennen.
Zwei dunkle Schiffe kreuzen vor den Küsten des Südens …
Das neue, gewaltige Epos der preisgekrönten Autoren Tom & Stephan Orgel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 833
Ähnliche
Das Buch
Einst war Berun nahezu unbesiegbar, doch die Macht des Kaiserreichs ist nun geschwächt. Ein Anschlag auf die Kaiserinmutter Ann Revin konnte gerade noch abgewendet werden, aber der brüchige Friede mit den Kolnorischen Steppenkriegern ist dahin. Im Süden sieht die Lage nicht besser aus, denn der Fürst des Protektorats Macouban will sich von der Herrschaft Beruns lossagen und hat sich fremde Söldner ins Land geholt. Der Kaiser hingegen ist schwach und nur um seine Vergnügungen besorgt, und so obliegt es dem Meisterspion Henrey Thoren sowie der Kaiserinmutter, Pläne zu schmieden und die Zukunft Beruns zu sichern. Ihnen zur Seite steht das ehemalige Straßenmädchen Sara, die nun mithilfe ihrer magischen Gabe und der Kraft des Blausteins nach den wahren Feinden Beruns forscht. Der junge Adlige Danil, ihr einstiger Mitstreiter, ist in den Norden verbannt worden und sucht dort, seinen Verrat an Sara zu sühnen. Währenddessen steht der Schwertmann Marten in den Sümpfen des Macouban vor ganz neuen Herausforderungen: Er will das Rätsel seiner Herkunft lösen, er muss die Fürstentochter Emeri vor geheimnisvollen Invasoren schützen – und dann sind da noch seine widerstreitenden Gefühle für sie und für Xari, ihre Metis-Dienerin. Als zwei graue Schiffe vor der Küste aufkreuzen, ahnen Marten und seine Freunde, dass hier ein neuer Feind sein Gesicht zeigt. Eine Macht, die seit Jahrhunderten schwieg – und die nun nach Blaustein dürstet …
Das neue große Epos der preisgekrönten Autoren Tom & Stephan Orgel:
DIE BLAUSTEINKRIEGE
Band 1 – Das Erbe von Berun
Band 2 – Sturm aus dem Süden
Die Autoren
Hinter dem Pseudonym T. S. Orgel stehen die beiden Brüder Tom und Stephan Orgel. In einem anderen Leben sind sie als Grafikdesigner und Werbetexter beziehungsweise Verlagskaufmann beschäftigt, doch wenn beide zur Feder greifen, geht es in phantastische Welten. Für ihren Debütroman »Orks vs. Zwerge« sind sie mit dem Deutschen Phantastik Preis ausgezeichnet worden und haben sich damit in die Herzen der deutschen Fantasy-Leser geschrieben. Mit »Die Blausteinkriege« stellen sie nun ihre neueste Fantasy-Weltenschöpfung vor.
Mehr über T. S. Orgel auf: www.ts-orgel.de
Mehr über die Blausteinkriege auf: www.blausteinkriege.de
T. S. ORGEL
STURM AUS DEM SÜDEN
Originalausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
INHALT
Karte des Macouban
Karte des nördlichen Waldlandes
Prolog – Huacoun
1 Ein fauler Handel
2 Signale und falsche Fährten
3 Der Klang der Stille
4 Cajetan ad Hedin
5 Ein neues Bündnis
6 Eine zweite Chance
7 Zwischen den Stühlen
8 Narrenspiel
9 Die Geister des Waldes
10 Den Bach hinunter
11 Aufbruch
12 Ausgebrannt
13 Die Augen des Sturms
14 Priester und tote Götter
15 Bessere Zeiten
16 Nichts als die Wahrheit
17 Fünfzehn Jahre
18 Nattern und Schwertfische
19 Schweine
20 Der Berg der Götter
21 Die Feuer der Leidenschaften
22 Nackte Tatsachen
23 Enthüllungen
24 Die Geister des Waldes
25 Was von der See kommt
26 Ein anderer Weg
27 Aufwärts und abwärts
28 Vom Sterben
29 In die Dunkelheit
30 Jäger und Gejagte
31 Letzte Begegnungen
32 Ein Freudentag
33 Weltenbrand
34 Wein und Blut
Epilog – Auf das Leben!
Personenverzeichnis
Glossar
Danksagung
»Gegner bedürfen einander oft mehr als Freunde,
denn ohne Wind gehen keine Mühlen.«
Hermann Hesse (1877 – 1962)
Karte des Macouban
Karte des nördlichen Waldlandes
PROLOG
HUACOUN
Nebel lag über dem Wasser, blaugrau und bleich wie der Bauch eines Fisches. Der Sturm der vergangenen Nacht hatte die Luft merklich abgekühlt, und die Frische zog die weißen Schwaden aus dem warmen Meer, das in trägen Wellen gegen die Bordwand schwappte. Die Boote waren schon vor Sonnenaufgang hinausgefahren und hatten die Netze ausgeworfen. Gewichte aus geschliffenem Kalkstein zogen die riesigen Geflechte aus Weciak-Seide hinunter auf den Grund der flachen Küstenlagune, während große, ausgehöhlte Rotkürbisse die oberen Ränder der Netze an der Oberfläche hielten. Jetzt blieb den Fischern nichts anderes, als zu warten.
Ibril lag im Bug des flachen Boots und blinzelte müde auf die silbernen Fische hinab, die im Lichtschein der Blausteinlaterne standen und träge mit den Flossen wedelten. Es waren lediglich Loriss, bitter schmeckende Begleitfischchen, die auf ein paar Brocken Köder aus dem Boot hofften und von den Fischern nichts zu befürchten hatten. Niemand aß Loriss. Sie schmeckten nach dem, was sie fraßen, und das war in den seltensten Fällen appetitlich oder auch nur frisch. Das hypnotische Wedeln der Flossen zusammen mit dem dumpfen Gluckern des Wassers unter dem Boot schläferte den jungen Metis nur noch mehr ein. Er hatte am Abend mehr getrunken, als gut für ihn war, doch für die Fischer um den alten Ambebe war das Neujahrsfest noch lange kein Grund, einen guten Fangtag auf dem Meer zu verpassen. Regenfreie Tage, an denen man sich auf die Wellen hinauswagen konnte, waren in der Sturmsaison selten und das Wasser zu dieser Zeit fischreich wie nie. Also lag Ibril auf seinem Platz im Boot des Alten, kämpfte gegen die Übelkeit und verfluchte stumm das Bier, seinen trockenen Mund, sein Schicksal im Allgemeinen und seinen sturen Großvater im Besonderen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis die Sonne über den Horizont geklettert war und die Nebel schmolzen. Dann begann die eigentliche Arbeit: das Einholen der Netze, die hoffentlich prall gefüllt waren. Ibril schloss sie in seinen Fluch ein. Weciak-Seide war nahezu nicht zu zerreißen, dafür biss sie in die Finger und hinterließ Schnitte, in denen das Salzwasser brannte. Immerhin – wenn es ihnen heute gelang, eine Schule goldschimmernder Cabrecas oder grünflossiger Balemar zu fangen, würde er den Rest der Woche wenig zu tun haben, außer seine Finger zu pflegen und das Netz zu flicken, während die Frauen die Fische ausnahmen und über Trockengestelle hängten oder sie in Lake und Salzfässer packten. Fisch brachte zurzeit gute Preise. Der Fürst hatte in der Festung eine Menge Mäuler zu stopfen, und wenn die Gerüchte stimmten, bereitete sich Gostin auf eine Belagerung vor. »Das kommt davon, wenn man sich von Berun lossagt«, hatte Ambebe düster gemurmelt. »Die Herren im Norden werden das nicht dulden. Sie werden die Festung zurückhaben wollen. Krieg liegt in der Luft, sage ich euch.«
Aus Ibrils Sicht lag nur der Gestank des Ködereimers in der Luft. Er grunzte und stemmte sich hoch. Die Nebelschwaden drifteten auseinander und gaben für einen Moment den Blick auf die hoch aufragenden, bleichen Kalkfelsen frei. Der Himmel über ihnen begann, sich rosa zu verfärben, und die ersten Sonnenstrahlen tauchten ihre Kronen aus dunklem Dschungelgrün bereits hier und dort in goldenes Licht. Die Fischer der Metis bewegten sich nie aus der Sichtweite des Ufers. Die offene See gehörte den Göttern und ihrem Hofstaat aus Ertrunkenen, und das galt auch für alles andere, was dort draußen schwamm. Kein Metis wagte sich hinaus in ihr Reich. Es war nie eine gute Idee, die Götter auf sich aufmerksam zu machen.
Ein Schwarm Skellinge kam auf aschgrauen Flügeln vom Land aus herüber, das scharfe Wispern ihrer Schwingen das einzige Geräusch in der Stille über dem Meer. Der vertrocknete alte Fischer am Heck des Boots richtete sich auf. Bislang hatte er wie üblich reglos zusammengesunken dagesessen, sodass Ibril nicht hätte sagen können, ob er überhaupt noch am Leben oder einfach im Schlaf gestorben war. Doch jetzt sah er dem Schwarm der gefräßigen Nachtmöwen mit besorgt gerunzelter Stirn nach. »Sie fliegen aufs Meer hinaus«, stellte er mit einem Krächzen fest.
Ibril zuckte mit den Schultern. »Vielleicht heißt das, dass wir endlich einen guten Fang machen, Großvater«, mutmaßte er. Die grauen Raubmöwen schienen nur aus Hunger und Hunderten kleiner, scharfer Zähne zu bestehen und waren unfehlbar immer dort zu finden, wo es in Sichtweite des Meeres etwas zu fressen gab. Zumindest, solange die Sonne noch nicht am Himmel stand.
Der Alte schüttelte unwirsch den Kopf. »Es ist zu spät für sie, egal, wie viel wir fangen. Außerdem – siehst du sie kreisen?« Er hob die Stimme. »Temba?«
Einen Moment später ertönte eine Antwort links von ihnen, wo das nächste in der Reihe der Fischerboote liegen musste. Die Worte waren durch den Nebel gedämpft und kaum verständlich. »Hast du die Skellinge gesehen?«, rief der Alte.
»Sie sind hier entlanggekommen«, antwortete Temba, ein untersetzter, muskulöser Fischer, der sich die Wartezeit im Boot gewöhnlich damit vertrieb, kleine Götterfiguren aus Treibholz zu schnitzen. Ibril fand im Stillen, dass Temba ein wesentlich besserer Schnitzer als Fischer war.
»Sie kreisen nicht?«
»Nein. Ich kann sie nicht … wartet. Da ist etwas. Etwas ist im Wasser.«
Etwas ist im Wasser. Ibril seufzte unhörbar. Etwas, das nur Temba sagen kann, während er in einem Boot über einem der besten Fischgründe des Macouban sitzt. Es platschte leise, kaum noch hörbar.
Einen langen Moment später räusperte sich Ibril vorsichtig. »Temba?«
Der Schnitzer blieb stumm.
»Etwas ist im Wasser?«, fragte Ibril leise. »Was …?«
Der Alte antwortete nicht. Schwerfällig drehte er sich auf seinem Sitz um und starrte in den Nebel, der im Licht der aufsteigenden Sonne von Augenblick zu Augenblick heller wurde. Noch immer verschluckte der zähe Dunst jedes Geräusch. »Die Skellinge«, flüsterte Ambebe schließlich. »Sie fliegen immer der Nacht entgegen.« Er hob einen zitternden Finger und streckte ihn in die Richtung, in die der Schwarm Raubmöwen verschwunden war. »Es gibt nur eins, was sie mehr lieben als die Nacht. Ihre wahren Herren«, sagte er leise, und der Ton, der in seiner Stimme lag, ließ den jungen Fischer frösteln. »Die Legenden berichten, dass die Skellinge Augen der Götter sind.«
Ibril verdrehte die Augen. Er fürchtete die Götter wie jeder Mann bei Verstand, doch es gab wohl nichts, wofür sein Großvater keine Legende kannte. Und fast alle beschäftigten sich damit, dass irgendjemand oder irgendetwas zu den Augen und Ohren oder auch den Zähnen, Klauen und Flossen der Götter gehörte. Fast konnte man meinen, dass …
Ibril erstarrte. Aus dem Nebel drang der lang gezogene, klagende Laut eines Muschelhorns herüber. Die Metis verwendeten diese Instrumente, um ihre Flotte von Booten im Nebel zusammenzuhalten. Wenn sie ertönten, wusste jeder der Fischer, an welcher Stelle in ihrer kleinen Fangflotte er sich befand. Das Horn mit dem tiefen Ton markierte das äußerste linke Ende der Bootsreihe, der helle Klang steckte das rechte Ende ab. Die dritte Muschel lag zu seinen Füßen im Boot, beschnitzt mit uralten Ornamenten, die Schutz und guten Fang versprachen und die Götter gnädig stimmen sollten. Es verriet der Flotte, wo das Boot des Ältesten lag, und es war Ibrils Aufgabe, es zu blasen, wenn Ambebe das Zeichen dazu gab. Neben diesen dreien gab es noch ein viertes Muschelhorn, das im Zentrum ihres Dorfs in einem eigenen Schrein lag. Dieses Horn konnte die Fischer vom Meer rufen, und in mehr als einer Nacht hatte es die Flotte sicher nach Hause geleitet, wenn der Nebel die Sinne verwirrte und jedes Leuchtfeuer ertränkte. Sie waren die Stimme ihres Dorfs, und jedes Kind kannte den Klang der vier Hörner so gut wie die Stimme seiner eigenen Mutter. Das Problem war: Der Ton aus dem Nebel stammte aus keinem davon. Er war fremd, durchdringend, kratzte über seine Wirbelsäule und ließ irgendetwas in seinem Bauch vibrieren.
Ein Zittern ging durch den dürren Körper Ambebes. Er murmelte etwas, das nach den Beschwörungen der Dorfweisen klang, und seine Finger tasteten nach dem Haumesser, das stets neben seinem Sitz lag. Als sie den Griff fanden, umklammerten sie das alte Werkzeug so hart, dass die Fingerknöchel weiß hervortraten, bevor der Alte mit hastigen Hieben die Seile durchtrennte, mit denen das Netz am Boot befestigt war. Er drehte sich um, und das Glühen in seinen Augen erschreckte Ibril zutiefst. »Rudere!«, krächzte er heiser.
Das riss den jungen Fischer aus seiner Starre. Er schwang sich auf die Ruderbank, ergriff sein Paddel und schob es in die Aussparung des Dollbords. Doch noch bevor er es eintauchen konnte, ging ein Zittern durchs Wasser, ähnlich dem auf einer Pfütze, wenn ein schwerer Stiefel direkt daneben den Erdboden erzittern ließ. Ein Geruch von Salz und Tang schlug ihm entgegen, ließ ihn würgen, und ein nicht spürbarer Lufthauch ließ die Nebel hinter Ambebe aufwallen und schließlich zerreißen. Aus den zerfasernden Schwaden schob sich lautlos eine gewaltige, monströse Form hervor, einer fahlgrauen Klippe gleich. Bleiche Tentakel hingen von oben herab und schienen sich träge tastend zu bewegen. Vielleicht bewegten sie sich auch nicht, doch Ibril war viel zu entsetzt, um darauf zu achten, ob der gewaltige Krake, der den Bug des Schiffs vor ihnen verzierte, ein echtes Meerestier oder nur eine lebensechte Schnitzerei war. Erst ein einziges Mal in seinen sechzehn Lebensjahren hatte der junge Fischer eine der Triaren Beruns gesehen, jener gewaltigen Schiffe, die die innere See befuhren, jedes angetrieben von den Ruderschlägen von mehr als einhundert Männern. Damals hatte er verstanden, wie Berun es gewagt hatte, seinen Göttern zu trotzen. Wer Fahrzeuge wie dieses bauen konnte, dem war niemand gewachsen. Das zumindest hatte er seitdem gedacht. Vielleicht hatte er sich getäuscht. Das hellgraue Schiff, das sich aus dem Nebel schälte, war größer. Viel größer. Obwohl kein Lufthauch wehte, glitt es heran und an ihnen vorbei. Doch kein Ruder ragte aus seiner Seite. Über vier Mannhöhen war überhaupt keine Öffnung in der glatten Bordwand zu sehen, nur silbrig schimmerndes, bleiches Holz in Planken, von denen jede breiter war als das ganze Boot Ambebes. Nichts wies darauf hin, wie sich dieses Schiff vorwärts bewegte, kein Geräusch ging davon aus, wenn man vom leisen Rauschen des Wassers absah, das an der Bordwand vorbeistrich, und vom gelegentlichen dumpfen Knarren aus dem Inneren des schweigenden Behemoths.
Für einen Augenblick lag das Paddel vergessen in Ibrils Händen, als er hinaufstarrte, hoch und immer höher, bis dorthin, wo die Wand in das unwirkliche Grau des hereinbrechenden Morgens überzugehen schien. Eine Gestalt stand dort oben. Sie war beinahe ebenso grau wie die Schiffswand. Ibril konnte sich nicht sicher sein, doch sie schien hager zu sein und höher aufzuragen als jeder Metis. Ihre Augen waren seltsam groß und hell, während ihr Mund von hier nur einen kaum zu erkennenden Strich bildete. Sie trat vor und legte die Hände auf die Reling, um auf das kleine Boot herabzusehen, das auf den Wellen tanzte. Jetzt konnte er erkennen, dass der Schädel der Gestalt vollkommen glatt war, beinahe wie poliertes Fischbein. Der Blick der riesigen Augen traf für einen Moment seinen eigenen und schien in ihn hineinzusehen, ihn bis in sein tiefstes Inneres zu erkunden. Dann wandte sich die Gestalt ab, als hätte sie das Interesse verloren.
»Huacoun«, flüsterte Ambebe heiser und brach damit zum zweiten Mal den Bann, der sich über Ibril gelegt hatte. Der junge Fischer wandte sich ab, stach sein Paddel ins Wasser und ließ ihr Boot ruckartig voranschnellen – weg, nur weg von dem verfluchten Hexerschiff. Zug um Zug schossen sie vorwärts, als Ambebe plötzlich entsetzt die Augen aufriss. Noch bevor Ibril seinen Blick deuten konnte, fiel ein Schatten über sie. Er fuhr herum und verlor das Gleichgewicht, als er den Bug des zweiten Schiffs direkt über sich aufragen sah. Mit einem Aufschrei kippte er ins Wasser, gerade als der gewaltige Kiel Ambebe unter sich begrub, sich knirschend durch das kleine Boot fraß und die Trümmer unter seine Bugwelle riss. Ibril wurde herumgewirbelt, ein Strudel packte ihn, schmetterte ihn gegen die Bordwand, wo der Besatz von Muscheln ihm die Haut von Schulter und Oberarm fetzte, bevor ihn eine andere Strömung vom Schiff wegriss und unter Wasser drückte. Eisige Finger legten sich um ihn, schnürten ihn ein und zerrten ihn zurück an die Wasseroberfläche, wo er keuchend nach Luft rang, nur um im nächsten Moment wieder unter die Wellen gerissen zu werden. Keine Finger, Schnüre waren es, die Maschen ihres eigenen Netzes, wurde dem jungen Fischer klar, als eine Kürbisboje dicht neben ihm durch das Wasser gezogen wurde. Die Stränge der Weciak-Seide wanden sich um seine Arme und Beine, als das Schiff Netz, Fang und Fischer mit sich riss. Panik überfiel ihn. Er versuchte, sich zurück an die Oberfläche zu kämpfen, die jetzt, in diesem Moment, von der Morgensonne berührt wurde. Doch während die grauen Schiffe lautlos weiter nach Osten glitten, zog sich das seidene Gefängnis weiter um Ibril zusammen und schnitt tief in seine Haut. Über ihm, kaum eine Armeslänge entfernt, glitzerte die Oberfläche, lockend oder spottend, das konnte er nicht sagen, als er langsam gedreht wurde und ihm nichts anderes übrig blieb, als in die smaragdgrüne Tiefe unter ihm zu starren. Dort unten schimmerte weißlich das gewaltige Netz, voll beladen mit den silbernen Leibern der Balemar, auf die sie gehofft hatten. Die Luft brannte in seiner Lunge, und sein Herzschlag raste in den Adern seines Halses, während er verzweifelt gegen das Verlangen ankämpfte einzuatmen. Jeder Schlag der Trommel in seiner Brust stach in seine Ohren, und dann sah er die bleichen Gesichter, die ihn mit unnatürlich großen, hellen Augen von der anderen Seite des Netzes anstarrten. Ibril schrie.
Die Luft aus seiner Lunge bildete eine silberne Perlenschnur, die zur Oberfläche hinauftanzte und das Gesicht auswischte.
1
EIN FAULER HANDEL
War nicht besonders schlau von dir, dich hier noch mal blicken zu lassen, Henrey Thoren.« Scheel Einohr grinste. Ein Grinsen, das den Menschen, die ihn näher kannten, das Blut in den Adern gefrieren ließ. Feyst Dreiauges ältester Sohn war nämlich selten gut gelaunt, und meistens nur dann, wenn die Aussicht bestand, jemandem so richtig wehzutun. Auf den ersten Blick erweckte der ausgemergelte Mann nicht den Eindruck besonderer Härte, aber was ihm an körperlichen Eigenschaften fehlte, machte er durch rücksichtslose Brutalität mehr als wett. »Du stehst auf Dreiauges Grund und Boden. Hier hat der Kaiser nichts zu melden. Wärst besser oben im Palast geblieben.«
»Scheint so.« Thoren breitete die Arme aus. »Aber dafür ist es jetzt wohl zu spät.«
Scheel nickte. »Keine hastigen Bewegungen. Die Hände schön weit vom Schwertgriff weg. Mein Bruder hat einen nervösen Zeigefinger.« Er warf einen Seitenblick auf seinen fetten Bruder Heygl, der eine geladene Armbrust auf Thorens Brust richtete. »Und jetzt beweg dich. Rein mit dir.«
Das Wirtshaus zum Roten Bären schien verlassen zu sein. Ein paar Tische standen noch da, eine Handvoll Weinkrüge und die Theke aus grob behauenem Eichenholz, auf dem die Spuren der zahllosen Becher zu erkennen waren, die darauf abgestellt worden waren. Der Rest des Raums war leer geräumt, von den wachsverklebten Kerzenhaltern bis hin zu den schwarzen Fässern, aus denen Feyst das billige Gesöff für seine anspruchslose Kundschaft gezapft hatte. Selbst der große Kamin, der schon seit Menschengedenken gebrannt hatte, war erloschen.
In der Tür stand Feysts kolnorischer Leibwächter Bedbur, der den Stiel seiner Streitaxt knetete wie einen Teigfladen, der in Form gebracht werden sollte. Thoren schenkte dem grimmigen Riesen keine Beachtung. Ruhig schlenderte er an ihm vorbei zur Feuerstelle und setzte sich auf den Platz, der ausschließlich dem Herrn des Hauses vorbehalten war.
Scheel runzelte die Stirn und ließ sich an der gegenüberliegende Tischseite nieder. »Hast ganz schön Eier in der Hose, das muss man dir lassen. Aber wenn du glaubst, mich damit beeindrucken zu können, hast du dich getäuscht.«
Thoren schnaufte und strich sich über die Glatze. »Aus dem Alter bin ich raus. Breitbeinig und mit herausgestreckter Brust durch die Gassen stolzieren wie ein verdammter Pfau? Das überlasse ich lieber den jungen Leuten. Das beeindruckt ohnehin niemanden.«
»Heute verlegst du dich mehr aufs Geschichtenerzählen, was?«
Thoren lächelte entschuldigend. »Du hast recht. Ich höre mich viel zu gern selbst reden. Neben dem Alkohol das größte Laster alter Männer.« Er deutete auf den Weinkrug und die Becher, die auf der Tischplatte abgestellt worden waren. »Du gestattest?« Ohne eine Antwort abzuwarten, zog er den Krug zu sich heran und schnüffelte an der Öffnung. Der Geruch schien ihn zu überzeugen. Er füllte einen Becher und nahm einen Schluck. Genüsslich schmatzend schaute er sich im Raum um. »Also gut. Lassen wir die Freundlichkeiten beiseite und reden Klartext. Wo ist Dreiauge?«
Scheel schnaufte. »Unser Vater ist nicht mehr hier. Hat gewusst, dass ihr nach ihm suchen würdet, du und Sara. Dieses Miststück hat es sich aber anders überlegt, hm? Hat endlich eingesehen, dass es in deiner Gesellschaft zu gefährlich ist. Das wird Feyst übrigens schade finden, denn er hätte sich furchtbar gern mit ihr unterhalten. So von Familienmitglied zu Familienmitglied, wenn du verstehst, was ich meine …« Er strich sich die Haare aus dem Gesicht, sodass die hässliche Narbe zum Vorschein kam, wo früher einmal sein Ohr gewesen war – die gängige Warnung an Betrüger und Diebe in Berun, die bei ihm aber ganz offensichtlich nicht die erhoffte Wirkung erzielt hatte. »An dir hat er übrigens kein Interesse mehr. Hat gesagt, dass wir dir einen Dolch zwischen die Rippen jagen dürfen, falls du uns noch mal in die Quere kommst.«
»Ein Armbrustbolzen tut es sicherlich auch«, fügte Heygl grinsend hinzu.
»Das sind ja keine besonders schönen Aussichten«, sagte Thoren unbeeindruckt. »Von euch habe ich allerdings auch nichts anderes erwartet. Ich hätte mir nur einen etwas würdevolleren Abgang gewünscht. Auf dem Schlachtfeld vielleicht, mit einem Schwert in der Hand. Oder noch besser im Bett, an der Seite einer schönen Frau.« Seufzend hob er den Becher und prostete den beiden zu. »Na wenigstens bleibt mir zum Schluss noch ein Schluck Wein.«
Scheels Augenbrauen zogen sich so weit zusammen, dass sie in der Mitte zusammenstießen. »Bis zum letzten Augenblick ein selbstgerechtes Arschloch, was? Du solltest lieber die Reisenden um Vergebung für deine Fehler bitten, denn das hier ist dein letzter Schluck. Genieß ihn, solange du noch kannst.«
»Genießen ist zu viel verlangt, aber es bekämpft den Durst.« Thoren wischte sich mit dem Handrücken über den Mund und lehnte sich im Stuhl zurück. Das Holz knarrte leise. »Ich werde das wirklich vermissen. Nicht diese Pisse hier, aber den Wein an sich. Wenn ich nicht wüsste, dass die Götter tot sind, würde ich schwören, dass sie dieses Getränk erschaffen haben. Welcher Sterbliche wäre schon in der Lage, so etwas Köstliches aus einer winzigen Traube zu pressen?«
»Bist du endlich fertig?«, knurrte Scheel ungehalten. »Dann gebe ich dir jetzt die Möglichkeit herauszufinden, ob die Götter noch existieren oder nicht.« Er gab seinem Bruder ein Zeichen, und Heygls Zeigefinger krümmte sich um den Abzug. Ein stählernes Klicken ertönte, und die Sehne schnellte nach vorn.
Thoren blinzelte und blickte an sich hinab. Für einen kurzen Augenblick schien er seine Gelassenheit verloren zu haben. Doch als er in seiner Brust keinen Bolzen entdecken konnte, lächelte er.
Der Bolzen schwebte knapp zwei Fingerbreit über der Armbrust in der Luft. Heygl glotzte ihn an und blinzelte. Dann blinzelte er noch mehr, als Sara den Schleier der Unsichtbarkeit von sich abfallen ließ und ihm ihr Messer an den Hals presste. Es war dasselbe Messer, mit dem sie Tilmann Arn erstochen hatte. Die Klinge war frisch geschärft, und als Heygl schwer schluckte, ritzte sie seine Haut.
Scheel stieß einen erschrockenen Laut aus, und seine Hand glitt zu dem Messer an seinem Gürtel.
Doch Thoren war schneller. Blitzschnell sprang er auf und zog sein Schwert. Die Spitze verharrte direkt vor dem Gesicht des Einohrigen. »Keine Dummheiten.«
Scheel stieß zischend die Luft aus. Mit einer knappen Handbewegung scheuchte er Bedbur zurück, der mit hoch erhobener Axt in der Mitte des Raums stand. Mit einem widerstrebenden Knurren ließ der Kolnorer die Waffe sinken, aber Sara bemerkte, dass seine Fingerknöchel weiß waren.
»Du hast dir ganz schön Zeit gelassen«, sagte Thoren, ohne den Blick von seinem Gegenüber zu nehmen.
Sara lächelte. »Der Ausdruck auf Eurem Gesicht, als die Sehne nach vorn schnellte … Der war es wert.«
Thoren seufzte. »Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ihr wolltet nur mit Sara reden. Hier ist sie also.«
»Aber macht bitte schnell.« Sara brachte ihren Mund ganz dicht an Heygls Ohr. »Ich habe nämlich lange nicht so viel Freude am Redenschwingen wie Thoren. Ich habe keine Lust, über Wein zu philosophieren, und ich möchte auch nichts von euren erbärmlichen Lebensgeschichten hören.«
Heygl setzte zu einer Erwiderung an, doch Scheels harter Blick brachte ihn augenblicklich zum Schweigen. Der ausgemergelte Mann richtete einen anklagenden Zeigefinger auf Thoren.
»Du verdammter Drecksack. Du hast uns übers Ohr gehauen.«
»Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber es war auch nicht besonders schwer.«
Scheel ballte die Hände zu Fäusten. »Ihr seid tot, alle beide! Wenn Vater euch in die Hände kriegt, werdet ihr euch wünschen, nie geboren zu sein.«
Thoren schüttelte seufzend den Kopf. »Scheel Einohr … Der letzte Einohrige, der solche Drohungen gegen mich ausgestoßen hatte, war dein Freund Dornik. Erinnerst du dich an ihn? Graue, zottelige Haare, ziemlich hässliche Visage, spielte immer mit seiner langstieligen Axt herum. Hat für deinen Vater gearbeitet und wollte mich ebenfalls umbringen. Jetzt schwimmt er mit dem Gesicht nach unten im Hafenbecken und dient den Skellingen als Futter.«
»So wie ihr beide auch, wenn ihr nicht antwortet.« Sara drückte ihr Messer so fest gegen Heygls Hals, dass ein dünner Blutfaden daran herabzulaufen begann. Der fette Mann wimmerte leise.
Scheel schnaufte verächtlich. »Dafür fehlt dir doch der Mut, Sara. Um solche Dinge durchzuziehen, muss man aus härterem Holz geschnitzt sein als du.«
Sara grinste und spürte, wie sich die frische Narbe auf ihrer linken Wange verzog. »Vor ein paar Wochen hätte ich dir noch recht gegeben. Damals, als ich noch ein dummes kleines Mädchen war, das geglaubt hat, mit Friedfertigkeit käme man weiter als mit roher Gewalt. Aber das Holz wurde inzwischen recht ordentlich beschnitzt, findest du nicht auch?«
Scheel starrte einen langen Augenblick finster auf die Narbe. »Ich habe von Anfang an gesagt, dass so eine wie du nur Unglück bringt. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir dich nie in die Familie aufgenommen. Ihr verdammten Südländer bringt nichts als Ärger nach Berun. Ich hätte dir mein Messer zwischen die Rippen jagen sollen, als es noch nicht zu spät gewesen ist.«
»Das hättest du, ja, aber ganz offensichtlich hat immer noch dein Vater das Sagen in der Familie. Also jammer nicht mir die Ohren voll. Ich sagte bereits, dass ich keine Lust auf deine traurige Lebensgeschichte habe. Sag, was du mir zu sagen hast, oder halt’s Maul.« Sara bohrte die Spitze ihres Messers ein kleines Stück tiefer in Heygls Hals, und der fette Mann schrie vor Schmerz auf.
»Ah verdammt, warte! Ein Angebot! Wir sollen dir ein Angebot machen.«
»So?« Sie zog das Messer zurück und warf Scheel einen fragenden Blick zu. »Stimmt das?«
Scheel stieß einen leisen Seufzer aus und nickte. »Feyst kennt dich besser, als du glaubst. Er weiß, dass du nicht locker lässt. Was du dir einmal in den Kopf gesetzt hast, das ziehst du durch, egal, um welchen Preis. Das ist eine sehr lobenswerte Eigenschaft, hat er gesagt. Jedenfalls, wenn es für die richtigen Ziele eingesetzt wird.«
»Rache ist ein richtig gutes Ziel.«
Scheel seufzte erneut. »Ihr hattet eure Meinungsverschiedenheiten, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es ist ja nicht so, dass ihr euch gegenseitig noch etwas schuldig wärt. Du musst zugeben, dass du die Familie ganz schön in die Scheiße geritten hast. Unser Vater war deshalb eine Zeit lang gar nicht gut auf dich zu sprechen. Aber es gibt wichtigere Dinge, als sich in kleinlichen Fehden zu zermürben. Das Geschäft muss weitergehen, nicht wahr? Feyst ist bereit, seinen Groll gegen dich zu begraben, wenn du es ebenfalls tust. Was sagst du dazu? Ist das nicht ein großzügiges Angebot?«
Sara hob die Brauen. Das klang so überhaupt nicht nach dem alten Drecksack. Jeder Mensch wusste, dass er nachtragend war wie eine betrogene Ehefrau. Er hätte sich eher ein Messer in die Hand gerammt, als sie ihr entgegenzustrecken. Sie warf einen Seitenblick auf Thoren, der nur mit den Schultern zuckte. »Wo ist der Haken?«
»Feyst verliert nicht gern«, antwortete Scheel. »Vor allem keine Familienmitglieder. Er weiß, wie sehr du seinen kleinen Blagen zugetan bist und dass du es nicht magst, wenn sie für ihn arbeiten. Aber sie gehören zu uns, und so wird es auch bleiben. Feyst möchte nicht, dass du den Kindern irgendwelche Flausen in den Kopf setzt. Deshalb will er, dass du die Finger von ihnen lässt und ihnen niemals wieder zu nah kommst.«
»Auf keinen Fall.« Energisch schüttelte sie den Kopf. »Ich lasse nicht zu, dass er sie weiter versklavt.«
Scheel lächelte sie an. »Er hat auch diese Reaktion vorhergesehen. Aus diesem Grund hat er mich gebeten, dir das hier zu überreichen …« Gemächlich griff er in seinen Hemdausschnitt und zog ein zusammengewickeltes Leinentuch hervor, das er ihr mit einer nachlässigen Handbewegung zuwarf. »Ein kleines Friedensgeschenk für dich.«
Mit gerunzelter Stirn schlug Sara das Leinentuch auf. Sie brauchte einen Augenblick, um zu verstehen, um was es sich bei dem verschrumpelten Ding handelte, das darin eingewickelt war. Entsetzt stieß sie die Luft aus. Es war ein Finger. Der Finger eines Kindes.
»Flynn Hasenfuß«, erklärte Scheel mit einem Grinsen. »An dem Jungen scheint dir besonders viel zu liegen. Wenn das der Wahrheit entspricht, wirst du sicherlich wollen, dass er gesund und munter bleibt.«
Wortlos starrte sie auf den Finger hinab. Der Anblick schmerzte sie mehr als die Verletzung in ihrem Gesicht. Ihre Hände begannen zu zittern, Tränen schossen ihr in die Augen.
»Kein Grund, sich aufzuregen.« Scheels Grinsen reichte beinahe bis zu seinem verstümmelten Ohr hinauf. Er lehnte sich im Stuhl zurück und schaute sie auf eine Art an, die ihre Wut nur noch verstärkte. »Es ist doch nur ein verdammter Finger. Alles andere haben wir drangelassen. Es liegt natürlich an dir, ob es so bleibt …«
»Was hast du gesagt?« Ihre Stimme war nur noch ein Krächzen. Sie umklammerte den Griff ihres Dolchs so fest, dass es schmerzte. Sie wollte nichts anderes, als ihn diesem Dreckschwein in die Visage zu rammen. Mitten hinein in sein hässliches Grinsen, und so lange zuzustoßen, bis es ausradiert war. »Ich bring dich um«, zischte sie und fletschte die Zähne.
Scheel zuckte zurück und hob die Hände, und Bedbur hob knurrend seine Axt.
Ihr war es egal. Selbst ein Dutzend Kolnorer hätten sie nicht aufhalten können. Nicht nach dem, was sie Flynn Hasenfuß angetan hatten. Sie machte einen Satz nach vorn und stach zu. Im letzten Augenblick riss Scheel schützend die Arme in die Höhe, und die Klinge zerriss seinen Ärmel. Blut spritzte, und er schrie auf und warf sich nach hinten. Der Stuhl kippte um, und sie stürzten gemeinsam zu Boden. Sara schlug mit der Stirn gegen das Holz, schrie auf, mehr aus Frust als vor Schmerz, zerrte Scheel am Kragen zu sich heran und wollte erneut zustechen. Doch eine schwere Hand packte sie am Arm und riss sie grob in die Höhe.
»Genug!« Thorens Stimme drang wie aus weiter Ferne durch das Rauschen in ihren Ohren. »Ich denke, er hat es verstanden.«
»Verstanden?« Ungläubig starrte sie ihn an.
»Wenn du ihn tötest, hilft uns das kein bisschen weiter. Das bringt niemandem etwas.«
»Mir schon«, zischte sie und wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. »Mir bringt es Genugtuung.«
»Und Flynn wird es den Tod bringen. Oder was glaubst du, was Feyst mit ihm anstellt, wenn du seinen ältesten Sohn erstichst?«
»Ich … er …« Sie sah auf Scheel hinunter, der mit der Hand seinen blutenden Unterarm umklammerte. Langsam wandte sie sich um, musterte den zitternden Heygl, der sie anstarrte, als wäre sie geradewegs den Gruben entstiegen, und dann Bedbur, dessen Blick so leer war wie der eines Ochsen vor dem Pflug. »Was sollen wir deiner Meinung nach sonst tun? Tatenlos herumsitzen und ihm bei seinen Schweinereien zusehen?«
Thoren hob die Schultern. »Für den Moment schon. Das ist für alle das Beste. Es gibt jetzt wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen.«
»Wichtigere Dinge? Du hast versprochen, dass du mir hilfst.«
»Und du hast der Kaiserinmutter die Treue geschworen, vergiss das nicht.« Thorens Augen funkelten zornig. »Ich habe dir geholfen, so gut es ging, und jetzt wirst du mir helfen. Du stehst in meiner Schuld!«
Sie sah ihn an, blickte in sein verschlossenes Gesicht und glaubte zunächst, dass sie sich verhört hatte. War es also das, was Henrey Thoren über sie dachte? Dass sie in seiner Schuld stand? Dass sie ihm nach all den Opfern, die sie für ihn und die Kaiserinmutter gebracht hatte, noch etwas schuldig war? Ungläubig schüttelte sie den Kopf. Hatte sie sich wirklich eingebildet, dass irgendetwas anders werden würde, nachdem sie sich von Feyst losgesagt hatte? Würde sich denn je etwas ändern, oder würde sie nicht immer irgendeinem Herrn dienen, dem ihr Schicksal egal war? Thorens Stimme drang wie aus weiter Ferne zu ihr vor. »Kümmern wir uns erst einmal um wichtigere Dinge.« Er machte eine unbestimmte Geste in Scheels Richtung. »Und danach … sehen wir weiter.«
Die Sonne war bereits hinter dem Meer verschwunden, als sie den Kaiserpalast erreichten.
Wie ein einziger Augenblick doch alles verändern konnte. Für kurze Zeit hatte Sara geglaubt, wieder alles in den Griff zu bekommen. Sie hatte sich ausgemalt, wie sie vor Feyst treten und ihn mit gezogener Klinge zwingen würde, seine Sklavenkinder in die Freiheit zu entlassen. Vor allem Flynn, der schon immer wie ein kleiner Bruder für sie gewesen war. An die Vorstellung seiner Rettung hatte sie sich geklammert, seit sie aus Confinos zurückgekehrt war. Wütend ballte sie die Hände zu Fäusten. Verdammt, sie verlangte doch nicht viel vom Leben. Sie wollte doch nur, dass es ein einziges Mal auf ihrer Seite stand.
Im Kaiserpalast empfing sie ein Diener mit vor Aufregung zitternder Stimme. Der Kaiser verlangte nach Thoren, und zwar unverzüglich. Sara blickte auf ihre dreckverkrusteten Hände hinab und war froh, nicht an seiner Stelle zu sein. Sie wünschte sich nichts sehnlicher als ein heißes Bad und danach ein weiches Bett. Sie unterdrückte ein Gähnen. »Viel Glück.«
»Du kommst mit mir«, knurrte Thoren, während er den Umhang abwarf.
»In diesem Aufzug?« Sie hob die Hände.
»In den Augen des Kaisers bist du ein Niemand. Du müsstest schon mit Blattgold bestrichen sein und mit einem Apfel im Mund auf einem Silbertablett vor ihm liegen, damit er dich beachtet.« Er ließ sich von dem Diener ein Tuch reichen und wischte sich damit über das Gesicht. »Verhalte dich unsichtbar und hör still zu. Das Erstere sollte dir nicht schwerfallen, beim Letzteren streng dich zur Abwechslung einmal an.«
Der Kaisersaal war von unzähligen Fackeln erleuchtet, und ein prasselndes Kaminfeuer verbreitete gewaltige Hitze. Trotz allem reichte sie nicht annähernd aus, um die frostige Stimmung zu vertreiben, die über dem Raum lag. Sie traten vor die Stufen des Kaiserthrons, vor dem sich bereits der greise Patriarch Veit ad Gillis, Reichsverweser Johen ad Rincks und Ordensfürst Cajetan ad Hedin zusammengefunden hatten. Der Hofnarr war ebenfalls anwesend und lümmelte unverschämt grinsend zu Füßen des Kaisers und seiner Mutter. Als er Thoren erblickte, klingelte er spöttisch mit seinem Schellenstab. »Verzeiht, dass wir Eure Vergnügungen zu stören wagten, Meister Thoren, aber es gilt noch, ein Reich zu regieren. Mit Eurer Erlaubnis natürlich. Seid Ihr bereit, Euch unserer kleinen Runde anzuschließen, oder möchtet Ihr weiter mit Eurem Mädchen herumspielen?«
Die Worte brachten ihm einen finsteren Blick von Ann Revin ein. »Sei still, Narr!«
»Wer hier still zu sein hat, entscheide immer noch ich«, fauchte der Kaiser. Ruckartig erhob er sich von seinem Thron und verschüttete dabei fast den Inhalt seines Weinbechers. »Ich bin der Löwe von Berun, und niemand widersetzt sich meinem Befehl. Nicht Ihr, Mutter, nicht Jerek und schon gar nicht Henrey Thoren.« Er holte aus und schleuderte den Becher nach unten. Statt Thoren traf er allerdings nur den greisen Patriarchen, der zusammenzuckte und sich verschreckt an seinem Amtsstab festklammerte.
»Verzeiht, Majestät.« Mit gesenktem Kopf kniete Thoren vor ihm nieder und zog Sara mit sich nach unten. »Die Verspätung ist unentschuldbar. Ich bin Euer gehorsamer Diener.«
»Natürlich seid Ihr das!«, schnauzte Edrik. Er ließ sich einen neuen Becher reichen und trank ihn in einem Zug leer. »Ihr dient mir. Mir ganz allein. Ich bin der verdammte Kaiser, und Ihr seid mein gehorsamer Kriegshund.« Rülpsend ließ er sich zurück auf den Thron fallen und wedelte ungehalten mit der Hand. »Wo waren wir stehen geblieben, ad Gillis?«
Der Patriarch räusperte sich. »Wie ich bereit sagte, ist das Volk über die Gerüchte beunruhigt, die aus Lytton und Confinos zu uns vordringen. Hinter vorgehaltener Hand flüstern sie von Aufständen, vielleicht sogar von Krieg. Sie machen sich zunehmend Sorgen um ihre Sicherheit.«
Edrik schnaufte gelangweilt. »Bauernpack, das mal wieder den Aufstand probt, nichts weiter. Das hatten wir doch schon einmal, und das Resultat ist bekannt. Gibt es nicht sogar ein Theaterstück über die damaligen Geschehnisse?«
»Der Dumresische Bauernaufstand«, sprang ihm der Narr hilfreich bei. »Ein echter Klassiker auf den Beruner Bühnen.«
»Da seht Ihr es, ad Gillis. Ein Klassiker auf den Bühnen. Nichts Ernsthaftes, und schon gar kein Grund, sich Sorgen zu machen.«
»Wenn der Überfall auf Eure Mutter kein Grund ist, sich Sorgen zu machen …«
Edrik machte eine ungeduldige Geste. »Graf Ulin hat diese Sache doch recht schnell wieder in den Griff bekommen, oder nicht?«
»Graf Ulin wurde … äh, bei dem Überfall getötet.«
»Ach ja, natürlich.« Edrik nickte betroffen. »Das war allerdings eine unangenehme Geschichte. Ich habe ihn wirklich sehr gemocht. Er war ein freundlicher alter Mann, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Sein Tod ist ein herber Verlust für das Reich. Aber habe ich nicht alles getan, um ihn zu rächen? Habe ich nicht eine Armee aufgestellt, um die Verräter zu bestrafen? Habe ich nicht …?« Er warf einen fragenden Blick auf Cajetan ad Hedin, der den Wortwechsel mit finsterer Miene verfolgte.
Der hagere Ordensfürst neigte den Kopf. »Ich habe auf Euren Befehl hin eine Armee von sechshundert Kriegsknechten nach Lytton entsandt, um ein Exempel an den Aufständischen zu statuieren. Lasst die Männer eine Handvoll Siedlungen wie Skaftaton oder Borgyrton niederbrennen, und man wird nie wieder die Hand gegen Eure Besitztümer erheben.«
»Da seht ihr es«, rief der Kaiser aus. »Skafelton und Sowienoch. Das sollte ausreichen, um diese Barbaren in ihre Schranken zu verweisen. Haben wir noch mehr getan?«
»Confinos wurde befestigt und die Brücke über den Korros geschlossen. Meine Ordensritter haben die Situation vollständig unter Kontrolle. Wir haben einhundert kolnorische Gefangene hingerichtet und ihre Köpfe entlang des Flussufers auf Pfähle gespießt. Das sollte genügen.«
Thoren schüttelte den Kopf. »Ihr glaubt wirklich, dass die Sache so leicht aus der Welt zu schaffen ist, ad Hedin? Mit einer kleinen Strafexpedition und neuen Stadtmauern?«
Cajetan ad Hedin zog eine Augenbraue in die Höhe. »Es sind Wilde, mehr nicht.«
»Ich habe Eure sogenannten Wilden gesehen. Sie waren schwer bewaffnet und hochdiszipliniert. Wenn Hilgers Kriegsknechte nicht zur Stelle gewesen wären, hätten sie Confinos im Handumdrehen eingenommen und das Kastell bis auf die Grundmauern niedergebrannt.«
Cajetan schnaubte verächtlich. »Falls Ihr Euch erinnert, haben meine Ritter die Kolnorer regelrecht vom Schlachtfeld gefegt.«
»Die Kolnorer haben sich zurückgezogen, das ist alles.«
»Weil sie Feiglinge sind. Was sollten wir Eurer Meinung nach denn sonst noch tun?«
Thoren breitete die Arme aus. »Der Überfall auf Confinos war erst der Anfang. König Theoder wird sich nicht die Mühe gemacht haben, unzählige Krieger zusammenzurufen und den Friedensvertrag zu brechen, nur um beim ersten Anzeichen von Gegenwehr einzuknicken. Ihr kennt diesen Mann, er ist kein Narr. Alles, was er tut, hat Hand und Fuß. Ihr solltet darauf vorbereitet sein und ein Heer gegen ihn aufstellen.«
»Wisst Ihr, was das kostet?«
»Deutlich weniger, als ein zerstörtes Kaiserreich wieder aufzubauen.«
»Genug!«, brüllte Edrik. Er richtete einen anklagenden Zeigefinger auf Thoren. »Vergesst nicht, wer der Kaiser ist. Der Herrscher von Berun bin ich, und ich habe das letzte Wort. Für Eure Unternehmungen ist kein Geld mehr in meinen Truhen. Ich habe Euch bereits genug Goldadler in den Rachen geworfen, damit Ihr Eure Privatarmee finanzieren konntet.« Er wandte sich an Johen ad Rincks. »Wie viel ist es noch mal?«
»Ich gehe von einem fünfstelligen Betrag aus, Majestät.« Der massige Reichsverweser warf einen Blick in seine Unterlagen und legte die Stirn sorgenvoll in Falten. »Allein in diesem Jahr. Dabei sind die Truhen ohnehin schon fast leer. Euer Privathafen und der neue Sommerpalast …«
»Habt Ihr das gehört, Thoren? Ihr schuldet dem Reich ein Vermögen!«
»Das er einzig und allein zu unserem Schutz ausgegeben hat«, sagte Ann Revin leise.
Edrik rollte mit den Augen. »In erster Linie zu deinem, liebe Mutter.«
Ann Revin verzog keine Miene. »Er hat mein Leben gerettet, das ist wahr. Darüber hinaus hat er die Leben unzähliger Bürger in Confinos bewahrt. Deiner eigenen Stadt Confinos. Männer und Frauen, die auf den Schutz vertraut haben, den dein Vater ihnen versprach. Sie hatten sein Wort!«
Edriks Augenbrauen zogen sich zusammen. »Mein Vater war ein großer Mann, aber ich bin genauso groß wie er.«
»Größer«, seufzte der Narr ergriffen. »Die Welt zittert vor Eurer Stärke.«
»Die Fürsten nicht«, entgegnete Ann Revin. »Was werden sie denken, wenn Kolno ihre Grenzen bedroht und der Großherzog von Lytton sich vom Reich lossagt, ohne dass du einschreitest? Wie können sie sicher sein, dass das Wort deines Vaters noch gilt?«
»Lytton ist ein Wurm«, kreischte der Narr. »Ein unbedeutender kleiner Wurm, der sich in die Eingeweide der Erde verkriecht. Lasst ihn kriechen, Herr, Ihr habt andere Sorgen. Henreys Heerwurm zum Beispiel, der Euch die Haare vom Kopf frisst …«
Edrik brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. Missmutig trommelten seine Finger auf der Armlehne herum. »In dieser Sache muss ich meiner Mutter ausnahmsweise einmal recht geben. Ich bin der Kaiser. Ich kann nicht zulassen, dass ein stinkender Barbar aus dem Osten meine Macht herausfordert.«
»Denkt an die leeren Truhen!«, beschwor ihn Johen ad Rincks.
Edrik verzog das Gesicht. »Das ist allerdings ein Punkt, den wir nicht außer Acht lassen können.«
Ann Revin lächelte. Nur ganz schwach zwar, ihre Mundwinkel verzogen sich kaum nach oben, aber Sara bemerkte den Glanz in ihren Augen. Sanft legte sie die Hand auf den Arm ihres Sohns. »Lass doch die Fürsten für das Heer bezahlen …«
Der Narr stieß ein kreischendes Lachen aus. »Sie werden begeistert sein. Sie haben ja nicht schon mehr als genug Steuern an den Kaiser gezahlt.«
Lächelnd zuckte Ann Revin mit den Schultern. »Dann bieten wir ihnen im Gegenzug eben etwas an, das sie auf jeden Fall haben möchten.«
»Aber was?«, fragte Johen ad Rincks. Hilflos blätterte er durch seine Dokumente. »Die Truhen sind vollkommen leer. Wir haben nichts, was wir ihnen bieten könnten!«
»Das Macouban.«
»Wie bitte?«
»Ihr habt richtig gehört. Bietet den Fürsten das Protektorat Macouban an. Neues Land ist im Kaiserreich schwer zu bekommen. Sie werden es Euch aus den Händen reißen. Alles, was sie dafür tun müssen, ist, Euch mit ihren Schwertleuten und Kriegsknechten zu unterstützen.«
»Ach du liebe Güte! Das Macouban ist doch nicht unser Eigentum.«
»Wen interessiert das schon.« Ann Revin zuckte beiläufig mit den Schultern. »Es ist weit fort, und niemand kennt sich wirklich mit den dortigen Besitzverhältnissen aus. Dafür ist aber jedem Fürsten bekannt, dass das Protektorat reich an Bodenschätzen ist und der Fürst die Kontrolle über den Handel besitzt. Sie werden sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Dafür müssen sie dort nur mit ihren eigenen Kriegsknechten für Ruhe und Ordnung sorgen und entledigen Euch damit einer weiteren Sorge. Ihr kennt die Situation im Macouban und wisst, wie unruhig die Lage geworden ist. Der Orden hat bereits Ritter nach Gostin geschickt, aber das wird auf lange Sicht nicht ausreichen. Wir benötigen ungleich mehr Bewaffnete, und die Fürsten werden sie uns nicht so ohne Weiteres zur Verfügung stellen.«
Johen ad Rincks runzelte verwirrt die Stirn. »Ist das denn rechtens?«
»Wenn es der Kaiser bestimmt, schon.« Ann Revin schaute ihren Sohn an.
Edrik hob in einer hilflosen Geste die Hände. »Es ist … verwirrend, nicht wahr?«
»Es ist verrückt!«, rief Jerik aus. »Und für Verrücktheiten bin immer noch ich zuständig. Majestät, lasst nicht zu, dass jemand anderes meinen Posten übernimmt!«
Ann Revin blieb unbeeindruckt von seiner Beleidigung. »Lassen wir doch die Reichsfürsten darüber abstimmen. Lasst sie entscheiden, ob diese Idee verrückt ist oder nicht.«
»Sie werden niemals …!« Jerik erstarrte. Mit einem Mal wurden seine Augen größer und begannen zu leuchten. Ruckartig fuhr er herum und zog aufgeregt am Stiefel des Kaisers. »Das Blausteinzimmer, Majestät!«
»Das was?«
»Ihr wisst schon: Das Geschenk, von dem Ihr noch nichts wissen dürft. Es soll bald eingeweiht werden, und Ihr werdet zu diesem Anlass ohnehin ein Fest veranstalten. Warum verbindet Ihr nicht das Angenehme mit dem Nützlichen und ruft die Fürsten hinzu? Das wird sicherlich eine furchtbar spaßige Angelegenheit.«
Edrik runzelte die Stirn. »Bist du sicher?«
»Ja, natürlich! Wie könnte ich etwas dagegen haben, die größten Narren des Reichs auf die Hauptstadt loszulassen? Sie die kaiserlichen Keller leer saufen, unsere Töchter besteigen und sich im Anschluss gegenseitig die Köpfe einschlagen zu lassen? Ich wäre ein Narr, wenn ich mir so ein Spektakel entgehen ließe. Wisst Ihr was? Lasst sie doch zu uns kommen. Das ist die einmalige Gelegenheit, die Fürsten Eure wahre Größe spüren zu lassen. Wenn sie erst einmal den Glanz Beruns gesehen haben, werden sie nicht mehr an Euch zweifeln. Wer weiß, ob sie dann nicht sogar auf die verrückten Ideen Eurer Mutter eingehen. Und falls nicht, können wir immer noch gemeinsam darüber lachen.«
»Hm.« Nachdenklich strich sich Edrik über das Kinn. »Dieser Vorschlag übt tatsächlich einen gewissen Reiz aus. Weißt du was? Je länger ich darüber nachdenke, desto besser gefällt er mir. Er gefällt mir sogar ausgesprochen.« Er richtete sich kerzengerade auf und schlug mit der Faust auf die Armlehne seines Throns. »Ladet die Fürsten zu den Feierlichkeiten ein. Ich will, dass sie endlich die Macht des Kaiserhauses erkennen. Joren ad Rincks, Ihr werdet ein Fest für mich organisieren, das seinesgleichen sucht. Ich will Musik und Essen für alle. Veranstaltet ein Turnier mit allem, was dazu gehört.«
Der Reichsverweser blies die Backen auf. »Aber Majestät, die leeren Truhen!«
Der Narr kicherte. Er kroch am Stiefel des Kaisers hoch und flüsterte ihm etwas ins Ohr.
Der Kaiser nickte und wandte sich Ann Revin zu. »Jerik hat recht. Es war deine Idee, also wirst du auch dieses Turnier für mich ausrichten. Mein Vater hat dir genug Geld hinterlassen, und du bist schließlich der Grund, warum die Fürsten ins Feld ziehen sollen. Also sollen sie auch von dir bewirtet werden. Ich verlange ein Turnier, das so prächtig ist, wie ein Fest nur sein kann. Die Welt soll noch in hundert Jahren von diesem Ereignis sprechen. Versprecht dem Sieger einen Pokal aus Gold und dem zweiten ein Lehen.« Der Narr flüsterte ihm erneut etwas ins Ohr, und er lächelte schmal. »Ich gebe dir aber die Möglichkeit, dein Geld zurückzugewinnen, indem du einen eigenen Ritter in das Turnier schickst. Wenn er gewinnt, kannst du den Preis behalten.« Sein Lächeln wurde breiter, und sein Zeigefinger richtete sich auf Henrey Thoren. »Er wird dein Ritter sein.«
Ann Revin starrte ihn entsetzt an. Sie setzte zu einer Erwiderung an, doch der Kaiser donnerte die Faust auf die Armlehne. »Keine Widerrede! Ich will ihn kämpfen sehen. Lass ihn beweisen, dass er immer noch so ein mächtiger Krieger ist, wie er behauptet. Er soll gegen die besten Ritter des Reichs antreten und um deine Ehre kämpfen. Dein Ritter gegen meinen.« Sein Zeigefinger richtete sich nun auf Cajetan ad Hedin. »Ihr werdet für mich kämpfen, Ordensfürst!«
Jerik lachte auf und schlug die Hände zusammen. Seine Augen leuchteten nun wie Sterne. »Eine großartige Idee, Majestät. Ich bin entzückt!«
Für einen Augenblick wurde es still im Raum. Cajetan ad Hedin warf Jerik einen finsteren Blick zu, und Sara erwartete, dass er den Kopf schütteln und empört ablehnen würde. Doch der Blick des Ordensfürsten wanderte weiter zu Henrey Thoren, und er runzelte nachdenklich die Stirn. Nach einem Augenblick des Zögerns neigte er den Kopf. »Selbstverständlich, Majestät. Es ist mir eine Ehre, für Euch das Turnier bestreiten zu dürfen.«
»Natürlich ist es das.« Lächelnd lehnte sich Edrik in seinem Thron zurück und wedelte mit der Hand. »Und jetzt raus hier, alle miteinander! Ich muss nachdenken.«
Stirnrunzelnd verließ Sara in Thorens Schatten den Saal. Zunächst hatte sie noch geglaubt, dass es Ann Revin gelungen wäre, ihrem Sohn auf geschickte Art ihren Willen aufzuzwingen. Doch jetzt war sie sich ganz und gar nicht mehr so sicher, wer diesen Schlagabtausch gewonnen hatte. Sie hatte das unangenehme Gefühl, dass alles ganz anders abgelaufen war als geplant. Sie warf einen Seitenblick auf Thoren, dessen düstere Miene Bände sprach. In ihrem tiefsten Inneren fühlte sie eine gewisse Genugtuung darüber, in welcher Zwickmühle er steckte. Zwar war es ihm und der Kaiserinmutter gelungen, eine Abstimmung über die Aufstellung eines Heers zu erreichen, aber gleichzeitig mussten sie nun ein Turnier veranstalten. Es würde ihnen verdammt schwerfallen, sich jetzt um all die anderen wichtigen Dinge zu kümmern.
»Ich habe eine Aufgabe für dich«, knurrte Thoren, als sie seine Gemächer erreicht hatten. »Eine Aufgabe, bei der dein Talent sinnvoller eingesetzt ist als bei der Suche nach einem billigen Straßendieb.« Er warf sein Schwert auf die Tischplatte und ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen. »Es wird Zeit, dass wir uns endlich um Jerik kümmern. Wir haben schon viel zu lange damit gewartet. Wir müssen endlich in Erfahrung bringen, was dieser Drecksack im Schilde führt. Es macht mich wütend, dass er uns ständig an der Nase herumführt und uns immer mehr Steine in den Weg legt.«
Sara verzog das Gesicht. Es gefiel ihr überhaupt nicht, dem Puppenspieler zu helfen, nachdem er sie kurz zuvor noch im Stich gelassen hatte. Andererseits ging es hier ja nicht um ihn, sondern in erster Linie um Ann Revin. Und die Kaiserinmutter konnte am wenigsten dafür, dass ihr Handlanger sich heute als eigennütziges Arschloch entpuppt hatte. Widerwillig nickte sie. »Ich soll ihn beschatten.«
Thoren schnaufte. »Nicht beschatten. Mit solchen Dingen können wir uns nicht länger aufhalten. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Was ich brauche, ist ein Geständnis.«
Sara runzelte die Stirn. »Was soll er denn gestehen?«
»Alles natürlich. Ich will wissen, was er vorhat, wer seine Helfer sind und ob er im Auftrag von jemandem handelt. Und zwar so schnell wie möglich. Am besten noch, bevor diese verdammte Versammlung stattgefunden hat.«
»Aber wie soll ich das denn anstellen? Wie soll ich ihn denn dazu bringen?«
»Denk dir etwas aus«, fauchte Thoren. »Du wolltest Scheel heute ein Messer in die Kehle rammen, da wirst du doch wohl noch mit einem Krüppel fertigwerden. Immerhin kannst du dich unsichtbar machen, verdammt!«
Sara zuckte zusammen und fühlte sich mit einem Mal ziemlich unwohl in ihrer Haut. So zornig hatte sie Thoren noch nie erlebt. »Schon«, brummte sie. »Bei Scheel war das aber etwas anderes. Ich war aufgebracht und wütend … und außerdem hatte Ann Revin befohlen, dass wir den Narren nicht anrühren sollen.«
»Jetzt sind die Umstände aber anders, und jetzt befehle eben ich, dass du alles Nötige tust, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.« Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Du kannst jetzt gehen. Sieh zu, dass du mir endlich etwas in die Hand gibst, mit dem ich arbeiten kann.«
Einen Moment lang starrte Sara ihn sprachlos an. Sie wusste nicht, was sie von dem Ausbruch des Puppenspielers halten oder was sie darauf erwidern sollte. Seinem Gesichtsausdruck nach wartete er auch gar nicht auf eine Antwort.
2
SIGNALE UND FALSCHE FÄHRTEN
Ich traue diesem Kerl nicht«, murmelte Cunrat ad Koredin halblaut. Er rieb sich den nach Art der Ordensritter kurz gestutzten Haarschopf und versuchte, sich so dicht wie möglich an der Wand zu halten, ohne den schmierigen Bewuchs darauf tatsächlich zu berühren.
»Er hat uns immerhin aus dem Kerker gebracht«, gab Jans zu bedenken. Auch das Hemd des anderen Ritters klebte klatschnass auf dessen Rücken. Ein dichter Vorhang aus seltsam warmem Regen prasselte auf das knappe Dutzend Männer ein und verwandelte die schmale Gasse in einen Bach, der um ihre bloßen Knöchel gurgelte. Der Regen wusch den Geruch von Staub und Abfall weg, der noch immer schwach zwischen den Gebäuden hing, und ersetzte ihn mit einem Hauch salziger Seeluft und dem Odem nasser Vegetation, die jenseits der Mauern wucherte.
»Er hat uns aus dem Keller in den Hof gebracht, wohin wir es auch ohne ihn geschafft hätten. Das ist noch lange kein Grund, ihm zu trauen. Wibalt sagt, der Kerl ist ein Gezeichneter. Und er ist mit Sicherheit kein Ritter des Ordens. Sieh ihn dir doch an.« Düster musterte Cunrat den hageren Mann, der sich fest in seinen abgeschabten, dunklen Umhang gewickelt hatte. Dünne Beine in ebenso abgetragenen Hosen schauten darunter hervor und verliehen ihm das Aussehen eines großen, missmutigen Schreitvogels, der im seichten Wasser auf seine Beute wartete. Die spitze Nase, die aus der Kapuze seines Umhangs hervorschaute, machte es nicht besser. Im Moment stand der vogelhafte Mann am Ausgang der Gasse und starrte irgendwohin in den Regen, während die übrigen Männer hinter ihm standen, die Köpfe zwischen die Schultern gezogen, die Hände um Messer und Schwertgriffe geklammert.
Der Ritter vor Cunrat drehte sich um. »Halt die Klappe, ad Koredin. Der Kommandant hat beschlossen, dass wir ihm vorerst folgen, also folgen wir ihm.« Er schniefte und wischte sich über den narbigen, schief verheilten Kiefer. »Von vertrauen hat niemand etwas gesagt«, murmelte er dann leiser, über das Rauschen des Regens kaum zu verstehen. »Haltet die Augen offen.«
Cunrat hob die Brauen. »Hast du eine Ahnung, was er vorhat, Dolen?«, raunte er zurück.
Als hätte der Vogelmann ihn gehört, drehte er sich um. Er wischte sich den Regen von der Nase. »Also gut. Der Regen ist ein Segen. Die Wachen hier taugen zwar nicht viel, aber nicht mal die wären blöd genug, um uns einfach passieren zu lassen. Wie es aussieht, haben sie sich aber nach innen verzogen. Das ist unsere Gelegenheit. Wenn wir schnell und leise sind. Hoffe ich.«
Der Grauhaarige unterbrach ihn barsch. »Haltet keine Volksreden, Messer. Wie ist euer Plan?«
»Meister Messer«, korrigierte ihn der Vogelmann mit einer Spur Tadel in der Stimme. »Der Plan ist einfach, Ritter. Wir gehen durch das schöne Tor in den äußeren Festungshof. Das Tor ist nur von zwei Mann bewacht und war die letzten drei Male offen, also wird es auch dieses Mal wieder offen sein. Und ich wette mein bestes Messer, dass die zwei Kerle sich irgendwo drinnen untergestellt haben, bis der schlimmste Wolkenbruch vorbei ist. Wir gehen einzeln und ohne zu laufen. Haltet die Köpfe unten und hofft, dass der Regen nicht nachlässt.«
Der Grauhaarige verzog das Gesicht. »Das soll ein Plan sein?«
Messers Nase zuckte. »Das ist der halbe Plan«, entgegnete er.
Der alte Ritter starrte ihn an. »Der halbe?«
»Vielleicht etwas weniger.« Messers Tonfall wurde eine Spur schärfer. »Kritisiert meinen Plan nicht, Ritter. Es ist ein guter Plan. Vielleicht sogar so gut, dass er uns hier rausbringt. Ich war noch nicht fertig. Sobald ihr durch das Tor seid, haltet euch rechts, die erste Gasse hinab. Dort liegt euer Ordenshaus. Es ist verlassen, aber das Portal steht offen.«
Jetzt starrten alle Ritter den hageren Mann an.
»Du willst, dass wir uns im Ordenshaus verstecken? Das ist der Plan? Das ist kein Plan, das ist Schwachsinn.«
Messer funkelte ihn einen Augenblick lang an. Dann kroch ein schmales Lächeln auf seine schmale Visage. »Genau das. Kein Mensch wird ernstlich annehmen, dass ihr euch an den offensichtlichsten aller Orte begebt, weil sie davon ausgehen, dass ihr zu schlau dafür seid. Tut das, was keiner erwartet.«
Cunrat runzelte die Stirn. »Aber wenn sie davon ausgehen, dass wir so schlau sind, werden sie dann nicht auf dieselbe Idee kommen?«
Messers Lächeln wurde eine Spur breiter, doch er gewann dadurch nicht. »Du denkst mit, junger Mann. Das gefällt mir. Würden sie – wenn sie tatsächlich ordentliche Kriegsknechte Beruns und die normale Besatzung dieser Festung wären. Sind sie aber nicht. Sie sind nur irgendwelche Söldner, die jemand in die Farben Beruns gesteckt hat, hauptsächlich aus Veycari, vielleicht auch Cortenara. Ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall ein undisziplinierter Haufen Nichtsnutze, die noch nicht viel länger hier sein können als ihr. Also werden sie darauf bauen, dass ihr euch noch weniger auskennt und das Ordenshaus nicht einmal findet. Ich würde also meinen, dass das genau der ideale Ort ist, um uns Gedanken darüber zu machen, was als Nächstes kommt. Und jetzt los.« Ohne weitere Worte drehte sich der Vogelmann um und stakste in den Regenvorhang hinaus.
»Das ist vollkommen bescheuert«, murmelte der narbige Dolen erneut. Dann sah er auf. »Aber vielleicht bescheuert genug.«
Der grauhaarige Anführer nickte. »Ihr habt den Mann gehört. Einzeln Marsch, und lasst euch nicht erwischen. Wir treffen uns am Ordenshaus.« Auf seinen Wink hin folgte der erste der Ritter dem Vogelmann, dann der zweite.
Dolen und Cunrat bildeten den Schluss. Geduckt und gerade so schnell wie jemand, der dem heftigen Wolkenbruch entgehen will, eilte Cunrat endlich über den Hof auf das gewaltige Tor zu. Das Wasser zerrte an seinen Füßen und rauschte durch den offenen Torflügel in den Außenbereich der Festung, als wollte es sich ein eigenes Bett in den Fels graben. Als Cunrat unter dem gewaltigen Torbogen kurzzeitig aus dem Vorhang von Wasser hervorkam, fühlte es sich an, als hätte er eine Last von den Schultern geworfen. Er schüttelte den Kopf, wischte sich das Wasser aus den Augen – und blickte direkt in das Gesicht eines Wachmanns, der aus der Tür des Torhauses starrte. Überraschung verwandelte sich in Misstrauen, und der Mann öffnete den Mund. Eine haarige Pranke schloss sich um seinen Hals, als Wibalt aus dem Schatten trat und den fast zwei Kopf kleineren Mann hochhob. Die Hände des Wächters suchten nach seinem Dolch, doch Wibalts Pranke war schneller. Er zog die Waffe des Wächters und stach sie ihm durch den offenen Mund.
Cunrat zuckte zurück. Er starrte auf das Blut, das über das Heft des Dolchs schoss, über Wibalts Arm floss und von dem Sturzbach um ihre Füße davongespült wurde. Dann riss er den Blick los und sah Wibalt düster an.
»Warum … war das nötig?«, zischte er und warf einen alarmierten Blick ins Torhaus, doch dort regte sich nichts.
Wibalt ließ den Mann sinken und zuckte mit den Schultern. »Er ist ein Kriegsknecht. Hat dein Gesicht gesehen. War die beste Lösung. Kein Risiko.«
Cunrat schniefte und sah sich nochmals um. »Einfach so? Und was wird jetzt mit ihm?«
»Einfach so«, bestätigte Wibalt.
Plötzlich stand Dolen neben ihnen. Er wischte sich den Regen aus dem Gesicht, dann musterte er den Toten in Wibalts Pranke. Seine Miene verfinsterte sich. Ohne eine Frage zu stellen, schien er zu begreifen, was vorgefallen war. »Hierbleiben kann er nicht. Und seine Sachen könnten nützlich sein«, stellte er nüchtern fest. »Nimm ihn mit.«
Mit einem Grunzen warf sich Wibalt den Mann über die Schulter.
»Solarin?«
Die Stimme aus dem Inneren des Torhauses ließ Cunrat zusammenzucken. Er wirbelte herum und sah eine Silhouette im dunklen Durchgang auftauchen. Dieser Wächter war schneller von Begriff als sein Kamerad. Mit einem Fluch sprang Dolen vor, um einen Fuß in den Eingang zu bekommen, doch der Mann war um Haaresbreite schneller und zerrte die eisenbeschlagene Tür vor der Nase des Ritters zu. Dolen packte den schweren Ring an ihrer Außenseite, doch schon scharrte ein Riegel und sperrte ihn wirksam aus. Dem narbigen Ritter blieb nichts weiter, als einen unflätigen Fluch auszustoßen und wirkungslos gegen das Hindernis zu treten.
»Ich schätze, jetzt haben wir ein Problem«, stellte Wibalt fest. Wie um seine Worte zu unterstreichen, begann irgendwo im Inneren des Torhauses blechern ein Alarmgong zu scheppern.
Cunrat starrte ihn entgeistert an. »Und vorher hatten wir keins?«
»Nicht so richtig.« Der bärtige Ritter deutete auf den Leichnam des Mannes namens Solarin auf seiner Schulter. »Ich schätze, den kann ich dann hierlassen, Dolen?«
Der andere würdigte ihn keiner Antwort. Stattdessen schoss er ihm nur einen düsteren Blick zu. »Kommt«, bellte er und schoss hinaus in den Regen des äußeren Festungshofs.