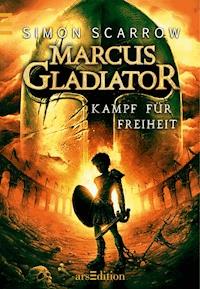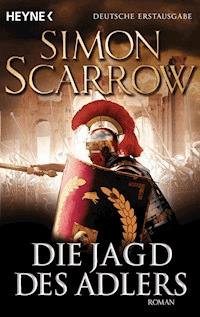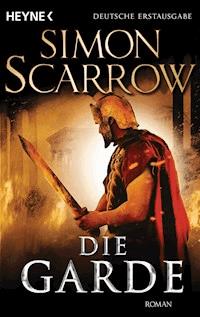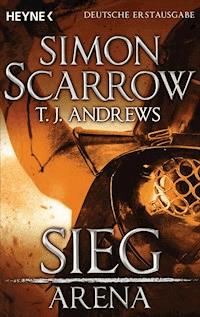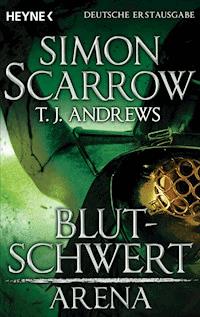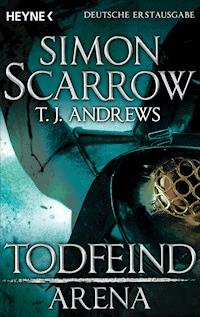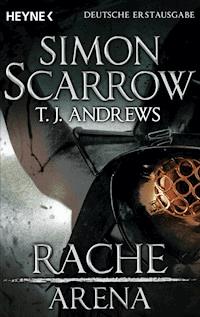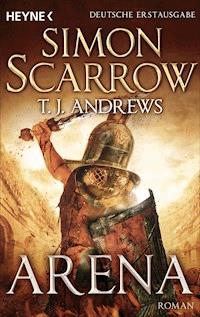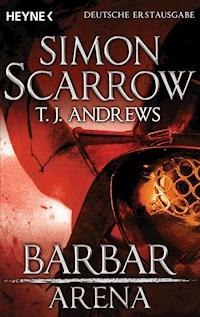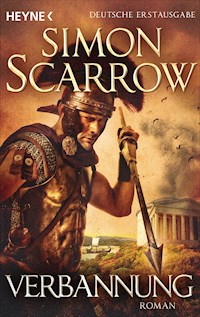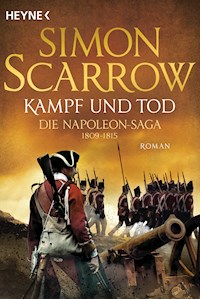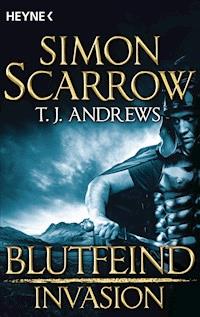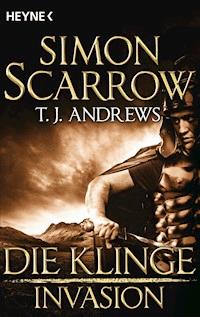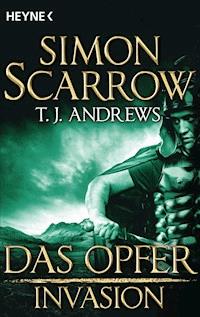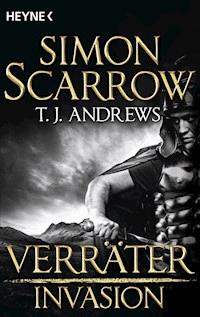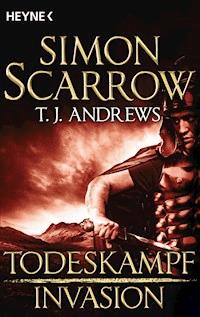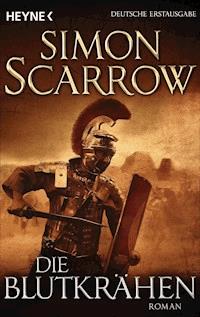
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rom-Serie
- Sprache: Deutsch
Der neue Band der gewaltigen Rom-Serie von Bestsellerautor Simon Scarrow
Britannien, A. D. 51: Seit zehn Jahren kämpft das Römische Reich, um seine Herrschaft über die britannischen Stämme aufrecht zu erhalten. In dieser Situation ist es fatal, dass der größenwahnsinnige Kommandant Quertus einen grausamen Privatkrieg führt, der den Hass in Britannien weiter schürt. Mit seiner Kohorte der »Blutkrähen« richtet er tief im Feindesland wahre Massaker unter der Bevölkerung an. Nun liegt es an den beiden Kriegsveteranen Cato und Macro zu verhindern, dass das Land in einem Chaos versinkt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Table of Contents
Das Buch
Der Autor
Eine kurze Einführung in die Römische Armee
Teil Eins
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Teil Zwei
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Anmerkung des Autors
Rom-Serie
Newsletter-Anmeldung
Das Buch
Britannien ist von römischen Legionen besetzt, doch die britischen Stämme unter der Führung von Caratacus widersetzen sich nach wie vor der Fremdherrschaft. Der Hass der Bevölkerung wächst immer weiter, seit der sadistische Quertus ein Regiment brutalen Terrors errichtet hat. In der weit im Feindesland liegenden Festung Bruccium befiehlt er über die Blutkrähen, eine Kohorte Thraker, die sich der Befehlsgewalt Roms entzogen hat. Präfekt Cato und Centurio Macro sollen Quertus das Handwerk legen und machen sich auf den gefahrvollen Weg. Derweil versammelt Caratacus sein Heer, um sich für die römischen Gräueltaten zu rächen … Am Ende des Buches findet sich ein ausführliches Werkverzeichnis von Simon Scarrow.
Der Autor
Simon Scarrow wurde in Nigeria geboren und wuchs in England auf. Nach seinem Studium arbeitete er viele Jahre als Dozent für Geschichte an der Universität von Norfolk, eine Tätigkeit, die er aufgrund des großen Erfolgs seiner Romane nur widerwillig und aus Zeitgründen einstellen musste. Besuchen Sie Simon Scarrow im Internet unter www.simonscarrow.co.uk
Simon Scarrow
Die
Blutkrähen
Roman
Aus dem Englischen von
Martin Ruf
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe THE BLOOD CROWS erschien 2013bei Headline Publishing Group, London
Vollständige deutsche Erstausgabe 02/2015
Copyright © 2013 by Simon Scarrow
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Werner Bauer
Coverillustration: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von © Thinkstock
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-13975-9V005
www.heyne.de
Ad meus plurimus
diutinus quod optimus amicus,
Murray Jones
Eine kurze Einführungin die Römische Armee
Wie alle römischen Legionen bestand auch die Vierzehnte aus fünfeinhalbtausend Mann. Die grundlegende Einheit bildete die aus achtzig Mann bestehende Centurie, die von einem Centurio befehligt wurde. Die Centurie war in Einheiten zu je acht Legionären unterteilt, die sich ein Zimmer in den Mannschaftsunterkünften oder, bei einem Feldzug, ein Zelt teilten. Sechs Centurien bildeten eine Kohorte, und zehn Kohorten eine Legion, wobei die erste Kohorte doppelte Größe besaß. Jede Legion wurde von einem Reiterkontingent begleitet, das aus einhundertzwanzig Mann bestand und in vier Schwadronen unterteilt war, die als Kundschafter und Boten dienten. In absteigender Ordnung waren die wichtigsten Ränge wie folgt:
Der Legat war ein Mann von aristokratischer Herkunft. Er war in der Regel Mitte dreißig und führte bis zu fünf Jahre lang das Kommando über seine Legion. Während dieser Zeit versuchte er, sich einen Namen zu machen, um die Aussichten seiner nachfolgenden politischen Karriere zu verbessern.
Der Lagerpräfekt war meist ein ergrauter Veteran, der zuvor als erster Centurio der Legion gedient und nun die höchste Position erreicht hatte, die einem Berufssoldaten offenstand. Er war absolut integer und verfügte über große Erfahrung. War der Legat abwesend oder hors de combat, fiel ihm die Befehlsgewalt über die Legion zu.
Sechs Tribune dienten als Stabsoffiziere. Bei ihnen handelte es sich um Männer Anfang zwanzig, die zum ersten Mal Dienst in der Armee taten, um Verwaltungserfahrungen zu sammeln, bevor sie kleinere Posten in der Zivilverwaltung antreten würden. Beim leitenden Tribun verhielt es sich anders: Er war für ein hohes politisches Amt vorgesehen und sollte eines Tages eine Legion befehligen.
Was die Disziplin und die Ausbildung betraf, bildeten sechzig Centurionen das Rückgrat der Legion. Sie waren aufgrund ihrer Führungsqualitäten und ihrer Bereitschaft, bis zum Tod zu kämpfen, ausgewählt worden. Dementsprechend waren die Verluste unter ihnen viel höher als in allen anderen Rängen. Der dienstälteste Centurio befehligte die erste Centurie der ersten Kohorte; bei ihm handelte es sich um einen mehrfach ausgezeichneten und hoch respektierten Mann.
Die vier Decurionen der Legion befehligten die Reiterschwadronen. Möglicherweise gab es jedoch noch einen Centurio, der das Kommando über das gesamte berittene Kontingent innehatte, aber dieser Punkt ist umstritten.
Jedem Centurio stand ein Optio als Ordonnanzoffizier zur Seite, der über eine deutlich eingeschränktere Befehlsgewalt verfügte. Optios warteten gewöhnlich darauf, selbst an die Stelle eines Centurios zu treten, sollte diese frei werden.
Den Optios untergeordnet waren die Legionäre, Männer, die sich für fünfundzwanzig Jahre zum Dienst in der Armee verpflichtet hatten. Theoretisch musste man dazu römischer Bürger sein, doch mit der Zeit wurden immer mehr Rekruten aus der örtlichen Bevölkerung angeworben, die beim Eintritt in die Armee die römische Staatsbürgerschaft erhielten. Die Legionäre wurden gut bezahlt und konnten von Zeit zu Zeit auf beachtliche Sonderleistungen des Kaisers hoffen (nämlich immer dann, wenn dieser der Ansicht war, dass eine zusätzliche Ermunterung ihrer Loyalität angebracht sein könnte).
Einen geringeren Status als die Legionäre hatten die Kohorten der Hilfstruppen. Diese wurden aus Männern der eroberten Provinzen rekrutiert und lieferten dem römischen Reich die Reiterei und die leichte Infanterie sowie Soldaten für spezielle Aufgaben. Nach fünfundzwanzig Jahren in der Armee erhielten sie das römische Bürgerrecht. Reitereinheiten wie die Zweite thrakische Kohorte bestanden entweder aus fünfhundert oder eintausend Mann, wobei Letztere nur von sehr erfahrenen und außerordentlich fähigen Kommandanten befehligt wurden. Es gab auch gemischte Kohorten, die zu einem Drittel aus Berittenen und zu zwei Dritteln aus Fußsoldaten bestanden. Sie wurden dazu verwendet, das umgebende Territorium zu überwachen.
Teil Eins
Kapitel 1
Februar 51 n.Chr.
Die Reiterkolonne schob sich gerade mühsam die Hügelkuppe hinauf, als ihr Anführer plötzlich sein Pferd zügelte, die Hand hob und seinen Männern das Zeichen zum Anhalten gab. Frischer Regen hatte den Weg in eine klebrige Schlammfläche verwandelt, die von Löchern und tiefen Furchen durchzogen war, sodass die Pferde angestrengt schnaubten und mit pfeifenden Lungen nach Luft schnappten, während ihre Beine in den völlig aufgeweichten Boden sanken. Die kühle Luft hallte von den dumpfen Geräuschen wider, die die Hufe auf dem nassen Boden machten, bis die Tiere langsamer wurden und schließlich stehen blieben. Langgezogene Dampfwolken strömten aus ihren Nüstern. Der Führer der Kolonne trug über seinem schimmernden Brustpanzer einen dicken roten Umhang, dessen Zierschleifen seinen Rang erkennen ließen. Es war Legat Quintatus, Oberbefehlshaber der Vierzehnten Legion und damit betraut, die Westgrenze der Provinz Britannien zu sichern, die erst seit Kurzem zum römischen Reich gehörte.
Keine leichte Aufgabe, wie er sich bitter eingestehen musste. Es war nun schon fast acht Jahre her, seit die Armee auf der Insel am Ende der bekannten Welt gelandet war. Damals war Quintatus noch ein Tribun Anfang zwanzig gewesen, voller Überzeugung, eine wichtige Mission zu erfüllen, und vom Verlangen erfüllt, für sich selbst, für Rom und für den neuen Kaiser Claudius Ruhm zu erlangen. Die Armee hatte sich ihren Weg ins Land erkämpft und das mächtige Heer der vereinigten Stämme besiegt, das unter der Führung von Caratacus gestanden hatte. In einer Schlacht nach der anderen hatten die Römer die Inselbewohner immer weiter zurückgedrängt, bis sie die feindlichen Krieger in einem letzten Kampf nahe ihrer Hauptstadt Camulodunum vernichtet hatten.
Damals schien diese Schlacht die Entscheidung zu bringen. Der Kaiser selbst war vor Ort gewesen, um Zeuge des Sieges zu werden. Und um die ihm gebührenden Ehren dafür in Empfang zu nehmen. Sobald die Vertreter der meisten Stämme Verträge mit dem Kaiser geschlossen hatten, kehrte Claudius nach Rom zurück, wo er sich triumphal feiern ließ und der Menge verkündete, dass die Eroberung Britanniens erfolgreich abgeschlossen sei.
Aber so war es nicht. Der Legat runzelte die Stirn. So war es ganz und gar nicht. Die vermeintlich letzte Schlacht hatte Caratacus’ Widerstandswillen mitnichten gebrochen. Sie hatte ihm nur gezeigt, dass es geradezu selbstmörderisch war, seine tapferen, aber schlecht ausgebildeten Krieger in einen offenen Kampf mit den Römern zu schicken. Inzwischen hatte er gelernt, die Sache anders anzugehen. Er lockte römische Einheiten in einen Hinterhalt und setzte schnelle, bewegliche Truppen dazu ein, die Nachschublinien der Legionäre und ihre Außenposten zu plündern. Sieben Jahre und zahllose Feldzüge hatte es gedauert, um Caratacus in die Bergfestung der Silurer und Ordovicer zurückzudrängen. Die Männer dieser Stämme waren unerschrockene Krieger, die von der fanatischen Wildheit ihrer Druiden angetrieben wurden und entschlossen waren, Rom bis zum letzten Atemzug Widerstand zu leisten. Sie hatten Caratacus als ihren Anführer akzeptiert, und das neue Zentrum seines Widerstands hatte Kämpfer aus allen Gegenden der Insel angezogen, die den Römern gegenüber unerschütterlichen Hass empfanden.
Hinter den Legionären lag ein harter Winter, und kalte Winde und Eisregen hatten die römische Armee gezwungen, ihre Aktionen während der langen, dunklen Monate einzuschränken. Erst gegen Ende der Jahreszeit, als die tief hängenden Wolken und der Nebel sich aus dem Bergland jenseits der Grenze zurückzogen, waren die Legionen in der Lage, für den Rest des Winters weitere Feldzüge gegen die Bewohner der Insel zu organisieren. Ostorius Scapula, der Statthalter der Provinz, hatte der Vierzehnten befohlen, in die bewaldeten Täler vorzudringen und eine Kette aus Festungsanlagen zu errichten. Diese sollten als Basen für die Hauptoffensive dienen, die für den Frühling geplant war. Die lokalen Stämme hatten schnell und entschieden reagiert, und Legat Quintatus musste zur Kenntnis nehmen, dass selbst die stärksten Einheiten, die er ins Feindesland geschickt hatte, angegriffen wurden. Zwei Kohorten Legionäre, fast achthundert Mann. Der befehlshabende Tribun der Kolonne hatte dem Legaten zu Beginn des Angriffs eine Nachricht geschickt, in der er dringend um Unterstützung bat. Quintatus hatte den Rest der Legion bei Tagesanbruch aus der Garnison in Glevum geführt, und während sie sich der Festung näherten, war er mit einer Eskorte vorausgeritten, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Sein Herz war schwer von Furcht vor dem, was ihn dabei erwarten würde.
Jenseits des Hügels lag das Tal, das tief ins Land der Silurer führte. Der Legat spitzte die Ohren und versuchte, die Geräusche der Pferde hinter sich auszublenden. Doch vor ihm blieb alles still. Kein dumpfes, rhythmisches Hämmern der Äxte begleitete das Fällen der Bäume, mit dem die Legionäre Bauholz für die Errichtung ihrer Festung gewannen oder einen Streifen freien Landes jenseits des Festungsgrabens schufen. Keine Stimmen hallten von den Talhängen rechts und links wider. Auch kein Kampflärm.
»Wir kommen zu spät«, murmelte er leise vor sich hin. »Zu spät.«
Verärgert über sich selbst, runzelte er die Stirn, weil es ihm nicht gelungen war, seine Befürchtungen für sich zu behalten. Rasch blickte er sich um, weil er sehen wollte, ob jemand seine Worte gehört hatte. Die Männer seiner Eskorte, die sich direkt neben ihm befanden, saßen gelassen in ihren Sätteln. Nein, korrigierte er sich, nicht gelassen. Ihre Miene verriet, wie besorgt sie waren, während ihre Blicke auf der Suche nach einem Zeichen für die Anwesenheit des Feindes über das Land huschten. Der Legat holte tief Luft, um wieder ruhiger zu werden, schwang seinen Arm nach vorn und drückte die Fersen in die Flanken seines Pferdes. Das Tier setzte sich wieder in Bewegung. Seine dolchartigen Ohren zuckten, als spüre es die Nervosität seines Herrn. Der Weg wurde eben, und kurz darauf hatten die Reiter an der Spitze freie Sicht auf die Talmündung.
Der Bauplatz lag eine halbe Meile vor ihnen. Eine breite, offene Fläche war aus dem Kiefergehölz geschlagen worden; die Baumstümpfe sahen aus wie abgebrochene Zähne, die sich kreuz und quer über die aufgeworfene Erde verteilten. Die Umrisse der Festung waren noch erkennbar, aber dort, wo sich eigentlich der tiefe Graben, der Erdwall und die Palisade hätten befinden sollen, herrschte nur noch ein einziges Chaos aus verbrannten Balken, zerstörten Karren und den Überresten von Zelten, deren Planen aus Ziegenleder niedergerissen und in den Schlamm getrampelt worden waren. Viele Abschnitte des Schutzwalls waren zerstört, und die Erde und die Holzfundamente, aus denen er bestanden hatte, hatten sich in den Graben abgesenkt. Und man sah die Kadaver von Maultieren und Pferden sowie etliche Soldatenleichen. Die Toten waren nackt, und aus der Ferne erinnerte ihr fahles Fleisch den Legaten an Maden. Er schauderte und schob den Gedanken unwirsch beiseite. Seine Männer schnappten vernehmlich nach Luft, und einige von ihnen fluchten leise vor sich hin, während sie die Szenerie musterten. Quintatus’ Pferd ging immer langsamer und blieb schließlich stehen, sodass er seine Fersen wütend in die Seiten des Tieres bohrte und es zu einem leichten Trab zwang, indem er heftig an den Zügeln zerrte.
Nirgendwo gab es Anzeichen für eine Gefahr. Der Feind hatte seinen Angriff schon vor vielen Stunden beendet und sich nach seinem Sieg mit allem, was er hatte erbeuten können, zurückgezogen. Außer der zerstörten Festung, den Transportkarren und den Toten gab es hier nichts mehr.
Abgesehen natürlich von den Krähen, die sich auf das Aas gestürzt hatten. Als die Reiter dem Weg ins Tal folgten, schwangen sich die Vögel in die Lüfte, wobei sie heisere Warnrufe ausstießen und sich krächzend darüber beschwerten, dass sie ihr düsteres Festmahl aufgeben mussten. Wie Streifen schwarzen Tuchs, die von Sturmböen erfasst worden waren, wirbelten sie durch die Luft und erfüllten die Ohren des Legaten und seiner Männer mit ihren hässlichen Lauten.
Quintatus ließ sein Pferd im Schritt gehen, als er die Überreste des Haupttores erreicht hatte. Die Holztürme der Festung waren zuerst errichtet worden; jetzt stand nur noch der verkohlte Rahmen. Vor einem Hintergrund aus Felsen und baumbestandenen Hügeln stiegen noch immer dünne Rauchfäden aus dem Holz zu den tief hängenden grauen Wolken auf. Von beiden Seiten des Tores aus führte der Graben zu den Ecken der Festung, wo die Überreste der Türme standen. Der Legat schnalzte mit der Zunge und führte sein Pferd am zerstörten Torhaus vorbei. Auf der gegenüberliegenden Seite befanden sich der Wall und der Streifen freien Landes, der innerhalb der Befestigungsanlagen eingerichtet worden war. Dahinter wiederum erkannte man das, was von den Zelten noch übrig war, und dort lagen auch die ersten, dicht aneinander gedrängten Leichen. Die Körper der Toten trugen keine Rüstungen, Tuniken und Stiefel mehr; sie wirkten seltsam verzerrt und waren von blauen Flecken übersät. Blut, das aus den düsteren Mündern ihrer tödlichen Wunden geströmt war, beschmierte ihre Haut. Außerdem gab es kleinere Schnitte und Risse in ihrem Fleisch, wo sich die Krähen mit ihren Schnäbeln zu schaffen gemacht hatten, und mehrere Leichen hatten blutige Augenhöhlen, aus denen die Vögel die Augen gezerrt hatten. Einigen Toten waren die Köpfe abgehackt worden, und die Stümpfe waren mit einer dicken Schicht aus schwarzem, getrocknetem Blut bedeckt.
Während Quintatus auf die gefallenen Legionäre hinabstarrte, lenkte ein Mitglied seines Offizierstabs sein Pferd neben ihn und nickte grimmig.
»Sieht so aus, als hätten einige unserer Männer wenigstens heftigen Widerstand geleistet.«
Der Legat ging nicht auf die Bemerkung ein. Es war nicht schwer, sich die letzten Augenblicke im Leben dieser Legionäre vorzustellen und vor sich zu sehen, wie sie, Rücken an Rücken kämpfend, sich bis zum Schluss behaupteten. Nachdem die letzten Verwundeten getötet worden waren, hatte der Feind den Männern ihre Waffen und ihre Ausrüstung abgenommen. Caratacus und seine Krieger würden behalten, was sie gebrauchen konnten, und den Rest in den nächsten Fluss werfen oder irgendwo vergraben, sodass die Römer nichts davon wieder in die Vorräte der Vierzehnten Legion zurückführen konnten. Quintatus ließ seinen Blick über die Festung schweifen und stellte fest: Noch mehr Leichen befanden sich zwischen den zerstörten Zelten; einzeln oder in kleinen Gruppen lagen sie auf der Erde, was auf das Chaos schließen ließ, das geherrscht haben musste, nachdem die feindlichen Krieger die erst halb errichteten Verteidigungsanlagen durchbrochen hatten.
»Soll ich die Männer absitzen lassen, damit sie die Toten begraben können, Herr?«
Quintatus drehte sich zu dem Tribun um, und es dauerte einige Augenblicke, bis die Frage seine düsteren Gedanken durchdrungen hatte. Er schüttelte den Kopf. »Sie sollen liegen bleiben, bis der Rest der Legion hier ist.«
Der jüngere Offizier wirkte überrascht. »Bist du sicher, Herr? Ich fürchte, die Moral der Truppe könnte darunter leiden. Sie ist ohnehin nicht besonders gut.«
»Ich kenne die Stimmung meiner Männer nur zu gut, vielen Dank«, erwiderte der Legat in scharfem Ton. Doch sofort wurde seine Miene wieder milder. Eifrig darauf bedacht, seine aus zweiter oder dritter Hand erworbenen militärischen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen, war der Tribun in seiner schimmernden Rüstung erst vor Kurzem aus Rom eingetroffen. Quintatus erinnerte sich daran, dass er selbst nicht anders gewesen war, als er den Dienst in seiner ersten Legion angetreten hatte. Er räusperte sich und zwang sich, in ruhigem Ton fortzufahren.
»Die Männer sollen die Leichen sehen.« Viele Legionäre gehörten noch nicht lange der Vierzehnten an; es handelte sich um Ersatzeinheiten, die nach dem Ende der Winterstürme mit den ersten Schiffen aus Gallien eingetroffen waren. »Ich will, dass sie begreifen, was ihr Schicksal sein wird, sollten sie es jemals zulassen, dass der Feind sie besiegt.«
Der Tribun zögerte einen Augenblick, dann nickte er und sagte: »Wie du befiehlst.«
Quintatus ließ sein Pferd wieder im Schritt gehen und ritt ins Herz der Festung. Zerstörung und Tod umgaben ihn auf beiden Seiten des breiten, schlammigen Weges durch die Trümmer, der im rechten Winkel von einem zweiten Weg geschnitten wurde. Er musterte die Fetzen, die vom Zelt der Kommandantur noch übrig waren. Gleich daneben lag ein weiterer Haufen Leichen, und der Legat spürte, wie ihm ein kalter Schauer über den Rücken rann, als er das Gesicht von Salvius erkannte, dem befehlshabenden Centurio einer der Kohorten. Der grauhaarige Veteran lag auf dem Rücken und starrte blicklos zum bedeckten Himmel hinauf; sein Kiefer hing schlaff herab, sodass man die unregelmäßigen gelben Zähne sehen konnte. Er war ein guter Offizier gewesen, dachte Quintatus. Zäh, effizient, mutig und mehrfach ausgezeichnet. Zweifellos hatte Salvius dafür gesorgt, dass seine Centurie bis zum Schluss den höchsten Anforderungen gerecht wurde. Er trug mehrere Wunden in Brust und Bauch, und der Legat war überzeugt, dass es keine einzige im Rücken des Mannes gäbe, wenn man seine Leiche umdrehen würde. Vielleicht hatte der Feind aus Respekt darauf verzichtet, ihn zu köpfen, dachte der Legat.
Noch nicht entdeckt hatte er Tribun Marcellus, den Leiter des Bautrupps. Quintatus drückte sich hoch, indem er sich auf den Sattelknauf stützte, schwang ein Bein übers Pferd und sprang zu Boden, wobei die feuchte Erde ein lautes Schmatzen von sich gab. Er trat auf die Leichen zu, wobei er nach dem jungen Aristokraten Ausschau hielt, dessen erstes unabhängiges Kommando sich auch als sein letztes erwiesen hatte. Weil es sinnlos war, ihn zwischen den kopflosen Toten zu suchen, wich der Legat ihnen aus und sah sich an anderen Stellen um. Doch er konnte Marcellus auch dann nicht finden, nachdem er mehrere Leichen umgedreht hatte, die auf dem Bauch lagen. Zwei der Toten hatten schreckliche Verletzungen im Gesicht. Zerfetztes Fleisch, zerschmetterte Knochen und lose herabhängende Hautlappen machten eine sofortige Identifizierung unmöglich. Marcellus zu finden musste warten.
Der Legat erstarrte. Plötzlich war ihm etwas klar geworden. Er richtete sich auf, musterte die Überreste des Lagers und versuchte, die Anzahl der im Schlamm verstreuten Leichen abzuschätzen. Nirgendwo gab es auch nur einen gefallenen Feind, aber das war auch nicht anders zu erwarten. Die Bewohner der Insel nahmen ihre Toten immer mit sich und begruben sie an verborgenen Orten, wo die Römer sie nicht finden konnten, damit niemand wusste, wie hoch ihre Verluste waren.
»Was ist, Herr?«, fragte der Tribun, den die plötzliche Reaktion seines Vorgesetzten beklommen machte.
»Hier sind zu wenige von unseren Männern. Soweit ich das erkennen kann, fehlt etwa ein Viertel.«
Der Tribun sah sich um und nickte. »Wo sind sie?«
»Wir müssen annehmen, dass sie dem Feind lebend in die Hände gefallen sind«, sagte Quintatus kalt. »Als Gefangene … Mögen die Götter ihnen gnädig sein. Sie hätten sich nicht ergeben sollen.«
»Was wird mit ihnen geschehen, Herr?«
Quintatus zuckte mit den Schultern. »Wenn sie Glück haben, wird man sie als Sklaven halten, bis sie sich zu Tode geschuftet haben. Zuvor wird man sie von Stamm zu Stamm führen und den Menschen in den Hügeln als Beweis dafür vorführen, dass Rom besiegt werden kann.«
Der Tribun schwieg einen Augenblick, dann schluckte er nervös. »Und was ist, wenn sie kein Glück haben?«
»Dann wird man sie den Druiden übergeben, um sie ihren Göttern zu opfern. Man wird ihnen die Haut abziehen oder sie bei lebendigem Leib verbrennen. Deshalb sollte man am besten dafür sorgen, dass man ihnen nicht in die Hände fällt.« Quintatus sah eine Bewegung aus den Augenwinkeln und drehte sich in Richtung des Weges, der vom Haupttor wegführte. Die erste Centurie aus dem Hauptteil seiner Einheit hatte die Hügelkuppe erreicht und ritt nun langsam den Abhang hinunter, was den Männern einige Mühe bereitete, denn der Boden wurde immer schlammiger. Für einen kurzen Moment rissen die Wolken auf, und ein dünner Lichtstrahl fiel auf die Spitze der Kolonne. Ein helles Funkeln verriet die Position der Adlerstandarte und der anderen Standarten, die ein Bild des Kaisers oder die Insignien und den Schmuck kleinerer Einheiten trugen. Quintatus war sich nicht sicher, ob er das als gutes Omen werten sollte. Wenn ja, dann hatten die Götter einen merkwürdigen Geschmack, was die Wahl des richtigen Zeitpunkts betraf.
Der Tribun fragte: »Was nun, Herr?«
»Hm?«
»Was sind deine Befehle?«
»Wir werden zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Sobald die Legion hier ist, will ich, dass der Graben und die Wälle repariert werden, und dann soll die Arbeit an der Festung fortgeführt werden.« Quintatus reckte sich und sah zu den bewaldeten Hängen hinauf, die das Tal umgaben. »Die Wilden haben heute einen kleinen Sieg errungen. Das lässt sich nicht mehr ändern. Sie werden ihn in den Hügeln ausgiebig feiern. Diese Narren. Das alles wird Rom nur noch mehr in seiner Entschlossenheit bestätigen, auch den letzten Widerstand zu vernichten, den man unserem Willen entgegenbringt. Wie lange es auch immer dauern mag, du kannst sicher sein, dass Ostorius und der Kaiser uns keine Ruhe gönnen werden, bis unsere Aufgabe erledigt ist.« Ein kurzes, bitteres Lächeln huschte über seine zuckenden Lippen. »Du solltest dich besser nicht an die Annehmlichkeiten gewöhnen, die die Festung bei Glevum zu bieten hat, mein Junge.«
Der junge Offizier nickte feierlich.
»Gut. Ich möchte, dass hier das Zelt für das Hauptquartier errichtet wird. Nimm dir einige Männer, um das Areal frei zu räumen, und mach dich an die Arbeit. Lass meinen Sekretär kommen. Der Statthalter wird so schnell wie möglich einen Bericht über die Ereignisse hier haben wollen.« Quintatus strich sich übers Kinn, während er noch einmal zu den Leichen von Centurio Salvius und seinen Kameraden hinübersah. Trauer erfüllte sein Herz angesichts des Verlusts dieser Männer, und schwer lastete das Wissen auf ihm, dass der kommende Feldzug nicht weniger schwierig oder weniger blutig würde als jeder andere, den die Römer seit ihrer Ankunft auf dieser verfluchten Insel geführt hatten.
Das hier war eine neue Art Krieg. Die römischen Soldaten würden äußerst rücksichtslos vorgehen müssen, um den Widerstand des Feindes zu brechen. Und diese Soldaten würden von Offizieren geführt werden müssen, die ihre Gegner gnadenlos und konsequent zu verfolgen wussten, ohne dass in ihren Herzen Platz für Mitleid gewesen wäre. Glücklicherweise gab es solche Männer, dachte Quintatus. Besonders der Name eines Mannes ließ bei seinen Feinden bereits das Blut in den Adern gefrieren. Centurio Quertus. Gäbe es hundert Offiziere wie ihn, wären Roms Schwierigkeiten in Britannien schon bald beendet. Solche Männer brauchte man im Krieg. Aber was wurde im Frieden aus ihnen? Nun, sagte sich Quintatus, das war nicht sein Problem.
Kapitel 2
Die Tamesis, zwei Monate später
Bei allen Göttern! Wie sehr hat sich dieser Ort doch verändert!« Centurio Macro deutete auf die Gebäude, die sich am Nordufer des Flusses unabsehbar weit hinzogen. Das Frachtschiff hatte gerade eine breite Biegung der Tamesis hinter sich gebracht und den Bug so ausgerichtet, dass die stetige Seebrise die Segel unter dem grauen, bedeckten Himmel flattern ließ.
Der Kapitän legte die Hände trichterförmig um seinen Mund und schrie mit bellender Stimme über das breite Deck: »An die Takelage! Holt die Segel ein!«
Mehrere Männer kletterten die Taue hinauf, während sich der Kapitän dem Rest seiner Besatzung zuwandte. »Bereitmachen zum Rudern!«
Die Matrosen – teils Gallier, teils Bataver – zögerten einen winzigen Augenblick, bevor sie der Anweisung mit mürrischer Miene nachkamen. Macro konnte ein Grinsen nicht unterdrücken, während er ihnen zusah, denn ihm war klar, wie man ihren stummen Protest verstehen musste: Er war ein Ritual, keine ernsthafte Weigerung. Genauso verhielt es sich mit den Soldaten, mit denen er die meiste Zeit seines Lebens über Umgang gehabt hatte. Er wandte sich der Landschaft zu, die auf beiden Seiten des Flusses von nicht allzu hohen Hügeln gekennzeichnet war. Fast überall waren die Bäume gefällt worden, und man erkannte zahllose kleine Bauernhäuser. Darüber hinaus gab es eine Handvoll größerer Gebäude mit Ziegeldächern, was ein Zeichen dafür war, dass Rom der neuen Provinz bereits seinen Stempel aufzudrücken begann. Macro schüttelte den Gedanken ab und warf einen Blick auf seinen Begleiter, der nur wenige Schritte entfernt neben ihm stand. Die Ellbogen des jungen Mannes ruhten auf der Reling, während er mit ausdruckslosem Gesicht in die kleinen Wellen des vorbeigleitenden Flusses starrte. Macro räusperte sich auf nicht gerade subtile Art.
»Ich sagte, dieser Ort hat sich verändert.«
Cato zuckte zusammen, sah auf und lächelte knapp. »Entschuldige, ich war viele Meilen weit weg.«
Macro nickte. »Natürlich. Du bist mit deinen Gedanken in Rom. Mach dir keine Sorgen, Junge. Julia ist eine gute Frau und eine wunderbare Gattin. Sie wird dafür sorgen, dass dich ein gutes Zuhause erwartet, wenn du wieder nach Rom zurückkehrst.«
Trotz der Tatsache, dass sein Freund inzwischen einen höheren Rang innehatte als Macro, hatten acht Jahre des gemeinsamen Dienstes eine ungezwungene Vertrautheit zwischen ihnen geschaffen. Einst war Macro Catos vorgesetzter Offizier gewesen, doch jetzt hatte Cato ihn überrundet. Ihm war der Rang eines Präfekten verliehen worden, und er stand kurz davor, sein erstes, längerfristiges Kommando einer aus Hilfstruppen bestehenden Kohorte zu übernehmen: die Zweite Kohorte der thrakischen Kavallerie. Der bisherige Kommandant der Zweiten war während des letzten Feldzugs getötet worden, und der kaiserliche Stab in Rom hatte Cato dazu bestimmt, seinen Posten zu übernehmen.
»Ich frage mich, wann das sein wird«, erwiderte der jüngere Mann, und eine gewisse Bitterkeit lag in seiner Stimme. »Nach allem, was ich gehört habe, war die Siegesfeier, die der Kaiser anlässlich der Eroberung Britanniens veranstaltet hat, einigermaßen verfrüht. Gut möglich, dass wir noch gegen Caratacus und seine Anhänger kämpfen werden, wenn wir längst alte Männer sind.«
»Soll mir nur recht sein.« Macro zuckte mit den Schultern. »Besser ehrlichen Dienst in einer Legion leisten als die Geheimoperationen, mit denen wir uns beschäftigen mussten, als wir das letzte Mal hier waren.«
»Ich dachte, du hasst Britannien. Ständig hast du dich über das feuchte Klima, die Kälte und den Mangel an anständigem Essen beschwert. Du hast gesagt, du könntest es gar nicht erwarten, von hier wegzukommen.«
»Tatsächlich?«, fragte Macro mit unschuldiger Miene und rieb sich die Hände. »Trotzdem sind wir hier, wo ein ordentlicher Feldzug vorbereitet wird und die Chance besteht, dass wir weiter befördert werden, Auszeichnungen erhalten und ich – was am allerbesten ist – möglicherweise meine Pension aufstocken kann. Auch ich habe mir die Berichte über dieses Land angehört, mein Junge. Die Leute reden über gewaltige Silbervorkommen in den Bergen im Westen der Insel. Wenn wir Glück haben, wird es uns hier ziemlich gut gehen, sobald wir den Einheimischen einen ordentlichen Tritt in den Hintern verpasst haben und sie zur Vernunft gekommen sind.«
Cato konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Meiner Erfahrung nach kommen die Leute selten zur Vernunft, wenn man sie in den Hintern tritt.«
»Da bin ich anderer Ansicht. Wenn man weiß, wo und wie fest man zutreten muss, kann man einen Mann dazu bringen, alles zu tun, was einem notwendig erscheint.«
»Wenn du das sagst.« Cato hatte keine Lust auf ein Streitgespräch. Der Umstand, von Julia getrennt zu sein, bedrückte ihn noch immer. Sie hatten sich wenige Jahre zuvor an der Ostgrenze des Reichs getroffen, wo Julias Vater, Senator Sempronius, kaiserlicher Botschafter am Hof des Königs von Palmyra war. In eine Senatorenfamilie einzuheiraten hatte für einen jungen Mann wie Cato, der als Offizier in der Legion diente, einen beträchtlichen Zuwachs an gesellschaftlichem Rang sowie die Sorge mit sich gebracht, dass die Mitglieder der alten Aristokratenfamilie auf ihn herabsehen würden. Doch Senator Sempronius hatte Catos große Aussichten erkannt und sich darüber gefreut, dass der junge Offizier seine Tochter heiraten wollte. Die Hochzeit war der glücklichste Tag in Catos Leben, doch ihm blieb nur wenig Zeit, sich an ein Leben als Ehemann zu gewöhnen, denn kurz darauf war der Marschbefehl des kaiserlichen Sekretärs bei ihm eingetroffen. Narcissus stand unter dem wachsenden Druck einer Gruppe, die sich dafür einsetzte, dass der junge Prinz Nero Claudius als Kaiser folgen sollte. Der kaiserliche Sekretär gehörte zu denjenigen, die Britannicus, den unehelichen Sohn des Kaisers, unterstützten, doch seine Partei verlor immer mehr an Einfluss auf den tatterigen alten Mann, der über das mächtigste Reich der Welt herrschte. Narcissus hatte erklärt, er tue Cato einen Gefallen, wenn er ihn so weit wie möglich von Rom wegschickte. Sollte der Kaiser sterben, würde ein Kampf um die Macht losbrechen, bei dem niemand mit Gnade rechnen konnte, der auf der falschen Seite stand oder irgendwie mit der unterlegenen Partei verbunden war. Sollte Britannicus scheitern, wäre das sein Ende. Was ebenso für Narcissus galt.
Da sowohl Cato als auch Macro dem Sekretär – wenn auch gegen ihren Willen – gute Dienste geleistet hatten, wären auch sie in Gefahr. Deshalb war es besser für sie, wenn sie an irgendeiner fernen Grenze kämpfen würden, sobald die entscheidende Phase begonnen hatte, damit sie der Aufmerksamkeit der auf Rache sinnenden Anhänger Neros entgingen. Obwohl Cato erst vor Kurzem Nero das Leben gerettet hatte, hatten sich seine Wege mit denen von Pallas, dem kaiserlichen Freigelassenen, gekreuzt, der gleichsam das Gehirn hinter der Partei des Prinzen war. Pallas war nicht geneigt, denjenigen zu vergeben, die ein Hindernis für seine Ambitionen darstellten. Neros Schuld gegenüber Cato würde den jungen Offizier nicht retten. Das war der Grund, warum Cato und Macro kaum einen Monat nach der Hochzeitsfeier im Haus von Julias Vater in den Palast befohlen wurden, um dort neue Aufträge zu erhalten. Cato wurde das Kommando über die thrakische Kohorte übertragen und Macro das Kommando über eine Kohorte innerhalb der Vierzehnten Legion. Beide Einheiten dienten in der Armee von Statthalter Ostorius Scapula in Britannien.
Tränen waren geflossen, als die Zeit von Catos Aufbruch gekommen war. Julia hatte ihn umschlungen, und er hatte sie so fest an sich gedrückt, dass er spürte, wie ein Zittern durch ihre Brust ging, als sie ihr Gesicht in die Falten seines Mantels geschoben hatte und ihr volles, dunkles Haar auf seine Hände fiel. Der Trennungsschmerz, den seine junge Frau empfand und den auch er fühlte, zerriss Cato schier das Herz. Doch der Befehl war erteilt worden, und das Pflichtgefühl, das die Bürger Roms verband und das es ihnen ermöglichte, ihre Feinde zu überwinden, ließ sich nicht einfach beiseitewischen.
»Wann wirst du zurückkehren?« Julias Stimme wurde von den Falten der Wolle gedämpft. Mit geröteten Augen sah sie zu ihm auf, und Cato spürte, wie ein heftiger Schmerz durch sein Herz strömte. Mühsam rang er sich die Andeutung eines Lächelns ab.
»Der Feldzug wird schon bald vorbei sein, Liebste. Es ist unmöglich, dass Caratacus noch lange durchhält. Er wird besiegt werden.«
»Und dann?«
»Dann werde ich auf eine Nachricht des neuen Kaisers warten, und wenn es sicher ist, werde ich zurückkehren und mich um einen zivilen Posten in Rom bewerben.«
Einen Moment lang presste Julia die Lippen zusammen. »Aber das kann Jahre dauern.«
»Ja.«
Beide schwiegen einen kurzen Augenblick, bevor Julia fortfuhr: »Ich könnte zu dir nach Britannien kommen.«
Cato legte den Kopf auf die Seite. »Vielleicht. Aber jetzt noch nicht. Bis jetzt ist die Insel kaum mehr als ein barbarischer Landstrich am Ende der Welt. Es gibt nur wenig von den Annehmlichkeiten, die du gewöhnt bist. Und es gibt die verschiedensten Gefahren. Die ungesunden Lüfte sind nur eine davon.«
»Das spielt keine Rolle. Ich habe schon unter den schwierigsten Bedingungen gelebt, Cato. Du weißt, dass das stimmt. Nach allem, was wir durchgemacht haben, verdienen wir es einfach, zusammen zu sein.«
»Ich weiß.«
»Dann versprich mir, dass du mich benachrichtigst, sobald ich gefahrlos nachkommen kann.« Sie drückte sich noch heftiger gegen seinen Mantel und starrte ihm in die Augen. »Versprich es mir.«
Cato spürte, wie seine Entschlossenheit, sie vor den Gefahren und Unannehmlichkeiten der neuen Provinz zu bewahren, ins Wanken geriet. »Ich verspreche es.«
Sie lockerte ihre Umarmung und trat einen halben Schritt von ihm weg, wobei ihre Miene zugleich Erleichterung und Schmerz verriet. Sie nickte. »Lass mich nicht zu lange warten, liebster Cato.«
»Nicht einen Tag länger als unbedingt nötig. Das schwöre ich.«
»Gut.« Sie lächelte und stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn auf den Mund zu küssen. Dann drückte sie seine Hände ein letztes Mal und reckte sich. »So musst du gehen.«
Cato sah sie lange an. Dann verbeugte er sich, wandte sich vom Haus des Senators ab und folgte der Straße, die ihn zum Stadttor führte. Dort würde er eines der auf dem Tiber liegenden Boote nehmen, um Macro im Hafen von Ostia zu treffen. Als er das Ende der Straße erreicht hatte, warf er einen Blick zurück und sah Julia an der Tür stehen. Er zwang sich, sich wieder umzudrehen, und ging weiter, bis er außer Sichtweite war.
Auch jetzt litt Cato kaum weniger unter der Trennung, obwohl die lange Reise ihn zunächst über das Meer nach Massillia und dann über Land nach Gesoriacum geführt hatte, wo er sich schließlich zusammen mit den anderen auf das Frachtschiff begeben hatte, welches sie das letzte Stück des Weges bis nach Britannien brachte. Es fühlte sich merkwürdig an, nach mehreren Jahren auf die Insel zurückzukehren. Einige Stunden zuvor hatte das Frachtschiff einen Uferabschnitt passiert, an dem Cato und seine Kameraden von der Zweiten Legion sich gegen eine Horde einheimischer Krieger den Weg an Land freigekämpft hatten. Damals waren ihre Gegner von kreischenden Druiden angefeuert worden, die düstere Zaubersprüche und wilde Flüche gegen die Invasoren ausstießen. Die Erinnerung war eine schauerliche Mahnung vor dem, was Cato möglicherweise bevorstand, und er fürchtete, dass es noch einige Jahre dauern würde, bis er dieses Land für sicher genug halten konnte, um seine Frau zu sich zu holen.
»Ist das da vorne Londinium?«
Cato drehte sich um und erblickte eine schlanke, alte Frau mit hartem Gesicht, die über das Deck auf ihn zukam. Eben war sie aus der Luke geklettert, die hinab in die beengten Quartiere der Passagiere führte. Sie hatte sich einen Schal um den Kopf gewickelt, und einige lose Strähnen ihres grauen Haars tanzten im Wind. Cato lächelte zur Begrüßung, und Macro empfing sie mit einem breiten Grinsen, als sie neben ihn an die Reling trat.
»Du siehst sehr viel besser aus, Mutter.«
»Natürlich«, erwiderte sie in scharfem Ton. »Schließlich hat dieses elende Boot aufgehört, ständig hin und her zu schwanken. Ich war mir sicher, dass wir im Sturm sinken würden. Und ehrlich gesagt hätte ich es als Gnade betrachtet, wenn es so weit gekommen wäre. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so elend gefühlt.«
»Das war überhaupt kein richtiger Sturm«, sagte Macro verächtlich.
»Nein?« Die alte Frau nickte in Catos Richtung. »Was meinst du? Du hast dich genauso oft übergeben wie ich.«
Cato schnitt eine Grimasse. Beim Schwanken und Sich-Aufbäumen des Schiffs in der Nacht zuvor war ihm höchst übel geworden. Er hatte sich nur noch zusammenkrümmen und in einen Holzeimer neben seinem Bett erbrechen können. Selbst unter den günstigsten Bedingungen waren ihm Reisen über das Mittelmeer zuwider, und die wilde See vor der Küste Galliens war für ihn eine einzige Qual.
Macro stieß ein unbeeindrucktes Schnauben aus. »Das waren bestenfalls ein paar heftige Böen. Gute, frische Luft, die ein wenig Salz in meine Lungen geblasen hat.«
»Während sie alles andere bis auf den letzten Rest aus deinen Därmen geholt hat«, erwiderte seine Mutter. »Ich würde lieber sterben als so etwas noch einmal durchmachen zu müssen. Aber sei’s drum. Es ist am besten, die Sache ganz schnell zu vergessen. Ich habe gerade gefragt, ob das dort vorne Londinium ist.«
Die beiden Männer wandten sich in die Richtung, in die die alte Frau deutete, und hielten nach den fernen Gebäuden Ausschau, die sich am Nordufer der Tamesis entlangzogen. Mithilfe großer, in das Flussbett getriebener Holzbalken hatte man einen Kai errichtet, dessen Rahmenwerk aus Querbalken mit Steinen und Erde aufgefüllt und schließlich gepflastert worden war. Mehrere Frachtschiffe waren bereits am Kai vertäut, und genauso viele andere ankerten ein kurzes Stück davon entfernt flussaufwärts, wo sie darauf warteten, bis sie an die Reihe kämen, ihre Ladung zu löschen. Auf dem Kai waren zahllose Sklaven eifrig damit beschäftigt, die Waren aus den Frachträumen der Schiffe in die langen, flachen Lagerhäuser zu tragen. Hinter diesen Lagerhäusern erhoben sich weitere Gebäude, von denen viele noch im Bau waren, wodurch die neue Stadt langsam Gestalt annahm. Etwa einhundert Schritte vom Ufer entfernt konnte man das zweite Stockwerk eines großen Gebäudekomplexes erkennen, das sich über die anderen Bauwerke erhob. Cato erkannte, dass sich dort das Stadtzentrum mit dem Markt, mehreren Höfen, Geschäften, Büros und dem Verwaltungssitz befinden musste, wie das bei allen Städten der Fall war, die von Rom gegründet wurden.
»Ja, genau das ist Londinium«, antwortete der Kapitän, als er zu den Passagieren trat. »Die Stadt wächst schneller als ein Abszess am Arsch eines Maulesels. Und sie ist genauso bösartig.«
»Oh?« Macros Mutter runzelte die Stirn.
»Nun, genauso ist es, Dame Portia. Der Ort ist ein Rattenloch. Enge Straßen voller Schlamm, billigen Kneipen und zweifelhaften Geschäften. Es wird eine Weile dauern, bis der Ort ein wenig zur Ruhe kommt und sich in die Art von Stadt verwandelt hat, die du gewohnt bist.«
Sie lächelte. »Gut. Genau das wollte ich hören.«
Der Kapitän sah sie stirnrunzelnd an, und Macro stieß ein bellendes Lachen aus.
»Sie ist gekommen, um hier ein Geschäft aufzuziehen.«
Der Kapitän musterte die alte Frau aufmerksam. »Welche Art von Geschäft?«
»Ich möchte ein Gasthaus eröffnen«, erwiderte sie. »Einen guten Schluck Wein und andere Annehmlichkeiten wissen die Leute immer zu schätzen, wenn sie eine Seereise hinter sich haben, und ich würde sagen, dass Londinium zahlreiche Händler, Matrosen und Soldaten zu Gesicht bekommt, die durch seine Tore ziehen. Das sind alles gute Kunden für die Art von Diensten, die ich anzubieten beabsichtige.«
»Oh, es gibt hier gewiss viele Möglichkeiten, mit den Leuten ins Geschäft zu kommen.« Der Kapitän nickte. »Doch es ist kein leichtes Leben. Und in dieser neuen Provinz ist es sogar besonders schwierig. Bei den Kaufleuten, die hier auf gute Verdienste aus sind, handelt es sich um unangenehme, raue Gesellen. Sie werden es nicht gerne sehen, wenn eine Römerin ihnen Konkurrenz machen will.«
»In meinem Gasthaus in Ravenna habe ich gelernt, mit ungehobelten Männern umzugehen. Ich glaube nicht, dass mir die Leute hier irgendwelche Schwierigkeiten machen werden. Besonders nicht, wenn sie herausfinden, dass mein Sohn einer der befehlshabenden Centurios in der Vierzehnten Legion ist.« Liebevoll drückte sie Macros Arm.
»Stimmt.« Macro nickte. »Jeder, der sich mit meiner Mutter anlegt, bekommt es mit mir zu tun. Und das hat sich für niemanden ausgezahlt, der das bisher versucht hat.«
Der Kapitän betrachtete den kräftigen, gedrungenen Körper des römischen Offiziers sowie die Narben in seinem Gesicht und auf seinen Armen. Er war überzeugt, dass Macro recht hatte.
»Das mag ja alles sein, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum du hierhergekommen bist, gute Frau. In Gesoriacum hättest du es viel bequemer. Auch dort lassen sich jede Menge Geschäfte machen.«
Portia zog einen Schmollmund. »Das richtige Geld wird hier verdient, und zwar von denen, die keine Zeit verlieren. Abgesehen davon ist dieser Junge alles, was ich jetzt noch habe auf der Welt. Ich will so nahe wie möglich bei ihm sein. Wer weiß, wenn er die Legion verlässt, beteiligt er sich vielleicht an meinem Geschäft.«
Macros Augen funkelten. »Ah, das ist mal eine Idee. All der Wein und so viele Frauen, wie ein Mann sich nur wünschen kann. Und das alles unter einem Dach!«
Portia schlug ihm leicht auf den Arm. »Wenn ich es mir recht überlege … Ihr Soldaten seid alle gleich. Aber wie auch immer. Ich werde hier in Londinium mein Glück machen, und ich werde hier bis ans Ende meiner Tage bleiben. Was du mit deinem Leben machst, Macro, liegt ganz bei dir. Aber ich bleibe hier. Das ist mein letztes Zuhause.«
In einer stetigen Bewegung glitt das Frachtschiff auf den Kai zu. Als sie sich der Stadt näherten, rochen die an Deck Stehenden zum ersten Mal den scharfen, torfigen Geruch der Stadt, in den sich der Gestank nach Abwässern und Holzrauch mischte, der ihnen fast im Hals stecken blieb.
»Vielleicht hat die Seeluft doch gewisse Vorteile«, sagte Cato und rümpfte die Nase.
Es gab keinen Platz mehr, um am Kai anzulegen, und der Kapitän befahl, das Ende der Schiffsreihe anzusteuern, die ein Stück flussaufwärts vor Anker lag. In entschuldigendem Ton wandte er sich an seine Passagiere.
»Es wird eine Weile dauern, bis wir an der Reihe sind. Ihr könnt gerne an Bord bleiben, aber wenn ihr wollt, lasse ich euch von ein paar meiner Leute in einem Boot an Land rudern.«
Cato drückte sich von der Reling hoch und nahm jenes militärische Auftreten an, das er von Macro gelernt hatte. Er reckte sich und strahlte Entschlossenheit aus. »Wir gehen an Land. Der Centurio und ich müssen der nächstgelegenen Dienststelle so schnell wie möglich Bericht erstatten.«
»Ja, Herr.« Der Kapitän begriff sofort, dass der lässige Umgang, der während der Seereise geherrscht hatte, zu Ende war, und führte die Knöchel seiner Hand an die Stirn. »Ich kümmere mich sofort darum.«
Er hielt Wort, und als der Anker mit einem lauten Aufklatschen in den Fluss abgelassen wurde und die Mannschaft die Ruder einholte, waren die Ausrüstungstaschen der beiden Offiziere sowie die Taschen und Kisten Portias bereits aus dem Laderaum an Deck gebracht worden. Das Boot, ein kleines, breites Gefährt mit flachem Bug, wurde zu Wasser gelassen; zwei Ruderer sprangen geschickt hinein und hoben die Arme, um den Passagieren zu helfen. Es gab nur Platz für sie selbst; ihr Gepäck würde danach an Land gebracht werden. Cato trat als Letzter in das kleine Boot, wobei er heftig mit den Armen fuchtelte, um das Gleichgewicht zu bewahren, bevor er sich schwer auf eine Ruderbank sinken ließ. Macro warf ihm einen wachsamen Blick zu und verzog missbilligend das Gesicht, doch da senkten die Matrosen bereits die Ruder, und das Boot glitt auf den Kai zu. Jetzt, da sie Londinium noch näher waren, konnten sie erkennen, dass überall aus den Abzugsrohren des Kais Abwässer in den Fluss strömten. In jenem Abschnitt des Flusses, in dem wegen des Kais fast keine Strömung herrschte, hatten sich zerbrochene Balken und anderes Treibgut gesammelt, über das Ratten auf der Jagd nach etwas Essbarem huschten. Am Ende des Kais erhoben sich mehrere Holzstufen aus dem Fluss, und die Ruderer hielten darauf zu. Als sie längsseits waren, zog der Mann, der dem Kai am nächsten war, sein Ruder ins Boot und griff nach der von Schleim überzogenen Trosse, die als Fender diente. Er hielt sie fest, während sein Kamerad die zu einer Schlaufe geformte Leine um den Anlegepfosten führte.
»Meine Herren, meine Dame, da wären wir.« Er lächelte und half ihnen aus dem Boot. Mit Cato an der Spitze stiegen sie die Stufen zum Kai hinauf, von wo aus sie die Verbindung zwischen den Schiffen und den Lagerhäusern musterten, auf der sich zahllose Menschen drängten. Lautes Stimmengewirr, in dem man die rauen Schreie von Maultieren, das Knallen mehrerer Peitschen und die Rufe der Sklaventreiber ausmachen konnte, erfüllte die kühle Luft dieses Frühlingsnachmittags. Obwohl die Szene chaotisch wirkte, wusste Cato, dass sie in jeder ihrer Einzelheiten verriet, welch gewaltiger Wandel über die Insel gekommen war, die der Macht Roms fast einhundert Jahre lang getrotzt hatte. Britannien hatte sich wohl oder übel verändert, und sobald die letzten Widerstandsnester vernichtet wären, würde die neue Provinz Gestalt annehmen und Teil des römischen Imperiums werden.
Macro trat neben ihn und sah sich kurz um, bevor er murmelte: »Willkommen zurück in Britannien, dem Arsch der Zivilisation.«
Kapitel 3
Sobald das Boot mit ihrem Gepäck zurückgekommen war, ging Macro auf eine kleine Gruppe von Männern zu, die neben dem nächstgelegenen Lagerhaus standen.
»Ich brauche ein paar Träger«, sagte er mit seiner lauten, klaren, auf dem Exerzierplatz geschulten Stimme zu ihnen. Sofort eilten sie zu ihm, und er suchte sich mehrere der am kräftigsten wirkenden Männer aus. Einer von ihnen hatte sich einen Lederstreifen um den Kopf gewickelt, um zu verhindern, dass ihm das dichte, drahtige Blondhaar zu tief in die Stirn sank. Unter dem Leder war ein Brandzeichen auf seiner Haut zu erkennen. Macro wusste sofort, was es bedeutete: Es war das Zeichen der Anhänger von Mithras, einer Religion, die aus dem Osten kam und sich scheinbar unaufhaltsam in den Reihen der römischen Armee verbreitete. »Du warst früher Soldat, wenn ich mich nicht irre.«
Der Mann verbeugte sich. »Ja, das war ich, Herr. Bevor der Speer eines Silurers mein Bein durchbohrt hat. Seither humple ich, weswegen ich nicht mehr mit dem Rest der Männer mithalten konnte. Die Armee hatte keine andere Wahl, als mich zu entlassen, Herr.«
Macro musterte ihn. Der Mann trug einen fadenscheinigen Militärmantel über seiner Tunika, und seine Stiefel wurden von Leinenstreifen zusammengehalten. »Lass mich raten. Du hast das Geld verschleudert, das dir bei deiner Entlassung ausgezahlt wurde, und jetzt ist dir nichts weiter geblieben als das hier.«
Der ehemalige Soldat nickte. »So könnte man sagen, Herr.«
»Wie heißt du, und was ist deine Einheit?«
»Legionär Marcus Metellius Decimus, Zweite Legion, Augusta, Herr!« Der Mann nahm Haltung an, wobei er kurz zusammenzuckte, bevor er die Hand an seinen Oberschenkel führte, um sein zitterndes Bein ruhig zu halten.
»Die Zweite. Hm.« Macro rieb sich über das Kinn. »Das ist meine alte Truppe. Oder vielleicht sollte ich besser sagen: unsere alte Truppe.« Er deutete mit dem Daumen nach hinten auf Cato. »Wir haben zusammen unter Legat Vespasian gedient.«
Decimus neigte bedauernd den Kopf. »Das war vor meiner Zeit, Herr.«
»Schade. Na schön. Decimus, du wirst dich um diese Männer kümmern. Unser Gepäck ist dort drüben auf dem Kai bei meinem Freund und der Frau.«
Decimus sah hinüber zur Verbindung zwischen Land und Wasser und schniefte. »Sie ist ein wenig zu alt für ihn. Es sei denn natürlich, sie hat Geld. Dann sind sie nie zu alt.«
Macro knirschte mit den Zähnen. »Die Dame ist meine Mutter. Und jetzt beweg dich.«
Rasch wandte Decimus sich ab und gab den anderen Männern ein Zeichen, ihm zu folgen. Als die Träger die Kisten und die Taschen mit der Ausrüstung hochhievten, versuchte Cato, sich zu orientieren. »In welcher Richtung liegt die örtliche Garnison?«
»Es gibt keine Garnison, Herr. Auch keine Festung. Nicht einmal städtische Befestigungsanlagen. Vor ein paar Jahren existierte zwar noch eine Festung, doch dieser Ort ist so schnell gewachsen, dass er sie einfach verschluckt hat. An der Stelle, an der die alte Festung stand, bauen sie jetzt den neuen Verwaltungssitz.«
»Verstehe.« Cato seufzte frustriert. »Wo kann ich dann jemanden aus dem Stab des Statthalters finden?«
Decimus dachte nach. »Du könntest es im Quartier des Statthalters versuchen. Das befindet sich direkt neben der Baustelle. Auf jeden Fall findest du ihn selbst dort.«
Cato war überrascht. »Ostorius ist hier in Londinium?«
»Ja, Herr.«
»Aber die Hauptstadt der Provinz ist Camulodunum.«
»Offiziell, ja, Herr. Caratacus kam schließlich von dort. Außerdem hat Claudius versichert, er wolle an jenem Ort sich selbst zu Ehren einen Tempel errichten lassen. Aber die Stadt liegt viel zu weit im Osten. Im Gegensatz zu dem, was einige in Rom vielleicht geplant haben, scheint jeder hier Londinium als Hauptstadt zu betrachten. Sogar der Statthalter. Und deshalb wirst du ihn dort finden.«
Cato hörte sich diese Neuigkeiten an und nickte. »Gut. Dann bring uns in sein Hauptquartier.«
Decimus verbeugte sich und hob eine der Ausrüstungstaschen auf seine Schulter. Er stieß ein Grunzen aus unter dem Gewicht der Rüstung, die sich darin befand, und schlug humpelnd den Weg in eine Seitenstraße ein. »Folge mir, Herr.«
Londinium erwies sich als exakt so unangenehm, wie der Kapitän des Frachtschiffs behauptet hatte. In den engen Straßen drängten sich die Menschen, und anders als in Rom gab es tagsüber keine Beschränkung für Fahrzeuge, die mit Rädern ausgestattet waren. Cato und die anderen mussten sich ihren Weg durch die schmale Durchgangsstraße freikämpfen, in der sich Karren, Pferde und Menschen dicht aneinander vorbeischoben. Decimus und seine Kollegen, denen die Stadt vertraut war, eilten voraus, und Cato befürchtete, dass er sie aus den Augen verlieren könnte. Mit einer diskreten Geste gab er Macro zu verstehen, er solle dafür sorgen, dass seine Mutter sich möglichst schnell durch die Menge schob. Aufgrund der Kleider und der Gesichtszüge der Menschen, die um sie herum unterwegs waren, konnte Cato erkennen, dass die meisten aus anderen Gegenden des Reichs stammten; zweifellos waren sie auf der Jagd nach schnellem Geld in die neue Provinz gekommen. Portia bekäme es mit zahlreichen Konkurrenten zu tun, und er hoffte, dass der Rang ihres Sohnes tatsächlich ausreichen würde, um ihre Geschäfte vor Betrügern, Dieben und anderen Verbrechern zu schützen, die Londinium bereits als lohnendes Ziel ausgespäht hatten.
»Alles in Ordnung, Mutter?«, fragte Macro.
Portia starrte mit kaltem Blick eine Gruppe von Inselbewohnern an, die auf der Straße an ihr vorüberkamen. Sie waren in Felle gekleidet, und kunstvolle Tätowierungen zogen sich über ihre Arme. »Wilde …«
Cato lächelte wortlos in sich hinein, doch dann runzelte er die Stirn. Es war noch ein langer Weg, bis die Menschen der Insel die römische Herrschaft akzeptieren würden. Caratacus und seine Anhänger mochten sich zwar weit entfernt im Westen von Londinium aufhalten, doch der Geist der Stammesangehörigen, die hier und in der Nähe der Stadt lebten, war offensichtlich ungebrochen. Sollte der Vormarsch der Legionen einen ernsthaften Rückschlag erleiden, würden sich gewiss mehr als nur ein paar der ursprünglichen Bewohner der Insel zu einem offenen Aufstand gegen Rom ermutigt fühlen. Wenn der Statthalter den größten Teil seiner Armee an der Grenze konzentrierte, gäbe es wenig, was die Rebellen noch stoppen könnte, sollten sie aus denjenigen Teilen der Provinz angreifen, die die hohen Herren in Rom auf ihren Karten offiziell als »befriedet« führten.
»Verdammt, wo sind dieser Decimus und seine Leute?«, knurrte Macro und reckte den Hals. Doch weil er nicht besonders groß war, konnte er nicht allzu viel erkennen.
»Etwa zwanzig Schritte vor uns«, erwiderte Cato.
»Lass diese Kerle nicht aus den Augen. Ich will nicht, dass unsere Ausrüstung schon beschädigt wird, kaum dass wir unseren Fuß an Land gesetzt haben. Wenn ich meinen Dienst in der Legion wieder antrete, werde ich nicht wie ein grüner Junge oder ein Muttersöhnchen aussehen, wenn ich es verhindern kann.«
Portia schnaubte. »Mein Sohn, wenn du eines ganz sicher nicht bist, dann ein Muttersöhnchen.«
Sie schoben sich weiter und bemühten sich, mit den Trägern vor ihnen Schritt zu halten. Als sie eine Kreuzung erreichten, auf der sich die Karren stauten, die dicht gepackte Amphoren transportierten, waren die Träger auf der anderen Straßenseite plötzlich nicht mehr zu sehen. Cato fühlte, wie ihm das Herz vor Verzweiflung schwer wurde und beißender Ärger über Decimus in ihm aufstieg, der ihnen so übel mitgespielt hatte.
»He! Präfekt! Hier entlang.«
Cato wandte sich in Richtung der Stimme – und sah Decimus und seine Kollegen gleich links jenseits der Kreuzung! Der ehemalige Legionär schüttelte spöttisch den Kopf. »Ich habe ein kaputtes Bein, aber wer nicht mehr mitkommt, das sind die Herren Offiziere. Was soll nur aus dieser Welt werden?«
Bevor Cato ihn unterbrechen und ermahnen konnte, er solle auf seine Worte achten, wenn er mit einem Vorgesetzten sprach, hob Decimus die Hand und deutete auf ein großes Tor, das sich nicht allzu weit entfernt am anderen Ende der Straße befand, in die sie gerade eingebogen waren. Hinter der Mauer konnte Cato ein Gerüst und einen hohen Holzkran erkennen, die sich vor dem von Rauch erfüllten Himmel erhoben.
»Da wären wir, Herr. Das ist der Verwaltungssitz. Oder jedenfalls das, was schon von ihm steht.«
Ohne darauf zu warten, ob einer seiner Kunden etwas dazu bemerken würde, setzte sich Decimus wieder in Bewegung, doch hier bewegte sich der Verkehr immerhin so, dass Cato und die anderen ihm leichter folgen konnten. Nachdem die Reihe der Weinkarren endlich vorübergerollt war, schafften sie es bis zum Tor und traten auf die beiden Legionäre zu, die dort Wache standen. Die äußere Seite des Torbogens war mit Steinplatten verkleidet und verputzt worden, doch die Wand, die den Bauplatz umgab, war noch nicht fertig, sodass man die frei liegenden Backsteine erkennen konnte.
»Berichtet mir, in welcher Sache ihr hierherkommt«, sagte einer der Wachsoldaten mit ruhiger Stimme, während er seinen Blick über die beiden Männer und die ältere Frau schweifen ließ und sich bemühte, die vor ihm Stehenden einzuschätzen. Die beiden Offiziere waren mit sauberen, neuen Tuniken und Militärmänteln bekleidet, die sie vor ihrer Abreise in Rom gekauft hatten. Obwohl sie weder Abzeichen trugen, die ihren Rang angaben, noch Schmuckringe, die möglichen Reichtum verraten hätten, erzählten die Haltung der beiden Offiziere und die sichtbaren Narben ihre eigene Geschichte. Besonders die lange, weiße Linie, die sich von der Stirn bis zum Kinn über Catos Gesicht zog. Der Wachposten räusperte sich und fuhr mit noch ein wenig milderem Ton fort: »Wie kann ich dir helfen, Herr?«
»Präfekt Quintus Licinius Cato und Centurio Lucius Cornelius Macro.« Er nickte kurz in Macros Richtung, bevor er weitersprach. »Wir sind gerade aus Rom angekommen, um unser Kommando anzutreten. Wir möchten dem Stab des Statthalters Bericht erstatten. Außerdem suchen wir eine Unterkunft für uns.«
»Was die Unterkunft betrifft, so ist hier nicht mehr viel übrig. Die Festung wurde vor zwei Monaten abgerissen.«
»Offensichtlich. Ich nehme an, dass Ostorius und sein Stab wohl kaum im Freien arbeiten.«
»Das werden wir wohl kaum erleben, Herr!« Der Wachposten drehte sich zur Seite, senkte die Spitze seines Speers und deutete auf das Gerüst, das den breiten, einstöckigen Gebäudekomplex umgab. »Dort beginnt der Palast des Statthalters. Er hat den Arbeitern befohlen, das Erdgeschoss fertigzustellen und dann zu verschwinden. Es ist ihnen jedoch noch gelungen, die Fußbodenheizung einzubauen, bevor sie gegangen sind, also hat man es da drin jetzt nett und gemütlich. Anders als diejenigen von uns, die der Eskorte des Statthalters zugeteilt wurden. Die schlafen draußen in Zelten.«
»Das machen Soldaten üblicherweise so, mein Junge.« Macro schnalzte mit der Zunge. »Wenn das zu hart für dich ist, hättest du dich vielleicht irgendeiner weibischen Truppe von Schauspielern anschließen sollen.«
»Kommt mit!« Cato winkte seine Begleiter heran und folgte dem Pfad, der auf dem Bauplatz frei geräumt worden war. Auf beiden Seiten zogen sich Stapel von Balken, Backsteinen und Dachziegeln entlang des Weges, und überall gab es Tröge zum Mischen von Zement. Die Fundamente für mehrere große Häuser waren bereits fertiggestellt, und hüfthohe Mauern umgrenzten das erste, mächtige Verwaltungsgebäude, das die Stadtlandschaft beherrschen und dessen Anblick, so stand zu hoffen, das Herz jedes Inselbewohners mit Ehrfurcht erfüllen würde. Hunderte Männer arbeiteten auf dem Gelände, wobei noch einige Sträflinge hinzukamen, die das Material dorthin transportierten, wo es gebraucht wurde. Es war laut. Das Sägen des Holzes und das In-Form-Meißeln der Steine mischte sich mit den Stimmen der Aufseher, die den Arbeitern ihre Anweisungen zuriefen.
Macro nickte anerkennend, als sie über den Bauplatz gingen. »Wenn das fertig ist, dürfte es ziemlich beeindruckend aussehen.«
Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes hatte man im Baugerüst eine Lücke gelassen, wodurch es möglich wurde, das erst zur Hälfte errichtete Gebäude zu betreten, das als Hauptquartier für Statthalter Ostorius und seinen Stab diente. Zwei Mann aus seiner Eskorte standen am Eingang Wache. Noch einmal erklärte Cato den Grund seines Kommens und schickte sich an, die Träger zu bezahlen, welche ihre Lasten unmittelbar vor dem provisorischen Eingang abgesetzt hatten. Er griff nach der Börse in seinem Gürtel und löste die Schnüre.
»Das macht dann eine Sesterze, Herr.« Decimus salutierte lässig, indem er mit einem Finger gegen seine Stirn tippte. »Für jeden.«
Macro hob eine Augenbraue. »Bei den Göttern, das ist ein bisschen teuer.«
»Ist der übliche Preis in Londinium, Herr.«
Cato wandte sich an eine der Wachen. »Stimmt das?«
Der Legionär nickte.
»Na schön.« Er fischte einige Münzen aus seiner Börse, zählte sie ab und reichte sie Decimus und den anderen. »Sieht so aus, als würde Londinium eine teure Stadt werden. Ihr könnt gehen … Decimus, auf ein Wort.«
Der ehemalige Legionär winkte seinen Kameraden nach und wandte sich dann an Cato. »Herr?«
Cato musterte ihn und versuchte, hinter der schmutzigen, zerrissenen Kleidung und dem ungekämmten Haar den Mann zu erkennen, der einst Legionär gewesen war. Wenn Decimus die Wahrheit sagte, dann hatte das immer unbeständige Kriegsglück seine Karriere in der Armee beendet – dasselbe Glück, das Cato und Macro in allen Feldzügen und erbitterten Schlachten der letzten Jahre treu zur Seite gestanden hatte. Manchmal kam es Cato so vor, als stelle er dieses Glück, von dem ihm nur eine ganz bestimmte Menge zuerkannt worden war, auf eine harte Probe. Früher oder später würde ihn ein Speer, ein Schwerthieb oder ein Pfeil finden, genau wie das bei Decimus und zahllosen anderen der Fall gewesen war.
»Wie viele Jahre hast du in Britannien gedient?«
Decimus kratzte sich das Kinn. »Ich bin vor fünf Jahren aus dem Ausbildungslager bei Gesoriacum hierhergekommen. Ich war bei der Zweiten, als wir gegen die Deceangli gekämpft haben, bevor ich mit einer Einheit als Verstärkung zur Vierzehnten bei Glevum kam. Dann folgten zwei Jahre Feldzüge gegen die Silurer, bis das hier passiert ist.« Er klopfte gegen sein lahmes Bein.
»Gut.« Cato nickte und dachte einen Augenblick nach, bevor er fortfuhr. »Wie gefällt dir die Arbeit als Kairatte?«
»Scheiße, ich hasse sie, Herr.« Er warf Portia einen raschen Blick zu. »Tut mir leid, verehrte Dame.«
Portia erwiderte seinen Blick mit großer Ruhe. »Während der letzten fünfzehn Jahre habe ich fast ununterbrochen mit einem Marinesoldaten zusammengelebt. Also schieb dir deine beschissene Entschuldigung sonst wohin.«
Macro starrte seine Mutter schockiert an. Sein Unterkiefer sackte nach unten, doch gleich darauf schloss er seinen Mund wieder, denn es schien ihm am besten, einfach das zu ignorieren, was sie gesagt hatte.
Decimus wandte sich wieder an Cato. »Aber was soll ein Soldat tun, wenn er zum Invaliden geworden ist? Ich hatte Glück, denn mir wurde wenigstens ein Teil meiner Pension ausbezahlt. Das genügte, um mich hier einzurichten, aber es ist nicht so viel, dass ich davon leben könnte.«
»Verstehe«, erwiderte Cato. »Nun, es könnte sein, dass ich Arbeit für dich habe. Nichts, das dir irgendwelchen Ruhm einbringt, und außerdem könnte es gefährlich werden. Wenn du interessiert bist, solltest du hier morgen bei Tagesanbruch wieder auftauchen.«
Decimus wirkte einen Moment lang vollkommen verblüfft. Dann verbeugte er sich und humpelte davon.
Macro sah ihm nach, bis er außer Hörweite war, und wandte sich dann an Cato. »Was sollte das denn?«
»Die Dinge haben sich verändert, seit wir das letzte Mal hier waren. Sicher, der Statthalter wird uns einiges an Informationen zukommen lassen, doch er wird alles ausschließlich aus seiner Perspektive darstellen. Die übliche Mischung aus Zweckoptimismus und dem Herunterspielen der tatsächlichen Bedrohung, die von unseren Feinden ausgeht. Ostorius dürfte wie jeder andere Statthalter sein. Er wird versuchen, seine eigene Amtszeit möglichst glanzvoll wirken zu lassen, und ihm wird sehr daran gelegen sein, dass sämtliche Briefe und Berichte, die wir nach Hause schicken, ausführlich auf seine Erfolge eingehen. Deshalb könnte es nützlich sein, die Ansichten von jemandem zu hören, den Marius bestenfalls als eine Art Lastesel betrachtet. Außerdem brauche ich jemanden, der sich im Lager um meine Sachen kümmert. Jemanden, dem ich, wie ich hoffe, vertrauen kann.«
»Vertrauen?« Portia rümpfte die Nase. »Diesem Vagabunden? Für mich sieht er wie ein ganz gewöhnlicher Gauner aus.«