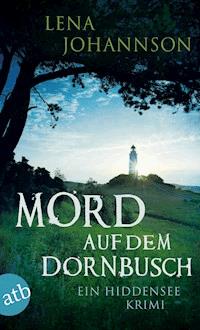4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
1430. Der Lübecker Kaufmann von Ranteln handelt mit allerlei Waren, die er nach Riga bringt und dort gegen Pelze eintauscht. Da er nun seine Tochter Bilke gut und vor allem gewinnbringend verheiraten will, schickt er sie mit einem Handelsschiff nach Riga, wo der junge Pelzhändler Hartwych bereits auf sie wartet. Dessen Herz gehört der armen Sängerin Ria, die er jedoch niemals zu seiner Frau nehmen kann … Die Braut des Plazhändlers: historischer Roman im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Ähnliche
Lena Johannson
Die Braut des Pelzhändlers
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Bilke
Am vierten Tag von Bilke von Rantelns Reise nach Riga zogen schwere Wetter auf. Düstere Wolken türmten sich vor einem gelblichen Himmel, der auf die Lübecker Kaufmannstochter bedrohlich wirkte. Schon seit der Nacht hatte der Wind beständig zugenommen und sich schließlich zu einem gewaltigen Sturm entwickelt. Bilke wusste, dass sie besser in ihrer Kabine geblieben wäre. Doch bei allem Komfort und aller Behaglichkeit, die der kleine Raum in dem Kastell bot, einem Aufbau am Heck der mächtigen Kogge, wie man ihn seit geraumer Zeit baute, konnte er sie doch nicht mit frischer Luft versorgen. Stickig war es und finster, da es nicht einmal ein kleines Fenster gab. Sie hatte Sorge, dass sie sich würde erbrechen müssen, und war an Deck gekommen. Besser, an der Reling festgeklammert würgen, als womöglich den Inhalt ihres Magens auf dem hölzernen Boden ihrer Kabine wiederzufinden. Obwohl sie gute Vorräte an Schollen und Rindfleisch mit sich führten, gab es an diesem Tag nur Zwieback und Butter. Das Herdfeuer war gelöscht worden, als der Sturm immer mehr an Kraft zugelegt hatte, damit nicht womöglich ein Brand entstünde. Bilke war es gerade recht. Appetit hatte sie ohnehin keinen. Schon der harte Zwieback lag ihr schwer im Magen. Aber ihr Vater hatte ihr vor ihrer ersten Seereise aufgetragen, auch dann zu essen, wenn ihr nicht danach zumute war, weil es ihr dann bessergehen würde, als wenn sie mit leerem Magen das Schwanken und Rollen, das Heben, Senken und Kippen des Schiffes auszuhalten versuchte.
Sie dachte an ihren Vater, ihre liebste Schwester Bente, die ihr glich wie eine Birke der anderen, und an Lübeck, wo sie mit ihren weiteren drei Geschwistern aufgewachsen war. Wie lange schien es her zu sein, dass sie an einem lausig kalten Apriltag des Jahres 1430 an Bord dieses Handelsschiffes gegangen war, um eine Reise anzutreten, die ihr ganzes Leben verändern würde. Ihr war, als sei sie bereits Wochen auf diesem Schiff unterwegs, dabei waren es erst einige Tage. Jede Minute floss unendlich zäh dahin, so langsam wie eine alte Frau, die sich schwerfällig aus einem Sessel erhob. Dabei wünschte sich Bilke doch nichts sehnlicher, als endlich livländischen Boden zu betreten. Der Grund ihrer Reise war ein äußerst glücklicher. Zum ersten Mal würde sie Hartwych begegnen, dem Sohn des Pelzhändlers Hans van Broke. An seiner Seite, so war es beschlossen, würde sie ihr Leben verbringen. Sie wusste, dass er ein weltgewandter und gebildeter Kaufmann aus den vornehmsten Kreisen Rigas war. Wenn sie an ihn dachte, klopfte ihr Herz einen Takt schneller. Wie mochte er wohl aussehen? Wie klang sein Lachen? Sie konnte es kaum erwarten, die Antworten auf all ihre Fragen zu bekommen.
Eine Welle war luvseits herangerollt und schlug jetzt hart gegen den Schiffsleib. Die Kogge neigte sich gefährlich zur Seite. Ein Bootsmann schrie Bilke gegen den tosenden Sturm an, sie habe sich augenblicklich wieder in ihre Unterkunft zu begeben. Sie zu begleiten, dazu fehlte ihm jedoch die Möglichkeit, denn er war vollauf damit beschäftigt, sich festzuhalten, um nicht zu stürzen. In der nächsten Sekunde musste er schon wieder Matrosen kommandieren und Rücksprache mit dem Kapitän halten. Bilke stand auf der dem Land abgewandten Seite des Schiffes. Ihre Finger klammerten sich um die Reling. Sie spürte das feuchte Holz und blickte auf dunkelgraue schäumende Ostseewellen. Salzwasser klatschte eisig gegen ihre Hände. Beinahe hätte sie losgelassen. Schon war ihr Kleid feucht von der Gischt, die unablässig über die Planken sprühte. Ihre Haare, von der Haube nur mäßig geschützt, klebten ihr am Kopf. Sie fragte sich, wo all die anderen Schiffe der Flotte waren. Auch kein einziges der Schutzboote war mehr zu sehen, wie sie beklommen feststellte. Sie waren vor drei Tagen im Verband von vier Handelsschiffen und sechs kleinen Schutzbooten aus dem Hafen von Lübeck ausgelaufen. Die Fracht an Bord war kostbar, und die dänischen Piraten waren gefürchtet.
In der Ferne entdeckte sie dann doch ein Schiff. Wie es aussah, hatte der Sturm die lübsche Flotte weit auseinandergetrieben. Für einen kurzen Moment verschwand das ungute Gefühl, das sich breitgemacht hatte, seit Bilke begriffen hatte, dass die anderen Schiffe fort waren. Doch die Erleichterung dauerte nicht lange an. Nein, dieser schlanke Dreimaster gehörte gewiss nicht zu ihrem Verband. An ihn hätte sie sich erinnern können. Sie war auf der Stelle in höchstem Maße angespannt und gleichermaßen fasziniert. Elegant trotzte das Schiff der schweren See und kam in erstaunlichem Tempo auf sie zu. Die hellen Segel schienen vor den schwarzen Wolken wie aus eigener Kraft zu strahlen. Bilke blickte angestrengt in die Richtung des fremden Seglers. Immer wieder musste sie einen Schritt bald zu dieser, bald zu jener Seite machen, um nicht ihr Gleichgewicht zu verlieren.
»Gehen Sie in Ihre Unterkunft«, rief der Bootsmann wieder, der soeben an ihrer Seite aufgetaucht war. Jetzt entdeckte auch er das schlanke Schiff. »Die Sandeimer!«, schrie er im nächsten Augenblick. Bilke erschrak. Herrschte eben schon wegen des schlechten Wetters und der tobenden See Unruhe unter der Mannschaft, steigerte sich diese jetzt zu nahezu panischer Betriebsamkeit. Die Männer brüllten Kommandos, schleppten Eimer heran und begannen, Sand auf die hölzernen Planken der Kogge zu schütten. Hier und da schwappte eine Welle über die stellenweise mannshohe Reling, so dass die Seeleute die Eimer gleich wieder füllen und erneut auskippen mussten. Sie wusste, was das bedeutet. Ihr Vater war oft genug mit seiner Ware auf der Ostsee unterwegs gewesen und hatte davon berichtet. Der Sand sollte verhindern, dass das Schiff in Flammen aufging, wenn es zum Gefecht kam, und er sollte den Männern mehr Halt auf dem nassen Holz geben. Sie begriff schlagartig, dass der schnittige Dreimaster, der direkt auf sie zuhielt, ein Piratenschiff sein musste. Ihr stockte der Atem. Die Übelkeit, die sie vollkommen vergessen hatte, kehrte unvermittelt zurück. Schon war das Schiff heran. Bilke musste sich in ihrer Kammer verbergen. Als sie es wagte, die Reling loszulassen, konnte sie die Männer an Bord des feindlichen Seglers bereits erkennen. Einer von ihnen hisste eine blutrote Flagge.
Bilke hastete auf die Treppe zu, die sie nach oben führen würde. Einen kurzen Moment zögerte sie, überlegte, ob es nicht klüger sei, sich zwischen Salz, Stockfisch und Hering zu verkriechen. Im Bauch der Kogge wäre sie sicher, das wusste sie. Oft genug hatte ihr Vater erzählt, dass Piraten niemals auf den Rumpf unterhalb der Wasserlinie zielten, denn bei einem solchen Treffer könnte das angegriffene Schiff leicht sinken. Und damit gleichzeitig ihre Beute. Nein, so töricht waren Piraten nicht. Sie kamen erst ganz nah heran und setzten dann die verteidigungsbereite Mannschaft außer Gefecht. Und dann machten sie sich über die Ladung her und würden auch eine Frau entdecken, die sich dort verbarg. Sie schauderte. Eine Gänsehaut kroch über ihren Nacken und breitete sich aus. Und das lag gewiss nicht allein an der Kälte. Nur wenige Schritte noch. Bilke konzentrierte sich darauf, schnell voranzukommen, ohne zu fallen. Ihr von der Gischt inzwischen vollkommen durchnässtes Kleid war ihr dabei hinderlich, denn es legte sich schwer um ihre Beine. Sie versuchte, den üppigen roten Stoff zu raffen, als eine Welle die Kogge anhob und gleich darauf in ein tiefes Tal stürzen ließ. Bilke machte rasch einen Schritt zur Seite, um sich abzufangen, und stieß mit dem Knie gegen das Geländer der kleinen Treppe, die zu ihrer Kabine führte. Sie kümmerte sich nicht um das schmerzhafte Pochen, sprang eilig die vier Stufen hinauf und schlug gleich darauf ihre Tür hinter sich zu.
Wenn nur ihr Vater da wäre! Seit vor fünf Jahren, im Jahr des Herrn 1425, Bilkes Mutter bei der Geburt des Jüngsten, Knud, gestorben war, sorgte Heimo von Ranteln allein für seine Kinder. Obwohl er ein Geschäft zu führen hatte und es für einen Mann gänzlich ungewöhnlich war, sich um seine Kinder zu kümmern, tat er dies mit einiger Hingabe und war stets für Bilke und ihre Geschwister da. Gewiss, die Kinderfrau war ihm stets zur Hand gegangen, doch blieben ihm noch immer genug Arbeit und Sorgen, die er nicht auf fremde Schultern abwälzen konnte. Nie würde Bilke den Tag kurz nach ihrem vierzehnten Geburtstag vergessen, an dem sie, wie schon bei ihren anderen Geschwistern, voller Spannung darauf gewartet hatte, in die Kammer der Eltern schleichen und das Neugeborene betrachten zu dürfen. Nur war diesmal alles anders. Schon erklang das für einen Säugling gewiss kräftig zu nennende Schreien des Kindes, das gedämpft durch die schweren Holztüren nur schwach an Bilkes Ohren drang. Und im nächsten Moment erfüllte ein Schrei das ganze Haus, der so laut und schauderhaft war, dass sie ihn ihr ganzes Leben nicht würde vergessen können. Es klang wie das Kreischen und Ächzen eines wilden Tieres, doch es war Bilkes Vater, der den Tod seiner Frau beklagte. Einige Tage bekamen Bilke und Bente und die Brüder Holger und Hauke ihren Vater nicht zu Gesicht. Sie trösteten sich mit dem winzigen Knud – die Mutter war sich sehr früh sicher gewesen, dass es ein Junge werden würde, und hatte diesen Namen gewählt – und waren mit ihrem eigenen Kummer beschäftigt. Bilke, als die Älteste, gab sich alle Mühe, Bente und die Jungen zu trösten. Gern hätte sie auch ihrem Vater Trost gespendet, wenn sie ihn manchmal nachts vor Kummer stöhnen hörte. Meist waren zuvor Schritte zu hören gewesen. Wahrscheinlich war er ruhelos herumgelaufen, oder eine Magd hatte ihm noch etwas zu essen oder zu trinken gebracht oder ihm eine Wärmflasche gerichtet. Nach dem Begräbnis seiner Frau ging Heimo wieder seinen Geschäften nach, dem Handel mit Gewürzen, Salz und vor allem Hering und Stockfisch. Er achtete überraschenderweise noch mehr als zuvor auf seine Kleidung, seine Haarpracht und seinen stattlichen Bart. Bilke fiel auf, dass die Kinderfrau seit dem Tod von Frau von Ranteln beschwingter wirkte und mit einem Mal zu geröteten Wangen neigte. Sie fragte sich, ob die Bedienstete womöglich ihren Kummer und die Mehrbelastung mit dem einen oder anderen Gläschen zu betäuben suchte. Von solchen Fällen hatte man schon gehört.
Ein Donner ertönte, gleich darauf ein Krachen und das alles durchdringende Geräusch von berstendem Holz. Bilke zuckte zusammen. Sie stellte fest, dass sie noch immer wie angewurzelt in ihrer Kabine stand. Es musste doch irgendetwas geben, das sie tun konnte. Nun gab es keinen Zweifel mehr, dass es sich um Piraten handelte, die sich anschickten, die lübsche Kogge zu entern. Hilfe von den Schutzbooten war offenkundig nicht zu erwarten. Sie strich das nasse Kleid glatt und richtete notdürftig die Haare und die Haube. Sie würde einem Kapitän, selbst wenn es sich um den eines Piratenschiffes handelte, so gegenübertreten, wie es sich für die Tochter eines angesehenen Rigafahrers gehörte. Bilke lauschte auf die Geräusche, deren Vielfalt mit jeder Sekunde zu wachsen schien, als würden unterschiedliche Instrumente sich nach und nach zu einem mehrstimmigen Orchester zusammenfinden. Zu dem Glucksen der Wellen, die an den Schiffsleib schlugen, kamen die Rufe der Männer, die zur Mannschaft gehörten, und längst auch die Schreie der Angreifer. Zudem war ein unregelmäßiges Trommeln wie von schweren Hagelkörnern auf einem Holzdach zu hören, das immer wieder von Schmerzenslauten durchbrochen wurde. Mit einem Mal gab es einen dumpfen Schlag, als ob ein schwerer eiserner Gegenstand gegen die Bordwand krachte. Bilke fiel ein, wie ihr Vater ihren Brüdern einmal erzählt hatte, dass Piraten Wurfanker aus Eisen verwendeten, um ihr Boot längsseits an ihre Beute heranzuziehen und dann entern zu können. Während sie daran dachte, wie sie, auf ihrer Fidel übend, damals über die Geschichte gelächelt hatte, spürte sie einen kräftigen Ruck, hörte gleich darauf einen lauten Schlag, verlor die Balance und stürzte auf die schlichte Pritsche, die ihr an Bord als Nachtlager diente. Also war die Geschichte mit dem durch die Luft sausenden Anker doch kein Ammenmärchen gewesen. Dann fielen die ersten Schüsse. Sie richtete sich kerzengerade auf, wartete und starrte auf die niedrige Holztür. Sie hätte nicht annähernd raten können, wie lange sie so saß, auf die grauenhaften Töne lauschend, die von berstendem Holz – oder waren es gar Knochen? – verursacht wurden oder die aus den Kehlen der gepeinigten Männer kamen. Plötzlich hörte sie ihren Namen, ausgesprochen mit einer tiefen Stimme, die zwar Bilkes Sprache benutzte, mit ihr aber offenbar nicht völlig vertraut war.
»Ich weiß, dass sie an Bord ist«, sagte die Stimme mit großer Überzeugung. Schritte kamen näher.
Bilke bemerkte, dass sie zitterte. Sosehr sie sich auch bemühte, sie konnte es nicht abstellen. Seeräuber für dumm zu halten wäre ihr nicht eingefallen. Dafür hatte sie schon zu viel von ihnen gehört. Dass sie aber die Personen mit Namen zu nennen wussten, die auf einem Handelsschiff reisten, erstaunte sie doch. Woher nur konnten sie derartige Kenntnisse haben? Sie stand auf, straffte sich, strich fahrig über das noch immer nasse Kleid und blickte so stolz und ruhig, wie es ihr nur möglich war, zu der Tür, hinter der die Schritte immer lauter wurden.
»Nein, Sie können nicht …«, hörte sie den Kapitän ganz nah bei ihrer Kabine. Dann gab er ein ersticktes Gurgeln von sich und schwieg. Sie schluckte. Die Tür wurde geöffnet. Bilke konzentrierte sich auf den Schlag ihres Herzens, den sie wild, beinahe schmerzhaft in der Brust spürte und der, wie ihr scheinen wollte, den gleichen Takt hatte wie das Pochen in ihrem Knie. Ein Mann stand in der offenen Tür. Er war groß und trug eine Hose, die einige Risse aufwies, ein ebensolches Hemd und eine Lederweste darüber.
»Da ist sie also«, sagte er mit dieser Aussprache, die ihn auf der Stelle als Dänen entlarvte. Jedes S zischte, und die Worte wurden zwischen engen Kieferknochen zermahlen.
Bilke sah ihm in die Augen, die grau und kalt waren wie das Meer.
»Kommen Sie schon raus aus Ihrem Versteck, oder soll ich zu Ihnen hineinkommen?« Bilke konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, seine eigene Zunge sei ihm andauernd im Weg. Unter anderen Umständen hätte sie darüber gelacht. Doch in dieser Situation war ihr keineswegs nach Heiterkeit zumute. Ohne ein Wort trat sie auf ihn zu, bückte sich unter dem niedrigen Türrahmen hindurch und stand ganz dicht vor ihm. Er war fast einen Kopf größer als sie. Trotzdem blickte sie ihm auch jetzt fest in die Augen.
»Bilke von Ranteln, habe ich recht?«
Sie nickte.
»Können Sie nicht sprechen, Bilke von Ranteln?« Es klang nicht böse oder aggressiv, wie er fragte, eher abwartend, fast ein wenig verständnisvoll.
»Lassen Sie sie in Frieden, ich flehe Sie an.« Kapitän von Holstein machte einen Schritt nach vorn, wurde aber von einem Mann festgehalten, der lange schwarze Haare und eine unübersehbare Narbe quer über der Nase hatte. Bilke bemerkte, dass von Holstein an der rechten Schläfe blutete.
»Wir ergeben uns«, fuhr er unbeirrt fort. »Das habe ich Ihnen doch bereits zugesichert. Wir laden unsere Fracht auf Ihr Schiff um und ziehen dann unseres Weges. Fräulein von Ranteln kann wohl kaum von Nutzen für Sie sein, also lassen Sie sie mit uns nach Hause segeln.«
Der Piratenkapitän, dessen rotblondes, ungestüm gelocktes Haar sein kantiges Gesicht einrahmte, drehte sich langsam zu von Holstein um.
»Ihr ergebt euch?« Er machte eine Pause und begann dann dröhnend zu lachen. Seine Männer, die überall an Deck verteilt waren, stimmten ein.
Erst jetzt wagte Bilke, sich genauer umzusehen. Was sie sah, war grauenvoll. Die Segel der Kogge hingen in Fetzen, der Mast war so schwer getroffen worden, dass er in zwei Stücke geborsten war. Das Deck war von nassem Sand bedeckt, der an einigen Stellen durch das Kampfgetümmel zu einem Haufen zusammengeschoben, an anderen Stellen von Blut getränkt war. Einige Seeleute lagen reglos auf den Planken. Stoff war zerfetzt, die Haut, die darunter zum Vorschein kam, war es ebenfalls. Was wie Hagelkörner geklungen hatte, musste Schrot gewesen sein. Überall ragten Holzsplitter in die Luft, waren Löcher geschlagen, Seile und Taue in tausend Stücke gerissen. Auch einige der Toten waren auf die gefährliche Waffe zurückzuführen, die wegen ihrer Streuwirkung, durch die Menschen schwer verletzt wurden und Material zerstört wurde, gefürchtet war. Wer von der Mannschaft der Kogge noch auf seinen zwei Beinen stehen konnte, wurde von Piraten bewacht und hielt die Hände zum Zeichen der Unterwerfung über den Kopf. Welch ein Gegensatz, kam es Bilke in den Sinn: die lachenden Angreifer, die kaum Verluste zu beklagen hatten, und die Besiegten, die verängstigt und verzweifelt dreinblickten. Anscheinend hatte dieser Verbrecher, der ihr gegenüberstand, allen Grund, zu lachen. Viel Gegenwehr war von den lübschen Seeleuten nicht mehr zu erwarten. Sie hatten wohl kaum eine andere Wahl, als sich zu ergeben.
Ganz langsam drehte sich der Blonde nun wieder zu Bilke um. Obwohl seine Antwort im Grunde von Holstein galt, sah er sie an, während er sprach: »Irrtum, mein Bester, ich bin davon überzeugt, dass sie mir und meinen Männern noch von großem Nutzen sein kann.«
Zwar stand er mit dem Rücken zu seinen Leuten, doch er sprach laut genug, um gehört zu werden. Schmutziges Gelächter und Pfiffe waren die Antwort. Bilke musste wieder schlucken und hoffte inständig, dass er nicht sah, wie sehr sie erschauderte.
»Leider muss ich Sie auch enttäuschen, was Ihre Pläne für Ihre Heimreise betrifft. Wir werden umladen, was wir gebrauchen können. Danach machen wir mit diesem Kahn ein Feuerchen.« Nun drehte er sich zu von Holstein um und trat einen Schritt von Bilke weg. »Verstehen Sie mich nicht falsch, mein Bester, ich bin ein Ehrenmann. Ich werde Sie und Ihre Männer am Leben lassen, wenn Sie sich entschließen können, in Zukunft unter meinem Kommando auf meiner prächtigen Karacke zu fahren. Das Schiff kann ich Ihnen nicht lassen. Ich weiß, wie schnell Sie damit zurück in Lübeck wären. Und ich weiß auch, was Sie dort auf der Stelle tun würden.«
Kein Zweifel, dass der Mann recht hatte. Natürlich würde von Holstein, kaum dass die Übeltäter außer Sicht wären, seine Leute anhalten, notdürftig Segel, Taue und Mast in Ordnung zu bringen, und dann, ohne eine weitere Minute zu verlieren, gen Lübeck aufbrechen, um dafür zu sorgen, dass man den Piraten nachstellte. Noch immer sagte Bilke kein Wort. Was hätte es geholfen? Die Kogge, die den Namen Marie trug, würde brennen. Es gab nichts, was das verhindern konnte.
Der Blonde wendete sich ihr erneut zu: »Wie ich sagte, ich bin ein Mann mit Ehrgefühl und Moral. Ich weiß, was sich gegenüber einer Dame gehört.« Er neigte ein wenig den Kopf. Die Geste allein hätte womöglich Ehrerbietung ausdrücken können, doch sein Lächeln, voller Ironie und Verachtung, sprach eine andere Sprache. »Svendsson«, stellte er sich ihr vor. »Von nun an Ihr Kapitän. Gestatten Sie, dass ich Sie auf Ihr Schiff bringe?« Was wie eine Frage klang, war in Wahrheit ein Befehl. Er trat einen Schritt zur Seite und bedeutete ihr mit der ausgestreckten Hand, an ihm vorbeizugehen.
Sie hob den Saum ihres Kleides an, damit er nicht beschmutzt wurde, und stolzierte aufrecht und mit erhobenem Kopf an dem Piratenkapitän vorüber. Um keinen Preis würde sie die Fassung verlieren oder sich ungehörig benehmen. Nachdem sie die Stufen von dem Kastell auf das Deck hinabgestiegen war, fiel ihr etwas ein, und sie blieb unvermittelt stehen. Svendsson, der ihr die Stufen hinab gefolgt war, prallte gegen ihren Rücken.
»Vorwärts«, kommandierte er.
Bilke machte einen Schritt zur Seite, um ein wenig Abstand zwischen sich und den Mann zu bringen. Dann drehte sie sich um.
»Darf ich meine Fidel mitnehmen, bitte?«, fragte sie.
Svendsson zog die Augenbrauen hoch. Ihren Namen mochte er kennen, aber offenbar wusste er nicht viel über sie.
»Sie spielen die Fidel?«, fragte er zurück.
»Gewiss«, sagte sie in einem ganz natürlichen Ton, als würde sie sich jeden Tag mit einem Freibeuter unterhalten. »Mein Vater hat sie mir aus Spanien mitgebracht. Ich meine, ich verstehe mich recht gut auf den Umgang mit dem Instrument.«
»Ein bisschen Unterhaltung kann bestimmt nicht schaden«, entschied Svendsson nach kurzem Zögern. Sie nahm wahr, wie zwei Männer der gegnerischen Mannschaft miteinander tuschelten und lachten, doch sie gab sich alle Mühe, nicht auf sie zu achten.
»Beeilen Sie sich!«
Bilke ging wieder an ihm vorbei und die Stufen hinauf. Mochte ein Beobachter sie auch für die Ruhe in Person halten, so geschickt spielte sie ihre Rolle, sah es in ihrem Inneren doch ganz anders aus. Sie hätte nicht zu sagen vermocht, warum sie den Mann gerade um diese Gefälligkeit gebeten hatte. Sie wollte nicht als Gefangene auf dieses Räuberschiff gehen. Warum hatte sie nicht versucht zu verhandeln? Wohin würde ihr Stolz sie noch bringen? Sie wollte ihrem Vater keine Schande machen, wollte beweisen, dass sie die gesellschaftlichen Regeln kannte und sich danach zu benehmen wusste. Doch galten diese Regeln unter diesen Umständen überhaupt noch? Sie bezweifelte nicht, dass die Kerle, in deren Hände sie sich zu begeben im Begriff war, ihre eigenen Regeln hatten, von denen Bilke nicht den Hauch einer Ahnung besaß.
Während sie in ihrer kleinen Kabine nach dem Koffer griff, in dem das kostbare spanische Streichinstrument aufbewahrt war, suchten ihre Augen die Kammer nach einem Gegenstand ab, den sie dem Widerling über den Schädel ziehen oder den sie in sein Fleisch bohren konnte. Wenn der Kapitän außer Gefecht war, würden die anderen Seeräuber sich mit etwas Glück zurückziehen. Oder die lübsche Mannschaft würde die Gelegenheit nutzen, um einen letzten Versuch der Gegenwehr zu wagen.
»Also?« Svendsson wurde ungeduldig. »Wo ist nun die Fidel?«
»Ich habe sie«, rief Bilke zurück. Hier gab es nichts, womit sie hätte angreifen können. Fast war sie ein wenig erleichtert. denn ihr war klar, dass sie niemals den Mut dafür aufgebracht hätte. Sie zog den ledernen Koffer zwischen der großen hölzernen Truhe, in der sie ihre Kleider untergebracht hatte, und dem Bett hervor. Sie überlegte kurz, ob sie darum bitten sollte, auch ihre Kleider mitnehmen zu dürfen. Doch sie verwarf den Gedanken rasch wieder, denn sie konnte sich ausmalen, wie die Antwort lauten würde. Die Schmach wollte sie sich lieber ersparen und nahm im Geiste Abschied von Brokat und Seide, von Spitze und feinsten englischen Tuchen. Aus dem Augenwinkel entdeckte sie ihre Schmucknadel, ein Erbstück von ihrer Mutter. Die Kogge schwankte, neigte sich zur Seite. Bilke tat so, als ob sie sich kurz an dem Brettchen, das an der Wand befestigt war und als Ablage diente, festhalten musste, griff nach der Nadel und ließ sie in den Ärmel ihres Kleides verschwinden. Dann trat sie mit dem Instrumentenkoffer durch die Tür.
»Da ist sie«, sagte sie und schritt würdevoll erneut die Stufen hinab, die Fidel in der einen Hand, den üppigen Spitzenbesatz des Ärmels an der anderen Hand fest umklammert.
Die Männer schwiegen, als sie, dem Rollen des Schiffes trotzend, mit festen Schritten zu dem Teil der Bordwand ging, die mit dem gegnerischen Schiff durch Wurfanker und Taue verbunden war.
»Darf ich ihr helfen, Kapitän?«, wandte sich der Bootsmann, der Bilke noch vor nicht allzu langer Zeit aufgrund des Sturms in ihre Kabine verwiesen hatte, an Svendsson.
Der zog, überrascht von der förmlichen Anrede, die er sonst nur von seinen eigenen Leuten erwarten durfte, die Augenbrauen hoch.
»Darf ich annehmen, dass ich einen neuen Mann an Bord der Schwarzen Rose begrüßen darf?«
Der Bootsmann verbeugte sich. »Jawohl, Kapitän, wenn Sie erlauben.«
Svendsson nickte gefällig und machte eine Handbewegung, woraufhin der Bewacher des Bootsmannes sich entspannte, während der Bootsmann selbst zur Bordwand eilte, einen Eimer und eine Kiste heranschleppte, die er zu einem treppenähnlichen Gebilde zusammensetzte. Als er damit fertig war und die Stabilität seiner Konstruktion geprüft hatte, reichte er Bilke die Hand.
»Hinrichs, Sie elender Verräter!«, rief von Holstein in diesem Moment. Sein ohnehin stets rot geädertes Gesicht schien zu glühen, die Wangen leuchteten dunkelrot. Er spuckte voller Abscheu vor seinem abtrünnigen Bootsmann aus.
Der warf ihm einen Blick zu, aus dem für Bilke nicht erkennbar war, was in ihm vorging. Als Hinrichs sie ansah und ihre Hand nahm, um ihr auf die Kiste zu helfen, war sie jedoch froh, dass er sie nicht auf dem Piratenschiff allein lassen würde.
»Nun?«, fragte Svendsson gedehnt. »Wer schließt sich an? Auf meinem Schiff ist noch Platz für tüchtige Seeleute.«
Bilke drehte sich noch einmal um und sah, wie er die Reihen der Lübecker abschritt, vor jeden hintrat und in das verängstigte Gesicht schaute. »Ich werde niemanden zwingen«, sprach er weiter. »Es ist eure freie Entscheidung. Wer es vorzieht, darf hier zurückbleiben.«
»Um zu verbrennen und mit der Marie unterzugehen«, rief von Holstein aufgebracht.
Svendsson ging langsam auf ihn zu. Bilke hielt die Luft an. Sie presste den Lederkoffer fest an sich und hielt sich mit der anderen Hand, die Schmucknadel kalt an ihrem Unterarm, an der Bordwand fest. Svendsson bewegte sich an Bord, als läge die Marie ruhig und fest vertäut im Hafen. Dabei wand sie sich noch immer wie ein Tier, zerrte an den Leinen und rieb sich kratzend an der Außenhaut der Schwarzen Rose, mit der sie anscheinend nicht länger verbunden sein mochte.
»Ich denke doch, Sie und Ihre Männer können schwimmen?« Wieder diese Ironie. Der Kerl war sich seiner Sache sehr sicher. Seine Leute lachten.
Ihr böses Gelächter nahm Bilke alle Hoffnung. Auch wenn sie sich nur schwer vorstellen konnte, dass jemand in den hohen Wellen und dem kalten Wasser der Ostsee weit kam, so erschien es ihr doch möglich, das rettende Ufer zu erreichen. Die Küste war stets zu sehen, damit sich die Seeleute orientieren konnten und nicht vom Kurs abkamen. Sie hätte sich so sehr gewünscht, dass wenigstens einige der braven Matrosen ihr Leben retten konnten. Doch es wurde immer schwerer für sie, daran zu glauben.
Schon nickte der eine oder andere und gesellte sich zu Hinrichs.
»Tut das nicht!«, forderte von Holstein sie lautstark auf. »Das Seerecht verlangt, dass ihr eurer Schiff bis zum letzten Atemzug verteidigt. Das wisst ihr. Wer glaubt, sein jämmerliches Leben retten zu können, irrt.« Er holte tief Luft. »Der wird nicht einen Deut besser behandelt als ein gewöhnlicher Pirat. Auf ihn wartet der Tod.«
»Er spricht die Wahrheit«, bestätigte Svendsson den Kapitän. »Unsere Köpfe werden alle rollen.« Er machte eine Pause und sah in die Runde. »Nur müssen sie uns dafür erst mal kriegen!« Seine Stimme war angeschwollen wie der Sturm. Wieder dieses dröhnende Lachen.
»Gehen Sie, schnell!«, murmelte Hinrichs und half Bilke, den Schritt über die Bordwand zu machen.
An Deck des fremden Dreimasters nahm sie ein alter Mann in Empfang. Er hatte, wohl des Kämpfens müde, mit einer Handvoll anderer an Bord die Stellung gehalten. Seine Wangen waren eingefallen, seine Haut ledrig gelblich. Das weiße Haar war schütter und ließ die Kopfhaut hier und da durchblitzen. Das Kinn zierte ein silbriges Bärtchen, das Bilke an einen Ziegenbock erinnerte, den sie einmal vor den Toren Lübecks gesehen hatte. Die grauen Augen waren glanzlos, sein Griff war leicht. Selbst durch den Stoff von Bilkes Ärmel fühlte sich seine Hand, die schwach in ihrer Ellenbeuge lag, kalt an. Es wäre ein Leichtes, diesem vermeintlichen Bewacher zu entfliehen. Allerdings gab es keinen Ort, wo sie sich in Sicherheit bringen konnte. Einen Moment dachte sie darüber nach, einfach loszulaufen und sich über die Reling in die Wogen der Ostsee zu stürzen. Zwar hatte der April schon ein oder zwei milde Tage gebracht, doch das Meer war noch bitterkalt. Und Bilke konnte nicht schwimmen. Lange würde es nicht dauern, bis der Tod sie holte. Das wäre gewiss besser, als allein als einzige Frau unter diesen schrecklichen Gesetzlosen auf einem Schiff auszuharren. Wenn sie sich auch nicht ausmalen mochte, was diese Ungeheuer mit ihr anstellen würden, so ahnte sie es doch. Sie dachte an ihre Familie zu Hause in Lübeck, und sie dachte an Hartwych van Broke, dem sie womöglich niemals begegnen würde. Tränen traten in ihre Augen, doch sie blinzelte sie weg. Man konnte sie dem Wind zuschreiben, der ganz allmählich abzuflauen schien. Ohne den Kopf auch nur ein einziges Mal zu senken, stand sie frierend da und sah zu, wie ein Teil der Ladung von einem Schiff auf das andere gebracht wurde. Sie hatten weder Tuche noch Brokatstoffe, weder Samt noch Seide mit sich geführt, und auch keine Goldmünzen oder kostbare Messingwaren aus Dinant. In erster Linie waren es Viktualien, die sie im Bauch der Marie transportierten. Nicht, dass diese nicht kostbar wären, doch es stand zu befürchten, dass die Piraten sich mehr erhofft hatten. Emsig schleppten die Männer die Säcke und Fässer, die von den Lübecker Gefangenen aus den Frachträumen geholt und an Deck geschafft wurden, herüber auf ihr eigenes Schiff und verstauten sie dort in Windeseile. Es war leicht, zu erkennen, dass die Mannschaft dies nicht zum ersten Mal machte. Entern, die Ladung übernehmen und rasch mit der Beute verschwinden, das war ihr Leben und zugleich ihre Lebensversicherung.
Bilke beobachtete eine Auseinandersetzung zwischen Svendsson und von Holstein. Sie endete damit, dass Svendsson zwei seiner Männer in den Bauch der Kogge hinabschickte. Diese erschienen wenig später wieder, machten ihrem Kapitän Meldung, woraufhin man begann, eine Vorrichtung an dem zerbrochenen Mast zu befestigen, mit der schließlich eine Kiste aus dem Rumpf gezogen wurde, die groß genug war, um gut und gerne drei, wenn nicht gar vier erwachsene Menschen darin verbergen zu können. Sie fragte sich, welcher Art die Waren sein mochten, die in einer solchen Kiste lagerten. Als Bilke in Lübeck an Bord des Schiffes gegangen war, war das Laden bereits beendet gewesen. Zwar wusste sie, welche Handelsgüter ihr Vater nach Riga lieferte, jedenfalls glaubte sie bis zu diesem Moment, es zu wissen, doch dieses augenscheinlich schwere Holzbehältnis gab ihr Rätsel auf. So wie Svendsson ihren Namen gekannt hatte, wusste er offenbar auch von dieser geheimnisvollen Fracht. Die Piraten sprangen behende von einem Schiff zum anderen, holten Rundhölzer hervor, auf denen sie die gewichtige Beute voranrollen konnten. Bilke konnte sich nicht dagegen wehren, fasziniert zu sein von der Geschicklichkeit, mit der sie die gewaltige Kiste auf ihr Schiff luden.
Dann war es so weit. Svendsson und seine Männer sowie eine Handvoll Matrosen der Lübecker Mannschaft standen auf dem Dreimaster und sahen zu, wie Svendsson einen Pfeil entzündete, seinen Bogen anlegte und auf das Kastell am Heck der Kogge zielte. Der brennende Pfeil flog in großem Bogen zischend durch die Luft. Er blieb in dem hölzernen Aufbau, in dem Bilke die letzten Tage verbracht hatte, stecken und entzündete augenblicklich ein Feuer. Weitere lodernde Pfeile folgten. Von Holstein stand mit steinernem Gesichtsausdruck vor dem Rest seiner Besatzung. An immer mehr Stellen fing die alte Marie Feuer. Die Männer rissen die Augen in wachsender Panik auf. Schon schrie der erste auf, rannte zur Reling und stürzte sich in die See.
Bilke hielt es nicht länger aus. »Sie sind ein Ungeheuer!«, schrie sie Svendsson an. Der reagierte nicht auf sie, sondern vollendete ungerührt sein Werk.
»Nicht, Fräulein von Ranteln«, mahnte Hinrichs, der nicht weit von ihr stand, leise. »Wenn Sie so ruhig bleiben wie bisher, geschieht Ihnen mit ein bisschen Glück nicht viel. Vergessen Sie nicht, als lebende Geisel haben Sie einigen Wert.«
Sie bebte am ganzen Leib und hatte große Mühe, ein Schluchzen zu unterdrücken. Hinrichs Worte trugen nicht viel dazu bei, sie zu trösten, doch sie brachten sie immerhin so weit wieder zur Vernunft, dass sie es nicht auf einen Streit mit diesem Svendsson ankommen ließ. Sie atmete schwer und schloss die Augen, in der Hoffnung, dieser Alptraum möge bald vorüber sein. Noch eine geraume Weile hörte sie die Schreie der Männer, das Klatschen, wenn sie sich in ihr nasses Grab stürzten. Noch lange sah sie von Holstein vor sich, wie er auf den Planken seines Schiffes stand, während um ihn die Flammenhölle immer heller loderte, lauter knisterte und krachte und den Himmel über der Ostsee für eine kurze Zeit zum Leuchten brachte.
Hartwych
Dunkle Wolken zogen über Riga auf, als Hartwych van Broke, die Kapuze seines Pelzmantels tief ins Gesicht gezogen, die Stadt verließ und dem ausgetretenen Pfad zu dem kleinen Holzhaus inmitten von Feldern und Wiesen folgte. Er warf einen Blick zum Himmel. Nicht mehr lange, dann würde es zu regnen beginnen. Innerhalb kürzester Zeit konnten sich die Straßen Rigas in unpassierbare Bäche verwandeln. Von den Sümpfen außerhalb der Stadtmauer gar nicht zu reden. Er würde sich sputen müssen. Die düstere Stimmung, die das umschlagende Wetter erzeugte, spiegelte sich in Hartwychs Seele wider. Erneut blickte er hinauf zum Himmel, der so groß und endlos schien. Welch eine Verheißung von Weite und Freiheit, schoss es ihm durch den Kopf, die in seinem Leben niemals erfüllt werden würde. Er war nicht frei, sondern Sklave seines Vaters, seines Standes und der Konventionen, die ihn und Ria trennten. Hartwych beschleunigte seinen Schritt. Womöglich würde es ein Gewitter geben. Dann sollte er nicht mehr hier draußen sein. Als es nur noch wenige Fuß bis zu der Hütte waren, hielt er einen Moment inne. Er konnte Rias helle klare Stimme hören. Sie sang ein fröhliches Lied, das vom nahenden Frühling und von der Sonnengöttin Saule erzählte. Hartwych lächelte. Wie passend! Wenn er Rias Stimme hörte oder in ihre Augen blickte, dann war ihm stets, als würde die Sonne aufgehen. Er liebte ihr unbekümmertes Wesen, ihr Lachen und ihre Natürlichkeit, die selbst einen finsteren Tag wie diesen erhellen konnten. Das Lächeln verging ihm bei dem Gedanken, weshalb er sie aufsuchte. Er seufzte schwer und setzte seinen Weg fort.
Er klopfte an die niedrige Holztür. Rias Stimme erstarb mitten in dem Lied.
»Wer ist dort?«, fragte sie.
»Hartwych!«
Im nächsten Augenblick wurde die Tür aus dunklem Holz geöffnet, die an der unteren Kante bereits zu vermodern begann und dringend ausgebessert werden musste, und sofort wieder geschlossen, nachdem er in die Kate geschlüpft war. Die beiden Hühner, seit dem Tod von Rias Vater ihre einzigen Gefährten hier draußen, stoben auseinander, jedes in eine Ecke der Hütte.
»Hartwych!« Ihr Gesicht, von kastanienfarbenem, zu einem Zopf geflochtenen Haar eingerahmt, leuchtete. »Ich dachte nicht, dass du noch einmal kommst vor deiner Reise«, sagte sie, wischte die schmalen Hände an der Schürze ab, die sie über ihrem einfachen Kleid aus schlichtem Kattun trug. »Wie schön!« Sie kam auf ihn zu und bot ihm die Wange dar.
Hartwych fürchtete sich davor, ihr die Heiterkeit zu nehmen, aber eben das würde er tun müssen. Er küsste sie zart und nahm ihren Geruch wahr, der ihm längst vertraut geworden war. Er wusste nicht, wie er ihr die schlechten Nachrichten beibringen sollte.
»Ich habe mich für eine kurze Weile davongestohlen«, antwortete er, ließ den Mantel von den Schultern gleiten, hängte ihn an einen Haken, ging hinüber zu dem einfachen Tisch und setzte sich auf einen der beiden Schemel, der beängstigend wackelte. Hartwych rückte ihn an die Wand, um sich anlehnen zu können. Das Huhn, das nahe bei dem Hocker gestanden hatte, lief flügelschlagend an dem Besucher vorbei, unter dem Tisch hindurch und mit leisem Gegacker zu seinem Artgenossen.
»Ich muss ihn beizeiten richten«, sagte Ria wie jedes Mal, wenn Hartwych auf dem kleinen Schemel Platz nahm, und blickte auf die verzogenen Holzbeine.
»Die Tür muss auch erneuert werden«, sagte er, froh, über Dinge sprechen zu können, die er in Ordnung zu bringen imstande war.
»Ja, ich weiß. Ach, jetzt kommt der Sommer. Den hält sie noch gut aus. Bist du durstig? Soll ich dir einen Krug Bier einschenken?«
»Nein, Ria, ich kann mein Bier im Neuen Haus trinken. Du kommst doch kaum mit dem zurecht, was du hast. Da sollst du das Wenige nicht auch noch mit mir teilen.« Wie oft hatte er ihr das schon gesagt?
»Aber ich teile gern mit dir, Hartwych.«
Und wie oft hatte er diese Antwort schon von ihr gehört.
Er stand wieder auf. »Ich muss ohnehin noch in das Neue Haus. Es gibt so vieles zu besprechen, bevor ich aufbreche. Wegen der Stiftung der Tafelgilde, weißt du?«
»Gewiss. Es ist schön, dass du dich um derlei Dinge kümmerst. Immer mehr Menschen drängen in die Stadt. Nicht alle von ihnen werden ihr Auskommen finden. Sie brauchen jemanden, der ihnen zu essen und eine warme Decke für den Winter gibt.« Ria war ein gutes Stück kleiner als er. Ihr Scheitel reichte ihm eben bis zum Kinn. Wie ein Kind stand sie vor ihm und sah zu ihm auf. »Du bist ein guter Mensch, Hartwych.«
Ihm war elend. Nein, wie ein guter Mensch fühlte er sich ganz und gar nicht. Was er ihr zu sagen hatte, war alles andere als gut für sie, für sie beide.
»Du bist sehr ernst. Was hast du auf dem Herzen?«
Ihre braunen Augen blickten ihn so sanft an, dass es ihm noch schwerer wurde. Doch da nützte kein Zögern, er war gekommen, um ihr die Wahrheit zu sagen, und je länger er damit wartete, desto mehr würde es ihn plagen.
»Ich habe dir etwas zu sagen«, begann er. Seine Stimme wollte ihm nicht recht gehorchen und war eigenartig rauh. Das ärgerte ihn. Er wollte nicht zu deutlich seine Empfindungen preisgeben. »Ich konnte einfach nicht fahren, ohne mit dir gesprochen zu haben. Setzen wir uns hin.« Er nahm wieder auf dem wackeligen Schemel Platz. Sie setzte sich gehorsam auf den zweiten Hocker, den sie dicht zu ihm herangezogen hatte. In dem aus Lehm gefügten Ofen loderte schwach die Glut. Ria würde sie neu entfachen müssen, bevor die Nacht hereinbrach. Schon war es kalt und feucht in der Hütte. Die Hühner pickten in dem wenigen Stroh, das in einem Winkel ausgestreut war. Sie bewegten sich mit dem ihnen eigenen Rucken des Kopfes und scharrten leise auf dem Lehmboden. Neben dem kleinen Strohnest standen Behältnisse aus Holz und Ton auf dem Boden, ein Rechen lehnte an der Wand, und zwei geflochtene Siebe hingen neben seinem Stiel.
»Im nächsten Monat erwarten mein Vater und ich eine Lieferung Heringe aus Lübeck«, setzte Hartwych an. »Die Ware stammt von von Ranteln, einem Kaufmann, mit dem wir schon seit langem Handel treiben, ein verlässlicher und geachteter Mann.« Er hatte die Fingerspitzen aneinandergelegt und betrachtete sie konzentriert.
Sie nahm seine großen kräftigen Hände in ihre kleinen, deren Haut spröde und von der Arbeit auf dem Feld mit Schwielen gezeichnet war. »Warum erzählst du mir das? Du sprichst doch sonst nicht von deinen Geschäften.«
»Von Ranteln hat eine Tochter.« Er spürte, wie sie sich versteifte. »Mein Vater will mich mit ihr verheiraten«, sprach er weiter, ohne ihr in die Augen sehen zu können. »Ich hätte es dir längst sagen müssen, ich weiß. Du hast guten Grund, verärgert zu sein. Aber bisher glaubte ich noch, es wäre nur ein Gedanke meines Vaters und kein fester Plan.«
»Und jetzt?«
»Er hat mir heute mitgeteilt, dass Bilke von Ranteln auf dem Schiff ist, das den Fisch bringt. Es wird womöglich einen weiteren Hafen anlaufen oder vielleicht auch zwei. Aber in fünf oder sechs Wochen wird sie in Riga eintreffen.«
Für einen kurzen Moment herrschte Stille in der Kate. Nur ein Holzscheit knackte in der Glut, und die Hühner machten kratzende Geräusche. Hartwych hob den Blick und sah Ria in das Gesicht. Es zerriss ihm beinahe das Herz. Noch nie zuvor hatte er sie so traurig gesehen. Er allein war schuld daran, dass das sonnenhelle Strahlen erloschen war.
Ria bemühte sich um ein Lächeln. »Na, da wird dir hoffentlich ein hübsches Fischchen an die Angel gehen«, versuchte sie zu scherzen.
Er stand unvermittelt auf. Stünde der Schemel nicht so weit an der Wand, wäre er vermutlich umgekippt. Sie zuckte leicht zurück.
»Ich will diese Frau nicht heiraten, das weißt du. Ich will überhaupt keine andere heiraten, sondern dich. Aber das ist unmöglich.«
»Gewiss«, sagte sie leise.
Er wünschte, sie würde ihm Vorwürfe machen, würde schreien und zetern, ihm die Hölle heißmachen. Doch sie war ruhig und ertrug die Neuigkeit in stillem Schmerz. Das machte die Lage noch unerträglicher für ihn.
»Was soll ich tun?«, fragte er sie, ohne eine Antwort zu erwarten. »Sag mir, was ich tun soll!« Er legte einige dünne Zweige in das Feuer, so dass die Flammen sogleich größer und heller wurden. Dann legte er ein Scheit zwischen die Ästchen.
»Du musst sie heiraten«, entgegnete Ria hinter seinem Rücken. »Wir haben immer gewusst, dass so etwas früher oder später geschehen würde, Hartwych. Seien wir dankbar für die Zeit, die wir miteinander hatten.«
Er schoss in die Höhe und fuhr zu ihr herum. »Was sagst du da?« Ein Schritt und er war bei ihr, griff ihre Handgelenke und zog sie von dem Schemel hoch. Er konnte in ihren Augen sehen, dass er ihr weh tat, dass seine Hände ihre zarten Gelenke zu fest hielten, aber er konnte nicht anders. »Dann soll alles vorbei sein, was zwischen uns ist? Fünf Wochen noch, vielleicht sechs, dann ist alles Vergangenheit? Kannst du das?« Leiser fügte er hinzu: »Und in ebendiesen Wochen werde ich auch noch verreist sein und dich nicht sehen können.« Als er sah, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten, ließ er sie los. »Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verletzen.«
Sie standen einander gegenüber, mit hängenden Schultern und gesenkten Köpfen wie zwei Kinder, die soeben von der Mutter beim Stibitzen von Süßigkeiten erwischt worden waren.
»Wenn du dich wenigstens entschließen könntest, in die Stadt zu ziehen«, sprach Hartwych das Thema an, über das sie schon viele Male geredet hatten. »Dann wäre alles viel einfacher.«
»Und was hätten wir damit gewonnen? Ich hätte kein Auskommen mehr und wäre auf die Almosen deiner Tafelgilde angewiesen. Ich sehe nicht, was dadurch einfacher wird.«
»Du hast eine wunderschöne Stimme. Du kannst bei Festen zur Unterhaltung singen und dich dafür entlohnen lassen. Vielleicht kannst du erlernen, die Zither oder Drehleier zu spielen. Dann würde man dich sicher recht häufig einladen, ein Gelage zu begleiten. Die Compagnie der Schwarzen Häupter lässt sich ihre Trünke hübsche Sümmchen kosten. Und denk nur an das große Fastnachtsfest!« Er sah ihr an, dass er sie nicht zu überzeugen vermochte. »Ich könnte viel besser für dich sorgen und auf dich achtgeben, wenn du in meiner Nähe wärst. Das wäre einfacher.«
»Alle gehen in die Stadt, ich weiß. Alle suchen dort ihr Glück. Doch auf meinesgleichen wartet dort kein Glück. Es ist mir nicht einmal gestattet, als Bürgerin in Riga zu leben. Was auch immer ich anstelle, ich bleibe nur eine einfache Einwohnerin. Nein, Hartwych, mein Glück ist hier draußen, mag es auch klein sein.«
»Die Feldarbeit ist zu schwer für dich. Allein kannst du dein Land nicht bestellen.« Sie machte große Augen. »Schon gut, du kannst das, ich weiß. Nur wie lange wirst du das durchstehen? Eine Frau allein, das geht nicht.« Sie senkte den Kopf, und er küsste sie auf das glänzende Haar. Obwohl sie von Kindesbeinen an die Arbeit auf dem Feld gewohnt war, obwohl sie es nicht anders kannte, als von früh bis spät Getreide zu sieben, Kleider zu nähen, Bier anzusetzen oder Teig für Brote zu kneten, war sie doch zart und zerbrechlich geblieben. Die schwere körperliche Arbeit hatte ihr Vater erledigt. Seit seinem Tod war Ria auf sich allein gestellt. Sie würde nicht genug Rüben oder Kohl ernten, um von dem, was sie dafür in der Stadt bekam, leben zu können. Sie konnte sich vielleicht selbst durchbringen, aber zum Geldverdienen würde es nicht reichen. Und wenigstens ein bisschen Geld brauchte man heutzutage auch auf dem Lande. Die wenigen freien Bauern, die es gab, hatten es schon schwer genug. Eine Frau hatte es doppelt schwer. Ein jeder würde versuchen, sie übers Ohr zu hauen.
»Versprich mir, dass du es dir überlegen wirst.« Sie setzte zu einer Erwiderung an, doch er ließ sie nicht zu Wort kommen. »Die Situation hat sich geändert, Ria. Ich werde nicht mehr zu dir kommen können, wenn Bilke von Ranteln mein Eheweib ist. Wenn du aber eine Kammer in der Stadt hast, dann wird es eher möglich sein, dass wir uns wiedersehen.«
»Und wenn ich nicht will? Ich meine, wenn ich dich gar nicht wiedersehen will, Hartwych van Broke? Du wirst ein verheirateter Mann sein, und Gott der Herr duldet keinen Ehebruch. Was sollen das also für Wiedersehen sein? Wirst du höflich den Hut lüpfen und mir einen schönen Tag wünschen? Das könnte ich nicht ertragen. Dann schon besser hier draußen leben, wie ich es mein Lebtag kenne. Mit der Zeit werde ich dich vergessen und du mich. Und das ist auch recht so.«
»Ich werde dich niemals vergessen, Ria. Aber wenn du es so siehst, wenn du mich aus deinen Gedanken reißen kannst wie das Unkraut aus dem Boden, dann will ich dir nicht länger zur Last fallen.« Er riss seinen Mantel von dem Haken, der diesem Temperament nicht gewachsen war und zu Boden fiel.
»Versteh mich doch«, bat sie mit dünner Stimme. »Mir bleibt gar keine Wahl, als dich aus meinen Gedanken zu reißen, wie du es ausdrückst, wenn ich eine ehrbare Frau bleiben will. In meinem Herzen wirst du immer sein. Doch ich weiß, dass es mit der Zeit leichter wird, ohne einander auszukommen. Es war nach dem Tod meiner Mutter so.« Ihre Stimme wurde noch leiser. »Damals war ich ein kleines Mädchen und glaubte, ich könne nie wieder fröhlich sein, weil ich meine geliebte Mutter so schmerzlich vermisste. Aber an jedem Tag verblasste ihr Gesicht, das ich erst noch so deutlich vor Augen hatte, mehr. Ich habe sie nicht aus meinen Gedanken gerissen, Hartwych, sie hat sich ganz behutsam weggestohlen.« Sie sah ihn erwartungsvoll an, aber ihm fiel nichts ein, was er antworten könnte. Also sprach sie weiter: »Und jetzt ist es wieder so. Es ist noch nicht lange her, dass mein Vater diese Welt hinter sich gelassen hat, und doch kann ich schon wieder lachen und fröhlich sein. So wird es uns auch ergehen, wenn wir uns nicht mehr sehen.«
»Wie du meinst«, gab er ihr knapp zur Antwort und warf sich den schweren Pelzmantel über. »Nur weiß ich, dass du nicht gestorben bist, dass du in einer schäbigen Kate vor der Stadt lebst, wo ich dich sehen könnte, wenn ich nur wollte. Das wird mir zusetzen wie ein Dorn, den ich nicht aus meinem Fleisch ziehen kann.« Sie wollte etwas erwidern, doch er sprach hastig weiter. »Umso besser, wenn es dir anders ergeht, wenn du dich leichten Herzens abfinden kannst.« Hartwych wusste, dass er ungerecht war, dass er unrecht handelte, aber sie hatte ihm immerhin diesen einen winzigen Anlass gegeben, wütend auf sie zu sein, diese eine Chance, nicht allein als der Böse dazustehen, und er nutzte sie nur zu gern.
Grußlos verließ er die Hütte und schlug die Tür hinter sich zu. Die Kapuze über dem blonden Schopf schützte ihn vor dem feinen Nieselregen, der eingesetzt hatte und das kommende Unwetter ankündigte. Er blickte nicht nach links oder nach rechts, sondern starrte auf den sandigen Boden, der bereits aufzuweichen begann. In seinem Kopf und seinem Herzen herrschte Aufruhr. Wieder und wieder überlegte er, ob es noch einen Ausweg für ihn gab, ob er es bewerkstelligen konnte, seine Zukunft doch noch mit Ria statt mit dieser vermutlich schrecklich verwöhnten Lübecker Kaufmannstochter zu verbringen. Doch wie er es auch drehte und wendete, sein Schicksal schien beschlossene Sache zu sein. Er schritt durch das Stadttor und die Kalkstrate entlang. Die Dampfwolken, die über die Straße zogen, verrieten, dass die Kalkbrenner gerade mit dem Löschen beschäftigt waren. Hartwych lief weiter, an der Münze vorbei geradewegs auf den Marktplatz mit seinem stolzen Rathaus und dem Neuen Haus der Großen Gilde, in dem sich Kaufleute und Bürger nach vollendetem Tagwerk auf einen Krug Bier oder Wein trafen oder sich mit wandernden Gesellen austauschten.
»Was machen Sie für ein Gesicht, van Broke?«, begrüßte ihn sogleich Ratsherr Durkop, ein klein gewachsener Mann mit blitzenden Augen, grauem Haar, das ihm vom Kopf abstand wie die Stacheln eines Igels, und einem runden Wanst, den er vor sich herschob. »Ist Ihnen etwas über die Leber gelaufen?«
»Nein, bestimmt nicht, werter Durkop. Es ist nur das scheußliche Wetter. Ich befürchte, morgen wird Riga wieder in Schlamm und Wasser versinken. Da fällt es mir schwer, eine fröhliche Miene aufzusetzen.«
Durkop winkte ab. »Ach was, wenn’s draußen gar zu fürchterlich wird, machen wir es uns eben drinnen bequem. Sie und ich haben ein sicheres Dach über dem Kopf. An uns ist es gewiss nicht, zu jammern wie alte Waschweiber.«
»Da haben Sie recht. Das steht wohl eher den vielen armen Seelen zu, die in die Stadt drängen und doch nicht ihr Auskommen finden. Für sie gründen wir die Tafelgilde«, erklärte er. Er sah Ria vor sich. Hatte er eben nicht gerade ihre Worte benutzt? »Die letzten Einzelheiten festzulegen, bin ich hier«, sprach er weiter, um den Gedanken an sie zu verdrängen. Er griff in die Innentasche seines Mantels und zog ein Stück Papier hervor. »Wollen Sie sich meinen Entwurf für die Regeln und Bestimmungen bei einem Wein anschauen?«
»Mit Vergnügen, lieber van Broke, mit Vergnügen. Ich glaubte schon, heute will mir niemand mehr Gesellschaft leisten. Sie ahnen nicht, wie recht Sie mir kommen.« Der Ratsherr legte dem hochgewachsenen Hartwych die prallen Finger, die wie kleine Würste aussahen, auf den Arm und schob ihn in den Schanksaal, aus dem schon von weitem ein an- und abschwellendes Stimmengewirr und das Klirren von Krügen zu vernehmen war. »Hörten Sie jemals von dem Bildhauer Johannes Junge?«, plauderte er munter drauflos. »Sie haben doch beste Kontakte nach Lübeck, und der Herr ist ein Künstler der Hansestadt.«
»Nein, der Name sagt mir nichts. Was ist mit ihm?«
»Er soll den Sarkophag für Margarethe gefertigt haben. Denken Sie nur, endlich bekommt sie ein Grab, das einer Königin würdig ist. Da werden sie sich freuen, die Dänen.«
Hartwych war es herzlich gleichgültig, ob die einstige Regentin Dänemarks in einem prachtvollen Sarkophag oder in einer einfachen Holzkiste ihre letzte Ruhe fände. Was scherten ihn die Sorgen einer Toten? Die Lebenden hatten ganz anderes auf dem Herzen. Dennoch war er über jede Ablenkung froh. In ihre Unterhaltung vertieft, mischten sich die Männer unter die Gäste der Schankstube.
Als Hartwych das zweistöckige Giebelhaus verließ, prasselte der Regen kraftvoll hernieder, als wolle er die gesamte Stadt mit allem, was darin war und lebte, ersäufen. Den Kopf gesenkt, die Kapuze weit in das Gesicht gezogen, lief Hartwych mit großen Schritten bis in die Resenstrate am Ellerbrok, wo sein Elternhaus mit dem Kontor stand.
»Dieser verfluchte Dreck«, schimpfte er vor sich hin, während seine ledernen Stiefel mit jedem Schritt tiefer in Unrat und Schlamm versanken. Nur der Rathausplatz verfügte über Kopfsteinpflaster, auf dem es ein komfortables Gehen war. Die übrigen Straßen der Stadt waren mit Holz belegt oder, schlimmer noch, einfache Sandwege, kaum besser als jene vor den Stadttoren. Er musste sich etwas einfallen lassen, wie eine Pflasterung aller Wege zu finanzieren sei, ging es ihm nicht zum ersten Mal durch den Kopf. Doch er wusste wohl, dass eine baldige Verbesserung der Zustände ein frommer Wunsch war. Es war noch nicht lange her, da man haushohe Erdwälle um die Stadt errichtet hatte. In erster Linie sollten sie angreifenden Armeen das Eindringen unmöglich machen, gleichzeitig aber auch die Menschen vor Hochwasser schützen. Der Regen ließ sich von den Wällen freilich nicht beeindrucken. Und in manchen Jahren, wenn gar zu viel Treibeis auf dem Fluss taute, waren die Wassermassen einfach über die Wälle geflutet. Kostspielig war die Errichtung der künstlichen Erhebungen dennoch gewesen. Für ein weiteres aufwändiges Vorhaben war auf absehbare Zeit kein Geld mehr vorhanden.
Die Magd Hedda, ein klein gewachsenes Geschöpf, dünn und blass, machte einen Knicks, als Hartwych das Haus mit der weiß getünchten Sandsteinfassade und den vorspringenden Obergeschossen betrat. Er grüßte sie flüchtig und gab ihr seinen nassen Mantel. War er durch das Gespräch mit Ratsherr Durkop auf das Angenehmste abgelenkt gewesen, fiel ihm bei dem Anblick des Mädchens sogleich wieder Ria ein, und er spürte einen dumpfen Druck in den Eingeweiden. Vielleicht konnte er sie als Magd in sein Haus holen, wenn er erst verheiratet war, überlegte er, während er die Stufen bis in die Wohnetage im zweiten Stock hinaufstieg. In seiner Kammer schlüpfte er in bequeme lederne Pantoffeln, kostbare Exemplare, die sich längst nicht jeder leisten konnte. Doch Hartwych zog sie den weit verbreiteten Holzschuhen vor. Ria war die Tochter eines tüchtigen Bauern, die sich gewiss im Haushalt nützlich machen konnte. Sie hätte ihr Auskommen und wäre stets in seiner Nähe. Ein trefflicher Einfall, doch der Druck in den Eingeweiden wurde nur noch schlimmer. Er könnte es nicht ertragen, Ria um sich zu haben, sie aber nicht berühren zu dürfen. Sie war ein frommes Geschöpf, er durfte sie nicht in Versuchung führen, sie nicht in eine Lage bringen, die ihr Gewissen nicht auszuhalten vermochte. Mit einem Mal verstand er sie und wusste, dass sie recht hatte. Er würde noch einmal zu ihr gehen, um mit Anstand zu beenden, was immer respektvoll und gut gewesen war. Es wurde ihm immer schwerer ums Herz, wenn er daran dachte, dass er sie im Bösen und ohne Gruß zurückgelassen hatte. Wenn nur der Regen bald aufhörte, sonst würde er ihre Hütte am nächsten Tag kaum mehr erreichen, ohne bis zu den Knien durch Schlamm zu waten.
Hartwych betrat die Stube, die im Gegensatz zu den Schlafkammern keine steinernen Wände hatte, sondern vollständig aus Holz gezimmert war. Selbst die Raumdecke war aus dunklen Holzbalken gemacht. In einer Ecke stand der gemauerte weiße Hinterladerofen, der die Form einer ovalen liegenden Tonne hatte und von einem kleinen Nebenraum aus befeuert wurde. Von einer Verkleidung aus glasierten Kacheln, wie sie unter den wohlhabenden Kaufleuten gerade in Mode kam, hielten weder Hartwych noch sein Vater etwas.
Hans van Broke saß, wie Hartwych erwartet hatte, über Papiere gebeugt an dem Eichentisch, der dem Ofen gegenüberstand. Er hatte nur die Talgkerze auf dem Tisch entzündet, die Kerzen in dem Hängeleuchter nicht.
»Guten Abend, Vater, ich bin es, Hartwych. Dies nur für den Fall, dass du mich bei der Dunkelheit nicht erkennst.« Schon während er sprach, machte er kopfschüttelnd kehrt, um aus dem Nebenraum einen mit Werg umwickelten Span zu holen, mit dem er auch die Talgkerzen im Leuchter entzünden konnte. So wie ihm die Verschwendung der reichen Kaufleute Rigas oder – noch schlimmer – des Erzbischofs zuwider war, so sehr ärgerte er sich über die übertriebene Sparsamkeit seines Vaters. Eines Tages würde sie ihn noch Kopf und Kragen kosten, weil er in der Dunkelheit stolperte oder im eigenen Hause erfror.
Ohne auf die Spitze seines Sohnes einzugehen, die einen Vorwurf kaum verbarg, erwiderte Hans den Gruß. »Guten Abend, Sohn. Ist es wahrhaftig schon finster draußen? Das habe ich gar nicht bemerkt. Setz dich zu mir und berichte mir von deinem Besuch im Gildehaus.«
Wieder schüttelte Hartwych den Kopf, musste aber schmunzeln. Im letzten Jahr hatten sie Fensterscheiben in der Stube einbauen lassen. Seither mussten sie nicht allezeit hinter hölzernen Fensterläden bei künstlicher Beleuchtung leben wie in den anderen Räumen. Doch seit dem Tag, als die Handwerker die Rautenscheiben, die vom ersten Moment für neidische Blicke der einfachen Bürger sorgten, eingesetzt hatten, nutzte Hans das wenige Tageslicht über Gebühr. Schließlich hatte er den Einbau nicht aus repräsentativen Erwägungen vornehmen lassen, sondern einzig und allein, um Kerzen zu sparen.
Wie gewünscht, schilderte Hartwych seinem Vater, wie er zunächst mit dem Ratsherrn Durkop und später mit weiteren Herren, Mitgliedern der Compagnie der Schwarzen Häupter, über seine Einfälle bezüglich einer Tafelgilde gesprochen hatte. Der hörte ihm, obwohl die wohltätigen Aktivitäten seine Sache nicht waren, aufmerksam zu und nickte hin und wieder bedächtig, die für das schmale Gesicht unpassend buschigen Augenbrauen zusammengezogen. Hartwych erzählte noch den neuesten Klatsch. So sei der Wachtmeister mit einer Tumultsache befasst, die so manchen auf das Äußerste empörte. Auf dem Markt, so hieß es in der Stadt, seien Würste aus verdorbenem Schweinefleisch angeboten worden. Jedenfalls behauptete das ein Zimmermann, der gerade für den Bau eines Ständerhauses nahe des Doms in Riga weilte. Als er sich auf dem Fleischmarkt beschwerte, habe der Händler vehement widersprochen, woraufhin es zu einem Handgemenge gekommen sei, in das am Schluss beinahe zehn bis dahin brave Bürger verwickelt gewesen seien.
»Sie sollen sich mit Würsten und Keulen attackiert haben«, erzählte Hartwych. Sein Vater lachte bei der Vorstellung, wobei er seine kleinen grauen Augen zukniff, und die Augenbrauen tanzten.
So wenig wie Hans sich dafür interessierte, was in der Stadt für die Ärmsten der Armen getan wurde, so wenig konnte Hartwych etwas mit dem Tratsch anfangen, der täglich verbreitet wurde. Da sie aber beide wussten, worüber der jeweils andere gerne sprach, einander stets aufmerksam zuhörten und einander zu jeder Zeit respektierten, verstanden Vater und Sohn sich trotz ihrer Verschiedenheit ausnehmend gut.
»Das Badehaus hat heute geöffnet. Wir sollten den Abend dort ausklingen lassen«, schlug Hans vor.
»Nein, danke, mich bringt heute niemand mehr aus dem Haus«, entgegnete Hartwych. Der Regen hielt ihn tatsächlich davon ab, noch einmal einen Fuß vor die Tür zu setzen. Obendrein kam ihm jedes Mal Ria in den Sinn, wenn eine der hübschen Bademägde, nur mit einem dünnen Trägerhemdchen bekleidet, ihm den Körper abrieb und gegen ein paar Pfennige extra willig seine Lust befriedigte. War es für einen unverheirateten Mann seines Alters auch nicht ungewöhnlich, seine körperlichen Triebe auf diese Art auszuleben, fühlte er sich anschließend jedes Mal unwohl und schmutzig und hatte ein schlechtes Gewissen Ria gegenüber.
»Sagen wir dem Knecht, er soll noch etwas Holz nachlegen, und gönnen uns ein Würfelspiel«, schlug er vor.
»Ein feiner Einfall«, erwiderte Hans erfreut, der das Würfelspiel ebenso mochte wie sein Sohn. Sogleich nahm er die Papiere zur Hand, klopfte sie auf dem Eichenholz der Tischplatte zu einem ordentlichen Stapel und legte diesen beiseite.
Vertieft in ihr Spiel, merkten die Männer kaum, wie die Zeit verstrich. Nicht einmal der Glocke von St. Johannis, die die Stunde schlug, schenkten sie Beachtung.
»Es ist zwar noch Zeit, bis die von Ranteln Riga erreicht«, begann Hartwych beiläufig, »doch ich muss immer häufiger an ihre Ankunft denken. Was weißt du von der Frau?«
Hans zuckte die Schultern und ließ die Würfel schwungvoll über das derbe Holz springen. Das leise Klicken, das sie verursachten, konnte sich kaum gegen das laute Geprassel des Regens durchsetzen. »Nicht viel. Was soll es schon zu erzählen geben über eine Kaufmannstochter von neunzehn Jahren?«
»Sie ist schon neunzehn?«, fragte Hartwych mit unverhohlenem Unwillen. »Ein wenig alt zum Heiraten, meinst du nicht? Hat sie in Lübeck etwa keinen gefunden, der sie wollte?«
»Mach dir keine Sorgen, Sohn.« Hans van Broke war ein Mann mit feinen Gliedern und ebenso feinem Geist. Seine Augen verrieten einen wachen Verstand und seinen Humor. Jetzt zwinkerte er Hartwych zu.
Dessen Miene blieb unbeweglich. Er wollte die Frau ohnehin nicht ehelichen. Was, wenn sie obendrein eine hässliche alte Jungfer war?
Als er den ernsten Ausdruck seines Sohnes bemerkte, vermied auch Hans jeglichen Scherz. »Ihre Mutter ist vor fünf Jahren gestorben. Sie muss, genau wie du, seither mit ihrem Vater vorliebnehmen«, erklärte er. »Im Gegensatz zu dir ist sie das älteste Kind im Hause und hat sich um ihre jüngeren Geschwister gekümmert. Da blieb zunächst keine Zeit, nach einem Bräutigam Ausschau zu halten. Und von Ranteln hatte gewiss auch andere Dinge im Kopf.« Er zog zweideutig die Augenbrauen hoch.
Hartwych musste an seine beiden Brüder denken, die beide älter waren als er selbst. Justus, der Älteste, lebte seit geraumer Zeit in Vaters Haus im Kurzen Genthof in Brügge und regelte dort die Geschäfte. Henning war in Nowgorod vor Ort, dem wichtigsten Handelsplatz für den Russland-Verkehr.
»Jedenfalls trafen wir uns im Jahre 1427. Da war Bilke gerade sechzehn Jahre alt. Wir sprachen darüber, wie praktisch es sei, wenn ihr euch vermähltet. Es war nicht eilig, und von Ranteln wollte seine Tochter nicht zu früh auf eine immerhin nicht ungefährliche Reise schicken.«
Hartwych hörte konzentriert zu und nickte.
»Ich war der Ansicht, es würde sich schon ergeben, dass wir einmal gemeinsam der schönen Stadt Lübeck einen Besuch abstatten und du deine Braut ganz zwanglos in Augenschein nehmen kannst. Aber es hat sich bisher nicht ergeben, und nun hatte es von Ranteln mit einem Mal sehr eilig. Wahrscheinlich denkt er wie du und meint, dass ein Frauenzimmer von neunzehn Jahren kaum noch unter die Haube zu bringen ist.«
»Es war also seine Idee?«
»Gewiss, Sohn. Er teilte mir mit, er halte es für klug, wenn ihr euch endlich begegnet, damit es mit der Hochzeit nicht mehr gar so lange dauert. Da er ohnehin eine große Menge an Pelzen übernehmen und Fisch nach Riga bringen wolle, so ließ er mich wissen, sei es nur vernünftig, Bilke mit seinem Handelsschiff zu uns zu schicken.«