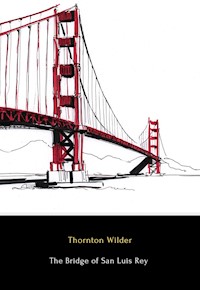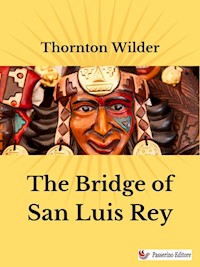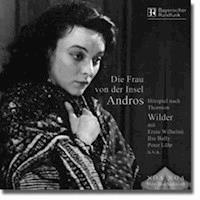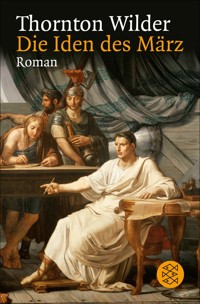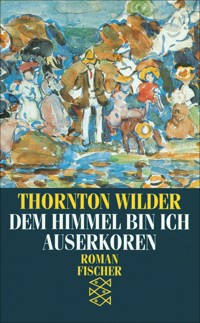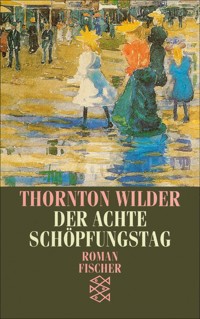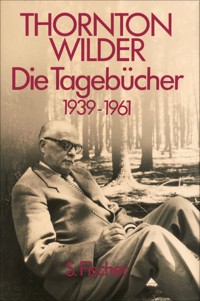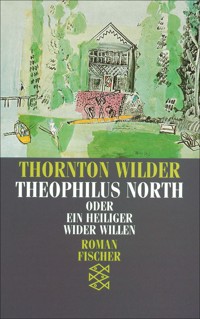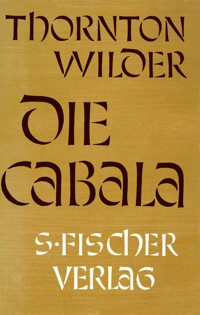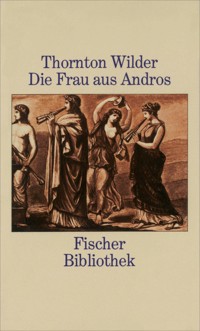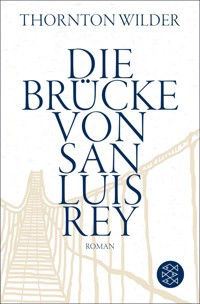
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Wiederentdeckung des größten Klassikers der amerikanischen Literatur – erstmalig seit 1929 in neuer Übersetzung. »Da ist ein Land der Lebenden und ein Land der Toten, und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe - das einzig Bleibende, der einzige Sinn.« Am 20. Juli 1714 stürzen in Peru fünf Menschen in den Tod, als eine von den Indios erbaute Hängebrücke reißt. Ein Franziskanermönch, Zeuge dieser Katastrophe, beginnt den Lebensgeschichten der Toten nachzuforschen. War alles blinder Zufall oder höhere Fügung? Doch je mehr Berichte, Anekdoten und Erinnerungen er zusammenträgt, desto weniger kann er einen höheren Sinn erkennen in dem, was diese Menschen antrieb: die Liebe in ihren unterschiedlichsten Formen. Und vielleicht ist diese Liebe das Einzige, was bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Thornton Wilder
Die Brücke von San Luis Rey
Roman
Aus dem Amerikanischen von Brigitte Jakobeit
FISCHER E-Books
Mit einem Nachwort von Patrick Roth
Inhalt
Editorische Notiz des Verlags zu dieser Ausgabe
1926, im Alter von 29 Jahren, beginnt Thornton Wilder, der Autor des berühmten Theaterstücks Unsere kleine Stadt (1938), mit der Arbeit an seinem zweiten Roman Die Brücke von San Luis Rey. Der New Yorker Verleger Albert Boni, der Wilder mit seinem Debütroman Die Kabala1926 (dt. 1929) entdeckte, veröffentlicht das Buch im November 1927, und im darauffolgenden Jahr wird Wilder für Die Brücke von San Luis Rey zum ersten Mal mit dem Pulitzerpreis für Literatur ausgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt ist der Roman bereits ein großer Publikumserfolg und liegt in der 17. Auflage vor. Mit der Verleihung des bis heute neben dem National Book Award bedeutendsten Literaturpreises in den USA beginnt die internationale Erfolgsgeschichte des Romans. Seither wurde Die Brücke von San Luis Rey in viele Sprachen übersetzt, mehrfach für Radio und Fernsehen adaptiert und bisher dreimal verfilmt.
Der Wiener Verlag E.P. Tal & Co. erwirbt kurz nach der Verleihung des Pulitzerpreises die deutschsprachigen Rechte, und so erscheint die erste – und bisher einzige – deutsche Übersetzung von Herberth E. Herlitschka 1929 zuerst in Österreich. In derselben Übersetzung kam Die Brücke von San Luis Rey1945 in der Schweiz heraus – als Lizenzausgabe und erstes Buch der von Peter Schifferli neu gegründeten »Verlags AG Die Arche«. Diese erste verlegerische Entscheidung des damals 23-jährigen Studenten legt den Grundstein für eine lange, bis heute andauernde Verlagsgeschichte. Die Rechte für Deutschland gehen nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 an Gottfried Bermann Fischer, den Schwiegersohn des S.-Fischer-Verlag-Gründers Samuel Fischer. Die Brücke von San Luis Rey ist 1951 auch das erste Buch der im S. Fischer Verlag neu gegründeten Taschenbuchreihe »Fischer Bücherei«, in der es, immer noch in der Übersetzung von Herberth E. Herlitschka, bis heute lieferbar ist.
Anlässlich seines 70-jährigen Jubiläums im Jahr 2014 legt der Arche Literatur Verlag in Kooperation mit S. Fischer Die Brücke von San Luis Rey in einer neuen Übersetzung vor. Ins Deutsche übertragen von Brigitte Jakobeit, zeigt sich Wilders Text wieder so frisch und zeitlos wie das Original. Die Fragen, die der Roman aufwirft, haben an Aktualität nichts verloren und erreichen uns in der Gegenwart genauso wie die Zeitgenossen Wilders vor fast hundert Jahren. Ist unser Leben und Sterben durch eine rational nicht fassbare Macht vorherbestimmt? Gibt es einen Gott, der unser Schicksal lenkt? Oder ist es sinnloser Zufall, dass gerade diese fünf Menschen an jenem Freitag, den 20. Juli im Jahr 1714, die Anden-Schlucht nahe der peruanischen Stadt Lima überqueren, als die alte Hängebrücke zusammenbricht und sie in den Abgrund reißt? Was bleibt vom Leben eines Menschen nach seinem Tod?
Die in der Moderne so dringlich gewordene Frage nach dem Sinn menschlicher Existenz, die Wilder sich und dem Leser stellt, greift Patrick Roths literarisches Nachwort auf und führt sie erzählend einer neuen Antwort zu. Die ins Sinnbild der Brücke gefasste Vorstellung eines Dritten, welches das »Land der Lebenden« mit dem »Land der Toten« verbindet, hat Patrick Roth schon 2005 in seiner Würdigung des Schauspiels Unsere kleine Stadt als »ungesicherten Faden« bestimmt, der beide Welten zusammenhält (Im Augenblick,2005). An das archetypische Bild der Zusammenführung der Getrennten schließt Roths Gespräch der fünf Freunde an, die sich in unseren Tagen zu mitternächtlicher Stunde auf einer Terrasse im kalifornischen Marina del Rey versammeln, um noch einmal der Brücke von San Luis Rey zu lauschen. Im Dialog »Nach der Erzählung« entwickelt sich eine schockierende Geschichte, die der von Wilder aufgeworfenen Frage nach dem Wert von Liebe und Erinnerung eine überraschend neue Wendung verleiht.
Zürich–Hamburg im Juni 2014
Meiner Mutter
Vielleicht ein Zufall
Am Freitag, dem 20. Juli 1714, um die Mittagszeit, riss die schönste Brücke in ganz Peru und ließ fünf Reisende in den Abgrund stürzen. Die Brücke lag an der Straße zwischen Lima und Cuzco und wurde jeden Tag von Hunderten Menschen überquert. Die Inkas hatten sie ein gutes Jahrhundert zuvor aus Weidenruten geflochten, und jeder Besucher in Lima wurde hingeführt, um sie zu bewundern. Eine schlichte Leiter aus schmalen Brettern, mit Handläufen aus getrockneten Ranken, schwang sie sich über die Schlucht. Pferde und Kutschen und Sänften mussten viele hundert Fuß hinunter, um mit Flößen über den reißenden Fluss zu setzen, aber niemand, nicht einmal der Vizekönig, ja nicht einmal der Erzbischof von Lima, stieg mit dem Gepäck hinab, sondern überquerte die berühmte Brücke von San Luis Rey. Der heilige Ludwig von Frankreich selbst beschützte sie durch seinen Namen und durch die kleine Lehmkirche auf der anderen Seite. Die Brücke schien ein Werk für die Ewigkeit zu sein, und dass sie reißen könnte, war undenkbar. Jeder Peruaner, der von dem Unglück hörte, bekreuzigte sich und rechnete nach, wann er sie das letzte Mal benutzt hatte und wann er sie das nächste Mal hatte benutzen wollen. Die Leute liefen wie in Trance umher und murmelten vor sich hin; im Geiste sahen sie sich selbst in den Abgrund stürzen.
In der Kathedrale fand ein großer Trauergottesdienst statt. Die Leichen der Opfer wurden, so gut es ging, geborgen und, so gut es ging, voneinander getrennt, und in der wunderschönen Stadt Lima prüften die Menschen gründlich ihr Gewissen. Dienstmädchen gaben Armbänder zurück, die sie ihren Herrinnen entwendet hatten, und Wucherer verteidigten vor ihren Frauen mit zornigen Reden ihr Gewerbe. Eigentlich war es seltsam, dass den Bewohnern von Lima dieses Ereignis so naheging, denn in Peru waren solche Katastrophen, die Rechtsgelehrte empörenderweise als »höhere Gewalt« bezeichneten, keine Seltenheit. Immer wieder fegten Flutwellen ganze Ortschaften fort; jede Woche gab es Erdbeben, und ständig stürzte irgendwo ein Turm ein und begrub brave Männer und Frauen unter sich. Krankheiten kamen und gingen in den Provinzen, und das Alter raffte einige der trefflichsten Bürger hinweg. Daher überraschte es umso mehr, dass das Reißen der Brücke von San Luis Rey den Peruanern so zu Herzen ging.
Alle waren zutiefst berührt, doch nur einer unternahm etwas dagegen, und das war Bruder Juniper. Durch eine Reihe von Zufällen, die so außergewöhnlich waren, dass man fast eine höhere Absicht vermuten könnte, weilte dieser kleine rothaarige Franziskaner aus Norditalien seinerzeit in Peru, um Indios zu bekehren, als er zufällig Zeuge des Unglücks wurde.
Es war sehr heiß an jenem Mittag, dem verhängnisvollen Mittag, und Bruder Juniper, der gerade um einen Felsvorsprung kam und stehen blieb, um sich den Schweiß von der Stirn zu wischen, betrachtete das ferne Panorama der schneebedeckten Gipfel und dann die unter ihm liegende Schlucht, die erfüllt war mit dem dichten, dunklen Gefieder grüner Bäume und grüner Vögel und überspannt von der Leiter aus Weidengeflecht. Er war voller Freude, denn seine Sache machte gute Fortschritte. Er hatte mehrere verlassene kleine Kirchen wiedereröffnet, und die Indios schlichen zur Frühmesse und stöhnten bei der heiligen Wandlung, als bräche ihnen das Herz. Vielleicht lag es an der reinen Luft von den Schneefeldern vor ihm, vielleicht an der flüchtigen Erinnerung an den Psalm, der auch ihm gebot, die Augen auf die hilfreichen Berge zu richten. Jedenfalls war er mit sich im Reinen. Dann fiel sein Blick auf die Brücke, und in dem Moment erklang ein scharfer Ton, als risse in einem leeren Zimmer die Saite eines Musikinstruments, und er sah, wie die Brücke entzweiging und fünf wild um sich schlagende Ameisen in das Tal schleuderte.
Jeder andere hätte sich heimlich gefreut und gesagt: »Nur zehn Minuten später, und ich …!« Doch Bruder Juniper bewegte ein anderer Gedanke. »Warum passierte das ausgerechnet diesen fünf?«, fragte er sich. Wenn es überhaupt einen Plan im Universum gab, wenn das menschliche Dasein irgendeinem Muster folgte, so mussten diese doch, verborgen angelegt, in den so jäh abgeschnittenen Lebensläufen zu finden sein. Entweder wir leben durch Zufall und sterben durch Zufall, oder wir leben nach Plan und sterben nach Plan. Und im selben Augenblick fasste Bruder Juniper den Entschluss, die Geheimnisse jener fünf Menschen zu ergründen, die vor ihm in die Tiefe gestürzt waren, und den Grund für ihr Ableben aufzudecken.
Nach Bruder Junipers Ansicht war es höchste Zeit, dass die Theologie ihren Platz unter den exakten Wissenschaften bekäme, und er hatte schon lange vorgehabt, ihr diesen zu verschaffen. Was ihm bislang gefehlt hatte, war ein Versuchslabor. Sicher, an Forschungsgegenständen mangelte es nicht, denn vielen seiner Schützlinge war schon einmal ein Schicksalsschlag zugestoßen – sie waren von Spinnen gestochen worden, sie waren an der Lunge erkrankt, ihre Häuser waren niedergebrannt, und ihren Kindern waren Dinge widerfahren, die man sich lieber nicht vorstellt. Aber keiner dieser Fälle menschlichen Leids eignete sich so recht für eine wissenschaftliche Untersuchung. Ihnen fehlte es an dem, was unsere großen Gelehrten später als Gesetzmäßigkeit bezeichneten. Diese Unglücksfälle wurden zum Beispiel durch menschliches Fehlverhalten herbeigeführt oder waren infolge bestimmter Wahrscheinlichkeiten eingetreten. Der Einsturz der Brücke von San Luis Rey jedoch war eindeutig höhere Gewalt. Er bot ein ideales Versuchslabor. Hier endlich ließen sich Gottes Absichten in aller Reinheit erforschen.
Ein jeder kann sehen, dass dieses Vorhaben bei jedem anderen als Bruder Juniper die Frucht eines tiefen Skeptizismus gewesen wäre. Es glich dem Streben von überheblichen Seelen, die auf den Pfaden des Himmels wandeln wollten und zu diesem Zweck den Turm zu Babel erbauten. Für unseren Franziskaner jedoch gab es bei diesem Experiment keinerlei Zweifel. Er kannte die Antwort. Aber er wollte seinen armen, verstockten Konvertiten, die einfach nicht begriffen, dass sie nur zu ihrem Besten so viel Leid zu tragen hatten, einen historischen, einen mathematisch einleuchtenden Beweis dafür liefern. Die Menschen verlangen stets nach guten, schlüssigen Beweisen; Zweifel regt sich von jeher in der menschlichen Brust, selbst in Ländern, wo die Inquisition die Gedanken der Menschen an den Augen ablesen kann.
Es war nicht das erste Mal, dass Bruder Juniper versuchte, sich solcher Methoden zu bedienen. Auf seinen langen Wanderungen (wenn er mit hochgeraffter Robe von einer Gemeinde zur nächsten eilte) träumte er häufig von Experimenten, die dem Menschen die Wege Gottes verständlich machen könnten. Zum Beispiel ein vollständiges Verzeichnis aller Regengebete und ihrer Resultate. Wie oft hatte er auf den Stufen seiner kleinen Kirche gestanden, während seine Gemeinde vor ihm auf der heißen Erde kniete. Wie oft hatte er die Arme gen Himmel erhoben und die herrlichen Worte gesprochen. Nicht oft, aber doch oft genug, hatte er die Gnade in sich gespürt und gesehen, wie eine kleine Wolke am Horizont erschien. Häufig jedoch waren Wochen vergangen … aber wozu daran denken? Nicht sich selbst wollte er schließlich überzeugen, dass Regen und Dürre weise bemessen sind.
Und so fasste er im Augenblick des Unglücks den Entschluss, der ihn sechs Jahre lang damit beschäftigte, an sämtliche Türen in Lima zu klopfen, Tausende von Fragen zu stellen, Dutzende von Notizheften zu füllen, um zu beweisen, dass jedes der fünf erloschenen Leben ein vollkommenes Ganzes war. Jeder wusste, dass er an einer Art Denkschrift über das Unglück arbeitete, und jeder half ihm und führte doch nur in die Irre. Einige kannten sogar das Ziel seiner Arbeit, und so fanden sich Gönner an hohen Stellen.
Das Ergebnis dieses großen Eifers war ein gewaltiges Buch, das, wie wir später noch sehen werden, an einem wunderschönen Frühlingsmorgen auf dem großen Platz öffentlich verbrannt wurde. Aber es gab eine geheime Abschrift, die nach sehr vielen Jahren, und ohne groß beachtet zu werden, ihren Weg in die Bibliothek der Universität von San Marco fand. Dort liegt sie zwischen zwei dicken Holzdeckeln in einem Schrank und fängt Staub. Sie befasst sich der Reihe nach mit den Opfern des Unglücks, verzeichnet Tausende von Einzelheiten, Anekdoten und Zeugnissen und endet mit einer ehrwürdigen Erläuterung, warum Gott jene Menschen und jenen Tag bestimmte, um seine Weisheit zu offenbaren. Doch trotz seines großen Eifers kam Bruder Juniper nicht hinter die entscheidende Leidenschaft in Doña Marías Leben noch hinter die in Onkel Pios und auch nicht in Estebans. Und ich, der behauptet, so viel mehr zu wissen – könnte nicht auch mir die wesentliche Antriebsfeder entgangen sein?
Die einen sagen, dass wir es nie wissen werden und dass wir für die Götter wie Fliegen sind, die Jungen an einem Sommertag töten; andere hingegen sagen, dass kein Spatz eine Feder verliert, die nicht zuvor von Gottes Hand berührt worden ist.
Die Marquesa de Montemayor
Jeder spanische Schuljunge muss heute mehr über Doña María, Marquesa de Montemayor, wissen, als Bruder Juniper in den Jahren seiner Forschung entdecken sollte. Hundert Jahre nach ihrem Tod galten ihre Briefe als Meilenstein der spanischen Literatur, und ihr Leben und ihre Zeit sind seitdem immer wieder Gegenstand langer Studien gewesen. Aber ihre Biographen haben sich in einer Hinsicht ebenso getäuscht wie der Franziskaner in einer anderen: Sie haben versucht, ihr eine Fülle von Tugenden zu verleihen und in ihr Leben und ihre Person einige der Schönheiten hineinzudeuten, wie sie in ihren Briefen zahlreich vorhanden sind, dabei muss jede wahre Erkenntnis um diese wunderbare Frau darauf gründen, sie zu erniedrigen und ihr alle Reize abzusprechen, bis auf einen.
Sie war die Tochter eines Tuchhändlers, der sich nur einen Steinwurf weit von der Plaza das Geld der Bewohner von Lima genommen und ihren Hass erworben hatte. Ihre Kindheit war unglücklich: Sie war hässlich; sie stotterte; ihre Mutter setzte ihr, um ein wenig gesellschaftliche Geläufigkeit in ihr zu wecken, mit sarkastischen Wendungen zu und zwang sie, in einem wahren Harnisch aus Schmuck durch die Stadt zu gehen. Sie lebte allein, und sie dachte allein. Viele Bewerber wurden vorstellig, aber sie kämpfte, solange sie konnte, gegen die Konventionen ihrer Zeit und war entschlossen, nicht zu heiraten. Es gab hysterische Szenen mit ihrer Mutter, Vorwürfe, Geschrei und Türenschlagen. Mit sechsundzwanzig Jahren schließlich sah sie sich in die Ehe mit einem blasierten, bankrotten Adligen gezwängt, und in der Kathedrale von Lima summte es förmlich vom Getuschel ihrer Hochzeitsgäste. Sie lebte weiterhin allein und dachte allein, und als sie eine wunderschöne Tochter zur Welt brachte, überschüttete sie das Kind mit einer abgöttischen Liebe. Aber die kleine Clara kam nach ihrem Vater, sie war kalt und kritisch. Im Alter von acht Jahren verbesserte sie ungerührt die Sätze ihrer Mutter und betrachtete sie bald mit Verwunderung und Widerwillen. Die verängstigte Mutter wurde kleinlaut und unterwürfig, aber sie konnte nicht umhin, Doña Clara mit nervöser Aufmerksamkeit und einer aufdringlichen Liebe nachzustellen. Wieder gab es hysterische Vorwürfe, Geschrei und Türenschlagen. Unter den Heiratsanträgen, die sie erhielt, wählte Doña Clara bewusst den, der ihre Übersiedelung nach Spanien erforderlich machte. Sie ging also nach Spanien, jenem Land, aus dem die Antwort auf einen Brief sechs Monate dauerte. Der Abschied vor einer so langen Reise wurde in Peru mit einem förmlichen Gottesdienst begangen. Das Schiff wurde gesegnet, und während es sich immer weiter vom Land entfernte, knieten die Menschen auf beiden Seiten und sangen ein Kirchenlied, das unter dem großen weiten Himmel stets schwach und zaghaft klang. Doña Clara trat die Reise mit bewundernswerter Fassung an, und ihre Mutter blickte dem hellen Schiff hinterher, die Hand im Wechsel auf Herz und Mund gepresst. Verzerrt und verschwommen geriet ihr das Bild des ruhigen Pazifiks und der perlmuttfarbenen Wolkenmassen, die ewig reglos darüber hängen.
Das Leben der Marquesa, nunmehr allein in Lima, wurde zunehmend nach innen gekehrt. Sie vernachlässigte ihre Kleidung, und wie alle einsamen Menschen führte sie wohlvernehmbare Selbstgespräche. Ihr ganzes Dasein fand seinen brennenden Mittelpunkt in ihrem Denken. Auf dieser Bühne wurden endlose Dialoge mit der Tochter aufgeführt, unmögliche Versöhnungen, immer wieder neu begonnene Szenen der Reue und Vergebung. Auf der Straße sah man eine alte Frau, deren rote Perücke halb übers Ohr gerutscht war; ihre linke Wange entstellte ein unschöner Ausschlag, der rechts durch die entsprechende Menge Rouge ausgeglichen wurde. Ihr Kinn war nie trocken, ihre Lippen standen nie still. Lima war eine Stadt der Eigenbrötler, doch selbst hier wurde sie zum Gespött, wenn sie durch die Straßen fuhr oder die Stufen einer Kirche hinaufschlurfte. Man sagte ihr nach, sie sei ständig betrunken. Und noch Schlimmeres wurde ihr unterstellt; es waren Gesuche im Umlauf, man möge sie wegsperren. Dreimal wurde sie der Inquisition angezeigt, und es ist durchaus möglich, dass man sie verbrannt hätte, wenn ihr Schwiegersohn in Spanien weniger einflussreich gewesen wäre und sie nicht irgendwie ein paar Freunde am Hof des Vizekönigs gefunden hätte, die sie aufgrund ihrer Überspanntheit und großen Belesenheit duldeten.
Die kummervolle Beziehung zwischen Mutter und Tochter wurde durch Missverständnisse in Geldfragen weiter verschlimmert. Die Condesa erhielt von ihrer Mutter beträchtliche Zuwendungen und viele Geschenke. Am spanischen Hof galt Doña Clara schon bald als eine der bemerkenswertesten und talentiertesten Frauen. Aber alle Schätze Perus hätten nicht ausgereicht, um ihr den prunkvollen Lebensstil zu ermöglichen, den sie für sich beanspruchte. Seltsam genug, hing ihre Verschwendungssucht mit einer der angenehmsten Eigenschaften ihres Wesens zusammen: Sie betrachtete ihre Freunde, ihre Dienstboten und alle interessanten Leute in der Stadt als ihre Kinder. Tatsächlich schien es nur einen Menschen in der Welt zu geben, dem sie ihre gütige Zuneigung versagte. Unter ihren Protegés war der Kartograph De Blasiis (dessen Atlas der Neuen Welt der Marquesa de Montemayor gewidmet war, was unter den Höflingen in Lima schallendes Gelächter auslöste, als sie lasen, sie sei der »Stolz der Stadt und eine im Westen aufgehende Sonne«); ein anderer war der Gelehrte Azuarius, dessen Abhandlung über die Gesetze der Hydraulik von der Inquisition als zu radikal verboten wurde. Zehn Jahre lang unterstützte die Condesa buchstäblich alle Künste und Wissenschaften in Spanien; es war nicht ihre Schuld, dass in dieser Zeit nichts von bleibendem Wert entstand.
Ungefähr vier Jahre nach Doña Claras Abreise erhielt Doña María die Erlaubnis der Tochter, sie in Europa zu besuchen. Auf beiden Seiten sah man dem Besuch mit guten Vorsätzen entgegen, die auf großen Schuldgefühlen gründeten: Die eine wollte geduldig sein, die andere zurückhaltend. Beide versagten. Jede quälte die andere und war kurz davor, unter abwechselnden Selbstbezichtigungen und leidenschaftlichen Ausbrüchen, den Verstand zu verlieren. Eines Tages schließlich stand Doña María vor dem Morgengrauen auf, wagte es gerade noch, die Tür zu küssen, hinter der ihre Tochter schlief, bestieg ein Schiff und kehrte nach Amerika zurück. Von diesem Zeitpunkt an musste an die Stelle all der Liebe, die nicht gelebt werden konnte, das Briefeschreiben treten.
Und so sind ihre Briefe in einer wundersamen Welt ein Lehrbuch für Schüler und ein Ameisenhügel für Grammatiker geworden. Doña María hätte ihre Begabung erfinden müssen, wäre sie nicht schon damit auf die Welt gekommen, so dringlich war es für ihre Liebe, die Aufmerksamkeit und vielleicht sogar die Bewunderung ihres weit entfernten Kindes zu gewinnen. Sie zwang sich, unter die Leute zu gehen, und erntete Schmäh und Spott; sie schulte ihr Auge im Beobachten; sie las die Meisterwerke ihrer Sprache, um zu verstehen, mit welchen Mitteln sie gemacht waren; sie suchte die Gesellschaft derer, deren Gespräche als geistreich galten. Abend für Abend verfasste sie in ihrem Barockpalast unglaubliche Seiten, verwarf sie und setzte erneut an, nötigte sie ihrem verzweifelten Verstand jene Wunder an Scharfsinn und Eleganz, jene feinsinnigen Beschreibungen des vizeköniglichen Hofes ab. Heute wissen wir, dass ihre Tochter die Briefe kaum eines Blickes würdigte und dass wir deren Erhalt ihrem Schwiegersohn zu verdanken haben.
Die Marquesa wäre erstaunt gewesen, hätte sie geahnt, dass ihre Briefe überdauern würden. Gleichwohl haben viele Kritiker ihr vorgeworfen, sie hätte die Nachwelt im Auge gehabt, und verweisen auf eine Reihe von Briefen, die sich allesamt wie Bravourstücke lesen. Es scheint ihnen ausgeschlossen, dass Doña María sich denselben Mühen unterzogen haben sollte, ihre Tochter zu betören, wie die meisten Künstler sie auf das Bezaubern ihres Publikums verwenden. Wie ihr Schwiegersohn verkannten sie die Marquesa: Der Conde las die Briefe mit großem Genuss, glaubte aber, sie seien allein dazu verfasst worden, in ihrer stilistischen Pracht zu schwelgen, und damit entging ihm (wie den meisten Lesern) der ganze Zweck der Literatur, der nämlich darin besteht, dass sie die Stimmung des Herzens vermittelt. Stil ist nur ein leicht verachtenswertes Gefäß, in dem der bittere Trank der Welt angeboten wird. Die Marquesa wäre sogar erstaunt gewesen, hätte sie erfahren, dass ihre Briefe so gut sein sollten, denn Schriftsteller wie sie leben in den luftigen Höhen des Geistes, und Werke, die uns bemerkenswert erscheinen, sind in ihren Augen doch nur alltäglich.
Dies war die alte Frau, die Stunde um Stunde auf ihrem Balkon saß, während ihr komischer Strohhut einen violetten Schatten auf ihr faltiges, gelbes Gesicht warf. Wie oft mag sie sich beim Umblättern der Seiten mit ihren beringten Fingern beinahe amüsiert gefragt haben, ob der stete Schmerz in ihrem Herzen nicht einen organischen Sitz habe und ob ein erfahrener Arzt, der zu diesem morschen Thron vordränge, nicht doch ein Anzeichen entdecken könne und, den Blick nach oben wendend, seinen Studenten im Hörsaal zuriefe: »Diese Frau hat gelitten, und ihr Leid hat Spuren auf dem Gewebe ihres Herzens hinterlassen.« Dieses Bild hatte sie so oft heimgesucht, dass sie es einmal in einem Brief an ihre Tochter erwähnte, die ihr daraufhin vorwarf, sie kreise zu sehr um sich selbst und betreibe einen Kult um ihren Kummer.