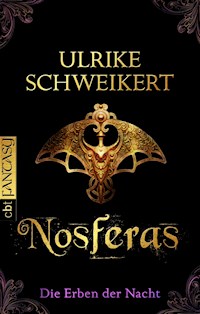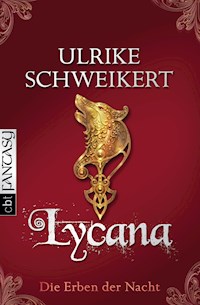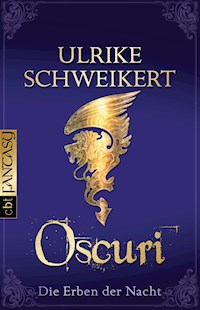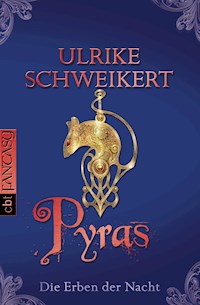9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Charité-Reihe
- Sprache: Deutsch
Sternstunden der Medizin Berlin, 1831. Seit Wochen geht die Angst um, die Cholera könne Deutschland erreichen – und als auf einem Spreekahn ein Schiffer unter grauenvollen Schmerzen stirbt, nimmt das Schicksal seinen Lauf. In der Charité versuchen Professor Dieffenbach und seine Kollegen fieberhaft, Überträger und Heilmittel auszumachen: ein Wettlauf gegen die Zeit. Während die Ärzte um das Überleben von Tausenden kämpfen, führen drei Frauen ihren ganz persönlichen Kampf: Gräfin Ludovica, gefangen in der Ehe mit einem Hypochonder, findet Trost und Kraft in den Gesprächen mit Arzt Dieffenbach. Hebamme Martha versucht, ihrem Sohn eine bessere Zukunft zu bieten, und verdingt sich im Totenhaus der Charité. Die junge Pflegerin Elisabeth entdeckt die Liebe zur Medizin und – verbotenerweise – zu einem jungen Arzt … Die Charité – Geschichten von Leben und Tod, von Hoffnung und Schicksal im wohl berühmtesten Krankenhaus Deutschlands.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ulrike Schweikert
Die Charité
Hoffnung und Schicksal
Roman
Über dieses Buch
Sternstunden der Medizin
Berlin, 1831. Seit Wochen geht die Angst um, die Cholera könne Deutschland erreichen – und als auf einem Spreekahn ein Schiffer unter grauenvollen Schmerzen stirbt, nimmt das Schicksal seinen Lauf. In der Charité versuchen Professor Dieffenbach und seine Kollegen fieberhaft, Überträger und Heilmittel auszumachen: ein Wettlauf gegen die Zeit. Während die Ärzte um das Überleben von Tausenden kämpfen, führen drei Frauen ihren ganz persönlichen Kampf: Gräfin Ludovica, gefangen in der Ehe mit einem Hypochonder, findet Trost und Kraft in den Gesprächen mit Arzt Dieffenbach. Hebamme Martha versucht, ihrem Sohn eine bessere Zukunft zu bieten, und verdingt sich im Totenhaus der Charité. Die junge Pflegerin Elisabeth entdeckt die Liebe zur Medizin und – verbotenerweise – zu einem jungen Arzt …
Die Charité – Geschichten von Leben und Tod, von Hoffnung und Schicksal im wohl berühmtesten Krankenhaus Deutschlands.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2019
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Heike Brillman-Ede
Umschlaggestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
Umschlagabbildungen Stephen Mulcahey, Ebru Sidar/Trevillion Images
ISBN 978-3-644-40423-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Alexandra Strauss
und in Liebe für meinen Mann
Peter Speemann
Prolog
Gnadenlos brannte die heiße Augustsonne 1831 auf Berlin herab. Sie spiegelte sich in der braunen Flut des träge hin und her schwappenden Spreekanals, dessen übler Geruch sich heute wie eine Wolke ausbreitete, die vertäuten Lastkähne einhüllte und durch die Häuser am Ufer waberte. Johannes Christian Mater stand an der Reling seines Kahns und kniff die Augen zusammen. Ein Stück weiter näherte sich eine Frau dem Kanal und leerte schwungvoll den stinkenden Inhalt eines Abtrittseimers ins Wasser. Sie hob grüßend die Hand, ehe sie wieder unter der niederen Tür des Hauses verschwand, in dem sie mit wer weiß wie vielen Kindern, Verwandten und fremden Schlafgängern hauste.
Hans stöhnte und wischte sich mit seinem schmutzigen Ärmel den Schweiß von der Stirn. Er war bereits vor einer Woche mit seiner Fracht aus Nienburg an der Saale eingetroffen und hatte fünfhundert Zentner Salz am Schiffbauerdamm abgeladen, doch seine Fracht war noch nicht bereit gewesen. Jetzt endlich war Kahn M92 mit Kiefernholz beladen, konnte aber immer noch nicht auslaufen. Ein betrunkener Schiffer hatte am Morgen mit seinem Torfkahn eines der Schleusentore aus den Angeln gerissen. Das konnte dauern! Es blieb Hans nichts anderes übrig, als sich einen Platz am Ufer nahe der Jungfernbrücke zu suchen und abzuwarten.
Der Tag verrann. Seine Mutter tauchte aus der Kajüte auf und goss Waschwasser aus einer Schüssel in den Kanal.
«Ich habe Durst», sagte Hans. «Ich geh mal rüber in den Nussbaum.»
Seine Mutter verzog zwar das Gesicht angesichts des Kneipennamens, nickte jedoch und verzichtete auf den Hinweis, nicht zu viel zu trinken. Heute würden sie eh nicht mehr auslaufen.
Hans steckte einen kleinen Beutel mit Münzen in die Hosentasche und machte sich auf den Weg. Auf der Gasse stieß er fast mit einer Frau zusammen, die es sichtlich eilig hatte. Hans sprang zur Seite.
«Entschuldigung», murmelte er.
Der Frau rutschte ihre schwere Tasche aus der Hand, sodass sie auf die mit Unrat bedeckte Straße fiel. Hans bückte sich und hob die längliche, abgewetzte Ledertasche auf. Nun erst erkannte er die Frau.
«Gott zum Gruß, Martha.» Er reichte ihr die Tasche. «Lass mich raten: Bald gibt es hier noch ein hungriges Maul mehr zu stopfen.»
Die Hebamme nickte. «Du sagst es. Aber wolltest du nicht schon längst auf dem Weg nach Nienburg sein?»
Hans zog eine Grimasse. «Die Schleuse ist kaputt. Ich liege fest.»
Martha sagte einige mitfühlende Worte, doch es war klar, dass sie mit ihren Gedanken bereits woanders war. Sie hob grüßend die Hand und schritt auf eines der Häuser zu, das wie betrunken an seinem Nachbarn lehnte.
Es gab kaum einen Ort in Berlin, an dem die Häuser so eng beieinanderstanden und so viele Menschen in winzigen Räumen miteinander hausten wie hier am Spreekanal. Aller Unrat wurde in den Kanal geleert, da die Senkgruben schon seit langem überfüllt waren. Fliegenschwärme kreisten in der flimmernden Luft.
Hans setzte seinen Weg fort. Er trank in der nächsten Kneipe ein Bier, das den brennenden Durst ein wenig stillen sollte, bis er sein eigentliches Ziel erreicht haben würde. In seinem Bauch rumorte es, als er weiterging.
«Gottfried, ich brauch einen Kräuterschnaps», rief er dem Wirt des Nussbaums zu und ließ sich auf einen Hocker fallen.
Aus dem einen wurden fünf, doch seine Eingeweide wollten keine Ruhe geben. In einer Ecke saß einer der Stammgäste der Destille mit einer Flasche billigem Fusel.
«Juppheidi, juppheida, Schnaps ist gut für die Cholera», sang er laut.
Der Wirt stöhnte. «Is ja gut!», schimpfte er. «Hör endlich auf damit, du vertreibst mir noch meine Gäste.»
«Du wirst keine Gäste mehr haben, wenn sich die Cholera alle geholt hat», lallte der Säufer.
Hans und Gottfried tauschten Blicke. «Ich kann’s nicht mehr hören», sagte der Wirt leise. «Jeder redet nur noch von der Cholera, und auch die Zeitungen sind voll davon. Mein Gott, der flotte Otto bringt einen gestandenen Mann nicht gleich um!»
Hans wiegte den Kopf. «Die Cholera, die da aus dem Osten kommt, scheint was anderes zu sein. Ich hab gelesen, in Indien sind neuntausend Mann einer Garnison einfach so innerhalb von ein paar Tagen abgekratzt.»
Der Wirt hatte auch davon gehört, weigerte sich aber, es den Schwarzsehern gleichzutun. «Berlin ist sicher», behauptete er. «Wir haben unseren Gesundheitsdirektor Rust, der die Cholera schon an der Grenze zu Preußen aufhält.»
Hans lachte. Die Schnäpse wallten warm in seinem Bauch auf und ab. «Du meinst, die Cholera bittet an der Grenze höflich um ein Visum?»
Gottfried fiel in sein Lachen ein. «Quatsch, das nicht, aber die Grenze nach Osten ist seit Wochen gesperrt. Die Armee lässt keine Maus durch, und jeder Mann muss erst mal zwanzig Tage in Quarantäne, ehe er nach Preußen einreisen darf. Jeder Brief wird in Chlor geräuchert, es kommen weder Getreide noch Obst, noch Pelze mehr von Russland zu uns rein.»
«Und dennoch ist die Cholera in Danzig ausgebrochen, hab ich gehört», wagte Hans zu widersprechen.
Gottfried brummte nur und kehrte zu seinem Platz hinter dem Tresen zurück, um zwei Neuankömmlingen einzuschenken.
Hans erhob sich. In seinem Kopf drehte es sich, und er musste sich erst einige Augenblicke festhalten, ehe er unsicher auf die Tür zuschwankte. «Wir seh’n uns, Gottfried. Halt die Ohren steif!», rief er dem Wirt zum Abschied zu, ehe er auf die Straße hinaustrat.
Die stinkende, schwüle Luft drohte, ihm den Magen umzudrehen. Hans atmete tief durch, straffte den Rücken und ging weiter, doch in seinen Eingeweiden wühlte es so wild, als würden hundert Schlangen einen Tanz aufführen. Hans presste sich die Hände gegen den Leib. Er hatte die Jungfernbrücke fast erreicht, da versagten seine Kräfte. Er sank auf die Knie. In schmerzhaften Wellen schoss es aus ihm heraus: Schnaps, Bier, Kartoffeln und was er sonst noch an diesem Tag zu sich genommen hatte. Alles schien gleichzeitig aus allen Körperöffnungen nach draußen zu drängen. Bebend kauerte er vor der Brücke, seine Sinne drohten ihm zu schwinden. Da drang eine Stimme wie durch einen Nebel in sein Bewusstsein.
«Hans, beim Herrn im Himmel, was ist mit dir?»
Trübe hob er den Blick. Noch immer von Krämpfen geschüttelt, sah er die Hebamme an. «Der Schnaps hat nicht geholfen.»
«Du hast zu viel getrunken. Das hat man dann halt», behauptete Martha, doch selbst Hans hörte die Skepsis in ihrer Stimme.
Die resolute Frau packte den Schiffer unter dem Arm und schleifte ihn zum Liegeplatz seines Kahns. Hans’ Mutter kam ihnen schon entgegen und half, den Sohn in die Kajüte zu schleppen.
«Was sollen wir tun?», fragte Frau Mater ängstlich. «So was habe ich noch nie erlebt.»
Martha schüttelte ratlos den Kopf. «Ich auch nicht. Ich denke, es ist besser, einen richtigen Arzt zu holen. Ich beeile mich!», versprach sie und kletterte die engen Stufen zum Deck hinauf.
1. Buch
Kapitel 1Cholera
Martha eilte durch die Stadt. An zwei Türen klopfte sie vergeblich, die Ärzte waren nicht daheim. Wohin sollte sie sich wenden? Vielleicht würde sich der junge Dr. Calow des armen Schiffers annehmen. Sie war sich nicht sicher, aber sie würde es versuchen. Im Laufschritt bog sie in die Charlottenstraße ein und eilte am Gendarmenmarkt mit den beiden prächtigen Kirchen vorbei. Vor dem Haus mit der Nummer 12 standen zwei Männer. Der eine war noch sehr jung, schlank und groß gewachsen, doch sein dünnes blondes Haar wirkte schütter, und sein Rock war abgetragen.
Der andere war etwas kleiner. Ein äußerst gutaussehender Mann, vielleicht Ende dreißig mit kräftigem Haar und dunklen Brauen. Sein Blick war aufmerksam und kraftvoll. Der grüne Frack mit den goldenen Knöpfen saß ausgezeichnet und war von guter Qualität. Martha kannte sich aus. Sie half nicht nur den Frauen in den Quartieren am Spreekanal bei der Geburt ihrer Kinder. Als Stadthebamme hatte sie sich den Ruf erworben, auch bei schwierigen Lagen Rat zu wissen, und wurde daher nicht selten in die prächtigen Häuser der Friedrichstadt gerufen.
Der Unterschied konnte nicht größer sein. Sie dachte an die hohen, hellen Räume, die von einem Heer von Bediensteten sauber gehalten wurden. Die schwangere Bürgersfrau bekam eine für ihren Zustand ausgewählte Diät serviert und bekam ganz sicher keine vorzeitigen Wehen, nur weil sie zu schwere Wassereimer geschleppt oder Feuerholz gehackt hatte. Ihr Kind wurde mit sauberem Wasser gewaschen und in frisch duftende Tücher gewickelt, während die Frauen am Kanal ihre Kinder auf schmutzigen Binsen gebaren und froh sein konnten, wenn sie selbst genug zu essen hatten, um ihr Kind zu nähren. Es wunderte Martha nicht, dass dort viele Säuglinge kaum ein paar Tage überlebten. An solch einem Ort geboren zu werden, war kein guter Start ins Leben.
Martha stand immer wieder fassungslos vor dem Elend. Warum nur war die Welt so ungerecht? Gab es denn gar keine Möglichkeit, das zu ändern? Hatten die armen Menschen nicht auch ein Recht zu leben?
Ihre Gedanken kehrten zu dem kranken Schiffer zurück. Sie fixierte die beiden Männer. Der jüngere war Dr. Hans Calow, den anderen erkannte sie nur an dem feurigen Gespann vor seiner Kutsche, das ein Diener im Zaum hielt. Über diese beiden Rappen sprach ganz Berlin – und über ihren Herrn, den zweiten dirigierenden Chirurgen der Charité, Dr. Johann Friedrich Dieffenbach.
«Dr. Calow», brach Martha jetzt in das Gespräch der beiden Männer ein. «Bitte, entschuldigen Sie, aber es handelt sich um einen Notfall.»
Die beiden Ärzte wandten sich ihr zu. Sie schienen ihr für die rüde Unterbrechung ihrer Unterhaltung nicht zu zürnen. Im Gegenteil, Dieffenbach betrachtete sie aufmerksam.
«Das ist Madame Vogelsang, unsere hervorragende Stadthebamme», stellte Calow Martha vor. «Was gibt es denn? Eine schwierige Geburt, nehme ich an.»
Sie schüttelte den Kopf und begann, von Hans Mater zu berichten.
«Ich denke, mit Kohlepulver und Opiumtropfen sollte das schnell behoben sein», schlug Calow vor. «Wir haben diesen Sommer ungewöhnlich viele Fälle von Brechdurchfall.»
Martha schüttelte den Kopf. «Ich glaube, dieser Fall ist anders.»
Auf der anderen Straßenseite sprangen zwei Jungen in kurzen Hosen und fleckigen Hemden vorbei und sangen: «Juppheidi, juppheida, Schnaps ist gut für die Cholera.» Das Spottlied war in diesen Tagen in aller Munde.
Martha spürte, wie sie erschauderte. Dr. Dieffenbach hob die dichten Brauen.
«Glauben Sie, es ist die Cholera? Ich wurde in den vergangenen Tagen zu vielen Patienten gerufen, die glaubten, an dieser Krankheit zu leiden, doch es war stets harmlos.»
Martha hob die Schultern. «Ich weiß nicht, aber eines kann ich Ihnen versichern, ich habe in meinem Leben schon viele Menschen mit Durchfall und Erbrechen erlebt, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Bitte, Dr. Calow, kommen Sie mit mir. Ich habe es der Mutter versprochen.»
«Wenn es so dringend ist, dann sollten wir besser meinen Wagen nehmen», schlug Dieffenbach vor.
Martha sah ihn erstaunt an. «Danke», stieß sie aus, ehe sie hinter Dr. Calow in die Kutsche kletterte. Dieffenbach stieg selbst auf den Kutschbock und schwang die Peitsche. Die Rappen zogen mit einem Ruck an. Der Diener, der die stürmischen Rösser offensichtlich gewohnt war, sprang rechtzeitig zur Seite und dann mit einem riesigen Satz auf den Wagen.
Es war brütend heiß an diesem Nachtmittag, als Elisabeth das Haus ihrer Schwester erreichte. Es war ein altes, schmales Gebäude, das jedoch in besserem Zustand war als die Häuser gegenüber, die mit der Rückseite an den Kanal grenzten. Doch selbst wenn Maria und ihr Mann den Luxus einer eigenen kleinen Wohnung genossen, war die Gegend alles andere als das, was man sich für das gesunde Gedeihen einer jungen Familie vorstellte. Elisabeths und Marias Eltern waren, wie so viele Leute vom Land, nach Berlin gezogen, nachdem Napoleon besiegt und die Menschen in Preußen nach den Reformen der Minister von Stein und von Hardenberg endlich frei waren, dort zu leben, wo sie wollten. Sie hofften auf Arbeit und ein besseres Leben, doch auch sie mussten erfahren, dass es in den neuen Fabriken zwar Arbeit gab, der Lohn aber nicht reichte, um ein besseres Leben zu führen als auf dem Land.
Berlin brachte der Familie kein Glück. Ihre Mutter brach sich das Genick auf einer Kellertreppe, der jüngere Bruder starb an Typhus und der Vater im vergangenen Jahr an der Seuche der Schwindsucht, die die Lungen der Fabrikarbeiter verzehrte, bis sie Blut husteten und unter Qualen starben.
Elisabeth schob die Haustür auf, stieg die enge Treppe einen Stock höher und blieb vor der geschlossenen Wohnungstür stehen. Es war dunkel und heiß im Treppenhaus, und es roch nach Zwiebeln und ungeleerten Nachttöpfen.
Sie zögerte. Warum war sie gekommen? Das letzte Mal, als sie ihre um vier Jahre ältere Schwester gesehen hatte, waren sie im Streit auseinandergegangen. Elisabeth hatte ihren Schwager von Anfang an nicht gemocht, doch Maria hatte nicht auf sie hören wollen und sich mit diesem liederlichen Kerl eingelassen, der sie ins Unglück stürzte, davon war die Jüngere überzeugt. Hubert hatte sein Glück zuerst bei Elisabeth versucht und dann, als er bei ihr keinen Erfolg hatte, sich der Schwester zugewandt, die seinen plumpen Annäherungsversuchen allzu bereitwillig nachgegeben hatte. Das Ergebnis konnte man seit Monaten deutlich unter ihrem Busen wachsen sehen!
Elisabeth schnaubte voller Abscheu, als Huberts Bild vor ihr aufstieg. Er sah nicht schlecht aus, das musste sie ihm lassen, doch sie hielt ihn für verschlagen, er war schwach von Charakter und leider auch voller Jähzorn, vor allem, wenn er dem Ruf des Branntweins nachgab. Sie hatte sich mehr als ein Mal erbittert mit ihm gestritten, doch ihre Forderung, Maria mit mehr Respekt und Zartgefühl zu behandeln, verhallte ungehört. Er sei der Mann im Haus, und sein Weib habe ihm zu gehorchen!
«Pah!»
Niemals würde Elisabeth in diese Falle tappen und sich von einem Mann beherrschen lassen, das schwor sie sich. Sie war jetzt neunzehn, und der Vater hatte vor seinem Tod noch versucht, sie mit einem der Nachbarburschen zu verheiraten, doch sie hatte sich standhaft geweigert.
Nun aber war sie hier, um nach Maria zu sehen und Frieden mit ihr zu schließen. Sie hatten nur noch einander. Wenigstens die beiden Schwestern mussten zusammenhalten. Und sie musste ihrer Schwester etwas sagen. Etwas, das Elisabeth sehr wichtig war.
Sie holte tief Luft, klopfte und trat ein. Die Wohnung war klein und bestand aus einer winzigen Küche, die sich zum Hauptraum öffnete, mit einem Tisch, drei Stühlen und einem Canapé in verblichen graugrüner Farbe, das unter dem einzigen Fenster stand. Ein geschlossener Vorhang verbarg die Nische mit dem Bett. Die Schwangere saß auf dem Sofa, die Arme um ihren hervorquellenden Bauch gelegt.
«Du kommst spät», begrüßte Maria ihre Schwester unwirsch.
Elisabeth stemmte die Arme in die Taille und runzelte die Stirn. Sie fühlte Unmut in sich aufsteigen. Nein, sie würde sich nicht entschuldigen. Sie hatte versprochen, heute zu kommen, und hier war sie. «War Martha schon da?», erkundigte sie sich stattdessen.
«Ja», stieß Maria hervor.
«Und? Ist alles in Ordnung?»
«Ja», sagte Maria noch einmal, «in ein paar Tagen ist es so weit.»
Doch dann stürzten ihr Tränen in die Augen und rannen über ihre Wangen. Sie wischte sie nicht ab, sondern ließ sie ungehindert in den ergrauten Kragen ihres Kleides tropfen. Elisabeths Unmut schmolz. Sie eilte zu ihr, ließ sich neben Maria auf das durchgesessene Polster sinken und legte den Arm um sie.
«Warum weinst du dann?»
Maria schluchzte, dann griff sie nach dem Saum ihres Kleides und wischte sich energisch über das Gesicht.
«Er ist es nicht wert, dass ich um ihn heule.»
«Wer? Hubert?», erkundigte sich Elisabeth vorsichtig.
«Ja, Hubert!», stieß Maria erbost aus. «Wie viele Ehemänner habe ich denn? Hatte ich», endete sie lahm.
«Hatte? Er hat dich doch nicht etwa sitzenlassen jetzt vor der Geburt eures Kindes?» Schon wieder ballte sich der Groll in ihr zusammen. Das sähe diesem Nichtsnutz ähnlich!
«In gewisser Weise schon», antwortete Maria, und ihr standen schon wieder Tränen in den Augen. «Früher haben sich die Soldaten von Napoleons Männern totschießen lassen. Mein Mann braucht dazu keinen Feind. Er schafft es ganz alleine, sich in die Luft zu sprengen.»
Sie zog einen zerknitterten Brief aus ihrer Rocktasche und reichte ihn Elisabeth. Es war ein Schreiben aus dem Kriegsministerium, in dem der Unfall, der zum Tod des braven Soldaten geführt habe, bedauert wurde.
«Was soll denn jetzt aus uns werden?», klagte Maria. «Mit dem Wurm kann ich keine Arbeit finden, und ich muss doch die Miete bezahlen, sonst landen wir auf der Straße.»
«Sie werden dir keine Rente bezahlen», vermutete Elisabeth. «Er hätte als einfacher Rekrut nicht heiraten dürfen.»
Maria nickte, dann sah sie ihre Schwester plötzlich eindringlich an. «Du könntest zu uns ziehen», schlug sie vor. «Das Bett ist breit genug. Ja! Wir suchen uns eine Arbeit und teilen uns die Zeit mit dem Kleinen, dann reicht es für uns alle.»
Elisabeth erhob sich vom Sofa und strich ihr einfaches graues Kleid glatt. «Das geht leider nicht», sagte sie. «Ich habe eine Entscheidung getroffen.»
«Was für eine Entscheidung?», erkundigte sich Maria, aber Elisabeth hörte an ihrer Stimme, dass sie mit ihren Gedanken woanders war.
Sie richtete sich auf und reckte herausfordernd das Kinn. «Ich habe eine Arbeit angenommen», sagte sie. «Ich werde nicht viel Zeit haben, um mich um dich und das Kind zu kümmern. Es tut mir leid, aber ich verspreche dir, jeden Taler, den ich übrig habe, für euch aufzuheben.»
Maria sah sie erstaunt an. «Was für eine Arbeit?»
«Ich bin jetzt Krankenwärterin in der Charité», antwortete Elisabeth.
«Wärterin?», echote Maria. «Was verdienst du da denn?»
«Zwölf Taler», sagte Elisabeth leise und senkte beschämt den Kopf.
«Zwölf Taler?», wiederholte Maria und lachte schrill. «Ich nehme an, nicht im Monat, oder?»
Elisabeth schüttelte stumm den Kopf.
«Zwölf Taler im Jahr», höhnte Maria. «Das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel.»
«Ich wohne dort umsonst und bekomme freie Kost», fügte Elisabeth rasch hinzu, wobei sie verschwieg, dass dies kein Abendbrot beinhaltete.
«Wärterin!», wiederholte Maria fassungslos. «Wenn das unsere Eltern wüssten. Sie hätten sich was Besseres für dich gewünscht.»
«Was denn? Einen Säufer und Schläger als Ehemann, der mich schwanger zurücklässt?»
Maria schluchzte wieder. «Das ist gemein. Er ist ja nicht absichtlich gestorben.»
«Das nicht, aber selbst wenn er noch leben würde, wollte ich nicht mit dir tauschen. Besser, ich gebe meine Kraft kranken Menschen, die meine Hilfe brauchen, als so einem Mann!»
Maria lief rot an. «Er war kein Heiliger», war alles, was sie über ihren verstorbenen Mann zu sagen wusste.
«Nein, bei Gott nicht», legte Elisabeth nach.
«Dein Entschluss steht also fest?», versuchte Maria es noch einmal. «Du willst es dir nicht noch einmal überlegen und lieber bei mir – bei uns – bleiben?»
«Nein, ich habe einen Vertrag unterschrieben, und den werde ich erfüllen!», sagte sie fest, obgleich sie innerlich schwankte. Sie war mit dem festen Vorsatz gekommen, ihr Leben in eine andere Richtung zu lenken und von nun an den Kranken zu widmen, doch auf einmal kam sie sich stur und lieblos vor.
«Was denkst du denn, was für eine Arbeit wir finden könnten?» Elisabeth hielt dem bohrenden Blick ihrer Schwester stand.
Maria senkte als Erste den Blick. Sie wuchtete sich vom Sofa hoch und watschelte auf ihren geschwollenen Füßen zu dem Bord, das an der Wand über dem alten, eisernen Ofen hing.
«Ich habe noch Kräuterschnaps», sagte sie. «Willst du einen mit mir trinken?»
Elisabeth trat zu ihr und nahm zwei Gläser. «Ja, gern. Ich denke, in der Charité werde ich nicht so schnell wieder einen bekommen», sagte sie versöhnlich und setzte sich auf einen der Hocker. Maria gesellte sich zu ihr und schenkte die Gläser randvoll.
«Auf das Leben, was es auch noch bringen mag», sagte sie und leerte ihr Glas mit einem Zug.
«Ich komme dich besuchen, wann immer ich ein paar Stunden frei habe», versprach Elisabeth.
«Das wird nicht allzu oft sein», vermutete Maria.
«Nein», stimmte ihr Elisabeth zu und schenkte noch einmal nach. «Aber Martha wird da sein, wenn es losgeht, um sich um dich und das Kind zu kümmern.»
Sie leerte ihren Beutel und ließ einige Taler auf den Tisch fallen. «Das ist der Rest von Vaters Ersparnissen. Ich bringe dir mehr, sobald ich mein erstes Geld erhalte.»
Maria brummte nur und legte ihre Hand auf die der Schwester. «Ich wünsche dir, dass du mit deiner Entscheidung glücklich wirst. Vielleicht lernst du einen netten Mann kennen, der dich heiratet.»
Elisabeth lachte verächtlich. «Ganz bestimmt nicht, denn ich habe nicht vor, mich heiraten zu lassen. Ich werde mein Leben selbst bestimmen und mich mit meiner eigenen Hände Arbeit ernähren, das schwöre ich dir.»
Maria schüttelte nur stumm den Kopf.
Es dämmerte bereits, als die Kutsche mit den beiden Rappen am Kanalufer hielt. Martha sprang als Erste aus dem Wagen, die beiden Ärzte folgten ihr über die Planke auf das Schiff. Frau Mater kam ihnen entgegen. Sie war blass. Martha griff nach ihrem Arm, doch sie sagte nichts. Ihr fielen keine tröstenden Worte ein.
«Es geht ihm gar nicht gut», sagte Hans’ Mutter mit einem Schluchzen in der Stimme und führte die Ärzte und Martha unter Deck. Die dunklen Schiffsplanken glänzten feucht, doch obgleich Frau Mater gründlich gewischt hatte, stank es durchdringend nach Erbrochenem und Durchfall.
«Leidet er noch immer unter diesen starken Krämpfen?», erkundigte sich Dr. Dieffenbach.
Hans’ Mutter verneinte und zeigte auf den Leidenden, der völlig ruhig in seiner Koje lag.
Dr. Calow bückte sich, um unter der niederen Kajütendecke ans Bett treten zu können. Er schlug die Wolldecke beiseite. «Können wir mehr Licht haben?», bat er.
Martha nahm die Lampe vom Tisch und hielt sie so, dass der Lichtschein über das Gesicht des Kranken huschte. Es war ihr, als blickte sie in das Gesicht eines Toten. Das konnte kein normaler Brechdurchfall sein! Was auch immer im Körper des Schiffers wütete, es war seinen zerstörerischen Weg schon weit gegangen.
«Haben Sie so etwas schon einmal gesehen?», fragte Calow leise. Dr. Dieffenbach schüttelte den Kopf. Seine Miene war ernst und bestätigte Marthas Verdacht. Sie hatte nicht übertrieben.
Der Arzt zog ein Notizbuch hervor und begann zu schreiben: Gesichtsfarbe des Patienten fahles Aschgrün, Hände noch blasser, Augäpfel tief in die Höhlen eingesunken. Hornhaut getrübt, der Blick ist starr. Das Gesicht wirkt ausgezehrt.
Calow ergriff die schlaffe Hand. «Der Puls ist kaum zu spüren. Er ist ein wenig eilig.» Er öffnete den verschmierten Kittel des Schiffers und blickte auf die Brust, die sich kaum merklich hob und senkte. Dieffenbach notierte weiter.
«Ist das ein Krankheitsbild, das Ihnen vertraut ist?», wollte Calow wissen.
Der zweite dirigierende Chirurg der Charité schüttelte den Kopf. «Ich fürchte, wir müssen das Schlimmste annehmen.»
Es war Martha, die das schreckliche Wort aussprach: «Cholera.»
Die beiden Ärzte widersprachen nicht.
«Was können wir tun?», wollte Calow wissen.
«Sie kennen sicher Geheimrat Rusts Sechzehn-Punkte-Plan für Cholerafälle, den er vorsorglich erlassen hat», sagte Dr. Dieffenbach und rollte gleichzeitig mit den Augen.
«Danach müssten wir ihn jetzt zur Ader lassen. Mindestens ein Pfund Blut sollten wir ihm abzapfen», erwiderte Calow. «Halten Sie das in seinem Zustand für sinnvoll?»
«Sie vielleicht?», konterte Dieffenbach. «Es scheint, als habe dieser Mann jetzt schon kein Blut mehr in seinen Adern. Und er braucht auch nichts mehr, um den Magen oder Darm zu beruhigen.»
«Es scheint mir eher, als müsse man den ganzen Körper zum Leben anregen», stimmte ihm Calow zu.
Dr. Dieffenbach nickte. «Sie sagen es. Frau Mater, eine Scheuerbürste!»
Die Schifferfrau eilte davon, während der Arzt eine Flasche mit Kampferspiritus öffnete. Martha schob die Ärmel hoch, endlich gab es etwas zu tun. Endlich würden sie den Kampf gegen den unsichtbaren Feind im Körper des Mannes aufnehmen. Es war immer besser, etwas zu tun, statt dazusitzen und zuzusehen, wie ein Leben verging.
Sie half, den Schiffer zu entkleiden, der nur noch apathisch vor sich hinstarrte und sich nicht rührte. Dann rieb Dr. Calow seinen Körper mit dem Spiritus ein und bearbeitete die marmorblasse Haut mit der Scheuerbürste. Hans reagierte nicht.
«Hier!»
Frau Mater reichte der Hebamme eine zweite Bürste, und Martha tat es dem Arzt gleich. Sie konnte nicht sagen, ob ihm die Behandlung guttat oder ihn quälte. Die Haut blieb trotz der Borsten blass, doch schien er ein wenig kräftiger zu atmen.
«Frau Mater, wir brauchen heißes und kaltes Wasser!», rief Dieffenbach und nahm ihr die Bürste ab.
Martha ging mit der Schifferin und brachte Eimer um Eimer Wasser, während die Männer den Kranken abwechselnd mit kalten und heißen Tüchern abrieben.
«Ich habe keinen Zweifel», sagte Dieffenbach leise. «Der Fall muss gemeldet werden. Machen Sie hier weiter. Madame Vogelsang, würden Sie dem Kollegen Calow bitte helfen?»
Martha nickte. «Und wenn es die ganze Nacht dauert!», versprach sie.
«Gut, dann fahre ich zu Professor Rust. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hat es die Cholera nach Berlin geschafft. Der Fall muss General von Thile gemeldet werden. Er wird den Ausnahmezustand ausrufen.»
Martha schloss die Augen. Sie fürchtete sich vor der Erkenntnis, was dies für sie und alle anderen Berliner bedeuten würde.
Quarantäne, Ausnahmezustand, ein stetig anschwellendes Heer von Kranken, denen keiner helfen konnte, und dann von Toten, die man irgendwo hastig verscharren würde. Würde es erneut vor allem die Armen am Kanal und in den engen Mietskasernen in den Vorstädten treffen? Die Kinder, die Alten und Schwachen? Natürlich! Wie immer. Daran zweifelte sie nicht.
Eine Welle aus Elend, Schmerzen und Tod war im Begriff, über Berlin hinwegzurollen, und sie würde nichts tun können, außer das Schicksal zu beklagen.
Dieffenbach trieb seine Rappen durch die abendlichen Straßen, bis er das Haus in der Wilhelmstraße erreichte, in dem der Geheime Obermedizinalrat Professor Johann Nepomuk Rust wohnte, seines Zeichens nicht nur medizinischer Direktor der Charité und damit Dieffenbachs Vorgesetzter. Er war außerdem Direktor des Gesundheitswesens und somit für die Vorsichtsmaßnahmen verantwortlich, die an den östlichen Grenzen Preußens und rund um die Stadt getroffen worden waren.
Das Haus war hell erleuchtet, und Dieffenbach vernahm Musik. Der Direktor hatte Gäste, doch der Fall war zu wichtig, um darauf Rücksicht nehmen zu können.
Der Kontrast zu dem alten Kahn und seinen Bewohnern, von wo er gerade kam, hätte kaum größer sein können. Vor allem die Luft war hier in der Friedrichstadt viel besser und ließ die Erinnerung an den schrecklichen Gestank in der engen, niederen Kajüte verblassen. Er rief sich dennoch alle Einzelheiten der Erkrankung in Erinnerung. War er zum richtigen Schluss gekommen? War es wirklich die gefährliche asiatische Cholera, die den Schiffer niedergeworfen hatte?
Dies war nicht die erste Seuche, die er erlebte. Dieffenbach dachte mit Grauen an das, was ihnen allen bevorstand. Und doch war das Leid auch eine Herausforderung an seine Fähigkeiten als Arzt. Es stachelte seinen Ehrgeiz und seinen Forscherdrang an. Dieses Mal würde er nicht ruhen. Er würde seine Forschungen weitertreiben und ein Mittel finden, den Menschen zu helfen. Sie würden diese Pest aus Berlin verjagen!
Wann?
Nach wie vielen Opfern?
Er wusste keine Antwort. Zweifel quälten ihn. Hatten nicht schon klügere Köpfe alles versucht und waren gescheitert? Waren die Ärzte den Ursachen der vielen verschiedenen Seuchen und ihrer Heilung in den vergangenen Jahrzehnten auch nur einen Schritt näher gekommen?
«Folgen Sie mir bitte, Herr Dr. Dieffenbach», forderte ihn ein Bediensteter höflich auf, nachdem der Arzt den Türklopfer betätigt hatte.
Dieffenbach ließ sich ins Haus führen. Gewaltige Akkorde, die aus einem Konzertflügel aufstiegen, hüllten ihn ein. Er ließ den Blick über die Zuhörer schweifen, bis er den Hausherrn entdeckte. Rust saß in einem Sessel, in dem seine kleine, korpulente Gestalt fast versank, und nickte mit dem Kopf im Takt. Sein Blick war irgendwo gegen die Decke gerichtet. Der Obermedizinalrat liebte die Musik. So manch aufsteigender Komponist hatte schon an diesem Flügel gesessen, und selbst Paganini hatte diesen Salon mit seiner Geigenmusik erfüllt. Hier trafen Wissenschaftler und Musiker zusammen und natürlich diejenigen, die in der Politik und beim Militär etwas zu sagen hatten.
Für solch einen Abend würde seine Frau Johanna vermutlich ihr Seelenheil geben, kam es Dieffenbach in den Sinn, ehe er Johanna ebenso wie die herrliche Musik rüde aus seinen Gedanken verbannte. Er war nicht zum Vergnügen hier!
Er zögerte, dann trat er an den Sessel, beugte sich vor und flüsterte dem Geheimrat die schreckliche Botschaft ins Ohr.
Rust zuckte zusammen, griff nach der Brille mit den dicken Gläsern und schob sie sich auf die Nase. Aus seinen vom Star getrübten Augen starrte er den unwillkommenen Besucher an.
«Sind Sie ganz sicher?», fragte er leise.
Dieffenbach nickte.
Rust erhob sich und verließ leicht hinkend hinter Dieffenbach den Salon. Er schloss mit der Tür die brausenden Klavierklänge aus. «Lebt der Mann noch?»
«Als ich ihn verlassen habe, ja, doch er glich eher einem Toten.»
Rust legte grübelnd die Stirn in Falten. Einige Momente schwieg er. Dieffenbach konnte sich vorstellen, wie er die möglichen Folgen abwog. Die trüben Augen richteten sich auf seinen zweiten dirigierenden Arzt.
«Fahren Sie zurück und sehen Sie zu, dass der Mann überlebt!»
«Und was werden Sie tun?», wagte der Jüngere zu fragen.
«Ich werde abwarten. Heute Nacht können wir nichts mehr machen.»
Dieffenbach versuchte, sich seinen Unmut nicht anmerken zu lassen. «Verzeihen Sie, Professor Rust, aber sollten wir nicht Sorge dafür tragen, dass keine anderen Personen angesteckt werden?»
Rust kniff die Augen zusammen. «Ah, Sie glauben also auch, dass die Seuche von Mensch zu Mensch übertragen wird und nicht die Folge eines Miasmas ist, das mit seinen giftigen Dämpfen aus dem Kanal aufsteigt, wie viele sagen.»
Dieffenbach stimmte ihm zu. «Gerade deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen, die in den vergangenen Stunden mit dem Schiffer Kontakt hatten, von anderen Menschen ferngehalten werden», drängte er.
«Wir müssen erst einmal sicher sein, dass es sich wirklich um diese asiatische Cholera handelt, ehe wir die Pferde scheu machen und ganz Berlin in Aufruhr versetzen. Was, wenn es ein falscher Alarm ist? Was soll ich dann dem König sagen?»
«Wollen Sie ihm stattdessen erklären, wie sich die Seuche ausbreiten konnte, weil Sie zu spät Maßnahmen ergriffen haben?», konterte Dieffenbach und spürte, dass er zu weit gegangen war. Die Stimme des alten Geheimrats klang eisig.
«Fahren Sie zurück und bringen Sie den Schiffer, ganz gleich, ob er noch lebt oder tot ist, ins Pockenhaus der Charité. Wer sich auf dem Schiff befindet, wird dortbleiben oder ebenfalls mit ins Pockenhaus kommen. Ich schicke einen Schutzmann, der den Kahn bewacht. Und nun muss ich mich wieder um meine Gäste kümmern. Gute Nacht!»
Dieffenbach verbeugte sich kühl vor seinem Vorgesetzten und ließ sich seine Empörung nicht anmerken. Man musste jetzt handeln! Jede Verzögerung konnte sich fatal für die ganze Stadt auswirken, doch es war nicht an ihm, das zu entscheiden. Zornig sah er Rust nach, dann wandte er sich auf dem Absatz um und machte sich auf die Rückfahrt zum Kanal.
Kahn M92 lag dunkel und still im trägen Wasser. Keiner konnte ahnen, welch Drama sich unter Deck abspielte.
Martha und Dr. Calow waren schweißgebadet, doch es wollte ihnen nicht gelingen, die Lebensgeister des kranken Schiffers wieder zu wecken. Seine Haut war von der Farbe und Kälte wie Marmor, sein Atem eisig, der Puls wurde immer schwächer.
Calow gab Frau Mater die Schüssel mit dem kalt gewordenen Wasser.
«Das ist das letzte Stadium», sagte er zu Martha, als die Mutter des Kranken außer Hörweite war. «Ich habe darüber gelesen. Wenn der Puls erlischt, gibt es keine Rettung mehr.»
Martha betrachtete den jungen Schiffer voller Mitgefühl. Sie war kein Arzt, doch auch ohne Medizin studiert zu haben, sah sie, dass der Tod nach dem Elenden griff.
Da richtete sich Hans Mater unvermittelt in seiner Koje auf. Martha zuckte zusammen. «Durst», flüsterte er mit tonloser Stimme.
Ehe sie ihm den Becher mit Kamillentee reichen konnte, schwang er die Beine über den Rand des Bettes und erhob sich schwankend.
«Ein Wunder!», flüsterte Martha. Sie spürte, wie ihr Herz freudig klopfte. Konnte es wirklich wahr sein? Bestand noch Hoffnung?
Doch da fiel der Schiffer dem Arzt in die Arme, der ihn in sein Bett zurückschob. Draußen waren schnelle Schritte zu hören. Die Tür schwang auf, und mit wehend grünem Frack trat Dr. Dieffenbach über die Schwelle.
«Wie sieht es aus?»
Er betrachtete den Kranken, der nun auf der Seite lag. Seine Beine zuckten immer wieder, seine Finger bewegten sich. Calow legte ihm die Hand auf den Leib.
«Er scheint nicht mehr ganz so kalt zu sein.»
«Dann ist er gerettet?», wollte Martha wissen.
Einige Minuten betrachteten sie den zuckenden Körper. Dieffenbach runzelte die Stirn, dann kniete er sich neben die Koje und legte seine Finger an Hans Maters Hals.
«Nichts!», sagte er. Sein Ohr näherte sich Mund und Nase. Er schüttelte den Kopf. «Kein Atem, kein Puls. Er ist tot!»
«Wie kann das sein?», rief Martha. «Sehen Sie nicht seine Hände? Sie bewegen sich doch!»
Die Ärzte nickten, dennoch blieben sie bei ihrer Einschätzung. «Die Cholera ist eine tückische Krankheit. Die Lebenden sehen aus wie Tote, und die Toten scheinen zu leben.»
«Nein!», schrie Frau Mater, die gerade mit einer Schüssel voll heißem Wasser hereinkam. Die Schüssel fiel zu Boden, das Wasser spritzte über die Bohlen. Sie wollte zu ihrem toten Sohn, doch Dieffenbach stellte sich ihr in den Weg.
«Nehmen Sie von hier aus Abschied», sagte er. «Wir wissen nicht, ob nicht von seinem Körper noch immer die Gefahr der Ansteckung ausgeht.»
Calow stieß ein abwehrendes Geräusch aus. «Lassen Sie eine trauernde Mutter Abschied nehmen! Das ist doch absurd. Das Choleragift verbreitet sich durch üble Miasmen, die sich hier irgendwo am Kanal sammeln.»
Das klang einleuchtend und wäre eine Erklärung, warum Seuchen ausgerechnet hier am Kanal in den Häusern der Armen immer am stärksten wüteten, dachte Martha.
Dieffenbach blieb hart. «Das glauben Sie? Und diese Miasmen sind einfach so von Indien nach Russland und dann nach Berlin gewabert?»
Die beiden Ärzte starrten einander an.
Dieffenbach wandte den Blick als Erster ab. «Wir müssen Ihren Sohn mitnehmen», sagte er sanft. «Er wird in der Charité seziert.»
«Lassen Sie mich zu meinem Sohn», bat Frau Mater. «Ich muss bei ihm bleiben und ihn für sein Grab richten. Er muss nach Hause gebracht werden.»
Das Leid der Mutter dauerte sie. Martha trat neben die Schifferin und umarmte sie. «Frau Mater, das ist nicht möglich. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde bei Hans bleiben, bis er seine letzte Ruhe in der Erde finden kann.» Dann wandte sie ihren Blick trotzig in Dieffenbachs Richtung, fest entschlossen, ihr Versprechen zu halten und sich nicht wegschicken zu lassen.
«Na gut», gab dieser schließlich nach. «Frau Vogelsang kommt mit und wird der Sektion beiwohnen.»
Unter Tränen dankte Frau Mater der Hebamme und sah zu, wie die Männer ihren toten Sohn in seine Decke wickelten und von Bord trugen. Sie umarmte Martha an seiner statt und blieb verloren an der Reling stehen, während die Kutsche mit dem Toten, den Ärzten und der Hebamme davonrollte.
Kapitel 2Krankenwärterin Elisabeth
Es war gegen Mitternacht, als Dieffenbach in der Friedrichstadt in die Jägerstraße einbog, wo er mit seiner Frau Johanna in einer großzügigen Wohnung im ersten Stock lebte. Er hatte die Treppe noch nicht hinter sich gebracht, da riss sie bereits die Tür auf. Er brauchte sie nicht anzusehen, um zu wissen, dass ihre Stimmung auf Sturm stand. Die Luft schien wie vor der Entladung eines Gewitters zu flirren.
Dieffenbach ahnte, was gleich kommen würde, und wäre dem Streit gern ausgewichen. Er fühlte sich müde und ausgelaugt und wollte nichts mehr, als sich noch eine Stunde in sein ruhiges Studierzimmer zurückzuziehen, um über diesen Fall nachzudenken. Außerdem wollte er seinem Freund Dr. Georg Friedrich Stromeyer nach Hannover schreiben, der ihm von seiner faszinierenden Operation der Durchschneidung einer Achillessehne berichtet hatte. Zudem ließ der Hunger seinen Magen rumoren. Nur kurz in der Küche vorbeigehen, ein Stück Brot und Käse nehmen und dann die Tür hinter sich schließen.
Doch Johanna verstellte ihm den Weg und blitzte ihn zornig an. «Weißt du, wie spät es ist? Und komm mir nun nicht wieder mit irgendwelchen wichtigen Patienten. Es geht bei dir immer nur um Patienten. Und was ist mit mir? Bin ich nur deine Frau und damit unwichtig?»
«Johanna, es tut mir leid. Es war wirklich ein wichtiger Fall – nicht für mich, für ganz Berlin.»
Johanna wischte diesen Einwand mit einer Handbewegung weg. «Ich habe dir gesagt, dass dies ein bedeutsamer Abend für uns wird.»
«Für dich», wagte er zu widersprechen.
«Für uns», beharrte sie. «Wir haben geschätzte Gäste!»
«Devrient ist da», vermutete Dieffenbach und unterdrückte einen Seufzer. Er kannte die Vorliebe seiner Frau für den Schauspieler, doch seine Abneigung gegen diesen hatte nichts mit Eifersucht zu tun. Dabei war Johanna ganz sicher eine Frau, über deren Treue ein Ehemann sich Gedanken machen sollte. Sie hatte ihren ersten Gatten nicht nur mit Dieffenbach betrogen. Seltsam. Die Zeit, in der er in Bezug auf Johanna so etwas wie Eifersucht empfunden hatte, war irgendwann verflogen.
«Ja, Ludwig ist hier und hat unseren Gästen eine sehr interessante Lesung gehalten», sagte sie mit aggressivem Unterton. «Nur auf meinen Gatten mussten sie wieder einmal verzichten. Unser geschätzter Minister von Humboldt wartet übrigens ungeduldig auf dich!»
«Ehemaliger Minister», korrigierte Dieffenbach.
Johanna machte eine wegwerfende Handbewegung. Das war nicht der springende Punkt!
Obgleich auch Wilhelm von Humboldt zu den verflossenen Liebhabern seiner Frau zählte, mochte ihn Dieffenbach und war gern der Hausarzt der Familie. Ihm hatte er es unter anderem zu verdanken, dass er sich diese teure Wohnung und seine Pferde leisten konnte. Wilhelm von Humboldt wurde nicht müde, ein Loblied auf den Arzt seiner Wahl zu singen und ihm so gut betuchte Patienten für seine Privatpraxis zu verschaffen.
Für einen Moment huschten Erinnerungen an ihre ärmliche erste Wohnung durch Dieffenbachs Geist. An nicht enden wollende Tage mit Patienten, die kaum einen Groschen bezahlen konnten. An Studenten auf Paukböden, denen er abgetrennte Nasenspitzen wieder angenäht oder blutende Schmisse verbunden hatte. Doch obgleich Johanna auch damals schon davon geträumt hatte, einen berühmten Salon in Berlin zu führen so wie Henriette Herz, beispielsweise, oder Rahel Varnhagen, war sie zufriedener gewesen, voller Hoffnung und Zukunftspläne. Und es hatte noch Liebe zwischen ihnen gegeben.
Jetzt verfügte sie über eine großzügige Wohnung und musste nicht mehr sparen. Sie konnte einladen, wen sie wollte, doch ihr Dilemma war, dass die Leute, die zu Besuch kamen, den begnadeten Arzt treffen wollten, der sich allerdings nichts mehr ersehnte, als von seiner Frau ein wenig umsorgt zu werden, um ansonsten in seinem Studierzimmer seine Ruhe zu genießen und an seinen Artikeln oder Büchern zu arbeiten.
War das denn zu viel verlangt?
Dieffenbach sah Johanna an. Das Licht, das schräg über ihr Gesicht fiel, meißelte gnadenlos jede Falte in ihre erschlaffende Haut. Niemand hätte sie je als gutaussehend oder gar schön bezeichnet. Es waren ihre geistreiche Art und ihre anregende Konversation, die Männer anzogen – wenn sie nicht gerade in solch einer Stimmung war wie an diesem Abend. Er hatte sich nie daran gestört, dass seine Frau neun Jahre älter war als er selbst, und obwohl man ihr heute ihre fast fünfzig Jahre ansah, waren es nicht diese Äußerlichkeiten, die sie entzweiten. Dieffenbach sah in diesem Moment nicht seine Liebe, für die er alle Konventionen gebrochen hatte, die sich für ihn hatte scheiden lassen und die mit ihm durch die Welt gereist war, bis er endlich in Berlin praktizieren durfte. Die er gegen alle Widerstände geheiratet hatte.
Er sah nur eine verbitterte Frau.
«Ich werde hineingehen und von Humboldt begrüßen», sagte er und schob sich an ihr vorbei.
Es war noch früh am Morgen, dennoch waberte die Luft stickig durch die Räume des Pockenhauses, ein kleines Gebäude außerhalb der Zollmauer, die das Gelände der königlichen Charité auf der Nord- und der Ostseite umgab. Statt im normalen Totenhaus der Charité innerhalb der Mauer hatte man die Leiche hierhergebracht, und nun lag der tote Hans Mater auf dem Tisch in der Mitte des Raumes.
Martha zog sich in eine Ecke zurück, wo sie keinem im Weg stand und dennoch das Geschehen verfolgen konnte. Sie war fest entschlossen, den Schwur, den sie Frau Mater gegeben hatte, nicht zu brechen und bis zum Ende an der Seite ihres Sohnes zu bleiben. Bisher hatte noch keiner der anwesenden Ärzte versucht, sie hinauszuschicken.
Es wunderte sie nicht, dass Dr. Dieffenbach und Dr. Calow anwesend waren. Außerdem war da noch ein Arzt um die fünfzig in Uniform, den sie nicht kannte. Neben ihm stand ein kleiner, rundlicher Mann im schwarzen Rock mit einer dicken Brille auf der Nase – das musste Geheimrat Professor Rust sein. Obwohl es schon so früh am Morgen unerträglich heiß war, trug er einen dicken, abgetragenen schwarzen Gehrock und eine eng geschlossene Halsbinde, die in eine andere Zeit zu gehören schien.
Die Tür wurde aufgestoßen. Außer Atem stürmte ein junger Mann in Uniform herein. Seine Wangen glühten rot, das Haar stand ihm nach allen Seiten.
Ein hübscher Junge, dachte Martha. Groß, blond und mit wundervoll blauen Augen. Sie schätzte ihn auf dreiundzwanzig oder vierundzwanzig Jahre. So viel junges, ungestümes Leben in einem Raum des Todes. Zum ersten Mal an diesem Tag lächelte sie.
Der junge Mann verbeugte sich und blickte dann hilfesuchend in die Runde, bis sein Blick an den beiden Männern im Hintergrund hängenblieb.
«Professor Rust, Direktor Kluge, ich bin der Pépin Alexander Heydecker, im dritten Jahr der Medizinisch-Chirurgischen Akademie für das Militär und ab dieser Woche als Unterchirurg an die Charité abkommandiert. Ich habe vorhin beim Frühstück von einem Kameraden erfahren, dass Sie hier heute Morgen einen Choleratoten sezieren, und da dachte ich mir, es sei wichtig zu wissen, mit was genau wir es zu tun haben. Ich meine, was auf alle Ärzte in Berlin zukommt, sollte sich der Verdacht bestätigen.»
Er sah um Zustimmung heischend von einem zum andern. «Ich bitte Sie, mich an der Sektion teilhaben zu lassen. Ist der Tote wirklich ein Opfer der asiatischen Cholera?»
«Ein wissbegieriger junger Mann», sagte Direktor Kluge und lächelte. «So wie wir es uns bei unseren Schülern der Pépinière wünschen. Nun, dann treten Sie näher und sagen Sie uns, was Sie sehen.»
Martha überlegte, was sie über die Pépinière wusste. Sie waren vorhin erst an den Gebäuden des Friedrich-Wilhelm-Instituts, wie es seit zwei Jahrzehnten hieß, vorbeigefahren, ein Gebäudekomplex, der sich auf einem dreieckigen Gelände am Südufer der Spree direkt vor der Weidendammer Brücke entlang der Friedrichstraße erstreckte. Die Eleven erhielten hier eine kostenfreie Ausbildung zum Arzt oder Chirurgen, wenn sie bereit waren, acht Jahre Militärdienst zu leisten. Es gab allerdings auch die Möglichkeit, die Ausbildung selbst zu bezahlen, doch Martha hatte gehört, dass dies die Familien die stattliche Summe von mehr als einhundert Taler pro Semester kostete. Neben den jungen Pépins sah man dort auch häufig altgediente Regimentschirurgen und Feldscher, die sich zum höheren medizinischen Dienst weiterbilden lassen konnten. Sie arbeiteten in dieser Zeit als Pensionschirurgen an der Charité, was bedeutete, dass ihr Sold weiterbezahlt wurde.
Martha richtete ihre Aufmerksamkeit wieder der Leiche und den Ärzten rund um den Seziertisch zu. Direktor Kluge gab Dieffenbach und Calow ein Zeichen.
«Meine Herren, beginnen Sie.»
Dieffenbach griff zum Messer und setzte zwei diagonale Schnitte von den Schlüsselbeinen her, die sich über dem Brustbein trafen. Von dort zog er die Klinge gerade bis zum Schambein. Entschlossen öffnete er die Brust und die Bauchhöhle.
«Nun, mein junger Heydecker, was sehen Sie?», forderte der alte Rust den Pépin auf. «Was fällt Ihnen auf?»
«Es ist seltsam. Seine Blutgefäße. Sie sind wie ausgetrocknet. Nirgends auch nur ein wenig Blut zu sehen.»
Calow schnitt die großen Arterien auf und schüttelte den Kopf.
«So etwas habe ich noch nie gesehen», bestätigte Dieffenbach. «Sehen Sie, die Wände sind so hell, als wäre dort niemals Blut geflossen.»
«Die Wände der Venen dagegen sind verklebt», vermeldete Calow. «Eine teigige schwarzrote Masse.»
Martha rückte ein Stück näher, um besser sehen zu können. Auch der Magen des verstorbenen Schiffers war ausgebleicht, die inneren Darmwände waren dagegen entzündlich geschwollen.
Die Ärzte hatten offensichtlich die Protokolle vieler sezierter Opfer gelesen, denn sie waren sich einig: «Die asiatische Cholera hat Hans Mater dahingerafft.»
Aus dem aufgeschnittenen Herzen schöpfte Dr. Calow noch einen Rest dunkel geronnenes Blut und reichte den Becher Professor Rust. Der kniff die Brauen zusammen und drehte das Gefäß hin und her.
«Wenn man das Choleragift aus diesem Blut extrahieren könnte», sagte Dieffenbach. «Wenn man nur wüsste, wie es übertragen wird.»
«Und durch wen er es aufgenommen hat», bestätigte Professor Rust. «Doch ich fürchte, das werden wir schneller erfahren, als uns lieb ist. Er wird nicht das einzige Opfer bleiben.»
«Es gibt keinen einzigen Beweis, dass die Cholera von einem Menschen zum anderen übertragen wird», mischte sich Calow ein. «Sie würden in seinem Blut kein Choleragift finden. Gehen Sie zum Spreekanal! Dort wabert das Miasma über dem Wasser und kann sich jeden greifen, der ihm zu nahe kommt.»
Dieffenbach ergriff die Partei des Geheimrats und betonte, dass – trotz der ergriffenen Maßnahmen an der Grenze – Menschen die Krankheit nach Berlin gebracht hätten und von ihnen auch die Gefahr der Ansteckung ausgehe.
Martha hatte das Gefühl, dass dieser Streit schon lange die Geister unter den Ärzten schied. Was ihn so erbittert werden ließ, war vermutlich die Tatsache, dass keine der beiden Parteien ihre These beweisen konnte.
Dr. Calow nahm Professor Rust den Becher mit dem geronnenen Blut ab. «Der Schiffer hätte sich doch sicher daran erinnert, wenn er mit einem Cholerakranken in Berührung gekommen wäre», beharrte er. «Er hat nichts darüber gesagt!»
«Wir wissen nicht, wie lange vor den ersten Symptomen und wie lange nach dem Tod das Gift im Körper wirksam ist», gab Rust zu bedenken.
Calow wies mit dem Finger auf die Leiche des Schiffers, dessen Körper Dieffenbach nun mit groben Stichen zunähte.
«In diesem Körper gibt es kein Choleragift. Das werde ich Ihnen beweisen!» Noch ehe jemand begriff, was er vorhatte, setzte er den Becher an die Lippen und schluckte das Blut des Toten herunter.
Martha stieß einen Schrei aus, während Dieffenbach die Nadel fallen ließ und dem jungen Kollegen den Becher entriss, aber es war schon zu spät.
«Sie sind ein Narr!», rief Rust und schüttelte den Kopf. «Gehen Sie hin und sterben Sie und denken Sie darüber nach, wie viele Menschen Sie bis dahin anstecken und mit in den Tod nehmen.»
«Er muss in Quarantäne», stieß Dieffenbach hervor. «Das können Sie nicht verantworten.»
«Ich werde mich nur um Cholerakranke kümmern», versprach Calow. «Sie werden schon sehen, dass mir dieses Blut nichts anhaben kann.» Er verbeugte sich und verließ den Raum. Die anderen starrten ihm nach.
«Er war so ein vielversprechender junger Arzt», sagte Dieffenbach, als sei der Kollege bereits tot.
Ein wenig mulmig fühlte sich Elisabeth schon, als sie das Tor durchschritt und auf den großen, dreiflügeligen Bau zuging, der ihr von nun an Arbeitsstätte und Heim sein sollte.
Sie waren zu dritt, die heute ihren Dienst als Krankenwärter beginnen würden. Elisabeth, Linda und Joseph. Elisabeth war mit ihren neunzehn Jahren die Jüngste der drei. Linda war ein paar Jahre älter, und Joseph, ein Witwer, ging auf die vierzig zu. Nachdem er seine Arbeit in der Druckerei verloren hatte und dann auch noch sein einziger Sohn an der Halsbräune oder Diphtherie, wie die feinen Ärzte es nannten, gestorben war, blieb ihm nichts anderes übrig, als diese Arbeit anzunehmen, um nicht als Bettler auf der Straße zu enden.
Eine kleine Gruppe kam ihnen entgegen und ließ Joseph verstummen. Sie alle trugen die gleiche graublaue Kleidung. Die Männer Kittel über Hosen aus dem gleichen Material, die Frauen bis zu den Knöcheln reichende Kleider, die aber ebenso formlos und verwaschen aussahen.
«Kommt mit, man wartet schon auf euch», sagte eine der Wärterinnen.
Unter dem Eingang erwartete sie Generalstabsarzt von Wiebel, der sich den neuen Wärtern vorstellte und sie mit ernster Miene begrüßte. Ein Stück abseits standen drei junge Männer in schmucken Uniformen, die die Neuankömmlinge ungeniert musterten.
Eine Frau im gleichen graublauen Kleid wie die anderen Wärterinnen, die allerdings eine frische weiße Schürze umgebunden hatte, reichte dem Stabsarzt ein Brett, auf dem ein Blatt Papier befestigt war. Ein Mann, der ähnlich wie die Wärter gekleidet war, stand mit einem weiteren Arzt im Hintergrund.
«Joseph Müller, Elisabeth Bergmann und Linda Schmiederer», las der Stabsarzt vor.
Sie traten einer nach dem anderen vor und reichten dem Arzt die Hand.
Als Linda vortrat, hörte Elisabeth die jungen Männer hinter sich kichern. «Was für eine Frau. Ein Albtraum! Die erschreckt die Kranken ja zu Tode, wenn sie zur Tür reinkommt.»
Zorn stieg in Elisabeth hoch. Ja, Linda war ganz sicher nicht hübsch oder auch nur ansehnlich zu nennen. Sie war klein und dick, und ihr rotwangiges Gesicht wurde von Pockennarben entstellt, aber das gab diesen jungen Schnöseln nicht das Recht, so über sie zu reden!
«Die andere sieht dagegen ganz knusprig aus», antwortete ein anderer. «Die würde ich nicht aus meinem Bett schubsen.»
Nun wandte sich Elisabeth um und sah die drei jungen Männer scharf an. Sie wusste nicht, welcher von ihnen gesprochen hatte. Der Mittlere hatte wenigstens den Anstand zu erröten.
Er war groß und blond und hatte die tiefblausten Augen, die sie je gesehen hatte. Er starrte zurück, dann senkte er den Blick. Elisabeth sah die beiden anderen streng an, die erneut leise kicherten, ehe ihr Blick noch einmal zu dem schönen Gesicht mit den blauen Augen zurückkehrte.
Auch der Stabsarzt richtete seine Aufmerksamkeit auf die jungen Männer in ihren blau-roten Uniformen. Er winkte den Mittleren zu sich.
«Heydecker, ich weiß, dass Sie bei den klinischen Übungen schon an manchem Krankenbett der Charité gestanden haben, aber in gewisser Weise ist das heute auch Ihr erster Tag. Also werden Sie sich den neuen Wärtern bei einem Rundgang anschließen. Professor Wolff von der Inneren wird Sie durch alle Abteilungen führen. Dann wird man Ihnen Ihre Zimmer zuweisen.»
Dann stellte er noch das Ehepaar Rother vor, das als Hauseltern in der Charité lebte und die Befehlsgewalt über alle Wärterinnen und Wärter hatte.
«Lassen Sie Ihre Taschen hier in der Halle», sagte die Hausmutter barsch. «Sie können Ihre Sachen später in Ihre Kammer hinaufbringen.»
Elisabeth versuchte, sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern wandte sich dem Arzt zu, der an von Wiebels Seite trat. Auch er trug Uniform.
«Mein Name ist Professor Eduard Wolff. Ich leite die Deutsche Klinik, wie hier alle die Innere Abteilung der Charité nennen, weil ich meine Vorlesungen in Deutsch halte.» Sein Blick richtete sich auf die jungen Männer. «Da die meisten meiner Pépins kein Latein gelernt haben.» Dann forderte er die Gruppe auf, ihm zu folgen, die langen, düsteren Gänge entlang. «Dort hinten am Ende des Südostflügels befinden sich die beiden Krankensäle der Inneren Abteilung der Universität, mit denen Sie nichts zu tun haben werden. Kollege Bartels hält seinen Unterricht übrigens stets in Latein, weshalb wir sie die Lateinische Klinik nennen.»
Professor Wolff führte die beiden neuen Wärterinnen, den Wärter und den jungen Subchirurgen Heydecker zu seinen Krankensälen, in denen die Patienten mit fiebrigen Krankheiten, Atembeschwerden und Geschwüren aller Art lagen. Das Hausmeisterehepaar folgte ihnen mit einigem Abstand.
Weiter ging es in die Chirurgie, die Rust und Dieffenbach betreuten, daneben lagen die Patienten mit Augenkrankheiten von Professor Jüngken.
Elisabeth fiel auf, dass die Betten eng gedrängt nebeneinanderstanden, doch immerhin schien jeder Patient ein eigenes Bett zu haben. Sie waren alle mit den gleichen hellgrauen Laken und Bezügen bedeckt, und auch die Patienten steckten in grauen Kitteln, die die Charité ihnen gab.
«Alle eigenen Kleider und Gegenstände müssen abgegeben werden und werden bis zur Entlassung von Inspektor Hansmann verwahrt», betonte die Hausmutter. «Sehen Sie sich vor. Die Patienten sind um Täuschungen nicht verlegen, um die unmöglichsten Dinge hereinzuschmuggeln!»
Elisabeth ließ den Blick schweifen. Sosehr sich offensichtlich Mühe gegeben wurde, Ordnung und Sauberkeit in den Krankensälen zu halten, so schrecklich war der Gestank. Sie hatte bisher nirgends Bäder entdeckt. An diesen letzten heißen Augusttagen stank es in allen Sälen nach Schweiß und Exkrementen. In der Chirurgischen Abteilung kam ein unerträglicher Dunst aus Eiter und faulendem Fleisch hinzu, der einem den Atem nahm.
Elisabeth beobachtete, wie einer der Assistenzärzte einen Verband vom Bein eines Patienten löste. Der Gestank erhob sich wie eine Wolke von der gelb verfärbten Wunde, deren Ränder eine schwärzliche Farbe angenommen hatten. Ein Wärter reichte dem Doktor Wasser, mit dem er die Wunde auswusch, ehe er sie neu verband. Ein Schwarm Fliegen erhob sich aus einem der Eimer, in die die Patienten ihre Notdurft verrichteten, und ließ sich auf dem mit Eiter durchtränkten Verband nieder.
In diesem Moment betrat eine Frau den Saal und schwenkte einen Topf, aus dem aromatischer Rauch aufstieg.
«Der Rauch reinigt die Luft vom Gift der Krankheiten, die von den Körpern als eine Art Miasma aufsteigen», erklärte Professor Wolff. «Wir wollen verhindern, dass es von einem Patienten zum anderen gelangt und weitere Krankheiten oder gar den gefürchteten Wundbrand hervorruft. Die Räucherfrau geht täglich durch alle Säle.»
Sie besichtigten noch den Operationssaal, in dessen Mitte ein großer Tisch stand und dessen Rückenteil und Beinteile in verschiedenen Lagen fixiert werden konnten. Daneben stand ein Wagen mit diversen Instrumenten, die die Phantasie eines empfindsamen Wesens in Schrecken versetzen mochten. Im Halbrund erhoben sich einige Sitzreihen, von denen aus angehende Ärzte oder Kollegen einer Operation zusehen konnten.
Elisabeth überlief ein Schauder. Die Vorstellung, vor so vielen Leuten auf diesem Tisch festgehalten zu werden, während der Chirurg mit einem scharfen Messer ins Fleisch schnitt oder gar mit einer Säge ein Bein abtrennte, verursachte ihr Übelkeit. Sie war sich nicht sicher, ob sie hoffen sollte, bei Operationen anwesend sein zu dürfen. Andererseits verspürte sie ein Kribbeln der Aufregung, und vielleicht auch unangebrachte Neugier.
«Im Wachzimmer hier nebenan werden die, die eine Operation überstanden haben, versorgt und überwacht, bis sie in ihren Krankensaal zurückverlegt werden», erklärte Professor Wolff. «Hierher verlegen wir aber auch die Sterbenden, für die wir nichts mehr tun können – außer abzuwarten, bis ihr Leiden endgültig vorbei ist.»
Er trat ein und wandte sich an einen Mann im Gewand der Wärter. «Wen haben Sie da, Camille?», erkundigte sich Professor Wolff mit einem Stirnrunzeln und zeigte auf ein Bett, in dem eine Gestalt unter dem Laken zu erahnen war.
Der Wärter hob die Schultern. «Ein Landstreicher vermutlich. Ist heute in den frühen Morgenstunden reingekommen, aber wir wussten nicht, in welchen Saal wir ihn legen sollten. Der Nachtpförtner wollte es nicht entscheiden, und Inspektor Hansmann war noch nicht da.»
«Hat noch keiner der Ärzte ihn begutachtet?»
Camille schüttelte den Kopf. «Die meisten Herren Doktoren sind noch in der Stadt mit ihren eigenen Patienten beschäftigt. Sie kommen vielleicht am Nachmittag. Ich denke, es könnte etwas für Ihre Abteilung sein, Professor Wolff.» Der Wärter trat ans Bett und schlug die Decke zurück. «Oh!» Mit einem Ausruf wich Camille zurück.
Professor Wolff beugte sich über den Mann und tastete nach seinem Hals. «Er ist tot, Camille!», rief er dann, was Elisabeth selbst aus dieser Entfernung sehen konnte. Die Haut war so bleich, dass man keinen einzigen Tropfen Blut mehr in diesem Leib vermutete.
Wolff starrte den Leichnam an. «Laufen Sie, Camille. Holen Sie Professor Rust und Dr. Dieffenbach, wenn einer der Herren schon im Haus ist.»
Elisabeth spürte, wie ein Ärmel sie streifte. Sie sah an der blauen Uniformjacke hinauf zu dem jungen Militärchirurgen, der sich neugierig nach vorne schob.
«Noch ein Choleratoter», murmelte er.
Elisabeth sah ihn streng an. «In Berlin gibt es keine Cholera.»
Alexander Heydecker widersprach. «Doch, seit gestern Nacht gibt es sie. Das werden Professor Rust und Dr. Dieffenbach bestätigen. Und auch, dass dieser Mann ebenfalls an der Cholera gestorben ist.»
Elisabeths Neugierde war geweckt. Woher konnte ausgerechnet dieser junge Subchirurg das wissen, wenn nicht einmal der Leiter der Inneren Abteilung davon erfahren hatte? Sie hätte ihn gerne gefragt, traute sich aber nicht, ihn anzusprechen. Es wunderte sie sowieso, dass sich der Professor überhaupt die Mühe machte, die Neuen durchs Haus zu führen. Sie waren nur Wärter, die weit unter den Ärzten standen.
Professor Wolff drängte die Neuankömmlinge aus dem Raum. «Kommen Sie. Gehen wir nach oben.»
Im Treppenhaus trafen sie auf zwei Ärzte, die beide wichtig aussahen, fand Elisabeth. Vielleicht lag es an ihrer geraden Haltung oder ihrem ernsten Gesichtsausdruck. Der eine trug einen blauen Uniformrock mit den langen Schößen und den goldenen Knöpfen, der andere war in Zivil. Als sich Professor Wolff mit seiner Gruppe näherte, unterbrachen sie ihre Unterhaltung und sahen den Chirurgen fragend an.
«Ich führe unseren Subchirurgen Heydecker und die neuen Wärter durchs Haus», erklärte er bereitwillig und stellte dann den Neuen den Direktor der Charité vor. «Direktor Karl Alexander Kluge war wie Sie, Heydecker, einst ein Pépin und ist heute nicht nur Leiter der Abteilung für Syphilis- und Krätzekranke und unserer Gebärstation. Er ist der erste Arzt der ganzen Charité.»
Elisabeth betrachtete ihn neugierig. Er war ein großer Mann um die fünfzig mit einem ovalen Gesicht und hellbraunem Haar. Wangen und Kinn waren sorgsam rasiert, sein Gesichtsausdruck war offen und freundlich. Im Gegensatz zu manch anderem heute bedachte er alle mit einem Lächeln. Der Mann an seiner Seite war kleiner und schmaler, hatte eine hohe Stirn und dünnes Haar, obgleich er vermutlich erst Mitte dreißig war. Er war ebenfalls glatt rasiert. Seine Augen waren von einem hellen Grau, doch sein Blick hatte eine gewisse Schärfe, die in die Tiefe der Seele zu dringen schien.
«Gestatten: Professor Dr. Karl Wilhelm Ideler, Leiter der Psychiatrischen Abteilung, oder Irrenanstalt, wie die meisten sie nennen», nahm er Professor Wolff die Vorstellung ab.
«Zu Ihnen wollten wir gerade», sagte Wolff. «Ich denke, Wärterin Elisabeth und Wärterin Linda werden bei Ihnen oder in Direktor Kluges Abteilung anfangen.»
Ideler lächelte nun auch. «Am besten, ich nehme Ihnen Ihre Truppe jetzt ab und bringe sie in den oberen Stock hoch, dann können Sie zu Ihren Patienten zurückkehren.»
Professor Wolff verabschiedete sich. Die anderen stiegen die Treppe zu den Sälen im zweiten Stock hinauf. Dr. Ideler zeigte ihnen den Saal mit den Melancholikern, die stumm und starr in ihren Betten lagen, den Raum mit Tobsüchtigen, die von zwei grimmig dreinschauenden Wärtern bewacht wurden, und einige kleine Zimmer, in denen sich zahlende Patienten kurieren lassen konnten. Dann übergab er die Gruppe Direktor Kluge, der sie im dritten Stock in den Saal mit krätzigen Weibern und einen Raum mit anderen Haut- oder Geschlechtskrankheiten führte. Dort saßen einige Frauen auf den Betten, am Boden oder auf Hockern und zupften die Fäden aus in Streifen gerissener Baumwolle und aus Leinenstoffen. Ein großer Haufen alter Stoffe lag vor ihnen auf dem Boden, während die aufgerauten Fasern in Körben gesammelt wurden.
«Die Frauen zupfen Scharpie für unsere Wundverbände, die die Chirurgen nach ihren Operationen benötigen», erklärte Kluge. «Wir müssen sie beschäftigen, sonst gibt es hier Gezänk und Geschrei. Die Frauen vom großen Saal drüben lassen wir auch im Garten beim Jäten helfen, aber diese hier dürfen nicht hinaus.»
Die Frauen kicherten und stießen sich gegenseitig in die Seite. Einige obszöne Bemerkungen flogen hin und her. Eine schöne Frau mit langem schwarzen Haar warf den Kopf in den Nacken und lachte dröhnend.
Jetzt erst sah Elisabeth, dass einige der Frauen Ketten an ihren Fußknöcheln trugen, an denen schwere Holzklötze befestigt waren. Fragend sah sie den Arzt an.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: