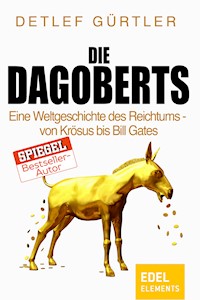Vorwort
Reich sein! Ein Traum! Nie mehr arbeiten müssen, nie mehr nachdenken müssen, ob man sich das, was man haben will, auch leisten kann. All die Last des Lebens von den Schultern gleiten lassen.
Reicher sein! Immer noch reicher sein! Ein Alptraum! Rund um die Uhr arbeiten, immer nachdenken, wie man das, was man haben will, auch bekommen kann. Niemals loslassen können.
Am reichsten sein! Der reichste Mensch der Welt sein! Eine Katastrophe! Denn von nun an kann es nur noch bergab gehen ...
Einfach nur reiche Menschen sind langweilig. Sie haben ihr Vermögen in der Regel damit gemacht, den Leuten das zu bieten, was sie haben wollen. Deshalb lassen sich die Erfolgsgeschichten unserer heutigen Mittelständler genauso austauschen wie die hansischer Kaufleute vor 600 oder römischer Großgrundbesitzer vor 2000 Jahren.
Die reichsten Menschen aber sind spannend – wobei es sich bisher immer um Männer gehandelt hat. Denn sie hatten oder haben ihr Vermögen nicht gemacht, indem sie sich mitten in den Mainstream hineinbegaben, sondern indem sie unbemerkt von ihren Zeitgenossen eine neue Chance, eine neue Technologie, einen neuen Markt erkannten und erschlossen. Wer braucht Herrn Krupps superharten Stahl, wo doch sogar Kanonen seit eh und je aus Bronze gegossen werden? Wie will Mr. Ford mit einem Auto Profit machen, das so billig ist, dass es sich sogar ein Fabrikarbeiter leisten kann? Und wie kann Mr. Murdoch auch nur eine Sekunde daran denken, in London eine Zeitungsdruckerei ohne Gewerkschaften einzurichten?
Sie haben es trotzdem versucht und hatten, aus teilweise ganz unterschiedlichen Gründen, Erfolg. Und sie veränderten damit die Welt, in der sie lebten. Jeder, der sich durch eigene Leistung zu den reichsten Menschen seiner Zeit emporschwang, konnte gar nicht anders, als dabei die Welt zu verändern. Denn er musste etwas besitzen, was außer ihm keiner besaß – und das genau zum richtigen Zeitpunkt. Ein Schriftsteller darf sich damit trösten, dass erst die Nachwelt seine Qualitäten zu würdigen weiß; ein Philosoph muss es wahrscheinlich. Sogar ein erfolgloser Erfinder kann auf die Genialität eines Leonardo da Vinci verweisen, der den Helikopter schon Jahrhunderte vor der Erfindung des dafür nötigen Motors erfand. Wer reich werden will, hat diese Chance nicht: Er muss es zu Lebzeiten schaffen. Ökonomischer Erfolg kann seiner Zeit nicht um Jahrzehnte voraus sein – er muss genau ihren Nerv treffen.
Es drängt sich deshalb geradezu auf, eine ökonomische Weltgeschichte aus der Perspektive der jeweils größten Vermögen einer Epoche zu schreiben – als »Wirtschaftsgeschichte von oben«. Man kann die Entwicklung des ökonomischen und gesellschaftlichen Fortschritts wohl kaum besser erzählen als durch die Geschichten der reichsten Männer aller Zeiten.
Umso erstaunlicher ist es, dass bislang noch niemand diesen Versuch gemacht hat. Aber irgendwann ist immer das erste Mal.
Detlef Gürtler
Marbella, im Juni 2004
Die reichste Ente aller Zeiten
»Ach, lieber Freund! Sie ahnen ja nicht, was man als Krösus leidet! Ich bin der reichste Mann der Welt! Meine Geldspeicher quellen nur so über! Kurz, ich müsste überströmen vor Glück! Aber all mein Reichtum macht mir keine Freude mehr!« Sagte Dagobert Duck zum genialsten Erfinder aller Zeiten, zu Daniel Düsentrieb. Das mit dem »reichsten Mann der Welt« stimmt natürlich nicht, schließlich ist Dagobert auch im feinsten Business-Outfit jederzeit als Ente zu erkennen. Aber den Titel »reichste Ente aller Zeiten« wird ihm niemals jemand streitig machen. »Auf den Kreuzer genau 37 Fantastillionen 119 Trilliarden Taler« zählte er 1983, und selbst wenn der Umrechnungskurs des Entenhausener Talers zum Euro nicht tagesaktuell berechnet wird und auch die Fantastillion in den uns Menschen geläufigen Zahlensystemen nicht vorkommt: Allein schon die 119 Trilliarden Taler sorgen dafür. Selbst wenn man dieses Vermögen gleichmäßig auf alle 6 Milliarden Menschen verteilen würde, blieben für jeden Einzelnen noch 20 Billionen Taler übrig. Geht man entsprechend den aus den Comics bekannten Entenhausener Kaufkraftparitäten davon aus, dass ein Taler etwa einem Dollar entspricht, wäre Dagobert Duck also so reich, dass er allein mit seinem Kleingeld (denn die Fantastillionen rechnen wir nicht mit) jeden Menschen auf der Erde 500-mal reicher als Bill Gates machen könnte! Dass wir es überhaupt wagen können, in einem Buch über die reichsten Lebewesen der Welt noch andere Personen außer Dagobert Duck aufzunehmen, verdanken wir einzig dem Umstand, dass es sich bei Dagobert um eine erfundene Figur, ja, um eine Karikatur handelt.
Es kommt immer wieder vor, dass wir uns anhand von Karikaturen eine historische Figur oder auch eine Situation erschließen. Cäsar kennen
wir so, wie er bei Asterix dargestellt ist, Nero so, wie Peter Ustinov ihn in Quo Vadis verkörperte. Ein geschminkter Bretone, der durch kroatische Karstlandschaften reitet und dabei das humanistische Ideal des Kleinkriminellen Karl May aus Sachsen darstellt, prägt unser Bild des Wilden Westens im 19. Jahrhundert: Pierre Brice als Winnetou. Und unser Bild vom turbokapitalistischen Vollblutunternehmer sieht ziemlich genau so aus, wie jener Zylinder- und Bürzelträger unbestimmbaren, aber hohen Alters aus Entenhausen.
Dabei ist diese Ente von der kapitalistischen Realität etwa so weit entfernt wie Pierre Brice von einem Häuptling der Apachen. Schon Dagoberts Ziehvater Carl Barks hat das eingestanden: »Dagobert ist ein absoluter Feind des kapitalistischen Systems: Er würde es innerhalb eines Jahres zerstören. Er würde alle Vorgänge, die den Kapitalismus ausmachen, einfrieren. Er würde niemals etwas ausgeben, und so würden alle ärmer werden, denn er häuft ihr Geld an, und nach einer gewissen Zeit hätte keiner außer ihm noch Geld. Das wäre das Ende des Kapitalismus.« «
So wie Dagobert wird man niemals Milliardär
Wobei dies bestenfalls die halbe Wahrheit ist. Denn Barks hält seiner Kreatur zugute, sie habe tatsächlich das Zeug, der reichste Mensch der Welt zu werden (wenn sie nicht zufällig eine Ente wäre). Das lässt sich jedoch mit Sicherheit ausschließen: Jemand, der sich verhielte wie Dagobert Duck, könnte niemals zum reichsten Menschen der Welt werden. Er würde irgendwo im Mittelfeld der Multimillionäre hängen bleiben, oder wahrscheinlich sogar schlicht Pleite gehen. Denn:
Dagobert Duck verzettelt sich. Es gibt kein Geschäftsfeld, das er verschmähen würde, wenn es nur genug Geld einbringt. Ob Schatzsuche, Töpferware oder Pfefferminzeis, Hauptsache der Profit stimmt. Das kann in Pionierzeiten eine Zeit lang gut gehen, wenn unzählige Marktnischen geradezu darauf warten, entdeckt zu werden. Es funktioniert nicht mehr in Konsolidierungsphasen, in denen in jedem Markt nur die besten, billigsten, schnellsten, jedenfalls die an die Marktbedingungen am besten angepassten Anbieter überleben. Spätestens da trägt es einen breit aufgestellten Generalisten wie Dagobert aus der Kurve, wenn er sich nicht strikt darauf beschränkt, eine Art finanzielles Controlling zu betreiben und den Rest seinem Management anzuvertrauen. Aber Dagobert muss ja unbedingt alle operativen Entscheidungen selbst treffen.
Praktisch alle Superreichen, denen wir auf unserem Rundgang durch die Weltgeschichte begegnen werden, haben sich beschränkt. Auf ein Produkt, eine Branche, eine Wertschöpfungskette, eine Methode. Wenn sie mit irgendetwas großes Geld verdient haben, sei es nun Software oder das Plündern von Städten, sind sie dabei geblieben. Die permanente Hinwendung zu neuen Herausforderungen, ob besonders spannend, anspruchsvoll oder profitabel, ist eher in Branchen wie Literatur oder Bildende Kunst anzutreffen – in der Ökonomie dagegen nur bei jener Sorte Unternehmer, die noch kein ausreichend profitables Geschäftsfeld gefunden haben und deshalb darauf angewiesen sind, zu experimentieren. Die erfolgreichen hingegen folgen der Maxime Henry Fords: »Es ist besser, alle Kraft einzusetzen, eine Idee zu vervollkommnen, statt anderen, neuen Ideen nachzujagen. Eine gute Idee bietet gerade so viel, als man auf einmal bewältigen kann.«
Dagobert Duck lässt sein Geld nicht arbeiten. Allein die Vorstellung, er müsse aus seinem Geldspeicher Geld wieder herausnehmen, ist ihm ein Gräuel. In sehr begrenztem Umfang fließen Investitionen in Entdeckungsreisen und sonstige Innovationen, aber auch das nur bei kurzfristig zu erwartendem Profit. Der Goldanteil seines Geldspeichervermögens ist dabei immerhin vor Inflation geschützt, bringt darüber hinaus jedoch keine Zinsen ein. Noch schlimmer steht es um das gehortete Bargeld. Es bringt keine Einnahmen, verursacht Sicherungs- und Pflegekosten und unterliegt obendrein noch der Geldentwertung: Bei einem Geldspeicherpegelstand von 20 Metern geht bei einer Inflationsrate von 2 Prozent allein hierdurch jeden Tag 1 Millimeter Kaufkraft verloren!
Dagobert Duck verachtet seine Kunden. Besonders verhängnisvoll ist seine immer wieder durchbrechende Neigung, um eines kurzfristigen finanziellen
Vorteils willen Kundenbeziehungen aufs Spiel zu setzen – sprich: seine Kunden so zu täuschen, dass sie das nächste Mal ihr Geld bei der Konkurrenz lassen. Ein Strip von Carl Barks persönlich schildert ein besonders abschreckendes Beispiel: Dagobert richtet einen kostenlosen Skilift ein, während die Konkurrenz mindestens einen Taler verlangt. An der Bergstation angekommen, müssen die Skiläufer feststellen, dass der Steilhang dort eine Abfahrt unmöglich macht. Und für die Rückfahrt mit dem Lift kassiert Dagobert drei Taler. »Na, einmal und nicht wieder«, sagt völlig zu Recht im letzten Bild einer der um die Abfahrt betrogenen Skifahrer. Wer wie Dagobert seiner Schuhfabrik befiehlt, auf alle Paare eine falsche Schuhgröße zu drucken, nur um mehr Hühneraugensalbe verkaufen zu können, mag damit kurzfristig seinen Profit steigern können. Aber als Schuhunternehmer hat er spätestens übernächste Saison ausgedient – und wenn ihm auch nur ein amerikanischer Verbraucheranwalt auf die Schliche käme, würde vor Gericht ein so verheerendes Strafgeld verhängt, dass sogar ein Fantastillionär daran schwer zu tragen hätte.
Dagobert Duck ist ein Unmensch. Nun gut, Enten sind eben keine Menschen. Und die Regeln für den Umgang mit der eigenen Familie lassen sich auch nur begrenzt verallgemeinern. Aber so, wie Duck mit seinen sonstigen Beschäftigten, vor allem mit seinen Führungskräften, umgeht, kann er schlichtweg nicht zum Herrn über Hunderttausende von Mitarbeitern aufsteigen. Denn dafür bräuchte er Manager, denen er vertrauen kann, die loyal sind und auch in Krisenzeiten zu ihm halten. Doch wenn ein Manager in den Comicstrips auftaucht, dann meist am anderen Ende der Telefonleitung, wenn der Patriarch Duck einen Befehl quakt, der gefälligst ausgeführt werden muss. »Ich möchte, dass alle Gelder, die ich für die nördliche Hemisphäre vorgesehen hatte, auf der südlichen Halbkugel angelegt werden!« – »Aber ...« – »Kein Aber. Wer an meinen Anweisungen etwas auszusetzen hat, fliegt raus!« Bei keinem seiner Mitarbeiter hat man jemals den Eindruck, dass er gerne für Dagobert arbeiten würde: Ein Leuteschinder und Geizkragen, der seinen Mitarbeitern keine Möglichkeit zur Entfaltung ihrer Qualitäten lässt, der alles besser weiß und den ganzen Ruhm und natürlich den ganzen Profit selbst einstreichen möchte, wird üblicherweise weit vor der Milliardärsschwelle von den internen Reibungsverlusten in seiner Organisation gestoppt.
Wenn all diese Eigenschaften Dagobert Duck als real existierenden Superreichen disqualifizieren: Warum verkörpert er seit Jahrzehnten für alle Welt genau diese Personengruppe? Zum einen, weil wir es nicht besser wissen – es ist nun mal schwer zu begreifen, weil der Anschauung widersprechend, dass ein prall gefüllter Geldspeicher eben ein Symbol für Megareichtum ist, sondern eines für Megadummheit. Zum anderen, weil wir es nicht besser wissen wollen – wir argwöhnen gerne und konsequent, dass jeder, der besonders viel Geld hat, dazu gekommen ist, indem er anderen (uns nämlich) etwas weggenommen oder vorenthalten hat.
Zwischen Dienen und Ausbeuten
Dieser Argwohn ist völlig gerechtfertigt, wenn es sich um ein Nullsummenspiel handelt, es also nur darum geht, wie sich eine feststehende Menge an Geld beziehungsweise Gütern unter einer ebenso feststehenden Menge an Menschen aufteilt. Für einen dynamischen Kapitalismus wie den heute fast überall auf der Welt herrschenden gilt dieser Argwohn nicht – zumindest nicht in der Theorie. Der schwedische Radikalliberale Johan Norberg formulierte das jüngst besonders kategorisch: »Die einzige Möglichkeit, auf einem freien Markt reich zu werden, besteht darin, den Menschen etwas zu geben, das sie haben wollen und für das sie freiwillig Geld bezahlen. Etwas vereinfacht könnte man sagen: Je größer die Einkommen der Menschen sind, desto mehr haben sie getan, um anderen das anzubieten, was sie haben wollen. Man kann nur verdienen, indem man dient.«
In der Praxis pendeln gerade die Superreichen der Weltgeschichte irgendwo zwischen den Extremen des Dieners und des Ausbeuters. Denn es können zwar viele Unternehmer gut davon leben, dass sie auf freien Märkten etwas anbieten, wofür die Menschen freiwillig Geld zahlen, aber davon alleine wird niemand Multimilliardär. Dafür muss man schon die Freiheit des Marktes ein wenig einschränken und die Menschen dazu nötigen, etwas mehr als das zu bezahlen, was sie freiwillig zahlen würden. Insofern lässt sich zwar der Ausbeutervorwurf, der in der Figur Dagobert Ducks so manifest ist, dem Kapitalismus als solchem gegenüber nicht aufrechterhalten; aber bei den Reichsten der Reichen schwebt er zumindest als Anfangsverdacht immer im Raum.
Die Faszination, die Dagobert Duck ausübt, leidet jedoch nur wenig unter den Punktabzügen bei den oben aufgeführten Sekundärtugenden eines Multimilliardärs. Denn dafür lebt er umso konsequenter die Primärtugend, die Conditio sine qua non eines Superreichen: den Riecher für Geld. »Mein einziges Interesse ist Geldverdienen«, sagt Dagobert von sich selbst. Seine Verwandten bemerken es lediglich am Glitzern in seinen Augen und an den registrierkassenähnlichen Geräuschen in seinem Kopf, wenn ihr Onkel respektive Großonkel gerade wieder einmal auf eine Profitader gestoßen ist. Denn während Tick, Trick und Track nur genüsslich ein Pfefferminzeis schlecken, rechnet Dagobert sich aus, dass Pfefferminzeis eine Umsatzrendite von exakt 80 Prozent einfährt. »Müller!«, ruft er ins Telefon, »Kaufen Sie unverzüglich sämtliche Eisfabriken im ganzen Land auf. Ich gebe Ihnen drei Minuten Zeit!« Und dann, zu seinen Großneffen: »Heißa, Kinder! Das wird das beste Geschäft meines Lebens! Sobald alle Eisfabriken in meiner Hand sind, sichere ich mir das Monopol für Pfefferminzeis, und die Milliarden träufeln nur so in meine Taschen.«
Der Gedanke an das Pfefferminzeismonopol mag ein wenig abwegig klingen, aber das ist kein wirkliches Problem. Es gab schon ähnlich absonderliche Monopole, zum Beispiel das noch im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts bestehende Zündholzmonopol. Und die meisten Ideen, aus denen sich später ein Multimilliardenvermögen entwickelte, erschienen den Zeitgenossen ähnlich unwahrscheinlich wie uns der Gedanke an ein Monopol für Pfefferminzeis. Alle diese erfolgreichen Unternehmer brauchten, um ihre Ideen in die Tat umzusetzen, eine Eigenschaft, die Dagobert Duck in überreichlichem Maße besitzt: Starrsinn. Und sie brauchten den Willen, die Welt, zumindest einen Teil davon, nach ihren Vorstellungen zu formen. Da sie weder als Politiker noch als Bildhauer reüssierten, sondern als Unternehmer, gehören sie wie Dagobert Duck zu der vom Feuilleton verachteten Spezies, deren Vertreter all ihre Energien für etwas einsetzen, das zu schnöde ist, um ebendieser Ehre wert zu sein.
Männer wollen immer nur das eine: Sex. Männer vom Schlag eines Dagobert Duck wollen immer nur das andere: Geld. Diese nicht nur bei (dem als Disney-Figur zwangsläufig asexuellen) Dagobert beobachtete Verdrängung des Geschlechts- durch den Bereicherungstrieb hat schon diverse vulgär- und regulärpsychologische Interpreten auf die Bühne getrieben. Wir werden uns in diesem Buch wenig bis gar nicht mit solcherart Meinungsbildung unterhalb der Gürtellinie beschäftigen. Da wir der Bedeutung nachspüren wollen, die einzelne Menschen für den Verlauf der Geschichte, in unserem Fall: der Wirtschaftsgeschichte, haben, werden wir ihnen bei der Arbeit über die Schulter schauen und nicht im Schlafzimmer.
Wir könnten sonst am Ende ebenso ins Esoterische abdriften, wie es Dagobert Mitte der Neunzigerjahre passierte. Da ließen ihn die Zeichner mit der ihm sonst völlig zu Recht unerträglichen Gitta Gans im Fernen Osten nach der Formel des Reichtums suchen, die, so das Gerücht, ein alter weiser Mann entdeckt habe. Doch als Dagobert die Formel endlich findet, ist die Enttäuschung groß. Sie heißt nämlich: »Sieh dich um und lerne das, was du siehst, zu lieben. Dann wirst du dich als reichster Mann aller Zeiten fühlen.« Wutentbrannt reist Dagobert ab. Doch der weise Alte sinniert ihm hoffnungsvoll hinterher: »Vielleicht wird auch er eines Tages die Formel des Reichtums verstehen und begreifen, dass der größte Reichtum unserer Welt die Liebe ist.«
Aber dann wäre er nicht Dagobert. Und wir wären im falschen Buch.
Ägypten: der pharaonische Sozialismus
Für Herodot war Ägypten ein Paradies. Ein Bauernparadies. Fasziniert berichtete der berühmteste Historiker der Antike über seine Eindrücke von der Arbeit der ägyptischen Bauern – besser gesagt, von deren Nicht-Arbeit: »Diese Leute bringen die Frucht vom Feld ein mit weit geringerer Mühe als alle anderen Menschen. Sie, die sich nicht zu mühen brauchen, mit dem Pflug Furchen aufzubrechen, nicht zu hacken brauchen. Wenn bei ihnen der Fluss von alleine kommt und die Fluren tränkt und nach dem Tränken wieder zurückweicht, dann besät ein jeder sein Feld und treibt bloß Schweine darauf, ist aber die Saat von diesen Schweinen eingetreten, braucht er nur die Ernte abzuwarten und drischt mit diesen Schweinen sein Korn aus und bringt’s so ein.« Das klingt grandios.
Wir dürfen allerdings vermuten, dass Herodot den Bauern nicht so genau zugeschaut hat. Die meiste Zeit des Jahres mussten sie ihre Felder in mühsamer Schöpfarbeit bewässern; wenn die Arbeit auf den Feldern ruhte, leisteten sie den Frondienst für den Pharao, und alle zwei Jahre kam der Steuerbeamte, um die Abgaben neu festzusetzen. Ein altägyptisches Schulbuch beschrieb das Dasein der Bauern denn auch ganz anders als Herodot: »Der Bauer klagt mehr als ein Perlhuhn, seine Stimme ist lauter als die eines Raben, denn seine Finger sind Geschwüre geworden mit einem Übermaß an Gestank. Wenn man ihn für das Delta zur Fronde registriert und wegtreibt, ist er in Fetzen.«
Auf Schlamm gebaute Hochkultur
Für den Rest der damaligen Welt mussten solche Klagen jedoch nach Jammern auf hohem Niveau klingen. Die Kombination aus Nilüberschwemmung und Bewässerung erlaubte in Ägypten mehrere Ernten pro Jahr, der Pharao ließ seine Untertanen zwar hart arbeiten, aber nicht verhungern, und es kamen auch nicht ständig Soldatentrupps vorbei, um die Dörfer auszuplündern. Genauer gesagt: Es kamen eigentlich nie irgendwelche Truppen vorbei. Gemessen an den regelmäßigen Kriegszuständen im Zweistromland Mesopotamien war das schon ein bisschen paradiesisch.
4500 Jahre nach dem Bau der Pyramiden, 2000 Jahre nach dem Untergang des Ägyptischen Reiches wurde noch einmal versucht, ein Bauernparadies zu schaffen – nur dass diesmal die Arbeiter in den Genuss der gleichen Segnungen kommen sollten. Wären Karl Marx und seine Erben nicht davon überzeugt gewesen, dass die Geschichte sich von Fortschritt zu Fortschritt immer weiter entwickelt (»Vorwärts immer, rückwärts nimmer«, meinte Erich Honecker dazu), hätten sie offen zugeben können, dass sie ihre Ökonomien nach dem Vorbild der pharaonischen Wirtschaftsform konstruierten. Das Experiment ist bekanntlich gescheitert, denn zu seinem Gelingen fehlten ihm die zentralen Voraussetzungen: Für die Existenz eines paradiesischen Zustands auf Erden müssen drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein – die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung, ein natürlicher Schutz gegen äußere Feinde und ein natürlicher Schutz vor ungezügelter Expansion.
Alle drei Bedingungen waren in Ägypten erfüllt. Die Nahrungsmittelversorgung sicherte der Nil mit seinem jährlich wiederkehrenden Hochwasser. Er ermöglichte zudem eine Überschussproduktion, die einen sehr anspruchsvollen Herrscher und große Scharen von Priestern und Beamten mitversorgen konnte. Und für alle Bedürfnisse, die über das physische Überleben hinausgingen, war Ägypten mit auskömmlichen Rohstoffdepots gesegnet, vor allem von Gold, Türkisen und Kupfer. Insbesondere das Kupfer, das im Sinai abgebaut wurde, war eine begehrte Handelsware, benötigten es doch alle Völker zur Herstellung von Bronze.
Den Schutz vor äußeren Feinden übernahm in Ägypten die Wüste, die sich in alle Richtungen rund um die Flussoase des Nils erstreckt. Es gab lediglich eine Achillesferse: den Zugang über das Mittelmeer, via Nilmündung oder Sinai, was alle paar Jahrhunderte den Einfall wilder Barbaren zur Folge hatte, die sich aber sehr schnell assimilierten oder wieder vertrieben wurden. Einer dieser Stämme, die Hyksos, deren Führer sich im 17. Jahrhundert vor Christus zu ägyptischen Königen aufschwangen, holte sich auch noch Fremdarbeiter ins Land – die Israeliten. Als die Ägypter die Besatzer wieder vertrieben hatten, wurde es auch für die zugewanderten Arbeitskräfte ungemütlich. Wie es mit den Israeliten weiterging, steht in der Bibel. Für die Ägypter ging es nach dem Abzug der Fremdlinge weiter wie zuvor.
Auch für den Schutz vor ungezügelter Expansion war der Nil zuständig, der den Ägyptern eine kaum auszudehnende landwirtschaftliche Nutzfläche zugestand. In den Anfangsjahren des Alten Reiches wurden die Nilfluten so weit kanalisiert, dass die bebaubare Fläche bis an die Felswände heranreichte, die das Niltal einfassen. Mehr ging nicht. Die Bewässerungskanäle ermöglichten es, statt einer nun zwei bis drei Ernten im Jahr einzufahren. Und damit waren bereits vor 4600 Jahren die Grenzen des Wachstums erreicht.
In die gleiche stabilisierende Richtung wirkte das damalige Pendant zu unserer heutigen Erbschaftsteuer: ein Totenkult, bei dem ein großer Teil der zu Lebzeiten angesammelten Reichtümer dem Vestorbenen mit ins Grab gelegt beziehungsweise darauf verwendet wurde, dieses Grab zu bauen. Auf diese Weise hielt sich die Anhäufung von Vermögen über die Generationen hinweg stark in Grenzen. Und über die Institution der Grabräuber kamen die Besitztümer, die so dem Zugriff der Erben entzogen worden waren, in etwa genauso effizient wieder in den Wirtschaftskreislauf zurück wie heute die Steuergelder über den Staat.
Ein Gott als Monopolist
Das Ergebnis waren in der Tat nahezu »paradiesische Zustände«: eine über Jahrtausende stabile, träge, auf sich fixierte Gesellschaft, in der nichts passiert, sich nichts bewegt, die Zeit stillzustehen scheint.
Dynamische Elemente, wie sie etwa ein freies Unternehmertum hervorbringen hätte können, gab es nicht. Bei den Ägyptern gehörte praktisch die gesamte Wirtschaft dem Pharao, also Gott. Wie alle Lebensbereiche war auch sie prinzipiell auf das Ziel gerichtet, dem Pharao zu dienen und auf diese Weise die Verbindung zwischen der Sphäre der Götter und der Welt der Menschen zu ermöglichen. Dem Staat unterstanden der Außenhandel, die Bergwerke, große Teile der Produktion und des Bauwesens. Auch die Lohngestaltung entsprach durchaus dem, was im realen Sozialismus des vergangenen Jahrhunderts üblich war: eine Rundumversorgung mit Nahrungsmitteln, Kleidung und Werkzeugen, und dazu eine Art Einheitslohn, um sonstige private Gelüste zu befriedigen. Um 1000 vor Christus bekam ein ägyptischer Arbeiter 1,5 Sack Gerste und vier Sack der Weizenart Emmer pro Monat – ein Schreiber oder ein Vorarbeiter brachten es auf zwei Sack Gerste und 5,5 Sack Emmer.
Es gab zwar Kaufleute, aber sie waren keine Unternehmer, sondern Angestellte des Staates oder eines Tempels. »Reiche Leute zogen Nutzen aus dem Handel, betrachteten ihn aber nicht als Beruf«, schreibt der britische Ägyptologe Barry Kemp. »Die Vorstellung, dass solche Aktivitäten Reichtum und gesellschaftliches Ansehen begründen könnten, war buchstäblich undenkbar für alle, die davon betroffen waren.«
»Mache deine Beamten reich«
Und wer waren dann die reichen Leute im alten Ägypten? Entsprechend den Mitgliedern der Nomenklatura im Sozialismus des 20. Jahrhunderts – die hohen Würdenträger der staatlich-religiösen Bürokratie. Als offizielle Begründung dafür diente das Vorbeugen gegen Korruption, wie sich den Ratschlägen eines Pharaos an seinen Nachfolger entnehmen lässt: »Mache deine Beamten reich, damit sie deine Gesetze ausführen. Denn einer, der in seinem Haushalt reich ist, braucht nicht parteiisch zu sein, denn ein Besitzender ist einer, der keine Not leidet. Einer, der ›Ach, hätte ich doch‹ sagt, ist nicht rechtschaffen. Er ist parteiisch gegenüber demjenigen, den er vorzieht, und er neigt sich dem Herrn seiner Bestechung zu.«
Im Großen funktionierte dieses System: Keiner der ägyptischen Beamten kam jemals auch nur annähernd an den Pharao heran, was seine Reichtümer betraf. Aber ganz ohne Übergriffe auf das Gottes- beziehungsweise Volkseigentum ging es auch in Ägypten nicht ab, wie die Wirtschaftspublizistin Judith Mathes berichtet. Sie zitiert aus der Aussage des Tempelgärtners Kar, der um 1100 vor Christus zugab, die vergoldeten Türpfosten eines Tempels um ein paar Gramm Gold erleichtert zu haben – und damit die Begehrlichkeiten seiner Vorgesetzten weckte: »Einige Tage später zankte Paminu, unser Chef, mit uns, indem er sagte: ›Ihr habt mir nichts gegeben.‹ Also gingen wir noch einmal zu den Türpfosten und entfernten 5 Kite Gold von ihnen. Wir tauschten es gegen einen Ochsen und gaben ihn Paminu. Nun hörte aber der Schreiber der Königlichen Archive Sethmose ein Gerücht davon und drohte uns, indem er sagte: ›Ich werde es dem Hohenpriester des Gottes Amun berichten.‹ Also nahmen wir 3 kite Gold und gaben es dem Schreiber der Königlichen Archive Sethmose. «
Aber das sind nun wirklich Kleinigkeiten. Breiten wir deshalb für diesmal den Mantel des Schweigens über die alten Ägypter. Ihre Lebens- und Umweltbedingungen waren gleichzeitig so außerordentlich und so langweilig, dass der Wunsch, reich, reicher, am reichsten zu werden, dort keine Chance hatte.
Dafür begegnet uns die ägyptische Situation wieder und wieder in der Literatur: als ideale Voraussetzung für ideale Staaten wie Thomas Morus’ Utopia. »Habsucht und Raubgier stammt bei allen Lebewesen aus der Angst vor der Entbehrung«, doziert Morus, also muss man ein Gemeinwesen nur so konstruieren, dass niemand mehr Angst vor Entbehrung zu haben braucht, und die Habsucht verschwindet – natürlich unter der Voraussetzung, dass die benachbarten und die weiter entfernten Gemeinwesen diese Konstruktion auch garantiert respektieren. In Utopia lässt es sich nämlich nur deshalb so sorglos und friedfertig leben, weil kein Cäsar den Weg dorthin findet. Den Weg nach Ägypten fand er, und aus dem ältesten Reich der Welt wurde eine römische Provinz.
Das hervorstechende Merkmal eines solchen staatlichen Paradieses ist also das Fehlen eines äußeren Feindes. Das ist, wie wir noch sehen werden, auch ein auffallendes Merkmal der meisten Unternehmen, die den Dagoberts aller Zeiten den Weg zum fabelhaften Reichtum bahnten. Ins Betriebswirtschaftliche übersetzt heißt »keine äußeren Feinde« nämlich »keine Konkurrenz« oder schlicht »Monopol«. So gesehen fließt der Nil noch heute durch so manche Vorstandsetage in aller Welt.
Rom: die Maden im Speck
Für das über tausend Jahre bestehende Römische Reich fiele es weit schwerer, mildernde Umstände zu finden. Die riesigen Geldsummen, die aus dem ebenso riesigen Reich in die Hauptstadt flossen, wurden verschlungen, verschleudert, bestenfalls verbaut. Die Athener erfanden das Theater, die Römer den Gladiatorenkampf. In Athen wurde beim Gastmahl philosophiert, in Rom kitzelte man sich mit einer Feder das Essen wieder aus dem Magen, um Platz für noch köstlichere, noch erlesenere Speisen zu schaffen.
Aber die Römer brauchen keine mildernden Umstände. Sie haben schließlich nie behauptet, es solle für die unterworfenen Völker und Staaten von Nutzen sein, dass sie all ihre Reichtümer dem Moloch Rom in den Rachen werfen mussten. The winner takes it all – dafür stand eben Rom, die größte Ballung von Reichtum, die es bis dahin gegeben hatte.
Die Landmacht aus dem Wilden Westen
Der entscheidende Faktor für diese Konzentration des Reichtums war die militärische Überlegenheit des Römischen Reiches. Es verfügte über disziplinierte Truppen, eine ausgefeilte Logistik und (nicht immer, aber immer wieder) über brillante Feldherren. Rom konnte sich in den Jahrhunderten nach seiner Gründung 753 vor Christus relativ ungestört von den damaligen Großmächten entwickeln, weil es gleich in zweifacher Weise abseits lag. Es befand sich im ökonomisch wenig interessanten Westteil des Mittelmeers, und dort auch noch auf der ökonomisch uninteressantesten Landmasse: Italien verfügte über wenige Rohstoffe, seinen Bewohnern mangelte es an herausragenden Kulturtechniken. Im mittelmeerischen Warenaustausch hatte es also nichts anzubieten, was exportierbar gewesen wäre, und zog deshalb auch keine beutegierigen Eroberer oder gewinnorientierten Fernhändler an – einzig auf Sizilien und in Süditalien gab es ein paar griechische Kolonialstädte. Und die zweite Abseitsposition: Rom lag nicht am Meer. Es war und wurde keine Seemacht, sondern blieb stets eine bäuerlich-soldatisch geprägte Landmacht. In dem Kulturraum, der sich vor allem entlang den zerklüfteten Küstenstreifen des Mittelmeeres erstreckte, war eine Landmacht von vornherein gegenüber den seefahrenden Mächten der Phönizier und der Griechen hoffnungslos im Hintertreffen, man brauchte sich also nicht um sie zu kümmern. Der Gedanke, dass jemand rund um das Mittelmeer befestigte Straßen anlegen könnte, um auf diesem Weg fremde Völker zu erobern, musste damals absurd erscheinen.
Erst im dritten Jahrhundert vor Christus erreichte Rom erstmals eine Stärke, durch die es für eine der Großmächte zur Gefahr wurde: für Karthago, die Seemacht des westlichen Mittelmeers. In den frühen Seeschlachten des Ersten Punischen Krieges (264 – 241 v. Chr.) waren die Römer der Flotte Karthagos noch hoffnungslos unterlegen, sie konnten aber ab 260 vor Christus ihren Nachteil dadurch wettmachen (und schließlich den Krieg für sich entscheiden), dass sie die Enterbrücke erfanden. Damit ließen sich das eigene und das gegnerische Schiff so fest miteinander verbinden, dass sich der Kampf auf See beinahe wie an Land abspielte.
Nach dem verbissenen, am Ende nur knapp gewonnenen Kampf gegen Karthago profitierte Rom bei seinem Aufstieg zur Weltmacht 100 Jahre später von einem zufälligen Aussetzer der Weltgeschichte: Es gab im östlichen Mittelmeerraum gerade kein starkes und selbstbewusstes Reich, das den Kampf gegen Rom hätte aufnehmen können. 500 Jahre früher gab es die Babylonier, 400 Jahre früher hätten sich die Griechen vehement zur Wehr gesetzt, 300 Jahre früher die Perser, und 200 Jahre früher wäre es sehr spannend gewesen, Alexander den Großen gegen ein römisches Heer kämpfen zu sehen. Aber in den zwei Jahrhunderten vor Christi Geburt laborierte der östliche Mittelmeerraum noch an den Konflikten, die aus der Teilung des alexandrinischen Reiches resultierten, sodass dem Auf marsch aus dem wilden Westen kein adäquater Widerstand entgegengestellt werden konnte: Die Schätze (und nach und nach auch die Weisheiten) des Orients wanderten in die Arme Roms, der neuen Supermacht des Mittelmeers.
Die Umverteilung aus dem Reich in die Hauptstadt Rom ruhte auf drei Säulen:
◇ Raub: Frisch unterworfene Länder wurden geplündert, Teile der Bevölkerung versklavt.
◇ Tribut: Staaten und Städte konnten einer drohenden Zerstörung durch Strafzahlungen entgehen. Die regelmäßigen Abgaben gingen entweder direkt an die Staatskasse oder an den Feldherrn, dessen Heer vor den Toren stand.
◇ Steuern und Abgaben: Hier hatte die römische Republik eine Art Doppelbesteuerungsabkommen entwickelt, das ganz ohne weiteren staatlichen Eingriff dafür sorgte, dass alle Gesellschaftsschichten Roms in den Genuss der Reichtümer des Reiches kamen. Und das sollten wir uns einmal genauer anschauen.
Doppelte Steuern für die Provinz, null Steuern für die Hauptstadt
Die erste Variante des Abgabensystems bestand darin, dass die Steuererhebung auf Steuerpächter übertragen und somit privatisiert wurde. Die Steuerpächter entstammten meist dem Ritterstand, also dem niederen Adel. Sie zahlten an den Staat im Voraus eine festgelegte Pacht und bekamen dafür die zeitlich begrenzte Steuerhoheit für eine Region des Reiches. Je mehr sie also an Steuern aus ihrem Gebiet herauspressten, desto höher wurde der Gewinn. Also pressten sie.
Die zweite Variante begünstigte verblüffenderweise gleichzeitig die oberste Schicht, die Patrizier, und die unterste, die Proletarier. Es war die römische Variante der Demokratie. Die höchsten Ämter in Rom wurden jedes Jahr von der Volksversammlung neu besetzt. Wer Quästor, Ädil, Zensor oder Konsul werden wollte, musste also Wahlkampf führen. Und Wahlkampf in Rom hieß: Brot und Spiele. Gratis-Getreide, Gratis-Öl, Volksfeste und Gladiatorenkämpfe, je mehr, desto besser. Der Staat delegierte also die sozialstaatliche Funktion an die Wahlkämpfer – die sich dafür heillos verschuldeten. Aber im Normalfall nur für kurze Zeit, denn die Gewählten bekamen nach ihrer einjährigen Amtszeit die Verwaltung einer Provinz zugewiesen, um mit den Einnahmen aus dieser Pfründe ihre Schulden abzahlen und ein Vermögen ansammeln zu können.
Sicher, es gab Reibungspunkte im System. Das Nebeneinander von Steuerpächtern und Provinzgouverneuren führte häufig zu Reibereien und Prozessen um den jeweiligen Anteil an der Beute. Ciceros Anklage gegen den sizilischen Gouverneur Verres aus dem Jahr 70 vor Christus malt ein plastisches Bild der damaligen Zustände: Von Diebstahl über Erpressung bis hin zum Mord an Einheimischen und sogar an römischen Bürgern reichte die Liste der Vorwürfe. Und die Wahlverlierer, die auf ihren Schulden sitzen blieben, stellten zumindest für ihre Gläubiger ein Problem dar. Einer von ihnen, Catilina, versuchte sogar einen Staatsstreich, nachdem er zum dritten Mal bei einer Wahl durchgefallen war. Aber insgesamt profitierten doch Staat, Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht Roms von diesem Steuersystem, das für die Römer selbst natürlich nicht galt. Es konnte »so viel Geld in den Staatsschatz überführt werden, dass das Volk [Roms] keine Steuern mehr zu zahlen brauchte«, berichtet Plutarch über diese Zeit. Der Rest des Reiches zahlte die Zeche.
Wenn sich Bewerber für Staatsämter haushoch verschulden, muss ja auch jemand da sein, bei dem sie sich verschulden können. Und weil es noch keine Banken gab, gingen diejenigen, die den Wahlkampf nicht von ihrer Familie bezahlt bekamen, mit ihrem Anliegen zu den reichsten Männern der Stadt, also den reichsten Männern der Welt. Diese Geldelite traf eine Vorentscheidung darüber, wer für die politische Karriere tauglich war. Wer nicht finanziert wurde, konnte auch nicht gewählt werden.
Crassus: Roms skrupellosester Unternehmer
Der berühmteste dieser »Königsmacher« war Marcus Licinius Crassus (etwa 115 – 53 v. Chr.), nach Cäsar und Pompeius wahrscheinlich der drittreichste Mann im republikanischen Rom. Sein Vermögen wurde auf 200 Millionen Sesterze geschätzt. Während die typischen Vermögensquellen – neben der Steuerpacht — Großgrundbesitz (altes Geld) und Mietwucher (neues Geld) waren, entsprang Crassus’ Reichtum aus einer ungewöhnlichen und aus einer einzigartigen Wurzel: aus Proskription und Feuerwehr.
Die Proskription war eine im von Bürgerkriegen geschüttelten Rom des ersten Jahrhunderts vor Christus gelegentlich angewandte Methode der Vermögensumverteilung: Die zwischenzeitlich siegreiche Bürgerkriegspartei erklärt die Anhänger der Gegenseite für vogelfrei, beschlagnahmt deren Vermögen und lässt es unter ihren eigenen Anhängern verteilen oder versteigern. Kurzfristig konnten sich dadurch viele bereichern, nur ging dieser blutbefleckte Reichtum unter Umständen schnell wieder verloren – das Bürgerkriegsglück wechselte hierhin und dorthin.
Der Erfinder dieser Proskriptionen war Marius. Er wandte sie 87 vor Christus gegen die Anhänger seines Rivalen Sulla an, der gerade im Orient den Partherkönig Mithridates bekämpfte. Ein Jahr später starb Marius, und als Sulla 83 vor Christus nach Rom zurückkehrte, drehte er den Spieß um: Täglich fand man auf dem Forum Romanum die Namen der Männer angeschlagen, die gerade für vogelfrei erklärt worden waren. 40 Jahre später, während des Triumvirats von Marcus Antonius, Octavian und Lepidus, wurde die Methode noch ausgefeilter. Die Anhänger Marcus Antonius’ (83 – 30 v. Chr.) proskribierten Anhänger des Mitregenten Octavian (63 v. – 14 n. Chr.), der dafür im gleichen Ausmaß Anhänger Marcus Antonius’ auf die schwarze Liste setzte. Und damit es sich nicht zu sehr lohnte, neutral zu bleiben, gaben beide Seiten nach Belieben vermögende Römer jeglicher oder gar keiner Anschauung zum Abschuss frei – auf diese Weise verlor auch Cicero (106 – 43 v. Chr.) sein Leben. Nur wenige konnten sich damals so sicher fühlen wie Gaius Maecenas, der engste Berater Octavians, der an seinem Hauseingang die Notiz anbrachte, dass er sich jede Störung durch Kopfjäger verbitte, da er nicht proskribiert worden sei.
Mit der Feuerwehr zum Millionär