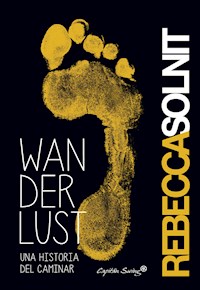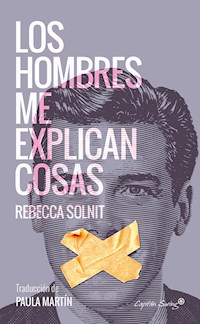10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die USA stecken in der Krise: Spätestens seit dem Wahlerfolg Donald Trumps erhalten wir tagtäglich Beispiele dafür, wie gespalten das Land ist und welch tiefe Gräben Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Gentrifizierung, Klassen- und eine verfehlte Umweltpolitik in die Gesellschaft schlagen. Ob die Anfeindungen Hillary Clintons im Wahlkampf, tödliche Polizeieinsätze, unterdrückte Wählerstimmen, das unsolidarische Ideal des Selfmademans oder die Leugnung des Klimawandels - in aller Deutlichkeit benennt Rebecca Solnit himmelschreiende Missstände des heutigen Amerika. Zugleich erteilt sie der Resignation eine klare Absage und ruft zum Glauben an die eigene Macht und zum Handeln auf, denn: "Hoffnung ist der Glaube daran, dass das, was wir tun, möglicherweise von Belang ist. Das Wissen, dass die Zukunft jetzt noch nicht geschrieben ist."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Rebecca Solnit
Die Dinge beim Namen nennen
Aus dem amerikanischen Englisch von Bettina Münch und Kirsten Riesselmann
Hoffmann und Campe
VorwortPolitik und amerikanische Sprache
Der Klassifikation des Aarne-Thompson-Uther-Index zufolge geht es in einem bestimmten Typus von Volksmärchen immer darum, dass »ein geheimnisvoller oder bedrohlicher Helfer in dem Moment besiegt wird, in dem der Held oder die Heldin seinen Namen herausfindet«. In alter Zeit wussten die Menschen, dass Namen Macht besitzen. Manche wissen das noch immer. Indem wir Dinge bei ihrem wahren Namen nennen, durchbrechen wir die Lügen, mit denen Untätigkeit, Gleichgültigkeit oder Weltfremdheit entschuldigt, abgeschwächt, vertuscht, verdeckt oder umgangen werden oder die sie befördern. Dies ist zwar nicht das alleinige Mittel zur Veränderung der Welt, aber doch ein wesentlicher Schritt.
Wenn es um düstere Themen geht, betrachte ich den Akt des Benennens als eine Art Diagnose. Auch wenn nicht alle diagnostizierten Krankheiten heilbar sind, ist man, sobald man weiß, womit man es zu tun hat, deutlich besser gerüstet, sich entsprechende Gegenmaßnahmen zu überlegen. Recherche, Unterstützung und effektive Behandlung können auf diesen ersten Schritt ebenso folgen wie die Möglichkeit, die Krankheit und ihre Bedeutung neu zu definieren. Sobald man eine Störung benennt, kann man mit der Gruppe der Menschen in Verbindung treten, die davon betroffen ist, oder eine aufbauen. Und manchmal kann das, was diagnostiziert wurde, auch geheilt werden.
Das Benennen ist der erste Schritt des Befreiungsprozesses. Als Rumpelstilzchen seinen wahren Namen ausgesprochen hört, bekommt es einen selbstzerstörerischen Wutanfall, der die Heldin von seiner Erpressung erlöst. Obwohl man allgemein annimmt, Märchen handelten von Verzauberung, ist das Ziel doch häufig die Entzauberung: Flüche werden gebrochen, die Täuschung oder Verwandlung einer Person aufgehoben, die dadurch stumm oder unkenntlich wurde oder ihr menschliches Äußeres verlor. Die Benennung dessen, was Politiker und andere mächtige Führungspersönlichkeiten in aller Heimlichkeit getan haben, führt häufig zu Rücktritten und Veränderungen des Machtgefüges.
Etwas offen zu benennen, bedeutet, das aufzudecken, was brutal oder korrupt sein mag – oder auch wichtig und möglich. Wer die Welt verändern will, muss auch die Begriffe und die Art, wie eine Geschichte erzählt wird, verändern, muss neue Namen, Formulierungen und Redewendungen finden und populär machen. Zu einem Befreiungsprozess gehört auch, neue Bezeichnungen zu prägen oder eher vage Begriffe zu konkretisieren. Inzwischen sprechen wir von Normalisierung, Extraktivismus, unbenutzbaren Kohlenstoffreserven, »Racial Profiling«, »Gaslighting«, der privaten Gefängnisindustrie und »The New Jim Crow«1, positiver Diskriminierung, Cisgender, Konzerncontrolling, von der mit Gegenfragen operierenden Ablenkungstechnik »Whataboutism«, Manosphäre und vielen anderen Schlagwörtern.
Das Ganze funktioniert in beide Richtungen. Man denke nur daran, wie die Trump-Regierung den Begriff der Familienzusammenführung, der sich nach etwas durchaus Positivem anhört, in die dubios und ansteckend klingende »Kettenmigration« verwandelt hat. Erinnern Sie sich, wie die zweite Bush-Regierung den Begriff Folter in »erweiterte Verhörmethoden« umdefinierte und wie viele Presseorgane diesen Begriff übernahmen. Oder denken Sie an die hohle Phrase der Clinton-Regierung vom »Brückenschlag ins einundzwanzigste Jahrhundert«, mit der die schöne neue Welt der technischen Errungenschaften gefeiert werden sollte, die jedoch verschleierte, dass sie uns auch das wirtschaftliche Gefälle und die Räuberbarone des neunzehnten Jahrhunderts zurückbringen würde. Ronald Reagan erfand die Figur der »Wohlfahrtskönigin« (analog den deutschen »Sozialschmarotzern«), eine mythische Gestalt, deren unverdiente Gier die Beschneidung der Zuwendungen für Arme rechtfertigen sollte und dabei die Realität der weitverbreiteten Armut ausblendete.
Es gibt so viele Möglichkeiten, eine Lüge zu erzählen. Man kann lügen, indem man sämtliche Auswirkungen großflächig ignoriert, entscheidende Informationen weglässt oder Ursache und Wirkung entkoppelt; man kann Informationen verfälschen, indem man sie verzerrt oder in ein Missverhältnis setzt, Gewalt beschönigt oder absolut legale Handlungen verunglimpft, sodass Weiße Jugendliche »abhängen«, Schwarze dagegen »herumlungern« oder irgendwo »lauern«. Sprache kann ausradieren und verdrehen, in die falsche Richtung weisen, sie kann falsche Köder auslegen und vom Eigentlichen ablenken. Sie kann Leichen vergraben oder sie hervorholen.
Man kann sich einreden, die Daten über den Klimawandel könnten so oder so interpretiert werden und die Spindoktoren der Unternehmen seien ebenso ernst zu nehmen wie die überwältigende Mehrzahl der Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Man kann es vermeiden, eins und eins zusammenzuzählen, wie es in diesem Land lange Zeit beim Thema Gewalt gegen Frauen geschah, sodass das obszöne Ausmaß der häuslichen Gewalt und sexuellen Übergriffe gegen Frauen zu zahllosen unerheblichen, nicht öffentlich gemachten Einzelfällen wird, die nichts miteinander zu tun haben. Man kann dem Opfer die Schuld geben oder die Geschichte so umdeuten, dass Frauen permanent unehrlich oder wahnhaft sind, statt zuzugeben, dass sie permanent angegriffen werden. Ersteres bestätigt den Status quo, während Letzteres ihn demontiert – was uns daran erinnert, dass es manchmal konstruktiv sein kann, etwas niederzureißen. Es gibt eine Vielzahl von Worten, die Frauen verunglimpfen – zänkisch, schrill, nuttig, hysterisch sind nur einige Beispiele – und nur selten auf Männer angewendet werden; andere Begriffe, wie etwa »rassig« oder »exotisch«, sind eindeutig rassistisch aufgeladen.
Man kann Konflikte erfinden, wo es keine gibt: Eine Politik, die »Klasse gegen Identität« ausspielt, ignoriert, dass wir alle in beide Kategorien gehören und ein Großteil derjenigen, die man der Arbeiterklasse zuordnen mag, auch Frauen und/oder People of Color sind. Der Slogan der Occupy-Wall-Street-Bewegung »We are the 99 percent« bestand auf der Vision einer Gesellschaft, die nicht in verschiedene Klassen aufgeteilt werden muss, in der jedoch das »eine Prozent« – eine Phrase, die sich erhalten hat und inzwischen in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist – gegen den Rest von uns ankämpft.
Präzision, Genauigkeit und Klarheit der Sprache sind von Bedeutung, nicht nur als Gesten des Respekts gegenüber unseren Gesprächspartnern, sondern auch gegenüber dem Thema – gleichgültig, ob es um eine Person oder die Erde selbst geht – und gegenüber der historischen Wahrheit. Darüber hinaus sind sie Ausdruck der Selbstachtung; in vielen alten Kulturen gibt es Redewendungen, in denen es darum geht, ob ein Mensch zu seinem Wort steht, ob er Wort hält oder sein Wort bricht. »Unser Wort ist unsere Waffe« war der Titel einer Sammlung von Schriften des zapatistischen Anführers Subcomandante Marcos. Jemand, dessen Worte unzuverlässig, gelogen, leeres Geschwätz oder heiße Luft sind, ist ein Niemand – ein Windbeutel, ein Schwindler, dem man selbst dann nicht mehr glaubt, wenn er die Wahrheit sagt.
Jedenfalls war es früher so, und genau deshalb ist eine der jetzigen Krisen eine linguistische. Worte verkommen zu einem Brei schwammiger Aussagen. Das Silicon Valley greift zu Phrasen, um sich selbst schönzureden und gleichzeitig seine Agenden voranzutreiben: Sharing Economy, disruptive Innovationen, Konnektivität, Offenheit – und Begriffe wie Überwachungskapitalismus feuern zurück. Der jetzige Präsident der Vereinigten Staaten beleidigt die Sprache selbst mit seinem gelallten, hingeklatschten, halbgaren Wortsalat und seinem Beharren darauf, dass er sich nach Belieben aussuchen kann, was er als Wahrheit und Fakt ansieht, selbst wenn es am Tag davor noch etwas ganz anderes war: Was auch immer er sonst noch damit bedient, er leistet in jedem Fall der Bedeutungslosigkeit Vorschub.
Die Suche nach Bedeutung drückt sich nicht nur darin aus, wie wir unser Leben leben, sondern auch darin, wie wir unser Leben und was uns sonst noch umgibt beschreiben. Es ist, wie ich in einem der folgenden Essays sage: »Sobald wir eine Sache beim Namen nennen, können wir anfangen, uns ernsthaft über unsere Prioritäten und Werte zu unterhalten. Denn der Aufstand gegen Brutalität beginnt mit einem Aufstand gegen die Sprache, die diese Brutalität verdeckt.«
Ermutigung bedeutet im wahrsten Sinne des Wortes Mut zu machen; Desintegration bedeutet den Verlust von Integrität oder Integration. Der sorgfältige und genaue Umgang mit Sprache ist eine Möglichkeit, sich dem Bedeutungsverlust entgegenzustellen, die Gemeinschaft, die man liebt, zu ermutigen und generell Gespräche zu fördern, die Hoffnungen und Visionen säen. In den folgenden Essays habe ich versucht, die Dinge bei ihrem wahren Namen zu nennen.
Achselschmiere
2014
Man kann eine Frau aus der Kirche vertreiben, aber ihr die Kirche austreiben kann man nicht. Das dachte ich jedenfalls, wenn meine vom Glauben abgefallene katholische Mutter durch Eiscreme und Brokkoli ausgelöste Dramen der Versuchung, Sünde und Buße durchlebte oder bei dem Gedanken, etwas falsch gemacht zu haben, vor Angst erstarrte. Sie hatte zwar die Riten und Zelebrationen hinter sich gelassen, aber nicht die Vorstellung, dass Fehler grundsätzlich unverzeihlich sind. Viele von uns glauben an Perfektion, obwohl sie alles ruiniert, denn das Perfekte ist nicht nur der Feind von allem, was gut ist, sondern auch dessen, was realistisch und möglich ist und uns Vergnügen bereitet.
Der strafende Gott meiner Mutter war der Feind von Kojote, dem lüsternen und ewig vom Pech verfolgten Schelm, der mitsamt seinen Vettern in den Mythen der amerikanischen Ureinwohner als unberechenbarer Schöpfer der Welt gilt. Sie verhalfen mir zu einer Vorstellung von dieser Welt als etwas, das ganz und gar nicht perfekt, sondern durch Ränke und Zänkereien entstanden ist. Als der Konzeptkünstler Lewis DeSoto, dessen Vater zum Stamm der Cahuilla gehörte, mich vor einem Vierteljahrhundert bat, über seine Arbeit zu schreiben, gab er mir dafür die Kopie einer Version der Entstehungsgeschichte der Cahuilla, die jemand nach mündlicher Überlieferung aufgezeichnet hatte. Die Cahuilla waren einer der zahllosen kleineren Stämme, die einst das riesige Gebiet des heutigen Kaliforniens bevölkerten. Sie lebten im Westen der Mojave-Wüste, und in der Geschichte, die Lewis mir schickte, beginnt die Welt mit Dunkelheit und »wunderschönen, entrückten Klängen – Klängen, wie sie von fernen Sängern kommen mochten«. Dann heißt es – der biblischen Schöpfungsgeschichte nicht unähnlich: »Und die Erde war leer und ohne Form; und Dunkelheit lag über dem Antlitz der Tiefe«, bis sich die mütterliche Dunkelheit zu gebären bemüht, was ihr zwei Mal misslingt, ehe sie Zwillingsbrüder gebiert, die in ständigem Streit darüber aufwachsen, wer als Erster auf die Welt kam.
Während sie die Welt und alles, was in ihr ist, gestalten, streiten sich die beiden darüber, ob es auch Krankheit und Tod geben soll. Der siegreiche Bruder fürchtet eine Überbevölkerung. Der Verlierer verlässt beleidigt die Erde und vergisst in seiner Eile einige seiner Schöpfungen, darunter auch Kojoten, Palmen und Fliegen. Der verbliebene Bruder wird zu einem Problemfall; er stellt seiner Tochter, dem Mond, nach; versieht Klapperschlangen mit giftigen Reißzähnen und stattet Menschen mit Waffen aus, die sie später aufeinander richten, sodass seine Schöpfungen darüber nachdenken, wie sie ihn beseitigen können. Niemand ist uneingeschränkt gut, und das fängt bei den Göttern an.
Der Stamm der Ohlone aus der Bay Area von San Francisco, wo ich wohne, sieht im Kojoten das Urwesen, das zusammen mit Adler und Kolibri die Erde schuf. Letzterer macht sich über Kojotes Versuche lustig, herauszufinden, wie genau er seine Frau schwängern kann. (Er ist nicht immer so naiv. In den Geschichten der Winnebago von den Großen Seen schickt Kojote seinen abnehmbaren Penis auf lange heimliche Penetrationsausflüge, wie eine Drohne aus der Traumzeit.) Der kalifornische Dichter Gary Snyder formulierte es einmal so: »Der alte Doktor Kojote … ist nicht geneigt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.« Aber er besitzt eine ansteckende Ausgelassenheit und große kreative Kraft. In einem anderen kalifornischen Entstehungsmythos streiten sich die Götter über die Fortpflanzung: Einer postuliert, ein Mann und eine Frau sollten nachts einen Stock zwischen sich legen, der sich beim Aufwachen am nächsten Tag in ein Baby verwandelt hat. Ein anderer findet, zum Kindermachen sollten auch jede Menge nächtliches Geschmuse und Lachen gehören.
Diese raffinierten Geschichten, ohne Scheu vor Improvisation, Versagen und Sex, erinnern mich an Jazz. Im Gegensatz zu ihnen ist der Schöpfer des Alten Testaments ein tyrannischer Komponist, dessen Partitur nur auf eine einzige Weise richtig gespielt werden kann. Wir wurden vom Engel mit dem Flammenschwert aus dem Garten Eden vertrieben, weil wir mit Schlangen geredet und uns für die falsche Obstsorte entschieden haben. Alles, was danach kam, war körperliche Qual und ein Fluch. Buße war gefordert, weil Perfektion das Maß aller Dinge war. An das nichts heranreicht.
Fast alle, die von der biblischen Schöpfungsgeschichte geprägt wurden, und das ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, glauben an irgendeine Version des Sündenfalls. Selbst viele weltliche Geschichten beruhen häufig auf dieser Struktur. Bei den Konservativen kommt das Paradies vor dem Fall – üblicherweise mit starken Vätern und sittsamen Ehefrauen und ohne irgendwelche nicht-heterosexuellen Menschen –, aber auch Liberale haben ihre Geschichten über Zeiten, in denen es noch keine Korruption gab, dafür aber matriarchale Gemeinschaften, Paläo-Diäten und handgefertigtes Allerlei, vom Käse bis zum Klappstuhl. Doch wenn man sich vom Konzept der Sünde verabschiedet, erübrigt sich auch der Fall. Und man kann anfangen, sich an Dingen zu erfreuen, die einfach nur ziemlich gut sind.
Dem nordkalifornischen Stamm der Pomo zufolge entstand die Welt aus der Achselschmiere des Schöpfers, die dieser zu einer Kugel rollte. Und nach den Maidu, die hauptsächlich in den Bergen der Sierra Nevada leben, entstand sie aus dem Dreck unter den Krallen einer Schildkröte, den diese am Grund der Ursuppe zusammengekratzt hatte.
Diese alten Mythen sind nicht die Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin, doch sie laden dazu ein, genau diese noch einmal zu überdenken. Wenn das Perfekte der Feind des Guten ist, dann ist das Unvollkommene vielleicht sein Freund.
1Wahlkatastrophen
Die Einsamkeit des Donald Trump
2017
Es war einmal ein Kind, das reich geboren wurde und dem es an nichts mangelte, doch der Knabe war besessen von einer abgrundtiefen, grenzenlosen alles an sich reißenden Raffgier. Er wollte mehr und bekam mehr, wollte noch mehr und bekam noch mehr. Er war ein gezacktes oranges Scherenpaar, das pausenlos über den Meeresgrund trippelt, hinlangt und stiehlt, eine Aaskrabbe, ein Hummer und kochender Hummertopf zugleich, eine Termite, ein tyrannischer Herrscher über seine eigene kleine Welt. Am Anfang profitierte er von dem Reichtum, der ihm vermacht worden war, dann bewegte er sich unter Gaunern und Gangstern, die ihm nichts übel nahmen, solange er ihnen von Nutzen war; es könnte auch sein, dass Nachsicht herrscht in Kreisen, in denen Menschen untereinander loyal sind, bis sie betrügen oder selbst betrogen werden und sich nicht mehr an Gesetze und die Bibel halten. Sieben Jahrzehnte lang stillte er also seine Gier und nutzte seine Lizenz zu lügen und zu betrügen, zu stehlen und ehrliche Menschen um ihren Lohn zu prellen. Er setzte Dinge in den Sand, kümmerte sich nicht darum, griff nach der nächsten goldenen Kugel und ließ Trümmerhaufen hinter sich zurück.
Er galt als großer Macher, doch vor allem war er ein Zerstörer. Er legte sich Gebäude, Frauen und Firmen zu, behandelte alle auf die gleiche Weise, lobte sie in den Himmel und stieß sie wieder ab, geriet in Pleiten und Scheidungen, sprang von Prozess zu Prozess wie einst die Flößer über ihre Baumstämme, wenn sie den Fluss hinunter zum Sägewerk trieben. Doch solange er sich in der Unterwelt der Geschäftemacher bewegte, waren die Regeln flexibel, ihre Durchsetzung noch flexibler, und er ging nicht baden. Doch er war unersättlich, er wollte mehr, also pokerte er darum, der mächtigste Mann der Welt zu werden, und gewann, ohne Gespür für das, was er sich gewünscht hatte.
Wenn ich an ihn denke, fällt mir Puschkins Nacherzählung des alten Märchens vom Fischer und seiner Frau ein. Ein goldener Fisch, der sich im Netz eines alten Fischers verfangen hatte, versprach dem alten Mann, seine Wünsche zu erfüllen, wenn er den Fisch dafür ins Meer zurückwarf. Der Fischer bat um nichts, erzählte jedoch seiner Frau später von der Begegnung mit dem Zauberwesen. Die Frau schickte den Ehemann zurück, damit er um einen neuen Waschtrog für sie bitte. Dann ein zweites Mal, damit der Fisch ihre Erdhütte durch ein richtiges Haus ersetze, und ihre Wünsche wurden Mal um Mal erfüllt. Doch die Frau war eitel und gierig und schickte ihren Mann wiederum aus, den Fisch zu bitten, sie in eine Edelfrau mit einem Herrenhaus und Dienerschaft zu verwandeln, die sie anschließend schlug. Dann schickte sie ihren Mann wieder aus. Hin- und hergerissen zwischen seiner Scham und der Unersättlichkeit seiner Frau bat der alte Mann den Fisch um Gnade. Seine Frau wurde Zarin und ließ den Ehemann von ihren Edelleuten und Bojaren aus dem Palast werfen. Man könnte im Ehemann auch das Gewissen sehen – das Bewusstsein für andere und sich selbst im Verhältnis zu anderen –, während die Ehefrau für die Gier steht.
Am Ende verlangte sie, zur Herrscherin über das Meer und den goldenen Fisch zu werden. Und der alte Mann kehrte an den Strand zurück, um dem Fisch von den jüngsten Wünschen zu erzählen – und ihm sein Leid zu klagen. Diesmal antwortete der Fisch nicht mehr, er schlug lediglich mit der Schwanzflosse, und als sich der alte Mann umdrehte, sah er seine Frau mit ihrem zerbrochenen Waschtrog vor der alten Erdhütte sitzen.
Es ist gefährlich, die Dinge zu übertreiben, sagt uns diese russische Geschichte; genug ist genug. Und zu viel ist Nichts.
Der Knabe, der zum mächtigsten Mann der Welt wurde, oder zumindest die Immobilie bewohnte, die schon von einer ganzen Reihe mächtiger Männer bewohnt worden war, hatte zuvor ein Familienunternehmen geleitet. Dann spielte er die Hauptrolle in einer Unreality-Show, die auf der Fiktion beruhte, er sei keine Witzfigur, sondern ein würdiger Vertreter des Großkapitals, und jede dieser Stationen war ein Spiegelkabinett, dazu da, seinem Selbstgefühl zu schmeicheln, dem einzigen Konstrukt, an dem er immer weiter baute und von dem er nie abließ.
Ich bin schon oft Männern begegnet (und selten, wenn auch mehr als einmal einer Frau), die so mächtig geworden waren, dass es niemanden mehr gab, der ihnen sagte, wenn sie sich grausam, falsch, töricht, absurd oder abstoßend verhielten. Am Ende gibt es in der Welt dieser Menschen nur noch sie allein, denn wer nicht bereit ist zu erfahren, wie sich andere Menschen fühlen und was sie brauchen, der ist auch nicht bereit, die Existenz anderer Menschen anzuerkennen. So ist es um die Einsamkeit an der Spitze bestellt. Es ist, als lebten diese kleingeistigen Tyrannen in einer Welt ohne Spiegel, ohne Mitmenschen, ohne Anker – abgeschirmt von den Folgen ihres Tuns.
»Sie waren leichtfertige Menschen«, steht in F. Scott Fitzgeralds Der große Gatsby über das reiche Paar im Zentrum seines Romans. »Sie zerstörten Dinge und Lebewesen, und dann zogen sie sich wieder in ihr Geld oder ihre grenzenlose Leichtfertigkeit zurück oder was immer es war, das sie zusammenhielt, und ließen andere das Chaos beseitigen, das sie angerichtet hatten.« Manche von uns sind von zerstörerischen Menschen umgeben, die uns einreden, wir wären wertlos, obwohl wir unendlich wertvoll sind, wir wären dumm, obwohl wir klug sind, wir wären Versager, selbst wenn wir Erfolg haben. Doch das Gegenteil von Menschen, die uns herabziehen, sind nicht jene, die uns auf einen Sockel stellen und uns Honig um den Bart schmieren. Es sind Gleichgestellte, die großmütig sind, ohne uns aus der Verantwortung zu entlassen, Spiegel, die uns zeigen, wer wir sind und was wir tun.
Indem wir aufeinander reagieren, uns gegen Gemeinheit und Falschheit wehren und verlangen, dass die Menschen, mit denen wir zusammen sind, uns respektvoll zuhören und antworten – so wie wir es selbst tun, wenn es uns zugestanden wird und wir geschätzt werden –, sorgen wir gegenseitig dafür, dass wir ehrlich und gut bleiben. Es gibt eine Demokratie des sozialen Diskurses, durch die wir gewahr werden, dass nicht nur wir selbst, sondern auch andere Begierden, Gefühle und Ängste verspüren. In der Occupy-Wall-Street-Bewegung engagierte sich eine alte Frau, an deren Worte ich immer wieder denken muss. Sie sagte: »Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der alle wichtig sind.« Genauso sähe eine Demokratie aus, die nicht nur eine wirtschaftliche und politische ist, sondern auch eine Demokratie des Geistes und des Herzens.
Seit Trumps Sieg ist Hannah Arendt in beunruhigendem Maße aktuell geworden; ihre Bücher verkaufen sich gut, vor allem Elemente und Ursprünge der totalen Herrschaft. In der Radiosendung On Being verwies Lyndsey Stonebridge im Gespräch mit der Moderatorin Krista Tippett auf die Bedeutung eines inneren Dialogs mit sich selbst bei Arendt, eines kritischen »Sich-in-Zwei-Spalten[s]«, mit dem man sich selbst erforscht – als echtes Gespräch zwischen dem Fischer und seiner Frau sozusagen. »Leute, die das vermögen, sind dann auch in der Lage, mit anderen Menschen Gespräche zu führen und mit ihnen zu einem Urteil zu gelangen«, schloss sie. »Was [Arendt] die ›Banalität des Bösen‹ nannte, war die Unfähigkeit, eine andere Stimme zu hören, die Unfähigkeit, mit sich selbst ins Gespräch zu kommen oder die Phantasie aufzubringen, mit der Welt, der moralischen Welt, in einen Dialog zu treten.«
Manche Menschen nutzen ihre Macht, um diesen Dialog zum Verstummen zu bringen, und leben in der Leere ihrer sich zunehmend verschlechternden und immer abwegiger werdenden Wahrnehmung von sich selbst und ihrer Bedeutung. Es ist, als verlöre man auf einer einsamen Insel den Verstand, allerdings mit Schleimern und Zimmerservice. Als hätte man einen gehorsamen Kompass, der den Norden immer dort anzeigt, wo man ihn gerade haben will. Ob man der Tyrann einer Familie, einer kleinen Firma, eines riesigen Unternehmens oder gar der Tyrann einer ganzen Nation ist – Macht korrumpiert, und absolute Macht korrumpiert häufig das Bewusstsein jener, die sie innehaben. Oder sie reduziert es: Narzissten, Soziopathen und Egomanen sind Menschen, für die andere nicht existieren.
Ein Bewusstsein für uns selbst und andere gewinnen wir durch Rückschläge und Schwierigkeiten. Durch sie gewöhnen wir uns daran, dass sich die Welt nicht immer nur um uns dreht. Menschen, die damit nicht umgehen müssen, sind zerbrechlich, schwach und unfähig, Widerspruch zu ertragen, weil sie von der Notwendigkeit durchdrungen sind, stets zu bekommen, was sie wollen. Die reichen Studenten, mit denen ich im College zu tun hatte, schlugen dort über die Stränge, als wären sie auf der Suche nach Wänden, die ihnen Grenzen setzen. Sie sprangen von ihren ererbten Höhen, als wünschten sie sich Schwerkraft, die sie auf dem Boden aufschlagen ließe, doch ihre Eltern und ihre Privilegien warfen immer wieder Sicherheitsnetze und Aufprallkissen aus, sie polsterten die Wände und sammelten die Scherben auf, sodass alles, was die Studenten taten, bedeutungslos wurde, im wahrsten Sinne des Wortes folgenlos. Sie trieben dahin wie Astronauten im Weltraum.
Ebenbürtigkeit lässt uns ehrlich bleiben. Es sind Gleichrangige, die uns daran erinnern, wer wir sind und wie wir uns verhalten, die im persönlichen Bereich also das übernehmen, was eine freie Presse in einer funktionierenden Gesellschaft leistet. Ungleichheit schafft Lügner und Täuschung. Die Machtlosen werden gezwungen zu heucheln – so kamen Sklaven, Diener und Frauen in den Ruf, verlogen zu sein –, und die Mächtigen verblöden durch die Lügen, die sie ihren Untergebenen abverlangen, und durch ihr mangelndes Bedürfnis, etwas über andere zu erfahren, die nichts darstellen, nicht von Bedeutung sind und zum Verstummen gebracht oder darauf getrimmt wurden, gefällig zu sein. Deshalb gehören Privilegiertheit und Weltfremdheit für mich zusammen; Weltfremdheit ist die privilegierte Form des Mangels. Wenn wir andere nicht hören, werden sie für uns unwirklich, und wir bleiben in der Ödnis einer Welt zurück, in der es nur noch uns gibt. Das löst mit Sicherheit ein Mangelgefühl aus, nur weiß eine Person, die sich nicht mehr vorstellen kann, dass auch andere auf eine wahre, echte Art existieren, nicht, woran es ihr mangelt. Für dieses Bedürfnis nach ebenbürtigem Kontakt fehlt uns die Sprache, zumindest sind wir nicht daran gewöhnt, darüber zu sprechen.
Ein Mann wollte der mächtigste Mann der Welt werden und durch Zufall, Einmischung und eine Reihe von Katastrophen wurde ihm sein Wunsch gewährt. Gewiss hatte er sich vorgestellt, dass mehr Macht auch mehr Schmeicheleien und ein höheres Ansehen, also einen noch größeren Spiegelsaal bedeuten würde, um seine Großartigkeit widerzuspiegeln. Doch er verwechselte Macht mit Prominenz. Dieser Mann hatte Freunde und Bekannte malträtiert, Ehefrauen und Angestellte, und er malträtierte Fakten und Wahrheiten, indem er darauf bestand, dass er bedeutender sei als die Wahrheit, dass selbst sie sich seinem Willen zu beugen habe. Das tat sie nicht, aber von ihm malträtierte Menschen taten so als ob. Vielleicht war er auch bloß ein Verkäufer, der einen Spruch nach dem anderen heraushaute, nur um ihn wieder zu vergessen, sobald er ihn ausgespuckt hatte. Ein hungriges Gespenst giert immer nach dem Nächsten, nie nach dem, was es schon bekommen hat.
Dieser Mann bildete sich ein, die Macht würde sich in ihn einbetten und ihn groß machen, so wie Midas’ Berührung alles in Gold verwandelte. Doch die Macht der Präsidentschaft war, was sie schon immer war: ein System von Beziehungen, eine Macht, die von der Bereitschaft der Menschen abhängt, die Befehle des Präsidenten auszuführen; und diese Bereitschaft wiederum speist sich aus dem Respekt des Präsidenten für das Gesetz, die Wahrheit und das Volk. Ein Mann, dessen Befehle nicht befolgt werden, stellt seine Machtlosigkeit zur Schau wie dreckige Wäsche auf der Leine. Einen Tag vor dem Amtsantritt dieses Präsidenten verkündete einer seiner Lakaien, die Macht des Präsidenten sei substanziell und könne nicht infrage gestellt werden. Es gibt Tyrannen, die ihre Untertanen durch eine solche Aussage mit Furcht erfüllen können, weil sie zuvor genug Furcht verbreitet haben.
Ein wahrer Tyrann braucht keine Machtbündnisse, er erteilt Befehle, die von Gaunern, Schlägern, Stasi- und SS-Leuten oder Todesschwadronen ausgeführt werden. Ein echter Tyrann hat die Regierung sich selbst unterstellt und auf sich persönlich eingeschworen statt auf die Gesetze und Ideale des Landes. Dieser Möchtegern-Tyrann hingegen verstand nicht, dass er sich innerhalb eines Systems bewegte, in dem viele von jenen, die für die Regierung arbeiteten – vielleicht sogar die meisten, abgesehen von seinen Parteigenossen in der Legislative –, sich Recht und Moral verpflichtet fühlten und nicht ihm. Als der Trump-Mitarbeiter Stephen Miller erklärte, der Präsident könnte nicht infrage gestellt werden, lachten wir ihn aus. Wie Höflinge bestellte der Präsident die führenden Köpfe des FBI und der NSA sowie den Direktor der Nachrichtendienste und seinen eigenen Rechtsberater zu sich, um ihnen aufzutragen, Beweise zu unterdrücken und Untersuchungen einzustellen, doch er musste feststellen, dass ihre Treue nicht ihm galt. Zu seiner Verbitterung stellte sich heraus, dass wir immer noch so etwas wie eine Republik sind und er die freie Presse nicht ganz so einfach aufhalten kann; die Öffentlichkeit lässt sich nicht einschüchtern und überschüttet ihn bei jeder Gelegenheit mit bitterem Spott.
Ein wahrer Tyrann sitzt jenseits des Meeres, im Land von Puschkin. Er manipuliert Wahlen in seinem Land, eliminiert seine Feinde (besonders Journalisten) durch Kugeln, Gift und mysteriöse Todesfälle, die wie Unfälle aussehen sollen, er verbreitet Angst und malträtiert die Wahrheit erfolgreich und strategisch. Doch auch er übernahm sich mit seiner Einflussnahme auf die amerikanische Präsidentenwahl, und das, was seinem Wunsch nach unbemerkt hätte bleiben sollen, sorgte dafür, dass die ganze Welt ihn, seine Taten und seine Vergangenheit unter die Lupe nahm und darauf mit Sorge und sogar Zorn reagierte. Möglicherweise hat Russland durch seine Einflussnahmen auf die amerikanischen und europäischen Wahlen alles verspielt, was es je an Ansehen und Vertrauen besaß.
Die Befehle der amerikanischen Witzfigur wurden missachtet, seine Geheimnisse sickerten in einem solchen Ausmaß durch, dass sein Büro den Brunnen von Versailles glich, vielleicht auch nur einem einfachen Sieb. Kurz nach seinem Amtsantritt wurde in der Washington Post ein bemerkenswerter Artikel veröffentlicht, der sich aus dreißig anonymen Quellen speiste. Seine Agenda wurde unterlaufen, selbst von einer Minderheitspartei, die eigentlich über keine sonderliche Macht verfügen sollte; die Gerichte hoben seine Dekrete immer wieder auf, und ein Skandal jagte den nächsten. In noch nie da gewesenem Ausmaß übten sich die Bürger*innen der Vereinigten Staaten in verschiedensten Arten des Widerstands, innerhalb und außerhalb des wahlpolitischen Geschehens. Der Diktator der kleinen halbseidenen Schönheitswettbewerbe, der Kasinos, Luxuswohnungen und Scheinuniversitäten, die Scheinbildung gegen echte Schulden anboten, der scheinbaren Reality-Shows, in denen er sich zum Herrn über die Scheinschicksale anderer aufspielte, ein Gebieter über Wert und Bedeutung, wurde zum Narren des Schicksals.
Er ist der meistverspottete Mensch der Welt. Nach dem Marsch der Frauen, am 21. Januar 2017, scherzten die Leute, noch nie sei ein Mann an einem einzigen Tag von mehr Frauen zurückgewiesen worden; er wurde im Fernsehen, in Zeitungen, in Karikaturen und von fremden Staatsoberhäuptern verspottet; er war die Zielscheibe von Millionen Witzen, und jeder einzelne seiner Tweets erfuhr augenblicklich eine Welle von Angriffen und Beleidigungen durch Bürger*innen, die sich diebisch darüber freuten, der aufgeblähten Macht die unverblümte Wahrheit entgegensetzen zu können.
Er ist das alte Fischerweib, das alles haben wollte, und er wird früher oder später mit leeren Händen dastehen. Die Frau, die wieder vor ihrer Erdhütte hockt, ist nach ihren Wünschen ärmer als zuvor, weil sie nun nicht nur mit ihrer Armut leben muss, sondern auch mit ihren Fehlern und ihrem zerstörerischen Stolz. Obwohl sie es anders hätte machen können, hat sie Ruhm und Macht verspielt, sie hat sich die ekelhafte Suppe selbst eingebrockt und muss sie nun auslöffeln.
Der Mann im Weißen Haus sitzt nackt und bloß im harschen Licht, ein Eiterpickel aus Selbstgefälligkeit, ein Mann, der nach mehr griff, als sein vom Luxus eingelulltes Begriffsvermögen zu fassen vermag. Irgendwo unter der Oberfläche, über die er dahinschlittert, muss ihm klar sein, dass er das Bild von sich zerstört hat und dass auch er, genau wie Dorian Gray, seinem eigenen Verfall zum Opfer fallen wird, wenn es so weit ist. Auf die eine oder andere Art wird es ihn zerstören, auch wenn er dabei Millionen andere mit sich reißen mag. Auf die eine oder andere Art weiß er, dass er über eine Klippe getreten ist, dass er sich zum König der Lüfte erklärt hat und sich nun im freien Fall befindet. Unten wartet ein Scheißhaufen auf ihn; und die Scheiße stammt von ihm allein. Wenn er dort hineinklatscht, ist es so weit: Dann ist er wirklich ein Selfmademan.
Coda (16. Juli 2018)
Diesen Schluss schrieb ich am 16. Juli 2018, jenem Morgen, an dem Trump nach seinem privaten Treffen mit Wladimir Putin die Welt mit seiner offenkundigen Unterwürfigkeit schockierte (auch wenn er die meisten von uns damit nicht überraschte):
Es war einmal ein Mann, der einen Pakt schloss. Er würde der König der Welt werden, aber nur, wenn er zuließ, dass ein gefährlicher anderer Mann über ihn herrschen durfte, weil dieser alle seine Geheimnisse, seine gesamte Vorgeschichte kannte und ihn jederzeit vernichten konnte. Der Mann regierte, brüstete sich und prahlte, er schwamm in seiner öligen Selbstverliebtheit stromabwärts, bis es Zeit wurde, seinen Schöpfer zu treffen. Bei einem Privatgespräch fixierte ihn dieser Schöpfer mit funkelnden Augen und erinnerte ihn daran, wie die Dinge standen, wem er gehörte und wo die Leichen vergraben lagen. Ihr Grab lag offen, und die Grube selbst blickte grinsend, mit gefletschten perlmuttfarbenen Grabsteinzähnen zu ihm hoch.
Als er den Raum verließ, wusste der Mann, dass ein König, der über alles herrscht, aber nicht über sich selbst, kein König ist, sondern die Schachfigur eines anderen, und seine Leine fühlte sich in diesem Moment sehr kurz an, sein Hemdkragen sehr eng und seine Erhabenheit wie Hohn. Unglücklich, schlecht gelaunt und eingeschüchtert schlich er aus dem Raum, und seine Stimme, die sonst so gern quengelte, protzte und schrie, klang mit einem Mal geschlagen, tonlos und ängstlich. Sein Herrscher betrachtete ihn mit unheilvoller Nachsicht, er lächelte wie eine Katze beim Anblick ihrer Beute, und nicht eines der gottesfürchtigen Monster um den Mann herum kam auf die Idee, ihn im entscheidenden Moment zu fragen, was es einem Menschen hülfe, wenn er die ganze Welt gewönne, seine Seele aber jemandem verkaufte, der sie noch zu Lebzeiten einfordern könnte?
Seine Anhänger wandten sich ab – sie huschten davon, um ihn zu verleugnen –, denn er hatte nichts Neues erreicht, außer dass nun alle Welt sehen konnte, wie tief er in die Falle der Grinsekatze neben sich getappt war, daher wagten sie nicht länger, bei ihm zu bleiben oder abzustreiten, dass es eine Falle gewesen war. Das war der Tag, der seine Ära beendete und eine neue begründete: die seines Niedergangs, der ebenso dramatisch, seltsam und unvorhersehbar verlaufen würde wie sein Aufstieg. Es war der Tag, an dem seine Anhänger Kommentare abgaben, die neue Fallen waren, Fallen, die verhindern sollten, dass sie zu ihren alten Lügen zurückkehrten, mit denen sie ihn freigesprochen hatten. Sie versuchen sich von seinen Verbrechen reinzuwaschen, doch die Flecken blieben an ihnen haften. Sie versuchten, sich von sich selbst reinzuwaschen. Doch die Diener und früheren Diener der Regierung, der er mehr oder weniger vorstand – die Mitarbeiter seiner Verwaltung, die er wieder und wieder beleidigt hatte, wenn sie die Wahrheit darüber aussprachen, was er verloren hatte, nur um dieses Amt zu erlangen –, sie erhoben sich einer nach dem anderen und verurteilten ihn als Betrüger, Lügner und Narren, als Saboteur all dessen, was er eigentlich bewahren sollte.
An jenem Tag veränderte sich etwas. Die Verschiebungen waren ebenso gewaltig und spürbar wie unberechenbar. Vielleicht würden sie berechenbarer sein, wenn die Geschichte der nächsten Jahre geschrieben wäre, doch an jenem Tag war sie fast unvorstellbar.
Meilensteine der Frauenfeindlichkeit
2016
Mehrere Frauen haben mir erzählt, dass nach der zweiten Präsidentschaftsdebatte vom 9. Oktober 2016 schreckliche Erinnerungen in ihnen wach wurden, dass sie nachts nicht schlafen konnten oder unter Albträumen litten. Die Worte, die in dieser Debatte fielen, waren so bedeutsam wie die Art ihrer Äußerung. Donald Trump unterbrach Hillary Clinton achtzehn Mal (im Vergleich zu einundfünfzig Unterbrechungen während der ersten Debatte). Auf die Frage des Moderators nach seinen in einem Video festgehaltenen Prahlereien darüber, dass er Frauen »an die Pussy« fasse, erwiderte Trump: »Das war Umkleiden-Gequatsche, das sind halt so Sachen. Ich werde dem IS die Hölle heiß machen … Außerdem sollten wir uns wichtigeren Dingen zuwenden, größeren Dingen.« Dann versprach er, »Amerika wieder sicher zu machen« – allerdings nicht vor sich selbst. In jener Woche wurden Frauen und der IS zusammengeworfen als Dinge, die Trump anzugreifen versprach.2
Doch Worte waren nichts im Vergleich zu den Taten. Trump tigerte herum, er baute sich auf, machte ein finsteres Gesicht, er fletschte die Zähne und schien mit seinem Podium zu kopulieren, das er mit beiden Händen packte, während er die Hüften schwenkte und dabei kurzzeitig völlig entrückt wirkte. Die von ihm ausgehende Bedrohung wirkte so dramatisch, so Hitchcock-artig, dass der Hollywood-Komponist Danny Elfman einen Soundtrack für einen Videomitschnitt verfasste, der die unheimlichsten Momente untermalt. »Zu beobachten, wie sich Trump während der Debatte unmittelbar hinter Hillary aufbaute, hatte etwas von einem Zombiefilm«, sagte Elfman. »Als wollte er jeden Moment auf sie losgehen, ihr den Kopf abreißen und ihr Gehirn fressen.« Freunde erzählten mir, dass sie ebenfalls geglaubt hätten, er könnte sie angreifen, und auch ich hielt es für möglich, als ich ihn so herumtigern und schäumen sah. Er war in ihre Wohlfühlzone eingedrungen, wie man so schön sagt, und ihre Fähigkeit, ruhig und konzentriert zu bleiben, war heldenhaft. Wie viele Männer in diesem Wahlkampf schien auch Trump darüber empört zu sein, dass sie die Stellung hielt. Im Wahlkampf wie in ihrer Wohlfühlzone.