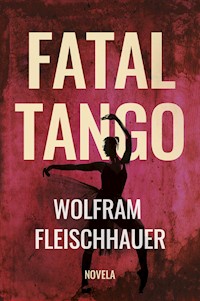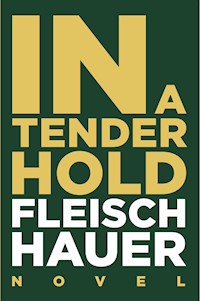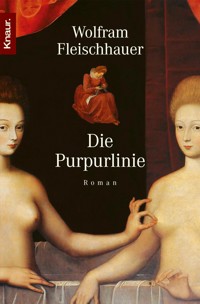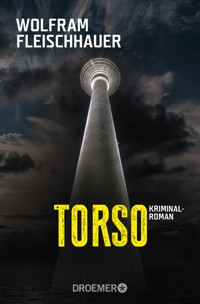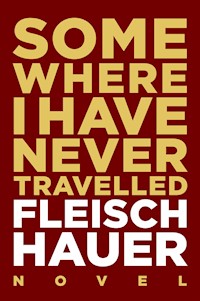9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er weiß nichts über sie – doch sie weiß, was er sucht … »Die dritte Frau« ist ein soghafter Roman über Liebe und Kunst, historische Fakten und literarische Fiktion und das ewige Rätsel um Mann und Frau. Vor Jahren schrieb ein junger Autor einen historischen Roman über das geheimnisvolle Renaissance-Gemälde »Gabrielle d'Estrées und eine ihrer Schwestern. Trotz jahrelanger Recherchen gelang es ihm nur zum Teil, das Rätsel um den Tod der schönen Herzogin zu lösen, die wenige Tage vor ihrer Hochzeit mit dem französischen König Heinrich IV. unter bis heute ungeklärten Umständen starb. Nun aber werden dem Autor unbekannte Quellen zugespielt – und zwar von einer direkten Nachfahrin der zweiten Frau auf dem Gemälde. Unaufhaltsam gerät der Autor in den Bann der geheimnisvollen Camille Balzac, und es entspinnt sich ein obsessives Spiel aus Verlockung und Zurückweisung, an dessen Ende der Sturz in den Abgrund droht: zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Liebe und Hass, Dichtung und Wahrheit – Mann und Frau. Der Roman über das rätselhafteste Gemälde des Louvre und eine obsessive Liebe knüpft thematisch an Wolfram Fleischhauers Bestseller »Die Purpurlinie« an – »Die dritte Frau« ist jedoch ein völlig eigenständiger Roman, ohne Vorkenntnisse zu lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wolfram Fleischhauer
Die dritte Frau
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vor Jahren schrieb ein junger Autor einen historischen Roman über das geheimnisvolle Renaissance-Gemälde »Gabrielle d’Estrées und eine ihrer Schwestern«. Dabei gelang es ihm nur zum Teil, das Rätsel um den Tod der schönen Gabrielle zu lösen. Nun aber werden ihm neue Informationen zugespielt – und zwar von Camille Balzac, einer Nachfahrin der zweiten Dame auf dem Gemälde. Unaufhaltsam gerät der Autor in den Bann der faszinierenden jungen Frau. Es entspinnt sich ein obsessives Spiel, an dessen Ende der Sturz in den Abgrund droht: zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Liebe und Hass, Dichtung und Wahrheit – Mann und Frau.
Inhaltsübersicht
Prolog
Teil 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Teil 2
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Teil 3
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Epilog
Bildnachweis
Prolog
Wir saßen im Gartenrestaurant der Villa Maria in Cannobio.
Unsere alljährliche Wanderung war beendet, wir waren nach sieben Tagen im Hochgebirge unbeschadet wieder auf Seehöhe angekommen und verbrachten den letzten Abend traditionsgemäß bei einem gemeinsamen Essen.
Ich hatte das Restaurant vorgeschlagen, die Qualität der Küche und die fantastische Lage am See gerühmt und dabei unvorsichtigerweise erwähnt, mit wem ich vor nicht allzu langer Zeit zuletzt hier gewesen war. Vielleicht lag es am Tonfall meiner Stimme, an meinem Gesichtsausdruck oder der Art und Weise, wie ich danach sofort versucht hatte, das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. In jedem Fall provozierte meine Äußerung sogleich neugierige Nachfragen. Ach, diese Französin, bei der ich den Unfall gehabt hatte. Hier hatte ich sie kennengelernt? Nein, hier hatten wir uns das letzte Mal gesehen. Das letzte Mal? Warum hier? Wart ihr wandern? Und was war aus ihr geworden, und aus den wertvollen Dokumenten, von denen ich erzählt hatte?
Sechs Augenpaare waren plötzlich in der Erwartung auf mich gerichtet, dass ich die ganze Geschichte endlich einmal etwas ausführlicher erzählen würde. Es ist ein ehernes Gesetz: Unglück zieht an. Nach dem ersten Schreck will man sofort die Gründe erforschen, die dazu geführt haben. Anstatt sich erleichtert abzuwenden, dass es einen nicht selbst erwischt hat, bleibt man stehen und starrt, keineswegs um zu erfahren, wie man dergleichen künftig verhindern oder sich selbst davor bewahren könnte, sondern aus einer unerklärlichen Lust heraus, jede Windung eines Schicksalsknotens zu verfolgen, ja in ihn hineinzukriechen, anstatt ihn einfach links liegen zu lassen.
Ich versuchte, mich mit beiläufigen Bemerkungen aus der Affäre zu ziehen, ließ die weiteren Fragen einfach unbeantwortet, zuckte mit den Schultern, nippte an meinem Weißwein und sagte irgendwann gar nichts mehr.
»Also deshalb warst du die letzten Stunden so schweigsam«, hörte ich neben mir. »Down memory Lane.«
Glücklicherweise kam der Kellner und trug seine Serenade der verfügbaren Gerichte vor. Da nur zwei von uns ausreichend Italienisch sprachen und für die anderen übersetzen mussten, dauerte es eine gute Weile, bis jeder entschieden und bestellt hatte. Nach diesem Durcheinander gingen die Gespräche in alle möglichen Richtungen, und die Erinnerung an meine Bekannte war verflogen.
Zumindest bei meinen Tischgenossen.
Wir saßen dort bis spät in die Nacht. Der Lago Maggiore funkelte. Die Sterne glitzerten darin. Ich war gar nicht mehr mit meinen Wanderfreunden hier, sondern mit ihr! Der Tisch, an dem sie mir damals gegenübergesessen hatte, blieb den ganzen Abend unbesetzt. Das war gewiss Zufall, wirkte aber gespenstisch. Warum hatte ich ausgerechnet dieses Restaurant vorgeschlagen? Rückblickend sicherlich in der Absicht, mit etwas abzuschließen, oder sogar aus der Hoffnung heraus, dass es bereits geschehen war. Der eiskalte Stich im Magen, den ich jedes Mal verspürte, wenn ich zu jenem Tisch hinübersah, und die Tatsache, dass ich so gut wie nichts essen konnte, bewiesen indessen nur, dass ich von dem leeren Stuhl dort bis heute nicht aufgestanden war.
Muss ich erwähnen, dass ich in dieser Nacht nicht schlafen konnte? Ich hatte wenig gegessen, daran konnte es nicht liegen. Die zwei Gläser Wein, die ich getrunken hatte, konnten auch nicht schuld daran sein, dass ich selbst nach einer Stunde auf dem Balkon noch immer keinerlei Müdigkeit verspürte.
In den Sommermonaten wurden die Verglasung und das Dach des Wintergartens bis auf die wichtigsten Streben entfernt, sodass ich selbst von hier oben den verdammten Tisch sehen musste, an dem wir damals gesessen hatten. Ich blickte hinab, natürlich nur mit dem gesunden Auge, das mir verblieben ist. Das andere schaut seit damals nur noch nach innen. Dort sehe ich noch immer ihr Gesicht. Nicht das Gesicht jenes letzten Abends. Das hat mein Bewusstsein gelöscht. Ich könnte es vielleicht heraufbeschwören, mühsam rekonstruieren, in Fragmenten zusammensetzen. Aber es wäre kein Vergleich mit dem Bild von ihr, das ich nie vergessen und für immer mit mir herumtragen werde. Nicht die erste oder letzte Begegnung. Und auch nicht die erste Liebesnacht. Aber ich greife vor. Und wenn ich jetzt schon begonnen habe, zu erzählen, dann vielleicht besser der Reihe nach.
Teil 1
1. Kapitel
Ich befand mich, als ich Camille Balzac begegnete, vielleicht in meiner Lebensmitte, doch es war nicht Dantes dunkler Wald, in dem ich herumirrte. Vielmehr versuchte ich, das Chaos einer gescheiterten Ehe zu ordnen, das Auseinanderfallen meiner Familie zu verkraften und dabei irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Geldprobleme verschärften die Situation. Mein Schriftstellereinkommen reichte keineswegs für zwei getrennte Haushalte. Und was konnte meine Ex-Frau dafür, dass Malerinnen noch prekärer lebten als Autoren? Dann waren da unsere beiden Kinder, die gerade erst mit ihrer Ausbildung begonnen hatten. Und ich? Ich saß vor dem weißen Blatt, mit nichts als Trauer, Schuldgefühlen und Zweifeln in der Seele.
Damit kein Missverständnis entsteht: Mein Leben war längst gegen diese Wand gefahren, bevor ich Camille traf. Und die Initiative war gar nicht von ihr oder mir ausgegangen, sondern von ihrem Onkel. Er hatte mir einige Jahre zuvor geschrieben, und vielleicht sollte ich daher mit seinem Brief beginnen. Ich gebe ihn hier auf Deutsch wieder, und hoffentlich besser übersetzt als mein auf Französisch erschienener Roman, auf den das Schreiben Bezug nimmt:
Manoir Saint-Maur, den 14. März 2014
Monsieur,
Sie firmieren als Autor einer belletristischen Veröffentlichung mit dem Titel »La Ligne Pourpre«. Dem Titelblatt entnehme ich, dass die deutsche Originalausgabe bereits vor einigen Jahren erschienen ist, was wieder einmal zeigt, wie zäh und langwierig der kulturelle Austausch zwischen unseren beiden Vaterländern noch immer ist – von einigen Ausnahmen einmal abgesehen, über deren Repräsentativität ich mir kein Urteil erlaube.
Ihr Werk gelangte auf einigen Umwegen in meinen Besitz, und ich will Ihnen nicht verhehlen, dass ich andernfalls wohl niemals davon Kenntnis erlangt hätte. Ich lese schlechterdings keine Romane, und schon gar nicht solche, die derart marktschreierisch daherkommen wie der Ihre, zudem in einem französischen Verlag, von dessen Existenz ich zuvor niemals gehört habe und dessen Programm, sofern ich es jetzt nach kurzer Prüfung kennenlernen durfte, auf ein Publikum zu zielen scheint, zu dem ich mich schwerlich zählen dürfte.
Da es sich bei dem, was ich gelesen habe, um eine Übersetzung handelt, bin ich zu Ihren Gunsten bereit anzunehmen, dass die sprachlichen Mängel zumindest teilweise auf das Konto des oder besser gesagt der Übersetzer gehen, denn die stilistischen Verfehlungen sind auf derart bizarre Weise variabel, dass man einfach gezwungen ist, hier mehrere Stümper am Werk zu vermuten, die ihr Handwerk nicht verstehen. Ein einzelner Stümper, der all diese Grade der Stümperei beherrscht, kann in der Natur logischerweise nicht vorkommen, da dies ja eine Sprachbeherrschung voraussetzt, deren Fehlen den Stümper gerade als solchen auszeichnet. Soll man also bewusste Sabotage vermuten? Aber wozu? Mir fällt kein plausibler Grund dafür ein. Daher kann ich mir die Sache nur so erklären, dass bei der Übertragung Ihres Werkes in unseren Sprachraum – aus welchen Gründen auch immer – viele Köche den Brei verdorben haben.
Mildernde Umstände kann ich nun aber leider nur für die sprachlichen und stilistischen Verfehlungen Ihres Werkes gelten lassen, womit ich zum eigentlichen Anlass meines Schreibens komme. Sie haben, wie ich Ihrem Nachwort entnehme, redliche Mühen darauf verwandt, das Schicksal einer Reihe von Menschen zu erhellen, die in der Geschichte meiner Familie einmal eine herausragende Rolle gespielt haben. Sie können sich vorstellen, wie ein direkt Betroffener sich fühlen muss, wenn von völlig unberufener Seite plötzlich Spekulationen über äußerst komplizierte Vorgänge in die Welt gesetzt werden, die nicht nur kaum geeignet sind, die tatsächlichen Zusammenhänge aufzuklären, sondern darüber hinaus einer mit Blindheit geschlagenen Öffentlichkeit nun weitere Bretter – oder besser Romane – vor den Kopf nageln. Daher wäre es mir ein Bedürfnis, Ihnen einige Dinge zu erläutern, die Sie hoffentlich dazu bewegen, Ihre Veröffentlichung entweder gründlich zu überarbeiten und eine, wie es ja durchaus üblich ist, korrigierte und ergänzte Neuausgabe vorzunehmen, oder zumindest eine Nachschrift folgen lassen, in der Sie endlich Ross und Reiter in dieser Angelegenheit benennen und nicht alles auf so unbefriedigende Weise im Vagen und Halbrichtigen belassen.
Ich muss annehmen, dass Sie des Französischen mächtig sind, sieht man doch in nicht wenigen Passagen Ihres Werkes Originalquellen durchschimmern, wenn auch teilweise durch die bereits monierte Rückübersetzung ins Französische derart verhunzt und entstellt, dass Kenner der Quellen wie ich sich manchmal nur verblüfft die Augen reiben können, bis sie sich das vermutlich ursprünglich Gemeinte und Zitierte zusammengereimt haben.
Ich lade Sie daher ein, wenn es Ihre Lebensumstände gestatten und Sie einmal nach Südfrankreich kommen sollten, in meinem Haus Station zu machen und aus berufenerem Munde als bisher zu erfahren, welchen Machenschaften Personen zum Opfer gefallen sind, die zu meiner Familie zu zählen ich die Ehre habe.
Mit hochachtungsvollen Grüßen
Charles Balzac
Briefe wie dieser erreichen mich nicht so häufig. Der Tonfall provozierte mich. Der Roman, auf den der Mann Bezug nahm, war mein Erstling gewesen. Natürlich stand es jedem frei, darin Schwächen zu entdecken. Aber die Geschichte über Gabrielle d’Estrées und Heinrich IV., ihre tragische Liebesbeziehung und das damit zusammenhängende mysteriöse Louvre-Porträt von zwei Damen in einer Badewanne, hatte viele Leser gefunden. Nicht wenige hatten mir geschrieben, um mir ihre Ansichten oder Theorien über das oft als skandalös empfundene Gemälde mitzuteilen. Sogar die etwas abwegigen Lesarten fand ich fast immer interessant und hatte alternative Deutungsversuche nie als Kritik empfunden. Im Gegenteil. Solange es mir gelungen war, meine Faszination und Begeisterung für das rätselhafte und letztlich wohl unergründliche Gemälde weiterzugeben, hatte der Roman, trotz aller Erstlingsmängel, sein Ziel erreicht.
Dieser Brief jedoch fiel aus dem Rahmen. Ich will keine nationalen Klischees bedienen, aber bei aller Liebe zu Land und Sprache – der Ton war mir einfach ein wenig zu französisch, blasiert, von oben herab, belehrend. Selbst wenn dieser Herr Balzac mit einer der historischen Persönlichkeiten verwandt sein sollte, über die ich einmal geschrieben hatte, so war die Aufforderung, meinen Roman unter seiner Ägide gefälligst umzuschreiben, ein ziemlich starkes Stück. Weder folgte ich also seiner Einladung, noch beantwortete ich den Brief. Er lag ein paar Wochen auf meinem Schreibtisch herum, und als ich das Gefühl hatte, dass die angemessene Frist für eine Antwort ohnehin verstrichen war, heftete ich ihn ab. Ich vergaß ihn einfach und hätte ihn bestimmt nicht wieder ausgegraben, wenn Moran nicht gewesen wäre.
Sie rief neuerdings häufiger als sonst an, denn sie war besorgt über meinen Zustand. Als meiner Literaturagentin war ihr meine persönliche Krise natürlich nicht verborgen geblieben. Mein letztes Buch hatte ich mit ihrer Hilfe gerade noch termingerecht mitten im Scheidungssturm zu Papier gebracht und mich danach sofort verkrochen. Sie hatte mit Engelszungen für mich plädiert, alle Lesungsanfragen abgeblockt, dem Verlag erklärt, dass ich diese kleine Auszeit nun unbedingt haben musste, Buchmesse hin oder her. Der neue Roman sei stark genug, er werde diesmal sicher auch ohne meine tatkräftige Mithilfe ein Erfolg werden, was sich glücklicherweise sogar bewahrheitete. Der Titel übertraf die Erwartungen und sogar die Verkaufszahlen der beiden vorhergehenden, ohne dass ich monatelang durchs Land fahren und daraus vorlesen musste. Moran wusste allerdings auch, wie es um meine Finanzen stand, und meldete sich daher immer öfter, um sich nach dem nächsten Projekt zu erkundigen. Doch ich hatte keines. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich jemals wieder eines finden sollte. Meine Stimmung war auf dem Nullpunkt. Ich war wie betäubt. War dies die befürchtete Midlife-Crisis? Scheidung? Bettgeschichten? Wieder raus in die Clubs? Alles von vorne? Wozu?
»Das ist ganz normal«, beruhigte sie mich. »Das geht vorüber.«
»Ich habe nichts mehr. Ich bin auserzählt. Und angezählt.«
»Unsinn«, widersprach sie. »Lass uns das mal in aller Ruhe besprechen.«
Sie kam bald darauf vorbei. Ich holte mein Ideenheft, aber uns war beiden schnell klar, dass die darin befindlichen Skizzen zwar teilweise ganz originell, aber kaum lebensfähig waren.
»Ich habe einfach keine brennende Frage mehr an die Welt«, erklärte ich. »Alles ödet mich an.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen.«
»Doch! Ich glaube, es ist vorbei. Zu Ende. Wie viele Romane trägt ein Mensch in sich?«
»Weißt du, wie oft ich das höre?«, sagte sie streng.
»Vielleicht sollte ich lieber umsatteln. Kannst du mir nicht ein paar Übersetzungsjobs besorgen?«
Sie musterte mich bekümmert, nickte, versprach, sich umzuhören, und klappte mein Skizzenbuch zu. Dann erhob sie sich, ging an mein Bücherregal, sammelte einige Exemplare ein und breitete sie vor mir auf dem Tisch aus. Mein Gesamtwerk starrte mich plötzlich an. Der Anblick sollte mich vielleicht aufmuntern, aber das Gegenteil war der Fall.
»Das ist doch alles tot, Moran. Es ist aus, vorüber, vorbei.«
Sie legte ihre Hand auf meinen Unterarm.
»Jetzt hör mir mal zu. Weißt du noch, was du mir damals gesagt hast, als ich dich gefragt habe, wie du dein erstes Buch geschrieben hast?«
»Keine Ahnung.«
Sie nahm den Roman mit dem Louvre-Porträt auf dem Umschlag in die Hand. »Wirklich? Du weißt nicht mehr, wie er entstanden ist?«
»Ich habe jahrelang herumprobiert«, sagte ich ratlos. »Ich hatte ja keine Ahnung, wie man einen Roman schreibt. Also habe ich es mit allen möglichen Textsorten versucht, mit Briefen, Verhören, auktorialem Erzählen …«
»Nein«, unterbrach sie mich. »Das meine ich nicht. Das ist Technik. Es war dein erster. Du hast gelernt. Und weil postmodernes Erzählen Mode war, bist du mit dieser Montage-Technik damals sogar durchgekommen. Aber das meine ich nicht. Und ich meine auch nicht den Stoff, das Gemälde. Da hast du einfach Glück gehabt, dass vorher noch niemand auf die Idee gekommen war, sich dieses Wahnsinnsgemälde mal genauer anzuschauen und die Hintergründe zu recherchieren. Technik braucht man immer. Und Glück bei der Stoffsuche hilft. Aber das Wesentliche fehlt.«
Ich hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, worauf sie hinauswollte.
»Du weißt es wirklich nicht mehr?«
»Nein. Sorry. Fehlanzeige.«
»Du hast damals gesagt: Wenn dich jemand fragen würde, wie man schreiben lernt, dann würdest du Folgendes empfehlen: Wähle die zehn Werke aus, die du über alles liebst, die dich wirklich umgehauen, die dein Leben verändert haben. Lies sie alle noch einmal, bis du verstanden hast, warum. Dann leg sie weg und mach es besser. Das erste Buch ist in Wirklichkeit immer das elfte.«
»Da hast du’s«, gab ich zurück. »Nicht einmal daran kann ich mich erinnern. Und zehn Werke, die mein Leben verändert haben! Du liebe Zeit. Im Moment wüsste ich kein einziges.«
Moran deutete auf den Tisch. »Sie liegen vor deiner Nase.«
Ich schaute sie nur an und schüttelte unwillig den Kopf.
»Du musst es einfach so betrachten«, fuhr sie unbeirrt fort. »Damals hast du von anderen gelernt, hast deine Lehrer gefunden, deine Meister. Du hast dein Erzähluniversum gebaut und deine maniera gesucht. Nur deshalb kam dieser erste Stoff überhaupt zu dir. Da bin ich mir ganz sicher. Das Gemälde wäre dir sonst gar nicht aufgefallen. Dann kam die Technik, die Schule, und schließlich der Abschluss, der erste Roman. So geht das immer. Die meisten bleiben dann dabei und schreiben einfach immer wieder mehr oder weniger das Gleiche. Für mich ist das übrigens das Allerbeste, denn so habe ich in relativ kurzen Abständen immer neue Titel oder sogar eine Serie, die ich verkaufen kann, ohne viel erklären zu müssen. Immer das Gleiche, nur ein wenig anders. Das wollen alle haben. Vielleicht bist du jetzt aber an einem Punkt, wo das bei dir nicht mehr funktioniert. Gut. Dann geh den nächsten Schritt. Ich helfe dir. Hier vor dir liegen lauter elfte Bücher. Geh aufs Ganze. Versuche ein zwölftes Buch. Wenn du dich traust.«
Noch Stunden, nachdem Moran gegangen war, saß ich da, brütete über ihrem letzten Satz und blätterte in meinen alten Romanen. Was mir dabei vor allem in den Sinn kam, war ein Ausspruch Kleists: Die Hölle gab mir meine halben Talente, der Himmel schenkt dem Menschen ein ganzes, oder gar keins. Ich entdeckte vor allem Mängel, Formulierungen, die ich heute ändern würde, Beschreibungen, die mir ungenau erschienen, und dergleichen mehr. Morans Vorschlag mochte noch so schön klingen. Aber bei mir selbst in die Schule zu gehen, erschien mir unvorstellbar.
Einige Tage später fiel mir beim Blättern in meinem Erstling auf, dass er nicht einmal einen Schluss hatte. Und nicht nur das. Wie Moran bemerkt hatte, war der Roman wirklich ein Kind seiner Zeit, aus unterschiedlichsten Elementen zusammenmontiert und ohne eine erkennbare kompositorische Struktur oder Form. Er entwarf eine Art Kaleidoskop. Nachsichtig formuliert, könnte man sagen: Es war eine romanhafte, kunsthistorische Spurensuche. Genauso gut konnte man aber auch von einem ziemlichen Durcheinander sprechen, das von einer konstruierten Rahmenhandlung in der Gegenwart mehr schlecht als recht zusammengehalten wurde. Am Ausgang bekam man dann auch noch sein Eintrittsgeld zurück und die Entschuldigung des Erzählers, dass es ihm leider nicht gelungen war, die Sache aufzulösen und zu einem ordentlichen Ende zu bringen. Mit einer Mischung aus nostalgischem Staunen und dramaturgischer Bestürzung las ich die letzten Sätze:
Bisweilen, wenn ich ihr Bild erblicke und mir seine Geschichte vergegenwärtige, bilde ich mir für einen kurzen Augenblick ein, in die Welt hinter dem Gemälde gelangt zu sein, in jenes Atelier in La Rochelle, wo Vignac nach seiner Flucht aus Paris einen bildhaften Abschluss seiner Erlebnisse gesucht hat, jenen jämmerlichen Schuppen, worin sich der Gestank rußender Kerzen mit dem scharfen Geruch von Firnis vermischt, in einer lautlosen Nacht des Jahres 1600. Ja, manchmal glaube ich fast, das Gesicht des Malers vor mir zu sehen, die Stellen auf dem Holz zu spüren, wo sein angestrengter, fragender, suchender Blick geruht haben mag. Und wenn dieser Eindruck längst verschwunden ist, klingt noch lange das leise, sanft kratzende Geräusch eines Pinsels in mir nach, der behutsam die letzten Striche an den Gestalten ausführt, um das Geheimnis ihrer Geschichte für immer zu verschließen und in den Zauber ihrer Form zu lösen.
Warum sollte das Bild in La Rochelle entstanden sein?, dachte ich. Und wieso ausgerechnet in jenem Jahr? Natürlich hatte ich mir etwas ausdenken müssen. Aber wenn ich schon etwas erfand, warum dann so willkürlich? Und genügte es dem Leser zu erfahren, was der Erzähler sich einbildete? Hätte er das Geheimnis der Geschichte nach fast fünfhundert Seiten nicht besser gelüftet, anstatt es im Zauber irgendeiner Form aufzulösen? Natürlich gab es keine überzeugende »Lösung« für das Gemälde. Das machte schließlich einen Teil der Faszination aus, die von ihm ausging, selbst für Betrachter, die keine Ahnung von den historischen Hintergründen hatten. Aber wäre es nicht meine Aufgabe gewesen, aus dem Material einen befriedigenden, dramatischen Schluss zu inszenieren, anstatt die Flinte mit einer zugegeben schönen Formulierung ins Korn zu werfen?
Diesem Erzähler, der ich unleugbar einmal gewesen war, traute ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so recht über den Weg. Der Schluss legte nahe, dass er sich offenbar noch nicht entschieden hatte, ob er Dramatiker oder Kunsthistoriker sein wollte. Gleichzeitig wurde mir klar, was Moran gemeint hatte, als sie ihr »wenn du dich traust« hinzugefügt hatte. Sich seinen eigenen Schöpfungen zu stellen, war äußerst heikel. Wenn Kinder missrieten, trug man höchstens eine Mitverantwortung, da sie schließlich autonome Wesen mit einem eigenen freien Willen waren. Für Sätze, die man einmal geschrieben hatte, gab es keine mildernden Umstände. Sie klebten für immer an einem, selbst wenn man inzwischen längst jemand anderes geworden war. Scripta manent.
In den darauffolgenden Wochen gab es einen Gerichtstermin und zuvor eine langwierige Auseinandersetzung beim Notar. Meine Stimmung sank auf einen neuen Tiefststand. Ich hielt es kaum in meinem neuen Eineinhalb-Zimmer-Zuhause aus, hatte noch immer nicht alle Kisten ausgepackt und wusste nicht, wie ich meiner neuen Situation eine Struktur geben sollte. Zur Arbeit an zwei Übersetzungen, die mir Moran glücklicherweise vermittelte, ging ich in die Staatsbibliothek. Auf dem Heimweg kaufte ich ein paar Sachen zum Essen ein, kochte mir aber selten etwas und nur dann, wenn ich absolut niemanden für einen Besuch beim Griechen oder Italiener finden konnte oder bei Freunden eingeladen war. Ich ging wie zuvor ins Kino, zu Lesungen, in Konzerte oder in die Oper, später dann manchmal noch in Clubs. Wenn ich nach Hause kam, fühlte ich mich in der leeren Wohnung nicht unbedingt unwohl oder einsam, aber es lag ein Phantomschmerz über meinem gesamten Leben.
Die Straße, wo mein Familienleben stattgefunden hatte, mied ich. Die Wohnung war längst an fremde Menschen vermietet. Die Streitereien vermisste ich natürlich nicht, auch nicht das Gefühl der Ausweglosigkeit, das am Ende alles andere dominiert hatte, gemischt mit der bitteren Erkenntnis, dass einfach nichts mehr da war als unerfüllbare Erwartungen. Doch was ich dagegen eingetauscht hatte, fühlte sich nicht besser an, und es konnte passieren, dass ich plötzlich das Kinderzimmer meiner Tochter vor Augen hatte und einfach losheulte. Der Autor meines Lebens war mir nicht weniger fremd geworden wie der meiner Romane. Und für mein Leben gab es nicht einmal eine Agentin, die ich um Rat fragen konnte. Vermutlich stand ich deshalb irgendwann im Keller vor dem Regal mit meinen Archivboxen.
2. Kapitel
Ich lade Sie daher ein, wenn es Ihre Lebensumstände gestatten und Sie einmal nach Südfrankreich kommen sollten, in meinem Haus Station zu machen und aus berufenerem Munde als bisher zu erfahren, welchen Machenschaften Personen zum Opfer gefallen sind, die zu meiner Familie zu zählen ich die Ehre habe.
Ich löste den Umschlag ab, den ich an dem Brief festgeklammert hatte, nahm dann aber beides mit nach oben.
Saint-Maur war kein Ort, sondern eine Domäne, etwa eine Autostunde von Toulouse entfernt. Genauere Informationen darüber waren nicht zu finden, und es blieb daher nur, auf gut Glück an die Retour-Adresse zu schreiben. Es sollten nur ein paar Zeilen sein, ich brauchte dann aber doch mehrere Stunden, bis ich das Gefühl hatte, die passende diplomatische Formulierung gefunden zu haben. Ich bat um Nachsicht für meine äußerst späte Antwort, für die ich erst gar keine Entschuldigung anbot. Irgendein Versehen oder die unzuverlässige Post vorzuschieben, erschien mir würdelos.
Warum hatte ich dem Mann nie geantwortet? Womöglich hatte mich die merkwürdige Begegnung mit einer Leserin vorsichtig gemacht, die mir eine Sammlung von Briefen aus dem Dreißigjährigen Krieg angeboten hatte, angeblich großartige Originalquellen für einen historischen Roman. Sie hatte es verstanden, das in Aussicht gestellte Material so interessant erscheinen zu lassen, dass ich der Versuchung nicht widerstehen konnte, wenigstens einmal einen Blick darauf zu werfen. Ich fuhr nach Kassel. Eine ältere Frau in Jagdmontur erwartete mich auf dem Bahnsteig und fuhr mich in ihrem Jeep zu einem abgelegenen Gehöft. An drei großen Wachhunden vorbei gelangte ich ins Haus, wurde in ein geräumiges Wohnzimmer geführt, bekam ein Getränk angeboten und sogleich einen Vertrag vorgelegt, den ich zuvor unterzeichnen sollte. Ich würde ja gewiss viel Geld mit diesem Roman verdienen, und da sei es nur recht und billig, dass wir gleich zu Beginn festsetzten, welcher Anteil am Kuchen wem zustünde. Ich wies freundlich darauf hin, dass es noch gar keinen Roman gab und vielleicht auch niemals geben würde, und dass Romanschreiberei eher ein kostspieliges Hobby denn eine wirtschaftliche Unternehmung war. Aber ich begriff bald, dass es wenig Sinn hatte, auf dieser Ebene zu argumentieren.
»Ich würde ja gern unterschreiben«, lenkte ich ein. »Ich darf es aber leider nicht.«
»Warum nicht?«, kam die Rückfrage in einem irritierten Tonfall wie aus der Pistole geschossen.
»Weil allein meine Agentin befugt ist, Verträge für mich zu schließen. Ich nehme diese Vereinbarung aber gerne an mich, lasse alles von ihr prüfen und unterschreiben, und beim nächsten Mal machen wir uns dann an die Arbeit.«
Ich musste an die schreckliche Geschichte von Stephen King denken, in der ein Autor von einer Leserin gefangen gehalten und gefoltert wird, um nach ihrem Willen zu schreiben. Glücklicherweise entging ich diesem Schicksal. Nach einigem Hin und Her wurde ich samt sorgfältig in einem Umschlag verwahrten Vertrag an den Höllenhunden vorbei wieder nach Kassel zum Bahnhof gebracht und mit der Ermahnung verabschiedet, bald zurückzukehren, um die Arbeit an unserem Erfolgsroman zu beginnen. Noch nie habe ich so sehnsüchtig das Anfahren eines Zuges erwartet.
Hatte ich auch deshalb Herrn Balzac nicht geantwortet?
Ich schickte meinen Brief ab. Zehn Tage später erhielt ich folgende E-Mail:
Monsieur,
Ich danke Ihnen für Ihr freundliches Schreiben vom 17. August. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass der Adressat Ihres Briefes im März dieses Jahres verstorben ist. Wir sind gegenwärtig mit der Auflösung seines Nachlasses beschäftigt. Ich habe mir erlaubt, im Archiv meines verstorbenen Onkels die Kopie des Briefes herauszusuchen, den er Ihnen vor einigen Jahren geschickt hat. Aus der Lektüre schließe ich, dass die Angelegenheit für die Nachlassabwicklung nicht relevant ist. Falls doch, dann würde ich Sie bitten, mit unserem Nachlassverwalter in Carcassonne, Maître Lemoy, Kontakt aufzunehmen, der Ihnen auch die Termine für die nächsten Versteigerungen nennen kann.
In der Hoffnung, Ihnen hiermit behilflich gewesen zu sein, verbleibe ich, hochachtungsvoll
Camille Balzac d’Entragues
Dieser Name! Schon aus den wenigen Zeilen wehte mich etwas an, das mit weit zurückliegenden Erfahrungen und Erinnerungen an eine obsessive Suche verknüpft war. Carcassonne!Maître Lemoy! Dazu die Adresse. Manoir Saint-Maur.
Aber vor allem der Familienname: Entragues. Ich hätte Balzacs Brief sicher nicht unbeantwortet gelassen, wenn er damals mit seinem vollen Namen unterzeichnet hätte.
Undenkbar, dass ich nicht reagiert hätte. Doch ich hatte die Verbindung einfach nicht gesehen. Und die Kopie des Briefes ihres Onkels an mich existierte noch! Wer machte sich heutzutage noch Kopien von handgeschriebenen Briefen? Ja, wer schrieb überhaupt noch welche?
Ich rief im Büro des Notars an, erfuhr jedoch nicht viel mehr, als was ich schon wusste. Charles Balzac war nach längerer Krankheit an den Spätfolgen eines Autounfalls gestorben, und die Familie hatte entschieden, das Anwesen zu veräußern. Möbel, Hausrat, Fahrzeuge und dergleichen waren bereits weitgehend verkauft. Der restliche Nachlass bestand im Wesentlichen aus einer Bibliothek, die demnächst versteigert würde. Auch das Haus sei bereits unter Vertrag. Bis zur Übergabe Ende Oktober musste es geräumt sein.
Ich ließ mich vorsorglich auf den E-Mail-Verteiler setzen, um die nächsten Auktionstermine mitgeteilt zu bekommen. Dann saß ich lange da, las immer wieder Balzacs Brief, dann die E-Mail seiner Nichte und spürte fast den provozierenden Blick der beiden nackten Damen in der Wanne vor mir auf dem Schutzumschlag meines Romans. Es war und blieb das merkwürdigste, faszinierendste Gemälde, das ich kannte. Was immer der anonyme Maler mit dieser Komposition erreichen wollte: Die Wirkung war auch nach über vierhundert Jahren ungebrochen. Rechts Gabrielle d’Estrées, Herzogin von Beaufort, um ein Haar Königin von Frankreich und vermutlich von den Medici vergiftet. Links Henriette d’Entragues, Marquise von Verneuil, Gabrielles Nachfolgerin im königlichen Bett, doch nach einer Fehlgeburt ohne Chance auf den Thron.
Und eine Nachfahrin dieser Henriette d’Entragues hatte mir heute eine E-Mail geschrieben!
3. Kapitel
Mitte September flog ich nach Toulouse. Ich erzählte niemandem, wohin ich eigentlich fuhr. Auch Moran weihte ich nicht ein. Ich verfolgte keinen Plan. Noch immer kam es vor, dass meine Kehle jäh für Minuten wie zugeschnürt war. In der Abflughalle am Berliner Flughafen gab es so einen Moment. Ich fühlte mich wie auf dem Weg zu meiner Hinrichtung. Nein. Ich sehnte sie herbei. Wäre es nicht das Beste, wenn dieses Flugzeug abstürzen würde? Was sollte jetzt noch kommen? Außer Wiederholungen? Woher diese dunklen Gedanken, diese schwarze Melancholie beim Betreten der Maschine?
Über den Wolken verflog sie ein wenig. Ich las noch einmal Balzacs Brief. Dass die Übersetzung ins Französische keine Glanzleistung gewesen war, wusste ich selbst. Bei der Durchsicht des Manuskriptes, das der französische Verlag mir damals auf wiederholte Nachfrage widerwillig zugesandt hatte, waren schon mir als Nicht-Muttersprachler derart viele Fehler aufgefallen, dass ich den Entwurf mit dringender Bitte um gründliche Überarbeitung zurückschickte. Leider waren die zwei darauffolgenden Fassungen nicht viel besser, und Balzac hatte sicher recht mit seiner Vermutung, dass kein einzelner, sondern eine ganze Schar von Zuarbeitern – vermutlich Studenten – sich an meinem Roman versucht hatten und keineswegs nur der renommierte Übersetzer, der dafür verantwortlich zeichnete. Wie war sonst zu erklären, dass aus einem deutschen Schlossherrn im Französischen ein Meisterschlosser geworden war und aus dreißig Jahren Religionskrieg der Dreißigjährige Krieg, in dem Gabrielle d’Estrées und Heinrich IV., 1599 beziehungsweise 1610 gestorben, schwerlich eine Rolle gespielt haben konnten. Die Liste französischer Originalzitate, die ich dem Verlag zur Verfügung gestellt hatte, war offenbar niemals in die Nähe des Übersetzers und seines Zuarbeiter-Kollektivs gelangt. Aus Heinrichs berühmter Wehklage über den jähen Verlust Gabrielles, die Wurzel seines Herzens sei tot und werde nicht mehr treiben, war in der französischen Rückübersetzung eine Wurzel geworden, aus der keine Zweige mehr sprießen würden. Bekannte französische Zitate waren derart entstellt, als stieße man in einem aus dem Französischen ins Deutsche übersetzten Roman auf ein Faust-Zitat, das da lautete: »Das ist des Hundes Mitte«, oder: »Blut ist ein ganz besonderes Getränk.« Ich war damals sogar extra nach Paris gefahren, um die Veröffentlichung erst einmal zu stoppen, und hatte hierfür dem Verlag eine Sammlung der schlimmsten übersetzerischen Stilblüten unterbreitet: Ein Oberlicht etwa, das zu einem im Französischen inexistenten lumière supérieure geworden war, eine Segeltuchtasche, die als sac en drap de voile nach Frankreich unterwegs war und dort wohl schulterzuckend als deutsches Kuriosum wahrgenommen würde, ganz zu schweigen von einem Kehler Manuskript, das es als manuscrit Kehler ins Französische geschafft hatte und gewiss eine vergebliche Suche nach einem Herrn Kehler in Gang setzen würde, dessen man selbst in Kehl nicht würde habhaft werden können.
Im Rückblick hatte ich die Kontaktaufnahme zu diesem Herrn Balzac wohl auch deswegen gemieden. Ich wollte mich nicht für einen Text rechtfertigen müssen, den ich – recht besehen – ja gar nicht geschrieben hatte. Übersetzungen sind wie Kinder, die man zur Adoption freigegeben hat und deren Schicksal man nur mit Sorge und Kummer aus der Ferne verfolgen, aber kaum beeinflussen kann. Dieses Kind war in Frankreich so gründlich missraten, dass ich wenig Neigung verspürt hatte, dort als der biologische Vater in Erscheinung zu treten, umso weniger, als das Kind ja durch und durch französischen Ursprungs war und wenig Deutsches vorzuweisen hatte. Schon die Empfängnis, wenn man die Analogie fortführen will, hatte in Paris stattgefunden, an einem Sonntagnachmittag im Louvre, als ich das Gemälde zum ersten Mal gesehen hatte: zwei Damen in einer Badewanne, von denen eine die Brustwarze der anderen zwischen spitzen Fingern hält, als prüfe sie, ob der Milcheinschuss schon stattgefunden hat. Über Jahre hatte ich versucht herauszufinden, was es mit diesem seltsamen Motiv auf sich hatte. Die historischen Hintergründe des Gemäldes von Deutschland aus zu recherchieren, erwies sich bald als unmöglich. Die wichtigsten Quellen lagen in Frankreich, dreifach unerreichbar durch die geografische Entfernung, ein kompliziertes und langwieriges Fernleihesystem, und mein damals noch kümmerliches Schulfranzösisch. Es blieb nichts anderes übrig, als nach Paris zu ziehen, Französisch zu lernen und die Quellen vor Ort zu studieren. Ein ziemlich verrücktes Vorhaben, das sowohl meine studentischen Hungerjahre noch eine Weile verlängerte als auch mein Leben für längere Zeit in frankofone Bahnen lenkte, was hier jetzt zu weit führen würde. Ich möchte im Grunde nur andeuten, mit welch gemischten Gefühlen ich nach Toulouse unterwegs war. Ich hatte diesem Bild fast sieben Lebensjahre gewidmet. Es hatte mich niemand gezwungen, jahraus, jahrein Archive zu durchforsten und Museen und Galerien nach einer Erklärung für ein ikonografisches Rätsel zu durchstreifen. Weit von einem Teufelspakt entfernt, war ich dennoch wie besessen davon gewesen, verhext, bis ich durch einen Zufallsfund in Brieffragmenten aus dem Medici-Archiv von Florenz einer möglichen Lösung des Rätsels ziemlich nahekam. Auf einmal ergab das alles einen nachvollziehbaren Sinn – und wenn ich auch gezwungen war, in Ermangelung von Lebenszeugnissen des anonymen Malers die Entstehungsgeschichte des Gemäldes an einer fiktiven Künstlerbiografie aufzuhängen, so war doch die Wahrscheinlichkeit, dass sich alles so oder ähnlich zugetragen hatte wie von mir erfunden, nicht geringer als alles andere, was zuvor darüber geschrieben worden war.
Monsieur Balzac hatte das anders gesehen, klar und deutlich von Fehlern gesprochen, von falschen Schlüssen und notwendigen Korrekturen. Sein Wissen über die Familiengeschichte hatte er wohl mit ins Grab genommen. Aber vielleicht gab es in seiner Bibliothek noch Quellen, die ich nicht kannte oder übersehen hatte?
Ich fuhr für eine Woche. Eine Unterkunft hatte ich noch nicht, aber es gab um diese Jahreszeit so viele Angebote, dass ich beschlossen hatte, lieber spontan vor Ort etwas zu suchen, als Fotos im Internet zu vertrauen.
Die anderthalb Stunden vom Flughafen nach Saint-Maur vergingen wie im Flug. Und kaum war ich eine halbe Stunde unterwegs, stellte sich eine merkwürdige Veränderung ein. Es war, als ob etwas von mir abfiele, aber es war kein Urlaubsgefühl, wie ich es kannte. Etwas anderes, Unbekanntes ergriff von mir Besitz. Die Landschaft war unfassbar schön, rollte in alle vier Himmelsrichtungen in sanften Wogen auf den Horizont zu, sinnlich wie ein weiblicher Körper, la terre in all ihrer Pracht. Wie so oft, wenn mich etwas wirklich berührte, verband sich sofort ein Leseerlebnis damit. Vielleicht hatte meine Ex-Frau sogar recht mit ihrem Vorwurf, dass ich außerhalb von meinen »verdammten Büchern« zu gar keinen Emotionen fähig war. Und möglicherweise betraf dies nicht nur meine Bücher, sondern einfach alle? Geschichten. Sprache. Gab es denn überhaupt Gefühle ohne Worte?
Du haut des côtes, descendre et s’enfoncer dans le creux des paysages …, hörte ich eine Stimme in mir. Von Hügeln herunterfahren in die Ebenen hinein, wie auf Flügeln die Landschaft abseits der Straße erkunden, die sich, wenn man näher kommt, ausweitet und in Blüte steht, im Nu ein Dorf durchqueren und mit einem Blick einfangen.1Als wäre ich wieder sechzehn und erlebte zum ersten Mal das unbeschreibliche Glücksgefühl einer Fahrradfahrt im Sommer. Oder säße als sechsundzwanzigjähriger Literaturstudent wieder in der romanistischen Bibliothek, völlig versunken in Alain-Fourniers Roman, gleich seiner Hauptfigur im Bann des »Großen Meaulnes«. Monatelang hatte mir dieses Buch das Gefühl gegeben, unheilbar krank und zugleich rekonvaleszent zu sein. So war es eben mit mir. Sogar das Paradies meiner frühen Jugend hatte ich in einem Roman verloren. Natürlich war das lange zuvor geschehen; aber erst durch dieses Buch war es wahr geworden.
4. Kapitel
Als ich das Anwesen auf immer enger werdenden Straßen schließlich erreichte, stand die Nachmittagssonne schräg am Himmel. Mein erster Gedanke war, was für ein Privileg es sein musste, an einem solchen Ort zu sterben. Ganz davon zu schweigen, dort gelebt haben zu dürfen. Das Haus, oder vielleicht sollte man besser sagen, das Schlösschen, erwies sich als ein dreistöckiges Schmuckstück mit zwei Flügeln. Es lag in einem kleinen Park, der nichts Barockes im Stil von Le Nôtre hatte, sondern eher das geheimnisvoll Verwinkelte eines Watteau. Das Gebäude thronte auf einer kleinen Anhöhe. Ein stellenweise von Moos bewachsenes Schieferdach schimmerte in der Sonne. Die Fassade war schlicht und enthielt drei Fensterreihen, die mittlere doppelt so hoch wie die beiden anderen, alles in hellbeigem Sandstein gehalten. Zwei Umzugswagen standen auf dem Parkplatz, außerdem mehrere Pkw unterschiedlicher Marke, alle aus dem gehobenen Segment. Ich lenkte meinen gemieteten Peugeot auf die gegenüberliegende Seite des Vorplatzes, parkte in ausreichender Entfernung von der Freitreppe und stieg aus. Ich ging ein paar Schritte auf dem hellgrauen Kies und hielt nach Möbelpackern oder Bewohnern Ausschau. Aber es war niemand zu sehen.
Ein zweiflügeliges Holztor unterhalb der Freitreppe war verschlossen. Ebenso die beiden Fenster links und rechts davon. Ich vermutete, dass sich dahinter Stallungen oder Abstellräume für Kutschen befanden. Die Freitreppe führte beidseitig auf eine Empore vor ein zweiflügeliges Portal. Ich wartete einen Augenblick, ob irgendjemand von irgendwoher zum Vorschein kommen und es mir abnehmen würde, dort hinaufzusteigen und ungefragt anzuklopfen. Aber nichts rührte sich. Es war völlig still. Kein Vogel sang. Keine Katze schlich heran, um mich misstrauisch aus der Entfernung zu beobachten, kein Hund kam um die Ecke geschossen, um einen fremden Eindringling auf seinem Territorium zu stellen. Meine Schuhe knirschten bei jedem Schritt auf dem Kies. Es war das einzige Geräusch weit und breit. Doch als ich die ersten Stufen der Treppe erklommen hatte, vernahm ich ein Geräusch, das durch die vorherige Stille umso unerwarteter war: Ein Geigenton war plötzlich zu hören, irgendwo tief drinnen im Haus. Ich blieb unwillkürlich stehen. Die Melodie erklang ein paar Takte lang, brach ab, begann von Neuem, erreichte nicht die gleiche Stelle wie zuvor, setzte wieder an, energischer, wie mit größerer Entschlossenheit, gelangte über die zuvor erreichte Stelle hinaus, aber nicht sehr weit, bis sie wieder abbrach. Dann wieder Stille.
Ich zögerte und gab mir schließlich einen Ruck, denn ich konnte ja nicht ewig hier stehen bleiben. Ich würde anklopfen oder klingeln, mich vorstellen, einige Freundlichkeiten austauschen, mich erkundigen, wann ich kommen dürfte, um mein Anliegen vorzutragen, und mir dann in der Nähe eine Unterkunft suchen. So war jedenfalls der Plan.