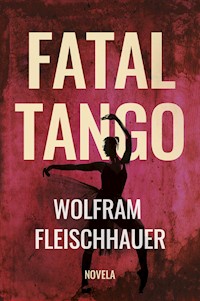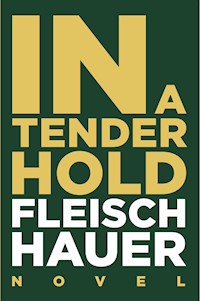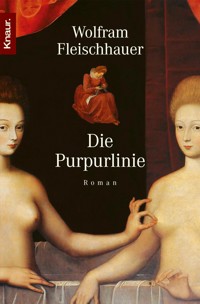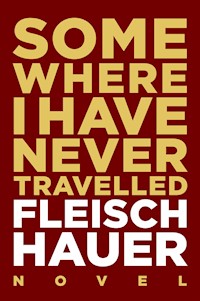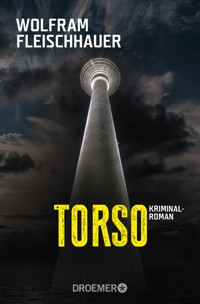
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Gier, Geld und Geschäfte: Ein atemloser Polit-Thriller um einen außergewöhnlichen Fall inmitten von Berlin In einem verlassenen Plattenbau in Berlin-Lichtenberg macht die Polizei eine grausige Entdeckung - ein Frauen-Torso mit Ziegenkopf, gehüllt in mittelalterlich anmutendes Tuch. Der bizarre Fund bleibt nicht der einzige seiner Art. Noch am selben Morgen stößt eine Putzfrau in einem Club auf ähnlich schockierend inszenierte Leichenteile. Hauptkommissar Martin Zollanger befürchtet eine Mordserie – oder ist es das makabre Statement eines Psychopathen? Zollanger tappt im Dunkeln und zweifelt angesichts solcher Monstrositäten am Sinn seines Berufes. Unterdessen sucht die junge Streetworkerin Elin vergeblich das Gespräch mit ihm. Sie ist überzeugt, dass ihr Bruder, der sich in Berlin das Leben genommen haben soll, ermordet wurde. Kurz vor seinem Tod hatte er schreckliche Angst – doch warum sollte der allseits beliebte, erfolgreiche IT-Spezialist einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein? »Torso« von Wolfram Fleischhauer ist ein eBook von Topkrimi – exciting eBooks. Das Zuhause für spannende, aufregende, nervenzerreißende Krimis und Thriller. Mehr eBooks findest du auf Facebook. Werde Teil unserer Community und entdecke jede Woche neue Fälle, Crime und Nervenkitzel zum Top-Preis!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Wolfram Fleischhauer
TORSO
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In einem verlassenen Plattenbau in Berlin-Lichtenberg macht die Polizei einen grausigen Fund: ein Frauentorso mit Ziegenkopf, gehüllt in blaugoldenes Tuch. Kurz darauf findet man in der Putzkammer eines Szene-Clubs ein totes Lamm, in das ein weiblicher Arm eingenäht ist. Kommissar Martin Zollanger befürchtet eine Mordserie – oder ist es doch »nur« Leichenschändung, will jemand ein makabres künstlerisches Statement abgeben? Während Zollanger grübelt, wartet die junge Streetworkerin Elin Hilger auf dem Präsidium umsonst auf ihn. Sie ist überzeugt, dass ihr Bruder, der sich in Berlin das Leben genommen haben soll, ermordet wurde. Kurz vor seinem Tod hatte er schreckliche Angst – doch warum sollte der allseits beliebte junge Mann einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein? Noch weiß niemand, dass die beiden Rätsel eng verknüpft sind. Und dass jemand sich aufgemacht hat, Rache zu nehmen für einen gesellschaftlichen Skandal ungeheuren Ausmaßes …
Inhaltsübersicht
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
Nachwort
Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie?
Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?
BERTOLT BRECHT
1
Martin Zollangers Handy klingelte um 4:37 Uhr. Er war bereits wach. Er schlief schon seit vielen Jahren schlecht, wachte nachts fast jede Stunde auf, den Blick auf das rot leuchtende Display seines Weckers gerichtet, der stets derartige Zeiten anzeigte. Aus dem nächtlichen Tiergarten drang kein Laut, und die einzigen Geräusche, die in der Dunkelheit zu vernehmen gewesen waren, bevor das Handy zu summen begann, waren das leise Rauschen der Zentralheizung und das leichte Pfeifen seines Atems.
Das Pfeifen war nicht immer da. Manchmal blieb es wochenlang aus. Dann plagte es ihn plötzlich über mehrere Tage und Nächte. Er hätte längst zum Arzt gehen sollen. Aber er schob es hinaus. Mit einundsechzig ging man nicht mehr so gern zum Arzt.
»Martin?«
Zollanger hatte Udo Brenners Stimme sofort erkannt. Der Grund, warum Udo ihn um diese Zeit anrief, war nicht erklärungsbedürftig. Daher fragte er nur:
»Wo?«
»Lichtenberg«, lautete die Antwort.
»Mann? Frau?«
»Offenbar schwer zu sagen. Wir sollen gleich kommen.«
Zollanger saß bereits aufrecht im Bett.
»Thomas und Sina sind schon hier«, erklärte Udo Brenner. »Harald und Günther sind auf dem Weg. Nur Roland habe ich noch nicht erreicht. Aber seine Frau sagt ihm Bescheid.«
Seine Frau, dachte Zollanger. War Roland Draeger nicht geschieden? Offenbar hatte er die neueste Entwicklung im Leben seines jüngsten Mitarbeiters nicht mitbekommen.
Fünf Minuten später war er angezogen und auf dem Weg in die Tiefgarage. Die Fahrbahn war nass, aber es regnete nicht, als er die Auffahrt zur Bartningallee hinauffuhr und dann auf die Altonaer Allee einbog. Acht Minuten später parkte er im Innenhof des Dienstgebäudes in der Keithstraße.
Als er die Büroräume der siebten Mordkommission erreicht hatte, traf er auf Sina Haas und Thomas Krawczik. Sie hatten ihre Dienstwaffen geholt und waren einsatzbereit. Harald Findeisen und Günther Brodt, die beiden Tatortleute, hatten den Mordbus genommen und waren bereits losgefahren. Udo Brenner war mit ihnen aufgebrochen. Als Zollanger seine Waffe geholt hatte, kam endlich auch Roland Draeger an. Damit waren sie komplett. Es wurde nicht viel gesprochen. Draeger und Krawczik nahmen einen Dienstwagen. Sina fuhr bei Zollanger in dessen privatem Pkw mit. Zollanger fuhr zügig, ließ das Blaulicht jedoch ausgeschaltet. Die Straßen waren noch so gut wie leer. Der Berufsverkehr würde erst in einer Stunde beginnen.
»Weißt du Genaueres?«, fragte Sina.
»Nur, dass das Opfer offenbar schlimm zugerichtet ist. Udo hat gesagt, sie wüssten nicht einmal, ob es ein Mann oder eine Frau ist.«
»Mittlerweile wissen sie’s.«
»Und?«
»Frau«, sagte Sina. »Beziehungsweise Reste davon.«
»Wer ist dort?«
»Kripo Lichtenberg.«
»Kennen wir die Kollegen?«
»Ich nicht. Karlow und Teschner.«
Zollanger zuckte mit den Schultern. »Nie gehört.«
Sina gähnte und schaute aus dem Fenster. Der Nachtclub gegenüber dem Bundesratsgebäude entließ ein Grüppchen Clubgäste. Die hell erleuchteten Schaufenster der Friedrichstraße trieben vorüber. Dann meldete sich Udo Brenner über Funk.
»Wir sind vor Ort, Chef. Soll ich kurz berichten?«
Zollanger überlegte kurz. »Ist die Sache eilig?«
»Sieht nicht so aus«, meinte Brenner. »Seltsam. Aber nicht eilig.«
»Gut. Dann warte, bis ich da bin.«
Sina schaute zu Zollanger hinüber. Der schaltete den Funk ab.
»Feind hört sicher mit«, sagte er. »Die Presse rückt uns schon noch früh genug auf den Leib.«
Zwölf Minuten später trafen sie vor Ort ein. Brodt und Findeisen hatten den Mordbus halb auf dem Gehsteig hinter den zwei Streifenwagen vor dem Gebäude geparkt. Der Wagen der Kripo stand in zweiter Reihe daneben, der von Roland und Thomas auf der anderen Straßenseite. Zollanger lenkte seinen Wagen auf die freie Stelle daneben.
Karlow und Teschner erwarteten Zollanger am Mordbus. Die anderen standen dabei und stellten ihre leise Unterhaltung ein, als Zollanger und Sina zu ihnen traten.
»Sie sollten sich das lieber selbst ansehen, bevor wir es Ihnen zu schildern versuchen«, sagte Karlow.
»Wo ist die Leiche?« fragte Zollanger.
Karlow deutete auf das Gebäude. »Dort oben. Achter Stock.«
»Waren Sie beide da?«
»Nein, nur ich«, erwiderte Teschner.
Harald Findeisen verteilte Gummihandschuhe und weiße Einwegüberschuhe. Günther Brodt hantierte an seiner Kamera herum und schaltete den Blitz ein. Ein leises Fiepen ertönte. Zollanger öffnete eine Klappe an der Innenseite des Busses und holte eine Taschenlampe heraus.
»Ich gehe jetzt erst einmal mit Harald und Günther alleine hoch«, sagte er. »Kollege Teschner, zeigen Sie uns bitte den Weg.«
Er wollte sich erst ein Bild von der Sache machen. Ein Bild! Hätte dieser Teschner ihn nicht warnen können. Sie gingen im Gänsemarsch den Trampelpfad entlang. Immerhin hatten die beiden Kripoleute gut reagiert und einen Weg auf Asphalt gewählt, auf dem keine Spuren zu erwarten waren. Sie näherten sich dem Haupteingang von der Seite. Die Fläche vor dem Gebäude war teilweise aufgerissen. Mit etwas Glück könnte man dort später Fußspuren im aufgeweichten Untergrund finden.
Bevor sie das Treppenhaus betraten, flimmerte plötzlich etwas vor Zollangers Augen. Er blieb stehen und richtete den Strahl der Taschenlampe nach vorn. Lautlos schwebten vereinzelte Schneeflocken zu Boden.
»Es gibt zwei Treppenhäuser«, sagte Karlow. »Wir müssen das östliche nehmen. Hier entlang.«
2
Elin wartete bereits seit einer Stunde. Die Holzbank begann allmählich unbequem zu werden, aber sie blieb sitzen. Behörden, dachte sie. Immer das Gleiche. Sozialamt. Arbeitsamt. Ausländerbehörde. Immer hatte man dort alle Zeit der Welt. Klar. Schließlich war die Zeit derer, die hier aufkreuzten, völlig wertlos. Null. Bei den Bullen war es offenbar ebenso.
Ihr Termin war um zehn Uhr gewesen. Jetzt war es fünf vor elf, und noch immer war keine Frau Wilkes erschienen, um sie abzuholen. Frau Wilkes. Was interessierte sie Frau Wilkes. Sie hatte einen Termin mit einem gewissen Zollanger. Hauptkommissar. Der hatte die Antworten auf ihre Fragen. Keine Frau Wilkes.
Elin stand auf und vertrat sich ein wenig die Beine. Der Aufpasser in seinem Glaskasten neben der Treppe schaute kurz zu ihr auf, widmete sich jedoch dann wieder seiner Zeitung. Ein grünes Lämpchen im Querbalken des Metalldetektors blinkte sinnlos vor sich hin. Elin setzte sich wieder.
Zum hundertsten Mal überlegte sie, wie sie beginnen würde. Mit Erics letztem Besuch bei ihr in Hamburg? Mit seiner merkwürdigen Verfassung? Nein. Das wussten die ja. Und es passte zu ihrer Selbstmordtheorie. Eric sei depressiv gewesen. Und hoch verschuldet. Ergo.
Sie biss die Zähne aufeinander und versuchte, nicht an dieses letzte Treffen zu denken. Aber es gelang ihr nicht. Als sei es gestern gewesen, sah sie ihn auf der Matratze ihres Zimmers in der Hafenstraße sitzen, hager, mit Dreitagebart, aufgekratzt wie immer und dennoch irgendwie völlig verändert. Seine blauen Augen strahlten, wenn er von seinen Projekten erzählte. Seine drei Handys steckten in Ledertaschen an seinem Gürtel. Sein ewiger Begleiter, ein Ledermäppchen mit winzigen Schraubenziehern, mit denen man jeden PC aufbekam, lag neben seinem schwarzen Rucksack. Das war Eric. Drei Handys und ein paar Uhrmacherschraubenzieher. Und seine immergleichen Fragen, warum sie in so einem Slum wohnte, noch immer für die soziale Revolution kämpfen wollte, anstatt in die technische mit einzusteigen. Die wahre Subversion finde heute nicht auf der Ebene von Betriebsräten, sondern auf der Ebene von Betriebssystemen statt. Die Waffe gegen das System sei nicht mehr die Faust, sondern der Quellcode. Und so weiter.
Das hatte er schon immer erzählt. Aber bei diesem letzten Besuch vor vier Monaten hatte es nur noch wie eine Tonspur geklungen, eine Ansammlung von Phrasen über einem tiefen Schweigen. Aber sie hatte ihn nicht darauf angesprochen. Eric war Eric. Ihr großer Bruder. Der einzige Mensch, der ihr wirklich etwas bedeutete. Der Neunjährige, der neben ihr gestanden hatte am Grab ihrer Mutter, der ihre Hand hielt, ihr zuflüsterte, dass er sie niemals verlassen würde. Der Zwölfjährige, der ihr erklärte, dass Papa nichts dafür konnte. Dass Papa ein verzweifelter Mensch sei und sie Mama zuliebe Geduld mit ihm haben müssten. Der Fünfzehnjährige, der sie nicht verriet, als sie weglief. Und der Achtzehnjährige, der ihr das Leben gerettet hatte.
Eric war ihre einzige Verbindung zu dieser anderen Welt gewesen. Der Welt der Fleischfresser und Geldbenutzer. Der Macker und Tussis. Der Soistesnunmals und Kannmannichtsmachens. Auch wenn er dazugehörte. Auch wenn er im Grunde genauso wie Papa war mit seinen Frauengeschichten, seiner Oberflächlichkeit. Eric, das waren ein Paar Designerjeans und ein Laptop. Papa ein Designerhemd und ein Fotoapparat. Ihr Papa, Edmund Hilger, Platzhirsch unter den Hamburger Modefotografen. Mit dreiundzwanzig bei der Vogue. Mit vierundzwanzig hatte er die schwedische Vizeschönheitskönigin Marie Svensson erst fotografiert, dann geschwängert, geheiratet und schließlich erfolgreich zu Tode betrogen. Oder woher bekam eine zuvor kerngesunde, bildschöne Frau mit dreiunddreißig Jahren plötzlich Krebs, wenn nicht von Edmund Hilgers verlogenem Ego. Ja, davon hatte Eric durchaus auch etwas gehabt. Aber es war eben auch etwas von Marie Svensson in ihm gewesen, etwas Menschliches, ein Herz vielleicht oder eine Seele, irgendetwas in dieser Art, das Edmund Hilger nicht einmal vorgab zu besitzen.
Aber sollte sie das diesem Herrn Hauptkommissar erzählen? Ihre und Erics Familiengeschichte. Früher Tod der Mutter. Verhältnis zum Vater zerrüttet. Tochter jahrelang Straßenkind und heute in der Hamburger Attac-Szene. Hausbesetzerin. Militante Vegetarierin. Sohn in der Computerbranche, gescheiterter Existenzgründer. Ergo: Selbstmord.
»Frau Hilger?«
Sie hatte die Frau gar nicht kommen sehen. Elin erhob sich. Die Frau trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Elin schaute auf sie herab. Sie spürte, wie der Blick der Beamtin sie scannte. Das kleine Bindi zwischen ihren Brauen! Die kurzen blonden Haare. Die Lederjacke.
»Wilkes«, sagte die Frau jetzt. »Es tut mir leid, aber Herr Zollanger kann Sie heute nicht empfangen. Er ist bei einem Einsatz. Ich muss Sie bitten, ein anderes Mal wiederzukommen.«
»Wann?«
»Sie müssten einen neuen Termin ausmachen. Vielleicht am Montag per Telefon.«
»Ich habe zehn Tage auf diesen Termin gewartet.«
»Ja. Und wir können es uns nicht aussuchen, wann in Berlin Straftaten begangen werden. Worum geht es denn überhaupt?«
Elin versuchte, sich zu beherrschen, aber es fiel ihr schwer. Montag. Drei Tage. Sie hatte Pläne gehabt für das Wochenende. Pläne, über die sie mit diesem Bullen hatte sprechen wollen.
»Es geht um meinen Bruder. Eric Hilger. Hier ist das Aktenzeichen.«
Sie gab der Frau einen Zettel. Die schaute das Papier verständnislos an.
»Ich begreife gar nicht, wieso er Sie überhaupt hat herkommen lassen. Über Ermittlungssachen kann er gar nicht mit Ihnen sprechen.«
»Er hat den Tod meines Bruders untersucht. Warum sollte er nicht mit mir sprechen?«
»Weil er es nicht darf. Sie müssen sich an die Staatsanwaltschaft wenden, beziehungsweise Ihr Anwalt.«
Elin atmete einmal tief durch, bevor sie weitersprach.
»War die Staatsanwaltschaft vielleicht im Tegeler Forst?«, fragte sie.
»Frau Hilger, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur …«
»Aber ich kann es Ihnen sagen: Es war kein Staatsanwalt vor Ort, als mein Bruder gefunden wurde. Auch kein Gerichtsmediziner. Weil die Polizei von Anfang an von einem Selbstmord ausgegangen ist. Zwei Streifenpolizisten haben ihn einfach abgeschnitten und ins Leichenhaus gebracht. Es wurde überhaupt nichts richtig untersucht.«
Frau Wilkes schüttelte den Kopf.
»Da müssen Sie sich schon an die Staatsanwaltschaft wenden, liebes Mädchen. Hauptkommissar Zollanger wird Sie nicht empfangen, das kann ich Ihnen garantieren. Guten Tag.«
Elin schaute der Frau hinterher. Ihr Herz klopfte. Nach einer Weile bemerkte sie, dass sie den Umschlag in ihrer Hand fast zerdrückt hatte. Sie strich ihn glatt, schob ihn in ihren Rucksack, schulterte ihn mit einer wütenden Bewegung und verließ das Gebäude.
Das Schneetreiben hatte an Stärke zugenommen. Die Straßen waren weiß. Die Autos fuhren vorsichtig. Auf Elins Fahrrad türmten sich kleine Schneehauben. Sie strich den Sattel frei, öffnete das Schloss und fuhr Richtung Kanal davon.
Tanja Wilkes beobachtete sie aus ihrem Büro. Fahrrad, dachte sie. Bei diesem Wetter. Dann verfasste sie eine Notiz für den ersten Hauptkommissar und vergaß den Vorfall.
Re: Ihr Termin heute 10:00 Uhr mit Elin Hilger, Schwester des Verstorbenen Eric Hilger (Selbsttötung/Aktenzeichen 1 Kap Js 3412/01). Bez. Hilger um 11:08 Uhr in Ihrer Abwesenheit empfangen und an Staatsanwaltschaft verwiesen. Wird vermutlich nicht erneut vorstellig werden. Gez. Wilkes.
3
Zollanger hatte sich für seine Zigarettenpause in die siebte Etage zurückgezogen. Aber selbst hier verfolgte ihn dieses Ding. Er sah es vor sich, ganz gleich, wohin er schaute, wie es dort oben auf dem Boden lag, gut ausgeleuchtet, wie ein verdammtes Kunstwerk. Er konnte seine Kollegen im oberen Stock gut hören, wenn sie sich etwas zuriefen oder Material bewegten. Findeisen war dabei, letzte Fotos zu schießen. Draeger ordnete sichergestellte Spuren.
Zollanger hatte seinen weißen Schutzanzug geöffnet und die Handschuhe ausgezogen. Schade, dachte er, dass die Anzüge nicht über die Augen reichten. Auch nach nun fast vier Stunden verstörte ihn der Anblick immer noch. Ja, es schien ihm sogar durch die Betondecken hindurch hinterherzustarren.
Er blickte in das Schneetreiben hinaus und rauchte. Berlin-Lichtenberg lag sieben Stockwerke unter ihm, aber durch das Schneegestöber war die Sicht schlecht. Die Dächer der Türme am Frankfurter Tor waren schemenhaft zu erkennen. Der Alex war verschwunden. Wenn es früher zu schneien begonnen hätte, wäre das von Vorteil gewesen. Wer immer das Ding hier deponiert hatte, hätte wenigstens Fußspuren hinterlassen. So war der Schnee nur ein Störfaktor.
Er spürte, dass jemand neben ihn getreten war. Es war Udo Brenner.
»Willst du auch eine?«, fragte Zollanger, griff in seine Manteltasche und nestelte ein Päckchen Club-Zigaretten hervor.
»Frühstück wär’ mir so langsam lieber.«
»Unten gibt’s Kaffee.«
»Ohne Fahrstuhl. Nee danke.«
Du mit deinen dreiundfünfzig wirst das ja wohl noch schaffen, dachte Zollanger, sagte aber nichts.
»Warum wohl ausgerechnet acht?«, fragte er stattdessen.
»Das wundert dich?«, gab Udo Brenner zurück. »Sonst nichts?«
Zollanger ließ seine Zigarette auf den rauhen Betonboden fallen, trat sie aus und steckte fröstelnd die Hände in seine Manteltaschen. Brenner hatte recht. Vor dem Frühstück schmeckten die Dinger nicht besonders. Nicht mal seine geliebten alten Ostzigaretten.
»Ich frage mich nur: Warum schleppen die Typen das Ding ausgerechnet ins achte Stockwerk? Warum nicht ins zehnte oder dritte? Es sieht doch überall gleich aus. Alle Wände weg. Alle Fenster. Rohbau sozusagen. Hätte es der dritte Stock nicht auch getan?«
Brenner zuckte mit den Schultern. »Du meinst also, es waren mehrere Männer?«
Knipste Findeisen da oben immer noch herum? Digitaltechnik, dachte Zollanger. Er war in einer anderen Welt groß geworden. Der Welt des Mangels. Da überlegte man, bevor man Bilder schoss, und knipste nicht einfach besinnungslos drauflos. Was nützten ihm Hunderte von Fotos von einem Torso?
»Frauen waren es sicher nicht«, sagte er.
»Warum?«
»So eine Scheiße macht keine Frau. Und das Ding wiegt gut und gerne vierzig Kilo.«
»Rollkoffer«, entgegnete Brenner. »Kein Problem heutzutage.«
»Ja. Da hast du auch wieder recht. Kein Problem.«
»Du traust Frauen zu wenig zu.«
Zollanger erwiderte nichts. Ein dunkelgrüner Kleinbus kam auf einmal unten auf der Straße herangekrochen. Die weiße Aufschrift auf der Seite war aus der Entfernung nicht zu lesen, aber Zollanger wusste auch so, was darauf stand: Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin Berlin. Der Wagen schlich die Siegfriedstraße entlang, ein gut sichtbarer dunkelgrüner Kasten im bereits wieder schwächer werdenden Schneetreiben. Er kam neben den zwei Streifenwagen zum Stehen. Trotz des schlechten Wetters hatte sich eine kleine Traube von Schaulustigen gebildet, die immer wieder neugierig zu ihnen heraufschauten.
»Kriegen noch Genickstarre da unten«, brummte Brenner ungehalten. »Worauf warten die bloß? Leuchtreklame, oder was?«
Zollangers Handy klingelte.
»Ja?«
»Frieser hier. Wie siehts aus?«
»Wir sind bald fertig, haben aber nicht viel«, sagte Zollanger. »Der Notruf kam aus einer Telefonzelle Siegfried-/Ecke Bornitzstraße. Männliche Stimme.«
»Anonymer Anruf also.«
»Ja. Das Gebäude wird demnächst abgerissen. Angeblich treiben sich oft Obdachlose darin herum, die manchmal auch hier übernachten. Wir haben jede Menge Müll gefunden, der vielleicht etwas hergibt. So, wie das Ding zurechtgemacht ist, sollte es wohl auch gefunden werden.«
»Haben Sie die Telefonzelle untersucht?«
»Auf dem Hörer sind die Fingerabdrücke von halb Lichtenberg. Ein Kondom lag auch in der Kabine. Gebraucht. Haben wir sichergestellt.«
»Na prima«, bemerkte Frieser. »Wir sollten in dieser Stadt dazu übergehen, es als sonderbar zu vermerken, wenn keine gebrauchten Kondome herumliegen. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten?«
»Nein. Abgesehen von einem weiblichen Torso, in den jemand einen Gewindestab hineingerammt hat, um einen Ziegenkopf darauf aufzuspießen, ist hier nichts auffällig.«
Der Staatsanwalt verstummte für einen Augenblick. »Ich frage ja nur«, sagte er dann. »Hat Weyrich sich schon geäußert? Irgendwelche ersten Erkenntnisse, die uns helfen können?«
»Er vermutet, dass das Opfer in gefrorenem Zustand zerlegt wurde. Genaueres will er aber erst sagen, wenn er die Leiche im Institut untersucht hat. Der Wagen vom Institut ist gerade gekommen. Weyrich sitzt unten im Mordbus und trinkt Kaffee. Wollen Sie mit ihm sprechen, bevor er in die Invalidenstraße fährt?«
»Nein. Wir sehen uns ja nachher sowieso alle dort. Wann fahren Sie los?«
»Innerhalb der nächsten halben Stunde, hoffe ich. Ein paar Leute sind noch unterwegs und befragen die Anwohner, ob irgendjemand etwas gesehen hat. Sobald der Torso weg ist, brechen wir auf.«
»Also noch keinerlei Anhaltspunkt für eine Ermittlungsrichtung?«
»Wie ich schon sagte. Außer einem weiblichen Rumpf mit einem Ziegenkopf haben wir nicht viel.«
Brenner drehte die Augen zum Himmel, verbiss sich aber einen Kommentar. Staatsanwälte.
»Was sagen wir der Presse, falls jemand nachfragt?«, fragte Zollanger und lauschte in sein Handy nach einer Antwort. Es dauerte einige Sekunden, bis Frieser sich äußerte.
»Erst einmal gar nichts. Wir warten auf Weyrichs Bericht. Bisher wissen wir überhaupt nicht, womit wir es zu tun haben. Bis später.«
»Wo er recht hat, hat er recht«, sagte Zollanger.
Sie kehrten in den achten Stock zurück. Hinter sich hörten sie bereits die Schritte der Leute aus der Gerichtsmedizin. Das Ding lag noch immer an der gleichen Stelle. Zollanger ging langsam darauf zu.
Als sie den Rumpf heute Morgen gefunden hatten, lehnte er an einem der Betonpfeiler des Plattenbaus. Jetzt lag er auf einer hellen Plastikplane. Die Schnittstellen, wo die Oberschenkel abgetrennt worden waren, konnte man gut erkennen. Ebenso, dass es sich um den Rumpf einer Frau handelte. Abgesehen von den entsetzlichen Wunden, wo die Gliedmaßen entfernt worden waren, wies der Rumpf keine sichtbaren Verletzungen auf. Weder am Geschlecht noch an den Brüsten waren Spuren von Gewaltanwendung zu sehen. Ein Umstand, den Zollanger mit Erleichterung zur Kenntnis nahm. Immerhin nicht das. Keine zerschnittenen Geschlechtsteile. Keine Anzeichen von Folter oder so etwas. Oder vielleicht doch? Oder noch etwas Schlimmeres?
Wie alt mochte die Frau gewesen sein? Zwischen fünfundzwanzig und fünfunddreißig, hatte Weyrich spontan geschätzt. Und Weyrich hatte viel Erfahrung. Aber half ihnen das? Zollangers Blick wanderte über den Torso hinauf bis zu der Stelle, wo alle Logik und Erfahrung abrupt endeten. Weyrich hatte den Ziegenkopf, der anstelle des menschlichen Hauptes auf dem Hals saß, ein wenig nach oben geschoben, um die Befestigung sichtbar zu machen. Zollanger ging in die Hocke und blickte von unten in den Schädel des getöteten Tieres hinein. Er sah Wirbelknochen, einen Teil der Luftröhre, das Zungenbein und dazwischen eine grau schimmernde Gewindestange, die aus dem Schädel nach unten herauswuchs und tief in den Torso hineingerammt worden war. Eine banale Gewindestange, wie man sie in jedem Baumarkt kaufen konnte. Die Stoffbahnen, mit denen der Rumpf drapiert gewesen war, befanden sich bereits in Plastikbeuteln. Zollanger musterte die Beutel, die dunkelblaue Farbe des einen Tuches und die mattgoldene des anderen.
Zwei Männer mit einer Blechwanne erschienen auf dem Treppenabsatz. Zollanger erhob sich wieder und trat zur Seite. Von geräuschvollem Rascheln begleitet, wurde die Plastikplane über dem Ding zusammengefaltet. Die Männer wuchteten das Paket in die Blechwanne hinein.
Zollanger warf Brenner einen kurzen Blick zu. Der nickte nur. Er dachte wohl das Gleiche.
Rollkoffer?
Zollanger und Brenner folgten den Männern mit etwas Abstand nach unten. Als sie das Erdgeschoss erreichten, kam Sina Haas auf sie zu und reichte ihnen einen Becher dampfenden Kaffee.
»Danke, Sina. Nett von dir.«
»Keine Ursache, Chef. Ihr solltet schnell trinken, sonst gibt’s nur Schneewasser.«
Sina war der angenehmste Neuzugang des letzten Jahres, dachte Zollanger. Eine Frau so ganz nach seinem Geschmack. Charmant ohne jede Koketterie. Sie stammte aus Dresden, hatte ein paar Semester Psychologie studiert, das Studium jedoch aus Geldnot abgebrochen. Sie war ehrgeizig und dank ihrer psychologischen Kenntnisse äußerst kreativ bei der Fallanalyse. Sie hatte im Grunde nur zwei Fehler: Sie war etwa dreißig Jahre zu jung für ihn und außerdem fest liiert mit einem sympathischen und gutaussehenden Kinderpsychologen.
Zollangers Handy klingelte erneut.
»Ja.«
»Hier ist noch mal Frieser.«
»Was gibt’s?«
»Sind Sie noch in Lichtenberg?«
»Ja. Aber schon so gut wie weg. Wir sind auf dem Weg ins Büro.«
»Fahren Sie bitte sofort nach Tempelhof. Borsigzeile 44.«
»Herr Frieser. Wir haben vier Stunden Auswertungsangriff hinter uns.«
»Ja. Deshalb müssen Sie sofort hin. Es ist gerade noch so ein Ding gefunden worden.«
»Was?«
»Ja, es klingt jedenfalls so ähnlich. Ich wiederhole: Borsigzeile 44. Es ist ein Nachtclub namens Trieb-Werk.«
Udo Brenner und Sina Haas schauten Zollanger neugierig an.
»Was ist los?«, fragte Sina.
»Frieser. Wir haben noch so etwas. In Tempelhof.« Zollanger öffnete die Wagentür. »Udo. Sag Weyrich Bescheid. Er und seine Leute sollen gleich mitkommen.«
4
Durch das Schneetreiben brauchte sie fast eine dreiviertel Stunde bis in den Wedding. Das Wetter zähmte den Autoverkehr. Elin fuhr trotzdem nach Möglichkeit auf den Gehwegen. Körperlich machte ihr das Wetter nichts aus. Sie trug Thermounterwäsche. Ihre Drillichhosen ließen keinen Wind durch, ihre Lederjacke ebensowenig. Sie war es gewöhnt, bei Wind und Wetter Fahrrad zu fahren. Sie benutzte aus Prinzip kein anderes Verkehrsmittel.
Das Schering-Gebäude ragte vor ihr auf. Sie hielt vorsichtig an, zog einen Stadtplan aus ihrer Fahrradtasche und orientierte sich. Sie war erst seit zwei Wochen in Berlin. Im Vergleich zu Leuten, die sich mit der U-Bahn bewegten, hatte sie zwar bereits einen ganz guten Überblick über die Hauptachsen der Stadt. Doch die Namen der zahllosen Nebenstraßen waren ihr natürlich fremd. Und die, die sie jetzt suchte, konnte sie nicht einmal richtig aussprechen, geschweige denn, im Gedächtnis behalten, obwohl sie schon zweimal hier gewesen war: Malplaquetstraße.
Das Internetcafé, das sie kurz darauf betrat, lag im dritten Stock eines Hinterhauses. Es war nicht das übliche Internetcafé. Die Leute, die hierherkamen, surften nicht nur im Netz, sondern knüpften kreativ und leidenschaftlich daran herum. In einem Nebenraum wurden Programmierkurse angeboten. An einer Pinnwand hingen Zettel mit Fragen und Aufrufen, die meisten in Computerchinesisch und fast alle mehr oder minder bedenklichen Inhalts. Hacking ist Kunst, stand auf einem Aufkleber. Kunst ist Menschenrecht. Daneben erfuhr man, dass die DRM-Knacker sich freitags um sieben bei Kalli trafen. Nur für Fortgeschrittene.
Elin war nicht fortgeschritten. Sie hatte gerade mal genug Ahnung von Computern, um mit E-Mails umzugehen oder sich in diverse Foren einzuloggen, in denen sie regelmäßig unterwegs war. Deshalb war sie hier. Um ihre Post zu erledigen. Um sich um ihre Leute zu kümmern. Und um jemanden zu treffen, der fortgeschritten genug war, um ihr bei ihrem eigentlichen Problem helfen zu können.
Es war nicht viel Betrieb, als sie den Raum betrat. Der Mann an der Kasse erkannte sie von ihren letzten beiden Besuchen wieder und buchte ihr einen Terminal.
»Du zahlst mit Promessen?«, fragte er nur.
Einer der Gründe, warum sie hierherkam.
»Ja.«
Sie verbrachte die ersten zehn Minuten damit, ihr Zeitkonto zu überprüfen. Elin boykottierte vieles, aber an erster Stelle auf ihrer Tabuliste stand Geld. Wann immer sie konnte, versuchte sie, ihre ohnehin sehr geringen Bedürfnisse durch Tauschen oder direkte Dienstleistungen zu befriedigen. Berlin bot dafür glücklicherweise eine ähnlich gut entwickelte geldlose Gemeinde an wie Hamburg. Sie loggte sich auf ein Tauschringkonto ein und buchte rasch einen kleinen Job, um die geforderten Währungseinheiten zu verdienen, die hier Promessen hießen. Eine alte Dame in der Birkenstraße suchte jemanden, der ihr heute ein paar Einkäufe erledigte. Elin akzeptierte das Angebot, überwies die Promessen für das Internetcafé, loggte sich wieder aus und überprüfte ihre E-Mails. Es waren dreiundzwanzig. Sie überflog die Absenderadressen, öffnete jedoch lediglich die Nachricht einer gewissen Alexandra.
Elin. Ich werde am Montag in Berlin sein. Wenn du willst, können wir uns treffen. Schwarzes Café? Zehn Uhr? Ich habe um zwölf einen Termin.
Gruß
Alexandra
Elin antwortete:
O.k. Danke.
Elin
Sie verschickte die Nachricht und schloss ihre E-Mail-Anwendung. Dann loggte sie sich bei den Nachtelfen ein. Bevor sie den Chatroom aufsuchte, lenkte sie ein Diskussions-Thread ab, den der Administrator irgendwo abgefischt und für alle als Warnung deutlich sichtbar eingestellt hatte. Elin las die Diskussion.
X-Ray schrieb:
Ich wollte mir selbst mal ein Bild von der Sache machen und habe mich in einem Pro Ana Forum angemeldet, was gar nicht so leicht war. Nun muss ich entsetzt feststellen wie eine tödliche Krankheit verherrlicht wird. Ich möchte mein Entsetzen gerne mit anderen teilen.
Ich habe ein account von einem Pro Ana Forum zu verleihen. Ich erwarte, dass die Personen denen ich mein account ausleihe sich unauffällig verhalten und so tun als ob die ein krankes Mitglied wären.
Violate schrieb:
Ich find das scheiße sich in so ein Forum einzuschleichen indem man irgendwelche Lügen über sich erzählt. Klar ist das schlimm wenn da Magersucht verherrlicht wird, aber die haben nicht umsonst solche Aufnahmeregelungen. Das was sie da schreiben soll eben nicht einfach jeder lesen können und die Mädels da verlassen sich wohl drauf dass das was sie den anderen mitteilen auch unter ihnen bleibt.
Elin scrollte weiter und wollte sich schon wegklicken, als ein Foto sie zusammenzucken ließ. Shewolf1313 hatte es unter folgendem Text eingefügt:
Mh, ich halte mich aus der Sache dort raus, aber es wäre keine schlechte Idee … Ich selbst möchte nicht in das Board rein, sonst muss ich eventuell Threads lesen mit der Überschrift »Findet ihr mich fett?«, und dann taucht höchst wahrscheinlich so ein Bild auf:
Das Mädchen war nur Haut und Knochen. Es trug ein Tutu. Ein schmaler Gazestreifen war um die Brüste gebunden, die auf die Größe von Mandarinen geschrumpft waren. Die Gelenkknochen zeichneten sich gut sichtbar unter der angespannten Haut ab. Eine orangefarbene Schleife steckte im Haar des Mädchens, das ebensogut dreizehn wie dreiundzwanzig Jahre alt hätte sein können. Sein Kopf war kokett zur Seite geneigt, als flirte es mit dem Fotografen.
Elin spürte Würgereiz. Es war Toblerone, die kleine Schweizerin, mit der sie vor vier Jahren durch halb Deutschland getrampt war. Bis vor kurzem hatte sie das Mädchen in Hamburg immer mal wieder gesehen. Sie kannte Toblerones Geschichte. Und eben dies war das Entsetzliche an diesem Bild. Nicht der abgemagerte Körper. Nicht dieser Leib, der einfach nur Schutz gesucht hatte in seinem Verdorren, Schutz vor Papas geilen Blicken, die sie jetzt offenbar eingeholt hatten. Welches Schwein hatte dieses obszöne Hochglanzfoto geschossen?
Sie war kurz davor, einen Kommentar zu schreiben, ließ es aber bleiben. Was hatte es für einen Sinn, mit Voyeuren aus der Fresswelt zu reden? Sie würde Toblerone suchen müssen, wenn sie wieder in Hamburg war. Wenn sie wieder Zeit hatte. Sie schaute noch einmal bestürzt das Foto an. Wie viel mochte sie noch wiegen? Kaum vierzig Kilo. Absolute Untergrenze.
»Elin?«, sagte jemand neben ihr.
Ein hagerer Junge in Jeans und schwarzem Kapuzenpulli stand da. Sein Blick wanderte zwischen ihr und dem Foto auf dem Computer hin und her. Er errötete.
»Ich wollte nur sagen, dass ich da bin. Wenn du noch zu tun hast …«
»Nein. Ich bin fertig.«
Sie loggte sich aus, schloss die Anwendung und erhob sich. Elin war groß, aber der Junge überragte sie um einen Kopf.
»Ich hab’ die Sachen nicht hier«, sagte sie. »Können wir zu mir gehen und es dort machen?«
»Klar. Ist es weit?«
»Nein. Zehn Minuten.«
Durch den Schnee wurden es zwanzig. Sie mussten vorsichtig fahren und an fast allen Kurven absteigen, weil es zu glatt war. Als sie in den Hinterhof fuhren, waren sie die Ersten, die auf der weißen Fläche Spuren hinterließen. Sogar die stets überquellenden Mülltonnen sahen unter ihren frischen Schneehauben romantisch aus. Und Elin fand, dass der Wind und die Kälte einen unschlagbaren Vorteil hatten: Die Stadt stank weniger.
Die Wohnung war kalt. Elin hatte am Morgen eingeheizt, aber der Kachelofen war gerade einmal lauwarm. In der spartanisch eingerichteten Küche gab es überhaupt keine Heizung, und das einzige Zimmer verfügte über zwei schlecht isolierte Kastenfenster. Elin bat Max, am überfüllten Schreibtisch Platz zu nehmen. Der Junge sah ihr schweigend zu, wie sie die Ofenklappe aufschraubte und zwei Briketts in den Schacht warf. Dann verfrachtete sie das Durcheinander auf dem Schreibtisch, das vor allem aus Papieren, Ordnern, einem Teebecher und einem Blechteller mit drei geschälten Karotten bestand, mit einigen Handgriffen auf die Matratze, die neben dem Ofen auf dem Boden lag.
»Kannst du damit etwas anfangen?«, fragte sie, während sie einen offenen Karton vor ihn hinstellte. Sie nahm zwei handgroße, mit Luftpolsterfolie eingepackte Gegenstände heraus und entfernte die Hülle.
»Das sind Festplatten.«
»Ja. Kannst du sie auslesen?«
»Klar. Warum nicht?«
Er deutete auf den Laptop, der auf dem Schreibtisch stand. »Kann ich den benutzen?«
»Sicher.«
Max öffnete seinen Rucksack, holte einen Satz Kabel und Stecker daraus hervor und machte sich an die Arbeit. Nach zehn Minuten lehnte er sich irritiert zurück und schüttelte den Kopf. Der Bildschirm des Laptops zeigte allerlei Balken und Kuchendiagramme an, die Elin nichts sagten.
»Und? Was ist?«
»Na ja. Die Platten sind voll. Aber die Dateien sind leer.«
»Voll?«
»Ja. Voll mit nichts.«
Max nahm zwei weitere Festplatten aus dem Karton, packte auch diese aus und schloss sie nacheinander an den Computer an. Die bunten Balken flimmerten. Zahlenkolonnen huschten am unteren Rand entlang. Max experimentierte mit unterschiedlichen Tastenkombinationen herum. Aber das Ergebnis war immer das gleiche. Flimmernde Balken und endlose Listen von Dateien, die nichts zu enthalten schienen.
»Von wem sind die Dinger?«, wollte Max wissen.
»Ist das wichtig?«
»Na ja, es würde mir schon helfen, wenn ich wüsste, wie gut derjenige war, der die Dateien verschlüsselt hat.«
»Geh mal davon aus, dass er sehr gut war.«
»Hätte ich mir ja denken können.«
»Wieso?«
Max blickte auf den Laptop.
»Supergeile Maschine.«
»Kannst Du die Dateien nicht irgendwie aufmachen?«
»Ich versuch’s. Aber null Garantie.«
»Das heißt?«
»Wenn’s danebengeht, sind die Daten Asche. Außerdem … ist das Zeug okay?«
Er schaute auf die Pinnwand über dem Schreibtisch. Elin bemerkte sofort, worauf sein Blick ruhte. Umrahmt von Notizzetteln hing ein Organigramm. Die Überschrift war nicht zu übersehen: Landeskriminalamt.
»Die Platten sind von meinem Bruder«, sagte Elin. »Er ist im September ums Leben gekommen.«
Sie beugte sich über ihn und drückte ein paar Tasten auf dem Laptop. Ein Foto von einem Kind erschien. Das kleine Mädchen schaute melancholisch in die Kamera. Es war ein hübsches Kind.
»Meine Nichte«, sagte Elin. »Sie wird im Sommer vier. Mein Bruder hat Tausende Fotos von ihr gemacht.«
»Aber das hier sind keine Bilddateien«, entgegnete Max.
»Bist du sicher? Du weißt doch gar nicht, was drin ist.«
»Warum sollte dein Bruder Bilddateien so aufwendig verschlüsseln?«
Elin zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Willst du einen Tee?«
Elin richtete sich wieder auf. Sie legte kurz ihre Hand auf seine Schulter. Dann ging sie in die Küche. Als sie den Wasserhahn wieder zudrehte, vernahm sie das Geklapper der Tastatur. Sie wartete, starrte stumm in den Topf, bis sich am Boden kleine Blasen zu bilden begannen. Dann gab sie auf und ließ die Tränen laufen. Die Erinnerung an die kleine Carla war das Schlimmste. Wie sie an diesem Grab gestanden hatte, völlig verständnislos, mit ihrem dunkelgrünen Mantel, den rosa Strümpfen, die linke Hand in der Hand von Jule, ihrer dämlichen Mutter, und in der rechten ihren kleinen Stofftiger. Erics Tiger. Katanga, aus dem Berliner Zoo. Was war eigentlich schlimmer? Wenn Eltern ein Kind begraben mussten oder eine Dreijährige ihren Papi?
Vor allem Carlas Anblick hatte ihr damals furchtbar zu schaffen gemacht. Wie das kleine Mädchen zwischen den Trauergästen stand und manchmal fragend zu Jule aufschaute. Eric war vernarrt in seine Tochter gewesen. Und die Kleine hatte sich irrsinnig auf die Wochenenden gefreut, wenn Papa für zwei Tage aus Berlin kam, um sein Sorgerecht auszuüben, trotz Jules ewiger Sabotageversuche. Elin hasste diese Tussi. Wie die meisten Ex-Freundinnen ihres Bruders war Jule hübsch, blond und für Elins Begriffe strohdoof, ein fester Bestandteil der Hamburger Schickeria. Ohne Eric würde sie Carla nun wohl kaum mehr zu sehen bekommen. Das Kind war verloren, Jule würde sie schon ihrer Art entsprechend versauen.
Elin riss die Augen auf, starrte in den Hinterhof und fühlte, wie ihre Tränen trockneten. Als das Wasser kochte, goss sie den Tee auf, stellte die Kanne und zwei Becher auf ein Schneidebrett und trug alles ins Zimmer.
Max kauerte konzentriert vor dem Laptop. Elin konnte nicht erkennen, was genau er gerade gemacht hatte. Mehrere Festplatten waren irgendwie miteinander verkabelt, und auf dem Bildschirm öffneten sich laufend neue Fenster. Max fluchte und hieb zunehmend genervt auf die Escape-Taste. Aber nichts geschah. Elin stellte das Brett ab. Plötzlich wurde der Bildschirm schwarz. Dann begann auf einmal ein Videoclip. Elin trat einen Schritt zurück. Es war Eric! Eric neben einem Fenster. Dem Fenster dieses Zimmers. Er lachte in die Kamera. Dann streckte er die Zunge heraus.
»Nein, verdammt, dieser Arsch …«
Max drückte so schnell er konnte eine Tastenkombination. Aber es war zu spät. Das Display wurde grau, dann weiß und schließlich schwarz. Max versuchte sofort, das Gerät wieder hochzufahren. Doch es gab keinen Mucks mehr von sich.
Elin war blass geworden.
»Sorry«, sagte Max, »aber das war eine Falle. Das konnte ich nicht wissen.«
»Was ist passiert?«
»Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist irgendein Sicherungssystem, das ich nicht kenne. Die Platten sind vollgepackt mit Daten. Aber um sie zu lesen, muss man die Dateien verknüpfen. Vermutlich gibt es dafür eine vorgeschriebene Reihenfolge. Wenn man die nicht einhält, stürzt das System ab. Vielleicht aktiviert so ein Absturz auch noch irgendwelche Programme, die die Daten zerstören. Keine Ahnung.«
Elin wusste nicht, was sie sagen sollte.
»War das dein Bruder auf dem Video?«
Elin nickte.
»Kinderbilder hätte er wohl nicht so aufwendig geschützt.«
»Gibt es keine Möglichkeit, so einen Schutz zu knacken?«
»Sicher. Man kann alles knacken. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Rechenleistung.«
»Wie lange kann so etwas dauern?«
»Kommt auf die Verschlüsselung an.«
»Und das heißt?«
»Es kann ein paar Tage dauern oder ein Jahr. Je nachdem. Ich kann so etwas jedenfalls nicht. Mein Gott, Elin, ich dachte, du hast ein Computerproblem.«
Elin schüttelte ungläubig den Kopf. »Ein Jahr?«
»Sicher. Wenn du nur ein paar hundert Computer einsetzt. Mit drei oder vier Millionen geht es schneller.«
Machte sich der Junge über sie lustig?
»Im Netz natürlich«, ergänzte er. »Es gibt Serverparks, die man für so etwas nutzen kann. Aber echt, das ist nicht meine Liga. Sorry.«
5
Es stank extrem nach kaltem Rauch. Der Gesichtsausdruck von Sina, der passionierten Nichtraucherin, war dafür ein unfehlbarer Gradmesser. Missbilligende Falten bildeten sich auf ihrer Stirn, als sie das alte Fabrikgebäude durch einen schmalen Eingang betraten. Zwei Polizeibeamte erwarteten sie. Sie lehnten am Tresen einer Garderobe, welche die Hälfte der riesigen Eingangshalle in Anspruch nahm. Angesichts der endlosen Reihen Kleiderständer dahinter folgerte Zollanger, dass hier offenbar Großveranstaltungen abgehalten wurden.
Zollanger und Sina traten zur Seite, um es den anderen zu ermöglichen, aus dem engen Eingangstunnel nun gleichfalls in die Eingangshalle einzutreten. Die Polizeibeamten kamen auf sie zu. Zollanger stellte sein Team vor.
»Wir sollen Sie hinbringen«, sagte einer der beiden Polizisten. »Es ist hinten.«
»Wir warten noch auf die Kollegen von der Gerichtsmedizin«, sagte Zollanger.
»Gut«, sagte der ältere der beiden. »Dann bleibt mein Kollege mit einem Ihrer Kollegen hier.«
»Roland«, sagte Zollanger zu Draeger. Der nickte nur.
Der Rest des Teams setzte sich in Gang. Sie gingen durch die Eingangshalle, die Köpfe leicht in den Nacken gelegt, als durchquerten sie das Hauptschiff einer Kirche. Die Decke war enorm hoch. Acht bis zehn Meter, schätzte Zollanger. Das Imposante daran war allerdings nicht allein die Höhe, sondern die Bemalung. Zollanger fühlte sich an Darstellungen erinnert, die er einmal in einem Buch gesehen hatte. Dort waren die ineinander verschlungenen Körper allerdings aus Stein gewesen und nicht in prallen Farben ausgemalt wie hier. Außerdem sahen die glückselig oder ekstatisch verzerrten Gesichter der kopulierenden Paare oder Gruppen über ihnen europäisch aus und nicht asiatisch. Und noch etwas war anders. Zollanger kam erst darauf, als sie bereits die nächste Halle betraten: Es waren keine Frauen auf den Bildern zu sehen.
»Weiß vielleicht jemand, was hier früher produziert wurde?«, fragte Udo Brenner. »Oder wozu braucht man solche Räume?«
Die Frage hatte sich Zollanger auch gerade gestellt, denn die Halle, die sie jetzt betraten, war schlechterdings gigantisch. Vier Betonpfeiler trugen eine Dachkonstruktion aus Drahtglas, die gut und gern zwanzig Meter über ihren Köpfen schwebte. Sie war allerdings nur teilweise zu sehen, da zwei über Stahltreppen verbundene und zueinander versetzte Ebenen eingezogen worden waren. Lange schwarze Stoffbahnen bildeten hier und da Sichtblenden oder regelrechte Gänge und Tunnel.
»Sieht aus wie ein Theater«, bemerkte Sina.
Sie kamen an einer Bar vorbei, einem einfach gemauerten Quadrat mit einem umlaufenden Tresen aus schwarzem, unpoliertem Granit. Dann betraten sie einen der schwarzen Stofftunnel und fanden sich plötzlich in einem flacheren Nebengebäude. »Lab-Oratory« hatte jemand in großen schwarzen Buchstaben auf die Betonwand vor ihnen gesprüht und einen dicken Pfeil nach rechts daneben gemalt. Sie folgten ihm. Nach zwei weiteren Abzweigungen blieb der Polizist plötzlich stehen und deutete nach rechts in eine Nische. Ein Mann trat ihnen entgegen. Er hatte ein Taschentuch vor die Nase gepresst. Er wischte sich das Gesicht, musterte die Gruppe kurz und sagte dann unsicher:
»Sind Sie die Detectives?«
»Ich bin Hauptkommissar Zollanger«, sagte Zollanger. »Das sind meine Kollegen, Frau Haas, die Herren Krawczik, Brenner, Findeisen und Brodt. Wer sind Sie, bitte?«
»Naeve«, antwortete er. »Desmond Naeve. Ich bin die Pächter von diese Club.«
Der britische Akzent war überdeutlich, aber der Mann sprach passables Deutsch.
»Was ist hier passiert?«
»Ein schlechter Scherz, glaube ich. Jemand hat ein totes Tier dort unten deponiert. Ein Tier mit … I don’t know. Sie müssen sich das selbst anschauen.«
»Wer hat das Tier gefunden?«, fragte Zollanger.
»Die Putzfrau. Vor etwa einer Stunde. Es gibt da unten eine Kammer, wo Putzgerät und so was aufbewahrt wird. Dort lag es.«
»Und warum liegt es jetzt nicht mehr dort? Wer hat es herausgeholt?«
»Die Putzfrau. Es war im Weg. Sie dachte, es sei ein Kostüm.«
»Ein Kostüm?«
»Ja. Das hier ist ein Club. Wir machen hier Themenpartys.«
»Ist die Putzfrau noch hier?«
»Sie hat einen Schock. Der policeman hat sie nach Hause geschickt. Aber wir haben natürlich ihre Adresse. Sie kann allerdings kaum Deutsch.«
Zollanger ging in die Nische hinein. Sofort schlug ihm scharfer Uringestank entgegen. Der Durchgang war zu schmal für mehrere Personen. Aber nach etwa zwei Metern mündete er in einen vielleicht sechs mal sechs Meter großen Raum. Was für ein Ort war dies nur?
»Irre ich mich, oder ist das ein Pissoir?«, fragte er Sina, die neben ihn getreten war, den Blick auf ein grün gestrichenes Metallhäuschen vor ihnen gerichtet.
»Sieht so aus«, erwiderte sie und trat zur Seite, um die anderen durchzulassen. Erst jetzt sah Zollanger, dass unter dem Metallhäuschen noch ein Raum existierte, der über eine Wendeltreppe zugänglich war. Ein Lichtschimmer drang von dort zu ihnen herauf. Der Boden des Metallhäuschens bestand aus einem Metallrost. Aber was lag dort unten? Täuschten ihn seine Augen, oder sah er wirklich, was er da sah?
»Hat jemand Geruchsmasken dabei?«, fragte er, während er Gummihandschuhe und Plastiküberschuhe anzog.
»Die hat Weyrich«, antwortete Harald Findeisen. »Sollen wir auf ihn warten?«
»Nein«, sagte Zollanger. »Ich gehe jetzt erst einmal mit Sina da hinunter, und wir besichtigen das kurz. Ihr geht wieder raus in den Gang. Es ist zu eng hier. Und wir müssen ja nicht alle in diesem Gestank herumstehen. Udo, dieser Mister Naeve soll in sein Büro gehen und dort auf mich warten. Wenn Weyrich da ist, dann schickt ihn sofort her. Komm, Sina.«
War die Atmosphäre des Ortes daran schuld? Oder der erste flüchtige Blick auf dieses Ding da unten? Wenn seine Augen ihn nicht trogen, war es nicht weniger entsetzlich und rätselhaft als das Ding in Lichtenberg. Etwas Krankes, Abartiges war hier geschehen. Und er hatte keine Ahnung, wie er damit umgehen sollte. Auch deshalb wollte er, dass Sina es sich zuerst anschaute. Genau so, wie man es gefunden hatte. Denn das war ihr Gebiet.
Wo um alles in der Welt waren sie hier bloß? Offenbar in einer alten Fabrik, die jemand zu einer riesigen Diskothek umfunktioniert hatte. Aber was hatte ein schmiedeeisernes Parkpissoir in dieser Ecke hier verloren? Hatte man früher in Fabriken solche Toiletten gebaut? Oder war das irgendeine durch Materialknappheit diktierte improvisierte Lösung aus der Nachkriegszeit? In DDR-Fabriken hatte es derartige Pissoirs nicht gegeben. Das wusste er. Außerdem befanden sich in dem Toilettenhäuschen überhaupt keine Toiletten oder Wände, gegen die man hätte pinkeln können. Nur die äußere Struktur war vorhanden. Sowie ein Metallgitterboden. Und darunter ein kahler Raum, in dem es so bestialisch stank, dass die Geruchsmasken vermutlich nicht besonders viel nützen würden.
Jemand hatte eine Taschenlampe hiergelassen. Sie lag auf der vorletzten Treppenstufe und beleuchtete den Gegenstand auf dem Boden. Sina hatte ebenfalls eine Lampe in der Hand und ließ den Lichtkegel erst über den Boden und dann langsam über das tote Tier gleiten. Zollangers erster Eindruck hatte ihn nicht getäuscht. Vor ihnen lag ein totes Lamm.
Zollanger wusste nicht viel über Lämmer. Er war ein Stadtmensch. Aber immerhin war er sich sicher, dass es sich um kein besonders großes Exemplar handelte. Es lag auf der Seite. Die Kammer, in der es entdeckt worden war, stand offen und befand sich hinter dem toten Tier. Sina leuchtete kurz hinein, und der Lichtkegel glitt über Regale mit Putzmitteln. Die Tür verfügte nur über ein einfaches Schloss, das auf den ersten Blick unversehrt aussah.
Sinas Lampe beleuchtete wieder das Lamm. Fast eine Minute lang sprachen sie kein Wort, sondern versuchten nur, die Einzelheiten irgendwie geordnet zu erfassen. Der Kopf und das Vorderteil des Tieres waren unversehrt. Weder war ihm die Kehle durchgeschnitten worden, noch sah man Spuren von einem Bolzenschuss oder sonst einer der üblichen Tötungsmethoden. Die erste Auffälligkeit begann am Bauch. Die gesamte Unterseite des Tieres war mit einem dicken schwarzen Strangmaterial vernäht worden. Die Naht endete zwischen den Hinterbeinen, wo die nächste Merkwürdigkeit begann. Die Hinterbeine waren mit handbreitem, starkem schwarzem Klebeband umwickelt.
Zollanger hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Er spürte allmählich, dass er seit halb fünf auf den Beinen war, Stunden in einem eiskalten und zugigen Plattenbau verbracht und noch nicht einmal gefrühstückt hatte. Aber der Gedanke an ein Frühstück hatte sich vorerst erledigt. Dafür sorgte schon der Gestank. Sina hielt den Lichtkegel der Taschenlampe noch immer auf die Hinterbeine des Kadavers gerichtet. Sie machte eine kleine Bewegung, und plötzlich blinkte etwas auf. Sie beugten sich näher über die Stelle. Es war eine Klinge. Der Griff eines Messers war so zwischen den Hinterläufen des toten Tieres fixiert worden, dass nur noch die Klinge herausragte.
»Stinkt der Kadaver so?«, fragte Zollanger. »Oder ist es dieser Ort?«
»Schwer zu sagen«, sagte Sina. »Lange kann das Tier hier nicht gelegen haben. Und verwest sieht es nicht aus. Ich tippe eher auf den Ort. Es stinkt nach Urin. Aber … o nein, was ist denn das?«
Der Lichtschein von Sinas Lampe hatte sich wieder zum vernähten Bauch des Tieres vorgearbeitet und ruhte nun auf einer Stelle kurz vor dem Brustbein, wo die Naht etwas aufklaffte. Das Fell war dort sehr kurz, und man konnte gut sehen, wie der kräftige schwarze Faden die durchschnittenen Haut- und Muskelpartien des toten Tieres zusammengeklammert hielt. Aber eben nicht vollständig. Und dort, wo die Naht ein wenig aufklaffte, war etwas zu sehen, das da absolut nicht hingehörte.
»Großer Gott«, flüsterte Zollanger.
6
Nach dem fehlgeschlagenen Versuch, Erics Festplatte zu knacken, hatte Elin die Einkäufe der alten Frau in der Birkenstraße erledigt und sich dann auf den Weg nach Kreuzberg gemacht. Es schneite nicht mehr. Aber sie musste vorsichtig fahren und brauchte fast eine dreiviertel Stunde. Als sie in die Adalbertstraße einbog, war es bereits dunkel. Der Verkehr hatte den Schnee auf der Straße zu einem braunen Brei zerquirlt. Wenn dieser Matsch demnächst gefrieren würde, könnte sie das Fahrrad gleich stehen lassen, dachte sie skeptisch und verbrachte dann einige Minuten damit, einen freien Laternenpfahl zu suchen, um ihr Rad daran anzuschließen.
Cemal stand hinter dem Tresen und schaute fern, als sie den Dönerladen betrat. Er hatte sichtlich keinen Grund, etwas anderes zu tun, denn der Laden war völlig leer. Es war wohl nicht die richtige Tageszeit für die Berge von frisch geschnittenem Salat, für Tomaten, Zwiebelringe, gehackte Petersilie und Knoblauchsauce. Der Dönerspieß, der sich vor einem rotglühenden Heizstrahler im Hintergrund drehte und krachend Fettspritzer verschoss, war ebenso jungfräulich wie die Kiste Fladenbrot, die daneben auf der Arbeitsplatte stand.
»Ey, Elin«, rief Cemal, als er sie erkannte. Er kam um den Tresen herum auf sie zu. »Was für ein Wetter. Wie geht’s dir?«
Sie ließ sich umarmen. »Du bist mein erster Kunde nach der Mittagspause«, sagte er freudig. »Was willst du essen?«
Er ließ die Arme über seiner Auslage kreisen.
Elin schüttelte den Kopf. »Nichts, danke, aber ich trinke gerne einen Pfefferminztee, falls du welchen hast.«
»Klar.«
Er schob eine Tasse Wasser in die Mikrowelle und öffnete drei Schubladen, bis er irgendwo einen Teebeutel fand. Elin hatte eigentlich auf frische Pfefferminze gehofft. War das in türkischen Gaststätten nicht Standard? Aber Cemals Dönerbude war ziemlich neu. Vielleicht war es deshalb so leer hier. Konkurrenzdruck. Cemal hätte besser auf Eric gehört und mit ihm einen Telefonladen anstatt einer Dönerbude aufgemacht, von denen es in Berlin ohnehin schon wimmelte. So hatte ihr das Eric jedenfalls bei seinem letzten Besuch in Hamburg erklärt. Internettelefonläden schössen zwar auch wie Pilze aus dem Boden, aber der Markt sei vielversprechend neu und unübersichtlich. Kein Mensch hätte einen Durchblick bei den ständig sich ändernden Telefontarifen. Doch der letzte Penner wisse, dass ein Döner höchstens zwei oder drei Euro kosten durfte. Außerdem gäbe es zu viele Ausweichprodukte. Zweimal Fritten mache einmal Döner, so etwa laufe die Gleichung. Und irgendwo dazwischen Currywurst. Und dass die Sache ohne Cemal nicht funktionieren würde, weil Türken eben nur bei Türken kauften. Imbiss sei hoffnungslos. Aber Ferngespräche übers Internet, das sei interessant. Und Cemal hätte sich ja um gar nichts Technisches kümmern brauchen, nur vorne sitzen und auf Knöpfe drücken. Anstatt Dönerspieße zu rasieren.
Aber Cemal hatte sich das nicht zugetraut. Und deshalb stand er jetzt hier. Und Eric? Elin schloss kurz die Augen und wartete, bis der Stich in ihrem Magen nachgelassen hatte. Immerhin wollte er ihr helfen. Aus schlechtem Gewissen? Aus levantinischem Freundschaftsethos? Oder wohl eher, weil er dachte, dass sie schleunigst nach Hamburg zurückkehren und die ganze Sache ruhen lassen sollte?
Cemal stellte ein kleines Tablett mit der Tasse Tee vor sie hin, blieb einen Augenblick unschlüssig stehen und setzte sich dann ebenfalls.
»Wie läuft es denn so?«, fragte sie und nippte an der Tasse.
»Schlecht. Aber so ist das immer am Anfang.«
»Ist Nuran nicht hier?«
»Sie kommt erst abends, wenn Yesmin im Bett ist. Dann ist hier mehr los. Das bisschen bis dahin schaffe ich alleine.«
Elin trank schweigend ihren Tee. Gut, dass Cemals Frau nicht hier war. Sie war ihr letzte Woche das erste Mal begegnet, und es hatte nur wenige Minuten gedauert, bis klar war, dass Nuran nichts mit ihr zu tun haben wollte. Elin hatte die kleine Yesmin auf den Arm genommen. Das Kind hatte neugierig ihr Bindi berührt. Nuran war herbeigeeilt, hatte das Kind sofort zu sich genommen und aus dem Zimmer gebracht.
»Ich habe diesen Bullen noch immer nicht sprechen können«, sagte Elin. »Er hat mich versetzt.«
»Die mögen das nicht, wenn man sie so nennt. Vielleicht liegt’s daran?«
»Wie soll ich sie sonst nennen?«
»Na vielleicht … dein Freund und Helfer?«
Elin richtete sich auf, lehnte sich ein wenig zurück und musterte Cemal. Sein Gesichtsausdruck hatte sich verändert. Das Spöttische darin war einer leichten Verlegenheit gewichen.
»Ist doch nur so eine deutsche Redensart. Ich meine … vielleicht sehen wir ja Gespenster. Kann doch sein, oder?«
Elin schob ihre Teetasse von sich weg. Es war natürlich Nuran, die da sprach. Nuran, die auf jede Frau eifersüchtig war, die auch nur in die Nähe von Cemal kam. Nuran, die nicht wollte, dass ihr Mann mit der Schwester eines Geschäftspartners redete, der sich angeblich erhängt hatte. Eines Geschäftspartners, der nicht einmal Türke war.
»Ich erwarte nicht von dir, dass du mir irgendetwas glaubst«, sagte Elin. »Ich bitte dich nur um einen Gefallen, Eric zuliebe. Das ist alles.«
»Ja, schon, ich weiß«, sagte Cemal. »Aber Tatsache ist, dass du Dinge tust, die nicht erlaubt sind.«
»Ach ja, was denn?«
»Die Polizei hat doch alles genau untersucht. Und wenn die Polizei sagt, dass Eric sich das Leben genommen hat, und du nun hingehst und sagst, das sei nicht wahr, dann ist das … dann ist das …«
»Was ist das? Widerstand gegen die Staatsgewalt?«
»Nein. Aber du missachtest die Behörden.«
»Was für eine geisteskranke Logik ist das denn. Machen Behörden vielleicht keine Fehler?«
»Doch. Schon. Aber dann ist es Sache einer anderen Behörde, das zu überprüfen. Es kann doch nicht jeder Bürger einfach losziehen und irgendwelche Vorfälle untersuchen, von denen er glaubt, dass etwas mit ihnen nicht stimmt.«
»Sagt Nuran.«
»Meinetwegen. Sagt auch Nuran. Aber ich sage es auch. Vielleicht sollten wir das alles einfach lieber sein lassen.«
»Was alles? Dass dein Freund Eric sich wochenlang vor irgendwelchen Leuten unter anderem bei dir versteckt hat? Dass er Todesangst hatte, dass ihn jemand umbringen wollte? Dass er bis kurz vor seinem Tod ein fröhlicher und lebenslustiger Mensch war, und sich plötzlich ohne ersichtlichen Grund in einem Waldstück erhängt, an einem Ort, wo man ohne ein Fahrzeug kaum hingelangen kann, nachts, ohne …«
Cemal hob abwehrend die Hand.
»Ich weiß, ich weiß. Das hast du mir ja alles schon erzählt. Und es stimmt ja, dass es merkwürdig aussieht. Merkwürdig für uns. Aber offenbar nicht für die Polizei. Elin, die bearbeiten jedes Jahr Hunderte solcher Fälle. Wenn es den geringsten Verdacht gäbe, dass Eric sich nicht das Leben genommen hat, dann hätte die Polizei das doch herausgefunden. Und dann hätten sie versucht …«
»… hat auch nur ein Polizist mit dir geredet, Cemal?«
»Nein.«
»Ach. Und das findest du nicht merkwürdig? Du warst einer der Letzten, die ihn lebend gesehen haben. Du hattest sogar eines seiner drei Handys, auf dem er bis eine Woche vor seinem Tod jede Menge Gespräche geführt hat. Warum interessiert sich die Polizei nicht dafür? Wo sind seine Ausweispapiere? Seine Brieftasche? Hat er das alles vernichtet, bevor er sich aufgehängt hat? Warum? Wozu?«
Cemal schaute irritiert vor sich auf den Tisch. Elins blasses Gesicht hatte sich ein wenig gerötet. Ihre Augen glänzten. Jetzt sah sie Eric ähnlich. Ja, im Grunde sah sie fast wie ein Mann aus mit ihren kurzen blonden Haaren. Wie ein sehr schöner Mann. Wie Eric.
»Komm«, sagte er und stand auf. »Ich habe ja alles besorgt. Schau.«
Er ging zu einer Tür an der Rückwand des Gastraumes, öffnete sie und schlug mehrmals mit der flachen Hand auf eine Stelle an der Wand, bis das Licht endlich anging. Elin saß noch immer unbeweglich auf ihrem Platz. Er winkte sie mehrmals zu sich. Schließlich erhob sie sich, stieg die beiden Stufen zu ihm hinauf und trat neben ihn in den Hausflur. Zwei große Plastiktaschen standen dort neben dem Treppenabsatz. Seilenden und Karabinerhaken schauten daraus hervor.
»Es ist alles da«, sagte er. »Fehlt nur die Leiter. Aber die bekomme ich morgen früh.«
»Super«, sagte Elin. »Danke, Cemal. Aber morgen wird es nichts. Nächste Woche.«
Elin kniete sich hin, holte eines der Seile heraus und fädelte es probehalber durch einen der Karabinerhaken des Klettergeschirrs, das unter dem Seil in der Tasche lag. Es ließ sich geschmeidig durch die Öse ziehen.
»Hast du am Montag Zeit?«, fragte sie.
Cemal schüttelte den Kopf. »Nein. Geht nicht. Wenn morgen früh ausfällt, geht erst wieder Dienstag.«
»Okay«, sagte sie. »Dann bleibt es doch bei morgen. Ich kann nicht ewig auf diesen Bullen warten. Du weißt, wo?«
»Ja. Schulzendorfer Straße. Am Waldparkplatz. Wann?«
»Um elf? Ist das in Ordnung?«
»Ja. Sicher. Soll ich dich abholen?«
Sie schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Lust, ihm jetzt auch noch zu erklären, warum sie grundsätzlich nicht Auto fuhr. Deshalb sagte sie nur: »Ich werde schon früher da sein. Ich warte auf dich.« Dann stopfte sie das Seil in die Tasche zurück.
»Willst du nicht doch etwas essen?«, fragte Cemal, als sie wieder in der Imbissstube waren. »Komm. Ich mach dir einen schönen Döner.«
Er meint es ja nur gut, dachte sie bei sich. Aber wie konnte er diesen aus zermanschten Drüsen und Knorpel zusammengebackenen, vor Fett triefenden Fleischbatzen nur ernsthaft als Essen bezeichnen? Sie griff in die Auslage und schnappte sich zwei rohe Möhren.
»Danke, Cemal«, sagte sie und gab ihm ein Küsschen auf die Wange. »Bis morgen. Und denk an die Leiter.« Dann verließ sie den Laden.
7
Leichenteile gehörten mittlerweile leider zum grausigen Alltag. Aber diese Kombination mit Tieren war verstörend. Zollanger spürte ein unbändiges Verlangen, diesen Einsatz abzubrechen, einen starken Widerwillen gegen all das, was in den nächsten Stunden und Tagen auf ihn zukommen würde, angefangen mit der neuerlichen Besichtigung dieser Scheußlichkeiten, sobald sie auf den Edelstahltischen der Gerichtsmedizin auseinandergenommen und in ihrer ganzen schauderhaften Rätselhaftigkeit durchleuchtet und erfasst waren. Er konnte das alles nicht mehr sehen. Es widerte ihn an. Knapp zwei Jahre lagen noch vor ihm. Und auf den letzten Metern, bevor er seinen letzten Bericht über irgendeine widerliche Gewalttat schrieb, sollte er sich nun auch noch mit so etwas befassen? Die Zumutung war ja nicht nur die Tat an sich. Nein. Es war der Zwang, die Tat nachvollziehen, sie im Geiste selbst noch einmal begehen zu müssen. Anders war den Subjekten, die so etwas taten, ja nicht beizukommen. Man musste sich diesen Perversen anverwandeln, um sie aufzuspüren.
Sie hatten die Naht an der Unterseite des Tieres unverzüglich geöffnet. Für die Spurensicherung wäre es natürlich besser gewesen, Dr. Weyrich hätte die Erstuntersuchung im Institut vornehmen können. Aber dort, wo die Naht aufklaffte, war ein menschlicher Finger zu sehen gewesen. War ein Mensch in das Tier eingenäht worden? Es war kaum vorstellbar, aber sie durften keinerlei Risiko eingehen. Bis eben hatten sie es nur mit einem Tierkadaver zu tun gehabt. Jetzt war alles anders.
Bitte kein Kind oder Baby, schoss es Zollanger in den letzten Sekunden durch den Kopf, bevor die Wunde unter dem Skalpell aufriss und der Bauchinhalt des toten Lamms vor ihre Füße rutschte. Niemand sprach ein Wort. Einige Sekunden lang hörte man nur das Klicken von Harald Findeisens Fotoapparat. Jetzt war keine Eile mehr geboten. Der menschliche Unterarm vor ihnen auf dem Boden glänzte gelbbraun. An der Schnittstelle des Stumpfes hatten sich die Haut und das darunterliegende Fett- und Muskelgewebe so weit zurückgezogen, dass der Knochen freilag.
Dr. Weyrich erhob sich und trat zwei Schritte zurück. Das Verfahren war eingespielt, und es bedurfte keiner Worte. Die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass sich in dem Kadaver noch etwas Lebendiges, Menschliches befunden hätte, war nun ausgeschlossen. Also hatten sich die Prioritäten wieder verschoben. Findeisen machte seine Aufnahmen. Günther Brodt packte seine Gerätschaften aus. Alle anderen entfernten sich zunächst vom Tatort.
»Ich will, dass Frieser sich das anschaut, bevor viel verändert wird«, sagte Zollanger zu Thomas Krawczik. »Er ist unterwegs.«
»Okay, Chef.«
»Ich werde jetzt erst einmal mit dem Pächter sprechen. Udo, du kommst bitte mit. Thomas, ruf mich bitte über Handy an, sobald Frieser hier ist.«
Das Büro lag im obersten Geschoss der Fabrikanlage. Sie brauchten fast zehn Minuten; und Zollangers Knie schmerzte erheblich, als sie endlich dort eintrafen.
Naeve stand mit umwölktem Blick am Fenster, als sie das Büro betraten.
»Herr Detective«, begann er, »Sie können sich nicht vorstellen, wie skandalisiert ich bin. Ich meine, good grief, es ist schockierend.«
»Was ist das hier für ein Etablissement?«, fragte Zollanger, während Brenner den Personalausweis des Engländers prüfte und nichts Unregelmäßiges daran entdecken konnte.
»Ein Club, Sir, ein ganz normaler Club.«
»Für ein vornehmlich homosexuelles Publikum?«
»Nein. Wir machen alles«, erwiderte Naeve. »Hetero, schwul, lesbisch, ganz egal.«
»Und letzte Nacht. Was war da los?«
»Gestern war Bad Santa. Also, das heißt auf Deutsch wohl Böser Nikolaus.«
»Bad Santa«, wiederholte Zollanger.
Udo Brenner gab Naeve seinen Personalausweis zurück.
»Wie viele Nikoläuse waren letzte Nacht da?«
Naeve zog die Augenbrauen hoch. »Es war ein durchschnittlicher Abend. Vielleicht knapp zweitausend.«
Zollanger und Brenner schauten sich kurz an.
»Zweitausend?« Brenner war skeptisch. »Sind Sie sicher?«
»Ja. Die Zahl der verkauften Tickets habe ich hier im Computer. Wollen Sie sie haben?«
»Ja. Wir wollen alles haben, was uns Aufschluss darüber gibt, wer gestern hier gewesen ist. Es war also recht voll?«
»Ja, aber nicht übermäßig. Wir hatten auch schon Abende mit dreitausendfünfhundert Besuchern. Wir sind der größte Club Europas.«
»Und Ihr Publikum?«, fragte jetzt Brenner. »Das sind vermutlich nicht alles Leute aus Berlin?«
»Nein«, sagte Naeve und schüttelte amüsiert den Kopf. »Das würde sich nicht rechnen. Die Leute kommen von überallher. Siebzig Prozent EU. Zwanzig aus Resteuropa. Der Rest aus Übersee. USA. Japan. Australien. You name it.«
»Fliegen hierher, um Nikolaus zu feiern?«, fragte Brenner ungläubig.
Naeve blinzelte, als verstehe er die Frage gar nicht.
»Sie wissen, was Sie da heute morgen gefunden haben?«, fragte Zollanger.
»Ein totes Lamm, ja, entsetzlich.«
Brenner wollte etwas hinzufügen, aber Zollanger hob rasch den Arm.
»Das gehört also nicht zu den Dingen, die man hier üblicherweise findet?«
»Wie bitte?«
»Verstehen Sie mich nicht falsch, Mr. Naeve. Was wir bisher von diesem Club gesehen haben, entspricht nicht unbedingt dem, was man erwartet, wenn man eine Diskothek aufsucht. Sie brauchen mir jetzt nicht im Einzelnen zu schildern, was für eine Art Nikolausparty zweitausend Männer hier letzte Nacht gefeiert haben. Aber die Stelle, wo das tote Tier deponiert worden ist, ist wohl nicht zufällig ausgewählt worden. Könnten Sie uns sagen, was für ein Ort das ist?«
»Nun ja«, begann er, »wir nennen das den Golden-Shower-Bereich, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Durchaus«, sagte Zollanger. »Es treffen sich dort Leute mit urophilen Neigungen. Und nach dem Geruch zu urteilen, war der Ort gestern auch gut besucht, oder?«
Naeve zuckte mit den Schultern.
»Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich meine, ja, natürlich werden Leute, die so etwas mögen, sich dort aufgehalten haben. Aber wir haben kein Personal abgestellt, das darüber Buch führt.«
»Wann genau ist der Tierkadaver gefunden worden?«
»Gegen halb neun. Die erste Putzschicht im Lab-Oratory beginnt um acht.«
»Und Sie waren hier, als die Putzfrau Alarm schlug?«
»Ja. Ich war hier im Büro. Seit etwa zwanzig Minuten.«