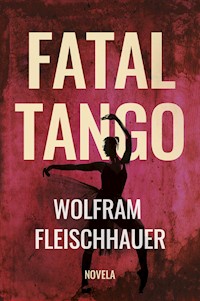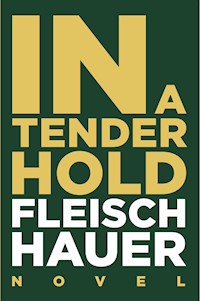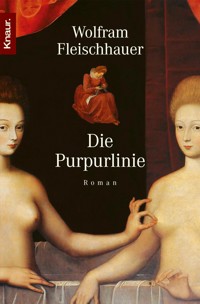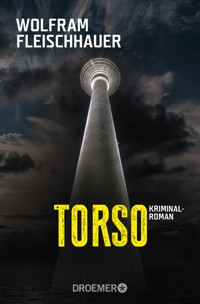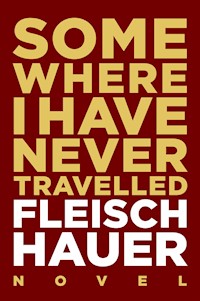9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wolfram Fleischhauers großer Spannungsroman vom Gedächtnis der Natur - als Spielfilm in den deutschen Kinos! Anja Grimm kehrt in das entlegene Waldgebiet zurück, in dem ihr Vater spurlos verschwand, als sie acht Jahre alt war. Ihr plötzliches Auftauchen löst einen brutalen Mord aus. Verdächtige Bodenproben und rätselhafte Zeigerpflanzen im Wald bringen Anja bald auf die Spur tieferer Schichten von Schuld und Verbrechen und beschwören eine Katastrophe herauf... Der Wald-Thriller in der Verfilmung von Saralisa Volm, mit Henriette Confurius, Noah Saavedra und August Zirner in den Hauptrollen »Traulich und hold ist hier nichts: grausige Höfe, dörfliche Vetternwirtschaft und brauner Sumpf, atmosphärisch dicht erzählt.« Bücher »Mystischer Wald, Todesfälle und deutsche Vergangenheit: Fleischhauer verpackt hier gewichtigen Inhalt in eine Erzählung, die mit leichter Feder geschrieben ist.« Buchkultur »Absolut empfehlenswert.« krimi-couch.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Wolfram Fleischhauer
Schweigend steht der Wald
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als es die Forststudentin Anja Grimm ausgerechnet in jene entlegene Gegend im Bayerischen Wald verschlägt, wo sie als kleines Mädchen mit ihren Eltern Urlaub gemacht hat, holt sie der Alptraum ihrer Kindheit ein: Einen Tag nach ihrer Ankunft wird im gleichen Waldstück, wo vor zwanzig Jahren ihr Vater spurlos verschwand, der geistig zurückgebliebene Xaver Leybach erhängt aufgefunden. Und dies soll nicht der einzige Todesfall bleiben, der durch Anjas Auftauchen ausgelöst wird. Schon bald erregt Anja mit ihrem Verdacht, dass Xaver etwas über das Verschwinden ihres Vaters wusste, nicht nur bei den Dorfbewohnern Hass und Feindseligkeit. Selbst die Polizei reagiert äußerst reserviert auf ihre Nachforschungen. Allmählich begreifen die Bewohner des Ortes, dass Anja durchaus nicht zufällig hier ist – und treffen eine furchtbare Entscheidung.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
Vom Buch zum Film oder »Money into Light«
Glossar
Mauerlattich
Waldhainsimse
Heidelbeeren
Brombeerranken
Schlehen
Frauenfarn
Waldhabichtskraut
Lonicera japonica
Brennnessel
Blechnum/Rippenfarn
Wollreitgras
Peitschenmoos
Oxalis/Sauerklee
Dornfarn
Labkraut
Riemenmoos
Lerchensporn
Blutampfer
Quellbinsen
1
Sie hatte keine klare Vorstellung davon gehabt, was der Anblick des Dorfes in ihr auslösen würde. Die Bilder, die sie die letzten zwanzig Jahre mit sich herumgetragen hatte, waren diffus. Eine leicht hügelige Landschaft. Weilerhöfe. Felder, die in alle Himmelsrichtungen gegen Wände aus dichtem Nadelwald stießen. Es waren vage Erinnerungen, die stets widersprüchliche Empfindungen in ihr geweckt hatten. Furcht und Argwohn. Aber auch eine schwermütige Sehnsucht.
Als sie das Ortsschild passierten und sie den Namen des Ortes las, verkrampften sich ihre Hände um das Lenkrad. Doch kaum hatte sie die ersten Häuser erblickt, wurde ihr klar, dass ihre Vorahnungen einer Illusion geschuldet sein mussten. Sonst hätte sich doch angesichts der Höfe und Felder vor ihren Augen irgendein Gefühl der Vertrautheit einstellen müssen. Aber da war nichts. Was da vor ihr lag, war ihr fremd, auch wenn es etwas spiegelte, das sie seit ihrem achten Lebensjahr immer wieder vor sich sah.
»ACHTUNG!«
Anja schreckte hoch und riss das Steuer herum. Der Mann auf dem Beifahrersitz verlor das Gleichgewicht. Sein kräftiger linker Oberarm presste sich gegen sie. Das linke Vorderrad erwischte das Schlagloch noch schlimm genug. Ein harter Stoß erschütterte den VW-Bus, und er begann zu schlingern. Anja lenkte scharf gegen. Der Mann neben ihr flog hart gegen die Beifahrertür. Er warf ihr einen Blick zu, der alles Mögliche bedeuten konnte, aber sie versuchte erst gar nicht, das Richtige herauszulesen.
»Warum schnallen Sie sich auch so früh ab?«, fragte sie gereizt.
Obermüller angelte stumm nach seinem Gurt, den er gerade erst beim Passieren des Ortsschildes gelöst hatte, und rammte wortlos die Metallzunge in die Halterung. Im selben Moment krachte das rechte Vorderrad in das nächste Schlagloch, und augenblicklich erfüllte das Klirren gegeneinanderschlagender Metallstangen den Innenraum des Wagens.
Anja verzog schmerzhaft das Gesicht und dachte an ihre Stoßdämpfer und daran, dass sie absolut kein Geld für neue hatte. Dann wandte sie den Kopf und warf einen genervten Blick auf die Ladefläche, wo zwei schwere Bohrstöcke seitwärts über den Blechboden rutschten. Aber sie waren fast da. Es lohnte sich nicht mehr, extra anzuhalten, um die Stöcke zu sichern.
Sie kurbelte die Fensterscheibe ein Stück herunter. Die Herbstluft war kühl. Zwischen den Waldhängen hing Frühnebel, aber das Wetter sollte später angeblich gut werden. Menschen waren nicht zu sehen. Auf einem teilweise abgeernteten Feld am Waldrand stand eine Erntemaschine. Ihr Einsatz würde vermutlich nicht lange auf sich warten lassen, und der Lärm würde sie bis tief in den Wald verfolgen. Schade! Die Stille im Wald war die schönste Belohnung für das enorme Arbeitspensum, das vor ihnen lag.
Sie würden sich durch jedes erdenkliche Dickicht kämpfen, aufrecht, gebückt oder, wenn es sein musste, auf allen vieren. Obermüller würde alle fünfzig Meter einen Bohrstock in den Boden hämmern, ihn wieder herausdrehen und dann für sie ablegen. Sie hätte inzwischen per Kompass den nächsten Einschlag bestimmt, er würde fünfzig Meter in die vorgegebene Richtung gehen und dort die nächste Probe ziehen, während sie die Bodenhorizonte auf dem Bohrstock ablas und auf ihrem Datenblatt eintrug. Vielleicht würde es unliebsame Überraschungen geben? Ein aufgescheuchter Schwarm Erdwespen oder ein tollwütiger Fuchs. Und wie viele Zecken würde sie sich wohl am Abend aus der Haut drehen?
Sie hatte in den drei Wochen seit Beginn ihres Praktikums zwar bereits ein wenig Routine gewonnen, aber im Grunde war doch jeder Tag anders verlaufen. Dass sie heute überhaupt in diesem Gebiet kartierten, war nicht geplant gewesen. Aber ihr bisheriges Einsatzgebiet war am Wochenende von einem Herbststurm derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass dort auf Monate kein Durchkommen war. Sie hatte erst gestern von der Änderung erfahren, sich nichts anmerken lassen, neues Kartenmaterial geholt und den ganzen Sonntag damit verbracht, den Begehungsplan auszuarbeiten. Schweigend. Konzentriert. Jegliches Unbehagen ignorierend.
Sie hatte niemandem erzählt, warum sie hier war. Der Einzige, der Bescheid wusste, war Dr. Venner-Brock. Diese Doppelnamen! Das Zeitalter der Unschlüssigen. Man konnte nicht einmal sagen, welcher Name zu wem gehörte. War sie vier Monate lang bei einem Herrn Brock in Therapie gewesen, der eine Frau Venner geheiratet hatte? Oder umgekehrt? Der Mann wusste so gut wie alles über sie, und sie kannte nicht einmal seinen Familiennamen. In dieser Gegend hatte niemand Doppelnamen. Die Leute hießen Fuchs, Huber, Bauer, Riedel oder eben Obermüller wie der Mann neben ihr, der jetzt missmutig durch die Windschutzscheibe stierte. Sie hätte grundsätzlich nichts dagegen gehabt, Michel zu ihm zu sagen. Aber Michel Obermüller war Mitte vierzig und alleinstehend. Die Frage, wer mit der jungen Forststudentin im Wald das erste richtige Loch bohren würde, war, wie sie erfahren hatte, in Obermüllers Stammkneipe in Waldmünchen bereits wiederholt diskutiert worden. Die Gegend ließ wenig Spielraum für Experimente in Geschlechterfragen.
Anja brachte den VW-Bus zum Stehen und blickte einen Feldweg hinab, der sich wenige Meter vor ihnen teilte. Links von ihnen, geduckt am Waldrand, lag ein altes Gehöft mit einem hässlichen Anbau, der aussah, als habe man ihn über die vor zehn Jahren verschwundene Zonengrenze hinweg hergeschleppt. Zur Rechten führte eine sandige Piste direkt in den Wald hinein. Anja griff nach den Karten auf der Ablage.
In der Eile und durch die rasch improvisierte Neuplanung gestern hatte sie teilweise mit älterem Kartenmaterial arbeiten müssen. Nord Ost LLX34 stand in großen Lettern am oberen Rand der alten Flurkarte. Faunried, Leybach, Haingries, Hinterweiher. Die Gemarkungen und Höfe waren zwar erfasst, aber ob das alles noch so genau stimmte, war zweifelhaft. In den letzten Jahrzehnten war gestorben und geboren, verkauft und vererbt worden. Im Vergleich zu den riesigen Zeiträumen im Boden, in denen sie gleich herumstochern würden, waren die Zeithorizonte hier oben zwar kaum der Rede wert, aber für die grobe Orientierung nun einmal unerlässlich.
Sie kuppelte wieder ein, lenkte den Wagen bis zu den ersten Bäumen, fuhr dann rechts heran und schaltete den Motor ab.
»Sind wir da?«, fragte Obermüller ungeduldig, weil Anja noch immer stumm die Karte studierte. »Was ist denn heute dran?«
»Leybach und Haingries«, antwortet sie und nestelte den Kompass aus ihrer Brusttasche. »Das sollten wir in einer Woche schaffen. Danach kommt Hinterweiher an die Reihe.«
»Und Faunried?«
»Enthält keine Waldstücke mehr. Streusiedlung ohne Streu sozusagen.« Sie deutete hinter sich auf ein hässliches Biogassilo. »Wie der Boden dort aussieht, weiß ich auch ohne Bohrstock.«
Obermüllers Blick folgte Anjas Finger auf der Karte, der jetzt auf drei schraffierte kleine Vierecke mitten im Wald zeigte. »Leybachhof«, sagte sie und schob den Finger dann an eine andere Stelle. »Gollashof.«
Sie drehte sich um und schaute zu der kleinen Häusergruppe am Dorfrand hin, die direkt an den Wald angrenzte. Sie hatten angebaut, sagte sie zu sich selbst. Aber anscheinend war ihnen das Geld ausgegangen. Nur ein Teil der Wände war verputzt. Im hinteren Teil des Anbaus waren Pressspanplatten vor die Fensteröffnungen genagelt. Am Haupthaus blätterte der Putz ab.
»Wir fangen hier an und bewegen uns dann erst einmal entlang dieser Achse bis zum Haingries. Danach schauen wir, nach welcher Seite wir auffächern. Auf geht’s.«
Anja stieg aus und machte einige Schritte in den Wald hinein, während Obermüller die Gerätschaften aus dem Wagen holte. Als er bepackt neben ihr stand, prüfte sie noch ein letztes Mal die Orientierung im Gelände an und sagte dann: »Hier.«
Obermüller plazierte die Spitze des Bohrstocks auf dem Waldboden und drückte ihn ein Stück in den Boden hinein. Als Nächstes hob er den weißen Plastikhammer. Anja sah sich irritiert um. Nein. Nicht jetzt. Ein unangenehmes, pelziges Gefühl kroch ihr über den Nacken und begann allmählich, ihre Brust zu umschließen. Sie griff in ihre Hosentasche, aber die war leer.
»Ich komme gleich wieder«, sagte sie mit gepresster Stimme zu Obermüller, der sie jedoch gar nicht beachtete, sondern Maß nahm, um den ersten Schlag richtig zu plazieren. Sie erreichte den Wagen gerade noch rechtzeitig. Das Medikament lag im Handschuhfach. Sie riss es auf, griff nach dem Zerstäuber, biss auf das Mundstück, drückte auf den Verschluss und sog das kühle, feuchte Spray tief in die Lungen ein. Der Krampf löste sich sofort. Erleichtert über die Wirkung des Medikaments, stand sie einige Sekunden da und atmete mit vollem Bewusstsein, noch immer ein wenig misstrauisch, ob der Krampf nicht doch gleich wieder einsetzen würde, dann zunehmend gelöst und dankbar, dass der Druck in ihren Lungen verschwunden war.
Obermüllers Schläge hallten dumpf durch die morgendliche Stille. Als sie wieder bei ihm eintraf, trieb er das Metall mit zwei letzten kraftvollen Schlägen bis in die gewünschte Bohrtiefe. Er warf den weißen Plastikhammer zur Seite, bückte sich zu dem noch aus dem Waldboden herausragenden Schaft und steckte einen runden Querstab durch eine schmale Öffnung im Schaftkopf, um den Stock wieder herauszudrehen. Der Bohrstock war etwa zur Hälfte aus dem Boden heraus, als aus der Ferne ein Rasseln und Dröhnen ertönte.
Die Erntemaschine war aufgewacht.
2
Die Probe, die Obermüller aus dem vierundzwanzigsten Loch gezogen und daneben abgelegt hatte, sah fast genauso aus wie die der drei vorhergehenden Einschlagstellen. Anja nahm ein neues Datenblatt, trug die Einschlagsnummer ein, maß die Mächtigkeit der aufeinanderfolgenden Bodenhorizonte und füllte die Spalten aus.
Die Humusschicht im Oberboden betrug elf Zentimeter. Im A-Horizont dominierte feinsandiger Lehm, im B-Horizont glimmerreicher, schluffiger Lehm, der mit rötlichem und ockerbraunem Lehm wechselgelagert war. Sogar im C-Horizont bei hundertsechzehn Zentimetern war der Boden noch locker, wies kein Gestein und nur punktuell Verdichtungen auf und enthielt gut sichtbare Feindurchwurzelung. Anja trug alle Einzelheiten ein und schlug dann mehrmals leicht gegen die Unterseite des Bohrstocks. Ein dünner Feuchtigkeitsfilm trat hervor. Sie notierte »gut« und »grundfeucht« unter der Rubrik Wasserhaushalt und trug als Standorteinheit den Code 204+ ein. Dann hörte sie jenseits des Dickichts vor ihr wieder Obermüllers Hammerschläge.
Doch plötzlich war da noch etwas. Der Buchenbestand ging hier in Nadelholz über. Als sie das letzte Mal darauf geachtet hatte, war dort, wo die noch Blätter tragenden Buchen es zwischen ihren Kronen zuließen, kurzzeitig Sonnenlicht zu sehen gewesen.
Inzwischen hatte die Sonne die Feuchtigkeit wieder heruntergedrückt und einen schweren, kühlen Dunst über den Wald gelegt. Anja hielt inne und lauschte. Die Erntemaschine lief nicht mehr. Rührte daher ihr Gefühl, dass etwas anders war als zuvor?
Sie schaute sich um. So einen Wald sah man nicht oft. Überall lag vermoderndes Totholz herum. Wild wuchernde Schlehen und Brombeersträucher machten ein Durchkommen manchmal fast unmöglich. In den letzten Stunden war sie schon mehrmals ganz schön ins Schwitzen gekommen bei dem Versuch, das auf dem Schreibtisch erstellte Raster ihres Probenziehungsplans wenigstens halbwegs einzuhalten. Aber trotz dieser Schwierigkeiten genoss sie die unberührte Umgebung, hielt manchmal inne, um ihren Blick in die verwunschene Tiefe zwischen den dicht stehenden Bäumen wandern zu lassen, weiter und weiter hinein in eine Welt, in der offenbar seit Jahren keine Menschenhand etwas verändert hatte. Doch wenn hier alles unberührt und verlassen war, warum hatte sie dann mit einem Mal so ein merkwürdiges Gefühl?
Sie nahm ihr Klemmbrett unter den Arm, umklammerte instinktiv den Bohrstock fester und ging ein paar Schritte in Obermüllers Richtung. Er konnte nicht weit entfernt sein. Durch die dichte Wand aus Nadelwald vor ihr war er ihrem Blick zwar vollständig entzogen. Auch hörte sie keine Hammerschläge. Aber sollte sie rufen? Unsinn. Obermüller würde sich über sie lustig machen. In zwei Minuten hätte sie zu ihm aufgeschlossen. Plötzlich blieb sie stehen. Zwischen den Fichten hatte sich etwas bewegt. Sie starrte auf die Stelle. Und dann entdeckte sie den Mann. Er stand gut geschützt in einer Gruppe kleinwüchsiger Fichten und blickte durch ein Fernglas direkt zu ihr hin. Jetzt schien er bemerkt zu haben, dass sie ihn gesehen hatte, denn er ließ das Glas sinken, stand reglos da und starrte sie an. Anja hob die rechte Hand. Der Mann reagierte nicht. Ein wenig verwundert, aber noch immer arglos setzte sie sich in seine Richtung in Bewegung. Sie hatte ein freundliches »Grüß Gott« auf den Lippen, als der Unbekannte sich abrupt umdrehte und zwischen den Zweigen verschwand. Das Letzte, was sie von ihm sah, waren sein breiter Rücken und der Lauf eines Gewehrs, der über seine Schulter hinausragte.
Sie erstarrte in der Bewegung. Sie hatte genug über merkwürdige Waldbegegnungen gehört, um zu wissen, dass es nun das Beste war, so schnell wie möglich zu Obermüller aufzuschließen. Ihr war unbehaglich zumute. Gleichzeitig hörte sie eine spöttische Stimme in sich. Was dachte sie denn gleich, nur weil ihr jemand mit dem Fernglas bei der Arbeit zugeschaut hatte? Vermutlich war es ein neugieriger Einheimischer, der sich nicht dafür rechtfertigen wollte, dass er sie beobachtet hatte. Doch eine zweite innere Stimme schlug eine ganze andere Richtung ein: nämlich dass ihr eigenes Gewehr im Auto lag und dass man nie wissen konnte, wer sich ein paar hundert Meter von der tschechischen Grenze entfernt in einem einsamen Waldgebiet herumdrückte. Das hier war eine ziemlich verlassene Gegend, und die Art und Weise, wie dieser Mann plötzlich verschwunden war, nachdem sie ihn bemerkt hatte, ließ alle Warnlampen in ihr aufleuchten. Und noch bevor sie das Dickicht erreicht hatte, das sie durchqueren musste, um zu Obermüller zu gelangen, rief sie plötzlich laut und deutlich: »HOOP! HOOP! HOOP!«
Es dauerte ein paar Sekunden. Aber dann ertönte ein klares: »JOH?«
Sie kämpfte sich durch die Zweige und schaute dann sowohl erleichtert als auch überrascht zu Obermüller hin. Er stand wartend auf einer Lichtung und blickte ihr verwundert entgegen. Der Bohrstock lag vor ihm auf dem Boden, den Querstab hielt er in der Hand. Anjas Verwirrung steigerte sich noch. Wieso war hier eine Wiese?
Während sie sich beeilte, zu Obermüller aufzuschließen, sah sie sich immer wieder um, ob der Mann mit dem Fernglas irgendwo zu sehen war. Aber der Wald hatte ihn wieder verschluckt. Rasch legte sie die letzten Meter zu Obermüller zurück.
»Was ist denn?«, wollte er wissen. »Frühstückspause?«
Anja zog sich Fichtennadeln aus dem Haar und rieb sich die lehmigen Finger an ihrer dunkelgrünen Hose ab. »Da war eben ein Mann im Wald. Er ist bewaffnet. Ist der hier vorbeigekommen?«
»Nein, Frau Grimm«, erwiderte Obermüller förmlich und musterte sie. »Hier war niemand.«
Anja konsultierte ihre Karte. Hatten sie die Orientierung verloren? Oder hatte sie diese Wiese übersehen? Aber ein zweiter, prüfender Blick bestätigte ihr, dass dem nicht so war. Sie standen zweifellos auf der mit Haingries bezeichneten Parzelle, gut zweihundert Meter vom Leybachhof und etwa doppelt so weit vom Gollashof entfernt. Doch auf ihrer Karte war eindeutig Fichtenwald verzeichnet. Sie sah sich um. Unweit der Stelle, wo sie aus dem Wald herausgekommen war, stand ein Hochsitz. Die Kanzel war derart alt und vermodert, dass sie mit dem Rest des Waldes wie verwachsen schien. Sie drehte sich um und nahm den Rest der Wiese in Augenschein. Ein Stück von ihr entfernt stand etwas, das wie eine Kiste aussah. Anja ging darauf zu. Jemand hatte alte Holzlatten zu einem vielleicht vierzig Zentimeter hohen, rechteckigen Verschlag zusammengenagelt. Darin lagen, an einem Holzpflock festgebunden, die Reste eines toten Huhns. Ein Fuchsköder, dachte sie. Sie standen offenbar auf einem Luderplatz.
Sie ging zu Obermüller zurück, der noch immer den Bohrstock in der Hand hielt und sie verwundert beobachtete. Dann hörten sie Schritte. Überrascht fuhren sie beide herum. Der Mann kam am östlichen Rand der Wiese aus dem Wald und marschierte direkt auf sie zu. Mit einem leisen »Jesus Maria« wich Obermüller zurück, während Anja wie angewurzelt stehen blieb.
Der Blick des Fremden war stur auf sie gerichtet. Seine Augen verblieben während der ganzen Zeit, da er auf sie losstürmte, in der gleichen starren, wenig vertraueneinflößenden Stellung. Sein Aufzug war nicht weniger seltsam als sein bedrohliches Auftreten beunruhigend. Er trug klobige, dunkelbraune Schnürstiefel, tiefgrüne Knickerbockerhosen und einen kurzen, schwarzen Ledermantel, dessen Riemen und Schnallen geschlossen waren. Überhaupt nicht dazu passte die blaue Schirmmütze aus Stoff auf seinem Kopf, auf der weithin sichtbar das Logo einer bekannten Düngemittelfirma prangte. An einem breiten Lederriemen über seiner rechten Schulter hing ein Drilling. Die Mündung der Waffe war auf ihre Beine gerichtet, und Anja wusste sehr gut, dass es in dieser Trageposition kein Problem war, den Lauf mit einer Handbewegung anzuheben.
Anja und Obermüller standen reglos da und brachten kein Wort heraus. Anja durchfuhr der Gedanke, dass dieser Mensch sein ganzes Lebensalter auf dem Leib zu tragen schien: Schuhe und Hosen der Nachkriegszeit, eine Lederjacke, die an Staatssicherheit und DDR-Polizei erinnerte, und obenauf eine vermutlich in China genähte Düngemittel-Werbemütze. Alles zusammengenommen passte das zu dem Eindruck, dass der Mann wohl um die sechzig Jahre alt war. Jetzt hatte er sie erreicht. Er baute sich in etwa zwei Meter Entfernung vor ihnen auf und schrie sie an. Was sie hier verdammt noch mal verloren hätten?
So jedenfalls übersetzte sich Anja den Sinn der Wörter, die sich in einem kaum verständlichen Dialekt über sie ergossen. Der kurz zum Sprechen sich öffnende Mund hatte eine unvollständige Vorderzahnreihe enthüllt. Die breite Stirn war gefurcht. Um die dunklen Augen herum, in denen Anja unbändigen Zorn, aber auch eine Spur von Fassungslosigkeit und völligem Unverständnis zu lesen vermeinte, war die Haut schlaff und faltenverwittert. Ein ungepflegter grauer Vollbart bedeckte sein Gesicht und hatte auch die Lippen komplett überwuchert. Nur wenn er sprach, sah man seinen Mund.
»Nehmen Sie bitte sofort die Waffe herunter!«, befahl Anja in einer Schärfe, die sie selbst überraschte. »Und ich meine SOFORT. Haben Sie mich verstanden?«
Aber der Mann reagierte nicht. Er sah sie unverwandt an, rührte sich nicht vom Fleck, schien gar nicht zu begreifen, was sie gesagt hatte, und setzte seine Schimpftirade fort. Das Gewehr baumelte an seiner Seite, aber glücklicherweise schien er sich – jedenfalls im Moment – nicht dafür zu interessieren.
Anja spürte Angstschweiß auf dem Rücken. Hilfesuchend drehte sie sich nach Obermüller um. Der hatte offenbar nur darauf gewartet, dass sie an ihn übergab, und schrie unvermittelt los.
Was auch immer er gesagt hatte – denn es war wieder im Dialekt gesprochen –, der Fremde verstummte. Aber die Situation war unverändert. Der Mann sah noch immer so aus, als könnte er jeden Moment die Beherrschung verlieren und sie einfach über den Haufen schießen.
Anja schielte zu Obermüller hin, der weitere Sätze hervorstieß, die dem Unbekannten wahrscheinlich erklärten, was sie hier taten. Die Worte selbst verstand Anja noch immer nicht, ebenso wenig wie die Schimpftirade des Mannes, die nun wieder einsetzte. Anja konnte sich nur zusammenreimen, dass sie es mit dem Waldbesitzer zu tun hatten, der weder über ihre Tätigkeit hier informiert noch damit einverstanden war.
Während die Wechselrede zwischen Obermüller und dem Fremden immer erregter wurde, wanderte Anjas ängstlicher Blick immer wieder zur rechten Hand des Mannes, die nervös zuckend den Tragriemen des Gewehres umfasst hielt. Dieser verkürzte Ringfinger! Anja fixierte das wutverzerrte Gesicht. War das er? Unschlüssig wanderte ihr Blick zwischen diesem Gesicht, das ihr vollkommen fremd war, und der verstümmelten Ringfingerkuppe dieser rechten Hand, die ihr durchaus vertraut erschien, hin und her.
Entschlossen unterbrach sie den heftigen Wortwechsel der beiden Männer mit einem plötzlich ausgestoßenen »Xaver«.
Der Fremde verstummte. Auch Obermüller hielt inne und verschränkte die Arme, vielleicht enttäuscht, in jedem Fall jedoch erstaunt darüber, dass dieses eine Wort Anjas so unglaublich viel wirkungsvoller gewesen sein sollte als seine vielen.
»Xaver?«, fragte Anja erneut, diesmal in einem ruhigeren, sanfteren Ton, denn sie musste ja nicht länger ein Wortgefecht übertönen und war sich nun auch recht sicher, dass von diesem Menschen für sie keine Gefahr ausgehen konnte.
Der Fremde fixierte sie wie eine phantastische Erscheinung. »Xaver?«, fragte sie ein drittes Mal und ging nun sogar einen Schritt auf ihn zu. »Ich bin’s doch nur. Die Grimm Anja.«
Er war es! Oder etwa nicht? Wer auch sonst? Warum hätte er auch andernfalls so plötzlich innegehalten? Dieser Mann war Xaver Leybach, Sohn von Anna und Alois Leybach, der Bruder von Traudel Gollas. Die Namen kehrten wie von selbst in ihr Gedächtnis zurück.
»Wir untersuchen hier die Böden«, fügte sie hinzu, weil Xaver Leybach noch immer nicht reagierte, sondern nur reglos stumm und finster vor sich hin starrte. »Ich komme vom Forstamt Waldmünchen«, fuhr sie ruhig fort. »Wir kartieren hier nur. Das ist alles. Schau.« Sie hielt ihm ihr Klemmbrett hin und zeigte dann auf ihren Bohrstock, den sie noch immer so fest umklammert hielt, dass ihre Finger jetzt schmerzten.
Er schnaufte. Das war alles.
Anja wollte hinzufügen, dass er doch wohl benachrichtigt worden sei wie alle Waldbesitzer im Kreis, aber Xaver Leybach schien entschieden zu haben, dass das Gespräch für ihn beendet war. Ohne ein weiteres Wort machte er kehrt und ging davon.
»Xaver … Herr Leybach«, rief Anja und eilte ihm ein paar Schritte nach. Aber der Alte machte nur eine wedelnde Handbewegung, als müsse er Fliegen verscheuchen, die ihn auf Höhe des Gesäßes verfolgten. Anja blieb stehen und schaute ihm ratlos nach.
»Jesus Maria«, fluchte Obermüller in ihrem Rücken.
3
Sie genoss den scharfen Geschmack von Zahnpasta in ihrem Mund und bürstete so lange, bis ihr Zahnfleisch zu bluten begann. Vor dem Duschen hatte sie ihren Körper mit Hilfe eines Handspiegels nach Zecken abgesucht und sich dann ausgiebig die Haare gewaschen, um den fettig-rauchigen Gestank des Restaurants, wo sie zu Abend gegessen hatte, loszuwerden. Aber das reichte nicht. Der Geruch war überall. Sie zog ihren Schlafanzug wieder aus und cremte sich von oben bis unten ein. Erst dann bemerkte sie, dass es ihre Kleider waren, die ihr kleines Zimmer mit diesem ranzigen Gaststättengeruch verpesteten. Sie schaute missmutig um sich. Es war schon nach zweiundzwanzig Uhr. Die knarrende Stiege hinunterzusteigen war ausgeschlossen. Frau Anhuber hatte sie mit ihren engstehenden Schweinsäuglein schon missbilligend genug angeschaut, als sie erst um halb neun nach Hause gekommen war und nicht wie gewohnt um sieben. Kurzerhand steckte sie ihre Kleider in einen Plastiksack, öffnete das Fenster und klemmte den Tragegriff beim Schließen unter der Zarge ein. Sie durfte nur morgen früh nicht vergessen, dass der Sack dort hing.
Die Begegnung mit Xaver hatte sie stärker mitgenommen, als sie erwartet hatte. Obermüller hatte sie natürlich gefragt, woher um alles in der Welt sie den Namen dieses verrückten Kauzes gekannt hatte. Aber nachdem sie nur vage geantwortet hatte, war er glücklicherweise nicht weiter in sie gedrungen. Ausgerechnet Xaver. Und dann so. Sie war darauf in keiner Weise vorbereitet gewesen. Sollte sie gleich Herrn Venner-Brock anrufen und ihn fragen, ob das vielleicht etwas zu bedeuten hatte und ob es seiner Theorie nach ihrem Zustand förderlich sei, dass sie Xaver Leybach begegnet war?
Ihr Handy zeigte endlich wieder ein Netz an. Aber sie wählte nicht die Nummer des Therapeuten, sondern klickte die Namen durch, bis »Sonja« erschien, und drückte dann auf die Ruftaste.
»Ja bitte«, erklang ihre helle Stimme nach dem zweiten Klingeln.
»Wie war es heute?«, fragte Anja ohne Umschweife.
»Unverändert. Mittags hat sie ein wenig gegessen. Abends war sie leider nicht dazu zu bewegen, aber sie hat Tee getrunken. Ich glaube, sie schläft schon. Willst du mit ihr sprechen? Soll ich nachsehen?«
»Nein. Nicht nötig. Von hier gibt es nichts zu erzählen. Hat sie nach mir gefragt?«
»Ehrlich gesagt …«
»Du sollst immer ehrlich zu mir sein, Sonja.«
»Also nein. Sie hat den ganzen Tag kaum gesprochen. Die Medikamente sind ziemlich stark.«
»Ich hoffe nicht zu stark.«
»Ich weiß es nicht. Aber ich denke, man darf bei ihr kein Risiko eingehen.«
»Danke für alles. Ich melde mich morgen. Kommst du gut voran?«
»O ja. Ich lebe ja hier wie in einer Mönchszelle. Herrlich.« Sonjas Stimme tat ihr wohl. Was für ein Glücksfall, sie gefunden zu haben! Zwei Monate würde sie noch bleiben, auf ihre Mutter aufpassen und in den vielen Stunden, wo glücklicherweise gar nichts zu tun war, für ihr Medizinstudium büffeln. Und dann? Wie sollte es dann weitergehen? Sollte sie ihre Mutter bis ans Ende ihrer Tage bewachen lassen, damit sie sich nicht noch einmal etwas antat? Müsste sie ab jetzt immer Medikamente nehmen?
Anja ließ den Arm sinken und sah sich niedergeschlagen in ihrem Zimmer um. Der Anblick deprimierte sie fast noch mehr als der Gedanke an ihre depressive Mutter. Wenn sie wenigstens dort sein könnte, in ihrem Haus in Planegg. Da gab es eine Bücherwand, einen Kamin, kuschelige, bequeme Sofas und Bilder an den Wänden. Diese Behausung hier war entsetzlich. Offenbar war irgendwo ein Ausverkauf von Kiefernpaneelen gewesen, als dieses Zimmer eingerichtet wurde. Eine Sauna war nichts dagegen. Sie suchte nach ihren Strümpfen, um den grünen Nadelfilz auf dem Boden nicht mit nackten Füßen betreten zu müssen, zog sie an, trat vor den Spiegel und wickelte ihre feuchten Haare aus dem Handtuch, das sie um den Kopf geschlungen hatte. Der Blick aus dem Fenster besserte ihre Stimmung nicht, denn wie sie es auch drehte und wendete: Früher oder später würde sie in genau solch einem Kaff wohnen müssen. Forstleute lebten nun einmal üblicherweise nicht in München oder Hamburg, sondern meistens in Orten wie diesem. Dabei war Waldmünchen noch relativ groß, mit fast siebentausend Einwohnern und einem eigenen Erlebnisbad. Sie war erst drei Wochen hier, und schon jetzt bedrückte sie das alles nur. Oder lag es an etwas ganz anderem?
Sie legte sich auf das schmale Bett und schloss die Augen. Vielleicht würde sie ja heute einfach einschlafen. Schließlich war sie um sechs aufgestanden und hatte den ganzen Tag im Wald kartiert. Aber sobald sie die Augen schloss, zog die Szene auf der Wildwiese an ihr vorüber. Xaver, der aus dem Wald gestürmt kam, das Gewehr an der Seite, die irren Augen starr auf sie gerichtet. Ein Waldschrat, dachte sie. Das hatten die letzten zwanzig Jahre aus ihm gemacht. So alterte man hier. Wie die anderen wohl heute aussahen? Lukas? Rupert? Die ganze Gollas-Familie. Würde sie denen auch über den Weg laufen? Wie sollte sie weiter vorgehen? Einfach weitermachen und hoffen, dass ein Wunder geschah?
Sie überdachte die letzten Monate, vor allem das Horrorwochenende im April. Drei Tage und Nächte hatte sie in der Intensivstation gesessen und gebetet, dass ihre Mutter den Selbstmordversuch überleben würde. Sie hatte sich vor Angst übergeben. Sie hatte vor Verzweiflung geweint. Und irgendwann war diese Wut in ihr hochgestiegen. Das Leben ihrer Mutter war ein Fiasko. Und ihr eigenes? Seit über zwei Jahren plagten sie diese Asthmaanfälle. War an der Theorie von Herrn Venner-Brock etwas dran, dass das alles eine psychische Ursache haben könnte? Hätten die Anfälle dann nicht schon einsetzen müssen, als sie acht Jahre alt war? Oder kurz nach dem Verschwinden ihres Vaters? Warum erst so viele Jahre später?
Aber sie hätte sich kein Praktikum in Waldmünchen organisiert, nur weil sie manchmal Atemnot bekam. Der Auslöser war ihre Mutter gewesen, nachdem Anja sie in letzter Sekunde mit einer Überdosis Schlaftabletten in die Notaufnahme von Großhadern gebracht hatte. Sie wird nicht sterben, ohne erfahren zu haben, was mit ihrem Mann geschehen ist, hatte Anja sich geschworen. Sie würde ihren Papa suchen. Und wenn es noch so sinnlos war.
Sie überdachte den nächsten Tag. Am Morgen musste sie erst einmal im Büro vorbeifahren und ihre Datenblätter ablegen. Um halb neun hatte Forstamtsleiter Grossreither einen Termin mit irgendwelchen chinesischen Holzkunden im Hochbrunner Gemeindewald, zu dem sie ihn begleiten sollte. Die Chinesen wollten sich Buchenpolter anschauen. Sie hatte wenig Lust dazu. Sie empfand es als unangenehm, mit Grossreither zu arbeiten, denn es war kein Geheimnis, was der Mann davon hielt, dass neuerdings Frauen in Forstämtern auftauchten. Andererseits sollte sie sich vielleicht besser schon jetzt an derartige Chefs gewöhnen. Danach würden sie wieder kartieren. Obermüller war für morgen bestellt. Und ausgerechnet in Faunried. Der Zufall hatte gewollt, dass Xaver ihr am ersten Tag über den Weg gelaufen war. Würde das jetzt so weitergehen? Würde sie auch den anderen begegnen? Und was versprach sie sich davon?
Sie lauschte dem Elfuhrläuten der Kirche. Als es halb zwölf schlug, war sie noch immer hellwach. Sie war versucht, eine von den Schlaftabletten zu nehmen, die sie nach der Katastrophe mit ihrer Mutter im Haus eingesammelt und damals nicht restlos entsorgt hatte. Ein paar davon für Notfälle griffbereit zu haben konnte ja wohl nicht schaden. Aber sie entschied sich anders, erhob sich, ging zu dem kleinen Tisch am Fenster, der ihr als Schreibtisch diente, und sortierte ihre Datenblätter. Sie überschlug die Zeit, die sie brauchen würden, um den Leybachwald zu kartieren. Ein paar Tage wären es bestimmt noch.
Dann stutzte sie. Was hatte sie auf Blatt 25 eingetragen? Sie verglich die Daten mit den Blättern 24 und 26 und schaute sich dann wieder die 25 an. Die Bodenschichtung war auffällig anders als die der näheren Umgebung. Sie suchte die Stelle auf dem Kartenraster und überlegte, woran die Abweichung liegen konnte. Dann wurde ihr klar, was die nächstliegende Erklärung dafür war: Sie hatte gepatzt. Kein Wunder. Es war die Probe, die Obermüller kurz vor Xavers Auftauchen gezogen hatte. Hatte sie den Bohrstock überhaupt richtig angeschaut? Sie wusste es nicht mehr. Sie erinnerte sich nur, dass sie ziemlich durcheinander gewesen war. Gab es möglicherweise noch mehr fehlerhafte Profile?
Sie fluchte leise. Sie konnte ja wohl keine verpatzten Proben abliefern. Sie sonderte das Datenblatt aus, malte ein Fragezeichen an den oberen Rand, legte es zuoberst auf den Stapel und verstaute es in ihrer Tasche. Sie würde morgen eine neue Probe ziehen und die Blätter erst am Abend abgeben. Dann war die Müdigkeit auf einmal da, und sie versank erschöpft in den Kissen.
4
Die Dolmetscherin hatte sichtlich Mühe mit dem Vokabular. Von Minute zu Minute wurde die Stimmung gereizter. Die Chinesen wollten diese Buchenstämme nicht haben, das war offensichtlich. Oder sie wollten sie nicht zu diesem Preis. Die Gemeinde würde die drei Polter also an einen anderen Holzhändler verkaufen müssen. Aber das war den Chinesen auch nicht recht, denn sie brauchten nun mal Buchenholz, um daraus Klavierfüße zu fertigen. Sie wollten also durchaus dieses Buchenholz von der Gemeinde kaufen, hatten sogar großes Interesse an bayerischem Buchenholz, aber irgendetwas war damit nicht in Ordnung, was die Dolmetscherin entweder selbst nicht begriff oder einfach nicht in die deutsche Sprache zu übersetzen verstand.
»Was ist denn nun damit nicht in Ordnung?«, fragte Anjas Chef genervt. »Die Stämme sind tadellos. Keine Zwiesel, keine Chinesenbärte. Nichts dergleichen. Also was soll das? Wo ist das Problem?«
Die Dolmetscherin bekam einen starren Gesichtsausdruck. »Chinesenbärte?«, fragte sie unsicher zurück. »Was bitte sind Chinesenbärte?«
»Na hier«, erklärte Manfred Grossreither und deutete auf einen aussortierten Stamm auf der anderen Wegseite, der eine unschöne wulstige Stelle aufwies. »Das hier. Chinesenbart.« Unwillkürlich hatte er in den etwas gestelzten Sprachmodus gewechselt, den Deutsche Ausländern gegenüber oft benutzen, auch wenn diese der deutschen Sprache mächtig sind. Glücklicherweise hatte er nicht auch noch angefangen, die Worte besonders laut und deutlich auszusprechen, was aber bestimmt die nächste Stufe sein würde.
Die beiden Chinesen starrten die Dolmetscherin erwartungsvoll an, die panisch nach Worten suchte. Plötzlich sprudelten einige Sätze aus ihrem Mund, und sie deutet auf den Holzwulst, wobei sie ein Wort mehrfach wiederholte, den Kopf schüttelte, erneut auf die Stelle deutete und dann gespannt wartete, wie ihre Kunden wohl reagieren würden. Die beiden Chinesen sahen sich kurz an, lächelten dünn und setzten dann zu einer längeren Gegenrede an.
»Qualität ist nicht gut«, übersetzte die Dolmetscherin kurz und bündig, womit endgültig klar war, dass nicht in erster Linie das Holz das Problem war, sondern die Kommunikation.
Grossreither winkte resigniert ab. Anja tat die Dolmetscherin leid. Wo hatten die beiden Chinesen die junge Frau wohl her? War sie Studentin? Sie sprach gut Deutsch. Aber Holzdeutsch war nun mal nicht Deutsch. Und Chinesen zu erklären, dass Astnarben an deutschen Buchen Chinesenbärte hießen, war sicher ein wenig heikel. Anja überlegte, was sie in einer derartigen Situation getan hätte. Vielleicht müsste man den Begriff als »Germanennase« ins Chinesische übersetzen, um die Situation zu retten? Aber die Dolmetscherin wirkte nicht sehr schlagfertig. Sie sah eher erschlagen aus und wäre wahrscheinlich am liebsten im Waldboden versunken. Hatten die Chinesen ihr denn nicht gesagt, worum es hier ging? Wahrscheinlich wollten sie nicht nur den Holzpreis drücken, sondern auch die Dolmetscherkosten und hatten deshalb für ein Trinkgeld diese bedauernswerte Studentin engagiert, die völlig überfordert war.
Ein aufheulendes Motorengeräusch unterbrach die peinliche Verhandlungspause. Etwa dreißig Meter von ihrem Polter entfernt war ein Rücker damit beschäftigt, frisch gefällte Bäume aus dem Wald herauszuziehen. Eine riesige, unbemannte Planierraupe bewegte sich kettenrasselnd auf dem Waldweg hin und her und zog ein langes Stahlkabel stramm, das sich bis zu der Stelle an dem steilen Waldabhang erstreckte, wo der Rücker mit seiner Fernsteuerung stand und versuchte, einen Baumriesen, der sich im Sturz verkeilt hatte, loszubekommen. Immer wieder heulte der Motor der Raupe auf, gefolgt vom Sirren des sich spannenden Stahlseils und dem Knirschen der sich reibenden Stämme. Der Rücker fluchte. Man konnte ihn bis hierher hören. Die Raupe fuhr ein Stück zurück, drehte leicht und fraß sich ein paar Meter in den Wald hinein. Anja verzog schmerzlich das Gesicht.
Mit einem Mal schrie Grossreither: »PAVEL! Verdammt noch mal. Lass die Raupe auf dem Weg.«
Aber Pavel schien nichts zu hören.
»Frau Grimm, sagen Sie diesem Idioten doch mal, er soll die verfluchte Raupe auf dem Weg lassen!« Anja rannte los. Aber der Rücker hatte die Raupe bereits wieder zurückgesetzt und wedelte jetzt entschuldigend mit der Hand. Anja blieb stehen. Dann gab es einen lauten Krach, und ein riesiger Stamm rutschte den Hang hinab. Anja verzog erneut das Gesicht. Theorie und Praxis, dachte sie resigniert. Was Pavel da mit dem empfindlichen Waldboden veranstaltete, war ein Massaker.
»Was müssen wir auch Buchen nach China verkaufen?«, schimpfte Grossreither auf der Fahrt zurück ins Büro. »Können die das Holz für ihre Klavierfüße nicht selber anpflanzen?«
»Globalisierung«, sagte Anja.
»Mein Arsch. Bis der Stamm in China und wieder hier ist, hat der Transport zehnmal mehr Dreck erzeugt, als der Baum in hundert Jahren aus der Luft gefiltert hat. Ein Schwachsinn das alles. Und dann wollen sie auch noch die Preise drücken.«
»Meinen Sie, dass es nur darum ging?«
»Worum denn sonst? Ist doch immer das Gleiche. Qualität runterreden und billig einkaufen. Die Stämme waren A-Qualität.« Er verstummte, griff in die Vertiefung neben der Handbremse und zog ein Karamellbonbon hervor.
»Auch eins?«, fragte er.
»Nein danke.«
Grossreither rauchte seit einigen Wochen nicht mehr, aber angesichts seines Bonbonverzehrs fragte sich Anja, welche Sucht schädlicher war. Der Mann hatte miserable Laune, was sicher nicht nur an den Chinesen lag. Er fuhr ruckartig, drehte hoch, schaltete spät und schimpfte vor sich hin.
»Wie läuft’s in Hinterweiher?«
»Wir sind noch im Leybachforst.«
»Hm. Na ja. Sehr schnell geht’s ja nicht gerade bei Ihnen. Ist der Obermüller so langsam?«
»Nein. Aber wir hatten gestern einen merkwürdigen Zwischenfall. Xaver Leybach. Kennen Sie den?«
Grossreither schnaubte. »Sicher kenn ich den. Was war denn los?«
»Er hat uns heimlich beobachtet. Dann kam er uns mit dem Gewehr unterm Arm im Haingries entgegen und hat uns angeschrien, wir sollten seinen Wald in Frieden lassen. Es war ziemlich unheimlich.«
»Hat er denn nicht gewusst, dass Sie zum Kartieren kommen?«
»Die Benachrichtigungen sind im April rausgegangen. Einsprüche gab es keine, das habe ich geprüft.«
Grossreither kaute eine Weile auf seinem Bonbon herum, bevor er weitersprach. »Die Gollas sind schon geschlagen mit dem Xaver.«
»Ah ja?«
»Die müssen sich ganz schön strecken, um irgendwie über die Runden zu kommen. Wenn sie den Leybachwald hätten, könnten sie einiges draus machen. Der Lukas will einen Ökowald mit Wipfelpfad einrichten, um das Geschäft mit den Feriengästen anzukurbeln. Das machen die wohl neuerdings in Amerika.«
»Australien«, korrigierte Anja.
»Von mir aus. Jedenfalls ist Fremdenverkehr ja so ziemlich das Einzige, womit man hier noch ein bisschen Geld verdienen kann.«
»Und? Wo ist das Problem?«
»Xaver. Der will das nicht. Sie haben es ja selbst erlebt. Der geistert dort immer herum und erschreckt die Leute.«
»Wem gehört denn der Wald?«
»Na den Alten. Anna und Alois Leybach. Aber die kümmern sich nicht. Die Anna liegt seit Jahren krank im Leybachhof und würde wohl lieber heute als morgen sterben. Der Xaver ist eigentlich nicht zurechnungsfähig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn noch lange frei herumlaufen lässt. Aber ihn entmündigen zu lassen ist nicht so einfach. Er versorgt ja auch die Mutter.«
»Und Alois Leybach? Warum nimmt der das nicht in die Hand?«
Grossreither stieß ein unbestimmbares Brummen aus, das er manchmal vorausschickte, bevor er etwas sagte. »Der ist doch schon ewig auf und davon. Deshalb verlottert ja alles.«
Anja sagte nichts, sondern sah aus dem Fenster. Verlottert? Der Begriff zeigte deutlich, welch unterschiedliche Auffassung Grossreither und sie von einem Wald hatten. Sie ließ ihren Blick über die Landschaft schweifen. Die Hänge schimmerten in sattem Grün. Der Mais stand hoch und wurde allerorten abgeerntet. Die Sonne wärmte, und überall hing reifes Obst an den Bäumen. Der bayerische Nadelwald floss wie ein dunkelgrünes Meer kilometerweit in die Landschaft hinein. Grossreithers Forstordnung. Monokulturen, wohin das Auge reichte.
Voller Unbehagen dachte sie an die Szene auf der Wildwiese zurück. Geistert immer im Wald herum und erschreckt die Leute. Sie versuchte, sich den Xaver Leybach in Erinnerung zu rufen, den sie als Kind gekannt hatte. Er war sonderbar gewesen, aber niemals so aggressiv, wie sie ihn gestern im Haingries erlebt hatte. Xaver war ein harmloser Mensch gewesen, liebevoll zu ihr und den anderen Kindern. Auch mit den Tieren war er sanft umgegangen, sogar zärtlich im Gegensatz zu den anderen Jungs. Vor allem im Vergleich zu diesem Grobian Rupert. Lukas plante also einen Wipfelpfad. Und Rupert? Franz und Waltraud? Wie die wohl heute aussahen? Würde ihr Name ihnen etwas sagen?
»Braucht ihr noch lange in Faunried?«, riss Grossreither sie aus ihren Gedanken.
»Drei oder vier Tage«, antwortete sie zerstreut. Sie schwieg eine Weile und fragte dann: »Warum ist denn dieser Xaver Leybach so komisch? Kennen Sie ihn näher?«
»Was heißt schon kennen. Ist ein armer Teufel. War schon immer sonderbar, und seit der Vater weg ist, ist es nur schlimmer geworden.«
»Wie lange ist er denn schon weg?«
Grossreither überlegte. »Zehn, fünfzehn Jahre. Weiß ich nicht genau. Erst kam er ja noch ab und zu. Hatte ja Geschäft mit dem Heinbichler.«
»Wer ist das?«
»Na sein Jagdpächter.«
»Ah.« Anjas ironischer Tonfall war Grossreither nicht entgangen.
»Sie sagen es«, bemerkte er trocken. »Haben Sie den Wildverbiss gesehen?«
»Ja. Ziemlich schlimm.«
»Schießt nur herum ohne Sinn und Verstand«, schimpfte er. »Manchmal tut er ja auch, was man ihm sagt. Oft kommt er aber monatelang gar nicht her, weil er Großwild jagt. Hat eben viel Geld.«
»Gehört der auch zu einer der Familien?«
»Nein. Gar nicht. Der Heinbichler ist ein Spezl vom alten Albrecht Gollas, dem Franz sein Vater. Die kennen sich schon ewig, noch aus der Zeit vorm Krieg. Interessiert Sie wohl, diese Gollas-Familie. Na, warten Sie mal, bis Sie den Lukas sehen.« Er sah sie jetzt augenzwinkernd an. »Der könnte Ihnen gefallen.«
Anja musste lachen.
»Sie lachen. Warten Sie’s mal ab. Das ist ein fescher Bursche.«
»Bestimmt«, erwiderte sie und fragte sich, was Grossreither bloß zu der Annahme gebracht haben konnte, sie interessiere sich für irgendwelche Männer hier. Doch die Erwähnung von Lukas versetzte ihr dennoch einen Stich. Sie versuchte, sich den achtjährigen blonden Bub in Erinnerung zu rufen, mit dem sie zwei Sommerferien lang fast jeden Tag gespielt hatte. Aber das Einzige, woran sie sich jetzt erinnerte, war der Dialekt, den er gesprochen hatte: Er kimmt statt er kommt.
Um vom Thema abzulenken, fragte sie: »Haben Sie eine Erklärung dafür, warum mitten im Leybachforst eine Wildwiese angelegt wurde? Ganz in der Nähe, Richtung Hinterweiher, ist doch ein großes Feld. Warum legt man da extra für teures Geld eine Wildwiese an?«
Grossreither griff erneut neben die Handbremse und angelte sich das nächste Bonbon. »Na, wer sich’s leisten kann, in Afrika Großwild zu jagen, der kann wohl auch für ein paar Tausender eine Wildwiese einrichten, wenn ihm danach ist, oder?«
»Hat der Heinbichler die Wiese angelegt?«
»Na, die Leybacher und die Gollas sicher nicht, so wie die herumknapsen müssen. Ich vermute, der Heinbichler wollte etwas, wo man Schwarzwild und Füchse ködern kann. Übrigens, da wir schon dabei sind: Wenn Sie ein paar Abschüsse machen könnten, wär’s auch recht. Sie haben ja selbst gesehen, dass der Heinbichler viel zu wenig schießt. Vielleicht gleich heute Abend? Und von dem Xaver sollten Sie sich besser fernhalten. Irgendwann passiert mit dem noch ein Unglück.«
»Ja, sicher«, sagte sie, fest entschlossen, keiner der beiden Empfehlungen Folge zu leisten
5
Obermüller wartete auf dem Parkplatz des Forstamts auf sie. Er sah nicht besonders gut gelaunt aus und sprach nach einem dahingemurmelten Morgengruß während der ganzen Fahrt bis Faunried kein weiteres Wort mehr. Anja unternahm keinen Versuch, den Grund für sein mürrisches Schweigen zu ergründen. Sie hatte außerdem ihre eigenen Sorgen. Wie es ihrer Mutter wohl ging? Sie durfte nicht vergessen, um die Mittagszeit herum Sonja anzurufen.
Daraus wurde nichts, denn in dem Waldstück, in das sie gegen halb eins vorgedrungen waren, gab es keinerlei Funkempfang.
»Darf ich Sie noch mal was fragen?«, sagte Obermüller plötzlich, während sie Mittagspause machten und ihre Brote aßen.
»Ja. Sicher.«
»Wie kommt es, dass Sie diesen Menschen gestern mit Namen kannten?«
Anja trank einen Schluck Kaffee, bevor sie antwortete: »Ich war als Kind mal hier in den Ferien. Ist ziemlich lange her. Ich war sieben oder acht. Da gab’s hier viele Kinder, mit denen ich gespielt habe.«
»Kinder?«, fragte Obermüller verdutzt. »Dieser Verrückte gestern war doch mindestens dreimal so alt wie Sie?«
»Ja. Aber nicht im Kopf. Er war bei uns Kindern schon richtig.«
»So«, antwortete Obermüller und biss in sein Brötchen.
»Er hat manchmal auf uns aufgepasst, dass wir nicht in den Bach fielen und so weiter. Er sah auch nicht so erschreckend aus wie heute.«
»Wie haben Sie ihn dann erkannt?«
»Sein rechter Ringfinger ist verstümmelt. Die Fingerkuppe fehlt. Während Sie mit ihm geredet haben, habe ich auf seine Hand am Gewehr geachtet. Da hab ich’s gesehen.«
Obermüller kaute stumm weiter. »Letztes Jahr hatten wir schon mal so etwas«, sagte er nach einer Weile.
»Ah ja?«, sagte sie und steckte sich ein Tomatenviertel in den Mund.
»Wir sind früh unterwegs gewesen«, fuhr er fort, »halb sieben vielleicht. Plötzlich ein Krach, als würde ein Schwein abgestochen. Und ein Bauer mit Mistgabel, der auf uns zurennt und brüllt wie am Spieß. Fluawereihium schrie er. Fluawereihium. Keine Sau konnte verstehen, was er gemeint hat. Wir sind dagestanden wie zwei Hornochsen, bis bei Grossreither endlich der Groschen gefallen ist. Der Mann hat gedacht, wir kämen von der Flurbereinigung. Wie sich später herausgestellt hat, war sein Hof komplett arrondiert, Hofstelle, Felder, Wiesen, Wald, alles. Aber man hat ihn dennoch zwingen wollen, an der Flurbereinigung teilzunehmen und horrende Gebühren dafür zu bezahlen. Fünfzigtausend oder so. Er hat gedacht, wir kämen vom Amt und wollten heimlich seinen Besitz vermessen. Na, da hätte ich auch zugestochen.«
»Viel habe ich ja gestern nicht verstanden, aber von Flurbereinigung war, glaube ich, nicht die Rede.«
»Das stimmt«, gestand Obermüller ein. »Ich dachte ja nur. Gründe, die Mistgabel zu schwingen, wenn Leute vom Amt kommen, gibt’s in jedem Fall genug, oder?«
»Wenn er den Drilling auf uns angelegt hätte, hätten Sie das sicher nicht witzig gefunden, oder?«
»Naa«, gab Obermüller zurück. »Da haben Sie auch wieder recht.«
Er kaute schweigend weiter und blickte zufrieden vor sich hin. Ob Xaver sie heute wieder beobachtete, fragte sie sich. Sie schaute sich um. Der Bewuchs war so eng und dicht, dass man nur wenige Meter Sicht in den Wald hatte. Wirklich gefährlich war Xaver wohl nicht, sonst hätte Grossreither sie bestimmt nicht wieder losgeschickt. Aber seine Warnung verunsicherte sie dennoch. Wäre es vielleicht klüger, nach der Arbeit beim Leybachhof vorbeizuschauen, um den Vorfall von gestern zu klären? Sollte sie mit Anna Leybach reden? Oder mit Waltraud Gollas? Wie würde Xaver Leybach reagieren, wenn sie ihn aufsuchen würde?
Kurz darauf brachen sie auf. Obermüller kam schneller voran als am Vormittag. Oder war sie langsamer geworden? Das Einhämmern und Herausdrehen des Bohrstocks sah einfach aus, aber selbst mit einer guten Technik war die Arbeit eine Strapaze. Ihr selbst wären nach zwanzig oder dreißig Bohrungen die Arme abgefallen. Obermüller hingegen schien jetzt richtig in Fahrt zu kommen. Lag es an der steigenden Temperatur, dass sie allmählich müde wurde? Die Sonne hatte nun allen Dunst weggebrannt, und die Luft hatte sich merklich aufgewärmt.
Immer öfter blieb Anja stehen, um über der monotonen Arbeit nicht zu vergessen, durch was für einen wunderschönen Wald sie heute gehen durfte. Dieser Leybachforst war kein gewöhnlicher Forst. Es lag jede Menge Totholz herum, ein klares Anzeichen dafür, dass hier schon lange keine intensive Forstnutzung mehr stattfand. Ja, im Grunde war der Forst gar kein Forst, sondern auf dem Weg, wieder ein richtiger Wald zu werden: verwahrlost und verwunschen, mit stehengelassenen Käferbäumen und verrottendem Sturmholz. Ein vor langer Zeit verwester und fast gänzlich mumifizierter Kuhkadaver steckte grotesk verdreht im Wurzelstock einer umgestürzten Buche, und Anja konnte sich beim besten Willen nicht erklären, wie das Vieh sich dort verfangen hatte. Aber vor allem stieß sie auf Pflanzengesellschaften und Vegetationsformen, die in einem straff bewirtschafteten Gemeinde- oder Staatswald in dieser Form eher nicht vorkamen.
Immer wieder hielt sie inne und nahm sich Zeit, die poetische Stille dieses vernachlässigten Durcheinanders zu genießen. Obermüllers Gehämmer hatte natürlich längst alle Tiere in der näheren Umgebung vertrieben, so dass sie kaum Vögel sah, geschweige denn sonst irgendein Tier, von denen es, aus dem Wildverbiss zu schließen, doch jede Menge geben musste. Aber schon die Bodenvegetation war interessant. Mauerlattich trat gehäuft auf. An den sonnigeren Stellen dominierte erwartungsgemäß die Waldhainsimse. Merkwürdigerweise stieß sie auch auf Heidelbeermatten, vermutlich das Ergebnis wiederholter Streuentnahme aus der Zeit, bevor dieser Wald in seinen Dornröschenschlaf verfallen war. Es gab auch Frauenfarn und Waldhabichtskraut. Vor einem fast zehn Meter langen und bestimmt fünf Meter breiten, zart weiß blühenden Teppich von Lonicera japonica blieb Anja eine Weile lang fast ehrfürchtig stehen, bevor sie den schwer zu bekämpfenden Neophyten in ihren Unterlagen vermerkte.
Als sie gegen vier Uhr nachmittags fertigkartiert hatten, schickte sie Obermüller zum Wagen voraus und kehrte allein noch einmal zum Haingries zurück. Er brauchte ja nicht unbedingt danebenzustehen, wenn sie die verpatzte Probe noch einmal zog. Die Wiese sah genauso aus wie am Vortag. Die Wildköder waren unberührt und zeigten bereits Anzeichen von Verwesung. Bei den Maisködern, die am Wiesenrand in einer Blechkiepe von einem Buchenzweig herabhingen, hatte es in der Nacht wohl etwas Schwarzwildaktivität gegeben. Anja drehte sich um und blickte in Richtung des Hochsitzes, der am südlichen Ende der Wiese stand. Die Schussentfernung von der Kanzel war ideal, aber Jagdpächter Heinbichler war offenbar zurzeit nicht aktiv.
Sie wollte sich nicht lange aufhalten, ging zu der Stelle, wo sie Einschlag 25 vermutete, und suchte den Boden nach wurmartigen Erdröllchen ab, die von ihren Bodenbohrungen üblicherweise zurückblieben. Sie schritt einige Minuten lang die Parzelle ab und entdeckte endlich ein paar Reste der Bodenkrume, die sie für Probenrückstände vom Vortag hielt. Sie kniete sich kurz hin, um sicherzugehen, drückte dann den Bohrstock in den Boden hinein, hämmerte zweimal vorsichtig auf das stumpfe Ende, um den Stock zu fixieren, ließ ihn wieder los und trieb ihn dann mit gezielten Schlägen tiefer hinein. Als sie die 120-Zentimeter-Marke erreicht hatte, warf sie den Hammer ins Gras und steckte den kleinen Metallstab durch das Loch im Schaft. Dann stemmte sie sich mit beiden Beinen gegen den Boden, drehte den Bohrstock mehrfach hin und her und zog ihn mühsam wieder heraus.
Das Profil entsprach genau dem Muster, das sie gestern eingetragen hatte. Sie hatte keinen Fehler gemacht. Mit dem Boden stimmte etwas nicht. Er stand sozusagen auf dem Kopf. Sie nahm die Datenblätter der vorausgegangenen und nachfolgenden Proben zur Hand und fand die Störung bestätigt. Die Humusschicht war hier nur etwa halb so mächtig wie zuvor. Im B-Horizont waren graugrün verfärbte Lehmanteile eingelagert, die im restlichen Gelände erst viel tiefer auftraten. Dort hingegen … Sie stutzte und betrachtete helle Einlagerungen in der untersten Schicht. Sie griff in ihre Tasche, zog eine kleine Flasche mit Salzsäure heraus und tröpfelte ein wenig Flüssigkeit auf die hellen Stellen. Sie brausten sofort auf.
Anja blickte perplex auf das schäumende Substrat. Dann säuberte sie den Stock, ging fünfzehn Schritte in Richtung des letzten Einschlags zurück und zog eine zusätzliche Probe. Hier war kein Kalk im Boden. Sie schaute irritiert um sich und musterte das Gelände. Warum änderte sich die Horizontabfolge zur Mitte der Wiese hin so abrupt? Sie ging auf den Hochsitz am Wiesenrand zu und zog ein paar Schritte rechts davon eine dritte Probe. Das Profil war unauffällig. Die Humusauflage war ein wenig mächtiger, was am Waldrand zu erwarten war. Die tieferen Schichten jedoch entsprachen exakt dem Muster, das im Waldboden und fast überall auf der Wildwiese vorherrschte. Nur nicht an Einschlag 25.
Sie stützte sich auf den Bohrstock und nahm die gesamte entwaldete Fläche in Augenschein. Wenn sie die Profilübergänge genau erfassen wollte, müsste sie die Proben in einem deutlich kleineren Raster ziehen, etwa alle fünf oder zehn Meter, womöglich sogar noch enger, was sie ganz schön lange beschäftigen würde. Aber wozu eigentlich? Hier wurde schließlich nicht aufgeforstet. Grossreither würde sie für verrückt erklären, wenn sie mit Obermüller stundenlang diese Wildwiese kartieren würde.
Und was besagte die Unstimmigkeit schon? In der Mitte dieser Fläche war wahrscheinlich irgendwann einmal ein Loch gegraben und dann wieder aufgefüllt worden. Na und? Hatte sie verdächtige oder meldepflichtige Rückstände in den Bohrkernen gefunden? Nein. Alles sah normal aus. Kein Öl. Kein Giftmüll. Jedenfalls nichts, was auf illegale Einlagerungen oder Grundwassergefährdung hinwies. Die Kalkrückstände konnten von Bauschutt stammen, der hier entsorgt worden war. Oder hatte es einen Unfall gegeben, als die Fläche gerodet wurde? War Öl aus einer Maschine ausgelaufen und der Boden daher teilweise abgetragen worden? Und hatte sie überhaupt die Zeit oder eine Veranlassung, sich mit dieser Frage zu beschäftigen? Warum stand sie noch hier herum?
Plötzlich war das pelzige Gefühl wieder da. Sie griff sofort in ihre Hosentasche, zog das Kortisonspray heraus, biss auf das Mundstück und atmete das Mittel so tief ein, wie sie konnte. Auf den Bohrstock gestützt, wartete sie, bis die Wirkung einsetzte. Der Krampf in ihren Lungen ließ augenblicklich nach. Aber nicht der in ihrer Kehle. Die war wie zugeschnürt. Sollte Herr Venner-Brock doch recht haben? Was suchte sie hier? Ein auffälliges Bodenprofil? Wartete sie nicht ständig darauf, dass ihr Papa zwischen den Bäumen auftauchen würde, um mit ihr nach Hause zu gehen? Stand sie deshalb hier und keuchte, weil die letzten, kümmerlichen Erinnerungen an ihn dort im Wald herumgeisterten? Die letzten Bilder von ihm, die letzten vagen Eindrücke? Am Vortag seines Verschwindens waren sie gemeinsam im Wald gewesen. In der Buchenschule. Er hatte ihr gezeigt, wie die alten Buchen ihren Nachwuchs erziehen, wie sie noch in hohem Alter ihre Blätterkrone plötzlich wieder wachsen lassen, um durch die Steuerung des Lichteinfalls am Boden Ordnung unter dem wild heraufschießenden Nachwuchs zu halten. Fast so, als hätten sie einen Willen, ein Bewusstsein.
Ein Geräusch ließ sie herumfahren. Keine drei Meter von ihr entfernt, den Lauf seines Gewehrs direkt auf ihren Kopf gerichtet, stand Xaver Leybach.
6
Rudolf Heinbichler rührte sich nicht. Mit angehaltenem Atem starrte er durch die Zweige hindurch auf die Lichtung. Was er sah, war grotesk. Xaver Leybach zielte aus nächster Nähe auf eine unbekannte junge Frau, die bis vor wenigen Minuten im Haingries Bodenproben gezogen hatte. Er hatte die Hammerschläge gehört und keine Mühe gehabt, sie zu finden. Fast hätte er sie angesprochen, aber dann war es ihm zunächst ein größeres Vergnügen gewesen, sie heimlich zu beobachten. So ein Anblick bot sich nicht alle Tage. Und jetzt das! Wo zum Teufel war der Xaver so plötzlich hergekommen? Wie aus dem Nichts war er hinter der Frau aufgetaucht, und als sie sich erschrocken umdrehte, hatte er das Gewehr hochgerissen.
Heinbichler spürte, dass ihm der Schweiß in den Nacken lief. Sein Herz klopfte. Sollte er eingreifen, sich bemerkbar machen, bevor ein Unglück geschah? Aber was würde geschehen, wenn er jetzt auf die Lichtung hinausstürzte? Xaver war unberechenbar. Keiner konnte sagen, was im Kopf dieses Irren vor sich ging.
Ein leichter Wind bewegte die Baumkronen und ließ die Zweige rascheln. Er könnte auch einfach unbemerkt davonschleichen.
Im Grunde konnte es ihm ja gleich sein, was die Frau hier tat. Da war ja schon lange nichts mehr. Sollte die Forstverwaltung doch hier im Boden herumbohren. Es musste ja wohl die Frau sein, von der Grossreither gestern erzählt hatte. So weit war es also schon. Frauen in Forstämtern! Und dann auch noch im Außendienst. Immerhin war sie ganz ansehnlich.
Jetzt sagte sie irgendetwas. Aber er konnte es nicht verstehen. Nerven hatte sie ja, das musste er zugeben. Er würde nicht so ruhig dastehen, wenn ein Depperter den Lauf eines durchgeladenen Drillings auf seinen Kopf gerichtet hätte. Sie sprach ganz ruhig auf ihn ein. Aber was sagte sie? Er schloss die Augen. Gleich gäbe es eine Katastrophe. Plötzlich war er sich sicher, dass es im nächsten Moment geschehen würde. Xaver würde abdrücken. Jetzt gleich, vor seinen Augen. Und was sollte er dann tun? Die Frau wäre sofort tot. Und er hätte die Wahl. Er könnte versteckt bleiben. Er könnte weglaufen. Oder er könnte selbst schießen. Er öffnete die Augen wieder. Die Frau sprach noch immer. Leise, behutsam, eindringlich. Und der Xaver? Stand unverändert da und zielte.
Heinbichler raffte sich auf. Er konnte nicht zulassen, dass dieser Irre die Frau erschoss. Vorsichtig ließ er sein Jagdgewehr von der Schulter gleiten und legte an. Xavers verbissenes Gesicht erschien widernatürlich groß und grobkörnig in seinem Zielfernrohr. Diese Augen. Diese irren Augen. Aber er konnte Xaver doch nicht in den Kopf schießen! Er senkte den Lauf behutsam, bis das Fadenkreuz auf Xavers rechter Schulter angekommen war, genau an der Stelle, wo der Gewehrstock anlag. Sollte er jetzt abdrücken? Wie genau würde er auf diese Distanz treffen? Und wenn er die Frau traf? Xaver hatte den Finger am Abzug. Selbst wenn er ihn gut erwischte, würde Xaver möglicherweise noch aus allen drei Läufen feuern. Eine doppelte Schrotladung und auch noch eine Kugel aus dieser Entfernung auf ihren Kopf abgefeuert … Nein, er durfte nicht abdrücken. Was für eine entsetzliche Situation!
Plötzlich sah er nur noch Wald durch sein Glas. Heinbichler blickte von seinem Okular auf. Xaver war zwei Schritte zurückgewichen und hatte den Lauf seiner Waffe ein wenig gesenkt. Die Mündung war noch immer auf die Frau gerichtet, aber nicht mehr auf ihren Kopf. Sie stand still. Ihre Stimme war nicht mehr zu hören. Es vergingen endlose Sekunden. Heinbichler fixierte Xaver erneut durch sein Zielfernrohr. Der Lauf von Xavers Jagdgewehr sank weiter und war nun gänzlich zur Erde gerichtet. Die Stimme der Frau war wieder zu vernehmen. Wenn er nur etwas verstehen könnte! Ein metallisches Klicken klang über die Lichtung. Xaver hatte die Hähne entspannt. Heinbichler ließ seine Waffe sinken, sicherte sie geräuschlos und legte sie neben sich ab. Und jetzt? Was würde jetzt geschehen?
Er wartete und beobachtete. Die Frau war in die Hocke gegangen und deutete auf irgendetwas im Gras. Xaver rührte sich nicht von der Stelle. Jetzt wischte er sich mit der linken Hand übers Gesicht. Plötzlich fuchtelte er mit den Armen. Die Frau hatte einen Bohrstock aufgehoben und mit der Spitze nach unten auf die Wiese gestellt. Xavers heftige Reaktion ließ sie innehalten. Er stürzte auf sie zu und zog sie zur Seite. Heinbichlers Miene verfinsterte sich. Seine Gedanken schossen in derart viele Richtungen gleichzeitig, dass er sich zu keiner Handlung durchringen konnte. Ein Unheil war offenbar vermieden worden. Aber bahnte sich dort möglicherweise gerade ein zweites, weitaus schlimmeres an?
7
Jetzt wirst du sterben, brüllte etwas in ihr. Ihre Knie knickten ein. Dann geschah etwas Seltsames: In dem kurzen Augenblick, da sie sicher war, sterben zu müssen, überflutete eine Explosion von Wahrnehmungen ihr Bewusstsein. Es war ein furchterregendes und zugleich erlösendes Gefühl, das wohl kaum mehr als eine Sekunde andauerte. Doch die Intensität der Empfindung machte jedes Zeitmaß unerheblich. Dann übernahm irgendein Instinkt in ihr. Sie blieb ruhig stehen, suchte über die auf sie gerichtete Gewehrmündung hinweg Blickkontakt zu Xaver Leybach und sagte nur: »Xaver, warum zielst du auf mich?«
Er starrte sie an, die Augen weit aufgerissen, die Nasenflügel gebläht von schweren Atemzügen.
»Ich bin’s doch nur«, sprach sie ruhig weiter. »Die Anja. Du kennst mich noch, nicht wahr? Die Grimm Anja, Xaver. Aus München. Wir sind doch alte Freunde. Warum zielst du auf mich?«
Der Gesichtsaudruck des Mannes änderte sich nicht. Aber er senkte den Lauf ein wenig.
»Kein Wunder, dass du mich nicht gleich erkannt hast«, fuhr sie fort. »Ich bin jetzt erwachsen. Eine Frau. Aber ich kenne dich noch.«
Sie ließ auch auf diesen Satz eine längere Pause folgen, um ihm Zeit zu geben, die Information zu verarbeiten. Die Anspannung, unter der er offensichtlich stand, verminderte sich nicht. Aber die Starrheit seiner Augen milderte sich ein wenig, auch wenn er sie noch feindselig und zornig anblickte.
»Du hast dich ja auch verändert mit den Jahren.«
Keine Erwiderung. Verstand er sie überhaupt? Zweifellos besänftigte es ihn, wenn sie sprach. »Ich bin nur hier, um nach dem Waldboden zu sehen«, fuhr sie fort und deutete zaghaft in die Umgebung.
Er zuckte kurz zusammen, ließ das Gewehr jedoch hängen.
»Der Waldboden«, wiederholte sie.
Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und gab einen mürrischen Laut von sich.
»Schau«, sagte sie, ging in die Knie, hob betont langsam ihren Bohrstock auf und stellte ihn vor sich hin. »Ich nehme nur etwas Erde mit, um zu schauen …«
Weiter kam sie nicht. Plötzlich stürzte er auf sie zu, schlug ihr den Bohrstock aus der Hand, griff sie am Arm und zerrte sie ein paar Meter von der Stelle weg. Sie leistete keinen Widerstand.
Er ließ ihren Arm wieder los, trat zwei Schritte zurück und sagte plötzlich: »Niemand darf hier sein. Vater hat es verboten.«
Seine Stimme war rauh und scharrend, wie bei jemandem, der sich räuspern sollte und es nicht tat. Anja hob entschuldigend die Hände und pflichtete ihm bei. »Ja, natürlich, Xaver. Das wusste ich nicht. Und wenn dein Vater es verboten hat, müssen wir ihm natürlich gehorchen.«
Er kaute auf seiner Unterlippe. »Niemand darf hier sein«, stammelte er. »Niemand.«
»Ja, Xaver. Natürlich.«
Anja wusste nicht mehr, was sie noch sagen sollte. Sie dachte an Obermüller, der am Wagen auf sie wartete. Im Moment hatte sie das Gefühl, die Situation halbwegs entschärft zu haben. Aber wie würde Xaver reagieren, falls Obermüller jetzt auftauchen würde, um nach ihr zu suchen? Würde er sich bedroht fühlen, das Gewehr wieder hochreißen?
»Ich werde jetzt nach Hause gehen, Xaver, ja? Ich nehme meine Sachen mit und werde auch nicht mehr hierherkommen. Einverstanden?«