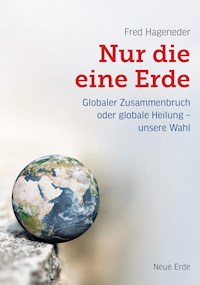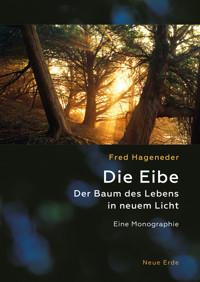
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neue Erde
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Baumart Eibe ist eines der ältesten Lebewesen auf unserer Erde. Schon botanisch ist sie aus vielen Gründen eine Besonderheit: So ist ein einzelner alter Baum imstande, sich neu zu gebären und kann so praktisch ewig leben. Kein Wunder also, dass die Eibe in allen alten Kulturen mit Wiedergeburt, Unsterblichkeit und der Transformationskraft der Natur assoziiert wurde und daher mit dem metaphysischen »Baum des Lebens«. Dieses beeindruckende Werk spannt eine solide Brücke zwischen Spiritualität und Naturwissenschaft, zwischen Urzeit und Moderne, es knüpft ein Netz zwischen Ethnologie, Religions- und Kulturgeschichte, Botanik, Dendrologie und Ökologie. Von allen Bäumen besitzt die Eibe den größten und ältesten Reichtum an Mythen und kulturgeschichtlichen Überlieferungen. In diesem Buch erfahren Sie, welche Schätze der Weisheit bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts unerkannt blieben und warum. Teil 1 – Naturgeschichte: Wissen Sie, wie die Blüten der Eibe aussehen? Oder wie außergewöhnlich langsam dieser Baum wächst? Dies ist die erste umfassende Darstellung einer wirklich einzigartigen Baumart. Klima und Boden, Blätter, Blüten, Wurzeln und Holz werden genauso tiefgehend behandelt wie die Bewohner der Eibe: Säugetiere, Vögel, Insekten und andere Wirbellose. Hier wird die reale Eibe beschrieben, wie sie schon lebte, bevor der Mensch überhaupt auf der Erde erschien – denn Eiben gibt es seit dem Jura, der Zeit der Dinosaurier! Teil 2 – Kulturgeschichte: Die kulturelle Bedeutung der Eibe begann bereits in der Altsteinzeit, da ihr Holz sich ausgezeichnet für Jagdwaffen – Speere und Bögen – eignet. Im Laufe der Geschichte kamen Musikinstrumente, Haushaltsgegenstände und der medizinische Gebrauch hinzu. Ihre größte Bedeutung jedoch hatte die Eibe seit jeher und überall im religiösen Bereich. Vornehmlich ihre biologischen Fähigkeiten der Regeneration machten sie zum Symbol der Wiedergeburt – und auch zum Hüter der Schwelle zwischen Leben und Tod. Der tiefe Blick in die Religionsgeschichte der Eibe bringt wesentliche neue Impulse für die ethnobotanischen und mythologischen Forschungen zum Thema »Baum des Lebens« oder »Weltenbaum«, die seit den 1950er Jahren stagnierten. Warum erscheinen Eibenzweige auf den ältesten Tongefäßen der Menschheit? Warum wollte der Evolutionsforscher Charles Darwin unter einer alten Eibe beerdigt werden? Was faszinierte T. S. Eliot, Lewis Carroll und Felix Mendelssohn-Bartholdy so an diesem Baum? Ist die Eibe ein Katalysator für kulturelle Ereignisse? Jedenfalls taucht sie unverhältnismäßig oft an Schnitt- und Wendepunkten der Kulturgeschichte auf. So ist dieser Titel weit mehr als »nur« ein Baumbuch. Kaum ein Aspekt der menschlichen Existenz bleibt unberührt von der uralten engen Beziehung von Mensch und Eibe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 795
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Fred Hageneder
Die Eibe
Bis auf die roten Samenmäntel ist alles an der Eibe für Menschen giftig; keine der in diesem Buch beschriebenen medizinischen Anwendungen sollte in Selbstexperimenten probiert werden. Falls Sie die ungiftigen roten Arillen sammeln oder essen wollen, stellen Sie bitte sicher, dass ggf. zuschauende Menschen, insbesondere Kinder, über die darin befindlichen giftigen Samenkerne aufgeklärt werden. (Siehe Kapitel 12.)
Fred Hageneder
Die Eibe
Der Baum des Lebens in neuem Licht
Eine Monographie
Bücher haben feste Preise.
1. Auflage der aktualisierten Neuausgabe von »Die Eibe in neuem Licht« von 2007
Fred Hageneder
Die Eibe
© Fred Hageneder/Neue Erde GmbH 2024
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlag:
Foto: Edward Parker
Rückseite: Christopher Cornwell
Gestaltung: Dragon Design, GB
eISBN 978-3-89060-492-3
ISBN 978-3-89060-872-3
Neue Erde GmbH
Cecilienstr. 29 · 66111 Saarbrücken
Deutschland · Planet Erde
www.neue-erde.de
Gedenke einer Aussage Homers, und würdige sie:
»Ein guter Botschafter«, sagte er, »erhöht
Die Ehre einer Nachricht.«
Sogar die Würde der Musen
Vergrößert sich, wenn gut über sie berichtet wird.
Pindar, Pythian Ode, IV, XIII
Wer nicht von dreitausend Jahren
sich weiß Rechenschaft zu geben,
bleib im Dunkeln unerfahren,
mag von Tag zu Tage leben.
Johann Wolfgang von Goethe, West-östlicher Diwan
Weibliche uralte Eibe in Tandridge, Surrey, Umfang 1.077 cm knapp über dem Wurzelansatz (1999).
Vorwort zur Neuausgabe
Vor genau zwanzig Jahren trafen sich fünf britische Naturschützer in einem kleinen Dorf in Südwales (das ausgerechnet Derwydd, »Druide«, heißt), um über Schutzmaßnahmen für Eiben auf den Britischen Inseln nachzudenken. Wir alle waren – auf unseren jeweils ganz unterschiedlichen Baumforschungswegen – auf die Besonderheit dieser Baumart gestoßen und auch darauf, wie völlig unzureichend die Gesetzgebung zum Schutz alter Bäume ist.
Wir befanden schnell, dass das Hauptproblem generelle Unwissenheit war, sowohl bei Gesetzgebern als auch der Öffentlichkeit. So beschlossen wir, eine freie, völlig unabhängige Vereinigung zu gründen, die Ancient Yew Group (AYG), »Uralte Eiben Gruppe«, um koordiniert Information, echtes Wissen über die älteste und bemerkenswerteste Baumart, die es in Europa gibt, zu verbreiten. Dies wollten wir mit drei Werkzeugen tun – einem Buch, einer Website und einer umfangreichen Datenbank gedeihender als auch unnötig zerstörter Eiben. Das Buch als Wissensgrundlage musste alles botanische und kulturgeschichtliche Wissen über diese Baumart enthalten und dabei so hieb- und stichfest sein, dass es allen Eiben-Anfeindungen standhalten kann.
Dieses Buch halten Sie nun in der Hand. Die Erstausgabe (2007) wurde im deutschen Sprachraum ein Dauerbrenner und in Großbritannien, dem Land der uralten Eiben, ein schneller und voller Erfolg. Nicht nur die botanische Welt wurde auf die Eibe aufmerksam. Ich wurde zu Vorträgen an erlesenen Orten eingeladen, z.B. dem National Arboretum in Westonbirt, den Royal Botanic Gardens in Kew, dem britischen Literaturfestival in Hay-on-Wye und dem National Museum of History in Wales.
Doch unsere Arbeit hatte erst begonnen. Immer wieder wurden alte Eiben infolge uninformierter Entscheidungen gefällt oder verstümmelt. Zehn Jahre lang wandten wir uns immer wieder an Vertreter der Anglikanischen Kirche. Dann gab die Church in Wales (eine ganz eigene Organisation), plötzlich und unerwartet öffentlich bekannt, fortan alle ihre alten und uralten Eiben nach unseren hohen Standards zu schützen. Der Leiter der Immobilienverwaltung der Church in Wales hatte einen meiner Eibenvorträge gesehen und war über Nacht zum Eiben-Enthusiasten geworden. Da sich drei Viertel der uralten Eiben in Wales auf Kirchhöfen befinden, ist das sehr bedeutungsvoll.
Die vorliegende Neuausgabe erscheint nicht mehr in Farbe. Das ist zwar schade, aber nicht mehr nötig. Man kann es sich heutzutage schwer vorstellen, aber 2007 ergab eine Internetsuche nach Bildern alter Eiben weniger als zwanzig Treffer! Inzwischen hat sich das gravierend geändert und so konnten wir uns durchringen, diese Neuausgabe – immer noch sehr reich bebildert – nur in schwarzweiß zu produzieren, was sie deutlich erschwinglicher macht.
Was den Inhalt betrifft, konnte ich erstaunt und erfreut feststellen, dass der Text von 2007 fast keine Aktualisierung benötigte. Wirklich Neues in der Eibenforschung ergab sich seither nur im Bereich der Genetik und der Altersbestimmung. Mit diesen Ergänzungen bleibt dieses Buch das aktuellste und umfassendste Porträt dieser faszinierenden Baumart.
Fred Hageneder, Mai 2024
Inhalt
Zur Altersbestimmung von Eiben
Einleitung
Teil I – Natur
1 Baccata – »die Beerentragende«
2 Evolution und Klimageschichte
3 Der »Ur-Baum«
4 Klima und Höhenlage
5 Pflanzengemeinschaften
6 Die Wurzeln
7 Die Blätter
8 Die Blüten
9 Bestäubung und Befruchtung
10 Der Samen
11 Naturverjüngung
12 Ein wirksames Gift
13 Säugetiere
14 Vögel
15 Wirbellose
16 Schädlinge
17 Vitalität und Gesundheit
18 Das Holz
19 Regenerationsfähigkeit
20 Altersschätzung an Eiben
21 Grüne Denkmäler
Teil II – Kultur
22 Die Kunst des Überlebens
23 Der Langbogen
24 Die Katastrophe
25 Heilmittel
26 Für die Sinne
27 Dichtkunst
28 Sympathie
29 Heiligtümer
30 Geheimnisse der Namen
31 Der große Übergang
32 Der Baum des Lebens
33 Zeitlose Symbole
34 Geburt
35 Die Mysterien
36 Ursprünge
37 Die Bergmütter
38 Götter und Helden
39 Königtum
40 Der Tanz der Amazonen
41 Der Weltenbaum
42 Harmonien
43 Wanderungen
44 Zehn Hundert Engel
45 »Erkenne den gesunden Tag«
Anhänge
I Botanisches Glossar
II Theophrast über die Eibe
III Wichtige Vorkommen der Europäischen Eibe
IV Über Frazers
Der Goldene Zweig
Danksagung
Über den Autor
Nützliche Adressen
Bildnachweis
Anmerkungen
Bibliographie
Stichwortregister
Verzeichnis der Diagramme und Tabellen
Morgensonne im Eibenhain auf dem Hambledon Hill, einer eisenzeitlichen Hügelanlage in Dorset, England
Zur Altersbestimmung von Eiben
Aus den im Kapitel 20 dargestellten Gründen werden in diesem Buch keine individuellen Alter von Eiben genannt. Sie werden lediglich als jung, reif, alt und uralt klassifiziert.
Jung bezeichnet Bäume von geringem bis mittlerem Stammumfang, entsprechend der 2. Lebensphase (Siehe »Die Lebensphasen der Eibe« in Kapitel 19).Reif bezeichnet solche, die ihre volle Kronengröße erreicht haben und (noch) einen kompakten Stamm aufweisen (3. Lebensphase).Alt werden hohlwerdende Bäume genannt (4. Lebensphase), was in Großbritannien gewöhnlich ab ca. 4,50 m Stammumfang beginnt.Uralt bezieht sich auf Bäume mit hohlen Stämmen (5. bis 7. Lebensphase) und Alterszahlen, die in den meisten Fällen nahe dem oder im vierstelligen Bereich liegen.Einleitung
In den deutschsprachigen Ländern ist die Eibe ein seltener und unscheinbarer Baum geworden, den kaum jemand kennt. Das war nicht immer so, im Gegenteil. Ihr äußerst langsames Wachstum macht ihr Holz, zusammen mit dem des Buchsbaumes, zum härtesten und dauerhaftesten einheimischen Holz Europas, und so wurde ihr hoher praktischer Nutzwert bereits in der mittleren Steinzeit voll erkannt. Die Verarbeitung von Eibenholz zu einer Vielzahl von Gegenständen, Werkzeugen und Waffen hielt bis ins Mittelalter ungebrochen an. Dann kam es zur ökologischen Katastrophe, von der sich die Eibenbestände Europas bisher nicht wieder erholt haben.
Mit dem Verschwinden der Eibe aus dem Alltagsleben der Menschen fiel auch die einstmalige religiöse Bedeutung dieses Baumes der Vergessenheit anheim. Der Prozess ihrer Überlagerung und Verdrängung durch andere Kulturphasen, Religionen und (Baum-)Kulte hatte allerdings schon lange vorher, noch vor der Verbreitung des Christentums, eingesetzt. Mag der Großteil der alten Überlieferungen auch verloren sein, selbst die wenigen kulturgeschichtlichen Belege, die uns erhaltengeblieben sind, sind für die Eibe reicher als für jeden anderen Baum der Erde.
Meine weltweite Detektivarbeit auf den Spuren dieses Baumes zeigte schnell, dass das philosophische Konzept des Weltenbaumes (oder Baumes des Lebens) genau in jenen alten Kulturen entstanden war und über lange Zeiträume Verbreitung gefunden hatte, in deren Territorium die Eibe wächst. Die wichtigsten Eigenschaften des mythologischen Weltenbaumes – er ist immergrün, er ist älter als die anderen Pflanzen- und Tierarten, er lebt ewig, wurzelt tief und schlangengleich, ist vorwiegend ein Gebirgsbaum, trägt süße Früchte, kann sogar Axt und Feuer überleben und spendet sowohl lebensrettende Medizin als auch tödliches Gift – passen zudem genau und ausschließlich auf die Eibe, sie sind deckungsgleich. So wird hier die These vorgelegt, dass der mythische Baum des Lebens eine real existierende »Vorlage« hat. Teil II des vorliegenden Buches führt uns durch über 8000 Jahre Kulturgeschichte zu unseren eigenen Wurzeln.
Doch zuerst wird der Baum selbst vorgestellt, und das ist weit mehr als trockene Botanik. In fast jedem Themenbereich zeigt sich, was für ein ungewöhnlicher, ja, einzigartiger Baum die Eibe ist. Allem voran natürlich ihre Fähigkeiten der Regeneration und der langen Lebensdauer. Teil I führt uns durch 150 Millionen Jahre Entwicklungsgeschichte und zeigt die Vernetzung von Menschen, Tieren und Pflanzen.
Ich bin mir der enormen Bandbreite von Interessengebieten, die von der Eibe berührt werden, völlig bewusst und habe dieses Buch deswegen so angelegt, dass jedes Kapitel nahezu selbständig gelesen werden kann; Querverweise jedoch helfen den Quer-Lesern, Beziehungen herzustellen und in die Tiefe zu gehen. Die umfangreichen Anmerkungen enthalten nicht nur die Quellenangaben, sondern viele weitere Hintergrundinformationen.
Ich wünsche allen viel Freude und viele Überraschungen bei dieser Lektüre!
Fred Hageneder, Mai 2007
Teil INatur
KAPITEL 1
Baccata – »die Beerentragende«
a. Ein Nadelbaum, der statt Zapfen feuerrote »Beeren« mit süßem Fruchtfleisch trägt? Eine Baumart, die im regnerischen Edinburgh genauso gedeiht wie im heissen Istanbul, die in Kanada und Skandinavien vorkommt, aber auch in Mexiko, Nordafrika und Sumatra? Deren Höhenamplitude von Küstengebieten der Britischen Inseln und Nordamerika sowie der norddeutschen Tiefebene bis zu den Bergen Japans reicht, und noch höher im Himalaya? Was ist das für ein Baum, der in all seinen Teilen, außer dem roten »Fruchtfleisch«, äußerst giftig ist, aber dennoch stark von Wild- und Weidetieren verbissen wird? Ein Baum, der in vielen Nationen auf der Liste bedrohter Arten aber in genauso vielen Ländern nicht unter Schutz steht?
Eines ist sicher: Die Eibe hat seit jeher die Gemüter bewegt und Anlass zu den verschiedensten Fragen gegeben. Wir sind auch heute weit davon entfernt, alle Antworten geben zu können, wir finden ständig Neues über sie heraus, aber viele dieser Antworten bringen nur neue Fragen. Die Eibe fährt fort, uns in Erstaunen zu versetzen … Die Herausforderungen, die die Eibe an die Wissenschaft stellt, beginnen bereits mit ihrer Stellung im natürlichen System des Pflanzenreichs und der Abgrenzung von Arten.
1.1
Der den Eibensamen umgebende Arillus ist keine Beere.
EINE KONIFERE?
b. Schon die Stellung innerhalb der Klasse der Coniferophytina (gabel- und nadelblättrigen Nacktsamer) ist umstritten. Nach Stewart (1983) sind die Taxales (Eibenartige) eine eigenständige Ordnung neben den Coniferales (Zapfenträger). Sie umfassen die Gattungen Taxus, Austrotaxus, Pseudotaxus, Torreya und Amenotaxus.
Andererseits verbindet das Merkmal der einzelnstehenden Samenanlagen (siehe »Botanisches Glossar«) und die besondere Form des Samenmantels (Arillus) die Familie der Eibengewächse (Taxaceae) mit den Steineibengewächsen (Podocarpaceae, einer großen Familie von Koniferen hauptsächlich auf der Südhalbkugel) und den Kopfeibengewächsen (Cephalotaxaceae, einer kleinen Gruppierung von Koniferen, die sich bis auf zwei Torreya-Arten in den südlichen USA auf Ostasien beschränkt), so dass sie zusammen auch als Unterordnung Taxineae (neben der Unterordnung Pineae) in der Ordnung Pinales zusammengefasst werden können.
c. Neuere Lehrbücher1 stellen die Familiengruppe der Taxidae jedoch nicht mehr getrennt neben die Pinidae, die eigentlichen Koniferen. Auch bei den Steineiben- und den Kopfeibengewächsen kommt es zur Ausbildung eines fleischigen Samenmantels. Dieser Samenmantel entsteht aus dem Stiel der Samenanlage oder dem Blütenboden und nicht aus dem Integument (der Deckhülle, siehe Diagramm 4), womit sie jedenfalls eindeutig Nacktsamer (Gymnospermen) sind. Bei Podocarpus und Cephalotaxus ist die Blüte ursprünglich eine Samenschuppe, die in der Achsel einer Deckschuppe sitzt. Die enge Verwandtschaft von Taxus und Cephalotaxus deutet man so, dass es auch bei Taxus einst diese Verwachsung von Deck- und Samenschuppe gegeben hat, die dann im Lauf der Evolution zurückgebildet wurde. Daher stellt die neue Systematik die Eibengewächse in eine Reihe mit den anderen Familien der Koniferen (Pinidae), an denen tatsächlich Zapfen hängen.
So ist die Eibe schließlich doch zu einer Konifere geworden, nicht aufgrund von neuen Entdeckungen über den Baum selbst, sondern durch die Erweiterung des Begriffes Konifere.
1.2
Taxus
in einem botanischen Werk von 1888
EINE ODER VIELE?
d. Unter Botanikern gibt es keine Übereinstimmung darüber, ob die verschiedenen Vertreter der Gattung Taxus Arten oder Unterarten oder gar nur Varietäten von Taxus baccata L. sind, der Gemeinen oder Europäischen Eibe.2 Es spricht manches für die Auffassung einer einzigen Art. Die verschiedenen Taxus-Sippen weisen einerseits in sich nur sehr geringe Unterschiede auf, während man andererseits ein unglaubliches Spektrum an morphologischer Plastizität innerhalb von T. baccata findet. Ferner hybridisieren zwei »Arten« leicht miteinander, wenn sich ihre Verbreitungsgebiete berühren.3 Auch die Tatsache, dass aus T. baccata bisher über 70 Gartenformen4 gezüchtet wurden, belegt das große Potential und die Anpassungsfähigkeit des genetischen Materials.
1.3
Verbreitungszonen der Gattung
Taxus
weltweit
(nach Ferguson 1978, de Laubenfels 1988)
e. Dessen ungeachtet schlug Richard W. Spjut, der über Jahre weltweit Pflanzenproben für das US National Cancer Institute (NCI) gesammelt hatte,5 eine gründliche taxonomische Revision der Gattung vor. Im August 2000 präsentierte er auf der Konferenz »Botany 2000« in Portland, Oregon seine Gliederung in 24 Arten und 55 Unterarten. Seine Taxonomie beruht lediglich auf morphologischen Eigenschaften,6 ist aber hilfreich für regionale Artenschutzbemühungen.
1.4
Einer der ältesten Bäume Europas: die Eibe von Barondillo o Valhondillo in der Sierra Guadarrama westlich von Madrid
KAPITEL 2
Evolution und Klimageschichte
FOSSILE BELEGE
a. Die ältesten Koniferen (Coniferales) gehen auf das späte Karbon (vor 360–286 Mio. J.) und das Perm (vor 286–245 Mio. J.) zurück. Die Taxadeen, welche die Taxaceae einschließen, entstanden vermutlich aus zapfentragenden Pflanzen der Familie Voltziaceae in der frühen Trias (ab 248 Mio. J.). Paleotaxus rediviva, der triassische Vorläufer der Gattung Taxus, wurde in 200 Mio. Jahre alten Schichten gefunden und war weit verbreitet, bevor sich die Kontinente ausbildeten, wie wir sie heute kennen.1Marskea jurassica aus dem oberen Jura ist etwa 140 Mio. J. alt und zeigt bereits viele Merkmale der heutigen Art.2 Seit dem Känozoikum (66,4 Mio. J. bis heute) beschränkt sich die Gattung Taxus infolge der Kontinentalverschiebung auf die Nordhalbkugel. Jüngere Fossilien umfassen Taxus grandis, T. engelhardtii und T. inopinata aus dem Mittleren Oligozän vor 32 Mio. Jahren. Taxus baccata selbst erscheint im Oberen Miozän vor etwa 15 Mio. Jahren.3
2.1
Palaeotaxus rediviva
Nathorst aus Skromberga, Bjuv, Skåne, Schweden, Späte Trias
b. Verschiedene Fundstücke aus dem Lower Deltaic von Yorkshire, die zuvor als Taxus jurassica bezeichnet worden waren, wurden 1958 als Marskea jurassica bestimmt.4Marskea kombiniert verschiedene Merkmale verschiedener Gattungen der Familie der Taxaceae, aber Marskea unterscheidet sich auch von jeder anderen Gattung in wenigstens einem wichtigen Aspekt. Die mikroskopischen Unterschiede zu Taxus betreffen u. a. die Spaltöffnungen, deren mitunter gewellte Zellwände, die Einzelständigkeit der Samenanlagen in den Blattachseln und die glatten Stiele der Samenanlagen, während diese bei Taxus winzige Schuppen haben. Auf der anderen Seite aber sind die Überschneidungen beider Gattungen so groß, dass Taxus harisii (ebenfalls aus dem Jura) als eine Form von Marskea jurassicaangesehen wird.5 Diese Schwierigkeit, die Eibe in ihren Merkmalen und Eigenschaften klar zu fassen, begegnet uns in fast allen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit ihr beschäftigen.
2.2
Marskea jurassica
, aus Yorkshire, Oberes Jura
DIE EISZEITALTER
c.Taxus-Pollenkörner sind kein einfaches Studienobjekt in der Vegetationsgeschichte. Sie können in den Pollenproben aus Sedimenten wie Torfen und Seeablagerungen von unerfahrenen Bearbeitern leicht übersehen werden, da sie sehr klein sind oder mit Pollenkörnern von Pappel, Eiche, Sauergräsern (Populus, Quercus, Cyperaceae) u. a. verwechselt werden. Trotzdem verraten uns Pollennachweise inzwischen, dass die Eibe während der Warmzeiten des europäischen Eiszeitalters ein konstitutives Element des Mischwaldes war, wenn auch in unterschiedlicher Häufigkeit. Sichere, aber keinesfalls die ältesten Belege stammen aus dem Cromer-Interglazial (700.000 – 450.000 J.), doch die größte Eibendichte erschien im milden, maritimen Klima des Hoxne-(Holstein-)Interglazials (400.000–367.000 J.). Das älteste uns bekannte von Menschenhand bearbeitete Holzfundstück ist der aus dieser Zeit stammende Eibenholzspeer, der bei Clacton, Essex (Südengland), gefunden wurde. In Nordwesteuropa war die Eibe besonders mit Esche (Fraxinus) und Erle (Alnus) auf grundwassernahen Standorten, z. B. im Bereich der Flussauen, vergesellschaftet.6
d. Im Eem-Interglazial (128.000 – 115.000 J.), der Warmzeit vor der letzten Eiszeit, erreicht Taxus-Pollen beträchtliche Werte, nämlich bis zu 20 % des gesamten Baumpollenniederschlags. Für 2000–3000 Jahre wurde die Eibe zu einer wichtigen Baumart im (Kiefern-)Eichen-Hasel-Mischwald.7 Im nördlichen Alpenraum erreichen örtliche Werte sogar 65 % (Mondsee im Salzkammergut) und 80 % (östliches Oberbayern), was darauf hindeutet, dass die Eibe dort etwa zur Hälfte am Waldaufbau beteiligt war.8 Schließlich folgte jedoch ein stetiger Rückgang, da sich das Klima zur Kaltzeit hin änderte.
NACH DER EISZEIT
e. Während der letzten Kaltzeit (ca. 115.000–11.000 v.Ztr.) war die Eibe, wie die anderen Waldbaumarten auch, an die Südränder Europas gedrängt worden (Spanien, Italien, Griechenland). In Kleinasien verbrachte sie ihr glaziales Exil im Amanus- und Taurus-Gebirge (Süd-Türkei und Nordwest-Syrien), von wo sie sich nach Norden ausbreitete, als das Klima wärmer wurde. Die Überquerung der anatolischen Ebene dauerte vermutlich um die 2000 Jahre, woraufhin sie sich am Schwarzen Meer und im Kaukasus etablierte.9
f. Auch im westlichen Mittelmeerraum begann die Eibe ihren Weg nach Norden. Zwischen 7800 und 7200 v. Ztr. erschien sie in Deutschland, breitete sich die folgenden Jahrtausende hindurch stetig aus und erreichte ihr häufigstes Vorkommen in der Kiefern-Eichenmischwald-(Buchen-)Zeit der Späten Wärmezeit zwischen 3800 und 900 v.Ztr.10 In England erschien sie im Übergang vom Kiefernwald zum Laubmischwald vor etwa 7000 Jahren. Im folgenden Jahrtausend war Taxus dort weit verbreitet u. a. auf kalkhaltigem Torf, z. B. in der Somerset-Tiefebene in von Erle, Birke und Eiche dominierten Moorrandwäldern, ebenso in East Anglia, wo sich die Esche dazugesellte.
g. Aber die Erwärmung des Klimas und zunehmender menschlicher Einfluss seit der Jungsteinzeit fuhren fort, Landschaft und Vegetation zu verändern. Im östlichen Schweizer Mittelland z. B. war die Eibe schon um 4600 v. Ztr. weitgehend verschwunden.11 Nördlich der Alpen glich die Eibe ihre Gebietsverluste zum Teil dadurch aus, dass sie im Zuge des Ulmenrückgangs um 3800 v. Ztr. in trockenere Mischwälder vordrang und außerdem in Niederwäldern und anderen Gebieten extensiver Waldwirtschaft neue Lebensräume fand. So kommt es z. B. in England zu einem neuerlichen Anstieg des Pollenniederschlags um 2000 v. Ztr. Später begann jedoch ein allgemeiner Rückgang, einerseits durch klimatisch bedingte Vernässung, hauptsächlich aber durch das Wachstum menschlicher Siedlungen mitsamt Ackerbau und Weidewirtschaft. Im ostddeutschen Tiefland z. B. kulminierte der Bevölkerungsdruck und die Waldzerstörung in der Zeit von 1150 v. Ztr. bis zur Anpflanzung der Kiefernforste ab 1750.12
2.3
Hoch aufragende Monumentaleibe in Alapli, Türkei
KAPITEL 3
Der »Ur-Baum«
a.Taxus baccata L., die Europäische Eibe, wächst ursprünglich in den Wäldern West-, Süd- und Mitteleuropas, des Baltikums, des Atlasgebirges (Nordafrika), Kleinasiens und des Nordirans. Die größten erhaltenen Vorkommen jedoch befinden sich an der türkischen Mittelmeerküste und v. a. im Kaukasus, wo mehr als 130 Standorte bekannt sind.1 Die Eibe ist ein immergrüner, harzloser Baum, der extrem langsam wächst: 20–30 cm jährliches Höhenwachstum sind normal im Freistand, im Wald weniger. Eiben werden selten höher als etwa 20 m, besonders im kühlen ozeanischen Klima scheinen sie eher in die Breite zu wachsen, im Wald von Killarney (Süd-Irland) z.B. befindet sich die Baumkrone zwischen 6 und 14 m Höhe.2 Viele der monumentalen Eiben im Norden der Türkei jedoch erreichen deutlich über 20 m, und für die höchste der alten Eiben in den Mischwäldern des Kaukasus werden 32 m angegeben.
b. Die Gattung Taxus geht bis in das obere Jura (140 Mio. J.) zurück, die Art baccata ist 15 Millionen Jahre alt. Damit ist die Eibe die älteste Baumart Europas. (In Asien ist Ginkgo biloba mit 160 Mio. Jahren die älteste Baumart.) Doch es ist nicht nur das hohe erdgeschichtliche Alter, das sie auszeichnet. Die Tatsache, dass sie heute noch vorkommt, spricht für ihre erstaunliche Plastizität (Anpassungsfähigkeit). So kommt die Eibe z. B. als geradstämmiger Baum, als mehrstämmiger Baum, als Strauch und in extremen Höhenlagen sogar als Kriechstrauch vor. Das sehr hohe vegetative Reproduktionsvermögen der Eibe zeigt sich nicht nur im Austreiben von Wurzelschößlingen, in Stecklingsvermehrung, Senkerwurzeln (Äste, die den Boden berühren, schlagen Wurzeln) und Adventivknospen (»schlafenden Augen«), sondern auch in der Ausbildung senkrechter Äste (aus anderen Ästen oder einem umgestürzten Stamm), sowie der Ummantelung eines absterbenden Stammes bei der Regeneration zu einem neuen Stamm. All dies ist Ausdruck einer fast einzigartigen ökologischen Strategie (siehe Kap. 5, Kasten: Fachbegriffe aus der Ökologie), die sich ganz erheblich von fast allen anderen europäischen Waldbäumen unterscheidet. Taxus baccata hat zudem eine auffällig große klimatische und geographische Amplitude.
3.1
Eibe als Kriechgewächs in Gait Barrows, Cumbria, Nordengland
c. Die Untersuchung der Stellung der Eibe in der Umwelt sowie im Waldverband zeigt Taxus in der einzigartigen Position einer »dreifachen Grenzgängerin« (Leuthold):4 ökologisch in einer Zwischenstellung von Pionier- und Klimaxbaumart (Tab. 1), im Waldbestand als typische Nebenbaumart, die zwischen Oberschicht und Bodenbereich vermittelt, und morphologisch-physiologisch als eine plastische Zwischenform zwischen den Laubbäumen und den immergrünen Nadelhölzern (Tab. 2). So ist die Eibe stammesgeschichtlich (phylogenetisch) zwar die älteste Baumart Europas, in ihrer nach allen Seiten offenen Konstitution und ihrer unvergleichlichen Vitalität aber die jugendlichste. All diese Faktoren machen sie zu einem »Ur-Baum Europas« (Leuthold).5
Tabelle 1: Konstitutionsmerkmale der Eibe (Taxus baccata L.)
Im Vergleich mit der Waldkiefer (Pinus sylvestris L.) als typische Pionierbaumart und der Buche (Fagus sylvatica L.) als Klimaxbaumart (nach Leuthold 1998, modifiziert)3
Tabelle 2: Eigenschaften der Eibe zwischen Laub- und Nadelbäumen (nach Leuthold 1998, modifiziert)
KAPITEL 4
Klima und Höhenlage
a. Die Eibe wächst am besten in den gemäßigten Temperaturen des milden ozeanischen Klimas. Besonders günstig sind milde Winter, kühle Sommer, viel Regen und hohe Luftfeuchtigkeit, auch Nebel. Strenge Winterkälte dagegen, Spätfrost oder starke kalte und trockene Winde an ungeschützten Lagen behindern ihr Wachstum. Die ökologischen Faktoren, die ihr Verbreitungsgebiet begrenzen, sind niedrige Temperaturen im Norden, strenges Kontinentalklima (östlich von Polen, im Binnenland Nordamerikas sowie im Inneren Nordostchinas und Ostsibiriens), lange Dürren (z.B. Anatolien) und Dürre und Hitze in Nordafrika. In der Nähe dieser Extreme beschränkt sich die Eibe auf feuchte Nischen wie die Nähe von Sümpfen und Mooren, Felsspalten oder den Mittelstand in einem schützenden Wald. Im Mittelmeerraum findet sie sich meist in den größeren Höhenlagen, da es dort kühler und feuchter ist.
WASSER
b.Taxus wächst oft in den Zonen mit dem höchsten Niederschlag einer Region, z. B. im Pazifischen Regenwald Nordamerikas (Unterart brevifolia), dem Reenadinna-Regenwald in Südwestirland oder im westlichen Taurus-Gebirge der Südtürkei. Die Niederschlagsmenge ist von besonderer Bedeutung im Juli und August, wenn die Blattknospen angelegt werden, und von März bis Mai, wenn die Blattknospen anschwellen und austreiben.12 Auch das Dickenwachstum des Stammes wird durch reichen Regenfall in der Vegetationsperiode begünstigt.13
c. Bis zu einem gewissen Grad kann Taxus jedoch auch Dürre ertragen. Das ist in der schnellen Reaktionsfähigkeit der Spaltöffnungen als auch in der Holzstruktur begründet, da der geringe Durchmesser der Wasserleitungsbahnen den Wassertransport und somit auch den Wasserverlust gering hält. Außerdem investiert Taxus beständig in den Aufbau des Wurzelsystems,14 in dem Reservestoffe gespeichert werden. Wenn es zu Dürreschäden kommt, äußern sich diese darin, dass die mehr als zweijährigen Nadeln besonders im oberen Teil der Krone von der Blattbasis her gelb werden und abfallen15 und dass die Adventivtriebe (falls vorhanden) welken und absterben.
Standort
Höhe ü.d.Meer
Niederschlag
Reenadinna, Irland1
20–30 m
1.585 mm
South Downs, England2
50–200 m
800–> 1.000 mm
Paterzell, Bayern3
600–750 m
1.050 mm
Bakony-Gebirge, Ungarn4
300–510 m
795 mm
Karpathen, Ukraine5
–
650–1.080 mm
südliche Krim, Ukraine6
–
500–1.000 mm
westlicher Kaukasus7
–
400–2.500 mm
Hyrcanischer Wald, Nord-Iran8
800–1,800 m
580–1.850 mm
Amanus-Gebirge, Türkei9
100–518 m
785–1.173 mm
westlicher Taurus, Türkei10
20 m
1.288 mm
westl. Taurus, Tannen-Zedernwald11
1.000–2.200 m
1.500–2.000 mm
4.1
In der trockenen Sommerhitze von La Tejeda de Carazo, Burgos, Spanien
4.2
Im kurzen maritimen Winter in Südengland
4.3
Im gemäßigten Regenwald von Reenadinna, Killarney, Irland
TEMPERATUR
d. Der Temperaturbereich der Netto-Photosynthese der Eibe ist außerordentlich groß und schließt denjenigen aller anderen europäischen Baumarten ein. Das bedeutet für die Eibe im Waldbestand, dass sie auch im Winter assimilieren kann (vergl. »Photosynthese«), wenn sie mehr Licht erhält, weil die Laubbäume der oberen Baumschicht unbelaubt sind. Durch die außerhalb der Vegetationsperiode gespeicherten Assimilate (Kohlenhydrate, v. a. Zuckerverbindungen) kann die Eibe zudem die geringeren Photosyntheseleistungen des Sommerhalbjahres ausgleichen. Das häufigere Auftreten von derart günstigen Witterungsperioden (kühl, aber nicht zu kalt) im ozeanischen Klima bedingt daher das Verbreitungs- und Wuchsoptimum der Eibe.16
e. Im allgemeinen reagiert die Eibe viel weniger empfindlich auf jährliche Klimaschwankungen als z. B. die Buche. Das liegt zum Teil daran, dass sie im Unterstand der anderen Baumarten vorkommt, wo sie den Klimabedingungen nicht direkt ausgesetzt ist. Eine geringe Empfindlichkeit gegenüber wechselnden Umweltbedingungen ergibt sich u. a. durch eine gute Anpassung an Mangelsituationen, durch Speicherfähigkeiten zur Überbrückung von Mangelperioden sowie ein geringes Ausnutzungsvermögen von Ressourcen in Überschussperioden.17
f. Sehr starken und langanhaltenden Frost sowie eisige Winde verträgt die Eibe nicht. Frostschäden wurden verschiedentlich beobachtet, z. B. im Westen Schottlands im Winter 1837/1838 oder im Süden Schwedens, wo die Nadeln ihre höchste winterliche Frostresistenz bei -33 bis -35°C zeigten und die männlichen Blütenknospen bereits zwischen –21 und -23°C geschädigt wurden. In den österreichischen Alpen stellte man fest, dass eine Temperatur von -23°C über drei Stunden sämtliche Nadeln schädigte.18 Aber die Frostresistenz ändert sich mit den Jahreszeiten, ihr Maximum liegt im Winter (Januar) und fällt dann rapide ab, so dass die Gewebe im Frühjahr empfindlicher werden.
g. Auch in verschiedenen Regionen ist die Frostresistenz unterschiedlich ausgeprägt. In Britannien treten um die Wintermitte ab -13,4°C Schäden auf, im winterfesten Südengland vom März ab -9,6°C, aber im Nordosten des Landes bereits ab -1,9°C.30 In den Fisht-Bergen im Kaukasus steigt Taxus bis 2000 m ü. d. M. und überlebt Winter, in denen 5–7 m Schnee liegen. Die Japanische Eibe (Unterart cuspidata) erträgt schweren Frost bis -40°C, bevor ihre Nadeln Schaden erleiden.31
h. Die Hitzeresistenz ändert sich dagegen im Jahreslauf nicht wesentlich. In kühlen, feuchten Sommern ist die Eibe jedoch hitzeempfindlicher als in heißen, trockenen Sommern, was darauf hindeutet, dass sich die Bäume in heißen Ländern wahrscheinlich zumindest teilweise angepasst haben. Eine Temperatur von 48–50°C für eine halbe Stunde schädigt die Nadeln. Im Sommer kann sich das auf 52°C erhöhen, im Winter liegt der Wert mit 49°C immer noch erstaunlich hoch. Die hohe Empfindlichkeit im Frühjahr (um 44°C) dagegen ist wahrscheinlich auf die sensiblen Knospen und jungen Blätter zurückzuführen.32
i. Aufgrund seiner dünnen Borke ist Taxus nicht feuerfest wie z. B. Mammutbäume (Sequoia). Wegen des Fehlens von Harzen ist die Entflammbarkeit der Eibe jedoch sehr viel geringer als bei den anderen Koniferen und lässt sich eher mit der von Laubbäumen vergleichen.33Ebenfalls hilfreich ist die Stellung der Eibe innerhalb der Vegetation: Die meisten »Waldbrände« im Mittelmeerraum sind Savannenbrände, und Eiben stehen in der Regel nicht zwischen entflammbaren Gräsern, Farnen oder Sträuchern, sondern im Mischwald, in Eibenhorsten und in höheren Lagen. Durch schattenwerfende Bäume verbleiben oft intakte Inseln in der Brandfläche, und das Feuer (selbst in Pinienpflanzungen) macht hin und wieder Halt an der Grenze zu altem Wald (z. B. in Spanien an der Rundblättrigen Eiche, Quercus rotundifolia).34 Dennoch erlagen auf Westsardinien kürzlich zwei alte Eiben einem Wiesenfeuer.
HÖHENLAGE
j.Taxus baccata wächst im Norden bis ca. 62° 30’ n. Br. (Norwegen) und im Süden bis ca. 33° n. Br. (Algerien), wobei bedingt durch die Wasserversorgung die Meereshöhe der Eibenbestände von Nord nach Süd zunimmt.35
k. In Gebirgslagen neigt die Eibe dazu, auf den nordwestlichen bis nordöstlichen Hängen zu wachsen, und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen: In südlichen Ländern (z. B. der Türkei) meidet sie die volle Sonneneinstrahlung und trockene Hitze der Südlagen.36 An den Grenzen zum nördlicheren, kontinentalen Klima (z. B. in den Alpengebieten) erwärmt die tiefstehende Frühjahrssonne die Südhänge, was die Eibe zu früher Öffnung der Knospen verleiten würde, die dann anfällig für die häufigen Spätfröste wären.37 Ganz im Gegensatz dazu stehen die Eibenhaine der englischen South Downs (90–250 m ü.d.M.) in südlicher, östlicher und (etwas seltener) westlicher Exposition, wo sie den Wärmemangel der Nordhänge und die häufigen Westwinde meiden. Ein anderer wachstumshemmender Faktor in niedrigen Küstengebieten (oder an Meeresklippen wie beim Great Orme, Wales) sind die salzhaltigen Winde von der See. Taxus reagiert sensibel auf salzige Gischt, die die Blätter rötlich-braun färbt.38
Tabelle 5: Höhenlage der Eibenbestände im Nord-Süd-Gefälle39
(in Metern über dem Meerespiegel)
0–ca. 470
Britische Inseln
660–1.200
Slowakei
1.100–1.400
in den Alpen
1.400–1.650
in den Pyrenäen
bis 1.660
in den Karpathen
1.600–1.950
Südspanien
bis 1.700
Sardinien
bis 1.800
Mazedonien
bis 2.000
Zentralgriechenland
0–2.000
Kaukasus
bis 2.500
Nordwestafrika
bis 3.333
Guatemala
2.800–3.570
Yünnan (China)
KAPITEL 5
PFLANZENGEMEINSCHAFTEN
5.1
Junge Buchen und Eiben auf den Dolomitfelsen im Wald bei Schloss Prunn, Kelheim, Niederbayern
MISCHWÄLDER
a. Die Europäische Eibe erscheint in der Regel als verstreute Einzelexemplare oder in Gruppen oder Horsten, und zwar gewöhnlich im Unter- oder Mittelstand; selten erreicht sie die obere Baumschicht. Der Waldtyp ist vielfach Eichenmischwald, Rotbuchenwald oder Rotbuchen-Nadelbaum-Mischwald. Wichtige Begleitbaumarten sind Esche (Fraxinus), Bergahorn (A. pseudoplatanus), Tanne (Abies), Fichte (Picea), Weißbuche (Carpinus), Linde (Tilia) und Ulme (Ulmus). In den Mittelmeerländern sind es außerdem Steineiche (Qu. ilex), weitere Eichenarten und Platane (Platanus), in der unteren Baumschicht Myrte (Myrtus), Lorbeer (Laurus nobilis, Prunus laurocerasus), Seidelbast (Daphne) u. a. Die häufigsten Begleiter der Eibe im Mittelstand sind Stechpalme (Ilex), Buchsbaum (Buxus), Haselnuss (Corylus) und Weißdorn (Crataegus), gelegentlich auch Mehlbeere (Sorbus aria), Schlehe (Prunus spinosa) und Holunder (Sambucus nigra).1
b. Oft wird die Rotbuche als großer und erfolgreicher Konkurrent der Eibe beschrieben, aber das ist Interpretationssache. In der Vegetationsgeschichte zeigen Pollendiagramme für verschiedene Gebiete tatsächlich Eibenrückgänge, die parallel mit einer Buchenausbreitung verlaufen, weswegen lange geglaubt wurde, dass sich die Eibe leicht durch die »konkurrenzstarke« Buche vertreiben ließe. Inzwischen wissen wir, dass die Eibe in verschiedenen Regionen sehr wohl in der Lage war, sich mit den noch heute dominierenden Baumarten zu behaupten.2 Es ist festzustellen, dass die Buchenausbreitung in vielen Gegenden Mitteleuropas in die Periode der Besiedlung durch vorgeschichtliche Ackerbauern fällt. Somit kann auch eine für die Eibe nachteilige Beeinflussung der Waldstruktur durch den Menschen angenommen werden, die zeitlich mit der Buchenausbreitung zusammenfällt.3 Dazu kommt eine bereits für die vorgeschichtliche Zeit belegte Wertschätzung des Eibenholzes, die mittelfristig in einigen Gebieten zu regionaler Übernutzung geführt haben dürfte. Und schließlich hat sich gezeigt, dass die Eibe auch heute noch nahezu im gesamten Bereich ihrer physiologischen Amplitude natürliche Vorkommen hat.4
c. Die Etablierung von Waldbaumarten ist eine Angelegenheit von Jahrhunderten (und nicht des »Kampfes« zwischen einzelnen Bäumen). Im allgemeinen ist an solchen Standorten eine Art dominant, für die sie besser als andere ausgestattet ist. Die Buche überwiegt auf tiefgründigen Böden, während die Eibe sich auf Böden ausbreitet, die zu nass oder zu arm für die Buche sind oder zu ungeschützt vor Licht und Wind. Wo Klima und Boden sehr günstig sind, wie z.B. in Paterzell, wachsen Eiben auch gut unter großen Buchen.
d.Taxus ist in Europa eine Klimaxwald-Baumart, »Klimax« (Leiter) ist der ökologische Begriff für das Endstadium einer Sukzessionsfolge von Pflanzengesellschaften unter den örtlichen Umweltbedingungen im Laufe der Zeit. Die Artenzusammensetzung einer Klimaxgesellschaft bleibt relativ gleich, da sich alle anwesenden Arten erfolgreich verjüngen und außenstehende Arten es nicht schaffen, einzudringen. Aufgrund langfristiger Standortveränderungen (z. B. Klima, Boden) und hinzutretender Arten kann sich jedoch auch eine Klimaxgesellschaft verändern.
5.2
Alte Buche (links) und alte Eibe (rechts) in Wakehurst Place, Sussex
e. Innerhalb der verschiedenen Waldgesellschaften ist Taxus eine Art, die für ihr Überleben »auf Sicherheit setzt«. Das langsame Wachstum, die effektive Speicherung von Ressourcen, die Ausbildung von Innenwurzeln in hohlwerdenden Stämmen, die enorm hohe Regenerationsfähigkeit, die schwere Zersetzbarkeit und Giftigkeit der Organe, die geringe Photosyntheseleistung der Eibe sowie die besonders schnelle Reaktionsfähigkeit ihrer Spaltöffnungen stellen allesamt Sicherungsmechanismen dar. So wurde ihre ökologische Strategie mit »Sparen für die Sicherheit« umschrieben (Larcher 2001).8
Einige Fachbegriffe aus der Ökologie
Anpassungsfähigkeit und Angepasstheit
»In der Genetik«, so Dr. Pietzarka vom Forstbotanischen Garten Tharandt, »wird Angepasstheit als der Zustand einer Population verstanden, unter bestimmten Umweltbedingungen dauerhaft zu überleben. Anpassungsfähigkeit ist deren Vermögen, sich durch Änderungen ihrer genetischen Struktur auf veränderte Umweltbedingungen erneut einzustellen. Strenggenommen kann daher in Bezug auf eine einzelne Pflanze nicht von Anpassungsfähigkeit gesprochen werden, da sie ihre genetische Struktur nicht ändern kann.«5 Er fügt hinzu, dass jedoch auch das Individuum »Möglichkeiten hat, im genetisch fixierten Rahmen auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren«.
Strategie
Der Begriff »Strategie« – auf den Menschen bezogen – setzt eine Reflektion des eigenen Handelns voraus. Das wird generell für Pflanzen nicht angenommen, jedoch ist der Begriff in der ökologischen Literatur weit verbreitet. Er kann im Sinne eines dynamischen Geschehens unter aktiver Mitwirkung des untersuchten Organismus verstanden werden. Die ökologische Strategie einer Art umfasst die Gesamtheit aller genetisch fixierten Merkmale, die Angepasstheit und Anpassungsvermögen (auf Populations- wie auf Individuenebene) sicherstellen und somit das Überleben der Art ermöglichen.6
Konkurrenz
Konkurrenz bezeichnet den Wettbewerb von Organismen oder Arten um begrenzte Ressourcen. Dabei wird gegenseitig die Geburten- und/oder Wachstumsrate verringert und/oder die Sterberate erhöht. Die Ökologie misst der Konkurrenz als Motor dynamischer Prozesse eine herausragende Bedeutung zu; die Konkurrenz um Licht war womöglich einer der stärksten Selektionsfaktoren bei der Entwicklung der Landpflanzen und der Ausbildung von aufrechten Stämmen.7
Es ist zu beachten, dass Analysen der pflanzensoziologischen Stellung und der Strategie der Eibe auf einer Beobachtung des derzeitigen Status beruhen. In Mitteleuropa kann das heutige Waldbild jedoch auf Grund der jahrtausendelangen intensiven Nutzung durch den Menschen nicht mehr als Urwald bezeichnet werden. Eine Beurteilung des ökologischen Verhaltens einer Baumart muss somit letztendlich unvollständig bleiben.
f. Die Anpassungsfähigkeit der Eibe an vielfältige und wechselnde Umweltbedingungen ist sehr hoch. Hier ist v. a. ihre Schattenverträglichkeit zu nennen: Selbst im Unterstand mit weniger als 5 % der Lichtmenge des Freilandes kann sie noch Blüten und Samen bilden.9 Die meisten Waldbaumarten reagieren bei Lichtmangel – solange sie der Konkurrenz nicht gänzlich unterliegen – mit verstärktem Höhenwachstum. Einigen Baumarten investieren sogar dann in das Höhenwachstum, wenn es auf Kosten des Durchmesser-Höhe-Verhältnisses oder der Ausbildung des Wurzelsystems geht und so zu einer Instabilität des Baumes gegenüber anderen Umweltfaktoren (wie z.B. Sturm) führt.10 Nicht so die Eibe: Auch unter schwierigen Lichtbedingungen investiert sie vornehmlich in die Ausbildung des Wurzelsystems, was ihr nicht nur eine gute Verankerung im Boden gewährt, sondern auch den Zugang zu weiteren Ressourcen.
g. Diese Anpassungsfähigkeit ist durch die hohe genetische Vielfalt der Eibe bedingt, die das Vorkommen unter unterschiedlichsten Umweltbedingungen ermöglicht.11 In Verbindung mit den erwähnten Sicherheitsinvestitionen ergibt sich auch die hohe Lebenserwartung als Beweis für den Erfolg dieser Strategie. Das extrem hohe Alter,12 das die Eibe erreichen kann, »stellt für die Population die Möglichkeit dar, sich mit großen Zeitabständen in besonders günstigen Perioden zu verjüngen. Auf der Ebene des Individuums ist es zugleich Ausdruck der guten Angepasstheit und Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umweltbedingungen während dieser langen Zeit.« (Pietzarka)13
h. Die Eibe nimmt nur sehr begrenzt am dynamischen »Konkurrenz«-Geschehen des Waldes teil. Ihre Reproduktionsrate als auch bestimmte Wachstumsraten (Durchmesserzuwachs, Biomassezuwachs, nicht jedoch der Höhenzuwachs) werden durch andere Baumarten nur in relativ geringem Maß beeinflusst. Und nur in äußerst geringem Maße schränkt sie die Reproduktions-, Wachstums- und Sterberaten anderer Arten ein.14
i.Taxus baccata ist eine Baumart, die in ihrer ökologischen Strategie vollständig von allen anderen europäischen Baumarten abweicht. Ihre Strategie beruht auf einer optimalen Angepasstheit an den jeweiligen Standort bei gleichzeitiger Erhaltung einer größtmöglichen Anpassungsfähigkeit.15 So kann die ökologische Strategie der Eibe am besten als Anpassungs-Strategie bezeichnet werden.16
Die der Eibe nachgesagte »Konkurrenzschwäche« kann also nicht bestätigt werden. Taxus erweist sich als ein perfekt auch an späte Sukzessionsstadien angepasster Waldbaum, dem es gelingt, in den meisten Waldökosystemen zu überdauern – morphologisch fast unverändert seit 140 Mio. Jahren!
j. Die verschiedenen Sicherungsmechanismen der Eibe sind die energetischen Voraussetzungen für ein langfristiges Überdauern unter suboptimalen Bedingungen, was eine Voraussetzung für die Erhaltung der Art im Unterstand ist.17 Tatsächlich sind Eibe, Stechpalme und Buchsbaum die einzigen europäischen Bäume, die ausreichend schattenverträglich sind, um unter dem dichten Kronendach der Buche zu überleben. Extremer Lichtmangel fordert zwar auch von der Eibe einen Tribut – er beschränkt die Ausbildung einer vollen Krone und limitiert die Blüten- sowie die Samenproduktion. Andererseits ist es der Schutz des Mischwaldes und der oberen Kronenschicht, der die Eibe vor Sturm, Blitzschlag, und – am wichtigsten – vor harten Frösten und anderen Temperaturextremen bewahrt. Eiben gedeihen am besten in Mischwäldern mit moderatem Licht und können dort sogar Kronen entwickeln, die fast so groß sind wie im Einzelstand.
k. Obwohl eine reife Eibe wie die Buche ein dichtes Laubdach erzeugt und damit einen tiefen Schatten, in dem nur wenige Arten gedeihen können, ist die Bodenschicht in einem Eibenmischwald nicht zwangsläufig unbelebt. Neben verschiedenen Farnen und Moosen finden sich häufig Bingelkraut (Mercurialis perennis), wilde Erdbeere (Fragaria vesca), Gundelrebe (Glechoma hederacea), Efeu, Brombeere, Brennessel18 und Veilchen (Viola). Eiben-Buchen-Mischwälder bieten außerdem dem Einblütigen Perlgras (Melica uniflora), dem Waldmeister (Galium odoratum), Blaugras (Sesleria), Veilchen (Viola, Cyclamen) und verschiedenen Orchideenarten einen Lebensraum, während Eiben-Eichen-Mischwälder u. a. die Schlüsselblume (Primula veris), die Pfirsichblättrige Glockenblume (Campanula persicifolia) und den Adlerfarn (Pteridium aquilinum) beherbergen.19
REINBESTÄNDE
l. Aufgrund der überaus großen Schattenverträglichkeit und des tiefen Schattens, den die Eibe erzeugt, kann sie sich langfristig auch über Nachbarbäume erheben (das mag fünf bis zehn Buchengenerationen dauern) und zu einer örtlich dominierenden Art werden oder sogar nach und nach einen reinen Eibenbestand ausbilden. Solche Wuchsorte sind zwar nicht sehr artenreich, aber nichtsdestoweniger sehr eindrucksvoll (z.B. Kingley Vale, Newlands Corner). Mehr als eine erfolgreiche Naturverjüngung durch Sämlinge ist es das außergewöhnlich hohe Lebensalter der Eibe, das einen solchen Bestand über lange Zeit erhält. Durch umgestürzte Altbäume freiwerdende Lücken füllen sich eher wieder durch andere Arten (Buche, Esche) als durch Eibennachwuchs. Daher vollzieht sich die Naturverjüngung der Eibe an den Rändern des Eibenwaldes, was zu der These geführt hat, dass es sich bei reinen Eibenhainen um Vorkommen einzelner Generationen handeln könnte, die sich langsam durch die Landschaft »bewegen«.20 Allerdings wird das meist durch die benachbarten Ökotope, Weideland und menschliche Siedlungen, verhindert, so dass der Eibenhain eingezäunt da bleibt, wo er ist. Wie dem auch sei, »die Umstände, unter denen sich die Eibe von einem verstreuten Bestandteil des Waldes zu einer dominanten Art entwickelt, bleiben weitgehend ungeklärt«. (British Ecological Society, 2003)21
5.3
Eine Eibe erhebt sich aus einem Weißdorn; Kingley Vale, Sussex.
FREILAND
m. Bei der Ausbreitung auf Weideflächen sind Weißdorn, manchmal Schlehe und Heckenrose, aber insbesondere der Wacholder starke »Verbündete« der Eibe.22 Der Wacholder ist der geeignetste Wegbereiter, da er bereits auf Standorten wächst, die für die Eibe günstig sind (flache Böden an steilen oder ungeschützten Stellen). Die Früchte dieser Sträucher locken zudem Vögel an, die dann dort die Eibensamen ausscheiden. Danach bietet das Wacholder- oder Weißdorngestrüpp den Eibensämlingen förderlichen Halbschatten und effektiven Schutz vor Pflanzenfressern. Mit der Zeit wächst die Eibe über den Schutzschirm ihrer Förderer hinaus und wird sich später als Baum über ihr trockenes Holz erheben.23
n. In der Regel findet sich die Eibe nicht auf nassen Lehmböden oder nassem sauren Torf. Im nördlichen Europa erscheint sie jedoch mit Eiche, Esche, Kiefer, Birke oder Erle auf kalkhaltigem Torf. Sie toleriert zwar vorübergehende Überschwemmung, meidet aber Böden mit permanenter Staunässe.
EPIPHYTEN
o. Epiphyten sind Pflanzen, die auf anderen Pflanzen wachsen, aber weder als Parasiten noch als Symbionten in deren Stoffwechsel eingreifen. Sie decken ihren Wasser- und Mineralbedarf durch den Regen und durch organisches Material, das sich auf den Gastgeberpflanzen ansammelt. Flechten, Moose und Algen sind Epiphyten der gemäßigten Zone.
p. Die glatte und in Schuppen abfallende Borke der Eibe macht diese eher unwirtlich für Epiphyten, aber auf Standorten mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit werden auch Eiben besetzt. Reenadinna Wood bei Killarney, Irland, z.B. ist berühmt für seine Fülle an Flechten und Moosen.24 Eine Studie von 1994 auf Inchlonaig, einer kleinen Insel im Loch Lomond, Schottland, zeigte, dass 60 von 791 Eiben Epiphyten beherbergten25 und 28 hatten andere Bäume, die auf ihnen wuchsen. Diese Bäume waren Birke (Betula pubescens ssp. carpatica), Eberesche (Sorbus aucuparia) und Stechpalme (Ilex aquifolium). Diese Bäume hatten ihr Wachstum in Humustaschen auf den Eiben begonnen und konnten später ihre Wurzeln durch die hohlen Eiben in den Boden wachsen lassen. Schließlich wurden die Stämme der im Boden verwurzelten Bäume vom wachsenden Stamm der Eibe ummantelt und so zu »Partnerbäumen«.26 Andere Berichte nennen Eiche,27 Esche und Rhododendron ponticum als Partnerbäume auf Eiben in Südwest-Wales.28 In Newlands Corner, Surrey, wächst eine mächtige Mehlbeere (Sorbus aria) aus einer alten Eibe.
5.4
Mit Flechten behangene Eibe; Duezce, Türkei
5.5–6
Verschiedene Epiphyten auf Eibenrinde. Links: Flechten; rechts: Moose (Bryophyta)
DER EINFLUSS DES MENSCHEN
q. Zweifellos haben die Aktivitäten des Menschen allzu oft eine negative Wirkung auf die Ausdehnung und den Reichtum der Wälder. Aber der menschliche Einfluss lässt auch neue Lebensräume für viele Arten entstehen, auch für die Eibe. Die Eibenwälder der südenglischen South Downs z. B. entstanden im 18. und 19. Jahrhundert als Folge der Napoleonischen Kriege und der nachfolgenden Armut mit dem Zusammenbruch der Schafweidewirtschaft und der Myxomatose (für Kaninchen tödliche Virusinfektion).29 Auch in der uralten Form der Niederwaldwirtschaft, in der gewisse Baumarten wie Hasel, Linde, Ulme, Hainbuche oder Esche alle 4–10 Jahre »auf den Stock gesetzt«, d.h. dicht über dem Boden abgeschnitten werden, was sie um so kräftiger wieder austreiben lässt, hatte die Eibe ihren Platz. Da sie zu langsam wächst, ließ man sie oft einfach für Jahrhunderte stehen. Doch durch das letzte Jahrtausend hindurch waren es die Kirch- und Friedhöfe, die der Eibe die langfristig sichersten und erfolgreichsten Wuchsorte boten. Hier sind besonders die Britischen Inseln zu nennen. In Asien erfüllen buddhistische und Shinto-Schreine eine ähnliche Aufgabe.
r. Auf den Britischen Inseln ist die Eibe außerdem oft in Hecken, Gärten und Parks anzutreffen. Auch auf dem europäischen Festland kann uns die Häufigkeit gepflanzter Bäume davon ablenken, dass Taxus in freier Natur noch immer eine gefährdete Art ist.
KAPITEL 6
Die Wurzeln
DER BODEN
a.Taxus wächst auf fast jedem Boden, bevorzugt jedoch tiefgründige, sickerfrische, humus- und basenreiche Böden, die mild bis mäßig sauer sind. Dabei ist Feuchtigkeit sehr wichtig und die Nähe von Quellen optimal.1 Die Eibe gedeiht aber auch auf flachen, trockenen Rendzinen auf Kalkstein, die oftmals reich an ausgewaschenem Flint aber regenwurmarm sind, und sie gedeiht auf warmen Kreideböden und kalkhaltigem Torf, ebenso auf sandigen, sumpfigen und moorigen Böden, auf Sand oder lehmigem Sand (wenn genügend Feuchtigkeit vorhanden ist), und auf kieselhaltigen Böden auf Eruptiv- oder Sedimentgesteinen. Zwei Bodeneigenschaften, die Taxus vermeidet, sind stehendes Wasser (Staunässe) und (bis auf Ausnahmen) hoher Säuregehalt.
6.1
Eibenwurzeln durchdringen eine Kalksteinwand in Kentchurch, Herefordshire.
b. Einige Beispiele aus Westeuropa mögen genügen, um die volle Bandbreite der Bodenwahl von Taxus zu verdeutlichen. Im Südwesten Irlands wächst die Eibe auf karbonischem Kalkstein,2 und einzelne Bäume stehen außerdem auf devonischem Sandstein (Killarney Woods).3 In Südostengland stockt sie auf dem Sandstein des Lower Greensand und des Central Weald sowie auf Kalk der North Downs und South Downs. Dort ist das Gestein weich und sickerfrisch, hält aber viel Wasser in einer tieferen Schicht.4 In Deutschland findet sich die Eibe meist auf Kalkhumusböden (Rendzinen), z.B. dem Jurakalk bei Kelheim, dem Muschelkalk bei Göttingen und ebenso im Thüringer Becken sowie dem Kalktuff bei Paterzell. Im Schwarzwald, im Bayerischen Wald und im schlesischen Gebirge stockt sie auf Gneis und Granit, und im Harz (Bodetal) auf Quarziten, Tonschiefer und Gneis. Hänge mit Mergel-, Löss- oder Kalkschuttböden bieten einen weiteren Lebensraum.5 Die Eiben in den Bergen Sardiniens wiederum stehen auf so unterschiedlichen Böden wie Schiefer, Granit, Kalk und Basalt.6
c. Die Eibe zeigt die größte Amplitude in der Bodenwahl, wenn sie sich deutlich innerhalb des für sie optimalen Klimas befindet, während sie sich an den Grenzen ihres klimatischen Verbreitungsgebietes mehr an die kalkigen Böden hält.7 Sie hat hohe Ansprüche an den Mineralgehalt des Bodens, insbesondere in Bezug auf Elemente wie Kalium, Phosphor und Calcium. Einer der Gründe ihres Verschwindens aus europäischen Wäldern könnte in der Bodendegradation und dem Mineralstoffrückgang liegen.8
d. Bäume passen sich nicht nur dem Standort an, sie haben auch einen verändernden Einfluss auf diesen. So ergab ein Vergleich der physikalisch-chemischen Bodeneigenschaften unter Eiben und unter Eichen, die auf dem selben Boden wachsen, dass Humussäuren unter Taxus stärker oxidiert sind, dass der Mineralgehalt geringer ist als unter Eichen und dass die Gesamtmengen von Kohlenstoff, Stickstoff und Calcium im Boden unter Eibe wesentlich höher sind als unter Eiche. Letzteres wird auf die Abwesenheit großer Regenwürmer unter Eiben zurückgeführt.9
Steilhänge
e. Da in der Kulturlandschaft Äcker, Grünland und Siedlungen den größten Teil der tiefgründigeren und gut wasserversorgten Böden in Anspruch nehmen, waren die schwierigeren Standorte, wie arme Böden, Hanglagen, Schluchten, Felsen und Steilhänge, schon immer ein wichtiger Lebensraum für Eiben.
f. Steile Klippen sind oft unzugänglich für den Menschen und sogar für äsende Tiere wie die gelenkigen Ziegen. Heutzutage beherbergen senkrechte Felswände »einige der ältesten und unberührtesten Lebensräume für Gehölze, die wir auf der Erde haben … sogar in der Nähe von Zonen intensiver landwirtschaftlicher oder industrieller Nutzung, die die meisten anderen natürlichen Lebensräume zerstört oder verändert hat«. (Doug Larson)10
6.2
Dieser Baum keimte in einer dunklen Felsspalte in 1.300 m Seehöhe; Mt Limbara, Sardinien.
g. Viele von diesen Eiben müssen mit wenig Nährstoffen auskommen und wachsen daher äußerst langsam, aber sie haben Zeit, und obwohl sie missgebildet und kleinwüchsig sind, können sie so alt oder gar älter sein als so mancher riesige Baum auf günstigem Boden.
DAS WURZELSYSTEM
h. Die Eibe hat ein weitläufiges, aber dichtes Wurzelsystem, das eine wirkungsvolle Durchdringung des Bodens ermöglicht. Es versorgt den Baum effizient mit Wasser und Mineralstoffen und verleiht ihm außerdem einen ausgezeichneten Halt auf schwierigen Böden wie Felsgestein, Steilhängen und sogar an senkrechten Felswänden. Die Ausprägung des Feinwurzelsystems ist, wie so vieles an der Eibe, sehr variabel.11
i. Bereits als Keimling beginnt die Eibe, vor allem in ihr Wurzelsystem zu investieren. Selbst bei nur geringen Lichtmengen und folglich stark eingeschränktem Wachstum hat eine Stärkung des Wurzelsystems Priorität vor dem Höhen- oder Dickenwachstum.12 Dies geschieht im Rahmen der Sicherheitsmechanismen dieser Baumart, denn wenn durch gar zu starke Beschattung die Photosyntheseleistung kein ausreichendes Wurzelwachstum mehr gewährleisten kann, stirbt die Eibe durch Austrocknung. Dieser Gefahr wirkt die Eibe einerseits durch einen englumigen Holzaufbau (enge Wasserleitungsbahnen) und andererseits durch den Aufbau des Wurzelsystems bereits bei geringen Strahlungsstärken entgegen.13
j. Tatsächlich zeigt das Wurzelsystem der Eibe die größte Vitalität unter den Bäumen, wie bio-elektrische Untersuchungen bestätigen (siehe Kap. 17). Das zeigt sich u. a. im Austrieb von Wurzelschößlingen sowie in der Möglichkeit, selbst nach komplettem Stammverlust aus dem Stumpf neu auszutreiben (siehe Abb. 20.1). Das an den Standort optimal adaptierte, intensive Wurzelsystem ist die entscheidende Grundlage für das einzigartige Regenerationsvermögen der Eibe.14Taxus-Wurzeln vermögen auch in stark verdichtete Böden vorzudringen, so dass nur bei extremer Verdichtung eine unterdurchschnittliche Durchwurzelungsintensität festgestellt werden kann. Auch unter der Erdoberfläche scheint Konkurrenz keine große Rolle zu spielen: Es lässt sich kein Einfluss der Wurzeln anderer Bäume auf die Dichte der Eibenwurzeln nachweisen, was gegen die (etablierte) Vermutung einer möglichen Beeinträchtigung der Eiben durch Wurzelkonkurrenz anderer Baumarten spricht.15
6.3
Wurzelspitze mit Wurzelhaaren. Hier wird der größte Teil des nährstoffreichen Wassers absorbiert.
6.4
Querschnitt durch die Wurzelspitze. Deutlich sichtbar das zentrale Leitbündel
Wurzelanatomie
k. Die Wurzeln aller höheren Pflanzen nehmen Wasser auf und führen es durch ein komplexes Filtersystem, das nur den benötigten Mineralstoffen Einlass gewährt, in den Zentralzylinder der Wurzel, in dem sich die aus Xylem und Phloem befindliche Leitbündel befinden. Das Xylem ist das Transportsystem, das das Wasser bis hinauf zu den Blättern bringt, wo es für die Photosynthese gebraucht wird. Der in den Blättern erzeugte nährstoffreiche Saft hingegen wird durch das Phloem abwärts transportiert, um die lebenden Gewebe in den Ästen, im Stamm und in den Wurzeln zu versorgen.
l. Während der Wachstumsphase der Eibenwurzel befinden sich die Streckungszone und die angrenzende Wurzelhaarzone nahe hinter der Wurzelspitze. Wenn die Wasseraufnahmefunktion der äußeren Wurzelhaut (Rhizodermis) beendet ist, stirbt sie ab, und durch Verkorkung der äußeren Schicht der Rinde (Cortex) entsteht eine schützende Außenschicht (Exodermis). Wenn das Wurzellängenwachstum gegen Ende der Vegetationsperiode zum Abschluss kommt, verkorkt auch die innere Schicht der Rinde, und es entsteht eine Überkappung (Metacutis), die das Wurzelinnere während der Winterruhe schützt. Ihre dicksten Lagen bedecken die empfindliche Wurzelspitze. Im Frühling, wenn das Wurzelwachstum wieder aufgenommen wird, fallen diese Zellschichten ab.
m. Die Struktur der jungen Eibenwurzel ist diarch, d. h., sie umfasst zwei Leitbündel aus Xylem und Phloem. Die Phloembündel liegen senkrecht unter denen des Xylems. Bereits dünne Wurzeln ab ca. 1 mm beginnen mit der Ausbildung von Kambiumzellen. Im Querschnitt der älteren Wurzeln gleichen die konzentrischen Lagen aus Kambium und sekundärem Xylem und Phloem der Struktur des Holzes im Stamm und den Ästen. Eibenwurzeln haben keine Harzkanäle, aber einzelne Zellen, die harzige Substanzen enthalten.16
Mykorrhizen
n. Generell leben höhere Pflanzen in Symbiose mit bestimmten Pilzen, deren Fasergeflecht (Myzel) eine bedeutende Erweiterung ihres Wurzelsystems darstellt. In dieser Verbindung zu gegenseitigem Nutzen wandelt der Pilz organische chemische Substanzen im Boden zu anorganischen Pflanzennährstoffen (Mineralstoffen) um, die die Pflanze überhaupt erst aufnehmen kann. Im Gegenzug versorgt die Pflanze den Pilz (der selbst nicht zur Photosynthese fähig ist) mit Kohlenhydraten und Aminosäuren. Die Symbiose von Baum und Pilz wird Mykorrhiza genannt; für die meisten Bäume ist sie lebenswichtig.
o. Mykorrhizen werden generell in drei strukturell unterschiedliche Gruppen eingeteilt: ektotroph, endotroph und ektendotroph. Ektomykorrhizen haben einen Pilzmantel, und das Pilzgeflecht (die Hyphen) wächst in den interzellularen Zwischenräumen der Rinde der Primärwurzeln des Baumes (z. B. bei der Kiefer). Endomykorrhizen haben keinen Pilzmantel, sie wachsen innerhalb der Zellen (z. B. bei Orchideen). Ektendomykorrhizen haben einen Pilzmantel und wachsen sowohl in als auch zwischen den Zellen (z. B. bei Kiefer, Buche, Eiche, Fichte). Bei der Eibe kennt man nur Endomykorrhizen.17Taxus verbindet sich mit einer ganzen Reihe verschiedener Pilzarten: So fand man bei einer Untersuchung von vier Bäumen im Iran sieben Arten aus den Gattungen: Glomus, Acaulospora und Gigaspora.18
KAPITEL 8
Die Blüten
a.Taxus hat sehr effektive Methoden der vegetativen Vermehrung (siehe Kap. 19), die die Lebensspanne eines einzelnen Baumes ausdehnen oder mit denen Klone erzeugt werden können (z.B. durch Senkerwurzeln). Aber so kann sich keine genetische Vielfalt erhalten, und daher kommt der geschlechtlichen Vermehrung große Bedeutung zu. Nur sie erschafft neue Individuen, die einen einzigartigen genetischen Code aufweisen. So erhöhen sich die Genotypen-Vielfalt einer Art und damit ihre langfristigen Überlebenschancen.
b.