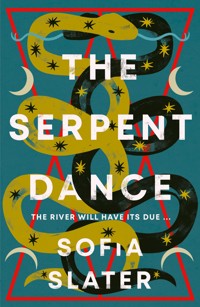5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Für Fans von Lucy Foley, »Neuschnee«, Sarah Pearse, »Das Sanatorium« oder Ruth Ware, »Das Chalet«.
Auf einer abgelegenen schottischen Insel trifft eine Gruppe von Fremden zu einer vermeintlich glamourösen Silvesterparty ein. Doch statt des erwarteten herrschaftlichen Anwesens finden sie ein verfallenes Herrenhaus vor, von Festvorbereitungen keine Spur. Unklar ist auch, wer das Fest organisiert und die Einladungen verschickt hat. Die Gäste beschleicht das ungute Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Doch das nächste Boot zum Festland kommt erst nach den Feiertagen wieder vorbei, die Handys haben keinen Empfang, und die Gruppe ist von der Welt abgeschnitten. Am nächsten Morgen wird eine von ihnen tot aufgefunden, und unter den verbliebenen Gästen macht sich die Angst breit. Zu Recht ...
»Spannungsvoll, bedrohlich, unglaublich atmosphärisch und so fesselnd, dass man nicht mehr von der Lektüre loskommt.« S.J. Watson
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Willkommen zur tödlichsten Party des Jahres …
Auf einer abgelegenen schottischen Insel trifft eine Gruppe von Fremden zu einer vermeintlich glamourösen Silvesterparty ein. Doch statt des erwarteten herrschaftlichen Anwesens finden sie ein verfallenes Herrenhaus vor, von Festvorbereitungen keine Spur. Unklar ist auch, wer das Fest organisiert und die Einladungen verschickt hat. Die Gäste beschleicht das ungute Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Doch das nächste Boot zum Festland kommt erst nach den Feiertagen wieder vorbei, die Handys haben keinen Empfang, und die Gruppe ist von der Welt abgeschnitten. Am nächsten Morgen wird eine von ihnen tot aufgefunden, und unter den verbliebenen Gästen macht sich Angst breit. Zu Recht.
Autorin
Sofia Slater wuchs im Westen Amerikas auf und lebte in Frankreich, Schottland und Oxford, bevor sie sich in London niederließ. Sie studierte Philosophie und Sprachen am Smith College und dem University College London. Neben ihrer Arbeit als Autorin übersetzt sie auch aus dem Französischen und Spanischen. »Die Einladung« ist ihr erster Roman.
SOFIA SLATER
DIE EINLADUNG
Thriller
Aus dem Englischen von Sabine Hübner
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Auld Acquaintance« by Swift Press, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2023
Copyright © der Originalausgabe
2022 by Sofia Slater
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Trevillion/ Nic Skerten; FinePic®, München
Redaktion: Susanne Bartel
AB · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30894-0V001
www.goldmann-verlag.de
Für Theo Saplund
Sollt’ alte Freundschaft denn vergessen sein,Erinn’rung uns entgleiten?Sollt’ alte Freundschaft denn vergessen sein,die lieben alten Zeiten?Auf die alten Zeiten, mein Freund,auf die alten Zeiten,lass uns den Becher der Freundschaft leerenauf die alten Zeiten.
30. Dezember
Kapitel 1
Aus dem Wagenfenster hing ein Arm. Als hätte der Fahrer während einer sommerlichen Spritztour die Scheibe heruntergekurbelt, um den Fahrtwind zu spüren. Aber der Krankenwagen kam direkt hinter meinem Taxi, als wir das Fahrzeug passierten. Ich reckte neugierig den Hals. Bereute es aber sofort. An dem zersprungenen Sicherheitsglas klebte überall Blut wie über geraspeltes Eis gegossener Sirup.
Der Anblick ging mir nicht mehr aus dem Kopf, aber schließlich gab es auch kaum eine andere Ablenkung, nachdem ich an Bord der Fähre gegangen war. Himmel und Meer reflektierten ein tristes Licht vom Farbton der grauen Schiffslackierung. Der Horizont wurde nur von den kleinen Zacken der Küstenlinie unterbrochen. Ohne das Grün des Sommers und die dramatisch hellen Sonnenstrahlen erinnerte nichts mehr an die Bilder, die mich Wochen zuvor bei der aufgeregten Suche nach Fotos der Äußeren Hebriden so begeistert hatten. Ich beobachtete einen der Fährmänner, dessen gelbe Signaljacke sich grell von der grauen Umgebung abhob. Er schrubbte mit einem Besen die Schiffsaußenwand. Vielleicht war das unbedingt nötig, um alles in Schuss zu halten, oder er langweilte sich genauso sehr wie ich. Mir war nämlich stinklangweilig.
Ich dachte immer noch an den Unfall. Das Einzige, was mir auf meiner frühmorgendlichen Fahrt vom Hotel zum Fährhafen ins Auge gestochen war, während sich die winterlichen Hügel und verstreut liegenden Häuser langsam aus der Dämmerung schälten, war der Unfallort gewesen. Ich hatte mich an den Becher mit scheußlichem Maschinenkaffee geklammert, den ich von dem verschlafenen Mädchen an der Rezeption geschnorrt hatte, und mich gefragt: Wie kann man so unglücklich in einem schmalen Straßengraben landen? Es war eine merkwürdige Stelle für so einen Unfall, und angesichts dessen und des verstörenden Gedankens, es könnte Verletzte oder gar Tote gegeben haben, schien die vor mir liegende sechsstündige Reise unter keinem guten Stern zu stehen.
Ich musste versuchen, dieses Gefühl abzuschütteln. Sechs Stunden sind eine lange Zeit, um in düsterer Stimmung auf den grauen Horizont zu starren, außerdem musste ich dieses Wochenende unbedingt genießen. Die Party sollte mein persönlicher Wendepunkt sein, der Start in ein besseres Jahr. Neues Jahr, neues Ich. Nicks Einladung im November war seit einer Ewigkeit das erste erfreuliche Ereignis gewesen. Darf ich dich in Versuchung führen?, lautete die überraschende Betreffzeile der E-Mail, überraschend auch deshalb, weil sie von einem Menschen stammte, mit dem ich monatelang nicht gesprochen hatte. Den ich vermisste.
Hi, Millie,
hab mich lange nicht gemeldet. Ich weiß, das kommt jetzt völlig unerwartet und ist vielleicht sowieso nicht dein Ding, aber … ich will mit ein paar Freunden zu dieser Silvesterfeier, und einer ist abgesprungen. Sollt’ alte Freundschaft denn vergessen sein / Erinn’rung uns entgleiten? In deinem Fall: nein! Mit niemandem würde ich lieber einen Becher der Freundschaft leeren als mit dir, also bitte komm, falls du dir die Reise zumuten willst.
Nick x
Und unter seinem Namen die Einladung: Schottenkaro in Neonfarben, ein paar Hirschsilhouetten und die Worte »Feiern wie 1899«.
Du bist ganz herzlich zu einer exklusiven Hogmanay-Feier auf der Isle of Osay in Fairweather House eingeladen. Du kümmerst dich um die Anreise, wir uns um den Rest: Whisky, Feuer, schottisch-herrschaftliche Vibes.
Als ich die Nachricht von Nick las, lief mir ein warmer Schauer über den Rücken. Ich betrachtete Bilder der Insel, die üppig mit violetter Sommerheide überzogen war, und Fotos vom Haus, einem hohen, neugotisch-viktorianischen Gebäude. Es lag offensichtlich ziemlich einsam: der Ruhesitz irgendeines alten Gutsherrn, ein winziges Fleckchen irgendwo auf den Hebriden.
Es war ein Albtraum, dorthin zu kommen. Die Überfahrt dauerte ewig, und die Fähre ging nur werktags und legte schon im Morgengrauen ab. Um den Hafen zu erreichen, musste man erst einmal durchs ganze Land fahren. Außerdem wirkte das Haus, als wäre es in seinem Innern im Winter bitterkalt. Trotzdem gab es da eigentlich nichts groß zu überlegen – mir reichte, dass Nick an mich gedacht hatte, obwohl unsere Zeit als Arbeitskollegen schon Monate zurücklag. Selbst wenn dort überhaupt nichts los sein würde, würde es bestimmt lustig werden. Auf jeden Fall war es um Welten besser als mein ursprünglicher Silvesterplan: mich mit den Überresten des Adventssüßkrams und der Weihnachtsplätzchen vollzustopfen und um zehn Uhr abends einzuschlafen. Ich hatte ihm geantwortet, ich würde mich freuen, trotz der langen Anreise.
Und jetzt war ich hier, am dreißigsten Dezember, und fröstelte beim Auf und Ab der Wellen. Ich war brutal früh aufgebrochen, mit zu wenig Koffein im Blut, das Wetter war beschissen, und außerdem hatte ich gerade einen Unfall gesehen; was alles nicht sonderlich erhebend war. Aber, so ermahnte ich mich, auch kein böses Omen. Einfach nur Pech. Ich ging auf die Toilette, tupfte mir mit einem feuchten Papierhandtuch das Gesicht ab und hielt meinem Spiegelbild eine Standpauke.
Als ich an Deck kam, legte die Fähre gerade an einer größeren Insel an, der erste von zwei Stopps auf dem Weg nach Osay. Ein paar Passagiere stiegen aus, und eine kleine Schar Männer und Frauen in dicken Jacken versammelte sich auf dem Kai, um Versorgungsgüter entgegenzunehmen. Wir waren nun schon einige Stunden unterwegs. Als ich mich umwandte, war das Festland nicht mal mehr ein Kohlestrich am Horizont.
Während wir langsam zur nächsten Insel tuckerten, zückte ich Fernglas und Notizbuch. Vielleicht sah ich auf der Reise ja ein paar Vögel. Allerdings spürte ich, als ich das Fernglas einstellte, den beißenden Seewind an den Händen und war nicht sicher, wie lange ich die Kälte aushalten würde. Doch ich wurde sofort belohnt. Eine Nonnengans flog übers Wasser Richtung Küste. Ihr elegantes schwarz-weißes Gesicht zeichnete sich zart glänzend vom grauen Himmel ab. Die Nonnengans war zwar kein seltener Vogel, doch wenn man nicht oft im Norden unterwegs war, bekam man sie nur selten zu sehen, und mich begeisterte ihr Anblick immer noch. Ich folgte ihrem Flug, gebannt von der Schönheit der gekräuselten Flügelspitzen, doch plötzlich tauchte etwas Gelbgoldenes vor dem Fernglas auf, und ich verlor den Vogel aus dem Blick.
Als ich das Glas verärgert senkte, sah ich, was es war: die lange blonde Mähne einer Frau in meinem Alter – vielleicht ein Jährchen mehr auf die dreißig zu –, die sich für ein Selfie an der Reling verrenkte. Irgendwie kam sie mir bekannt vor.
Sie zog einen Flunsch, probierte verschiedene Perspektiven aus und rief: »Ravi, Schatz, ich brauch dich hier mal!«
Ein Mann, der an der Wand zum Passagierraum lehnte – seine schwarz glänzende Haartolle wirkte genauso ätzend perfekt wie ihre lässig zerzauste Lockenmähne –, sah von seinem Handy auf und ging übers Deck zu ihr.
»Kriegst du die Insel mit aufs Bild? Das Wetter gibt absolut nichts her.«
Ich wandte mich ab und verdrehte die Augen. Allerdings nicht ganz so unbemerkt wie gedacht. Ein Typ im roten Anorak stand am Geländer gegenüber, lächelte mich schief an und wies mit einer Kopfbewegung auf das gut frisierte Paar.
Ich merkte, dass ich errötete, und entfernte mich übers Deck. Dabei hielt ich schützend das Fernglas vors Gesicht in der Hoffnung, der kalte Wind würde meine roten Wangen hinreichend erklären, falls der Mann mir nachschaute.
Ich stellte das Fernglas erneut scharf und dachte an die Worte meines Dads. »Atme einfach weiter, ganz ruhig und gleichmäßig. Wenn du nicht entspannt bist, kommen die Vögel nicht.« Er war gestorben, als ich dreizehn war, aber ich griff bis heute auf das zurück, was er mir beigebracht hatte, wenn wir gemeinsam Vögel beobachteten. Wie friedlich war das immer gewesen, wenn wir durch die Wälder oder am Meer entlangstreiften, nur er und ich, kameradschaftlich schweigend. Unsere Ferngläser pendelten uns dann vor der Brust, und manchmal streckte einer von uns die Hand aus, tippte dem andern auf die Schulter und zeigte auf etwas, das sich am Horizont bewegte.
Nach seinem Tod, als ich mit meiner Mutter lebte, war ich allein in den Wäldern unterwegs. Ich suchte den Himmel ab und tat so, als stünde mein Vater gleich hinter dem nächsten Baum. Ich hatte das Alleinsein damals gründlich satt.
Jetzt auf der Fähre sichtete ich keine interessanten Vögel mehr – nur hie und da eine Seemöwe oder eine Meerschwalbe –, und als wir vom nächsten Halt ablegten, war es schon zu dunkel, um weiterzusuchen. Eiskalt war es auch. Ich verschwand unter Deck und versuchte, meine steif gewordenen Finger warm zu reiben.
Drinnen tippten die beiden Gutfrisierten auf den Displays ihrer Handys herum, und der Mann an der Reling, der mich angelächelt hatte, lehnte mit geschlossenen Augen, die Hände in den Anoraktaschen vergraben, an der Wand. Jetzt kam der letzte Halt, nämlich Osay, also waren all diese Leute hier auch zu der Party eingeladen, und jetzt war es mir noch peinlicher als schon zuvor, beim Augenverdrehen ertappt worden zu sein. Eigentlich hätte auch Nick auf der Fähre sein müssen, fiel mir ein, aber vielleicht war er schon früher gefahren. Ich konnte mich nicht erinnern, je auch nur einen der anderen mit ihm zusammen gesehen zu haben. Die Blondine versuchte ich allerdings immer noch unterzubringen. Sie kam mir definitiv bekannt vor. Aber vielleicht war es nur ihre Aufmachung – ihre blonden Locken, die Gebetsketten aus Perlen und der Kristallanhänger erinnerten mich an meine Mutter, die ebenfalls zu einer ganz speziellen kalifornischen Ästhetik neigte, in die sie nicht hineingeboren worden war.
Obwohl ich wusste, dass wir alle dasselbe Ziel hatten, war ich zu schüchtern, um ein Gespräch zu beginnen. Und so saß ich verzagt am Ende einer Bank und pustete meine Finger warm. Auf der anderen Seite der Kabine hob jetzt der Mann im roten Anorak den Blick und schenkte mir erneut ein schiefes Lächeln.
»Hey.«
»Hi.« Ich brachte nur ein raues Flüstern zustande. Verlegen räusperte ich mich und merkte, dass ich seit meinem Gemurmel frühmorgens an der Hotelrezeption (»Ich checke aus. Kaffee?«) den ganzen Tag mit niemandem mehr gesprochen hatte. Wobei das in letzter Zeit keine Seltenheit war. Ich machte einen neuen Versuch. »Äh … hallo.«
»Schottisch-herrschaftliche Vibes?«
»War das so leicht zu erraten?«
»Ist ja kaum noch jemand an Bord. Ich bin James.«
James war ungefähr eins achtzig groß und knapp über dreißig. Er war nicht sonderlich attraktiv, gerade im Vergleich mit den beiden anderen, hatte aber ein Gesicht, das ich gerne länger angeschaut hätte. Er wirkte fröhlich und robust, so als hielte er sich oft an der frischen Luft auf, aber vielleicht kam dieser Eindruck auch nur vom Anorak.
»Millie. Freut mich, dich kennenzulernen.« Ich wollte seine ausgestreckte Hand nehmen und wurde erneut verlegen, als ich meine von der Kälte roten Finger nicht bewegen konnte.
Er nahm sie und begann, sie zwischen seinen Händen zu reiben. »Da muss man echt aufpassen. Mit Erfrierungen ist nicht zu spaßen. Du beobachtest Vögel?«
Die Berührung fühlte sich wie etwas ganz Besonderes an. Verblüfft überlegte ich, wann ich das letzte Mal jemanden berührt hatte, zog meine Hand aber nicht zurück. »Ähm … ja«, stammelte ich.
»Hab das Fernglas gesehen und gedacht, entweder Vogelbeobachterin oder Voyeurin. Aber da es für Voyeure auf dem Meer nicht viel zu sehen gibt …« Er lächelte mich an, wurde jedoch sofort wieder ernst, als er mein Gesicht sah. »Das war ein Scherz.«
»Nein, es ist nur …« Ich nickte in Richtung seiner Hände, die immer noch meine Hand umschlossen hielten.
»Oh! Sorry. Ich hätte fragen sollen.« Er ließ meine Hand los. »Ich arbeite im Krankenhaus. Da schaut man einfach hin, wo’s wehtut, und handelt. Da gibt es nicht viele Grenzen.«
»Schon okay, meine Finger sind schon wärmer.« Ich bewegte sie zum Beweis. »Dann bist du Arzt?«
»Nein, eine Nummer kleiner. Apotheker.« Er lachte gutmütig, aber auch ein bisschen gequält, so als wäre ihm diese Frage ein paarmal zu oft gestellt worden und würde ihm immer noch einen Stich versetzen. »Ich hab auch mal gerne Vögel beobachtet, genau wie du.«
Ich nahm die Vogelbeobachtung eher entspannt. Ich war noch nie seltenen Exemplaren hinterhergejagt – beobachtete einfach nur das, was in meiner Umgebung umherflog. Aber natürlich hatte ich eine Wunschliste. Und das machte mich dann wohl doch zur passionierten Vogelbeobachterin, weshalb ich ihn nicht korrigierte. »Echt?«
»So richtig fanatisch war ich nie, aber ich treibe viel Sport im Freien, und da sieht man automatisch eine Menge.«
Also war er tatsächlich viel in der Natur; ich hatte es mir nicht eingebildet. Jetzt bemerkte ich, dass seine Haut vom Wetter gezeichnet war, im positiven Sinn: Haselnussbraune Augen blitzten aus dieser tiefen Bräune, die den ganzen Winter über hält. Ich wollte ihn gerade nach seiner interessantesten Sichtung fragen, als eine andere Stimme ertönte.
»Ihr zwei wollt auch zu der Party?«, rief der Gestylte quer durch die Kabine. Er saß zurückgelehnt auf der Bank und hatte sich einen Fuß, der in einem Loafer steckte, so übers andere Knie gelegt, dass man den nackten Knöchel sah. Seine zurechtgemachte Partnerin war immer noch mit ihrem Handy beschäftigt, blickte aber kurz auf, als James antwortete.
»Genau. Ihr auch?«
»Klar. Wird bestimmt super. Aber mein Gott, die hätten einem ruhig sagen können, wie schweinekalt es hier ist.« Er zog demonstrativ die Ärmelbündchen seiner Wachsjacke nach unten.
Tja, im Dezember in Schottland sind Socken nicht verkehrt. Ich hätte nie gedacht, dass man das jemandem sagen muss.
»Ich bin Ravi, und das ist Bella.«
Die Blondine blickte von ihrem Handy auf, während wir uns vorstellten.
»Weiß von euch jemand etwas über die Besitzer von dem Haus, in dem wir untergebracht sind? Ich will gerade was posten, kenne aber die Namen nicht.«
»Sorry, ich bin nur die Begleitung.« An ihrem Blick merkte ich, dass ich ein bisschen zu glücklich geklungen hatte, aber ich konnte nicht anders, wenn ich an Nicks Nachricht dachte.
»Ich auch«, sagte James.
»Egal, ich kann ja erst mal aus persönlicher Sicht schreiben, ohne irgendjemanden zu erwähnen oder zu markieren«, meinte sie. Dann, nach kurzem Nachdenken: »Aber wir müssen das in Erfahrung bringen, sobald wir dort sind, Rav.« Sie wandte sich wieder ihrem Handy zu.
Klar. Jetzt wusste ich, wer sie war: Bella B., eine bekannte Influencerin, die ein paarmal auch in meinen Feeds aufgetaucht war. Wenn man sie persönlich erlebte, strahlte sie eine viel fokussiertere Energie aus – vermutlich hatte ich sie deshalb nicht gleich erkannt. In ihren Posts ging es ausschließlich um Beach-Frisuren und transparente Kleidung, Salbeibündel und Sunset-Yoga am Meer. Auch wenn sie eine lässig weite Pufferjacke mit Batikprint trug, fummelte sie an ihrem Handy herum wie eine gestresste Büroangestellte.
»Tu, was du nicht lassen kannst, Babe. Ich bin jedenfalls zum Feiern gekommen«, erwiderte Ravi.
Der Lautsprecher knackte, und eine barsche, kaum verständliche Ansage ertönte.
»Anscheinend ist es so weit«, sagte James.
Die Fähre stieß irgendwo an und kam zum Stillstand. Ich hielt die gewölbten Hände ans Kabinenfenster und starrte in die Nacht hinaus. Eine Lampe warf ihr gelbliches Licht auf einen Landungssteg, der sich im Dunkel verlor. Sie schwang im bestimmt eiskalten Nachtwind hin und her – es sah aus, als wäre der Steg seekrank –, und plötzlich sträubte sich etwas in mir, die Fähre zu verlassen und den Steg zu betreten; vor allem, weil ich nicht sah, wohin er führte. Doch dann entdeckte ich es – ein einzelnes erleuchtetes Fenster oberhalb der blinden Schwärze. Kein flamboyantes Leuchtfeuer, aber doch ein freundlicher Gruß des uns erwartenden Hauses. Wir waren angekommen.
Kapitel 2
Ich hatte an der Anlegestelle ein Empfangskomitee erwartet, einen Wegweiser oder wenigstens ein paar Lampen neben dem ansteigenden Pfad. Idealerweise Nick. Aber stattdessen war da nur eine einsame Funzel, deren gelbes Licht sich auf die halb verrotteten Planken ergoss. Und jetzt entfernten sich auch noch die Lichter des ablegenden Schiffs.
»Wir sehen uns am zweiten Januar!«, rief uns einer von der Besatzung zu. »Gutes Neues!« Dann wandte er sich ab, um ein Tau aufzuwickeln, und die Fähre verschwand langsam im Nebel. Jetzt gab es nur noch uns vier, den Wind und den Landungssteg.
»Ich wette, weil es hier sonst kein Licht gibt, kann man an klaren Tagen toll die Sterne beobachten«, meinte Bella. »Perfekt für ein Mondbad.«
Ein Mondbad schien mir bei diesen Temperaturen – oder eigentlich bei jeder Temperatur – zwar alles andere als verlockend, aber ich fand es gut, dass sie das Ganze so positiv sah.
»Lasst uns zum Haus raufgehen«, drängte Ravi. »Das ist hier ja so kalt wie an der verdammten Ostsee.«
Doch leider war das gar nicht so einfach. Zum einen wegen des Gepäcks: Bella und Ravi hatten je einen so riesigen Hartschalenkoffer dabei, als wollten sie auswandern. James bot galant an, einen davon bergauf zu ziehen, aber er hinkte ein bisschen und war nicht der Schnellste, was mich angesichts seiner athletischen Statur überraschte. Dauernd wurden die Kofferrollen von Gras und Steinen blockiert. Wir stolperten über Grasbüschel und kamen, obwohl wir unsere Smartphones als Taschenlampen benutzten, immer wieder vom Pfad ab. Dazu kamen der Nebel, der in dünnen Fetzen über die Küstenfelsen trieb und uns die Sicht nahm, und der unerbittlich eisige Wind. Meine Hände waren schon wieder ganz steif gefroren, und meine Ohren schmerzten. Ravi hatte recht: Es war so kalt wie an der verdammten Ostsee.
Als wir endlich das Haus erreichten, schien alles ein kleines bisschen weniger trostlos. Über der Tür hing eine Lampe, und hinter der Hausecke lagen ein paar Nebengebäude, deren Türen gleichfalls von runden Lampen beleuchtet wurden. Bis hier oben schaffte es auch der feuchtkalte Nebel kaum noch, sodass es mir schon etwas besser ging. Ich blickte zum Landungssteg hinab. Wie dunkel das Haus von dort unten gewirkt hatte, mit dem einen erleuchteten Fenster im Obergeschoss. Doch als ich zu der schaukelnden Lampe am Steg hinabsah und wieder zurück zum Haus, wurde mir klar, dass sämtliche Fenster in die dem Landungssteg abgewandte Richtung zeigten. Wie seltsam, dachte ich. Wer auch immer das Haus erbaut hat – es wäre doch eigentlich anzunehmen, dass er den Blick aufs Meer genießen wollte. Ich versuchte, mein Unbehagen abzuschütteln. Seitdem das mit meinem Job schiefgegangen war, hatte sich meine Stimmung immer mehr verschlechtert, und ich wollte mir dieses Wochenende nicht selber verderben.
»Okay, mal im Ernst, wo stecken die anderen bloß?«
Ich blickte rasch wieder zum Hauseingang, wo Ravi bestimmt schon zum dritten Mal auf die Klingel drückte.
»Wahrscheinlich sind sie schon am Feiern«, meinte James. »Ich geh mal auf der Rückseite nachschauen.«
»Super.« Ravi sank auf seinen Koffer. Bella saß bereits auf ihrem, klickte gerade auf ein Foto und probierte verschiedene Filter aus. Sie hob nicht mal den Kopf.
Ich merkte, wie Ärger in mir aufstieg. Wie hatten es die beiden nur geschafft, sich hier von wildfremden Menschen bedienen zu lassen? Da ich keine Lust hatte, ewig bei ihnen zu warten, während James nach jemandem suchte, der uns ins Haus ließ, lief ich die gewundene Steintreppe hinter ihm hinab und rief: »Warte, ich komme mit!«
»Oh, gut.« Er lächelte mich an. »Ich wollte es vorhin nicht sagen, aber ich fürchte mich im Dunkeln.«
»Keine Bange. Ich beschütze dich.«
Obwohl wir beide scherzten, war die Dunkelheit wirklich ein bisschen beängstigend. Bis auf die beleuchteten Eingänge herrschte pechschwarze Finsternis. Angesichts der hellen Türen in der dunklen Nacht fühlte ich mich an ein Bühnenbild erinnert: Lauter Öffnungen, aus denen jeden Moment jemand heraustreten konnte. Das Gras dämpfte unsere Schritte, und in der Ferne rauschte eintönig die Brandung gegen die Felsen. Kurz hörten wir Flügelschläge über unseren Köpfen – eine Eule, die in einem der Nebengebäude geschlafen hatte? Dann war die undurchdringliche Stille wieder fast mit Händen zu greifen. Ich begann, dagegen anzuplaudern.
»Und was hat dich an Silvester hierher verschlagen?«
»Na ja, könnte doch eine legendäre Party werden, oder nicht? Man hat nicht oft die Chance, es mal so stilvoll und fernab jeder Zivilisation richtig krachen zu lassen.«
»Stimmt. Keine Nachbarn, die die Polizei rufen. Apropos, hast du heute Morgen auf dem Weg zur Fähre den Unfall gesehen?«
»O Gott, ja, mit dem Paar?«
Ich hatte gar nicht bemerkt, dass zwei Personen im Wagen gesessen hatten, aber es musste sich um denselben Unfall handeln. Auf dem kurzen Stück zwischen Hotel und Hafen konnte wohl kaum noch jemand verunglückt sein.
James ging weiter und wies mit einer Kopfbewegung hinter sich zur Eingangstür, wo Ravi und Bella warteten: »Fast schade, dass es nicht die beiden erwischt hat, wie?«
Ich schnaubte zustimmend, obwohl ich seine Bemerkung ziemlich heftig fand. Klar hatten mich die zwei schon genervt, bevor sie den Mund aufmachten, und ich fühlte mich wirklich nicht zu ihrer Verteidigung berufen, was jedoch nicht hieß, dass ich ihnen den Tod wünschte. Aber wenn sie vielleicht für den Rest des Aufenthalts mit einer Lebensmittelvergiftung flachliegen würden …
»Triffst du hier jemanden?«, fragte ich.
»Äh … ja, ich hab eine Einladung von … Aha! Endlich.«
Nachdem wir schon fast das ganze Gebäude umrundet hatten, sahen wir im Erdgeschoss ein erleuchtetes Fenster und darin den Kopf einer alten Frau. Das warme Licht der Lampe verlieh ihrem feinen weißen Haar einen silbernen Schimmer. Ihr Gesichtsausdruck war hart und verkniffen, der Mund ein roter Strich. Sie presste die Lippen zusammen, während sie sich unaufhörlich vor und zurück bewegte, vor und zurück. Ich sah nicht, was sie tat, aber hier draußen im Dunkeln, wo letzte Nebelfetzen immer noch ihre kalten Finger auf meine Schultern legten, kam mir plötzlich das Schlimmste in den Sinn. Dieser brutale rote Mund und die energischen Bewegungen – es schien fast, als ob sie etwas zersägte.
Wir näherten uns dem Fenster, aber die Frau blickte erst auf, als James an die Scheibe klopfte. Dann stieß sie einen Schrei aus.
Ich keuchte und fuhr panisch herum, weil ich dachte, etwas käme aus dem Dunkel auf uns zu. Aber kurz darauf wurde mir klar: Wir hatten sie erschreckt.
Natürlich, dachte ich. Das muss die Küche sein, und sie kümmert sich um das Abendessen. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie es von drinnen wirkte, wenn plötzlich zwei Gesichter aus dem Nichts an der Scheibe auftauchten, während man Geschirr spülte. Als ich wieder zum Fenster blickte, presste sich die Frau eine Hand auf die Brust und schien schwer zu atmen, was ich durch die Glasscheibe aber nicht hören konnte. In dem Lichtschein, der durch das Fenster fiel, sah ich jetzt, wie James entschuldigend gestikulierte und Richtung Haupteingang deutete.
»Kommen Sie nach vorn«, formten ihre Lippen, und sie setzte sich in Bewegung.
Wir taten es ihr gleich und brachen, kaum waren wir außer Sicht, in Gelächter aus.
»Arme alte Omi.«
»Hat fast einen Herzinfarkt gekriegt.«
Genau dies sagte die Frau auch vorwurfsvoll zu Ravi, als wir um die Ecke bogen. Ihr ängstlicher, anklagender Tonfall passte nicht zu dem Messergriff, der aus ihrer Schürzentasche ragte. Vielleicht hatte sie das Messer eingesteckt, um sich notfalls verteidigen zu können.
»Ich verstehe nicht ganz«, entgegnete Ravi.
»Tut mir wahnsinnig leid, ich wollte Sie nicht erschrecken!«, rief James, während er die Treppe hinaufstieg.
»Sie hätten klingeln können!«
»So zum Beispiel?«, sagte Bella, drückte mit ihrem manikürten Finger auf den Klingelknopf und wartete demonstrativ, bis drinnen der lange Ton verhallte.
»Tja«, die Frau rümpfte die Nase, »muss ich wohl überhört haben.« Aber sie trat ein Stück zur Seite und ließ uns vorbei.
In der großen Eingangshalle starrte sie uns an, immer noch etwas feindselig, und wir starrten zurück. Aus der Nähe betrachtet bildete ihr Mund keine so harte Linie, wie ich ursprünglich gedacht hatte. Die Lippen waren sanft geschwungen und altersbedingt leicht eingestülpt – die Frau mochte um die siebzig sein. Doch ihr Lippenstift wirkte dramatisch – knallrot, nachlässig aufgetragen. Dazu leuchtend blauer Lidschatten. Der gleiche Mix aus Schlampigkeit und Dramatik spiegelte sich in ihrer Kleidung unter der fleckigen Schürze wider: ein stellenweise abgewetztes fuchsiarotes Samtkleid, unter dem der Unterrock hervorblitzte.
Auch die Eingangshalle selbst hatte schon bessere Zeiten gesehen. Ich hatte sie mir oft vorgestellt, wenn ich an das Wiedersehen mit Nick dachte und mir ausmalte, was ich sagen würde, wie wir miteinander tanzen und vielleicht ein bisschen mehr tun würden. In meiner Fantasie waren die Räumlichkeiten dann immer glanzvoll und festlich gewesen: Kronleuchter, Kellner mit Tabletts voller Champagnergläser, Frauen in paillettenbesetzten Kleidern, Musik, Konfetti. Aber das hier …? Nein, wirklich nicht.
Die Halle war tatsächlich von beeindruckender Größe, aber ansonsten entsprach sie in nichts meiner Vorstellung. Der Raum war so hoch, dass er sich im Dunkeln verlor, und die kalten Bodenfliesen, die im Rautenmuster verlegt waren und dringend einmal hätten geschrubbt werden müssen, erstreckten sich gleichfalls bis in düstere Ecken. Eine geschwungene Treppe, das hölzerne Pendant zur Steintreppe draußen, führte ins obere Stockwerk. Den Treppenabsatz säumten Porträts vornehmer Herren in Kilts. In einem riesigen Kamin flackerte ein so winziges Feuer, dass die verschnörkelten Ornamente des geschnitzten Kaminsimses kaum zu erkennen waren.
Als ich den Blick erneut nach oben wandte, entdeckte ich tatsächlich einen Kronleuchter, doch keineswegs den gleißenden Kristalllüster meiner Tagträume. Nur ein paar gelblich flackernde Birnchen warfen ihr trübes Licht auf Spinnweben, die sich zwischen ineinander verschränkten Hörnern gebildet hatten: Der Leuchter bestand aus uralten schrundigen, fleckigen Hirschgeweihen.
Und Nick ließ sich auch nicht blicken. Tatsächlich war außer uns niemand da. In diesem riesigen düsteren Gebäude voller Spinnweben schienen sich nur diese alte Frau und wir vier von der Fähre aufzuhalten. Doch dann rief ich mir in Erinnerung, dass wir ja erst den dreißigsten Dezember hatten. Ich war früher angereist. Bestimmt war dann morgen, am Tag der Silvesterparty, alles wie verwandelt.
Die Frau hatte sich etwas von ihrem Schrecken erholt und stellte sich vor. »Ich bin Marjorie Flyte, die Besitzerin von Fairweather House. Sie sind wohl alle wegen der Festivitäten hier?«
»Wenn man es so nennen will«, flüsterte Ravi Bella ins Ohr, die Mrs Flyte affektiert anlächelte.
»Wir erwarten noch mehr Gäste. Sind Sie als Einzige mit der Fähre gekommen?«, fragte sie, wieder in dem etwas mürrischen Ton wie zuvor an der Haustür. »Na ja, vielleicht mieten die anderen ein Boot und kommen morgen früh rüber. Das machen manche so.«
Ich war erleichtert, dass wir nicht die einzigen Gäste waren. So, nur zu fünft, hätte man die Party glatt vergessen können. Aber ein bisschen enttäuscht war ich auch – ich hatte so gehofft, Nick schon heute zu treffen. Wobei ein gemeinsamer Klippenspaziergang morgen am frühen Nachmittag auch nicht zu verachten wäre.
»Normalerweise würde ich Ihnen jetzt gleich Ihre Zimmer zeigen, aber die Fähre hatte ein wenig Verspätung, und ich kümmere mich gerade um das Abendessen. Wäre es sehr schlimm, wenn Sie noch etwas in der Bibliothek warten würden? Lassen Sie Ihr Gepäck einfach hier stehen, das tragen wir später nach oben.« Sie wies auf eine Tür auf einer Seite der Eingangshalle. »Die anderen, die schon hier sind, sind bereits dort. Ich rufe Sie dann zum Essen.«
Die anderen! Mir wurde flau im Magen. Vielleicht war Nick also doch schon da. Wir zogen die Jacken aus, stellten das Gepäck ab und betraten hintereinander die Bibliothek. Ich versuchte, ganz gelassen zu wirken.
Doch mit dem, was mich erwartete, hatte ich nicht gerechnet. Die Person, die mit einer Zeitschrift dort auf dem schäbigen Sofa mit Tartanstoff saß, war nicht etwa Nick. Mein Herz, das erwartungsvoll gepocht hatte, begann nun vor Schreck zu hämmern. Ich wich einen Schritt zurück, als wollte ich davonlaufen, obwohl ich wusste, dass das unmöglich war. Unschuldig in die Sofakissen geschmiegt und sanft vom Kaminfeuer beleuchtet, saß dort eine Person, der ich keinesfalls hatte begegnen wollen. Eine Person, die ich ein Jahr lang gemieden hatte. In der Hoffnung, sie nie wiederzusehen.
Penny Maybury.
Kapitel 3
»Na, Ihnen scheint die Überfahrt ja nicht gut bekommen zu sein.«
Die Bemerkung kam nicht von Penny. Sie starrte mich schweigend vom Sofa her an, genauso steif und ausdruckslos wie ich sie. Ich wandte mich nach dem Sprecher um, einem Schwarzen in fortgeschrittenem Alter, der am Kaminsims lehnte. Das warme Licht des Feuers flackerte über sein kurzes silbergraues Haar, den gut geschnittenen Anzug, das makellose Hemd, die helle Seidenkrawatte. Mit hochgezogener Augenbraue nahm er mich scharf ins Visier.
»Winston. Winston Harriot«, sagte er, wies erst auf seine maßgeschneiderte Erscheinung und dann mit fächerartig gespreizten Fingern erwartungsvoll auf mich. Doch bevor ich antworten konnte, verwandelte sich der interessierte Ausdruck der hochgezogenen Augenbraue in Überraschung, und er blickte Ravi an, der hinter mir den Raum betrat.
»Ravi Gopal? Ich hatte nicht damit gerechnet, Sie hier zu sehen! Eigentlich hatte ich ja mit niemandem gerechnet, aber jetzt ist doch wenigstens mal ein bekanntes Gesicht unter all den Fremden.«
Es war schwierig, in dem unsteten Feuerschein Ravis Miene zu erkennen, aber ich bildete mir ein, dass über seine attraktiven Züge ein Ausdruck des Widerwillens huschte. Dennoch ging er scheinbar erfreut mit ausgestreckten Armen auf Winston zu, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als Penny zu begrüßen.
Zum letzten Mal waren wir uns vor fast einem Jahr begegnet, aber sie wirkte unverändert. Wobei, nicht ganz. Sie war dünner geworden. Doch ihre blauen Augen, ihr sanft gelocktes rotes Haar, das Mondgesicht und der Schlabberlook waren wie immer.
»Hallo, Millie.« Sie rückte ein Stück beiseite, um mir auf dem Sofa Platz zu machen, und zog ihre Jacke enger um sich, als ich mich setzte.
»Hi.« Ich sah zu den anderen hinüber in der Hoffnung, dass sich gleich jemand zu uns gesellen und mir das Tête-à-Tête mit ihr ersparen würde, aber Ravi machte die anderen jetzt mit Winston bekannt, und es gab ein großes Hallo. »Dann hat Nick dich also auch eingeladen?«
»Nicht Nick, aber wir haben eine gemeinsame Freundin. Ich denke, sie und ihr Mann werden morgen kommen.«
»Hast du Nick … äh, in letzter Zeit gesehen?«
»Nein.«
»Aha.« Stille trat ein. Ich suchte angestrengt nach einem Gesprächsthema, aber dann war es Penny, die das Schweigen brach.
»Gut siehst du aus.«
»Findet er aber nicht.« Ich nickte in Richtung Winston Harriot. »Die kurze Nacht hat meinem Teint nicht gutgetan, und dann diese Kälte. Aber sonst ist bei mir alles okay. Na ja, einen neuen Job hab ich noch nicht gefunden, trotzdem hab ich immer was zu tun. Und du?«
»Immer was zu tun, das trifft es gut.« Sie lächelte angespannt.
Ich zermarterte mir das Hirn, aber jede höfliche Frage schien mit Bedeutung aufgeladen. Wie läuft’s so bei dir? Fatal. Wie ist es dir inzwischen ergangen? Unmöglich.
Hätte ich gewusst, dass sie hier sein würde, hätte ich mich vielleicht irgendwie vorbereitet, mir überlegt, wie sich alles wieder ins Lot bringen ließe.
Hättest du nicht, sagte eine Stimme in meinem Kopf. Du wärst einfach nicht gekommen.
Aber jetzt saßen wir beide hier. Wieso gelang es mir nicht, die alte Unbefangenheit an den Tag zu legen? Schließlich waren wir einmal Freundinnen gewesen.
»Dieses Haus ist …« Ich wies auf den Raum, wollte »schön« oder »beeindruckend« sagen, aber als ich mich umschaute, merkte ich, dass das überhaupt nicht stimmte. Der Raum, der sich seine Bezeichnung »Bibliothek« nur durch ein paar luftig bestückte verglaste Bücherschränke erworben hatte, wirkte ebenso runtergekommen wie die Eingangshalle. Die antiken Möbel waren stattlich, aber ziemlich abgenutzt. Einer Chaiselongue fehlte ein Fuß, den jemand kurzerhand durch einen Bücherstapel ersetzt hatte. Überall in dem großen Raum verstreut standen Sofas und Lehnsessel, und an den Wänden hingen Porträts längst verstorbener Gutsherren. Bis wohin sich das Zimmer ins Dunkel erstreckte, ließ sich nicht erkennen, aber hier, nahe der Tür, war es dank des Kaminfeuers und der paar matten Lämpchen doch so hell, dass ich sah, wie sich am Übergang von der Wand zur Decke die Velourstapete ablöste.
Und noch etwas anderes konnte ich im Licht des Kaminfeuers erkennen – eine große, blanke, schräg über dem Kaminsims fixierte Axt, die ziemlich scharf wirkte, was mich angesichts des Allgemeinzustands des Hauses nun doch überraschte. Vermutlich eine Prunkwaffe aus den Highlands, die zusammen mit den Porträts der Herren in Kilts in diesem Raum gelandet war. Die Axt passte sehr gut hierher, denn alles hier fühlte sich irgendwie falsch an, als wäre man von lauter Requisiten umgeben. Nur der Schmutz und der Verfall wirkten hundertprozentig authentisch.
Plötzlich ertönte draußen vor der Bibliothek ein ohrenbetäubender Lärm, der mich zusammenzucken ließ, mir aber auch ersparte, meinen Satz beenden zu müssen. Ich saß da wie erstarrt, bis unsere Gastgeberin in einem Tempo in der Tür erschien, das nicht auf einen Notfall schließen ließ. Sie schwankte ein wenig, und ich bekam wieder Gewissensbisse; sie war wohl immer noch ziemlich durch den Wind, weil James und ich sie so erschreckt hatten. Vielleicht war ihr gerade ein Tablett aus den zitternden Händen gefallen. An den Türrahmen gelehnt, verkündete sie: »Es ist angerichtet.«
Wir gingen im Gänsemarsch zurück durch die Eingangshalle – wo ich einen großen Messinggong bemerkte – und versammelten uns in dem Raum gegenüber der Bibliothek um einen langen Tisch. Für unsere kleine Gruppe war er viel zu groß. Wir saßen einen Meter auseinander, wie verfeindete Parteien, die über einen Waffenstillstand verhandeln wollen. Die Unterhaltung wirkte gestelzt, jede Bemerkung war etwas zu laut, damit sie über die Weiten des weiß gedeckten Tischs auch auf der anderen Seite zu hören war. Mrs Flyte, die an der Stirnseite Platz genommen hatte, schickte eine Terrine auf den Weg reihum.
»Was gibt’s denn Gutes?«, erkundigte sich James, während er eine tiefbraune Flüssigkeit in seinen Suppenteller schöpfte.
»Ochsenschwanzsuppe.« Mrs Flyte griff nach ihrem Weinglas.
»Sorry, aber ich bin Vegetarierin?« Bellas Satz endete als ungläubige Frage.
»Na, dann müssen Sie eben auf die Suppe verzichten«, erwiderte Mrs Flyte und betonte die letzten drei Wörter, als wollte sie unbedingt den Eindruck vermeiden, Silben zu verschleifen.
Ravi und Bella tauschten einen Blick, ebenso ich und James.
»Und auf den Hauptgang«, fügte Mrs Flyte hinzu und leerte ihr Glas.
»Mrs Flyte«, sagte Winston, »jetzt erzählen Sie doch mal, wie Sie Herrin dieses … reizenden Anwesens geworden sind.«
»Ich habe immer in London gelebt. Ich liebe den Großstadttrubel, Partys, das Nachtleben …« Sie schien sich einen Moment lang in Erinnerungen zu verlieren, doch gleich darauf räusperte sie sich und versuchte es mit einem munter-energischen Tonfall, der ihr nicht wirklich gelang, weil sie schon zu viel intus hatte. »Aber Dinge ändern sich nun mal, und als ich die Chance bekam, dieses Haus billig zu übernehmen, dachte ich: Tolle Lage, da lässt sich was draus machen. Seitdem führe ich es als Bed and Breakfast.« Sie schenkte sich nach und hob ihr Glas. »Prost allerseits!«
»O Gott«, murmelte James und beugte sich zu mir, damit er nicht so laut sprechen musste. »Die ist ja sturzbesoffen.«
Ich prustete unwillkürlich los und erntete vom anderen Ende des Tischs einen fragenden Blick.