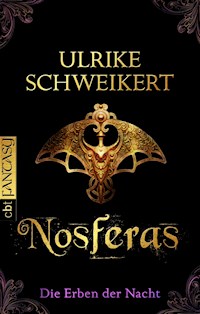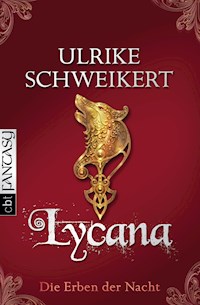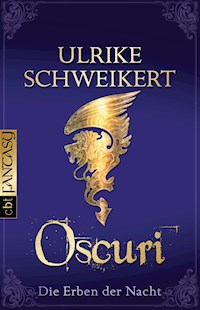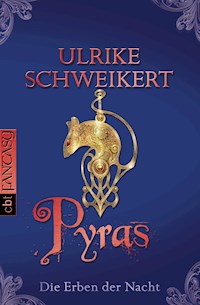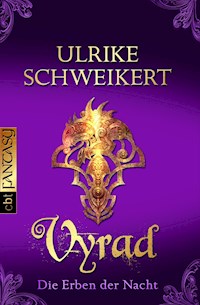
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Erben der Nacht
- Sprache: Deutsch
Historische Vampir-Fantasy von der Meisterin des Genres: actionreich, romantisch und herrlich düster
Schreckliche Kerker und schlimme Verbrechen – der fünfte Band führt die Akademie ins London zur Zeit Jack the Rippers. Vom Clan der Vyrad sollen die jungen Vampire lernen, wie man das Tageslicht erträgt und sich in Nebel auföst. Ivy sieht eine schreckliche Gefahr heraufziehen, die alle Clans bedroht. Doch sie kann ihre dunkle Ahnung mit niemandem teilen, denn nach wie vor ist sie aus der Akademie ausgeschlossen, seit entdeckt wurde, dass sie eine Unreine ist. Zudem wagt sie nicht einmal ihren Bruder Seymour einzuweihen, auf welche Weise sie ihr Wissen um diese Bedrohung erlangt hat …
"Die Erben der Nacht" ist schaurig-romantisches und zugleich actionreiches Drama um Intrigen, Liebe und Verrat voll wunderbar düsterer Schauplätze. Mireißender Schmökerstoff für alle Fans von Vampiren und dunkler Fantasy.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 880
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Ulrike Schweikert
Vyrad
Die Erben der Nacht
cbt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die zitierten Gedichte von Lord Byron, »Als wir zwei schieden« und »Newstead Abbey«, sind folgender Ausgabe entnommen: Siegfried Schmitz (Hrsg.), »George Gordon Byron: Sämtliche Werke. In den Übertragungen von Otto Gildemeister und Alexander Neidhardt, überarbeitet ergänzt und mit Anmerkungen herausgegeben von Siegfried Schmitz.« 3 Bde. Winkler Verlag München 1977–1978.
Die zitierte Passage aus Bram Stokers »Dracula« in der Übersetzung von Wulf H. Bergner ist der Heyne-Taschenbuch-Ausgabe aus dem Jahr 2001 entnommen
Originalausgabe Oktober 2011
© 2011 cbt/cbj-Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung einer Illustration von Paolo Barbieri
KK · Herstellung: AnG
Satz: Buch-Werkstatt, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-07704-4 V003
www.cbt-jugendbuch.de
Für meinen geliebten Mann Peter Speemann.
Und für Chakira, meine Freude und meine Inspiration jeden Tag.
Seymour
Geräuschlos schlüpfte der Wolf durch die halb geöffnete Tür und trat in die dämmrige Hütte. Das weit heruntergezogene, von Moos bedeckte Dach ließ das kleine Haus nahezu mit dem bleichen Grün des spätsommerlichen Moores verschmelzen. Das letzte Tageslicht drang durch den Türspalt und das winzige Fenster, dennoch war es in dem einzigen Raum der Hütte so dunkel, dass menschliche Augen wohl kaum die Konturen der wenigen Möbelstücke hätten ausmachen können. Der Wolf jedoch erfasste das Innere der ärmlichen Behausung mit einem Blick: Das niedrige, hölzerne Bettgestell in der rechten Ecke, über das eine Flickendecke gebreitet war, die Weidenkörbe an der hinteren Wand, aus denen der Duft von noch feuchten Torfstücken und allerlei Kräutern emporstieg, den massiven Tisch mit den vier Stühlen in der Mitte und dann auf der linken Seite den offenen Herd, neben dem sich Kessel und Töpfe reihten. Schimmernde Lichtpunkte huschten wie Glühwürmchen über das polierte Kupfer. Sein Blick verharrte auf der Gestalt, die– ihm den Rücken zugewandt– vor dem fast erloschenen Torffeuer saß. Sie rührte sich nicht, als er lautlos näher trat.
»Nun, was gibt es, mein Sohn?«
Nein, es wunderte Seymour nicht, dass es ihm nicht gelang, Tara zu überraschen. Vermutlich hatte sie seinen Weg in ihrem Geist begleitet, seit er den Kamm überquert und den Bergrücken ins Moor hinabgestiegen war.
»Aber sicher«, beantwortete sie seinen Gedanken. »Ist das nicht ganz natürlich? Beobachtet nicht jede Mutter den Weg ihrer Kinder in Stolz und Sorge?«
Der Wolf brummte in einer Mischung aus Unmut und Belustigung, antwortete aber nicht. Stattdessen begann sein Wolfskörper sich unnatürlich zu winden. Er zuckte am ganzen Leib, dass das silbrigweiße Fell bebte. Dann schien sich jedes Haar in die Haut zurückzuziehen, die Schnauze wurde flacher, der Schädel dehnte sich aus und nahm die Züge eines menschlichen Gesichts an. Als der Werwolf sich in seiner Menschengestalt erhob, wandte sich die Druidin um. Ein trauriges Lächeln umspielte ihre Lippen und ein weicher Zug trat in ihre Augen, die erstaunlich hell und wach aus dem runzeligen Gesicht einer uralten Frau blickten. Wie alt sie wirklich war, konnte keiner genau sagen, und die Druidin schwieg sich darüber aus. Seymour selbst war mehr als einhundert Jahre alt. Dabei war er kein Greis. Die Magie der Werwölfe verlangsamte das Altern seines Körpers, der vielleicht ein wenig dünn erschien, dennoch sehnig und stark. Ein Mann in seinen besten Jahren. Die Züge seines herben Gesichts waren alterslos, während das silbrige Haar von seiner langen Lebenszeit sprach.
»Setz dich, Seymour, und sage mir, was dich bedrückt.« Tara wies einladend auf einen der Stühle und machte sich daran, Torf nachzulegen und die Glut zu schüren, bis die ersten Flammen zuckten und dunkler Rauch den Abzug hinaufstieg. Sie entzündete die beiden Kerzen auf dem Tisch. Von einem Wandbord holte sie eine bauchige Flasche und zwei Tonbecher, schenkte ein und setzte sich dann zu ihrem Sohn. Seymour schnupperte ein wenig misstrauisch an dem Gebräu, das nach vergorenem Honig und Heidelbeeren roch, dann nahm er einen kleinen Schluck.
»So etwas bekommst du nicht oft zu trinken«, schmunzelte die alte Frau.
Seymour stieß einen abfälligen Laut aus.
»Das ist wahr. Das Wasser aus den Bergen ist der Wein der Wölfe. Aber ich bin nicht gekommen, um dein Gebräu zu probieren. Doch das weißt du ja bereits«, fügte er mit bitterem Ton hinzu. »Wozu soll ich die Fragen aussprechen, die du längst in meinem Geist gelesen hast?«
Ein wenig entschuldigend hob Tara die Schultern. »Das sollte dich nicht kränken. Es ist mir zur Gewohnheit geworden, den Gedanken derer zu lauschen, die mir am Herzen liegen. Ich freue mich dennoch, dass du den weiten Weg zu mir gekommen bist, um mit mir zu sprechen.«
Der Wolf schwieg. Tara wartete geduldig. Seymour kämpfte noch eine Weile gegen den Unmut, den er empfand, ehe er damit herausplatzte, was ihn seit Wochen mit Sorge erfüllte.
»Ich kann sie kaum mehr erreichen! Ich habe das Gefühl, das Band, das uns so eng verbunden hat, wird stetig dünner. Bald wird es ganz zerreißen!« Furcht und Schmerz standen in seinen bernsteinfarbenen Augen.
Tara nickte bedächtig. Sie musste ihn nicht um Erklärung bitten, um seine Worte zu verstehen.
»Ich weiß, Seymour. Das ist für euch beide keine leichte Zeit.«
»Ihr habt mich fortgeschickt«, brummte er missmutig. »Wochenlang habe ich weder sie noch dich zu Gesicht bekommen.«
»Jeder hat seine Aufgabe zu erfüllen«, sagte die Druidin sanft. »Der Friede in Irland ist brüchig. Deine Aufgabe ist es, das Band zu deinen Brüdern, den Werwölfen, zu festigen und dafür zu sorgen, dass sie den Vertrag einhalten und sich nicht wieder gegen Vampire und Druiden rüsten.«
»Der heilige Stein ist in den Tiefen des Lough Corrib versunken. Der Zankapfel ist allen Händen entrissen. Worum sollten sie noch kämpfen?«
»Die Rassen und Völker haben von jeher Gründe gefunden, sich zu bekriegen«, gab die Druidin zu bedenken, doch Seymour beachtete den Einwurf nicht.
»Meine Aufgabe ist es, meine Schwester zu begleiten und zu beschützen! Ich sollte keinen Moment von ihrer Seite weichen.«
Tara nickte. »Ja, so lauteten meine Worte. Ich kann mich durchaus erinnern. Das war deine Aufgabe in den vergangenen Jahren, als du mit Ivy nach Rom gereist bist, nach Hamburg, Paris und Wien. Doch die Zeiten ändern sich, und nicht immer verläuft der Fluss der Geschichte in dem Bett, welches ich ihm zugedacht habe.«
»Du willst doch nicht etwa sagen, dass sich die große Druidin Tara geirrt hat?«
»Dein Sarkasmus verrät deine Bitterkeit. Ja, auch ich kann die Zukunft nicht immer klar erkennen und manches Mal nehmen die Ereignisse eine überraschende Wendung.«
»Ach, du konntest nicht vorhersehen, dass Dracula Ivy entführen würde, um mit ihrem Blut eine neue, stärkere Rasse von Vampiren zu zeugen?«
»Nein, das war mein Fehler. Ich dachte, der Schutz des Connemaramarmors würde für die Zeit in Wien noch ausreichen, Dracula von ihr fernzuhalten.« Sorgenvoll runzelte die Druidin die Stirn. »Es hätte nicht so weit kommen dürfen. Wir müssen dem gnädigen Schicksal danken, dass Dracula mit seinem Plan gescheitert und Ivy unversehrt in den Schoß ihrer Heimat zurückgekehrt ist. Der cloch adhair ist für uns zwar verloren, aber es gibt mehr als die Magie des Steins, um Ivy zu schützen. Hier in Irland kann ihr nichts geschehen. Ich habe die vergangenen Wochen hart mit ihr daran gearbeitet, ihre Kräfte zu stärken und sie für jeden möglichen Angriff bereit zu machen. Deshalb haben wir uns in die Einsamkeit des Moores zurückgezogen.«
»Ihr hättet mich mitnehmen können. Ich hätte über euch gewacht.«
Die Druidin lächelte milde. »Ach Seymour, ich weiß, dass du deine Schwester über alles liebst und dass du dich daran gewöhnt hast, ihr nicht von der Seite zu weichen. Doch vielleicht brechen nun andere Zeiten an.«
Seymour ließ die Worte in sich nachklingen. »Sie wird also nicht nach London gehen, um mit den anderen jungen Vampiren die Akademie zu besuchen?«, sagte er nach einer Weile. »Trotz eurer einsamen Wochen des Lernens und des Übens und all deiner alten Magie wirst du nicht zulassen, dass sie die Insel verlässt, weil du sie dort draußen nicht beschützen kannst!«
Herausfordernd sah er die Druidin an.
»Selbst wenn ich sie aus Irland fortlassen würde, du vergisst, ihr Geheimnis wurde in Wien gelüftet. Glaubst du, die Vyrad würden eine Unreine zur Akademie laden?«
Seymour schwieg verblüfft. Daran hatte er gar nicht mehr gedacht. Über Ivys Entführung nach Transsilvanien und all seine Ängste bis zu ihrer Rettung hatte er ganz vergessen, dass Ivys Maskerade aufgeflogen war. Ja, nun wussten alle, dass die Lycana die anderen Clans getäuscht hatte, als sie Ivy als eine Erbin reinen Blutes ausgegeben hatten. Die Wogen der Entrüstung hatten sich zwar geglättet, dennoch lag Tara sicher richtig. Es war nicht zu erwarten, dass Ivy zur Akademie geladen würde. In diesem Herbst würde Mervyn der einzige Lycana sein, der nach London reiste, um mit den Erben der anderen Clans von den speziellen magischen Fähigkeiten der Vyrad zu lernen. Ivy wusste das. Es musste ihr schon vor Monaten klar geworden sein. Seymour begann zu ahnen, wie sehr Ivy der Gedanke quälte, ihre Freunde nicht wiederzusehen. Wie gut es ihr gelungen war, den Schmerz vor ihm zu verbergen! Seymour konnte es nicht fassen und es kränkte ihn, dass sie nicht seinen Trost gesucht hatte.
Plötzlich wurde ihm bewusst, dass auch er die anderen jungen Vampire nicht mehr treffen würde. Überrascht bemerkte er, wie sich ein Gefühl von Verlust und Leere in ihm ausbreitete und tiefe Traurigkeit ihn zu erfüllen begann. Ja, er würde die Vampire der anderen Clans vermissen, die ihm in den vergangenen Jahren ans Herz gewachsen waren: die kluge und wissbegierige Alisa von den Vamalia in Hamburg, Luciano de Nosferas aus Rom, der sich von einem dicken, tollpatschigen Jungen zu einem gut aussehenden, geschickten Vampir gemausert hatte, ja, selbst den schönen, arroganten Franz Leopold de Dracas aus Wien, der Ivy in ihrem Jahr in Irland erst den Kopf verdreht und sie dann hatte fallen lassen. Damals war Seymour so wütend gewesen, dass er ihn hätte zerfetzen mögen, doch seit der Dracas sich bei Ivys Befreiung so entschlossen und mutig gezeigt hatte, war er mit ihm versöhnt.
Dann der vorlaute Tammo de Vamalia, der Jüngste im Bunde, die stets schmuddeligen Pyras und all die anderen. Er vermisste sie alle und er verstand, was Ivy empfinden musste, vielleicht besser als sie es ahnte. Warum nur ließ sie sich nicht von ihm trösten? Warum wies sie ihn von sich? Sie hatte sich verändert. Früher hatte sie stets seine Nähe und seinen Rat gesucht. Was war nur geschehen?
Er spürte Taras mitfühlenden Blick auf sich ruhen. Seymour war klar, dass sie jedem seiner Gedanken gefolgt war. Er seufzte. Es gab nichts mehr dazu zu sagen.
»Wo ist Ivy? Ist das Stärken ihrer Kräfte jetzt beendet?«
Tara ignorierte die Bitterkeit und den Spott in seiner Stimme. Sie nickte nur. »Ja, mehr kann ich für ihre Sicherheit nicht tun. Nun ist es an Ivy, klug zu handeln.«
»Wo ist sie?«, wiederholte der Werwolf.
»Du wirst sie in Dunluce finden. Sie ist gestern aufgebrochen.«
Seymour erhob sich. »Ich bilde mir nicht ein, sie einholen zu können«, sagte er mit einem schiefen Lächeln. »Ich vermute, sie hat sich nicht in ihrer menschlichen Gestalt auf den Weg gemacht?«
Tara schüttelte den Kopf. »Sie flog mit meinem Falken als Begleiter.«
Wieder fühlte er einen Stich der Eifersucht. Es wäre an ihm gewesen, an ihrer Seite zu bleiben und sie sicher in den Norden der Insel zu geleiten, wo die Lycana auf Dunluce Castle hoch über den Klippen ihre Zuflucht gefunden hatten.
»Ich wünsche dir eine sichere Reise, mein Sohn.«
Seymour wandte sich noch einmal um. »Willst du mich nicht begleiten?«
Die Druidin schüttelte den Kopf. »Mein Platz ist hier, nicht bei den Vampiren von Dunluce. Wir Druiden haben stets die Einsamkeit gewählt.«
»Und wo ist mein Platz?«, murmelte Seymour.
»Du wirst ihn eines Tages finden. Lass dir Zeit«, antwortete die Mutter leise. Es schwang eine solch tiefe Traurigkeit in ihrer Stimme, dass Seymour ein eisiger Schauder über den Rücken rann. Sie sah wieder einmal etwas, das noch halb in den Schleiern der Zukunft verborgen lag, doch er scheute sich, sie danach zu fragen. Nein, vielleicht war es besser, wenn er nichts von dem wusste, was als böse Ahnung im Geist der Druidin aufgeblitzt war.
Der neue Schatten
Ivy saß im Schneidersitz auf einem flachen Stein. Mondlicht umflutete sie und ließ ihr Haar silbern leuchten. Nichts regte sich um sie. Selbst der Nachtwind war eingeschlafen. Weit breitete sich das nächtliche Moor unter ihr aus. Im Westen konnte sie bis zur Küste sehen, dort, wo das braune, feuchte Gras in schroffes Felsgestein überging, gegen das die Wellen in ihrem immerwährenden Rhythmus schlugen, es unterhöhlten, in Stücke brachen und sich so immer weiter ins Land hineinfraßen. Auf der anderen Seite glitt der Blick in ein weites Tal und hinüber zur nächsten Bergkette, deren Silhouette sich im Osten im noch finsteren Nachthimmel verlor.
Ivy war allein. Selbst die tastenden Gedanken des Werwolfs waren verstummt und ließen sie wenigstens für ein paar Augenblicke in Ruhe. Vielleicht schlief er. Sie wusste, dass er am Abend auf der Jagd gewesen war. Mit Erfolg. Und nun fühlte er sich satt und müde. Sein Geist ruhte und hatte die stete Suche nach seiner Schwester für eine Weile aufgegeben.
Ja, sie war vollkommen allein. Endlich. Erleichtert legte Ivy die Unterarme auf ihre Knie, die offenen Handflächen dem Mond zugewandt. Sie schloss die Augen. Ihr Atem stockte. Mit gerade aufgerichtetem Rücken saß sie bewegungslos da. Ihr Geist dagegen war hellwach. Ivy versuchte, ihre Gedanken nicht zu lenken. Sie bemühte sich, all ihre Überlegungen und Schlüsse, die die Erfahrung ihr eingaben, beiseitezuschieben.
So einfach es war, den Körper zur Ruhe zu bringen, so schwer war es, dasselbe mit dem Geist zu erreichen, ohne in tiefen Schlaf zu fallen. Es war eine Art Trance, die sie lange geübt hatte.
Ivy wartete. Sie saß einfach mit offenem Geist da und wartete. Sie wusste nicht genau worauf, aber sie war sicher, dass irgendetwas geschehen würde.
Da war es wieder. Eine Welle von Hass überlief sie, dass es sie am ganzen Körper schüttelte. Dann eine Gier, die größer war, als sie selbst je empfunden hatte. Sie spürte die zunehmende Erregung und dann den kurzen Augenblick des Triumphes, als das Wild in der Falle saß. Fast war es ihr, als könne sie das fremde Blut, von dem sie nicht einmal wusste, wem es gehörte, auf der Zunge schmecken.
Ivy schüttelte sich. Sie zog alle Kraft in sich zusammen und schloss die Pforten ihres Geistes. Die Gefühle, die nicht die ihren waren, verebbten.
Gut, wenn sie achtgab, konnte sie sich schützen. Bedeutete das, sie würde nun immer auf der Hut sein müssen?
Ivy unterdrückte einen Seufzer. Wie sollte sie ihren Geist auf Wanderschaft schicken, wenn sie gezwungen war, eine undurchdringliche Festung um ihn zu errichten?
Wider Willen dachte sie an Poienari und an Dracula. Tagelang hatte er ihren Geist und ihren Willen unterworfen und sie sich mit der Kraft seiner Gedanken untertan gemacht. Ivy hatte dagegen angekämpft und das Schlimmste verhindert– dachte sie zumindest–, dennoch war es ihr nicht gelungen, sich ohne Hilfe aus dieser Umklammerung zu befreien. Ausgerechnet mit Kreuzen, Weihwasser und einer Hostie war es Alisa, Luciano und Franz Leopold gelungen, sie aus Draculas Geist zu lösen. Und doch war seit dem irgendetwas anders als zuvor.
Zuerst hatte Ivy es nicht bemerkt. Sie hatten genug damit zu tun gehabt, aus Transsilvanien zu entkommen. Dann ging das Akademiejahr weiter. Es gab viel zu lernen– zumindest für die Erben– und so viel zu erleben. Theater und Bälle, Konzerte und Tanzvergnügen im nächtlichen Park bei allerlei Feuerzauber. So war es ihr eine Weile gelungen, aus ihrem Bewusstsein zu verdrängen, was sie eigentlich längst wusste. Oder besser gesagt, ahnte. Etwas war da. Etwas war anders, doch was genau war es? Und was wollte es ihr sagen?
Zurück in der Stille und Einsamkeit der Insel überfiel es sie immer öfter, und es blieb ihr nichts mehr anderes übrig, als sich ihm zu stellen, um herauszufinden, was es zu bedeuten hatte. Für sie selbst und für das Schicksal aller.
Weit war sie bisher nicht gekommen. Noch immer war es ihr ein großes Rätsel. Nun hatte sich Ivy auf den einsamen Gipfel des Berges zurückgezogen, um endlich mehr zu erfahren.
Sie wartete und öffnete vorsichtig ihren Geist. Da! Ein Bild blitzte in ihr auf, das sich wie eine Erinnerung anfühlte, doch nicht ihre eigene war. Dann eine Welle unterschiedlicher Gefühle. Noch ein Bild, das nicht zu dem ersten gehörte. Sie sah unvermittelt ihr eigenes Antlitz. Sie lag mit geschlossenen Augen auf einem Bett. Ein Brautkranz auf ihrem silbernen Haar. Das Verlangen, das sie überflutete, bereitete ihr Übelkeit, und Ivy wehrte sich dagegen. Sie wollte nicht mit seinen Gedanken widerliche Pläne schmieden, deren Mittelpunkt sie selbst und ihr Blut sein sollten.
War das nur eine Erinnerung oder steigerte er sich erneut in sein Verlangen? Was war es, was sie im Augenblick spürte? Ein Nachhall der Vergangenheit, die Gegenwart oder gar eine Ahnung der Zukunft?
Jedenfalls waren es nicht ihre Gefühle, die sich plötzlich einstellten und dann wieder verflogen, und sie waren schauderhaft! Er steigerte sich wieder in diesen Hass hinein, der sie immer öfter begleitete. Nein, Ivy hatte für heute Nacht genug. Sie versuchte ihre Gefühle von den fremden Empfindungen zu lösen. Sie wollte keinen Zorn mehr fühlen, keinen Hass und kein Sehnen nach Rache. Es war eine so wunderschöne Nacht in der Einsamkeit des Moores. Ivy wollte an etwas Schönes denken.
Sie dachte an Leo. An die Nacht auf dem Friedhof. An ihren ersten Kuss. Ach, was für ein wundervolles Gefühl.
Plötzlich erstarrte Ivy. Er war noch immer da. Hinter den Schleiern ihrer Erinnerung lauerte Dracula auf seiner Festung in den fernen Karpaten. Doch Hass und Gier waren verschwunden.
»Ach, Erzsébet«, seufzte Dracula in die Nacht. »Warum nur habe ich dich so früh verloren? Ich habe lange nicht mehr an dich gedacht, doch heute ist eine seltsame Nacht und ich vermisse dich schmerzlich.«
Und er dachte an ihren ersten Kuss und das wundervolle Gefühl, das ihn dabei durchströmt hatte.
Ivy riss erstaunt die Augen auf. Bei den Geistern der Erde, war das möglich? Vielleicht war es ein Zufall, aber wenn nicht? Sie wagte nicht, weiter darüber nachzudenken, was das bedeuten könnte.
*
»Dario, was tust du da?«, fragte Luciano in scharfem Ton. Er stand in der offenen Tür zu dem düsteren, feuchten Gelass, das zu dem Teil des alten Neropalasts gehörte, in dem die Särge der Erben der Nosferas standen.
Der Unreine, der einst dem Clanführer der Nosferas gedient hatte, drehte sich um und sah den jungen Vampir mit unbeweglicher Miene an. Luciano hatte sich in den vergangenen Jahren sehr zu seinem Vorteil verändert. Nun war er siebzehn, hochgewachsen und schlank. Sein früher pausbäckiges Gesicht nahm markante Züge an, was ihn zunehmend attraktiver erscheinen ließ. Das dichte, schwarze Haar lag ausnahmsweise glatt gekämmt um seinen Kopf.
»Ich packe Eure Gewänder für Eure Reise nach England«, gab der Schatten Auskunft.
»Das sehe ich«, empörte sich Luciano und trat, die Hände in die Hüften gestemmt, näher. »Und warum tust du das?«
Dario hüstelte und wandte den Blick ab. »Das gehört zu den Aufgaben der Schatten, die die Erben zur Akademie begleiten. Der Zug wird morgen am frühen Abend Rom verlassen, um Eure Cousine Chiara, Euren Vetter Maurizio und Euch selbst in Begleitung Eurer Schatten nach London zu bringen.«
Bei dem Wort Schatten kniff Luciano die Augen zusammen. »Ja, aber du wirst dieses Jahr nicht mit mir kommen. Du bist nicht mein Schatten! Und deshalb brauchst du auch nicht meine Sachen zu packen!«
»Ich befolge lediglich meine Anweisungen.« Der Unreine verzog keine Miene. Stattdessen faltete er das nächste Hemd zusammen und legte es in Lucianos Reisekiste.
»Ich habe dir das nicht befohlen. Hör sofort damit auf! Das ist nicht deine Sache. Hast du nicht gehört?«, rief Luciano erbost. Doch Dario tat so, als wäre er gar nicht da.
Plötzlich hielt Luciano inne und ließ den Blick durch den Raum schweifen, in dem es außer zwei steinernen Sarkophagen und einigen Truhen, in denen seine Kleider aufbewahrt wurden, nicht viel zu sehen gab.
»Wo ist Clarissa?«, herrschte er ihn an.
Dario vermied es, ihn anzusehen. »Ich weiß es nicht. Vielleicht solltet Ihr das alles mit Conte Claudio besprechen?«, riet der Servient und widmete sich weiterhin voller Sorgfalt Lucianos Garderobe.
»Oh ja, das werde ich tun«, rief Luciano aufgebracht und stürmte davon.
Er fand den Führer des Clans in der goldenen Halle auf einem der gepolsterten Ruhebetten liegen, umgeben von den Altehrwürdigen, deren Rat er schätzte.
»Darf ich Euch einen Augenblick stören, Conte Claudio?«, unterbrach Luciano die Unterhaltung mit kaum unterdrückter Anspannung. Der Conte hob die Brauen, rügte ihn aber nicht, sondern winkte ihn heran.
»Was gibt es, Luciano?«
»Dario packt meine Sachen für London!«
Die schwarzen Augenbrauen des Conte wanderten noch ein Stück weiter nach oben. »Ja, und? Gehört das nicht zu seinen Aufgaben?«
»Er ist nicht mein Schatten. Er wird mich nicht nach London begleiten!« Luciano wusste, dass sein Ton schlichtweg unverschämt war, aber der Clanführer tat so, als bemerke er die Respektlosigkeit nicht. Allerdings widersprach er dem Erben der Nosferas.
»Dario ist dein Schatten und er wird mit nach London fahren, denn ich habe es so bestimmt.«
Claudios Tonfall warnte Luciano, dass er so nicht an sein Ziel gelangen würde. Vielmehr würde er außer einer schmerzhaften Strafe gar nichts erreichen.
»Ich habe ja nichts dagegen, wenn Dario mit uns nach London reist«, lenkte er ein, »und wenn er sich berufen fühlt, zu packen, will ich ihn nicht aufhalten. Aber der Schatten an meiner Seite ist nun Clarissa!«
»Clarissa?«, wiederholte der Conte mit einem gefährlichen Klang in seiner Stimme. Er richtete sich auf seinem Ruhebett auf und sah Luciano so scharf an, dass dieser einen Schritt zurückwich. »Dein Schatten? Sprichst du von jener Unreinen, die wieder einmal von ihren Pflichten davongelaufen ist? Die Unreine, die du dir gewandelt hast, obwohl es dir nicht erlaubt war, vor deinem Ritual Menschenblut zu trinken?«
Luciano bemühte sich, nicht zusammenzuzucken. Er hatte gedacht, das Thema sei nun endlich vom Tisch. Hatte er nicht seine Strafe für diesen Verstoß empfangen und sie bis zum bitteren Ende ausgesessen? Zwei Wochen bewegungslos in seinen Sarg eingesperrt, ohne auch nur einen Schluck Blut! Er hatte es klaglos ertragen. Für Clarissa. Sie war jedes Opfer wert. Ein warmes Gefühl durchrieselte ihn, als er daran dachte, wie sie Nacht für Nacht neben seinem Sarg ausgeharrt und die Qual mit ihm geteilt hatte. Danach war sie allerdings zu ihrem Trotz und ihrem Starrsinn zurückgekehrt, und er dachte mit Schaudern an die Szenen, die sich seither fast jede Nacht zwischen ihnen abgespielt hatten. Dabei hatte er so gehofft, sie würde ihr neues Dasein als Vampir nun endlich annehmen und ihm die bedingungslose Liebe schenken, die sie ihm geschworen hatte, als sie noch ein Mensch und die Tochter des Hauses Todesco in Wien gewesen war. Doch seit die jungen Nosferas in die Domus Aurea nach Rom zurückgekehrt waren, lief es nicht gut zwischen ihnen.
Sie hasste die dunklen, feuchten Gänge. Sie fürchtete sich vor den unansehnlichen, fetten Nosferas und sie war nicht bereit, zumindest dem Anschein nach seine Servientin zu sein.
Luciano hatte es ihr erklärt. Er hatte sie angefleht. Clarissa blieb uneinsichtig. Sie wollte ihm nicht als sein Schatten dienen und ihm jeden Wunsch erfüllen, nicht seine Sklavin sein, die er nach Belieben herumstoßen durfte.
»Es ist doch nur zum Schein!«, beschwor er sie immer wieder. »Ich will dich weder beherrschen noch dir befehlen oder dich herumstoßen. Aber nur wenn du als mein Schatten giltst, darfst du an meiner Seite bleiben und mit mir nach London fahren. Ich schaudere bei der Vorstellung, was sie mit dir machen, wenn du alleine hier zurückbleibst. Sie werden dir deinen Trotz austreiben und deinen Widerstand brechen. Glaube nicht, dass du ihnen widerstehen kannst. Für sie ist nur ein gehorsamer Servient ohne eigenen Willen von Nutzen.«
»Sie? Ach, du sprichst von deiner Familie, zu der du mich gegen meinen Willen gebracht hast«, schleuderte sie ihm ins Gesicht, ohne die Dringlichkeit seiner Argumente zu begreifen. Erst am Abend hatte er sie noch einmal inständig gebeten, vernünftig zu sein und wenigstens so zu tun, als käme sie ihren Pflichten als sein Schatten nach und würde seine Reisegarderobe richten.
»Ich kann es später selber tun«, hatte er ihr noch vor einer Stunde versprochen, als er sie in seinem Gemach zurückließ. Doch dann war sie wieder einmal davongelaufen und hatte dem Conte die Gelegenheit gegeben, Dario mit dieser Aufgabe zu betrauen. Wie sollte er die Situation nun noch retten? Warum wollte sie das einfach nicht verstehen? Luciano richtete seinen Blick fest auf das feiste Gesicht des Clanführers.
»Ja, ich spreche von Clarissa. Von dem Mädchen aus Wien, das sich noch ein wenig schwer mit seinem neuen Dasein tut. Sie muss sich erst in diese für sie noch fremde Welt eingewöhnen. Wenn Ihr sie mit mir nach London reisen lasst, habe ich genügend Zeit, ihr alles beizubringen.«
Einer der Altehrwürdigen, auf dessen Gesicht sich wachsendes Erstaunen breitmachte, mischte sich ein.
»Sie muss sich erst an die fremde Welt gewöhnen? Ha! Habe ich richtig gehört? Es geht hier um eine Unreine? Einen Schatten? Der– wie lange schon in unserem Haus ist? Zwei Monate oder noch länger? Und du forderst jetzt Zeit, um ihr ihre Pflichten klarzumachen? Nicht zu fassen! Fragen wir unsere Unreinen inzwischen, ob sie uns zu dienen belieben? Oder bitten wir sie gar um Erlaubnis, ob wir sie beißen und wandeln dürfen? Ha!« Sein knochiger Finger schoss nach vorn. Luciano wich noch einen Schritt zurück.
»Schick sie zu mir und ich schwöre dir, ich brauche keine Nacht, um eine folgsame Sklavin aus ihr zu machen.«
Luciano lehnte schroff ab, obgleich er sich nicht sicher war, ob sich der Altehrwürdige oder Clarissa als der härtere Dickkopf herausstellen würde. Nein, das wollte er lieber nicht ausprobieren. Und überhaupt, er wollte sie ja gar nicht als gehorsame Dienerin, als verhuschten Schatten ohne eigene Meinung, die Augen stets niedergeschlagen und nur eifrig darauf bedacht, seine Wünsche zu erfüllen. Er liebte Clarissa. Deshalb hatte er sie gewandelt. Um für immer mit ihr zusammen zu sein.
Na ja, so ungefähr. Eigentlich war es ein Unfall gewesen. Nein, Leo war schuld. Er hatte Clarissa zuerst gebissen und dann hatte das Unglück seinen Lauf genommen. Hätte er sie etwa sterben lassen sollen? Ihre Wandlung war ihre Rettung gewesen. Nur dumm, dass Clarissa das ganz anders sah. In ihrer Sichtweise hörte sich die Sache nicht so gut an: Luciano habe sie betrogen und ermordet. Doch wie hätten sie sonst für immer zusammenbleiben können? Luciano konnte nur hoffen, sie würde irgendwann begreifen, dass es für ihre gemeinsame Liebe keinen anderen Weg geben konnte.
»Ist das Thema nun erledigt?« Conte Claudios schneidende Stimme riss Luciano aus seinen Gedanken. »Dario wird dich begleiten. Meine Entscheidung steht fest.«
»Selbstverständlich«, willigte Luciano rasch ein. »Aber könnte ich Clarissa nicht ebenfalls mitnehmen? Das wäre doch ein gutes Training, wenn sie mit dem erfahrenen Dario zusammen… unter seiner Aufsicht… ich meine…« Unter dem Blick des Clanführers verstummte er. Conte Claudio starrte den Erben der Nosferas noch eine Weile streng an, dann gewann seine träge und ein wenig nachlässige Seite die Oberhand, die jede Art von Konflikt verabscheute. Er lächelte schief.
»Also gut, dann nimm sie mit nach England und sieh zu, dass sich ihre Einstellung bessert. Ich möchte keine solche Kratzbürste in meinem Palast wissen. Lass dir nicht auf der Nase herumtanzen. Sie ist unrein und sie ist ein Weib! Du bist noch jung, aber lass dir gesagt sein, nichts ist schlimmer, als wenn man bei einer Frau nicht gleich die Zügel fest in die Hand nimmt und die Richtung vorgibt. Jede Nachlässigkeit rächt sich bitterlich! Und ehe du dich versiehst, kommandiert dich das Weib herum, nörgelt und raubt dir den letzten Nerv!«
Die Altehrwürdige, die zu seiner Rechten saß, lachte gackernd. »Glaub mir, mein Junge, der Conte weiß, wovon er spricht! Mir fallen gleich mehrere Vampirinnen ein, an die er sicher nur mit Schaudern zurückdenkt.«
Eine zweite Vampirin fiel in das Gelächter ein. »Ja, weißt du noch, als er Benedetta in die Oper begleitet hat?«
Die Stirn des Conte umwölkte sich. Rasch trat Luciano den Rückzug an. Er wollte nicht mehr in Reichweite sein, falls der Conte ein Opfer suchte, an dem er seinen aufwallenden Zorn auslassen konnte. Das Wichtigste hatte er erreicht. Clarissa würde ihn nach London begleiten. Und alles andere würde sich schon finden. Hoffte er zumindest.
*
Fünf Tage war der Wolf unterwegs, als Dunluce in der sternenklaren Nacht vor ihm auftauchte. Seymour hielt inne und ließ den Blick schweifen. Was für ein verzaubertes Bild! Die Menschen sahen mit ihren Augen vermutlich nur die Ruine einer alten Burg, die schon lange verlassen war. Ein Unglücksort, seit bei einem Sturm im Jahr 1639 ein Teil der Klippen samt Küche und Personal von den Wogen verschlungen worden war. Der Werwolf erblickte mehr als die aus den Felsen aufwachsenden Mauern und Türme auf dem Sporn im Meer, der nur über eine schmale Brücke mit dem Festland verbunden war. Er sah die Zuflucht der Lycana, des Clans der irischen Vampire. Er erkannte schattenhafte Gestalten. Ihre langen, fließenden Gewänder waren in den Farben Irlands gehalten: Grün- und Brauntöne, wie die Moore und saftigen Wiesen, die sich der Küste landeinwärts anschlossen. Ivys silbrig weißes Gewand konnte er nicht ausmachen. Eine Gruppe schlanker Gestalten huschte über die schwankend schmale Brücke zur Vorburg. Dort kümmerten sich einige der Unreinen um die Schafe, die sich die Vampire hielten, seit sie in den Tagen der Akademie viele hungrige Mäuler zu stopfen hatten, denen es noch nicht erlaubt war, sich an Menschenblut zu laben. Junge Vampire durften nur das schale Tierblut trinken, bis sie mit irgendeinem Ritual unter die erwachsenen Vampire aufgenommen wurden, die sie dann zu ihrer ersten Jagd begleiteten. Seymour hatte solch einem Spektakel noch nicht beigewohnt, aber er wusste von Mervyn, dass der junge Erbe der Lycana diesem Ereignis entgegenfieberte. Was das Blut der Menschen für die Vampire so viel verlockender machte, konnte Seymour nicht sagen. Er selbst gehörte nicht zu den Werwölfen, die Menschenfleisch etwas abgewinnen konnten. Dennoch wusste er sehr gut, dass es auch andere seiner Spezies gab. In den wilden Mooren im Nordwesten und weiter südlich am Rock of Cashel, dem alten Sitz der Könige von Munster im Landesinneren, trieben sich einige Rudel umher, die bei Vollmond auf Menschenjagd gingen. Ihm war das gleich. Auch Vampire labten sich seit Jahrhunderten am Blut der Menschen. Vor einigen Jahren allerdings hatten sich die Führer aller Vampirclans am Genfer See getroffen, um die Feindseligkeiten untereinander zu beenden. Sie gründeten nicht nur die Akademie für die Erben ihrer Blutlinien, sie schlossen auch einen Vertrag, der unter anderem untersagte, ihre Beute weiterhin zu töten. Die meisten schienen sich daran zu halten und raubten den Menschen nur noch so viel Blut, dass sie geschwächt und verwirrt zurückblieben, sich aber innerhalb von Tagen oder Wochen erholen konnten. Tara hatte dies mit Erleichterung aufgenommen und Seymour vermutete, dass sie an diesem Punkt der Vertragsverhandlungen nicht nur am Rande beteiligt gewesen war. Nun dachte die Druidin darüber nach, auch die Werwölfe zu zähmen und ihren Sohn zu ihnen zu senden, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Dieser Gedanke behagte Seymour nicht besonders. Wie sollte er das machen? Sie würden sicher nicht auf seine Worte hören. Sollte er jeden Einzelnen von ihnen zum Zweikampf auf Leben und Tod fordern? Nein, so stellte sich das Tara sicher nicht vor. Wie aber konnte er sich sonst Gehör bei diesen blutrünstigen Jägern verschaffen? Zum ersten Mal begann Seymour zu ahnen, was die Druidin geleistet hatte, sechs Vampirclans, die sich bis an den Rand ihrer Vernichtung über Jahrhunderte bekämpft hatten, an einen Tisch zu bekommen und auch noch ein stabiles Bündnis zu stiften. Denn das schien es wirklich zu sein. Die Erben reisten Jahr für Jahr von einem Clan zum anderen und lernten die speziellen Fähigkeiten, die der jeweilige Clan hervorgebracht hatte, seit sie sich voneinander abgespalten hatten.
Seymours Gedanken wanderten über die Küste hinaus nach Osten, wo England irgendwo in den Nebeln verborgen lag. Morgen würden die Erben der Clans aus allen Ecken Europas her nach London reisen, um das Jahr bei den Vyrad zu verbringen. Aber Ivy und Seymour würden nicht mit dabei sein.
Mit hängendem Kopf kletterte der Wolf über eine niedrige Steinmauer und überquerte dann eine Wiese. Die Schafe, die panisch blökend das Weite suchten, bemerkte er nicht einmal. Er passierte die ersten Gebäude der Vorburg und folgte dem Pfad, der ihn zur Brücke führte.
»Ah, Seymour. Dass du dich auch mal wieder blicken lässt«, begrüßte ihn eine männliche Stimme, die er noch mit dem hellen Klang eines Knaben im Ohr hatte. Seymour hob den Kopf und sah den jungen Vampir an. Mervyn war jetzt neunzehn und er sah noch immer ein wenig unscheinbar aus. Und typisch irisch, mit seinem rötlichen Haar und der feinen, weißen Haut. Seymour überlegte, ob er ihn ansprechen sollte. Normalerweise teilte er seine Gedanken nur mit Tara und Ivy, doch er musste die Frage gar nicht stellen.
»Falls du Ivy suchst, sie ist nicht in der Burg. Angekommen ist sie vor drei Tagen, aber vorhin habe ich sie weggehen sehen.« Er machte eine vage Handbewegung, dem Verlauf der Klippen nach Osten folgend.
Seymour richtete seine gelben Augen so durchdringend auf Mervyn, dass der junge Vampir blinzelte.
»Ivy ist nicht leicht zu durchschauen, wie du sicher weißt, aber ich hatte den Eindruck, es geht ihr nicht gut.«
Vielleicht hatte sich Seymour seine Sorgen zu deutlich anmerken lassen. Oder hatte Mervyn etwa bei den Dracas in so kurzer Zeit gelernt, selbst in den Gedanken eines Werwolfs zu lesen? Das war fast ein wenig unheimlich!
»Sie kam in meine Kammer, als ich gerade meine Reisekiste schnürte. Sie sagte mir Auf Wiedersehen und wünschte mir eine lehrreiche Zeit in London. Dann drehte sie sich um und lief weg, als seien Dämonen hinter ihr her.« Mervyn hob die Schultern, er schien sich entschuldigen zu wollen, dass er Ivy nicht aufgehalten hatte. Doch beide wussten, dass ihm das nicht möglich gewesen wäre.
Seymour brummte und wandte sich ab. Später würde noch Zeit genug sein, um Catriona und Donnchadh seine Aufwartung zu machen. Nun wollte er zuerst nach Ivy sehen. Ihr ein wenig Trost spenden und ihre Einsamkeit vertreiben. Wie früher, als sie wochenlang zusammen durch die Berge gewandert waren. Wenn dies noch in seiner Macht stand.
Seymour verließ die Vorburg und bog auf einen schmalen Klippenpfad ein. Er brauchte nicht lange zu suchen, bis er auf Ivys frische Fährte stieß. Rasch nahm er die Witterung auf und rannte los.
Er fand sie auf dem Clochán an Aifir oder Giant’s Causeway, wie die Engländer den Damm des Riesen nannten, dort wo er in einer Felszunge in den Wogen des Meeres versinkt. Sie saß auf einer der sechseckigen schwarzen Steinsäulen, das Gesicht in beide Hände gestützt, und starrte auf das Wasser hinaus, das in dieser Nacht glatt wie ein Seidenlaken im Mondlicht schimmerte. Nur zu ihren nackten Füßen, wo die Basaltsäulen im Meer versanken, kräuselte sich ein wenig weißer Schaum.
Er wusste, dass sie ihn längst bemerkt haben musste, doch sie sagte nichts. Seymour trat näher und setzte sich neben sie auf die Hinterpfoten. Gemeinsam starrten sie wortlos auf das Meer hinaus. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie nicht sprach. Doch er empfing auch keinen ihrer Gedanken, an denen sie ihn stets hatte teilhaben lassen. Nun stieß er mit seinen zaghaften Tastversuchen auf eine glatte Wand.
Warum wies sie ihn ab? Warum sprach sie nicht mit ihm? Er spürte die Kränkung wie einen schmerzhaften Stich. So saßen sie noch eine ganze Weile still nebeneinander, doch Seymour wartete vergebens darauf, dass Ivy das Schweigen brach. Schließlich gab der Wolf nach.
Unsere Mutter Tara hat dich gut gerüstet und deinen Geist gegen Freund und Feind gestärkt.
Wieder wartete er, doch Ivy schwieg noch immer.
Nun würde es Dracula vermutlich nicht mehr gelingen, deinen Geist dem seinen untertan zu machen! Zu dumm, dass Tara es versäumt hat, dich das alles schon im vergangenen Sommer zu lehren. Keine Antwort.
Der Wolf stieß innerlich einen Seufzer aus. Ach, Ivy, sprich doch mit mir! Was habe ich dir getan, dass du mich so von dir weist? Zürnst du mir, weil ich in Wien versagt habe? Weil es deine Freunde waren, die dich befreit haben? Weil ich mich von Dracula vertreiben ließ, statt mein Leben im Kampf für dich zu geben?
Ivys elfengleiches Antlitz wandte sich ihm zu. Ihre weiße Stirn legte sich in Falten.
Rede nicht solch einen Unsinn!, erklang ihre Stimme in seinem Kopf. Wenigstens sprach sie mit ihm!
Was soll ich denn denken, wenn du vor mir davonläufst und deinen Geist vor mir verschließt?
Ich bin nicht davongelaufen, wehrte Ivy barsch ab. Ich bin Taras Ruf gefolgt und habe die vergangenen Wochen hart gearbeitet, bis ich dachte, der Schädel müsse mir zerspringen.
Seymour nickte bedächtig. Das konnte er sich gut vorstellen. So sanft die alte Druidin sein konnte, man durfte sich nicht der Illusion hingeben, sie sei eine alte schwache Greisin, auch wenn ihr Körper diesen Anschein gab. In ihr wohnten ein außergewöhnlich heller Geist, ein eiserner Wille und eine Stärke, die man nicht unterschätzen durfte.
Das kann ich mir gut vorstellen. Aber warum durfte ich nicht an deiner Seite bleiben? Ich wäre einfach da gewesen und hätte geschwiegen, solange du lernst und übst, und wäre dir ein Trost in deinen dunklen Stunden des Zweifels und der Erschöpfung gewesen. Wie früher.
Ein Lächeln voller Bitterkeit huschte über die mädchenhaften Züge. Nichts ist wie früher. Die Zeiten haben sich geändert.
Wir sind Bruder und Schwester. Wir gehören zusammen. War das nicht schon immer so? Ein unbekannter Schmerz umklammerte sein Herz.
Ivys Stimme wurde sanfter. Fast so wie früher. Wir sind einhundert Jahre lang Seite an Seite durch das Land gezogen. Ist das nicht genug Erinnerung für eine ganze Ewigkeit?
Der Wolf knurrte und zeigte seine Zähne. Ich lebe nicht von Erinnerungen. Ich lebe jetzt. Jede Nacht neu. An deiner Seite!
Ihm war, als streife ihn eine Welle voller Zorn. Da war eine heiße Wut, die er von Ivy nicht kannte. Oder war es ein Widerhall seiner eigenen Gefühle?
Ich habe Mervyn getroffen, sagte er, obgleich diese Gedanken Ivy sicher auch nicht fröhlicher stimmen konnten. Nein, es wunderte ihn nicht, dass ihre Stimme nun voller Traurigkeit war.
Er hat schon gepackt. Ich war bei ihm, um mich von ihm zu verabschieden. Morgen wird Murrough ihn mit der Cioclón nach Dublin bringen. Niamh und Bridget werden ihn nach London begleiten. Sie lachte auf. Catriona scheint es zu gefährlich, ihn alleine ziehen zu lassen.
Vielleicht hätte sie diese Vorsichtsmaßnahme schon früher treffen sollen, meinte Seymour.
Wozu? Niamh und Bridget schicken, um Dracula aufzuhalten? Das denkst du nicht wirklich. Die Vorstellung ist lächerlich!
Der verächtliche Ton gefiel Seymour nicht, aber er ging nicht darauf ein. Mag sein. Außerdem war es nicht Dracula, der dein Geheimnis enthüllt hat und Schuld daran trägt, dass man dich dieses Jahr nicht zur Akademie lädt.
Nein, das war Marie Luise, unsere heiß geliebte Dracas.
Wieder diese Welle von Hass und Zorn. Ihre Stimme aber klang ruhig, ja, fast kalt. Unvermittelt erhob sich Ivy und strich ihr silbernes Gewand glatt. Ihre türkisfarbenen Augen schienen durch Seymour hindurchzusehen.
Komm, lass uns gehen.
Wohin?, erkundigte er sich, während er ihr in weiten Sprüngen über die glatt gewaschenen Basaltsäulen folgte.
Ivy hielt inne und wandte sich zu ihm um. Ihre Augen glitzerten gefährlich. Auf die Jagd! Mich dürstet es nach Blut. Nach frischem Menschenblut!
*
Luciano lag in seiner sargähnlichen Transportkiste, während der Zug Stunde um Stunde weiter nach Norden fuhr. Irgendwann sollten sie die Küste erreichen und in ein Schiff umgeladen werden, das sie hinüber auf die Insel bringen würde. Luciano wusste nicht, wo. In den vergangenen Tagen hatten ihn andere Probleme beschäftigt als ihre Reiseroute. Vielleicht würden sie gar über Hamburg reisen und die Überfahrt mit den Vamalia zusammen machen? Man würde sehen.
Seine Gedanken schweiften wieder zu der Kiste, die neben der seinen stand, und zu der Vampirin, die eingesperrt dort drinnen lag. Ihre Ungeduld, ihr Blutdurst und ihr Zorn umgaben sie wie eine Wolke, die Luciano nur allzu deutlich spürte.
Er war noch niemals mit so schwerem Gemüt zu einem Akademiejahr gefahren. Nun ja, vor dem ersten Mal war er aufgeregt und verunsichert gewesen, doch damals waren ja alle zu ihnen nach Hause in die Domus Aurea gekommen, was den Erben der Nosferas einen gewissen Heimvorteil verschafft hatte. Oder auch nicht, musste Luciano zugeben, wenn er an seine erste Begegnung mit Franz Leopold zurückdachte. Er zog eine Grimasse. Wobei er sich heute an diese Schmach sogar mit einem Lächeln zurückerinnern konnte. Was war Leo doch für ein Widerling gewesen, und was hatten sie dann nicht alles Aufregendes zusammen erlebt.
Sein Lächeln verblasste, als Clarissa wieder in seinen Sinn zurückkehrte und ihm die Rolle einfiel, die Franz Leopold in Wien gespielt hatte. Luciano ballte die Hände zu Fäusten. Verfluchter Bastard! Wenn Leo sich nicht eingemischt, wenn er sie nicht gebissen hätte, dann wäre alles ganz anders verlaufen.
Wie anders? Vielleicht hätte Luciano dann nicht den Mut gefunden, Clarissa zu beißen und zu wandeln. Dann würde sie nun noch als Mensch im Palais Todesco bei ihrer Familie leben und er sie vielleicht niemals wiedersehen. Oder er hätte sich irgendwann von seiner Leidenschaft hinreißen lassen und sie ausgesaugt, bis sie in seinen Armen gestorben wäre. Genau genommen war das auch beinahe passiert. Nur Ivy hatte er es zu verdanken, dass es anders gekommen war. Ohne die Hilfe der Lycana hätte er nicht die Kraft besessen, Clarissa zu wandeln. So oder so wäre seine Liebe für ihn verloren gewesen. Vielleicht hatte das Schicksal es gut mit ihm gemeint, so wie alles gelaufen war?
Vorsichtig tastete er wieder nach der Vampirin in der Kiste nebenan. War Clarissa immer noch so wütend? Oder gewannen Blutdurst und Ungeduld nun die Oberhand? Diese Gefühle waren für einen so jungen Vampir durchaus normal. Wenn Luciano daran zurückdachte, wie sehr ihn früher der Blutdurst bereits nach wenigen Stunden ohne einen Trunk gequält hatte!
Vor ihrer Abfahrt war er guter Dinge gewesen, voller Hoffnung, in London würde sich alles zum Besten entwickeln. Er hatte mit Clarissa zusammen sogar schon eifrig Englisch gelernt, so wie die Vyrad es in ihrer Einladung zum neuen Akademiejahr verlangt hatten. Aber dann hatte der Conte kurz vor ihrer Abfahrt Clarissa zu sich gerufen und ihr mit deutlichen Worten klargemacht, was die Nosferas von ihren unreinen Servienten erwarteten. Sie waren die Diener der Vampire reinen Blutes. Nur dafür wurden sie von ihnen geschaffen! Als stille, dienstbare Geister, schattengleich und immer bereit, die Befehle ihres Meisters zu erfüllen.
Sobald sie zurück in seiner Kammer war, hatte sie getobt. Sie hatte ihn angeschrien und verflucht, ihm Verrat und allerlei andere unschöne Dinge vorgeworfen. Luciano hatte nicht zugehört. Er wollte sich von ihren unbedachten Worten nicht kränken lassen. Sie meinte es nicht so. Das würde ihr irgendwann klar werden.
Statt sich darauf zu konzentrieren, was sie sagte, sah er sie nur an. Wie schön sie war. Wie gut der Zorn ihr zu Gesicht stand. Fast konnte man den Hauch rosiger Wangen wieder erahnen, den er an ihr so hübsch gefunden hatte, als sie noch ein Mensch gewesen war. Ach, wie schön war ihre Liebe in diesen Tagen gewesen. Wie berauschend ihr Duft, wenn sie sich in seine Arme schmiegte, und wie wundervoll ihre Küsse. Würde es irgendwann wieder so sein?
Wir haben alle Zeit der Welt, versuchte er seine Ungeduld zu beschwichtigen. Sie ist kein Mensch mehr, der in wenigen Jahren verblüht. Ja, jeden Abend, wenn sie erwachte, sah sie so aus wie am Tag ihres Todes. Das war bei jedem unreinen Vampir so. Er dagegen wurde reifer und älter wie alle Erben der Clans, die von einem Vampir gezeugt und von einer Vampirin geboren worden waren. Viele Jahrzehnte würden seine Kräfte sich entwickeln und er immer stärker werden. Ein Vampir konnte viele Menschenleben überdauern, bis er irgendwann den Höhepunkt seiner Kraft überschritt und sich unter die Altehrwürdigen einreihte. Doch bis dahin hatten sie noch viel Zeit, die Wunden zu heilen und die Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Luciano konnte nur hoffen, dass dies nicht zu lange dauern würde. So, wie sich Clarissa im Augenblick benahm, war es schlichtweg anstrengend, und er wusste nicht, wie lange er es schaffen konnte, sie von den anderen abzuschirmen, von denen keiner bereit war, ihr die gleiche Geduld entgegenzubringen, die Luciano aufbrachte. Was sein Vetter Maurizio zu dem Ganzen sagte, wollte er nicht einmal in seinen Gedanken wiederholen. Und selbst Chiara, die er als seine Cousine achtete und liebte und mit der er stets gut ausgekommen war, fand deutliche Worte.
»Weißt du, Luciano, bei aller Liebe, es ist nicht gut, wenn du ihr das alles durchgehen lässt. Weder für dich noch für Clarissa. Sie ist jetzt eine Servientin der Nosferas. Ob das nun gut oder schlecht ist, gerecht oder die Folge eines Verrats. Es ist eine Tatsache, die sich nicht mehr ändern lässt. Sie gehört in unsere Welt und muss sich den Regeln unserer Gemeinschaft anpassen. Schon möglich, dass die Vamalia in Hamburg oder die Lycana in Irland anders mit ihren Unreinen umgehen und ihnen mehr Freiheiten gewähren. Ja, sie behandeln, als wären sie denen reinen Blutes ebenbürtig. Was hilft es? Bei den Nosferas ist es eben anders. Sie hätte es auch noch schlimmer treffen können, wenn ein Dracas sie gewandelt hätte!«
Da hatte sie auch wieder recht. Aber das Argument ließ Clarissa nicht gelten.
»Jedenfalls wirst du ihr durch deine falsche Rücksicht den Schmerz nicht ersparen, und du kannst sie auch nicht bis in alle Ewigkeit vor allem beschützen und bewahren. Hilf ihr lieber, sich in der Wirklichkeit zurechtzufinden, in die du sie gebracht hast.«
»Und wenn sie mich dafür hasst? Wenn unsere Liebe dadurch zerstört wird?«, fragte er seine Cousine verzagt.
Chiara legte den Arm um seine Schultern. »Ach Luciano, mach dir nichts vor. Ihre menschliche Liebe ist längst mit ihrem Blut davongeflossen. Vielleicht schafft ihr es, etwas Neues für euch zu finden. Aber glaub mir, das geht nur innerhalb unserer Familie und ihrer Regeln, nicht gegen sie.«
Die Worte seiner Cousine trafen ihn hart, vielleicht gerade weil er die tiefe Wahrheit in ihnen spürte. Luciano unterdrückte einen Seufzer. Warum musste die Liebe so kompliziert sein?
Der Zug ratterte weiter nach Norden. Die Nacht floss träge dahin. Luciano streckte noch einmal seinen Geist aus, verließ seine eigene Kiste und drang in die daneben ein. Seine Gedanken liebkosten die hübsche junge Vampirin, die sich noch immer nicht in ihr Schicksal fügen und dem Geliebten verzeihen wollte, der ihr das angetan hatte.
Ankunft bei den Vyrad
»Die Nosferas sind angekommen«, verkündete Hindrik und trat in die einfache Schlafkammer, in der sich Alisa gerade einrichtete. Dieser Raum war das erste, was sie vom Heim der Vyrad zu Gesicht bekommen hatte.
»Wie schön. Wo sind sie?«, erkundigte sich die Vamalia und räumte einen zweiten Stapel Bücher in das Regal, das über ihrem Sarg an der Wand befestigt war. Daneben zeigte ein Fenster auf einen L-förmigen Hof hinaus mit alten Bäumen und einem hübschen Brunnen. Schwere Vorhänge sorgten dafür, dass bei Tag kein Sonnenstrahl ins Zimmer dringen konnte.
»Die Nosferas sind noch in ihren Kammern im Haus nebenan, aber ihr sollt nun alle in den großen Saal kommen. Ich sage Sören und Tammo Bescheid und bringe euch dann hinüber.«
Alisa nickte ein wenig zerstreut und ließ den Blick von den letzten Büchern in ihrer Reisekiste zu den Kleidern schweifen, die auf dem Tisch ausgebreitet lagen. Unbewusst wiederholte sie im Kopf ein paar englische Sätze, die sie über die Ferien geübt hatte. Die Vyrad hatten in ihrer Einladung verlangt, dass sich die Erben im Voraus mit der englischen Sprache vertraut machen sollten. Wie ungewöhnlich! Wollten sich die Vyrad etwa davor drücken, die Erben zu unterrichten? Doch ihre Gedanken schweiften schnell wieder ab.
»Ist gut. Ich ziehe mich noch rasch um.« Ihre Hand griff nach den langen, rotblonden Strähnen, die sich aus ihrer Frisur gelöst hatten. »Und mein Haar sollte ich vorher auch neu aufstecken, findest du nicht?«
Sie sah ihn aus ihren hellblauen Augen fragend an. Hindrik schmunzelte. Wie hatte sich Alisa verändert. Nicht nur äußerlich war sie zur Frau gereift. Noch vor einem Jahr hätte sie keinen Gedanken an ihre Erscheinung verwendet und lieber noch ein paar Seiten gelesen, um dann zerzaust und mit zerknittertem Kleid vor ihren Gastgebern zu erscheinen. Wobei die Sorge um ihre Garderobe sicher nicht dem Wunsch entsprang, den Vyrad zu gefallen. Nein, sie wollte einen anderen Vampir mit ihrer Erscheinung beeindrucken, der mit seinen Begleitern jeden Moment aus Wien eintreffen konnte.
»Pass auf, was du denkst. Das habe ich sehr wohl in deinem Geist gelesen!«, rief Alisa empört. »Es steht dir nicht zu, dir über Dinge Gedanken zu machen, die dich nichts angehen.«
»Das ist schon eine teuflische Fähigkeit, die die Dracas euch in Wien beigebracht haben«, beschwerte sich Hindrik.
Alisa ignorierte den Einwurf und behauptete stattdessen: »Außerdem ist es überhaupt nicht wahr. Es geht mir nur darum, die Vamalia hier in London würdig zu vertreten.«
»Und ich merke, auch ohne Gedanken lesen zu können, wenn du versuchst mich anzuschwindeln«, gab Hindrik lachend zurück und verließ das Zimmer. Draußen drehte er sich noch einmal um. »Ich schicke dir Bergit, damit sie dir zur Hand geht.«
»Danke!«, rief ihm Alisa nach und begann schon einmal, die Flechten zu lösen. Es war ihr Wunsch gewesen, in diesem Jahr zusätzlich eine weibliche Servientin mitzunehmen, und Bergit hatte sich gerne bereit erklärt, sie zu begleiten. Auch Dame Elina hatte nichts dagegen einzuwenden gehabt.
»Es ist nahezu unmöglich, ein halbwegs modisches Kleid alleine anzuziehen«, beschwerte sich Alisa. »Ganz zu schweigen davon, eine Frisur aufzustecken, die es auch wert ist, als solche bezeichnet zu werden!«
Dame Elina hatte gelächelt, ihr kleiner Bruder Tammo sie dagegen angestarrt, als habe sie den Verstand verloren. »Weiber!«, hatte er nur geschimpft und war mit Sören hinausgegangen, um seinen Reisesarg zu packen.
Nun ließ sich Alisa von Bergit die Häkchen und Verschnürungen schließen und sah zufrieden an sich herab. Ja, jetzt konnte sie gehen. So würde sie vor seinem kritischen Blick bestehen. Hoffentlich. Waren die Hamburger Schneider so gut wie die in Wien? Ihr kamen Zweifel. Dame Elina war nicht gerade für ihren guten Geschmack bekannt. Die Mode der Menschen ließ sie völlig kalt. Vielleicht sollte sich Alisa hier in London neu einkleiden lassen?
Mit diesen Gedanken beschäftigt, verließ sie ihre Kammer. Hindrik, Sören und Tammo warteten bereits im Flur und stiegen vor ihr die Treppe in den Hof hinunter. Alisa warf ihnen einen kritischen Blick zu. Sören sah gut aus, Tammos Erscheinung konnte man dagegen gerade noch so durchgehen lassen. Er hatte sich nicht die Mühe gemacht, sich umzuziehen.
»Mal sehen, ob Fernand und Joanne schon angekommen sind«, meinte Tammo mit einem Strahlen im Gesicht.
Alisa lächelte zurück. Die Freundschaft mit den Pyras aus Paris hatte sich die Jahre über gefestigt, so wie die ihre mit Luciano, Ivy und Leo. Leo– sie hatten sich so lange nicht mehr gesehen. Eine Ewigkeit. Die Zeit in Wien schien auf einmal so weit weg und verschwommen wie ein schöner Traum. Sie sah sein Gesicht vor sich. Er lächelte. Rasch schob sie den Gedanken an ihn beiseite. Es machte sie zu nervös, und Hindrik beobachtete sie schon wieder mit diesem wissenden Lächeln. Stattdessen bemühte sie sich, ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Hof zu richten, den sie gerade durchschritten. Die vierstöckigen Häuser, die ihn umschlossen, waren aus roten Ziegeln erbaut, die der Londoner Ruß aus seinen zahllosen Kaminen dunkel gefärbt hatte. Auch die steinernen Verzierungen um Fenster und Türen, die einst weiß gewesen sein mochten, waren nun düster und grau. Die Gebäude formten ein Trapez, das an seiner Ostflanke von einer Gasse durchbrochen wurde. Und in der nordwestlichen Ecke entdeckte Alisa einen weiteren schmalen Durchgang.
Sie folgte den anderen, die in die Gasse nach Süden einbogen und dann den Hof mit dem Brunnen betraten, den sie von ihrem Fenster aus bereits gesehen hatte. Das Haus auf der Südseite, dessen Ziegel fast schwarz waren, wirkte mit seinen hohen, verzierten Fenstern, dem Dachreiter und dem Turm über dem Eingangstor ein wenig wie eine Kirche. Doch Hindrik stieg, ohne zu zucken, die Stufen hinauf und trat durch die geöffnete Gittertür. Was war das für ein goldenes Zeichen über der Tür? Ein Tier? Das Gleiche auf der schmiedeeisernen Tür. Und auch der Schlussstein des Gewölbes, über dem der Turm aufragte, war mit einer kleinen Skulptur verziert. Alisa verrenkte sich den Kopf. Ein Schaf oder ein Lamm, das eine Fahne trug. Nein, es war ein Kreuz mit einer Fahne, und es sah so aus, als würde es das Schaf durchbohren. Alisa runzelte die Stirn. Ein Agnus Dei? Täuschte sie sich? Nein, aber wie war das möglich? Sie griff nach Hindriks Arm.
»Was hältst du davon?«
Nun, da er es erkannte, zuckte er doch. Dann schüttelte er verwirrt den Kopf. »Die Vyrad schmücken ihr Gebäude mit dem Lamm Gottes? Seltsam! Ich habe ja davon gehört, dass die Londoner exzentrisch sind. Aber so exzentrisch?«
»Eine Kirche war das Gebäude hier aber nie«, behauptete Alisa. »Es müsste sonst eine deutlich stärkere Ausstrahlung haben, selbst wenn es seit Jahrhunderten nicht mehr für Gottesdienste benutzt wird.«
Hindrik nickte. »Und dennoch spüre ich etwas, was mir nicht ganz behagt.«
Es war Sören, der den rechten Hinweis zur Lösung des Rätsels gab. Er trat neben Alisa und Hindrik und folgte ihrem Blick zu dem goldenen Lamm, auf das die Rippen des Kreuzgewölbes zuliefen.
»Jetzt verstehe ich, warum die Vyrad von der Middle Temple Hall sprechen.«
»Natürlich, es ist das Symbol der Tempelritter.« Alisa schlug sich an die Stirn. Es ärgerte sie ein wenig, dass sie den Zusammenhang nicht selbst erkannt hatte. »Hier muss der Orden im Mittelalter seine Londoner Niederlassung gehabt haben, bis der französische König mit Hilfe des Papstes den Orden unter fadenscheinigen Anklagen vernichtet hat.«
»Ja, wir wissen, dass du in der Geschichte der Menschheit bewandert bist«, kommentierte Tammo mit genervter Miene.
Alisa zuckte mit den Schultern. »Es schadet nichts, wenn du auch noch etwas lernst«, gab sie zurück und wandte sich wieder an Hindrik. »Das Gebäude gehörte also den Templern, die, obwohl sie wie Ritter kämpften und mit dem Schwert die Pilger zu den heiligen Stätten beschützten, auch als katholischer Orden galten. Sie lebten wie Mönche keusch im Zölibat, weshalb ihre Kommenden Klöstern gleichen. Das ist es, was dir Unbehagen bereitet.«
Hindrik nickte, während Sören einwarf: »Im Zölibat vielleicht, aber keusch? Das möchte ich bezweifeln.«
Sie traten durch das schwere Tor, neben dem zwei Vyrad in dunklen Uniformen mit blanken Goldknöpfen standen, die sich stumm vor ihnen verbeugten. Die beiden Unreinen wiesen ihnen den Weg den Gang entlang durch die offene Tür in der rechten Wand. Neugierig traten die Vamalia ein.
Es war ein beeindruckender Raum, zweifellos. Etwas Ähnliches hatte Alisa noch nie gesehen. Entfernt erinnerte die Halle mit den farbigen Glasfenstern und der hohen gewölbten Decke an ein Kirchenschiff und doch war die Wirkung eine andere, denn nicht nur die Wände waren bis auf halbe Höhe mit dunklem Holz verkleidet, das bunte Wappen zierten. Auch die Decke war ganz aus Holz, eine Konstruktion aus verschieden großen Kassetten– eingelassen zwischen Stegen und kunstvoll gedrechselten Bögen–, die zusammen den Eindruck eines Gewölbes erweckten. Vor der hinteren Wand stand– auf einem Podest ein wenig erhöht– ein Tisch mit einem Dutzend samtbezogener Stühle, deren hohe Lehnen ebenfalls kunstvolle Schnitzereien zierten. Wesentlich einfacher gehalten waren die zahlreichen weiteren Stühle um vier lange Tische, die den Rest des großen Saals nahezu ausfüllten. In der Mitte öffnete sich ein breiter Gang, den Alisa nun mit bewunderndem Blick entlangschritt. Dieser Saal war nicht verspielt oder reich mit Stuck und Gold dekoriert wie die Galerie im Palais Coburg bei den Dracas, aber nicht minder prächtig. »Ehrwürdig« war das Wort, das die Ausstrahlung am besten beschrieb.
»Alisa!«
Lucianos Stimme ließ sie herumfahren. Strahlend eilte sie ihm entgegen und umarmte den Freund.
»Wie schön, dass ihr da seid«, rief sie und drückte ihn gleich noch einmal. Anders als letztes Jahr schien es ihn dieses Mal nicht verlegen zu machen. Ja, sie spürte sogar so etwas wie Erleichterung. Er erwiderte die Umarmung. Dann schob er sie von sich und setzte eine entrüstete Miene auf.
»Alisa, du versuchst doch nicht etwa, meine Gedanken zu lesen?«
Die Vamalia kicherte. »Huch. Das wird mir langsam zur Gewohnheit. Ich habe den ganzen Sommer über geübt, und glaube mir, es waren nicht nur schöne Dinge, die ich erfahren habe!«
»Dann lass es doch einfach«, schlug Luciano vor, erntete dafür aber nur einen vorwurfsvollen Blick.
»Nachdem wir es nun endlich können? Niemals. Aber noch mehr Zeit habe ich darauf verwendet, meine Gedanken vor anderen zu verschließen! Es geht keinen etwas an, was ich denke. Los, versuche, ob du mir auch nur einen Gedankenfetzen entreißen kannst!«
Luciano wehrte mit einem schiefen Lächeln ab. »Vielleicht später.«
Er wandte sich kurz um. Hinter ihm waren seine Cousine Chiara und sein Cousin Maurizio eingetreten, um dessen Beine wie üblich sein Kater Ottavio strich und aufmerksam nach Beute Ausschau hielt. So fett wie er geworden war, fragte sich Alisa allerdings, wie viel Jagderfolg er noch haben konnte. Ein Kichern stieg in ihr auf, als sie merkte, dass diese Bemerkung sowohl auf den Kater als auch auf seinen Herrn zutraf.
Chiara dagegen sah wie üblich umwerfend aus. Sie verstand es, ihre feine weiße Haut, die weichen Gesichtszüge und das dichte schwarze Haar perfekt zur Geltung zu bringen. Alisa beneidete sie nicht zum ersten Mal um ihre üppig weiblichen Formen, die die Nosferas schamlos zur Schau trug.
Wer hat, der darf es auch zeigen, erklang eine amüsierte Stimme in Alisas Kopf. Was nützt uns falsche Bescheidenheit? Und wolltest du nicht üben, deinen Geist zu verschließen?
Ah, da hatte noch jemand die Fähigkeiten der Dracas trainiert. Die beiden Vampirinnen begrüßten einander freundlich.
»Du hast dich aber auch gut gemacht und könntest deine weiblichen Vorzüge noch besser präsentieren«, meinte Chiara großzügig. »Wenn du möchtest, kann ich dir zeigen wie.«
Alisa dankte und nahm sich vor, die Ratschläge auf alle Fälle anzuhören. Dann konnte sie ja immer noch entscheiden, ob sie so viel Dekolleté zeigen mochte wie die Nosferas.
Doch schon galt Chiaras Blick nur noch Sören, der strahlend auf sie zuging und sie mit Komplimenten überschüttete. Chiara fühlte sich sichtlich geschmeichelt und ließ es zu, dass er sie umarmte, bevor sie ihn fragen konnte, wie er diesen schrecklich langen Sommer ohne sie verbracht hatte.
Eine Welle starker Gefühle, die sie von Luciano empfing, ließ Alisa ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Tür richten, durch die die Schatten der Nosferas eintraten. Zu der schmächtigen Leonarda, die Chiara diente, gesellten sich Maurizios Schatten Pietro und Dario, der einst dem Clanführer Giuseppe gedient hatte und seit Francescos Vernichtung in Irland Luciano zur Verfügung stand. So hatte der Conte entschieden, obgleich sich Luciano noch immer dagegen wehrte, Francesco zu ersetzen. Er hatte mehr an seinem Schatten gehangen, als er zuzugeben bereit war, und vielleicht fühlte er sich auch ein wenig an seiner Vernichtung mitschuldig.