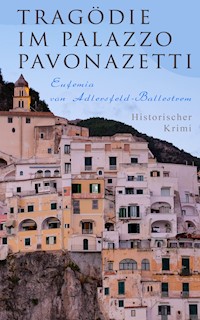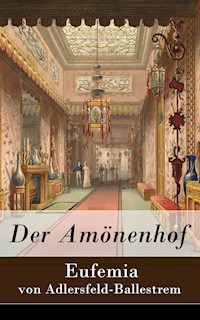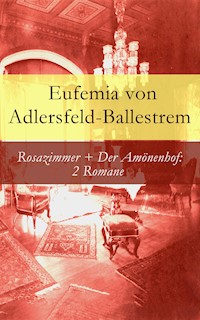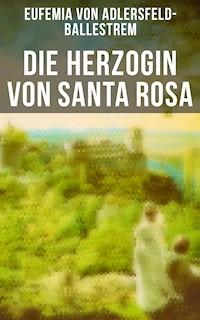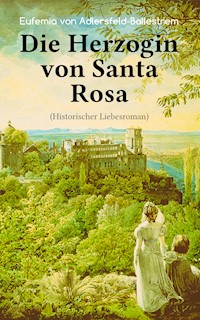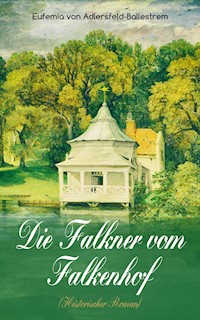Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In 'Die Erbin von Lohberg' von Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem wird die Geschichte von Agnes erzählt, einer jungen Frau, die nach dem Tod ihres Vaters das Schloss Lohberg erbt und sich mit den Herausforderungen der Verwaltung und den Intrigen ihrer Verwandtschaft auseinandersetzen muss. Das Buch zeichnet sich durch seinen detailreichen Schreibstil und die detaillierte Darstellung des gesellschaftlichen Lebens im 19. Jahrhundert aus. Adlersfeld-Ballestrems Werk wird oft als Paradebeispiel für den Adelsroman der Jahrhundertwende angesehen. Die Erbin von Lohberg ist ein fesselndes Werk, das sowohl Liebhaber historischer Romane als auch Interessierte an der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts begeistern wird. Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem, eine Autorin des späten 19. Jahrhunderts, war selbst Mitglied des Adels und schöpfte aus ihren eigenen Erfahrungen, um die Welt von Lohberg zum Leben zu erwecken. Ihr Werk reflektiert die gesellschaftlichen Normen und Werte ihrer Zeit und bietet einen faszinierenden Einblick in die Welt des deutschen Adels im 19. Jahrhundert. 'Die Erbin von Lohberg' ist ein Meisterwerk der deutschen Literatur, das sowohl unterhaltsam als auch informativ ist und Leser jeden Alters ansprechen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Erbin von Lohberg
Inhaltsverzeichnis
1
Doktor Franz Xaver Windmüller saß an einem schönen Sommernachmittag in einem Berliner Hotel in seinem Zimmer und betrachtete mit liebevollem Interesse eine alte Kassette, die vor ihm auf dem Tische stand. Wer ihn und seines Namens Bedeutung nicht kannte, hätte den schlanken, großen, älteren Herrn mit dem feinen Gesicht für einen der vielen harmlosen Altertumssammler gehalten, deren Horizont mit einem babylonischen Backstein beginnt und mit einem Empiremöbel endet, – aber das wäre ein Fehlschluß gewesen. Doktor Franz Xaver Windmüller war zwar wirklich ein hervorragender Kenner von Altertümern, von Beruf jedoch ein prominenter Detektiv, dessen Ruf über die Grenzen Europas hinausreichte.
Alle, die nur oberflächlich von ihm gehört hatten und danach seine Laufbahn für die eines »vor die Hunde gegangenen« Juristen hielten, waren mit ihrem Urteil im Unrecht. Doktor Windmüller war, als er seinen Beruf entdeckte, ein ziemlich wohlhabender Mann am Beginn einer vielversprechenden juristischen Laufbahn. Heute aber war er durch wichtige Dienste, die er gekrönten und ungekrönten Häuptern erwiesen hatte, ein reicher Mann. Seine feine, universelle Bildung sicherte ihm zudem einen Platz in der besten Gesellschaft. Dennoch hatte er sich von seinem Beruf nicht zurückgezogen; er stand allen, die seiner Hilfe bedurften, gern zur Verfügung.
Doktor Windmüller kam eben von einer Reise zurück, die ihn für etwa vierzehn Tage nach England geführt hatte. Diese kurze Zeit hatte genügt, ihn ein Rätsel lösen zu lassen, das die höchsten Personen des Inselreiches geängstigt, bestürzt und in Aufregung versetzt hatte, und reich an Ehren, klingendem Lohn und mehreren nebenbei erworbenen »Perlen« für seine Sammlungen, befand er sich auf dem Heimweg nach seinem römischen Tuskulum. Dort, in seiner Villa am Fuß des Janikulus, wollte er in Ruhe neue Aufgaben erwarten. Da er aber nur dann hastig zu reisen pflegte, wenn es nötig war, so hatte er in Berlin haltgemacht, um einige Konzerte und Opern zu hören.
Heute, an diesem schönen Sommernachmittag, war er friedlich in die Bewunderung seiner letzten Erwerbung versunken, da ihn die Oper nicht vor Abend rief. Am folgenden Tag gedachte er nach Rom abzureisen.
Die Kassette, die vor ihm auf dem Tische stand, hatte er in London aufgegabelt, mehr zufällig, als mit Spürsinn, so im Vorübergehen in einer durchaus nicht eleganten Stadtgegend. Wie sich dieser kostbare Gegenstand dorthin, in den Laden eines gewöhnlichen Trödlers, verirrt hatte, war ein Rätsel. Diese Kassette, in ihrem Innern groß genug, um einen kleineren Briefbogen ungefaltet aufnehmen zu können, war von Ebenholz, mit glatten, aber mit reicher Goldintarsia verzierten Wänden, die an den vier Ecken in schön gegliederte Nischen ausluden, in denen reizend geschnitzte Elfenbeinfigürchen standen, Allegorien der Kunst, Wissenschaft, Gerechtigkeit und Weisheit. Der Deckel, hoch gewölbt, war oben abgeplattet und trug als Krönung die wunderbar schön in Elfenbein geschnitzte Porträtstatuette der Königin Anna Stuart von England. In juwelengeziertem, weitbauschigem Staatsgewand, die Krone auf dem lockigen Haupt von minutiöser Porträtähnlichkeit, stand sie auf der Kassette, ein Meisterstück ihres geduldigen Künstlers, unversehrt von den Einflüssen zweier Jahrhunderte. Doktor Windmüller fuhr liebevoll mit einem weichen Bürstchen über das hübsche Gesicht des Figürchens und schlug dann den Deckel zurück. Das Innere des Kastens war mit purpurrotem Sammet ausgeschlagen; der Deckel war nicht ausgehöhlt, sondern massiv und trug auf seiner inneren, ebenen Fläche eine runde, vergoldete Metallplatte mit der Inschrift:
»Anna D. G. Angliae, Scotiae, Hibemiae et Francaise Regina, &. &,, Inaugurata XXIII. Die Aprilis 1711.«
Offenbar war diese Kassette ein königliches Geschenk gewesen; das bewies die Kostbarkeit des Materials, die künstlerische Ausführung und vor allem die Widmung auf der vergoldeten Platte, die so dick war, daß schlanke Finger sie fassen konnten. Ein kostbares Geschenk jedenfalls, und heute für eine lächerlich kleine Summe erstanden in einem Trödlerladen beinahe letzter Güte, dessen Inhaber keine Ahnung hatte von dem Wert des Gegenstandes. Oder doch? – Windmüller erinnerte sich, wie der nicht sehr saubere Trödler den Handel mit einer gewissen lässigen Hast betrieben hatte, – war die Kassette gestohlenes Gut und der Mann der Hehler? Möglich war das schon, aber trotz seines Schmutzes hatte der Mann auf Windmüller keinen schlechten Eindruck gemacht, und er verstand sich doch auf solche Gesichter. Allerdings hatte er seine Gedanken damals gerade ganz anderswo gehabt – – nun, vielleicht fanden sich in der Zukunft Mußestunden, den Spuren dieser Kassette nachzuforschen; ja, eine Ahnung, als könnten diese Stunden sich zu Tagen ausdehnen, wollte sich Windmüller fast aufdrängen, als er so vor seinem neuesten Schatze saß und ihn liebevoll betrachtete: denn das wäre doch kein richtiger Sammler, dem es nicht einfiele, Geschichten um seine Besitztümer zu spinnen und über ihr »woher« nachzugrübeln. Ohne das blieben es ja nur tote Dinge, und alles, was den Menschen überdauert, lebt –
In diese halb harmlosen, halb aber doch wieder vom Mißtrauen des Kriminalisten erfüllten Betrachtungen klopfte es an der Tür, und ein Diener meldete, daß ein Herr den Herrn Doktor zu sprechen wünsche.
»Ich glaube Ihnen ganz deutlich gesagt zu haben, daß ich für Leute, die ihren Namen nicht nennen, unter keinen Umständen zu sprechen bin«, sagte Windmüller nachdrücklich.
»Ein sehr richtiges Prinzip, das auch das meine ist«, ließ sich hinter der Tür eine Stimme vernehmen, bei deren Klang Windmüller aufsprang.
»Sie, Exzellenz?« rief er überrascht und erfreut, indem er dem Besuch entgegenging. Es war der Gesandte am römischen Hofe, Herr von Grünholz, eine stattliche, vornehme Erscheinung. »Ja«, fuhr er herzlich fort, »das ist eine Überraschung! Offiziell sind wir beide in Rom und treffen uns in einer Berliner Karawanserei.«
»Verzeihung – offiziell habe ich eben meinen Sommerurlaub angetreten«, erwiderte der Gesandte, indem er behaglich Platz nahm. »Eine Nebensächlichkeit, die Ihnen entgangen ist, lieber Doktor, weil Sie – hm – anderweitig beschäftigt waren. Übrigens meinen Glückwunsch zu den neuen Lorbeeren in Ihrem Ruhmeskranz!«
»Nicht der Rede wert, Exzellenz! Die Sache war einfach genug – den Kopf hat sie mir nicht zerbrochen.«
»Nun ja – dazu gehört bei Ihnen vielleicht mehr, aber – ich freue mich, Sie heil hier sitzen zu sehen, sehr freue ich mich. Und wie es scheint, haben Sie dabei Zeit gefunden, Ihre Sammlung zu bereichern«, meinte Herr von Grünholz, indem er auf den Kasten deutete.
»Ja, so im Vorübergehen; denn viel Zeit für mich hatte ich nicht, und nach Erledigung meiner Aufgabe war es gut, den Ärmelkanal zwischen mich und eine mir liebevoll gesinnte Person zu legen«, sagte Windmüller lachend. »Ein schönes Stück, nicht? Reinstes Queen-Anne-Barock. Sehen und kaufen war eins!«
»Herrliche Arbeit. Mag ein nettes Sümmchen gekostet haben!«
»Nein – nur zwölf Pfund Sterling. Das ist eine so lächerlich kleine Summe, daß sie eigentlich höchst verdächtig scheint.«
»Allerdings, in Anbetracht des wirklichen und des ideellen Kunstwertes – ja. Glück muß der Sammler eben haben. Aber um nun auf den Zweck meines Besuches zu kommen: Haben Sie Zeit, lieber Doktor, das heißt, sind Sie im Augenblick frei?«
Windmüller sah den Gesandten mit seinen scharfen, klugen Augen prüfend an. »Haben Exzellenz einen Auftrag für mich?«
»Ich möchte Sie gern entführen, um Ihrem Sammlerherzen ein Vergnügen zu bereiten und um Ihren Rat zu hören über den Wert eines Konglomerats von wild durcheinandergeworfenen Dingen, welches den stolzen Namen einer Sammlung führt«, erwiderte der Gesandte liebenswürdig. »Erst kürzlich sagte ich beim Anblick dieses feudalen Sammelkrams: Hier müßte Windmüller her, um die Spreu vom Weizen zu scheiden, und heute erfuhr ich zufällig von meinem britischen Kollegen, daß Sie hier sind. Da habe ich die Gelegenheit denn gleich beim Schopf gefaßt und Sie aufgesucht in der stillen Hoffnung, daß ich Sie in der Kunstpause zwischen zwei Fällen treffe.«
»Das trifft zu, Exzellenz, indes –«
»Oh, ich will Sie nicht blindlings einfangen, lieber Doktor, bewahre!« fiel Herr von Grünholz ein. »Hören Sie mich an und entscheiden Sie sich dann. Aber ich muß zum besseren Verständnis etwas ausholen, und Ihre Zeit ist vielleicht schon besetzt.«
»Ich hatte vor, die Vorstellung der ›Walküre‹ zu besuchen, mithin bleibt uns noch reichlich Zeit. Aber selbst die zu erwartenden musikalischen Genüsse dürften kaum interessanter sein als das, was Exzellenz mir erzählen wollen«, erwiderte Windmüller lächelnd.
»Ah – Sie wittern einen neuen Fall!« rief der Gesandte mit einer abwehrenden Handbewegung. »Nichts da, lieber Doktor! Keine verschwundenen Dokumente oder Juwelen, kein rätselhafter Todesfall, keine widerrechtliche Beraubung persönlicher Freiheit, kein auf leisen Sohlen herumschleichender Meuchelmörder, kein diplomatisches Mysterium – nichts, als ein wenig Familiengeschichte und – eine Antiquitätensammlung!«
»Ah!« machte Windmüller mit vertieftem Lächeln. »Um so interessanter! Nehmen Exzellenz eine Zigarre? Leicht, sehr leicht und fein – hier ist Feuer – so, und nun bin ich ganz Ohr. Familiengeschichten haben großen Reiz für mich.«
»Das nahm ich an«, versetzte der Gesandte, ebenfalls lächelnd. Beide Herren hatten sich im Lauf der Jahre ganz gut verstehen gelernt. »Doch vor allem: Sie haben doch keine neugierige Nachbarschaft? Denn wenn es ja auch keine Staatsgeheimnisse sind, die ich Ihnen erzählen will – auch Familienangelegenheiten sind für fremde Ohren nicht berechnet.«
»Ich habe hier nur einen Nachbarraum, mein Schlafzimmer, da dieser sogenannte Salon ein Eckzimmer ist«, erklärte Windmüller. »Das in diesem Hotel eingeführte System der Doppeltüren habe ich immer als sehr ruhefördernd empfunden und ungünstig für den Horcher am Schlüsselloch. Kamine, die freundlich den Schall nach oben oder nach unten tragen, gibt es hier auch nicht – wir sind also ganz ungestört und unbelauscht.«
»Sehr gut«, nickte der Gesandte, »man wird in meinem – unsern Berufen mißtrauisch und wittert überall Späher und Lauscher, selbst bei den harmlosesten Dingen. Ja, lieber Doktor, wie Sie mich hier sehen, lasten nicht nur die Sorgen des Staates auf mir, sondern auch eine Vormundschaft, und, da ich ein Mensch bin, der nicht gewohnt ist, etwas auf die leichte Achsel zu nehmen, so fasse ich auch die Last dieser neuen Würde ernst auf. Dazu ist mein Mündel die Erbin von Lohberg – der Name ist Ihnen vielleicht bekannt?«
»Lohberg! Lohberg!« wiederholte Windmüller sinnend. »Gab es nicht einmal einen Grafen Lohberg bei der Garde du Corps?«
»Ganz recht – das war mein Vetter, der Vater meines Mündels. Der letzte Besitzer der Herrschaft Lohberg, sein Vater war mein Onkel; mit dem ist das Geschlecht im Mannesstamm erloschen. Ein altes Geschlecht, aber ein wenig dekadent, wie das so bei diesen absterbenden Stämmen zu gehen pflegt, und den Rest gab ihm meine Tante durch den Keim der Schwindsucht, der sie erlag, nachdem sie dem Erben das Leben, aber nur eine kurze Lebensspanne gegeben hatte. Wenn Sie jemals meinen Vetter gesehen haben, dann kennen Sie das ganze Geschlecht der Lohberger: hünenhafte Gestalt, leuchtend goldrotes Haar, schwarze Augen unter dunklen, über der Nase zusammengewachsenen Augenbrauen und dann das berühmte Sippenzeichen, ein halbmondförmiges Muttermal, das jeder von ihnen im Gesicht trägt und ihn so kennzeichnet, wie den Galeerensträfling das Brandmal. Dafür gibt es natürlich eine Familienlegende, die bis in graue Zeiten zurückgeführt wird. Jener Magnus Lohberg von der Garde du Corps war also der letzte männliche Sproß des alten Stammes, und seine kurze Pilgerfahrt auf dieser Erde war nicht eben mit Glorienschimmer umgeben. Der gute Magnus konnte ein Lied singen von Weibern und Schulden, aber er hatte die gute, oder, wenn man will, fatale Gabe, daß man ihm nicht gram sein konnte; selbst der grimmigste seiner Manichäer mußte im persönlichen Verkehr mit ihm lächelnd die Waffen vor ihm strecken. Er war mit einem Wort von bestechender Liebenswürdigkeit, aber nicht wie ein Gassenengel, sondern immer und ohne Phrase. Er konnte nicht anders, und die Leute haben das auch wacker ausgenutzt. Nach mehreren kleinen Skandälchen, unter denen eine Affäre mit einer Kunstreiterin, der ihrerzeit sehr gefeierten Miß Titania, meinen Onkel besonders in Aufregung versetzte, da er sie allen Ernstes heiraten wollte, beging Magnus seinen dümmsten Streich: er heiratete eine andere. Verstehen Sie mich recht, Doktor, ich will damit nicht etwa sagen, daß das Heiraten an sich ein dummer Streich ist, bewahre! Bei mir war's der klügste meines Lebens, wie Sie sehr gut wissen, – in Magnus Lohbergs Fall war es nur die Wahl, die ich damit kennzeichnen wollte. Sein Vater hatte es nach der Geschichte mit der Kunstreiterin durchgesetzt, daß er als Militär-Attache zur Botschaft nach London versetzt wurde, und dort setzte Magnus es durch, in gleicher Eigenschaft zur Botschaft nach Wien kommandiert zu werden. Dort verheiratete er sich mit der unbestrittenen Schönheit der Hofgesellschaft, Komtesse Olga Jachenau, Tochter eines der Generaladjutanten, der nichts als Schulden hinterließ. Nun, Olga Jachenau war wirklich sehr schön, aber kalt, hochmütig und eitel wie ein Pfau, von einer Anmaßung ohnegleichen und – skrupellos. Aber sie blendete, wen sie blenden wollte, nur nicht meinen Onkel, der sie vollständig richtig bewertete, wie sein Verhalten später bewies. Denn als Magnus nach kaum fünfjähriger, reichlich stürmischer Ehe gleich seiner Mutter an der Schwindsucht starb, nahm der alte Herr das einzige Kind aus dieser wenig harmonischen Verbindung zu sich, das heißt, er kaufte das Mädchen der Mutter, die sich gar nicht um das arme Kind kümmerte, für eine erhöhte Jahresrente ab, eine schöne Summe, die der Witwe vertragsmäßig für des Gebers Lebenszeit und die ihrer Tochter zugesichert wurde. Dafür behielt sich der Großvater die Erziehung seiner Enkelin allein und unbeschränkt vor mit allen Rechten, die eine Mutter sonst hat. Das war ein Segen für das Kind; Gräfin Lohberg, der es bei ihrem Leben in der großen Welt einfach nur im Wege war, ging mit Freuden auf den Vorschlag ein; die kleine Leonore kam in eine reine, gesunde Lebensluft und wurde, unterstützt durch eine sorgsame, vortreffliche Erziehung, ihres Großvaters unentbehrlicher Liebling. Nach längerem Wittum entschloß sich Gräfin Lohberg zu einer zweiten Ehe; sie vermählte sich vor etwa vier Jahren mit einem Herrn von Ellbach, einer jener problematischen Existenzen, von denen man zu sagen pflegt, daß sie wie die Lilien des Feldes sind, die nicht spinnen und nicht ernten und die der Himmel doch ernährt. Dieser Mensch, der übrigens aus ganz guter, aber verarmter Familie ist, besaß die Gabe, sich seinen Kreisen fast unentbehrlich zu machen. Er war eine jener Drohnen, wie sie eben in der Welt, in der man sich nicht gern langweilt, herumzuschwirren pflegen. Auch er war Witwer, als die stolze, wählerische Gräfin Lohberg seinem Werben Gehör gab. Ein paar Jahre vor der Vermählung meines Vetters Magnus war es ihm gelungen, die Neigung eines liebenswürdigen Mädchens, der Tochter meines alten Freundes und Gönners von Aschau, der aber damals schon tot war, zu gewinnen und sie sehr gegen den Willen ihrer Mutter zu heiraten. Sie entfloh der Pein eines Lebens an der Seite eines Ellbachs früh durch den Tod, der sie jedenfalls vor noch größeren Enttäuschungen bewahrte. Einen Sohn aus dieser Ehe überließ der Vater gern bedingungslos der Obhut seiner Schwiegermutter. Der Junge soll ganz brav geworden sein, hat Gymnasium und Universität absolviert und ist jetzt Attaché bei der Gesandtschaft in Tokio. Kinder aus der zweiten Ehe seines Vaters sind nicht vorhanden.
Das wären also die Familienverhältnisse. Um nun zu meinem Mündel Leonore Lohberg zu kommen, so kann nur gesagt werden, daß das junge Mädchen unter der liebevollen Obhut ihres Großvaters sich zu einer sehr schönen jungen Dame entwickelt hat. Die Mutter besuchte alle Jahre ihre Tochter regelmäßig einmal, langweilte sich in dem einsamen Schloß mit Anstand eine Woche sträflich, und reiste dann, eine Märtyrerin ihrer Mutterpflichten, wieder ab. Leonore stand ihr durch Erziehung und Charakteranlagen zu fern, als daß beide eine Freude an dem Zusammensein haben konnten. Als mein Mündel sein achtzehntes Jahr kaum überschritten hatte, stellten sich bei dem zarten Mädchen die Spuren der schrecklichen Krankheit ein, der ihr Vater so rasch erlegen war, und diese Anzeichen wurden schnell so drohend, daß ein Aufenthalt im Süden dringend geboten schien, um das Schlimmste aufzuhalten. Mein Onkel aber war unfähig, die Reise zu machen; er war ein siecher, alter Mann, dem mancherlei Leiden eine Entfernung von seinem Hause verboten, und da blieb denn nichts anderes übrig, als Leonore der Obhut ihrer Mutter zu übergeben. Mit schwerem Herzen ließ der alte Herr den Sonnenschein seines Herzens mit den Ellbachs ziehen, – die Ahnung, daß er sie nicht wiedersehen würde, sollte leider in Erfüllung gehen. Die Nachrichten über Leonores Gesundheitszustand lauteten anfangs trostlos genug, dann aber trat eine merkliche Besserung ein, die auch anhielt, und als man begründete Hoffnung hatte, daß eine völlige Genesung zu erwarten sei, starb mein guter Onkel daheim verhältnismäßig rasch und unerwartet. Er hinterließ den ganzen großen Besitz seiner Enkelin unter meiner Vormundschaft mit der Bestimmung, daß sie erst mit vierundzwanzig Jahren für großjährig erklärt werden sollte, und daß ihr künftiger Gatte den Namen und Titel eines Grafen von Lohberg anzunehmen habe, wozu die landesherrliche Genehmigung bereits eingeholt war. Frau von Ellbach verbleibt im Genuß ihrer Rente bei Lebzeiten ihrer Tochter, und falls diese unvermählt stirbt, fällt die ganze große Herrschaft ungeteilt an die Nachkommen einer weiblichen Lohbergschen Agnatin. Sollte Frau von Ellbach ihre Tochter überleben, dann erlischt auch ihre Rente; irgendeine Stimme in der Vormundschaft hat sie nicht. Diese Klausel ist laut notarieller Verzichtleistung der Dame, als sie ihre Tochter dem Großvater ›mit allen Rechten‹ abtrat, unanfechtbar und ein Beweis dafür, daß mein Onkel seine Pappenheimer kannte. Nun, die Ellbachs brachten Leonore im vorigen Herbst nach dem Tod ihres Großvaters vernünftigerweise nicht gleich nach Lohberg zurück. Sie sind erst zu Beginn des Sommers heimgekehrt, und da mein Mündel nicht gut allein gelassen werden konnte, sind Herr und Frau von Ellbach zunächst bei ihr geblieben. Dagegen war nichts einzuwenden, da es ja auf den Wunsch der jungen Erbin geschah. Ich selbst habe für die Dauer meines Sommerurlaubs mit meiner Frau meine Zelte auch als Gast meines Mündels in Schloß Lohberg aufgeschlagen, um die Geschäfte einzusehen und mich über alles Nötige zu unterrichten.
Insoweit wäre alles nicht sonderlich erwähnenswert; es ist wohl nur selten eine Familie zu finden, die nicht ihr ›Skelett im Schranke‹ hätte. Das des Hauses Lohberg ist, wie Sie schon herausgehört haben werden, der Ausschluß der Mutter von der Vormundschaft, und in diesem Punkte finde ich eine Lücke. Denn wenn mein Onkel in seinem Mißtrauen gegen seine Schwiegertochter so weit ging, hätte er auch für eine räumliche Trennung sorgen müssen. Statt dessen aber vertraute er das kranke Mädchen der Frau von Ellbach und ihrem zweiten Gatten an und hinterließ auch keine Bestimmung, die dem Paar einen ständigen Aufenthalt auf Schloß Lohberg verboten hätte. Ich schließe daraus, daß das Mißtrauen meines Onkels sich hauptsächlich auf die finanzielle Seite erstreckte; tatsächlich weiß ja auch niemand schlechter zu wirtschaften als Frau von Ellbach, die immer bis über die Ohren in Schulden stecken soll. Damit würde sich auch die verlängerte Minderjährigkeit Leonores erklären: mein Onkel wollte sie vor den ewigen Geldforderungen ihrer Mutter so lange als möglich sicherstellen. Immerhin scheint mir aber der moralische Einfluß Frau von Ellbachs auf ihre Tochter nicht ganz einwandfrei zu sein; denn als Leonore vor ihrer Krankheit noch daheim war – ich habe sie, bevor sie erwachsen war, nur ein- oder zweimal ganz flüchtig gesehen –, soll sie ein harmloses, liebenswürdiges Geschöpf, sanften und heiteren Gemüts, freundlich und liebreich gegen jedermann gewesen sein. So habe ich sie, offen gesagt, nicht wiedergefunden. Sie ist aus dem Süden als eine total Veränderte wiedergekehrt, nicht äußerlich, und doch auch wieder das insofern, als ihre zweifellose Schönheit reifer, aber auch härter geworden ist, was sich ja schließlich mit der Krankheit erklären ließe, die gewiß geeignet war, die Züge zu verschärfen. Aber ihr Wesen hat auch eine Veränderung, und zwar nicht nach der liebenswürdigen Seite, erlitten. Sie stößt jetzt rücksichtslos ihre früheren Freunde ab, tut meist ganz erhaben und unnahbar und glaubt augenscheinlich den Eindruck der vornehmen Gutsherrin dadurch zu steigern, daß sie gelegentlich nach einfachen deutschen Ausdrücken sucht, gleichsam, als wenn die drei Jahre im Ausland ihr die Muttersprache entfremdet hätten. Nun, das letztere mag affektiert sein und sich mit der Zeit schon wieder abschleifen; sie ist ja erst einundzwanzig Jahre alt. Aber geradezu unerfreulich ist das Verhältnis, in welchem sie jetzt zu ihrer Mutter und ihrem Stiefvater zu stehen scheint. Man wandelt in dem früher so friedlichen Lohberg jetzt auf einem vulkanischen Boden permanenter Gereiztheit und trotzdem scheinen die Ellbachs sich dort fest etabliert zu haben. – So, mein lieber Doktor, das wäre wohl alles, was ich zu Ihrer Einführung zu sagen hätte«, schloß der Gesandte.
Windmüller hatte sehr aufmerksam zugehört.
»Und was wünschen Exzellenz, daß ich in Lohberg tun soll?« fragte er nach einer Pause.
»Ich sagte Ihnen schon, daß mein Onkel eine Leidenschaft für Antiquitäten hatte und einen solchen Wust von schönen Sachen und wertlosem Krimskrams zusammengesammelt hat, daß einem das Zeug überall im Wege ist«, erwiderte Herr von Grünholz. »Ich habe meinem Mündel den Vorschlag gemacht, die Sammlung zu einem kleinen Museum zusammenzustellen – Platz genug ist ja dazu in dem Schlosse, in dem ein Regiment Infanterie sich verlieren würde. Natürlich gehört dazu vor allem der Rat eines Kenners, der zunächst die Spreu vom Weizen zu sondern hätte, und dabei habe ich an Sie gedacht. Wenn Sie Zeit und Lust hätten, lieber Doktor, würde ich Sie bitten, mich morgen nach Lohberg zu begleiten. Als ich heute hörte, daß Sie in Berlin seien, telegraphierte ich gleich die willkommene Kunde der Begegnung mit einem archäologischen Freund an mein Mündel mit der Anfrage, ob ich Sie einladen dürfe, und erhielt, ehe ich Sie aufsuchte, die Drahtantwort, daß Sie sehr willkommen sind. Ich hoffe, ein Schloß im Stil Ludwigs XIV., vollgestopft mit Antiquitäten, wird Sie reizen.«
Über das feine Gesicht Windmüllers glitt ein leises Lächeln. »Exzellenz vergessen die Gesellschaft dabei«, sagte er mit einer verbindlichen Verbeugung. »Mein Beruf zwingt mich zum Verkehr mit soviel schlechter Gesellschaft, daß eine gute mich noch viel mehr anzieht als die schönste Antiquitätensammlung. Also, den Köder hätten wir, und der Fisch dazu wäre auch da; aber ich sehe doch noch nicht ganz klar, warum ich anbeißen soll. Der Altertumsnarr Franz Xaver Windmüller wäre untergebracht zur offiziellen Befriedigung der Bewohner von Lohberg und Umgebung, doch was der Detektiv Windmüller dort soll, geht vorläufig noch über meinen Horizont. Oder wäre ich der Erzählung doch nicht genügend gefolgt?«
Herr von Grünholz warf den Rest seiner Zigarre in den Aschenbecher.
»Es gibt Angelegenheiten, zu deren Lösung es einer sehr zarten, feinen Hand bedarf«, sagte er dann, »einer Freundeshand, wie zum Beispiel der Ihrigen. Mit dürren Worten: ich möchte erfahren, was mein Mündel in den drei Jahren ihrer Abwesenheit aus der Heimat erlebt hat.«
»Ah!« machte Windmüller kopfnickend. »Mir scheint, ich bin der so vertraulichen Mitteilung Eurer Exzellenz doch richtig gefolgt.«
»Nun ja, das habe ich vorausgesetzt«, erwiderte der Gesandte. »Damit haben Sie klipp und klar meinen Auftrag, falls solch eine Bagatelle nicht unter Ihrer Würde ist. Meine Motive –«
»Sind sicher wohlbegründet, Exzellenz!«
»Ich nehme es ernst mit meinen vormundschaftlichen Pflichten – das ist mein Leitmotiv. Ich glaube es dem Andenken meines Onkels, den ich geliebt und geehrt habe wie einen Vater, schuldig zu sein, dem Liebling seines Herzens nicht nur ein geschäftsmäßiger Vormund, sondern auch ein väterlicher Freund zu werden, und darum muß ich wissen, was vorgegangen ist, das imstande war, Leonores Wesen so zu verändern. Auf dem Weg des Vertrauens ist diese Kenntnis vorläufig nicht zu erreichen; denn das Mädchen ist ganz unzugänglich, ganz verschlossen. Reinen Wein von der Mutter oder dem Stiefvater zu verlangen, wäre wohl vergebene Liebesmüh'; denn was immer auch vorgefallen ist, vorgefallen sein muß –, die beiden haben ihre Hand darin und damit eine unverkennbare Gewalt über das junge Mädchen erlangt, gegen die es sich ebenso unverkennbar aufzulehnen versucht. Ich würde die Ellbachs selbst mit den vorsichtigsten Fragen nur auf die Hut bringen und nichts erfahren; weniger als nichts!
Es würde wahrscheinlich nur dazu führen, die schwachen Spuren zu verwischen, auf denen ich mit Ihrer Hilfe, lieber Doktor, das vielleicht noch erfahren könnte, was ich wissen möchte. Es muß etwas vorgefallen sein – ihre schwere, jetzt überdies wohl völlig überwundene Krankheit und die Gesellschaft der Ellbachs allein können den Wandel nicht zuwege gebracht haben; denn wenn ich, im Vertrauen gesagt, die Mutter auch für eine unbeherrscht leidenschaftliche, skrupellose Frau halte und ihren Mann für einen mit allen Hunden gehetzten Abenteurer, für einen relativ sogar gefährlichen Menschen, so war Leonore durch ihre Erziehung und Veranlagung doch zu sehr gegen einen moralisch nennenswerten Einfluß von dieser Seite gefeit, als daß drei Jahre imstande gewesen sein könnten, sie total umzumodeln. Übrigens will ich Sie nicht vorweg binden; kommen Sie mit mir, und sehen Sie sich die Leute an. Das ist alles, was ich zunächst von Ihnen erbitten möchte.«
»Nun ja, der Besuch in Lohberg wäre natürlich die Vorbedingung für fernere Schritte«, pflichtete Windmüller bei. »Ich könnte dort vielleicht schon den Schlüssel, jedenfalls gewisse Anhaltspunkte finden, auf deren Basis ich Nachforschungen anstellen könnte; sozusagen den Anfang des Fadens der Ariadne, Verbündete, Zeugen –«
»Mein Mündel war vor seiner Reise eng befreundet mit der jüngsten Tochter des königlichen Oberförsters, dessen Wohnsitz hart an der Grenze des Lohberger Parks liegt. Die Freundinnen haben anfangs miteinander im Briefwechsel gestanden, der jedoch allmählich einschlief oder jäh abbrach, und nach der Rückkehr Leonores hat die Freundschaft durch ihre Haltung einen Stoß erhalten, worüber niemand unglücklicher ist als das junge Mädchen aus der Oberförsterei.«
»Hilfstruppe Nummer eins«, murmelte Windmüller.
»Vielleicht. Fräulein Volkwitz ist harmlos und zutraulich, dabei aber klug. Übrigens habe ich von meinem Mündel zwei Bilder bei mir, die Sie interessieren werden.« Herr von Grünholz zog aus seiner Brusttasche eine Brieftasche, der er ein paar Fotografien entnahm, die er Windmüller reichte. Die erste war das Bildnis eines noch sehr jungen, zarten Mädchens mit aus der Stirn gestrichenem, krausem Blondhaar. Die schöngezeichneten, über der feingebogenen Nase zusammengewachsenen, dunklen Brauen verliehen ihm einen Charakter, der dem sonst noch etwas unfertigen Gesichtchen vielleicht, trotz der großen, sanften, dunklen Augen, gemangelt hätte. Auch das kleine, halbmondförmige Mal rechts über der Oberlippe des süßen Mundes gab dem holden Antlitz eine gewisse Pikanterie, wie ein bizarres Schönheitspflästerchen der koketten Rokokozeit.
»Eine sehr hübsche junge Dame«, murmelte Windmüller mit einem Blick auf die Unterschrift, die quer unter dem Brustbild in flüssigen, aber festen Zügen den Namen »Leonore« trug.
»Dieses Bild sandte mir mein Onkel vor etwa dreieinhalb Jahren«, erklärte der Gesandte. »Das andere hat meine Frau, die eine recht geschickte Fotografin ist, erst vor einigen Tagen gemacht. Es ist ganz vorzüglich gelungen.«
Windmüller stieß beim ersten Blick darauf ein interessiertes »Ah!« aus und betrachtete es neben dem älteren mit dem größten Interesse. Dieselbe Person, dieselbe Kopfstellung, und dennoch beide so verschieden! Das machte auf dem neuen Bild nicht allein die veränderte Frisur, welche das aufgebauschte Haar tief in die Stirn fallen ließ – die Weichheit der zarten Jugend war gänzlich aus den schönen Zügen verschwunden, die schmale Nase trat schärfer hervor, um den vordem so kindlich-süßen Mund zog sich ein harter Zug, die Lippen, dort halb geöffnet, waren hier fest geschlossen, und in den größer gewordenen Augen schien ein verhaltenes Feuer zu lohen – das waren »wissende Augen«, aus denen jede Spur von unschuldiger Kindlichkeit verwischt schien. Dieselbe Hand hatte auch unter dieses Bild den Namen »Leonore« geschrieben, doch in die flüssigen Züge war etwas Eckiges gekommen, das den Graphologen wohl zum Nachdenken angeregt hätte.
Windmüller schien sich von dem Vergleich der beiden Bilder gar nicht trennen zu können, so intensiv wanderte sein Blick von einem zum andern; aber der Gesandte zeigte keine Ungeduld darüber. Er saß in seinen Sessel zurückgelehnt und betrachtete seinerseits den Detektiv mit wachsender Spannung; denn er wußte, daß Windmüller sein Interesse nie an Minderwertiges verschwendete, daß er aus dem Vergleich der beiden Bilder schon mehr gelesen hatte, als sich vermuten ließ.
»Das ist sehr interessant«, sagte er endlich aufsehend. »Ich übernehme den Fall.«
»Ich bin Ihnen dankbar dafür, Doktor«, erwiderte der Gesandte mit einem tiefen Atemzug. »Noch dankbarer würde ich sein, wenn Ihre Nachforschungen ein negatives Resultat ergeben sollten. Ist das veränderte Wesen meines Mündels nur auf seine Umgebung zurückzuführen, dann wäre die Hoffnung vorhanden, den fremden, ungünstigen Einfluß wieder von ihm zu nehmen, sie denen zu entziehen, die anscheinend so ungünstig auf sie einwirken. Dazu habe ich die Macht, die Mittel und den Willen.«
»Gewiß, gewiß«, murmelte Windmüller zerstreut, immer den Blick auf den Bildern. »Aber«, setzte er hinzu, »wird meine Anwesenheit in Lohberg nicht Verdacht erregen, zum mindestens aber Vorurteile wecken? Exzellenz haben mich dort unter meinem Namen bereits eingeführt? Sollte nicht mindestens Herr von Ellbach meinen Beruf kennen?«
»Ich erwähnte Sie allerdings schon als alten Bekannten und Archäologen, doch schien der Name Herrn von Ellbach nichts zu sagen. Wenn ihm später Ihr Name im Zusammenhang mit Ihrem wahren Beruf einfällt, dann können Sie den ›Detektiv‹ immer noch als Namensvetter anerkennen.«
»Das dürfte genügen, und wenn nicht, so muß das eben riskiert werden; gesehen hat Herr von Ellbach mich ja wohl kaum. Übrigens, Exzellenz nannten Herrn von Ellbach vorhin einen gefährlichen Menschen. In welchem Sinne ist er das?«
»Nun, nur in dem allgemeinen, weil Leute, die sozusagen mit allen Hunden gehetzt sind, immer zu den gefährlichen Menschen gehören. Übrigens weiß ich nicht, wie er es bis jetzt fertiggebracht hat, in dem Stil zu leben, der seiner Frau Existenzbedingung ist. Wenn er also keine Schulden gemacht haben sollte, dann – doch das geht mich nichts an.«
»Ich entsinne mich, auf der Universität mit einem Ellbach zusammengewesen zu sein«, sagte Windmüller nachdenklich. »Er studierte, glaube ich, Medizin – ein großer, schlanker Mensch, mit sonderbaren, hellen Augen, die etwas medusenhaft Faszinierendes hatten. Übrigens besaß er gute Manieren, war aber ein ausgesprochener Schmarotzer mit einer starken Neigung zum Okkultismus.«
»Es muß der nämliche gewesen sein; denn auch der Stiefvater meines Mündels hat die von Ihnen erwähnten sonderbaren, hellen Augen; zudem verdankte unser Ellbach seinen Platz in der Gesellschaft und seine relative Beliebtheit vor allem seiner Gabe des Gedankenlesens, spiritistischer Kunststücke, Chiromantie und hypnotischer Experimente, wodurch er die langweiligsten Teeabende zu beleben verstand. Hm – ob er sich Ihrer auch noch entsinnen wird?«
»Sicher, wenn er mein gutes Gedächtnis hat, Exzellenz. Indes, da ich mich damals schon für Altertümer interessierte, läge darin noch keine Gefahr. Das muß eben abgewartet werden.«
Herr von Grünholz kam nun mit Windmüller überein, am nächsten Tag gemeinschaftlich die nur wenige Stunden währende Reise nach Lohberg anzutreten, und als er sich darauf erhob und die beiden noch auf dem Tisch liegenden Bilder wieder an sich nehmen wollte, bat der Detektiv, sie vorläufig noch behalten zu dürfen, was der Besitzer ohne weiteres zugestand, ihn aber sichtlich stutzig machte. Da er aber sehr genau wußte, daß Windmüller nichts ohne guten Grund tat und Erklärungen über sein Tun und Lassen »im Amt« nicht zu geben pflegte, so unterdrückte er die Frage, die ihm auf die Zunge trat, und verabschiedete sich ohne jeden Kommentar.
Als Windmüller dann wieder allein war, holte er aus seinem sorgfältig verschlossenen Koffer ein Vergrößerungsglas hervor, zog die Fenstervorhänge zu, entzündete die Tischlampe und versenkte sich in den Anblick der Amateurfotografie. Als er dann sein Vergrößerungsglas wieder sorgsam verpackte, sah er nachdenklich aus.
»Ich habe es immer gesagt und wiederhole es: der Amateurfotograf ist der unschätzbarste Gehilfe des Detektivs«, murmelte er. »Frau von Grünholz besitzt einen ganz hervorragend guten Apparat mit vorzüglicher Linse; sie versteht nicht nur ihre Bilder gut aufzunehmen, sondern auch gut zu entwickeln. Die andere Fotografie ist neben ihrem Werk einfach Handwerkerarbeit mit zunftmäßigen Retuschen – ganz Schablone. Tja – wenn mich nicht alles täuscht, dürfte die Erbin von Lohberg ein ganz interessanter Fall werden.«
Und nachdem Windmüller die Bilder eingesteckt und seine Kassette wohlverwahrt hatte, begab er sich in die Oper und lauschte den gewaltigen Klängen der »Walküre« mit einer Hingabe, als sei die Musik sein einziger Lebenszweck.
Es war noch früh am Nachmittag des folgenden Tages, als die beiden Herren das kleine Provinzstädtchen erreichten, das die Eisenbahnstation für Schloß Lohberg ist. Vor dem Bahnhof wartete schon der Wagen, der sie die etwa fünf Kilometer weite Strecke zu ihrem Bestimmungsort bringen sollte – eine elegante Viktoria mit Kutscher und Diener in der hechtgrauen Livree mit karminrotem Kragen des gräflichen Hauses. Ein Gepäckwagen war auch zur Stelle, und bald saßen sie in dem bequemen Vehikel und rollten auf der guten Landstraße durch die schöne, warme Sommerluft behaglich ihrem Ziel entgegen. Sie hatten aber kaum das Weichbild des Städtchens erreicht, als eine jugendlich frische Stimme erregt »Halt! Halt!« hinter ihnen dreinrief. Als sie sich umwendeten, sahen sie eine junge Dame dem Wagen im Laufschritt nacheilen – ein kleines, zierliches Figürchen, in dessen hübschem, frischem Gesicht ein Paar große, blaue Augen vor Lebens- und Übermut nur so blitzten.
»Ach, Exzellenz, Sie schickt mir der Himmel!« rief sie atemlos. »Ich war nämlich eben im Begriff, vor Verzweiflung aus der Haut zu fahren und mich heulend auf einen Stein zu setzen!«
»Welches Glück, daß mein bloßer Anblick imstande war, Sie an solch schrecklichem Beginnen zu hindern, mein gnädiges Fräulein«, versicherte der Gesandte lächelnd. »Womit kann ich Ihnen dienen?«
»Ach, es ist aber auch zum Verzweifeln«, war die immer noch atemlose Erwiderung. »Denken Sie bloß, Exzellenz, ich war in die Stadt geradelt, um für Papa einen Dienstbrief aufzugeben, an dem er den ganzen Vormittag im Schweiße seines Angesichts gesessen hat, da kommt mir halbwegs so'n niederträchtiger Nagel ins Hinterrad und ›pffff‹ leer war der Reifen! Ich hatte also die Ehre, den Rest des Weges zu schieben, und als ich das Fahrrad nun dem Radeldoktor bringe, da sagt mir der alte Peter, die Reparatur würde bis morgen dauern! Ich fange also schon an, halb aus der Haut zu fahren bei dem Gedanken, daß ich nun den ganzen Weg zurücklaufen muß, da kommt die Lohberger Galakutsche an mir vorüber, und Sie, Exzellenz, darin in voller Lebensgröße. Hurra, schreit's in mir, der Herr von Grünholz ist so lieb und nett, der nimmt dich gewiß bis zum Park mit! Hat mein Herz mich getäuscht?«
»Ich werde mich hüten, solch ein rührendes Vertrauen zu enttäuschen«, behauptete der Gesandte lachend. »Also steigen Sie nur ein und gestatten Sie mir, Ihnen in diesem Herrn den Professor Windmüller vorstellen zu dürfen. Lieber Professor, Fräulein Volkwitz, die Tochter des königlichen Oberförsters und nächsten Nachbarn von Lohberg.«
»Aha, Sie sind wohl der Herr Onkel, der die Antiquitäten begutachten soll, nicht wahr?« fragte das junge Mädchen, indem sie dem Fremden ihre Hand reichte. »Na, ich wünsche Ihnen Glück zu dieser Herkulesarbeit – an der werden Sie Ihr blaues Wunder erleben!«
Die Pferde zogen an, und weiter ging's im schlanken Trabe auf der glatten Landstraße.
»Nun vor allem – was macht Ihr Herr Vater und Fräulein Schwester?« erkundigte sich Herr von Grünholz bei seiner unerwarteten Reisegefährtin.
»Danke schön – Papa macht, was er immer macht: er lauert auf den Forstmeister«, erwiderte Fräulein Volkwitz lachend.
»Ist das eine ständige Beschäftigung der königlichen Forstbeamten?« fragte Windmüller lächelnd. »Ich dachte, dieser höhere Vorgesetzte erschiene nur ein- oder zweimal im Jahr zur festgesetzten Zeit –«
»Gott sei Dank, ja!« versetzte die junge Dame. »Natürlich meine ich, daß Papa auf seinen Forstmeister lauert, das heißt, auf seine Beförderung zu dieser Würde. Eine sehr anregende, immer in Aufregung haltende Beschäftigung. Schwarz könnte einer darüber werden – Papa aber ist weiß geworden. Manchmal ist es zum Auswachsen langweilig in der Oberförsterei, denn was uns der Himmel jetzt an Forstaspiranten beschert hat, ist auch herzlich wenig unterhaltsam.«
»Nun, dann werden Sie ja froh sein, daß Komtesse Lohberg wieder zurück ist«, meinte Windmüller, dem das ungekünstelte Geplauder der jungen Dame Spaß machte. »Ich nehme wenigstens an, daß Sie bei der nahen Nachbarschaft mit der Gräfin befreundet sind.«
»Ich war's wenigstens, ehe Leonore krank wurde«, nickte sie mit einer Grimasse. »Gott ja, so nahe Nachbarskinder, die den ganzen Tag zusammenhockten, als Kinder, als Backfische, als angehende junge Damen – da denkt man, es muß immer so bleiben. Wenigstens der Teil denkt es, der in seinem stillen Winkel zurückbleibt. Und so wär's auch geblieben, wenn der gute, alte Graf nicht gestorben wäre! Die Augen habe ich mir ausgeheult, als wir ihn verlieren mußten, und Papa ist auch ganz melancholisch geworden, seit er den alten Freund nicht mehr hat. Aber dort kommt, wenn ich mich nicht irre, Ihr Herr Neffe uns entgegengeritten, Exzellenz.«
Und ehe Herr von Grünholz noch eine Antwort geben konnte, war der Reiter schon neben dem Wagen – Rittmeister von Grünholz von den in Kuckucksnest stehenden Ulanen, eine elegante, hübsche Erscheinung.
»Guten Tag, mein lieber Alfred! Wie nett, dich hier so zufällig zu treffen!« rief der Gesandte ihm entgegen. »Mein Neffe, Herr Professor Windmüller. Bist du auf dem Weg nach Lohberg?'
»Nein, Onkel – im königlichen Dienst zu den Schießständen«, erwiderte der Rittmeister. »Und du kommst wohl eben von Berlin zurück? Und Fräulein Fritz ehrsam an deiner Seite, statt hoch zu Rad?«
»Nagel im Reifen«, erklärte sie kurz.
»Na, da kann man dem Nagel eigentlich keinen Vorwurf machen«, neckte der Rittmeister lachend. »Wenn Magneten sich auf Reisen begeben, müssen sie gewärtig sein, daß das Eisen ihnen zufliegt.«
Aber damit kam er schlecht an.
»Schöner Kohl wird hier in der Gegend gebaut, nicht wahr?« fragte Fräulein Volkwitz, zu den Herren im Wagen gewendet.
»Aber, Alfred, mein Junge, was hast du denn verbrochen, daß du so in Ungnade fallen konntest?« rief der Gesandte belustigt.
Über das sonnverbrannte Gesicht des Offiziers flog eine leichte Röte der Verlegenheit, aber schnell drehte er den Spieß um.
»Ungnade würde ich es nennen, wenn Fräulein Fritz meine untertänigsten Bemerkungen ohne Kommentar ließe«, sagte er mit gutmütiger Neckerei.
»Aha!« machte die junge Dame.
»Na«, meinte der Gesandte mit einem prüfenden Blick auf das junge Mädchen, »das scheint ja ein recht lustiger Krieg zwischen Ihnen und meinem Neffen zu sein.«
»Krieg ist ein zu stolzes Wort, Exzellenz – Plänkeleien waren's immer zwischen uns beiden, Vorpostengefechte sind's jetzt«, versetzte sie. »Aber wenn's not tut, will ich auch Schlachten schlagen.«
Nach kurzer Zeit erreichte der Wagen die Lindenallee, die zum Schloß führt. Hier stieg Fritz Volkwitz mit herzlichem Dank für die gewährte Gastfreundschaft aus, um die Oberförsterei auf einem Seitenweg zu Fuß zu erreichen.
Nach wenigen Minuten fuhr der Wagen unter dem weitausladenden Portal des Schlosses vor, und als erste trat zur Begrüßung die noch junge, anmutige Gattin des Gesandten auf die Schwelle und begrüßte ihn mit herzlichem Willkommen und einem gutbürgerlichen Kuß, worauf sie Windmüller als einem alten Bekannten freundlich die Hand reichte. Ihr auf dem Fuß folgte ein älterer, großer, schlanker Herr mit silber-schimmerndem Haar, zu dem seine starken, pechschwarzen Brauen in auffallendem Kontrast standen.
»Ah, Herr von Ellbach! Sie sehen, es ist mir gelungen, meinen Freund, den Professor Windmüller, zu dem Abstecher nach Lohberg zu gewinnen«, sagte der Gesandte mit einer vorstellenden Handbewegung. »Meine Geschäftsreise nach Berlin war ein glücklicher Fischzug; wir trafen uns zufällig im Hotel.«
»Wir sind Ihnen für Ihren freundlichen Besuch sehr zu Dank verpflichtet, Herr Professor«, versicherte Herr von Ellbach verbindlich. »Meine Tochter – ah, da kommt sie gerade mit meiner Frau. »Liebe Olga – Herr Professor Windmüller! Unsere Tochter, Leonore Lohberg.«
Windmüller küßte die ihm etwas herablassend gereichte, schöne und wohlgepflegte Hand der Frau von Ellbach und überflog ihre imposante, stark zur Fülle neigende Gestalt mit einem Blick; die ehemals berühmte Schönheit des Wiener Hofes konnte sich aus einiger Entfernung noch wohl sehen lassen; in nächster Nähe war sie eine durch krampfhafte Restaurierungsanstrengungen gezeitigte Ruine, deren Tünche den Verfall trotz raffinierter Toiletten mehr augenfällig machte, als ihn verdeckte. Der statuenhafte, klassische Schnitt ihrer Züge hatte durch die darauf liegende Schminke etwas maskenhaft Starres bekommen, dem der harte Ausdruck in den an sich schönen Augen kein Leben verleihen konnte. Der geübte Physiognostiker und Psychologe Windmüller hielt das aber für beabsichtigte Indolenz; denn in diesen kalt von oben herabblickenden Augen konnte es augenscheinlich ganz gefährlich aufflackern, wie von verhaltener Leidenschaft und ungezügelter Heftigkeit.
Die junge Erbin von Lohberg glich ganz dem Bild der Amateurkamera. Nur fehlte dem Lichtbild die Farbe, die der lebenden Leonore Lohberg einen Reiz verlieh, der schwer zu schildern ist. Kaum ein Maler wäre imstande gewesen, allein die Pracht ihrer Haare mit ihrem Farbton rötlichen Goldes wiederzugeben, dessen leuchtender Glanz niemals auf künstlichem Wege zu erreichen ist. Mit dieser seltenen Farbe stimmte das milchartige, aber durchsichtige Weiß ihrer Haut wunderbar zusammen, die Wangen wurden nur in der Erregung rosig überhaucht, wie das Innere einer Malmaisonrose, und auch der liebliche Mund war nicht eigentlich rot, sondern vom zartesten Inkarnat. Ob Leonore Lohberg trotz ihrer Vorzüge wirklich schön im engeren Sinne des Wortes war, wäre vielleicht zu bestreiten gewesen; aber die auffallende Pikanterie, die im Gegensatz ihrer tiefdunklen, großen Augen mit den über der feingebogenen Nase zusammengewachsenen Augenbrauen und dem bizarren Mal über der Oberlippe zu der lichten Fülle ihrer Haare lag, machte, daß man sie selbst neben einer tadellosen klassischen Schönheit sicher nicht übersehen hätte. Ihre Gestalt war leicht über Mittelgröße, schlank und biegsam, aber fast überzart gebaut; sie hielt sich aber gut und mit Grazie und schien dadurch größer, als sie wirklich war.
Windmüller besaß eine sensitive Natur. Die großen, dunklen, unergründlichen Augen seiner jungen Wirtin erregten seine Einbildungskraft. Die Augen einer Sphinx waren das, aber nicht die eines wohlbehüteten jungen Mädchens.
»Willkommen, Herr Professor«, war das einzige, was Leonore mit leiser, tiefer, melodischer Stimme sagte, indem sie dem Gast die Hand reichte, eine kühle, überschlanke weiße Hand mit langen Fingern, die dann nervös mit den Spitzen um die zarten Handgelenke spielten.
Die scharf markierte, sozusagen dick unterstrichene Art und Weise, mit welcher der Gesandte die junge Dame als Herrin des Hauses in den Vordergrund schob, blieb von Windmüller nicht unbemerkt.
Es war dies nicht nur ein Zeichen von Takt und das Bestreben, die junge Herrin dieses Hauses auf ihrem Platz sicher zu machen, sondern anscheinend auch eine wohlberechnete Zurückweisung etwaiger Herrschergelüste des Ellbachschen Ehepaares. Ohne die Höflichkeit des Weltmannes der älteren Dame gegenüber auch nur für einen Augenblick außer acht zu lassen, behandelte er diese eben als Gast, wenn auch als einen besonders bevorzugten; von seiner jungen Wirtin erbat er sich ritterlich die Erlaubnis, vor dem gemeinsamen Tee den Staub der Reise abschütteln zu dürfen.
Beim Heraustreten aus ihren nebeneinanderliegenden Zimmern traf das Grünholzsche Paar kurze Zeit darauf mit Windmüller zusammen.
»Herr von Ellbach ist derselbe, mit dem ich auf der Universität zusammen war«, sagte letzterer mit leiser Stimme. »Da er mich nicht wiederzuerkennen schien, habe ich mich natürlich dieser Jugendbekanntschaft nicht gerühmt. Einen näheren Verkehr hatte ich übrigens damals mit ihm nicht. Indessen sind seine Augen mir unvergeßlich geblieben, nur wirkten sie damals zu seinen dunklen Haaren noch auffallender.«
»Schreckliche Augen sind es«, murmelte Frau von Grünholz, »Medusenaugen, Hypnotiseuraugen.«
Als die drei Gäste den Salon betraten, fanden sie Herrn und Frau von Ellbach schon darin vor.
Der Teetisch war in einem reizenden, hellen und luftigen Gartensaal aufgestellt, dessen hohe Glastüren weit geöffnet waren und einen hübschen Blick über die smaragdgrüne Rasenfläche mit ihren Blumenbeeten und dem plätschernden Springbrunnen gewährten, dem die hohen, alten Bäume des Parks einen wohltuenden Abschluß gaben. Kletterrosen rankten sich reich blühend über die steinerne Balustrade der Terrasse, und eine leichte, warme Brise trug ihren Duft hinein in den schönen, hellen, hohen Raum; den Teetisch schmückte prächtiges, altes Silbergerät und kostbares, altes Porzellan – über dem ganzen Bild lag der Hauch vornehmen, gediegenen Wohlstandes und feudaler Ruhe.
Gräfin Leonore trat fast gleichzeitig von der Terrasse herein und begann alsbald den Tee zu bereiten. Mit geschmeidiger Grazie bewegte sich ihre schlanke Gestalt im einfachen weißen Leinenkleid ruhig, ja fast müde bei ihrer Beschäftigung; nur, wenn sie direkt angeredet wurde, beteiligte sie sich an der Unterhaltung, deren sich Frau von Ellbach mit der großen Gewandtheit der Weltdame, die über ein Nichts zu plaudern weiß, annahm. Herr von Ellbach brachte die Rede alsbald auf das beabsichtigte »Museum«, zu dessen Unterbringung er den Oberstock des gänzlich unbewohnten südlichen Pavillons vorschlug.
»Die vormundschaftliche Genehmigung vorausgesetzt«, schloß er mit einer Verbeugung gegen den Gesandten, der ruhig erwiderte:
»Der Vormund hat nicht die entfernteste Absicht, in die Hausfrauenrechte seines Mündels einzugreifen. Ich stehe nicht an, die Idee, den südlichen Pavillon aus seinem Aschenbrödeldasein zu erlösen, für ganz vortrefflich zu erklären, und wenn Leonore die Güte haben wollte, Befehle zu seiner Reinigung zu geben, so könnten wir uns alle vielleicht morgen schon am Umzug der Gegenstände beteiligen, damit wir die kostbare Zeit des Herrn Professors nicht durch unnütze Verschleppung der Angelegenheit vergeuden.«
»Wir haben heute früh den Pavillon schon besichtigt«, bemerkte Frau von Ellbach. »Ich bin noch ganz krank von der schrecklichen Atmosphäre des Unbewohntseins in diesem verödeten Bau.«
»Schade um die schönen Räume, daß sie so lange leer standen«, meinte Frau von Grünholz. »Namentlich der runde Saal ist ganz prächtig und wird ein herrliches Museum geben – ich sehe schon den Stern im Baedecker, der dem Touristen den Anblick seiner Schätze besonders ans Herz legen wird. Du wirst es doch dem reisenden Publikum zugänglich machen, Leonore?«
»O ja, vermutlich«, erwiderte die junge Erbin gleichgültig.
»Herr Professor, Ihr Name kommt mir so bekannt vor«, wandte sich Herr von Ellbach an Windmüller. »Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, wo ich ihm begegnet bin.«
»Gelesen werden Sie ihn haben, lieber Ellbach«, fiel der Gesandte ein. »Mein geschätzter Freund hier ist Mitarbeiter kunsthistorischer Zeitschriften; eine davon brachte unlängst einen interessanten Artikel von ihm über alt-italienische Emaillen.«
»Ah ja – diesen Artikel habe ich gelesen; er war F. X. Windmüller gezeichnet«, rief Ellbach. »Ganz recht. Also Sie sind der Verfasser, Herr Professor? Übrigens war ich auch auf der Universität mit einem Windmüller zusammen, der, wenn mir recht ist, Jura studierte –«
»Das kann nur mein Vetter gewesen sein«, fiel Windmüller bereitwilligst ein.
»Ah! Nun ja, ich wußte doch, daß ich dem Namen schon begegnet sein mußte. Und was ist aus Ihrem Vetter geworden?«
»Er hat sich einen ganz eigentümlichen Beruf gewählt: er ist Privatdetektiv geworden«, erklärte Windmüller mit vortrefflich gespielter Harmlosigkeit.
»Ah!« machte Herr von Ellbach wieder. »Ganz recht, ich habe ihn in Verbindung mit irgendeinem Kriminalfall gelesen. Ist Ihr Herr Vetter in Berlin ansässig?«
»Ach, er ist überall und nirgends«, meinte Windmüller lachend. »Er kann zur Zeit ebensogut in Haparanda sein, wie in Australien. Ich hörte, er sei unlängst in Paris gewesen, aber damit ist nicht gesagt, daß er noch dort ist.«
»Da weiß ich mehr als Sie, lieber Windmüller«, fiel der Gesandte ein. »Ihr berühmter Vetter ist gegenwärtig in London, wo er einen gewissen historischen Diamanten, der sich auf Reisen begeben hat, ohne sein Ziel zu verraten, aufspüren soll. Mehr darf ich darüber aber nicht verraten.«
»Nun«, schmunzelte Windmüller, »Potentaten pflegen auf Reisen ihr Inkognito meist nicht lange zu bewahren, besonders große. Mein Vetter hat schon kleinere wiedergefunden.«
»Es muß ein aufregender, aber ganz interessanter Beruf sein«, meinte Herr von Ellbach obenhin – sein Interesse an dem Namen Windmüller schien ganz befriedigt zu sein. Hingegen fand der Inhaber dieses berühmten Namens, der seiner jungen Wirtin die Teetasse mit der Bitte um nochmalige Füllung reichte, daß diese zum erstenmal ein sichtliches Interesse an der Unterhaltung nahm; denn sie hatte die Augen mit gespanntem Ausdruck auf ihren Stiefvater gerichtet und war so vertieft darin, daß sie die Bitte ihres Gastes überhörte.
»Leonore!« rief Frau von Ellbach scharf, und begleitete diesen Anruf mit einem Blick, vor dem Frau von Grünholz zusammenzuckte – ein Blick, wie man ihn kaum erwarten konnte aus den Augen einer Mutter –, freilich wohl einer Mutter, die ihre schönsten und heiligsten Rechte und Pflichten gegen eine Jahresrente verkaufen konnte.
Leonore selbst schien Außergewöhnliches aus dem Ton, mit dem sie an ihre häuslichen Pflichten ermahnt wurde, nicht herausgehört zu haben; denn sie wendete Windmüller ein vollständig unbewegtes, ruhiges Gesicht zu.
»Verzeihung«, sagte sie mit kühler Freundlichkeit und nahm ihm die Teetasse ab. Dabei fiel ihr Blick auf seine Uhrkette, an der ein paar Anhängsel hingen, und sie fuhr mit solch heftiger Bewegung zurück, daß die Tasse aus ihrer Hand fiel und klirrend auf dem silbernen Teebrett zerbrach, während ihr Gesicht weiß bis in die Lippen wurde. Aber im Augenblick hatte sie sich wieder gefaßt.
»Wie ungeschickt!« rief sie, indem sie nach einer unbenutzten Tasse griff. »Es gibt doch Tage, an denen einem alles aus den Händen fällt!«
»Wem fällt heut alles aus den Händen?« rief von der Tür her eine frische Stimme, und sehr gelegen für den peinlichen Augenblick schoß Fritz Volkwitz in den Saal, ein Paket Briefe in der Hand. »Guten Tag allerseits«, fuhr sie im selben Atem mit einem wild-graziösen Knicks fort. »Leonore, gib mir noch 'ne Tasse Tee, ja? Hast du die Tasse hier zertöppert? Na, gottlob, daß i c h diese kostbare Meißnerin nicht zur Strecke gebracht habe! Die Post bringe ich auch mit, ich habe den Briefträger unterwegs abgefangen, alter Freund von mir, der Briefträger – hat mich oft Huckepack getragen, als ich noch in kurzen Röcken herumlief. Na, Leonore, rümpfe nicht die Nase, dich hat er so gut rumgeschleppt wie mich. Und hier sind die Briefe – der Löwenanteil natürlich für Seine Exzellenz und hier einer an Herrn von Ellbach mit einer Handschrift, als ob ein Riese die Adresse mit seinem Wanderstab geschrieben hätte.«
»Von meinem Sohn«, sagte Ellbach und steckte den Brief zu sich.
»Tee, Leonore, ein Täßchen nur, bitte!« rief Fritz Volkwitz, indem sie ihre Freundin am Ärmel zupfte. »Herrje, wo hast du denn deine Gedanken? Du guckst ja förmlich ein Loch in die Weste des Herrn Professors! Zum Glück scheint er nicht empfindlich zu sein. So, danke! Und wann geht denn die Besichtigung der Antiquitäten los? Da möchte ich nämlich brennend gern dabei sein. Ich weiß viel besser als Leonore, wo Großpapa Lohberg all seine Schätze aufgehoben hat; denn ich habe ihm dabei geholfen! Leonore hatte immer nur so 'n latentes Höflichkeitsinteresse daran.«
»Ich nehme an, daß sich der größte Teil der Sammlung in den von meinem Onkel bewohnten Zimmern des Südflügels befindet«, meinte Herr von Grünholz.
»Natürlich! Nur was dort nicht mehr Platz hatte, wurde in den Staatsräumen untergebracht«, erläuterte Fritz Volkwitz. »Es steht und liegt in Großpapa Lohbergs Zimmern noch alles, wie er es verlassen hat, nicht wahr, Leonore?«
»Vermutlich«, war die ruhige Antwort.
»Vermutlich! Ja, warst du denn noch nicht drin?«
»Nein, noch nicht.«
»Na, aber –«