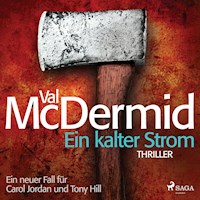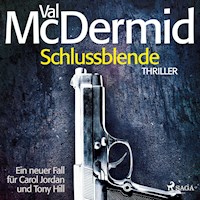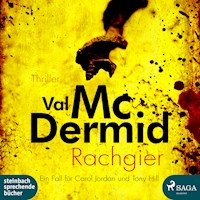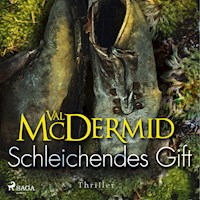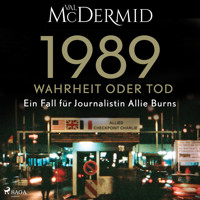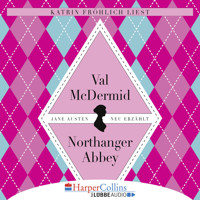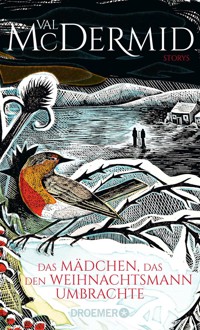6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine selbstverliebte Queen of Crime und ein eitler Horrorspezialist sterben so, wie sie es in ihren Romanen für ihre Opfer minutiös ausgeklügelt haben. Und nicht nur diese bestialischen Morde rauben der Psychologin und Profilerin Fiona Cameron den Schlaf, denn auch Kit Martin, ihr Lebensgefährte, zählt zu den prominentesten Erfindern des Todes. Fiona wird bald klar, dass Kit ganz oben auf der Liste des Psychopathen steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 775
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Val McDermid
Die Erfinder des Todes
Roman
Aus dem Englischen von Doris Styron
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine selbstverliebte Queen of Crime und ein eitler Horrorspezialist sterben so, wie sie es in ihren Romanen für ihre Opfer minutiös ausgeklügelt haben. Und nicht nur diese bestialischen Morde rauben der Psychologin und Profilerin Fiona Cameron den Schlaf, denn auch Kit Martin, ihr Lebensgefährte, zählt zu den prominentesten Erfindern des Todes. Fiona wird bald klar, dass Kit ganz oben auf der Liste des Psychopathen steht.
Inhaltsübersicht
Widmung
i
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
ii
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
iii
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
iv
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Epilog
Danksagung
Für B. B. – denn nur zu zweit lassen sich die Felsbrocken auf dem Weg überwinden.
i
Der dichte Nebel zieht vom stahlgrauen Wasser des Firth of Forth herauf wie eine Wand aus Kumuluswolken. Er verschlingt die hellen Lichter der Trendhotels und schicken Restaurants, der neuesten Spielwiese dieser Großstadt. Er wird eins mit den Schattengestalten der Seeleute aus dem Hafen, die früher ihre Heuer für billiges Bier und für Huren verschleuderten, deren Gesichter so hart wie die Hände ihrer Kunden waren. Der Dunst steigt den Hügel zur New Town hinauf, wo er von dem geometrischen Raster des vornehmen georgianischen Viertels in Blöcke zerschnitten wird, bevor er in die Senke der Princess Street Gardens hinuntergleitet. Die wenigen noch spät heimwärts schwankenden Nachtschwärmer beschleunigen ihre Schritte, um der feuchten Umklammerung zu entgehen.
Als der Nebel die schmalen, auf verschiedenen Ebenen verlaufenden Straßen und die gewundenen Gassen der Old Town erreicht, ist er nicht mehr so bedrohlich dicht. Er hat sich in ätherische, blasse Schwaden aufgelöst, aus denen manche als Touristenfallen bekannte Gebäude wie unheimliche Schemen aufragen. Plakate, die Veranstaltungen des kürzlich abgehaltenen Fringe-Festivals ankündigen, lösen sich bereits von der Wand, tauchen wie grelle Gespenster im Blickfeld auf und verschwinden wieder. In einer solchen Nacht versteht man, was Robert Louis Stevenson dazu anregte, sich den Seltsamen Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde auszudenken. Obwohl sein Buch in London spielt, sieht man doch auf jeder Seite unverwechselbar die schaurige Atmosphäre Edinburghs vor sich.
Hinter den rußgeschwärzten Fassaden der Royal Mile liegen die alten Mietshäuser mit ihren öden Hinterhöfen. Im achtzehnten Jahrhundert entsprachen sie unseren heutigen Sozialwohnungen – überfüllt mit den Besitzlosen der Stadt, Heimstatt der Säufer und Laudanumsüchtigen, Bleibe der armseligsten Huren und Gassenkinder. Als spiele sich die grausame Szene des schrecklichen Alptraums von damals an diesem Abend noch einmal ab, liegt am oberen Ende der steilen Steintreppe, die als Abkürzung von der High Street über den Abhang von The Mound hinunterführt, die Leiche einer Frau. Ihr kurzes Kleid ist hochgezogen, die schlecht gearbeiteten Nähte sind bei dem Angriff aufgeplatzt.
Hätte sie geschrien, als sie überfallen wurde, wäre ihr Schrei im Nebelschleier erstickt worden. Eines steht fest. Sie wird nie wieder schreien. Ihre Kehle gleicht einem klaffend roten, grinsend aufgerissenen Mund. Und wie zum Hohn sind die glänzenden Schlingen der Eingeweide über ihre linke Schulter gelegt.
Der Drucker, der auf dem Heimweg von der Spätschicht über die Leiche stolperte, kauert am Hofeingang, so dicht neben der Lache seines Erbrochenen, dass der eklige, von der schweren, feuchten Luft niedergedrückte Gestank ihn würgen lässt. Er hat auf seinem Handy die Polizei angerufen, aber die paar Minuten Wartezeit erscheinen ihm wie eine Ewigkeit. Der Blick in die Hölle hat sich seinem inneren Auge unauslöschbar eingeprägt.
Plötzlich blitzt Blaulicht vor ihm auf, zwei Polizeiautos fahren zügig am Rinnstein vor. Er hört schnelle Schritte, dann ist er nicht mehr allein. Zwei uniformierte Polizeibeamte helfen ihm vorsichtig auf die Beine. Sie führen ihn zu ihrem Wagen, wo sie ihm auf den Rücksitz helfen. Zwei andere sind in den Hof hinuntergegangen, aber das undeutliche Geräusch ihrer Schritte wird fast sofort von dem klammen Dunst verschluckt. Nur noch das Knacken des Polizeifunkgeräts und das Zähneklappern des Druckers sind zu hören.
Dr. Harry Gemmell kauert neben der Leiche, seine behandschuhten Finger betasten Dinge, an die Detective Inspector Campbell Grant nicht einmal denken mag. Statt den Gerichtsmediziner zu beobachten, schaut Grant zu den Kollegen von der Spurensicherung in ihren weißen Overalls hinüber. Sie suchen beim Schein tragbarer Lampen den Bereich um die Leiche ab. Der Nebel scheint Grant bis in die Knochen zu dringen, er fühlt sich wie ein alter Mann.
Schließlich brummt Gemmell etwas, steht auf und streift die blutbefleckten Latexhandschuhe ab. Er schaut auf seine klobige Sportuhr und nickt zufrieden. »Ja«, sagt er, »der achte September, tatsächlich.«
»Und was heißt das, Harry?«, fragt Grant missmutig. Er ärgert sich, wenn er daran denkt, was jetzt gleich wieder kommt – Gemmells Lieblingsspiel nämlich, die Polizisten zu zwingen, dass sie ihm alles einzeln aus der Nase ziehen.
»Euer Mann hier, der scheint Spaß am Imitieren zu haben. Sieh mal, ob du es selbst rauskriegst, Cam. Am Hals sind Abdrücke, die darauf hinweisen, dass sie mit den Händen erwürgt wurde, obwohl ich glaube, dass der Schnitt durch die Kehle die Todesursache war. Aber die Verletzungen verraten, worum es geht.«
»Willst du mir damit irgendeinen Hinweis geben, Harry? Außer dass du mir einen guten Grund lieferst, mein Essen wieder loszuwerden?«, erkundigt sich Grant.
»1888 in Whitechapel, 1999 in Edinburgh.« Gemmell zieht eine Augenbraue hoch. »Ist wohl an der Zeit, die Spezialisten für Täterprofile heranzuziehen, Cam.«
»Was schwafelst du da, Harry?« Grant fragt sich, ob Gemmell etwas getrunken haben könnte.
»Ich glaube, Cam, du hast da einen Nachahmungstäter vor dir. Du solltest wohl nach einem schottischen Ripper suchen.«
Kapitel 1
Dr. Fiona Cameron stand dicht am Rand von Stanage Edge und beugte sich vor – dem Wind entgegen. Der einzige unnatürliche Tod, über den sie sich hier Gedanken machen müsste, wäre zur Abwechslung mal ihr eigener, und auch das nur dann, wenn sie leichtsinniger wäre, als sie es je sein könnte. Aber angenommen, sie passte einen Moment nicht genau auf und rutschte auf dem nassen Sandstein aus, so würde sie kopfüber zehn bis fünfzehn Meter in die Tiefe stürzen. Ihr Körper würde wie eine Plastikpuppe auf den vorstehenden Felskanten aufschlagen, Knochen und Haut wären zerschmettert und zerfetzt.
Sie würde wie ein Mordopfer aussehen.
Nein danke, dachte Fiona und ließ sich vom Wind von der Klippe zurückdrängen, so dass sie außer Gefahr war. Nicht ausgerechnet hier. Dies war der Pilgerort, zu dem sie kam, um sich alle Gründe ins Gedächtnis zu rufen, warum sie sich zu dem Menschen entwickelt hatte, der sie war. Immer allein kam sie jedes Jahr drei- oder viermal hierher, wenn sie das Bedürfnis hatte, sich in ihre Erinnerungen zu versenken. Auf dieser öden Moorfläche wäre es unmöglich, die Gesellschaft eines anderen lebenden, atmenden Menschen neben sich zu ertragen. Hier war nur Platz für zwei, für Fiona und ihren Geist, ihre andere Hälfte, die in diesem Moor an ihrer Seite ging.
Merkwürdig, dachte sie. Es gab so viele Gegenden, wo sie viel öfter mit Lesley gewesen war. Aber überall hatten sich dort ihrem Bewusstsein fremde, störende Stimmen und die Gegenwart anderer Menschen eingeprägt. Hier jedoch konnte sie Lesley spüren, ohne abgelenkt zu werden. Sie konnte ihr Gesicht vor sich sehen, lachend und offen oder verschlossen vor konzentrierter Anstrengung, wenn sie eine schwierige Kletterstrecke bewältigte. Sie hörte ihre Stimme, die ihr ernst etwas anvertraute oder laut und aufgeregt über eine gelungene Leistung berichtete. Sie glaubte fast, den schwachen Duft ihrer Haut riechen zu können, wie damals, wenn sie zusammen beim Picknick saßen.
Hier mehr als irgendwo sonst wurde Fiona klar, welches Licht in ihrem Leben gelöscht worden war. Sie schloss die Augen und ließ Lesleys Bild vor sich aufsteigen. Es war ihr Ebenbild, die gleichen kastanienbraunen Haare, dunkelbraunen Augen und gewölbten Augenbrauen, die gleiche Nase. Alle hatten über ihre Ähnlichkeit gestaunt. Nur ihre Münder waren verschieden, Fionas breit mit vollen Lippen, Lesleys ein kleiner Herzmund, die Unterlippe voller als die obere.
Hier hatten auch die Gespräche stattgefunden, die letztendlich dazu geführt hatten, dass Lesley aus ihrem Leben gerissen wurde. Dies war der Ort, wo Fiona sich schließlich noch immer Vorwürfe machte und nicht vergessen konnte, was ihrem Leben fehlte.
Als ihre Augen feucht wurden, riss sie sie auf, um den Wind als Vorwand für die Tränen zu haben. Die Zeit der Verletzlichkeit war vorbei. Sie war hier, sagte sie sich mahnend, um Abstand zu den Opfern zu gewinnen. Sie blickte über die braunen Wedel des Adlerfarns im Hathersage Moor hinüber zum klobigen Daumen des Higger Tor und weiter, drehte sich wieder um und schaute auf einen Wolkenstreifen, aus dem sich weiter hinten Regen auf das Bamford Moor ergoss. Bei diesem Wind, schätzte sie, hatte sie gerade noch zwanzig Minuten Zeit, bevor der Regen Stanage Edge erreichte. Sie lockerte die Schultern, damit der Rucksack bequemer saß. Es war Zeit loszugehen.
Sie hatte Hathersage mit einem Frühzug von King’s Cross Station und dann mit einem Nahverkehrszug etwas nach zehn erreicht. Den steilen Anstieg auf High Neb hatte sie zügig geschafft, hatte genossen, wie ihre Muskeln sich dehnten und wie sie die Spannung ihrer Waden und die Festigkeit ihrer Oberschenkelmuskulatur spürte. Nach der letzten Kletterstrecke war sie ans Nordende von Stanage Edge gekommen, hatte sich, bevor sie an den flachen Sandsteinplatten entlang weiterging, außer Atem gegen den Felsen gelehnt und einen großen Schluck aus ihrer Wasserflasche genommen. Die Verbindung zu ihrer Vergangenheit hatte ihr mehr Halt gegeben als alles, was sie sonst kannte. Und der Wind im Rücken versetzte sie in Hochstimmung und befreite ihre Gedanken von der ärgerlichen Gereiztheit, mit der sie am Morgen aufgewacht war. Ihr war gleich klar gewesen, dass sie, wenn sie sich nicht damit abfinden wollte, dass ihre Schultern bis zum Abend völlig verkrampften und der Schmerz sich in Wellen über den Hals bis zum Kopf ausbreitete, an diesem Tag aus London herausmusste.
Der einzige Termin in ihrem Kalender war ein Gespräch mit einem ihrer Doktoranden, und das hatte sich leicht mit einem Anruf vom Zug aus regeln lassen. Hier oben auf den Mooren konnte sie kein Schmierfink der Boulevardpresse finden, kein Kameramann würde sein Objektiv auf sie richten und sie fragen, was die allwissende »Candid« Cameron über die Ereignisse vor Gericht zu sagen hatte. Sie konnte natürlich nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass sich ihre Erwartungen erfüllen würden. Aber gestern Abend hatte sie in den Nachrichten gehört, dass der sensationelle Prozess gegen den Mörder von Hampstead Heath wegen juristischer Formalitäten nach dem zweiten Verhandlungstag immer noch nicht in Gang gekommen war, und ihr Gefühl sagte ihr, dass die Pressemeute am Ende des heutigen Tages nach Blut schreien würde. Und sie war die perfekte Waffe, um der Polizei eine Wunde beizubringen. Aus verschiedenen Gründen war es besser, die Finger davon zu lassen.
Während ihrer Zusammenarbeit mit der Polizei hatte sie sich nie um die Aufmerksamkeit der Presse bemüht, aber diese war ihr trotzdem hartnäckig auf den Fersen geblieben. Fiona hasste es fast so sehr, wie ihre Kollegen sich darüber ärgerten, wenn ihr Gesicht in den Zeitungen groß herausgebracht wurde. Noch schlimmer als der Verlust an Intimsphäre war es, dass ihr Bekanntheitsgrad ihrem Ruf als Wissenschaftlerin eher geschadet hatte. Wenn sie heute in Fachzeitschriften veröffentlichte und Beiträge zu Büchern schrieb, wusste sie, dass ihre Arbeit skeptischer als früher betrachtet wurde, einfach weil sie ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen auf eine Weise praktisch angewandt hatte, über die die Puristen die Nase rümpften.
Die stillschweigende Ablehnung hatte sich noch verstärkt, als ein Boulevardblatt aufgedeckt hatte, dass sie mit Kit Martin zusammenlebte. Man konnte sich aus der Sicht des Universitäts-Establishments für eine ernst zu nehmende Psychologin, die die Polizei bei der Ergreifung von Wiederholungstätern wissenschaftlich unterstützte, kaum einen ungeeigneteren Partner vorstellen als gerade den bekanntesten Verfasser von Thrillern über Serienkiller im Land. Wäre das, was ihre Kollegen von ihr dachten, Fiona wichtig genug gewesen, hätte sie ihnen vielleicht erklärt, dass sie nicht Kits Romane liebte, sondern den Mann, der sie schrieb, und dass sie zu Beginn ihrer Beziehung gerade wegen seines Berufs viel vorsichtiger gewesen war als sonst. Aber da niemand es gewagt hatte, sie direkt darauf anzusprechen, beschloss sie, nicht in diese Falle der Selbstrechtfertigung zu tappen.
Beim Gedanken an Kit verlor sich ihre schlechte Laune. Dass sie den einzigen Mann gefunden hatte, der es schaffte, sie vor ihrer Neigung zur Selbstbeobachtung und Verschlossenheit zu retten, war ein Segen, den sie immer wieder wie ein Wunder bestaunte. Die Allgemeinheit würde wohl seine charmante Tarnung als knallharter Typ, die er in der Öffentlichkeit hervorkehrte, nie durchschauen, aber sie hatte hinter seiner rasiermesserscharfen Intelligenz so viel Großzügigkeit, Achtung und Einfühlungsvermögen entdeckt, wie sie es schon nicht mehr erhofft hatte. Durch die Beziehung zu Kit hatte sie endlich eine Art Frieden gefunden, der die Dämonen von Stanage Edge meistens von ihr fernhielt.
Im Weitergehen sah sie auf die Uhr. Sie war gut vorwärts gekommen. Wenn sie dasselbe Tempo beibehielt, würde sie noch Zeit haben, um im Fox-Houses-Pub etwas zu trinken, bevor sie mit dem Bus nach Sheffield zurückkehren und dann den Zug nach London nehmen würde. Sie hatte fünf Stunden an der frischen Luft genossen, fünf Stunden, in denen sie kaum einem anderen menschlichen Wesen begegnet war, und das reichte, um ihr wieder Kraft zu geben. Bis zum nächsten Mal, dachte sie grimmig.
Im Zug war es ruhiger, als sie erwartet hatte. Fiona hatte einen Doppelsitz für sich, und der Mann, der ihr gegenübersaß, schlief bereits zehn Minuten hinter Sheffield ein, so dass sie Platz hatte, ihre ganzen Sachen auf dem Tisch auszubreiten. Das war ihr sehr recht, denn sie hatte mehr als genug Arbeit dabei, um sich die Fahrt über zu beschäftigen. Sie hatte eine Vereinbarung mit dem Wirt eines Pubs in der Nähe des Bahnhofs. Er kümmerte sich um ihr Handy und ihren Laptop, wenn sie wandern ging, und dafür bekam er signierte Exemplare der Erstausgaben von Kits Büchern. Es war sicherer als ein Schließfach am Bahnhof und auf jeden Fall billiger.
Fiona klappte ihren Laptop auf und schloss ihn ans Handy an, damit sie ihre E-Mails empfangen konnte. Auf dem Bildschirm wurden fünf neue Nachrichten angekündigt. Sie lud sie herunter und zog den Laptopstecker wieder heraus. Zwei Nachrichten von Studenten und eine von einem Kollegen in Princeton, der sie bat, ihm Daten zur Verfügung zu stellen, die sie zu gelösten Vergewaltigungsfällen gesammelt hatte. Nichts, das nicht bis morgen früh warten konnte. Sie öffnete die vierte Nachricht, sie war von Kit.
Von: Kit Martin <[email protected]>
An: Fiona Cameron <[email protected]>
Betrifft: Abendessen heute
Hoffe, du hast einen schönen Tag in den Bergen gehabt. Hab einiges geschafft, 2500 Wörter bis zum Tee heute Nachmittag.
Im Bailey ist alles genau so gelaufen, wie du es vermutet hast. Auf die weibliche Intuition kann man sich eben verlassen! (Nicht ernst gemeint, ich weiß, dass deine fundierte Auffassung sich auf das gesamte wissenschaftliche Beweismaterial stützt …) Jedenfalls dachte ich, Steve werde ein bisschen Aufheiterung vertragen können, hab mich mit ihm zum Abendessen verabredet. Wir gehen ins St. John’s in Clerkenwell und haben vor, jede Menge totes Tier zu essen, wahrscheinlich wirst du nicht dazukommen wollen. Wenn du trotzdem Lust hast, wär’s prima. Sonst hab ich zum Mittagessen Risotto mit Lachs und Spargel gemacht, im Kühlschrank ist noch genug davon.
Hab dich lieb.
Fiona lächelte. Das war so typisch für Kit. Solange alle etwas Gutes zu essen hatten, war die Welt in Ordnung. Dass Steve Aufmunterung brauchte, überraschte sie nicht. Niemand bei der Kriminalpolizei findet es lustig, wenn in seinem Fall alles schief läuft, besonders nicht bei einem, der so viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt hatte wie der Mord von Hampstead Heath. Aber für Detective Superintendent Steve Preston war das Scheitern gerade bei diesem Fall wohl noch bitterer als bei den meisten anderen. Fiona wusste nur allzu gut, wie viel bei dieser Anklage auf dem Spiel gestanden hatte, und obwohl sie für Steve persönlich Mitgefühl empfand, fand sie, der Metropolitan Police geschehe es verdammt noch mal ganz recht.
Sie klickte die nächste Nachricht an, die sie als die interessanteste bis zum Schluss aufgehoben hatte.
Von: Salvador Berrocal <[email protected]>
An: Dr. Fiona Cameron <[email protected]>
Betrifft: Bitte um Beratung
Sehr geehrte Frau Dr. Cameron,
ich bin Chef der Abteilung Kriminalpolizei des Cuerpo Nacional de Policia in Madrid. Ich leite häufig Untersuchungen von Mordfällen. Ihren Namen habe ich von einem Kollegen beim New Scotland Yard, einem Experten für Deliktverknüpfung und das Erstellen geografischer Täterprofile. Bitte verzeihen Sie, dass ich so formlos und direkt an Sie herantrete. Ich wende mich mit der Bitte an Sie, uns in einer sehr dringenden Angelegenheit zu beraten. In Spanien haben wir sehr wenig Erfahrung mit Serienmördern, und deshalb fehlen uns fachspezifisch gebildete Psychologen, die mit der Polizei zusammenarbeiten können.
In Toledo hat es innerhalb von drei Wochen zwei Morde gegeben, und wir glauben, dass sie beide von demselben Täter begangen wurden. Aber es ist unklar, ob es eine Verbindung zwischen den Fällen gibt, und wir brauchen zur Untersuchung dieser Verbrechen jemanden mit entsprechender Fachkenntnis. Ich habe gehört, dass Sie auf dem Gebiet der Verbrechensanalyse und der Untersuchung von Querverbindungen Erfahrung haben, was meiner Ansicht nach von großem Nutzen für uns sein könnte.
Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie grundsätzlich bereit wären, uns bei der Lösung dieser Mordfälle zu unterstützen. Sie dürfen sicher sein, dass wir Ihnen eine angemessene Entschädigung für Ihre Mitarbeit bieten werden.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Hochachtungsvoll
Major Salvador Berrocal
Cuerpo Nacional de Policia
Fiona verschränkte die Arme und starrte auf den Bildschirm. Sie wusste, dass zu dieser vorsichtigen Anfrage zwei Leichen gehörten, die wahrscheinlich verstümmelt und vor dem Tod gequält worden waren. Vermutlich hatte auch ein Element sexueller Gewalt bei den Überfällen eine Rolle gespielt. Davon konnte sie mit einiger Sicherheit ausgehen, denn mit gewöhnlichen Mordfällen kam die Kriminalpolizei sonst überall durchaus zurande, ohne die fachmännische Hilfe in Anspruch zu nehmen, die nur sie und eine Hand voll anderer Experten zuverlässig liefern konnten. Wenn neue Bekannte Fionas von diesem Aspekt ihrer Arbeit erfuhren, erschauerten sie meist und fragten, wie sie es aushalte, mit so entsetzlichen Fällen zu tun zu haben.
Ihre Standardantwort war ein Achselzucken, wobei sie sagte: »Irgendjemand muss es doch machen. Dann ist es schon besser, jemand wie ich, der sich auskennt, tut es. Niemand kann die Toten wieder lebendig machen, aber manchmal kann vermieden werden, dass ihnen noch mehr Lebende folgen.«
Sie wusste, das war eine etwas zu glatte Antwort, die sorgfältig darauf abzielte, weitere Fragen abzuwehren. In Wirklichkeit hasste sie die unvermeidliche Konfrontation mit dem gewaltsamen Tod, die durch ihre Zusammenarbeit mit der Polizei zu einem Teil ihres Lebens geworden war, vor allem auch wegen der Erinnerungen, die sie in ihr weckte. Sie wusste mehr darüber, was man dem menschlichen Körper alles antun und welche Qualen die Psyche aushalten kann, als sie sich je gewünscht hätte. Aber solche Begegnungen waren unausweichlich, und weil sie ihr immer viel abverlangten, nahm sie einen neuen Auftrag stets erst dann an, wenn sie das Gefühl hatte, sich von dem letzten direkten Kontakt mit den Opfern eines Serienmörders genug erholt zu haben.
Es war fast vier Monate her, seit Fiona an einer Mordserie gearbeitet hatte. Ein Mann in Merseyside hatte im Verlauf von achtzehn Monaten vier Prostituierte umgebracht. Die Polizei hatte, zum Teil aufgrund von Fionas Datenanalyse, die sie mit einer ihrer Doktorandinnen erstellt hatte, die Verdächtigenliste so reduzieren können, dass mit Hilfe der gerichtsmedizinischen Ergebnisse weiterermittelt werden konnte. Jetzt hatte man einen Mann angeklagt, der schon wegen dreier der vier Tötungsdelikte in Gewahrsam war, und dank der Übereinstimmung der DNS-Struktur war man ziemlich sicher, dass er verurteilt werden würde.
Seit damals war ihr einziges Beratungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Polizei eine langfristig angelegte Studie über rückfällige Einbrecher für die schwedischen Behörden. Sie fand also, es sei an der Zeit, sich mal wieder die Hände schmutzig zu machen, und klickte auf <beantworten>.
Von: Fiona Cameron <[email protected]>
An: Salvador Berrocal <[email protected]>
Betrifft: Anfrage wegen Beratung
Sehr geehrter Major Berrocal,
danke für die Einladung als Beraterin des Cuerpo Nacional de Policia zu arbeiten. Prinzipiell bin ich bereit, Ihre Anfrage wohlwollend zu prüfen. Bevor ich jedoch sicher weiß, ob ich Ihnen helfen kann, müsste ich mehr über die Einzelheiten wissen als das, was Sie mir in Ihrer E-Mail mitteilen. Am besten wäre es, wenn Sie mir eine Kurzbeschreibung der Umstände beider Mordfälle sowie eine Zusammenfassung der pathologischen Befunde und eventueller Zeugenaussagen geben könnten. Ich kann Spanisch verhältnismäßig gut lesen, so dass Sie die Dokumente im Interesse einer zügigen Bearbeitung nicht für mich übersetzen lassen müssen. Natürlich werde ich alles, was Sie mir mitteilen, vollständig vertraulich behandeln.
Aus Sicherheitsgründen schlage ich vor, dass Sie die Dokumente über mein Faxgerät zu mir nach Hause schicken.
Fiona gab ihre private Fax- und Telefonnummer an und schickte die E-Mail ab. Im besten Fall würde sie dazu beitragen können, weitere Morde zu verhindern, und nützliche Daten für ihre laufenden Forschungsprojekte bekommen. Im schlimmsten Fall würde sie eine gute Ausrede dafür haben, sich aus den Nachwirkungen des schief gelaufenen Hampstead-Heath-Prozesses herauszuhalten. Irgendein spanisches Individuum – oder genauer zwei – hatten einen hohen Preis dafür gezahlt, dass »Candid« Cameron nicht in die Schlagzeilen geraten würde.
Kapitel 2
Fiona trat zum Klang von REM mit einem Song vom »sad professor«, den niemand mag, über die Schwelle. Wie meistens hatte Kit ein halbes Dutzend CDs in den Player seines Arbeitszimmers gelegt, die Zufallswiedergabetaste gedrückt und war ausgegangen, obwohl noch ein paar Stunden Spielzeit übrig waren. Er konnte Stille nicht ausstehen. Sie hatte dies sehr früh in ihrer Beziehung erfahren, als sie mit ihm zum Wandern in ihr geliebtes Derbyshire gefahren war und entsetzt feststellte, dass er seinen Rucksack mit Kassetten für seinen Walkman füllte. Mehr als einmal war sie nach Hause gekommen und hatte in der leeren Wohnung aus Kits Arbeitszimmer Musik gehört, während im Wohnzimmer der Fernseher laut plärrte und das Radio in der Küche einen verrückten Kontrapunkt gegen den Krach setzte. Je lauter das Getöse, desto leichter schien es für ihn, in sein Reich der Phantasie zu entfliehen. Für Fiona, die Stille brauchte, um sich auf alles auch nur im geringsten Kreative konzentrieren zu können, war dies ein völlig unbegreifliches Paradoxon.
Als sie besprachen, ob sie zusammenleben wollten, hatte Fiona auf einem ruhigen Ort zum Arbeiten bestanden, egal, was für eine Immobilie sie kaufen würden. Schließlich hatten sie ein schmales, hohes Haus in Tufnell Park erworben, dessen früherer Besitzer ein Rockmusiker war. Er hatte das Dachgeschoss zu einem schalldichten Studio umgebaut, ein perfektes Nest für Fiona, in das sie sich vor Kits lauter Geräuschkulisse verkriechen konnte. Es gab dort sogar einen Futon für die Nächte vor einem Abgabetermin, in denen Kit bis zum frühen Morgen durchschreiben musste. Manchmal hatte sie großes Mitgefühl mit ihren schon lange leidenden Nachbarn. Sie mussten dem Februar, wenn unvermeidlich das Ende eines Buches mit den nächtlichen Radiohead-Sitzungen nahte, mit Angst und Schrecken entgegensehen.
Fiona ließ ihre Taschen fallen und ging in Kits Arbeitszimmer im Erdgeschoss, um die Musik abzustellen. Gesegnete Stille senkte sich wie Balsam auf sie herab. Sie ging nach oben in ihr Schlafzimmer, zog ihre Wanderklamotten aus und schlüpfte in ihre Hauskleidung. Dann stieg sie die zwei restlichen Treppen zu ihrem Büro hinauf und spürte in den Beinmuskeln die Nachwirkung des Kletterns in den Bergen. Das Erste, was sie wahrnahm, war das blinkende Licht des Anrufbeantworters. Fünfzehn Nachrichten. Sie hätte wetten können, dass sie alle von Journalisten kamen, und hatte keine Lust, sich das anzuhören, und schon gar nicht zu antworten. In dieser Angelegenheit war sie fest entschlossen, keinen einzigen Kommentar abzugeben, der gedreht und gewendet und für andere Zwecke ausgeschlachtet werden konnte.
Als sie ihren Laptop auf den Schreibtisch abstellte, sah sie, dass Major Berrocal sich beeilt hatte. Ein Papierstoß füllte unübersehbar und anklagend die Faxablage. Sie unterdrückte einen Seufzer, nahm die Blätter an sich, glättete automatisch die Ecken und ging wieder hinunter.
Wie Kit versprochen hatte, stand ihr Essen im Kühlschrank. Sie fragte sich flüchtig, wie viele seiner Fans wohl für möglich hielten, dass ein und derselbe Mann Szenen von solch eindringlicher Brutalität verfasste, dass sie seinen Kritikern Alpträume verursachten, und danach zur Entspannung Feinschmeckergerichte für seine Liebste kochte. Wahrscheinlich wäre ihnen die Vorstellung lieber, dass er seine Abende damit verbrachte, in Hampstead Heath kleinen, haarigen Tieren die Köpfe abzubeißen. Fiona lächelte bei dem Gedanken und goss sich, während sie wartete, bis der Risotto warm war, ein Glas kalten Sauvignon ein. Dann nahm sie am Küchentisch Platz und legte die spanischen Faxe mit einem Bleistift zurecht. Sie sah auf die Uhr und beschloss sich die Nachrichten anzusehen, bevor sie sich daranmachte, die Polizeiberichte in der fremden Sprache zu entziffern.
Die donnernde Erkennungsmelodie zur Einleitung der Spätnachrichten ertönte wie üblich zur Begrüßung. Die Kamera zoomte das ernste Gesicht des Nachrichtensprechers heran. »Guten Abend. Die Schlagzeilen. Der Mann, der des Mordes von Hampstead Heath angeklagt wurde, ist auf freiem Fuß, nachdem die Richterin der Polizei unkorrekte Ermittlungsmethoden vorgeworfen hatte.« So weit die erste Meldung, die Fiona ohne Überraschung zur Kenntnis nahm. »Die Friedensverhandlungen im Nahen Osten sind kurz vor dem Abbruch, obwohl der US-Präsident sich persönlich eingeschaltet hat. Und der Rubel verliert nach einem weiteren Bankenskandal in Russland drastisch an Wert.«
Auf dem Bildschirm erschien jetzt hinter dem Kopf des Sprechers statt des Senderlogos der Platz vor dem Central Criminal Court.
»Im Old Bailey kam heute auf Anordnung der Richterin der Mann frei, der der brutalen Vergewaltigung und des Mordes an Susan Blanchard angeklagt war. Richterin Mary Delaney sagte, es könne keinen Zweifel geben, dass die Metropolitan Police Francis Blake durch eine Aktion, die ›schon fast einer Hexenjagd‹ gleichkäme, in eine Falle gelockt habe. Obwohl es keine stichhaltigen Beweise gegen Mr. Blake gab, habe man sich auf ihn als den Mörder festgelegt. Ich gebe nun ab an unsere Korrespondentin Danielle Rutherford, die heute im Gericht war.«
Eine Frau Mitte dreißig mit dünnem, braunem, vom Wind zerzaustem Haar blickte ernst in die Kamera. »Es gab heute im Gericht ärgerliche Reaktionen, als Richterin Delaney die Freilassung von Francis Blake anordnete. Die Angehörigen von Susan Blanchard, die in Hampstead Heath vergewaltigt und ermordet wurde, als sie mit ihren kleinen Zwillingen spazieren ging, waren empört über die Entscheidung der Richterin und über Blake, der auf der Anklagebank offensichtlich seine Genugtuung genoss.
Aber die Richterin ließ sich durch ihre Vorwürfe nicht beeindrucken und brachte ihre Geringschätzung für die Methoden der Metropolitan Police zum Ausdruck, die sie als eine Beleidigung für eine zivilisierte Demokratie empfinde. Auf den Rat eines Psychologen und Profilers hatte die Polizei mit Hilfe einer attraktiven Mitarbeiterin eine Täuschungsaktion durchgeführt. Sie sollte Mr. Blakes Zuneigung gewinnen und ihn zum Geständnis des Mordes bringen. Allerdings führte die Aktion, die hunderttausende von Pfund kostete, nicht zu einem klaren Geständnis. Trotzdem war man bei der Polizei der Ansicht, es läge genug Beweismaterial vor, um Mr. Blake vor Gericht zu bringen.
Die Verteidigung legte jedoch dar, Mr. Blake habe, was immer er gesagt hatte, nur auf Grund der Beeinflussung durch die Polizeibeamtin und auch nur deshalb geäußert, weil er die Person, die sie ihm vorgespielt hatte, beeindrucken wollte. Und diese Sichtweise wurde von der Richterin bestätigt. Mr. Blake, der acht Monate in Haft gesessen hat, kündigte nach seiner Freilassung an, er werde Entschädigung verlangen.«
Nun erschien ein untersetzter Mann im Bild, der auf die dreißig zuging und kurz geschnittenes schwarzes Haar und tief liegende dunkle Augen hatte. Ein ganzer Dschungel von Mikrofonen und kleinen Tonbandgeräten drängte sich vor seinem weißen Hemd und seinem anthrazitgrauen Anzug. Seine Aussprache war überraschend gepflegt, und er schaute öfter auf ein Blatt Papier in seiner Hand hinunter. »Ich habe immer gesagt, dass ich an dem Mord von Susan Blanchard unschuldig bin, und heute hat ein Gericht meine Haltung bestätigt. Aber ich habe einen schrecklichen Preis gezahlt. Ich habe meine Arbeit, mein Zuhause, meine Freundin und meinen guten Ruf verloren. Ich bin unschuldig und habe trotzdem acht Monate hinter Gittern verbracht. Ich werde die Metropolitan Police wegen Freiheitsberaubung auf Entschädigung verklagen. Und ich hoffe aufrichtig, dass man es sich dort beim nächsten Mal besser überlegt, wenn es darum geht, einem unschuldigen Mann etwas anzuhängen.« Dann schaute er auf, und seine Augen blitzten vor Zorn und Hass. Fiona fröstelte unwillkürlich.
Wieder änderte sich das Bild. Ein hochgewachsener Mann in einem zerknitterten grauen Anzug ging mit gesenktem Kopf und fest zusammengepresstem Mund auf die Kamera zu. Rechts und links von ihm waren zwei Männer in Regenmänteln mit starren Gesichtern. Die Stimme des Reporters sagte: »Der Polizeibeamte, der die Untersuchung geleitet hat, Detective Superintendent Steve Preston, wollte keinen Kommentar zu Blakes Freilassung abgeben. In einer späteren Verlautbarung teilte New Scotland Yard mit, man suche nicht gezielt nach einem anderen Täter in der Mordsache Susan Blanchard. Dies war Danielle Rutherford aus dem Old Bailey.«
Der Nachrichtensprecher im Studio wies nun auf einen Hintergrundbeitrag zu dem Fall hin, der nach der Pause gesendet würde. Fiona schaltete den Fernseher ab. Die verkürzte Fassung der Ereignisse interessierte sie nicht. Es gab triftige Gründe, weshalb sie die Vergewaltigung und den Mord an Susan Blanchard bestimmt nie vergessen würde. Sie hatten weder mit den drastischen Polizeifotos von der Leiche noch mit dem gerichtsmedizinischen Bericht oder auch mit der Tatsache zu tun, dass sie in der Nähe des Tatorts wohnte, der nur zwanzig Minuten zu Fuß von ihrem Haus entfernt war. Allerdings war all das schon schrecklich genug. Auch mit der Brutalität des Killers, der eine junge Mutter vor den Augen ihrer eineinhalbjährigen Zwillingssöhne schändete und erstach, hatte es nichts zu tun.
Bedeutsam war der Hampstead-Heath-Mord für Fiona deswegen, weil er das Ende ihrer Zusammenarbeit mit der Metropolitan Police, der Met, bedeutete. Sie und Steve Preston kannten sich gut vom Studium her, als sie beide in Manchester Psychologie belegten. Anders als die meisten Studentenbekanntschaften hatte ihre Freundschaft gehalten, obwohl sie beruflich ganz verschiedene Wege gegangen waren. Und als die britische Polizei die potenziellen Vorteile einer Zusammenarbeit mit Psychologen erwog, um bei der Erfassung von Wiederholungstätern bessere Chancen zu haben, war es für Steve die natürlichste Sache der Welt, sich an Fiona zu wenden. Es war der Anfang einer produktiven Beziehung, in der Fiona mit ihrem Konzept gründlichster Datenanalyse die Erfahrung und Intuition der Kriminalbeamten durch ihre Zusammenarbeit ergänzen konnte.
Schon Stunden nach der Entdeckung von Susan Blanchards Leiche war es Steve Preston klar, dass gerade in einem Fall wie diesem Fionas Fähigkeiten zum bestmöglichen Vorteil genutzt werden konnten. Ein Mann, der so töten konnte, war kein Anfänger. Steve hatte genug von Fiona gelernt und dies durch eigene Studien ergänzt, um zu wissen, dass ein solcher Mörder gewiss schon zuvor in der Strafgerichtsbarkeit seine Spuren hinterlassen hatte. Mit ihrem Fachwissen würde Fiona zumindest darauf hinweisen können, welche Art von Vorstrafen der Verdächtige vermutlich hatte. Je nach Sachlage konnte sie vielleicht sogar Angaben zu seinem wahrscheinlichen Wohnort machen. Sie würde von denselben Fakten ausgehen wie die Kriminalbeamten, aber andere Schlüsse im Hinblick auf ihre Bedeutung ziehen.
Im Verlauf der Untersuchung war Francis Blake schon früh als eventueller Täter aufgetaucht. Jemand, der mit seinem Hund spazieren ging, hatte zur Zeit des Mordes in Hampstead Heath die Kinder schreien hören und Blake in Richtung auf das dichte Unterholz davonrennen sehen, das die kleine Lichtung verdeckte, wo Susan Blanchards Leiche entdeckt wurde. Blake leitete die Filiale einer Kette von Bestattungsunternehmen, woraus die Kriminalbeamten auf eine ungesunde Vertrautheit mit Leichen schlossen. Er hatte als Junge auch bei einem Metzger gearbeitet, weswegen die Polizei davon ausging, dass es ihm nichts ausmachte, Blut zu sehen. Als Erwachsener hatte er keine Vorstrafen, aber zweimal war ihm eine Jugendstrafe angedroht worden, weil er einen Mülleimer in Brand gesetzt und beim zweiten Mal einen kleineren Jungen tätlich angegriffen hatte. Außerdem konnte er keine klare Aussage machen, wieso er an jenem Morgen im Park von Hampstead Heath gewesen war.
Es gab nur ein Problem. Fiona glaubte nicht, dass Francis Blake der Mörder war. Sie hatte dies Steve und auch jedem anderen mitgeteilt, der es hören wollte. Aber ihre Vorschläge für eine andere Richtung der Ermittlungen hatten offenbar zu keinem Ergebnis geführt. Unter dem Druck der wütenden Medien musste Steve eine Verhaftung vorzeigen können.
Eines Morgens war er in Fionas Büro in der Universität gekommen. Nach einem Blick auf seinen verbissenen Gesichtsausdruck hatte sie geäußert: »Was du mir zu sagen hast, wird mir nicht gefallen, was?«
Er schüttelte den Kopf und ließ sich schwer auf den Stuhl vor ihr fallen. »Nicht nur dir. Ich habe alle Argumente gebracht bis zum Gehtnichtmehr, aber man kann sich manchmal einfach nicht gegen opportunistische Schachzüge durchsetzen. Der Commander hat über meinen Kopf hinweg seine Entscheidung getroffen. Er hat Andrew Horsforth beauftragt.«
Keiner von beiden musste dazu noch etwas sagen. Andrew Horsforth war praktizierender Psychologe in einer Klinik. Er hatte jahrelang eine sichere Stelle in einer psychiatrischen Anstalt gehabt, deren Ruf nach jedem unabhängigen Bericht schlechter wurde, der über sie erschien. Sein Verständnis von Profiling beruhte auf dem, was Fiona verächtlich als »instinktive Annahmen« bezeichnete, und er bildete sich aufgrund jahrelanger praktischer Erfahrung mit Patienten viel auf die Qualität seiner Erkenntnisse ein. »Und das wäre ja in Ordnung, wenn für ihn je etwas anderes als sein Ego im Vordergrund gestanden hätte«, sagte sie einmal sarkastisch, nachdem sie einen Vortrag von ihm gehört hatte. Er hatte bei seinem ersten wichtigen Fall ein Mordsglück gehabt, wie sie es vertraulich umschrieb, als er ein Profil erstellte, das er später immer wieder ausschlachtete. Und er versäumte nie, den Medien bei allen möglichen Gelegenheiten Kommentare und Interviews zu geben, so viele sie wollten. Wenn die Polizei in einem Fall eine Verhaftung vornehmen konnte, für den er ein Täterprofil erstellt hatte, war er immer schnell dabei, dies als sein Verdienst zu reklamieren; wenn es nicht so weit kam, war es nie seine Schuld. Würde Francis Blake als verdächtigter Täter nun Horsforth zugewiesen, so würde dieser, dessen war sich Fiona sicher, schon ein irgendwie auf den Mann zugeschnittenes Profil zusammenbasteln.
»Dann will ich nichts mehr mit der Sache zu tun haben«, sagte Fiona bestimmt.
»Allerdings hast du nichts mehr damit zu tun, das kannst du mir glauben«, sagte Steve bitter. »Sie haben beschlossen, deine fachliche Beratung und meine persönliche Meinung zu übergehen. Sie tüfteln an einem Täuschungsmanöver, in Szene gesetzt von Horsforth.«
Fiona schüttelte deprimiert den Kopf. »Ach, verdammt noch mal«, explodierte sie. »Das ist doch eine Schnapsidee. Selbst wenn ich dächte, Blake sei euer Mann, wäre ein Täuschungsmanöver doch eine furchtbar blöde Idee. Vielleicht könnte man ja etwas zusammenbekommen, das sich vor Gericht verwenden ließe, wenn ein geschulter Psychologe mit jahrelanger therapeutischer Erfahrung die Aktion leitete, aber beim besten Willen – eine junge Polizistin loszuschicken, die von einem Bescheuerten wie Horsforth Instruktionen bekommt, das ist doch das ideale Rezept für eine komplette Katastrophe.«
Steve fuhr sich mit den Händen durch sein allmählich schütter werdendes schwarzes Haar und strich es sich aus der Stirn. »Meinst du, ich hab ihm das nicht gesagt?« Seine zusammengepressten Lippen bildeten eine scharfe Linie, die seinen ganzen Ärger ausdrückte.
»Ich bin sicher, dass du es ihm gesagt hast. Und ich weiß auch, dass du genauso wütend bist wie ich.« Fiona stand auf und wandte sich zum Fenster, um hinauszusehen. Sie wollte nicht zeigen, wie gedemütigt sie war, nicht einmal gegenüber jemandem, den sie so gut kannte wie Steve. »Also, das war’s dann wohl«, sagte sie. »Ich bin fertig mit der Met. Ich werde nie mehr mit dir oder deinen Kollegen zusammenarbeiten.«
Steve kannte sie gut genug. Er wusste, dass ein Gespräch mit ihr nichts bringen würde, wenn sie in dieser Stimmung war. Er selbst war über die Missachtung seines professionellen Urteils so verärgert gewesen, dass ihm sogar kurz der Gedanke an Kündigung durch den Kopf geschossen war. Aber anders als Fiona hatte er keine Alternative für eine berufliche Karriere, in der sein Fachwissen von Vorteil gewesen wäre. Also tat er den Gedanken daran ungeduldig als eine wehleidige Regung seines verletzten Stolzes ab. Er hoffte, dass Fiona das nach einiger Zeit auch tun würde. Jetzt war aber nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. »Ich kann dir keinen Vorwurf machen, Fi«, sagte er niedergeschlagen. »Es tut mir weh, dich zu verlieren.«
Sie war wieder gefasst und drehte sich zu ihm um. »Das wird nicht das Einzige bleiben, was dir wehtun wird, bevor diese Sache zu Ende ist«, sagte sie mitfühlend. Sogar damals schon hatte sie begriffen, wie schlimm die Sache ausgehen konnte. Wenn Polizisten durch die angebliche Glaubwürdigkeit und das Ansehen eines Psychologen bestärkt wurden, der ihnen sagte, was sie hören wollten, und wenn sie verzweifelt einen Täter verhaften wollten, ruhten sie nicht eher, als bis ihr Mann hinter Gittern saß.
Fiona freute sich jedoch nicht darüber, wie Recht sie gehabt hatte.
Kapitel 3
Die mittelalterliche Festung von Toledo war auf einem Felsvorsprung erbaut, den eine Schleife des Flusses Tajo wie ein Ochsenjoch fast vollständig umschloss. Der tiefe Fluss und die steilen Felsen boten fast der ganzen Stadt einen natürlichen Schutz, da man nur einen schmalen Streifen Land gegen den Feind befestigen musste. Jetzt wand sich eine schöne Straße auf der anderen Seite des Tajo entlang und gab verschiedene Ausblicke auf die Gruppierungen honigfarbener Gebäude frei, die sich von der prächtigen Kathedrale und den strengen Mauern des Alcazar den steil abfallenden Hang hinabzogen. Daran konnte sich Fiona noch von den heißen, durstigen Tagen eines Aufenthalts vor dreizehn Jahren erinnern, als sie die Stadt mit drei Freundinnen erkundet hatte.
Sie hatten damals ihr bestandenes Doktorexamen gefeiert und waren mit einem klapprigen VW-Bus durch Spanien gefahren, von einer Stadt zur anderen, wo sie die wichtigsten Attraktionen besuchten. Toledo – das waren El Greco, Ferdinand und Isabella, Schaufenster voller Waffen und Schwerter und ein besonders köstliches Wachtelgericht, wie sie sich erinnerte. Hätte damals jemand der jungen Psychologin, die gerade frisch von der Uni kam, vorausgesagt, dass sie eines Tages als Beraterin der spanischen Polizei hierher zurückkehren würde, hätte sie dies bestimmt für eine Schnapsidee gehalten.
Die erste Leiche war in einer tiefen, waldreichen Schlucht gefunden worden, die etwa eine Meile vor den Toren der Stadt zum Tajo hinunter verlief. Nach örtlicher Sitte hatte die Schlucht den schrecklichen Namen La Degollada – laut Fionas spanischem Wörterbuch »die Frau mit durchschnittener Kehle«. Die Leiche der historischen Degollada sollte ein Zigeunermädchen gewesen sein, das einen der Wachsoldaten verführte und damit einen zunächst unbemerkten Angriff auf die Stadt ermöglichte. Zur Strafe dafür, dass sie einem Soldaten den Kopf verdreht hatte, verlor sie den ihren dann tatsächlich. Ihre Kehle war so tief aufgeschlitzt, dass es praktisch einer Enthauptung gleichkam. Fiona bemerkte müde, aber ohne Überraschung, dass Major Berrocals Bericht nichts über das Schicksal des Soldaten enthielt.
Das jetzige Opfer war eine fünfundzwanzigjährige Deutsche, Martina Albrecht. Sie hatte gelegentlich als Reiseführerin gearbeitet und deutschsprachige Führungen durch Toledo organisiert. Ihre Freunde und Nachbarn berichteten, dass sie einen Lover gehabt habe, einen verheirateten, nicht hochrangigen Offizier der spanischen Armee, der dem Verteidigungsministerium in Madrid zugeteilt war. Er war in der Mordnacht bei einem offiziellen Festessen in der etwa sechzig Kilometer entfernten Hauptstadt gewesen. Man trank dort noch Kaffee und Cognac, als Martinas Leiche entdeckt wurde, so dass auf ihn kein Verdacht fallen konnte. Außerdem meinten Martinas Freunde, sie sei mit dieser Teilzeitbeziehung ganz zufrieden gewesen und habe nichts geäußert, was auf Probleme zwischen den beiden hingewiesen hätte.
Die Leiche wurde kurz vor Mitternacht von einem verliebten Teenager-Paar gefunden, das seine Motorräder an der Straße geparkt und sich neugierigen Blicken durch den Abstieg in die Schlucht entzogen hatte. Auch sie kamen als Verdächtige nicht in Frage, obwohl der Vater des Mädchens ihrem Freund unterstellt haben sollte, er sei durchaus zu einem Mord in der Lage, weil der Junge nach Ansicht des Vaters ein unschuldiges junges Mädchen verdarb.
Nach dem gerichtsmedizinischen Bericht hatte Martina im Mondlicht ausgestreckt auf dem Rücken gelegen, die Arme ausgebreitet und die Beine gespreizt. Der Pathologe fand heraus, dass ihre Kehle mit einer langen, sehr scharfen Klinge, vielleicht einem Bajonett, von links nach rechts aufgeschlitzt worden war und dass der Täter wahrscheinlich hinter ihr gestanden hatte. Es war schwierig, dazu etwas Genaues zu sagen, und da Toledo für seine Stahlklingen berühmt ist, war der Erwerb von rasiermesserscharfen Messern in den vielen Touristenläden an den großen Straßen eine ganz alltägliche Sache. Der Tod war schnell eingetreten, denn das Blut trat stoßweise aus den beiden durchgetrennten Halsschlagadern aus. Martinas Kleider waren vom Blut getränkt, woraus man schließen konnte, dass sie stand und nicht lag, als ihr die Wunde beigebracht wurde.
Die weitere Untersuchung ergab, dass eine abgebrochene Weinflasche wiederholt in ihre Scheide gerammt worden war und das Gewebe zerfetzt hatte. Dass an dieser Stelle des Körpers nicht viel Blut zu sehen war, deutete darauf hin, dass Martina zu diesem Zeitpunkt Gott sei Dank schon tot war. Die Flasche hatte vorher billigen Rotwein aus der Mancha enthalten, den man in fast jedem Laden der Stadt kaufen konnte. Der einzige weitere Gegenstand von Interesse am Tatort war ein blutbefleckter Reiseführer von Toledo in deutscher Sprache. Martinas Name, Adresse und Telefonnummer waren in ihrer Handschrift auf die Innenseite des Umschlags gekritzelt.
Kriminaltechnische Spuren vom Mörder gab es nicht, auch keine Hinweise darauf, wie Martina in die Schlucht La Degollada gebracht worden war. Es war ein leicht zugänglicher Ort. Die am Tajo entlangführende Panoramastraße verlief hier oberhalb der Schlucht, und es gab in der Nähe viele Stellen, wo ein Auto neben der Straße versteckt abgestellt werden konnte. Martina sei gegen sieben von der Arbeit nach Hause gekommen, sagte die Frau, mit der sie sich eine Wohnung teilte. Sie hatten zusammen kurz Brot, Käse und einen Salat gegessen, dann war die Mitbewohnerin weggegangen, um Freunde zu treffen. Martina hatte für den Abend nichts Besonderes geplant und lediglich geäußert, sie würde vielleicht später etwas trinken gehen. Die Polizei hatte die Cafés und Bars, die sie öfter besuchte, durchkämmt, aber niemand gab an, sie an jenem Abend gesehen zu haben. Als die Touristengruppe, die Martina am Tag zuvor geführt hatte, am nächsten Tag in Aranjuez ankam, hatte man sie befragt. Niemand hatte bemerkt, dass einer der Touristen sich besonders für ihre junge Führerin interessiert hätte. Außerdem waren sie an jenem Abend alle gemeinsam bei einer Flamenco-Fiesta gewesen. Für jeden konnte von mindestens drei anderen Mitgliedern der Gruppe die Anwesenheit dort und damit das Alibi bezeugt werden.
Es gab keine bestimmten Verdachtsmomente, und so war die Ermittlung zum Stillstand gekommen. Fiona kannte diese Art von frustrierender Untersuchung, die sich an die erste Tat einer Serie anschließt, wenn der Täter intelligent genug ist, seine Spuren gekonnt zu verwischen, und keine Zweifel daran hat, dass man ihn nicht erwischen wird. Fehlte eine klare Verbindung zwischen Opfer und Mörder, war es immer schwer, ergiebige Ansätze für die Ermittlungen zu finden.
Dann hatte es zwei Wochen später eine zweite Leiche gegeben. Ein relativ kurzer Zeitabstand, stellte Fiona fest. Diesmal war der Tatort die große Klosterkirche San Juan de los Reyes. Fiona erinnerte sich an die Kreuzgänge, ein mächtiges Viereck, das mit bizarren Wasserspeierfiguren verziert war. Dort war es auch gewesen, fiel ihr ein, dass eine aus ihrer Gruppe damals die absurde Figur eines umgekehrten Wasserspeiers entdeckt hatte. Statt einer grotesken Fratze, die Wasser spuckte, bestand diese Figur nur aus einem Unterkörper, als ob der dazugehörige Rest mit dem Kopf voran in die Wand gerammt worden sei.
Das Einzigartige an der Kirche selbst waren die vielen Ketten und Fesseln, die von der Fassade herabhingen. Mit diesen Fesseln pflegten die maurischen Eroberer ihre in Granada festgenommenen christlichen Gefangenen anzuketten. Als Ferdinands und Isabellas große Armee Granada den Mauren entriss, verfügten die Monarchen, dass die Ketten zum Andenken an der Kirche aufgehängt werden sollten. Fiona hatte noch lebhaft vor Augen, wie bizarr und tiefschwarz sie sich im Sonnenlicht vor dem Goldton der reich verzierten Steinfassade abgehoben hatten.
Das zweite Opfer war der Amerikaner James Paul Palango, der sakrale Kunst studierte. Seine Leiche war im Morgengrauen von einem Straßenfeger entdeckt worden, der den Kreuzgang des Klosters von San Juan de Los Reyes gefegt hatte. Als er auf dem geteerten Platz vor der Kirche um die Ecke gekommen war, hatte er etwas über seinem Kopf Baumelndes wahrgenommen. Palango hing an zwei Fesseln angekettet. Im frühen Morgenlicht glänzte etwas an seinem geschwollenen Hals. Als man die Leiche herunternahm, stellte sich heraus, dass er mit einem Würgehalsband für Hunde erdrosselt und dann mit Handschellen an die beiden Ketten gehängt worden war. Der Gerichtsmediziner berichtete auch, dass Palangos Leiche wiederholt mit dem abgebrochenen Hals einer Weinflasche verletzt wurde, die noch im wunden Anus steckte. Wieder schien es keine wesentlichen Spuren zu geben. Interessanterweise war auch in Palangos Tasche ein Führer von Toledo.
Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass Palango evangelisch war und einer reichen Familie aus Georgia entstammte. Er hatte in einem Parador-Hotel gewohnt, das von einem hohen Felsvorsprung aus einen weiten Blick über den Fluss auf die Innenstadt bot. Man sagte im Hotel, Palango habe früh zu Abend gegessen und sei dann so gegen neun mit seinem Mietwagen weggefahren. Das Auto wurde später in einem Parkhaus gegenüber dem Alcazar entdeckt. Nach Befragungen in der Nachbarschaft stellte sich heraus, dass der Amerikaner auf der Plaza Zocodover im Herzen der Altstadt einen Kaffee getrunken hatte, aber im allgemeinen Durcheinander der beim abendlichen Paseo Flanierenden hatte niemand bemerkt, ob er das Café allein verließ und wann. Niemand hatte sich gemeldet, der ihn seit dem Zeitpunkt gesehen hatte.
Fiona lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und rieb sich die Augen. Kein Wunder, dass Major Berrocal so erpicht war sie, als Helferin zu verpflichten. Die einzigen maßgeblichen Informationen, die die Polizei aus dem zweiten Mord hatte ableiten können, waren: Der Mörder war stark genug, einen 63 Kilo schweren Mann auf einer Leiter hinaufzutragen, und furchtlos genug, sein Opfer an einem öffentlichen Ort zur Schau zu stellen. Auf einem handgeschriebenen Zettel hatte Berrocal vermerkt, nach Schließung des Cafés sei die Gegend um die Kirche in den frühen Morgenstunden zwar ruhig, aber doch von mehreren Häusern aus zu überblicken. Deshalb habe der Mörder wohl die abgelegenste Stelle der Fassade für sein Spektakel gewählt, von wo aus er wahrscheinlich nicht so leicht gesehen werden konnte.
Fiona ließ sich auf dem Stuhl zurückfallen und reckte die Arme über den Kopf, während sie die Berichte noch einmal überdachte, die sie sorgfältig durchgearbeitet hatte. Der Fall war interessant, das stand außer Frage. Sie musste sich überlegen, ob sie mit einer konstruktiven Idee zu den Ermittlungen beitragen könnte. Sie hatte schon verschiedentlich mit ausländischen Polizeiabteilungen in Europa zusammengearbeitet und manchmal das Gefühl gehabt, ihre Arbeit werde dadurch beeinträchtigt, dass ihr ein tieferes, intuitives Verständnis für das Funktionieren der ihr fremden Gesellschaften fehlte. Andererseits machten sich schon erste Ansätze einer Idee bemerkbar, wie dieser Mörder vorgegangen sein und wo die Polizei mit ihrer Suche anfangen könnte.
Eines stand jedoch fest. Während sie noch unschlüssig war, plante er schon seinen nächsten Mord. Fiona schenkte sich wieder ein und traf ihre Entscheidung.
Kapitel 4
Fiona war mit ihrem Spanienführer schon halb die Treppe hinuntergegangen, als sie hörte, wie die Haustür aufging. »Hallo«, rief sie.
»Ich habe Steve mitgebracht«, antwortete Kit und klang, vom Alkohol entspannt, wie ein waschechter Einwohner von Manchester. Fiona war zu müde, um die Aussicht auf Trinken und Unterhaltung bis spät in die Nacht zu begrüßen. Aber wenigstens war es nur Steve. Er gehörte praktisch zur Familie und störte sich nicht daran, wenn sie zu Bett ging und die beiden allein ließ. Diese zwei wichtigsten Männer in ihrem Leben waren ein merkwürdig gegensätzliches Paar: Steve, groß, drahtig, dünn und dunkelhaarig, und Kit, dessen rasierter Kopf im Licht glänzte und der mit seinem breiten, muskulösen Oberkörper kleiner wirkte, als er war. Dabei sah Steve mit seinem unruhigen Blick und den langen, schmalen Fingern eher wie der Intellektuelle aus, während Kit mehr wie ein Streifenpolizist wirkte, der vielleicht nebenbei als Rausschmeißer in Nachtclubs arbeitete. Jetzt sahen sie mit dem gleichen verlegenen Klein-Jungen-Grinsen und geröteten Gesichtern zu ihr herauf.
»Das Essen war gut, wie ich sehe«, sagte Fiona trocken und lief die restlichen Stufen hinunter. Auf Zehenspitzen küsste sie Steves Wange, dann ließ sie sich von Kit in den Arm nehmen.
Er gab ihr einen schmatzenden Kuss auf den Mund. »Hast mir gefehlt«, sagte er, ließ sie los und trat in die Küche.
»Stimmt gar nicht«, widersprach ihm Fiona. »Ihr habt doch einen tollen Männerabend gehabt, habt einen Haufen abscheulicher Stücke von toten Tieren gegessen und …« – sie hielt inne und legte den Kopf schief, während sie die beiden taxierte – »… drei Flaschen Rotwein getrunken …«
»Sie irrt sich nie«, warf Kit ein.
»… und ihr habt die Welt wieder in Ordnung gebracht«, schloss Fiona. »Da wart ihr doch ohne mich viel besser dran.«
Steve zwängte seinen langen Körper auf einen Küchenstuhl und nahm das Glas Brandy, das Kit ihm hinhielt. Er wirkte wie jemand, der unter Beschuss stand und nun vorsichtig das Gefühl zulässt, an einem sicheren Ort angekommen zu sein. Er hob sein Glas zu einem spöttischen Toast. »Wünschen wir unseren Feinden Verwirrung. Du hast Recht, Fi, aber aus den falschen Gründen«, sagte er.
Fiona setzte sich ihm gegenüber und zog ihr Weinglas zu sich heran. Er hatte sie neugierig gemacht. »Es fällt mir schwer, das zu glauben«, sagte sie mit leichtem Spott.
»Fi, ich war froh, dass du heute nicht dabei warst. Du bildest dir schließlich so schon genug auf deine Arbeit ein, du musst dir nicht auch noch anhören, wie ich herumschimpfe, dass ich die Demütigungen von heute nie über mich hätte ergehen lassen müssen, wenn ich mit dir statt mit diesem Arschloch Horsforth zusammengearbeitet hätte.« Steve hob abwehrend die Hand, um Kit anzudeuten, dass drei Zentimeter Brandy mehr als genug seien.
Kit lehnte sich gegen die Küchenzeile. Er legte seine breiten Hände um das Glas, um den Inhalt anzuwärmen. »Du hast Recht mit dem Eingebildetsein«, sagte er mit leisem Lachen, und sein liebevolles Grinsen zeigte, wie stolz er auf sie war.
»Nur wer selber einer ist, erkennt den üblen Charakter«, sagte Fiona. »Tut mir Leid, Steve, dass du so einen beschissenen Tag hattest.«
Bevor Steve antworten konnte, schaltete sich Kit ein. »Es musste ja so kommen. Die ganze Aktion war doch vom ersten Tag an zum Scheitern verurteilt. Von allem anderen abgesehen, wärt ihr doch in einem Prozess nie mit so einer Falle durchgekommen, sogar wenn Blake voll darauf reingefallen wäre und alles haarklein erzählt hätte. Britische Geschworene schätzen solche Täuschungsmanöver nicht. An jedem Stammtisch hält man es für Betrug, wenn einem etwas angehängt wird, ohne dass die Beweise vorher auf normalem Weg gefunden wurden.«
»Nimm kein Blatt vor den Mund, Kit, sag uns, was du wirklich denkst«, sagte Steve sarkastisch.
»Ich hatte gehofft, dass ihr eure Erörterung schon hinter euch habt«, legte Fiona vorsichtig Protest ein.
»O ja, das haben wir«, sagte Steve. »Ich fühle mich, als wäre ich den ganzen Tag im Büßerhemd herumgelaufen.«
»He, ich hab aber nicht behauptet, es sei deine Schuld«, erinnerte ihn Kit. »Wir wissen doch alle, dass man dir von oben Druck gemacht hat. Wenn einer sich geißeln sollte, dann ist es dein Commander. Aber da kannst du deine Rente drauf verwetten, dass Teflon Telford sich heute Abend wie Pontius Pilatus die Hände in Unschuld waschen wird – mit Waschpaste extra stark. Das klingt dann ungefähr so: ›Tja, man muss seinen Leuten manchmal ihren Kopf lassen, aber ich hätte doch gedacht, dass Steve Preston die Sache besser in den Griff bekommen würde‹«, sagte er mit der tiefen Bassstimme von Steves Chef.
Steve starrte in sein Glas. Kit sagte ihm nichts, was er nicht schon wusste, aber es aus dem Mund eines anderen zu hören machte die Niederlage nicht gerade bekömmlicher. Und morgen würde er sich seinen Kollegen stellen müssen. Er wusste genau, dass er allein die ganze Sache ausbaden musste. Manche hatten genug Durchblick und verstanden, dass er zum Sündenbock abgestempelt worden war, aber es gab viele andere, die die Gelegenheit genießen würden, hinter vorgehaltener Hand über ihn zu feixen. Das war der Preis, den er für seinen bisherigen Erfolg zahlte. Und angesichts des Konkurrenzdrucks auf den höheren Ebenen der Met war man immer nur so gut wie sein letzter Erfolg.
»Seid ihr wirklich nicht hinter einem anderen Täter her?«, fragte Fiona, die Steves deprimierte Stimmung bemerkte und das Gespräch in eine positivere Richtung lenken wollte.
Steve antwortete bockig: »Das ist die offizielle Lesart. Wenn wir etwas anderes sagen, hält man uns für noch größere Holzköpfe als sowieso schon. Aber ich gebe mich damit nicht zufrieden. Irgendeiner hat Susan Blanchard ermordet, und du weißt besser als ich, dass so ein Killer wahrscheinlich nicht nach einem Opfer Halt machen wird.«
»Was willst du denn unternehmen?«, fragte Fiona.
Kit warf ihr einen nachdenklichen Blick zu. »Ich glaube, die Frage lautet wahrscheinlich, was wirst du tun?«
Fiona schüttelte den Kopf, bemüht, ihren Ärger nicht zu zeigen. »O nein, hör auf, mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich hab gesagt, ich werde nach diesem Desaster nie mehr für die Met arbeiten, und das hab ich ernst gemeint.«
Steve breitete beschwichtigend die Arme aus. »Selbst wenn ich das Geld zur Verfügung hätte, würde ich dich nicht so beleidigen wollen.«
Kit packte einen der Stühle und setzte sich rittlings darauf. »Ja, aber mich liebt sie. Ich darf sie beleidigen. Na los, Fiona, es würde doch nicht schaden, wenn du dir die Unterlagen zu der Aktion mal anschauen würdest, oder? Nur so, als theoretische Fingerübung.«
Fiona stöhnte. »Du willst ja nur, dass sie hier im Haus rumliegen, damit du deine Nase reinstecken kannst«, versuchte sie ein weiteres Ablenkungsmanöver. »Ist doch alles Wasser auf deine Gruselmühle, oder?«
»Das ist aber nicht fair! Du weißt genau, dass ich nie vertrauliche Unterlagen lese«, sagte Kit empört.
Fiona grinste. »Jetzt hab ich dich doch getroffen, was?«
Kit lachte. »Aber die Kripo ist immer fair, Chefin.«
Steve lehnte sich mit nachdenklichem Gesicht zurück. »Andererseits …«
»Ach, jetzt benehmt euch doch mal wie Erwachsene, ihr beiden«, brummte Fiona. »Ich hab Besseres mit meiner Zeit zu tun, als Andrew Horsforths dreckige kleine Fangoperation abzuklopfen.«
Steve sah Fiona aufmerksam an. Er kannte sie gut und wusste, mit welcher Art von Herausforderung man ihrer hartnäckigen Ablehnung eventuell beikommen könnte. Und er war verzweifelt genug, es damit zu versuchen. »Das Problem ist, Fi, die Spur ist schon lange nicht mehr heiß. Es ist mehr als ein Jahr her, dass Susan Blanchard bestialisch ermordet wurde, und bald zehn Monate, dass wir uns ausschließlich auf Francis Blake konzentriert haben. Ich will nicht, dass die Sache unaufgeklärt bleibt. Ich will nicht, dass ihre Kinder mit all den offenen Fragen aufwachsen. Ihr wisst ja, welchen Schmerz das Nichtwissen bedeutet. Ich will jetzt wirklich den Dreckskerl kriegen, der das getan hat. Aber wir brauchen neue Hinweise«, sagte er. »Und wie Kit sagt, es könnte ja zumindest interessantes Forschungsmaterial für dich dabei herauskommen.«
Fiona machte die Kühlschranktür fester zu als nötig. »Du bist mir wirklich ein berechnender Kerl«, beklagte sie sich. Dass sie durchschaute, wie er absichtlich die richtigen Knöpfe bei ihr drückte, machte es nicht weniger unangenehm. Verärgert versuchte sie sich mit einem letzten Verteidigungsmanöver herauszureden. »Steve, ich bin keine Praktikerin der Psychologie. Ich hör mir nicht den ganzen Tag die traurigen Lebensgeschichten der Leute an. Meine Sache ist das Jonglieren mit Zahlen. Ich arbeite mit harten Fakten, nicht mit vagen Eindrücken. Auch wenn ich meine Wut unterdrücken und die Unterlagen durchsehen würde, bin ich nicht sicher, dass ich am Ende überhaupt etwas Hilfreiches dazu sagen könnte.«
»Es würde aber nichts schaden, oder?«, warf Kit ein. »Du würdest ja deine Entscheidung, nicht mehr für die Met zu arbeiten, nicht zurückziehen. Du würdest nur Steve einen persönlichen Gefallen tun. Ich meine, sieh ihn dir doch mal an. Er ist total fertig. Und das soll dein bester Kumpel sein! Willst du ihm nicht beistehen?«
Fiona setzte sich und beugte sich vor, so dass ihre kastanienbraunen schulterlangen Haare wie ein Vorhang vor ihr Gesicht fielen. Steve wollte etwas sagen, aber Kit gab ihm schnell ein Zeichen, er solle still sein, und flüsterte: »Nein!« Steve zuckte leicht mit einer Schulter.
Schließlich seufzte Fiona tief und strich sich mit beiden Händen die Haare zurück. »Okay, ich mach es«, sagte sie. Als sie Steves begeistertes Lächeln sah, fügte sie jedoch hinzu: »Ich verspreche nichts, vergiss das nicht. Bring mir das Zeug gleich morgen früh, damit ich es mir anschauen kann.«
»Danke, Fi«, sagte Steve. »Auch wenn es gewagt ist, ich brauche alle Hilfe, die ich bekommen kann. Ich danke dir.«
»Gut. Das solltest du auch«, sagte sie ernst. »Können wir jetzt von was anderem reden?«
Es war nach Mitternacht, als Fiona mit ihrem Spanienführer endlich zu Bett ging. Als Kit aus dem Bad kam, warf er stirnrunzelnd einen erstaunten Blick auf ihren Lesestoff. »Willst du mir damit schonend beibringen, dass es an der Zeit sei, einen Urlaub zu planen?«, fragte er, schlüpfte unter die Decke und kuschelte sich an sie.
»Schön wär’s. Gehört zur Arbeit. Ich habe heute eine Anfrage von der spanischen Polizei wegen einer Beratung bekommen. Zwei Morde in Toledo, die nach dem Anfang einer Serie aussehen.«
»Du hast also schon entschieden zu gehen?«
Fiona schwenkte das Buch vor ihrer Nase herum. »Sieht so aus. Ich muss wegen der praktischen Details morgen früh mit ihnen reden, aber ich könnte ohne große Probleme zum Wochenende ein paar Tage wegfahren.«
Kit rollte sich auf den Rücken und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. »Und da hatte ich schon gedacht, du hättest eine romantische Kurzreise nach Torremolinos geplant.«
Fiona legte ihr Buch ab und wandte sich Kit zu. Ihre Finger fuhren durch die weichen dunklen Haare auf seiner Brust. »Du könntest ja mitkommen, wenn du möchtest. Toledo ist eine schöne Stadt. Es ist ja nicht so, als gebe es dort nichts für dich zu tun, während ich arbeite. Eine Abwechslung würde dir nicht schaden.«
Er legte einen Arm um ihre Schulter und zog sie näher zu sich heran. »Ich bin ziemlich im Rückstand mit dem Buch, und wenn du am Wochenende nicht da bist, ist das eine gute Gelegenheit, mich einzuschließen und durchzuarbeiten.«
»In Toledo könntest du auch arbeiten.« Ihre Hand wanderte langsam zu seinem Bauch hinunter.
»Wenn du da bist, um mich abzulenken?«
»Ich würde tagsüber arbeiten. Und wahrscheinlich die halbe Nacht, wenn man nach den früheren Erfahrungen gehen kann.« Sie rutschte näher und schmiegte sich an ihn.
»Da kann ich genauso gut zu Haus bleiben, so wie sich das anhört.«
»Es würde dir gefallen«, sagte Fiona gähnend. »Es ist eine interessante Stadt. Man weiß nie, vielleicht wäre es eine gute Inspiration.«
»Ja, genau, ich sehe schon vor mir, wie ich den spanischen Superkillerthriller schreibe.«
»Warum nicht? Es ist ein schmutziger Job, aber irgendjemand muss ihn machen. Ich dachte nur, du würdest vielleicht mal gern irgendwo eine Pause einlegen, wo man sensationelle Feinschmeckerkost speist …« Fionas schläfrige Stimme wurde immer leiser.
»Manchmal denke ich auch an was anderes als ans Essen«, protestierte er. »War Toledo nicht die Stadt mit den El Grecos?«
»Stimmt«, sagte Fiona. »Und sein Haus ist auch da.« Ihre Augen waren geschlossen und ihre Stimme war nur noch ein Murmeln, als sie den Traumpfad in den Schlaf hinunterglitt.
»Na, das hört sich so an, als wär’s eine Reise wert. Vielleicht komme ich doch mit«, sagte Kit. Keine Antwort. Das frühe Aufstehen und die zehn Meilen Wandern im Moor von Derbyshire forderten jetzt doch ihren Tribut. Kit lächelte und streckte seinen freien Arm nach dem Taschenbuch von James Sallis auf dem Nachttisch aus. Im Gegensatz zu Fiona konnte er nie ohne seine Portion Horror einschlafen. Allerdings wusste er immer, dass sein Lesestoff nur Erfindung war. Es machte nichts aus, dass er das Verbrechen nicht aufgeklärt hatte, wenn es Zeit war, das Licht abzuschalten. Die Killer, für die er sich interessierte, würden nicht wieder zuschlagen, bis er bereit war.
Kapitel 5
D