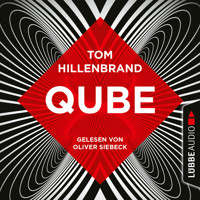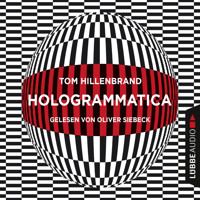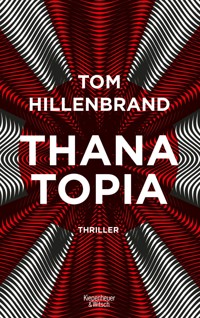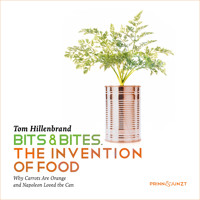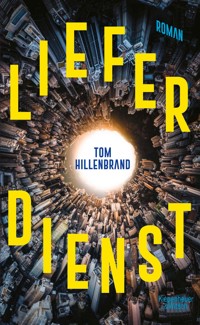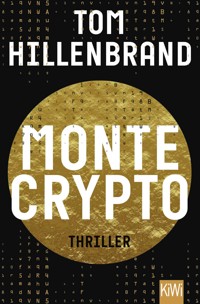12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die aufregende Jagd nach der verschwundenen Mona Lisa im Paris der Belle Époque - ein historischer Roman voller Intrigen, Kunst und Kultur! Als der Pariser Louvre am 22. August 1911 seine Pforten öffnet, fehlt im Salon Carré ein Gemälde: Leonardo da Vincis »Mona Lisa«. Sofort versetzt der Polizeipräfekt seine Männer in höchste Alarmbereitschaft, lässt Straßen, Bahnhöfe und sogar Häfen sperren. Doch es ist zu spät. La Joconde ist verschwunden. Juhel Lenoir von der Pariser Polizei soll es finden – und die Welt schaut ihm dabei zu … Commissaire Lenoir lebt in der aufregendsten Stadt der Welt – und bekommt den schwierigsten Auftrag, den er sich vorstellen kann: das Bild zu finden, das die Welt betört. Wen hat die »Mona Lisa« so sehr bezirzt, dass er nicht mehr ohne sie leben konnte? Auf seiner Jagd trifft der Ermittler auf den Maler Pablo Picasso und den Dichter Guillaume Apollinaire, die Ausdruckstänzerin Isadora Duncan und ihren Guru, den Satanisten Aleister Crowley, die Musiker Igor Strawinsky und Claude Debussy, die brutalen Anarchisten der Bonnot-Bande und Frankreichs größten Detektiv, Alphonse Bertillon, den »lebenden Sherlock Holmes«. Wer von ihnen ist in die Geschichte des verschwundenen Bildes verwickelt? Die Suche nach der »Mona Lisa« führt durch das Paris der ausgehenden Belle Époque, durch Künstlercafés auf dem Montmartre, in die Opéra Garnier, zu dekadenten Grandes Fêtes im Bois de Boulogne und in absinthgetränkte Spelunken an der Place Pigalle. Dieser historische Roman ist gleichzeitig Detektivroman und Gemälde einer Ära, in der Paris das Zentrum der Welt war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tom Hillenbrand
Die Erfindung des Lächelns
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tom Hillenbrand
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tom Hillenbrand
Tom Hillenbrand, studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Redakteur bei SPIEGEL ONLINE. Seine Bücher erscheinen in vielen Sprachen, wurden mehrfach mit Preisen ausgezeichnet und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Paris 1911: Als Leonardo da Vincis »Mona Lisa« aus dem Louvre verschwindet, bekommt Commissaire Lenoir den schwierigsten Auftrag, den er sich vorstellen kann: das Bild zu finden, das die Welt betört. Wen hat »La Joconde« so sehr becirct, dass er nicht mehr ohne sie leben konnte? Auf seiner Jagd trifft der Ermittler auf den Maler Pablo Picasso und den Dichter Guillaume Apollinaire; die Ausdruckstänzerin Isadora Duncan und ihren Guru, den Satanisten Aleister Crowley; die Musiker Igor Strawinsky und Claude Debussy; die brutalen Anarchisten der Bonnot-Bande und Frankreichs größten Detektiv, Alphonse Bertillon, den »lebenden Sherlock Holmes«.
Wer von ihnen ist in die Geschichte des verschwundenen Bildes verwickelt? Die Suche nach der Mona Lisa führt durch das Paris der ausgehenden Belle Époque, durch Künstlercafés auf dem Montmartre, in die Opéra Garnier, zu dekadenten Grandes Fêtes im Bois de Boulogne und in absinthgetränkte Spelunken an der Place Pigalle. Dieser historische Roman ist gleichzeitig Detektivroman und Gemälde einer Ära, in der Paris das Zentrum der Welt war.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Hinweis zum Buch
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
Nachwort
»Kunst ist Diebstahl.«
Pablo Picasso
»Ein Maler, der nicht zweifelt, macht keine Fortschritte.«
Leonardo da Vinci
In diesem Roman kommen an einigen wenigen Stellen Wörter vor, die heute nicht mehr gebräuchlich sind, weil sie abwertend und fremdbezeichnend sind. Sie werden hier wiedergegeben, weil sie Zitate und / oder gängige Ausdrucksweise der Zeit um 1911/1912 waren.
Prolog
Die Glocken von Saint-Germain rufen die Gläubigen, doch diese beiden gehen bestimmt nicht zur Sonntagsmesse. Es ist weniger ihre Kleidung, die diesen Schluss nahelegt – die wäre nicht einmal unpassend. Der Kleinere, ein südländisch wirkender Mittzwanziger mit akkurat gescheiteltem Haar, trägt einen halbwegs präsentablen schwarzen Samtanzug. Der Größere ist in braunen Cord gekleidet. Dazu trägt er eine Ballonmütze sowie ein Cape mit Fellbesatz. Seinen Kompagnon überragt er um mindestens zwei Köpfe. Mit seiner blonden Mähne wirkt er so hell wie der andere dunkel.
Nein, die Kleidung ist es nicht. Es ist die Gestik, es sind die Blicke. Diese beiden haben etwas Unchristliches vor. Während sie den Boulevard Saint-Germain hinauflaufen, redet und gestikuliert der blonde Siegfried. Sein alberichhafter Begleiter hingegen schweigt. Er raucht, nickt, beeilt sich, mit seinem hünenhaften Begleiter Schritt zu halten.
Sie biegen ab in die Rue du Bac, gehen Richtung Seine. Am Orsay schieben sie sich durch das Gewimmel vor dem Bahnhof, weichen Fuhrwerken und Automobilen aus.
Es ist sonnig und trocken gewesen in den vergangenen Tagen, der Verkehr wirbelt Unmengen von Staub auf, der sich auf den Samtanzug und das Cape legt. Als die beiden den Pont de Solférino erreichen, klopfen sie einander die Straße von den Schultern. Weitere Zigaretten werden entzündet. Dann überqueren die Männer die Seine. Vor ihnen erhebt sich der Louvre. Der Blonde deutet auf den Gebäudeflügel an der Flussseite, erklärt seinem Begleiter etwas. Der nimmt die Ausführungen unbewegt zur Kenntnis.
Am anderen Ufer angekommen, biegen sie nach rechts ab. Am Stand eines Bouquinisten verharrt der Blonde. Eine Radierung scheint sein Interesse geweckt zu haben. Doch bevor er diese genauer in Augenschein nehmen kann, zieht sein dunkler Begleiter ihn am Arm. Der Blonde folgt, wenn auch unter gespieltem Protest.
Zum Haupteingang des Museums gelangt man über die Place du Carrousel, den immensen Innenhof des ehemaligen Königspalasts. Sonntags ist dort einiges los. Zu den ausländischen Baedeker-Touristen gesellen sich Einheimische, die nach einem günstigen Zeitvertreib suchen. Der Eintritt ist gratis.
Die beiden Männer scheinen all das zu wissen und steuern deshalb die Porte des Lions an, den am Quai des Tuileries gelegenen Seitengang. Er ist an diesem späten Vormittag nahezu verlassen. Sie werfen ihre halb gerauchten Zigaretten fort, laufen zwischen zwei bronzenen Löwenstatuen hindurch. Im Vorbeigehen wirft der Mann im Samtanzug einen nachdenklichen Blick auf die beiden Raubkatzen. Er weiß, dass es ursprünglich nur eine gab. Diese versah ihren Dienst in den Tuilerien, bis Napoleon III. sie in den Louvre abkommandierte. Aus Gründen der Symmetrie ließ der Kaiser einen zweiten Löwen anfertigen, eine exakte Kopie des ersten, jedoch spiegelverkehrt. Der Kopist trieb die Sache bis zum Äußersten: Die Signatur am Fuße des Abgusses lautet »eyraB« – der spiegelverkehrte Name des Bildhauers, der den ersten Löwen fertigte. Diese Signatur ist die einzige Möglichkeit, Original und Kopie auseinanderzuhalten.
Da er den Louvre regelmäßig besucht, weiß der kleine Mann zudem, dass die beiden aufmerksam dreinblickenden Louvre-Löwen ihre Arbeit deutlich gewissenhafter verrichten als die Museumswächter. Dieser Umstand ist einer der Gründe dafür, dass er sich überhaupt auf dieses Abenteuer eingelassen hat.
Über eine kleine Treppe steigen sie hinauf in den ersten Stock und betreten die Grande Galerie. An deren Eingang sitzt einer der Gardiens, zu erkennen an seiner Uniform aus orangefarbener Hose und dunklem Rock. Der Wächter, ein kugelrunder Mittfünfziger, ist in seinem Stuhl zusammengesunken, die wurstigen Finger vor dem Wanst verhakelt, und schläft. Sein Zweispitz ruht auf einem seiner Knie. Links und rechts des Gardien hängen religiöse Szenen, ein Carracci und ein Albani. Eine Schar von Engeln wacht über den Schlaf des Aufsehers. Der Blonde schneidet eine Grimasse, legt die gefalteten Hände an seine Schläfe.
Zügigen Schrittes durchqueren die Männer die Galerie. In diesem Flügel hängen Gemälde der spanischen und der italienischen Schule, Velázquez und Zurbarán, Raffael und Il Correggio. Während sie all diese Meisterwerke passieren, scheint eine Veränderung in den beiden Männern vorzugehen. Der Blonde gestikuliert nicht mehr, und es scheint ihm ein wenig die Sprache verschlagen zu haben. Sein Kompagnon hingegen hält sich nun aufrechter, lässt sogar ab und an eine Bemerkung fallen.
Man hat nicht den Eindruck, dass die beiden sich für die Bilder interessieren. Ihr Ziel scheint jenseits der Galerie zu liegen. Dort geht es unter anderem zum Salon Carré, in dem viele der besonders sehenswerten Gemälde hängen. Der Kleine deutet fragend auf den Durchgang.
»Dort entlang, Baron?«
Der Angesprochene schüttelt den Kopf, blickt sich um. Sie sind keineswegs allein. Überall streifen Besucher umher – bürgerliche Familien mit Kindern und Zofe im Schlepptau, amerikanische Touristen mit Kunstkatalogen, russische Adlige mit Gehstock und Säbel. Das Einzige, was weit und breit nicht zu sehen ist, sind Museumswächter, nicht einmal schlafende.
»Und jetzt kommt der Clou«, sagt der Blonde.
Er zeigt auf eine Tür, die dem Kleinen zuvor nicht aufgefallen war. Sie liegt halb hinter einem Vorhang verborgen und trägt die Aufschrift »Kein Durchgang«. Der Blonde öffnet sie und tritt hindurch. Sein Kompagnon folgt ihm, wenn auch ein wenig zögerlich.
»Personaltreppenhaus«, bemerkt der Blonde.
Über steinerne Stufen gelangen sie hinab ins Erdgeschoss. Dort befindet sich eine schwere Eichentür, die jedoch nur angelehnt ist. Mit einem ungläubigen Gesichtsausdruck verharrt der Mann im Samtanzug am Treppenabsatz, während sein Kompagnon seelenruhig durch den Türspalt lugt. Jenseits der Schwelle liegt ein kleiner Innenhof. Er muss von den Fenstern im Obergeschoss aus einsehbar sein.
»Da durch? Das gefällt mir nicht«, sagt der Kleine in stark akzentuiertem Französisch.
»I wo. Ich wollte lediglich nachsehen, ob die Gardiens mal wieder im Hof Karten spielen. Nein, nicht da durch.«
»Sondern?«
»Hinab, hinab zu den dunkeln Gestaden!«, ruft der Blonde und eilt die Treppe weiter hinunter. Der Kleine schüttelt seufzend den Kopf, folgt ihm.
Etwas später müht sich ein Taxi die Butte hinauf. Es scheint auf Sacré-Cœur zuzuhalten, jene immer noch unfertige Kirche, wegen der es so viel Streit gibt. Dann jedoch biegt der Wagen ab. Durch ein Fenster sieht man im Fond den Kleinen mit dem Samtanzug. Die Straßen des Montmartre sind menschenleer. Die Bewohner haben sich am gestrigen Samstagabend im »Lapin Agile« oder der »Moulin de la Galette« die Nacht um die Ohren geschlagen. Sie schlafen vermutlich noch ihren Rausch aus.
Als das Taxi in der Rue Ravignan hält und der Mann im Samtanzug aussteigt, kann er sich folglich sicher sein, dass niemand Notiz von ihm nimmt. Er hievt sich den Sack über die Schulter.
Das Taxi fährt ab. Ohne ihm nachzusehen, geht der Kleine auf ein Gebäude zu. Es sieht aus, als gehöre es besser heute als morgen abgerissen: eine Reihe ohne Plan zusammengezimmerter Schuppen, deren Fenster längst erblindet sind und deren Türen kaum noch schließen. Der Mann betritt einen dieser Verhaue, geht einen schmalen, düsteren Gang entlang. Nach einer Weile gelangt er an eine Tür, an der ein Schild hängt. Darauf steht: »Treffpunkt der Poeten«. Er schließt auf, tritt ein.
Die Behausung gehört augenscheinlich einem Künstler. Überall stehen Töpfe mit Pinseln und Farben, außerdem Leinwände. Der Boden ist voller zusammengeknülltem Papier, Holzresten und anderem Unrat. Der Mann geht zu einem wackelig wirkenden Tisch, setzt sich. Der Stuhl knarzt vernehmlich.
»Was ist los?«, fragt eine verschlafene Frauenstimme.
Der Mann wendet sich in Richtung eines mit Stoffbahnen vom Rest des Raums abgetrennten Separees. Durch das semitransparente Material erkennt man eine unordentliche Bettstatt mit allerlei Decken und Kissen. »Nichts, Fernande. Schlaf weiter.«
Als Antwort kommt nur ein leiser Seufzer. Er kramt eine Packung Zigaretten aus der Hosentasche. Es ist eine neue Marke, die er erst neulich entdeckt hat, mit einem schönen französischen Namen: Gauloises.
Mit einer Zigarette im Mundwinkel geht er zu der großen Staffelei in der Mitte des Raums. Still betrachtet er die Leinwand. Sie misst zwei vierundvierzig mal zwei vierunddreißig. Das Bild ist damit etwas größer als sein Vorbild, El Grecos »Fünftes Siegel«.
Ein Ruck geht durch den kleinen Mann. Er legt sein Jackett ab, greift nach einer Palette, kleckst Farben darauf. Als er damit fertig ist, öffnet er den Sack, den er mitgebracht hat. Dessen Inhalt platziert er auf einem Stuhl. Eine Weile betrachtet er seine neueste Eroberung mit fiebrigem Blick. Dann beginnt er zu malen.
1
Vincenzo nippt an dem Roten. Französischer Landwein ist eigentlich nicht nach seinem Geschmack, Frascati oder Nebbiolo wären ihm lieber. Aber was soll man machen? Was Besseres ist nicht drin.
Er lehnt sich zurück, schaut sich um. Vincenzo hat einen Außenplatz im »Tortoni« ergattert, einem der ersten Cafés auf den Grands Boulevards. An diesem lauen Sommerabend sind alle Tische besetzt. Eine endlose Prozession von Spaziergängern schiebt sich vorbei: Herren in Frack und Zylinder, Damen in eleganter Garderobe und dazwischen ein Haufen deutlich weniger feiner Herrschaften – Hilfsarbeiter, Hausmädchen, Fuhrleute.
Die könnten sich im »Tortoni« nicht einmal ein Glas Tafelwein leisten. Aber immerhin können sie im Schein der elektrischen Laternen den Boulevard des Italiens entlangflanieren, sich als Bürger der Hauptstadt der Welt fühlen.
Vincenzo kann sich das »Tortoni« eigentlich auch nicht leisten. Aber an einem Sommerabend wie diesem gibt es keinen anderen Ort, an dem man sein möchte. Also hat er sich in seinen einzigen Anzug geworfen, einen halbwegs frischen Stehkragen am Hemd befestigt und ist aus dem Italienerviertel im 10. Arrondissement hergeeilt.
Zunächst ist Vincenzo eine Stunde auf und ab gelaufen. Er hat preiswertere Etablissements in den Seitenstraßen ins Auge gefasst. Aber da lässt sich das Spektakel der Boulevards nicht verfolgen – die dortigen Tische sind wie Hörplätze in der Oper. Nicht dass Vincenzo je in der Oper gewesen wäre – aber so in der Art eben.
Als er am »Tortoni« vorbeikam, wurde gerade ein Tisch frei. Er erinnerte sich an die berühmte Eiscreme des Cafés. Sie soll köstlich sein, como un vero gelato italiano. Vincenzo sah sich dasitzen, einen riesigen Eisbecher mit Sahne genießend. Die Damen an den Nebentischen schmunzelten über den ungeheuren Appetit dieses hübschen Burschen. Sie warfen ihm schelmische Blicke zu. Das war eine schöne Vorstellung. Also nahm er Platz.
Vincenzos Traum platzte, als er die Preise sah. Statt Eis bestellte er den billigsten Wein. Seit einer Stunde streckt er diesen mit dem kostenlosen Wasser, denn eine zweite Karaffe kann er sich nicht leisten.
Verstohlen schaut er sich um, vergewissert sich, dass keiner der Kellner in der Nähe ist. Vincenzo zieht einen Flachmann hervor, nimmt zwei schnelle Schlucke. Der Fusel setzt seine Kehle in Brand. Er krümmt sich, muss husten.
»Ich bitte um Verzeihung, Monsieur. Monsieur?«
Erschrocken blickt Vincenzo auf, lässt den Flachmann unter dem Tisch verschwinden. Vor seinem Tisch stehen zwei Herren. Der eine trägt einen schwarzen Dreiteiler, ein rosafarbenes Hemd, Melone, Monokel. Der andere ist in beigefarbenen englischen Tweed gehüllt, viel zu warm für das Wetter. Auf seinem birnenförmigen Schädel thront ein zu kleiner Strohhut, den er nun lüpft.
»Einen ganz wunderschönen guten Abend, Monsieur. Ich wollte mich erkundigen, ob diese beiden Plätze frei sind.«
Vincenzo mustert den Mann mit dem Strohhut. Unter dem rechten Arm trägt er einen ganzen Stapel Journale – offensichtlich ein homme des lettres. Auch sein dandyhafter Begleiter sieht wie ein Künstler aus. Es wäre ein Leichtes, den Männern zu erklären, dass er auf Freunde wartet oder dass er gerade zahlen wollte. Stattdessen erhebt sich Vincenzo, vollführt eine Geste, die er sich bei den Einweisern drüben im Pathé-Palast abgeschaut hat.
»Aber selbstverständlich, meine Herren. Es wäre mir eine Ehre!«
»Ah, ah, das ist zu freundlich von Ihnen. Max, komm, dieser Lebensretter hat Platz für uns.«
Die Männer setzen sich, bestellen Pouilly-Fumé, eine ganze Flasche. Der Strohhut stopft sich eine Pfeife, beginnt zu schmauchen und zu reden. Während sein aristokratisch wirkender Begleiter auf einen Bambusstock gestützt zuhört, spricht der andere über eine Ausstellung. Er äußert sich abfällig über einen Künstler und über einen Kunstkritiker. Vincenzo hat weder von dem einen noch von dem anderen je etwas gehört.
Der Strohhut holt ein Buch aus seiner Tasche, dann noch eines – und noch eines. Er kommt Vincenzo ein wenig wie ein Zauberkünstler vor, nur dass er anstelle von Kaninchen aus allen Falten seines Gewands Papiere hervorzaubert. Er schlägt eines der Bücher auf, liest dem Dandy ein Gedicht vor. Danach händigt er seinem Freund das Werk aus, nur um es ihm kurz darauf wieder wegzunehmen und abrupt das Thema zu wechseln. Zunächst geht es um einen römischen Kaiser namens Pertinax, dann um Buffalo Bill, auf den der Mann im Tweedanzug große Stücke zu halten scheint. Vincenzo kommt kaum mit. Dann berichtet der Fremde von seinem Besuch im Louvre, zählt verschiedene Maler auf: Lorenzetti, Uccello, Sassetta, da Vinci. Immerhin einen davon kennt Vincenzo. Dass der Strohhut nur über italienische Maler redet, überrascht ihn nicht. Italiener sind die besten Künstler der Welt.
Die beiden haben sich an seinem Tisch breitgemacht, in jeder Hinsicht. Der Strohhut hat seine Reisebibliothek über den ganzen Tisch verteilt. Darunter befindet sich ein Journal namens »L’Assiette au Beurre« und ein Buch mit einem Holzschnitt auf dem Titel: »Der verwesende Zauberer«. Während er mit einem weiteren Buch wedelt, sagt der Literaturliebhaber: »Hast du ihn denn schon gelesen?«
»Ja«, antwortet der Monokelmann. »Es hat eine gewisse Faszination. Aber gleichzeitig ergibt es keinen Sinn.«
Der Strohhut wedelt mit dem Finger.
»Ah, ah! Aber es geht nicht um Sinnhaftigkeit, es geht um Geschwindigkeit. Die Geschichte als Rausch, und der Rausch ist die Geschichte. Weißt du, wie sie es machen?«
»Na ja, wie alle, vermute ich.«
»Nein, Max, nein. Sie müssen ja pro Monat einen Roman abgeben.«
Während er dies sagt, tippt er immer wieder auf ein schmales Buch in seiner Rechten. Vincenzo versucht, den Titel zu entziffern, aber die Pranke des Vielredners ist im Weg.
»Jeden Monat eins? Unmöglich.«
»Souvestre hat’s mir verraten, pass auf. Sie sprechen die Handlung durch, die Kapitelstruktur, er und Allain. Dann gehen sie in getrennte Zimmer. Da stehen Phonographen. Sie diktieren, atemlos, pausenlos, geben die vollen Walzen ihrem Schreibdomestiken, der alles transkribiert und glättet.«
»Und danach redigieren sie.«
»Nein, nein! Sofort zum Drucker damit. Keine Korrekturen, literarischer Ausdruckstanz, pure Improvisation. Ah, es ist großartig! Ich verschlinge alles davon!«
Vincenzo trinkt den letzten Schluck wässrigen Rotweins, holt seinen Tabak hervor. Schon sieht er den Kellner mit gesenktem Blick durch die Reihen eilen. Wie ein Raubvogel hält er von oben Ausschau nach leeren Gläsern und Karaffen. Gleich wird er auf Vincenzo herabstoßen und eine weitere Bestellung einfordern.
Gerade will er zu drehen beginnen, als der Herr mit dem Monokel ihm ein geöffnetes Zigarettenetui hinhält. Vincenzo nimmt eine, bedankt sich.
»Ah, ah!«, ruft der Mann mit dem Strohhut, »was sehe ich dort?«
Er deutet auf Vincenzos Hand. An den Fingern, welche die Zigarette halten, sind Reste weißer Farbe erkennbar.
»Ihr arbeitet mit Farben, ja? Ist Monsieur etwa Maler?«
Nach der Arbeit hatte Vincenzo es derart eilig, sein stickiges Mansardenzimmer zu verlassen, dass er darauf verzichtete, sich gründlich zu säubern. An seinen Händen kleben immer noch Reste von Farbe und Putz. Zwölf Stunden lang hat er die Wände einer neuen Filiale von Félix Potin verputzt – eine stupide Arbeit, die nicht ansatzweise seinen Talenten und Fähigkeiten entspricht.
»So ist es, Monsieur. Ich arbeite als, ja, als Maler.«
Der mutmaßliche Dichter mustert ihn, bemerkt Vincenzos Akzent. Mühelos wechselt er ins Italienische.
»Welche Art von Malerei?«
Vincenzo fühlt sich ertappt. Ganz egal, ob man Ladenlokale weißt oder die Decke der Sixtinischen Kapelle verziert – im Französischen gibt es dafür nur ein Wort. Im Italienischen hingegen ist er ein gemeiner Anstreicher, ein imbianchino und nicht etwa ein pittore.
»Ich führe Auftragsarbeiten aller Art aus«, antwortet Vincenzo. »Kunstmalerei, Restauration. Ich habe«, er zieht an seiner Zigarette, »sogar schon im Louvre gearbeitet.«
Das hat er wirklich, allerdings nicht mit Palette und Staffelei. Sein Arbeitgeber hat dort vor Jahren einige Bilder gerahmt und hinter Glas gelegt. Weil Vincenzo ein wenig schreinern kann, war er dabei.
Um weiteren Nachfragen zuvorzukommen, erklärt er: »Euer Italienisch ist ausgezeichnet, Signore.«
Der Mann vollführt eine abwiegelnde Handbewegung.
»Ich bin Pole, aber in Rom geboren. Von wo aus Italien stammt Ihr, wenn ich fragen darf?«
»Aus Dumenza.«
»Ah, ah. Ich liebe die Gegend um den Lago Maggiore!«
Vincenzo lächelt stumm. Die Herren tun sehr freundlich, aber er spürt die Herablassung in ihren Blicken. Sie haben ihn durchschaut. Zwar sitzt er hier, in diesem Café, das von le Tout-Paris frequentiert wird, Schulter an Schulter mit echten Künstlern. Doch sie wissen, dass er nur ein kleiner Hilfsarbeiter ist, kein Mann von Welt wie sie. Vincenzos Hand kriecht in Richtung des Flachmanns. Er bräuchte dringend einen Schluck.
Der redselige Mann hat von ihm abgelassen und sich dem Boulevard zugewandt, auf dem er anscheinend ein bekanntes Gesicht erblickt hat. Er ruft etwas. Es klingt russisch. Er kommt aus dem Stuhl hoch, greift nach dem Buch mit dem Holzschnitt und hält es hoch, damit sein Bekannter es vom Trottoir aus sehen kann.
Vincenzo raucht derweil die geschenkte Zigarette. Ein guter Tabak ist das, nicht vergleichbar mit dem Kraut, das er normalerweise konsumiert. Sein Blick fällt auf das dünne Buch, das er vorhin nicht genau sehen konnte. Einband und Papier wirken billig, der Preis ist aufgedruckt – fünfunddreißig Centimes. Dennoch fesselt ihn das farbige Titelbild sofort. Es zeigt Paris bei Nacht. Der Blick geht gen Westen, die Seine hinauf. Im Vordergrund erkennt Vincenzo den Louvre und den Pont Royal. Weiter hinten reckt sich der Eiffelturm gen Himmel. Und über der Stadt, auf der Stadt, steht eine riesenhafte Figur. Sie scheint von jenseits des Horizonts emporzusteigen. Allein ihr Schuh ist so groß wie das Panthéon. Es handelt sich um einen Mann in einem schwarzen Frack. Auf seinem Kopf sitzt ein schwarzer Zylinder, eine Karnevalsmaske verbirgt den oberen Teil seines Gesichts. In der Rechten hält er einen blutverschmierten Dolch. Er scheint Vincenzo anzustarren. Über seinem Zylinder steht in fetten gelben Lettern: »Fantômas«.
Die Figur macht ihm Angst, gleichzeitig fasziniert sie ihn. Einmal so über den Dingen zu stehen wie das Phantom von Paris. Einmal die Macht zu besitzen, die dieser Unbekannte zweifelsohne ausübt. Vincenzo spürt, wie sich etwas in seinen Lenden regt. Peinlich berührt schlägt er die Beine übereinander.
»Die Wirkung ist durchaus beeindruckend, nicht wahr?«
Vincenzo schaut auf. Der Mann im Tweedanzug scheint sein Zauberbuch losgeworden zu sein, zumindest hält er es nicht mehr in der Hand.
»Ja«, erwidert Vincenzo. Mehr bringt er nicht hervor. Seine Kehle ist auf einmal ganz trocken.
»Wie einem Nachtmahr entstiegen, dieser Fantômas. Keine große Literatur, wahrlich nicht. Aber es besitzt eine dunkle Energie, die einen mitreißt. Habt Ihr die Zigomar-Romane gelesen? Nein? Wie schaut es mit Arsène Lupin aus?«
»Ich habe von beiden gehört, aber bisher leider keine Zeit dafür gefunden«, sagt Vincenzo.
Er erhebt sich. Ihm ist auf einmal unwohl, er fühlt sich wie bei einem Verhör. Während er hochkommt, wandert sein Blick erneut zu dem Titelbild. Seine Café-Bekanntschaft greift nach dem Buch, hält es ihm hin.
»Danke, Monsieur, aber … das kann ich nicht annehmen.«
»Ach was, nehmen Sie, nehmen Sie. Ich sehe ja, dass es Sie interessiert. Kein Wunder, wir alle reden nur noch davon. Geniestreich! Und ich habe es schon durch. Ist ein billiges Vergnügen, dieser ›Fantômas‹, aber kein schlechtes. Nur: Falls Sie danach schlecht schlafen, schieben Sie’s bitte nicht mir in die Schuhe.«
Mit einem Lächeln, das keine Widerrede duldet, drückt der Mann Vincenzo das Buch in die Hand. Dieser bedankt sich und macht, dass er fortkommt. Als er schon ein Stück den Boulevard hinauf ist, fällt ihm auf, dass er vergessen hat zu zahlen. Er beschleunigt seine Schritte. An der Porte Saint-Denis biegt er ab, für den Fall, dass ihm ein zorniger Kellner nachkommt. Mehrfach dreht er sich um. Zwar kann er keinen »Tortoni«-Ober ausmachen, dennoch verfestigt sich das Gefühl, dass ihm jemand auf den Fersen ist.
Er rennt nun fast. Nachdem er ein Stück gelaufen ist, drückt er sich in einen Hauseingang. Schwer atmend tastet Vincenzo nach dem Flachmann. Während er die letzten Schlucke trinkt, hält er Ausschau nach den Verfolgern.
Die Luft scheint rein zu sein. Eilig überquert er die Straße, wobei ihn beinahe eine Droschke erfasst. Die Schimpfkanonade des Kutschers ignorierend, geht Vincenzo weiter. Er nähert sich dem Gare de l’Est. Die Gegend ist schäbig, kein Vergleich zu den Grands Boulevards. Vor den Eckkneipen sitzen Arbeiter, viele von ihnen bereits sturzbetrunken.
An einer Ecke bleibt Vincenzo stehen. Immer noch ist er in Sorge wegen etwaiger Verfolger. Er bräuchte dringend etwas für seine Nerven, aber der Flachmann ist leer. Zumindest Tabak hat er. Vincenzo dreht sich eine.
»Hey, Süßer. Hast du auch eine für mich?«
Ein Mädchen löst sich aus dem Schatten eines Hauseingangs. Sie trägt ein Sommerkleid und dreht einen aufgespannten Sonnenschirm zwischen den Fingern.
»Ich bin nicht interessiert, verschwinde.«
»Musste ja nicht. Aber eine Zigarette?«
Vincenzo dreht eine zweite, händigt sie dem Mädchen aus. Sie war vermutlich mal ganz hübsch. Aber die Straße hat ihr zugesetzt. Es fällt ihm schwer, ihr Alter zu schätzen.
»Wie heißt du?«, fragt sie.
»François«, sagt er.
»Ich bin Yvette. Bist du Italiener?«
»Wieso?«
»Meine Mutter kommt aus Kalabrien.«
»Und dein Vater?«
»Witzbold.«
Yvette nimmt einen tiefen Zug, bläst Rauch aus. Irgendwo zwischen den Rüschen ihres Kleids holt sie eine kleine silberne Flasche hervor, nimmt einen Schluck. Vincenzo spürt, wie es in seiner Kehle kribbelt.
»Was arbeitest du, Francesco?«
»Ich bin Maler. Künstler.«
Sie lächelt spöttisch, dreht wieder ihr Schirmchen.
»Und wohnen tuste auf dem Montmartre, was?«
Yvette, oder wie auch immer sie in Wahrheit heißen mag, erwartet augenscheinlich eine originelle Antwort. Stattdessen verpasst ihr Vincenzo eine saftige Schelle. Die Kippe fliegt ihr aus dem Mund, sie taumelt.
»Du Schwein!«, stößt sie hervor.
Schon ist Vincenzo bei ihr. Er schnappt sich das silberne Fläschchen. Dann versetzt er der Dirne einen Stoß vor die Brust. Er schlägt nicht fest zu, er ist ja kein Unmensch. Aber die Wucht reicht dennoch aus, um die zierliche Frau von den Füßen zu heben und auf den Allerwertesten plumpsen zu lassen. Yvette heult auf vor Zorn.
»Dreckiger Makkaronifresser!«
Aber Vincenzo ist bereits um die nächste Ecke. Kurz darauf steht er am Ufer des Canal Saint-Martin. Er lehnt sich an die Brüstung und schnüffelt an dem Fläschchen. Sein Inhalt riecht süßlich. Vincenzo nimmt einen Schluck, spuckt ihn aber gleich wieder aus. Billiger Aprikosenlikör, Weibergesöff, nichts für einen echten Mann mit Durst. Er gießt den Rest in den Kanal, streicht mit der Hand über das Fläschchen. Es scheint aus echtem Silber zu sein. Morgen wird er den Pfandleiher im Italienerviertel fragen, was er dafür bekommt.
Aufgrund seines Glücksfunds etwas milder gestimmt, macht Vincenzo sich auf den Heimweg. Als er in der Rue de l’Hôpital Saint-Louis ankommt, ist es bereits dunkel im Haus. Seine Vermieterin und ihr Mann pflegen früh ins Bett zu gehen. Leise schleicht Vincenzo die Treppe empor. Er betritt sein Zimmer, das nur wenige Quadratmeter misst.
Vincenzo versperrt die Tür und klemmt den Stuhl unter die Klinke, für alle Fälle. Er hockt sich aufs Bett und starrt eine Weile die Wand an. Dann fällt ihm wieder das Buch ein, das der Mann im Café ihm gegeben hat.
Vincenzo ist kein großer Leser. Die einzigen Bücher auf seiner Anrichte sind die Bibel und ein italienisch-französisches Wörterbuch. Aber das Titelbild mit dem Maskierten hat ihn neugierig gemacht. Außerdem ist er hellwach. Er wird wieder die halbe Nacht nicht schlafen können. Zwar hat er noch etwas Medizin, aber dafür scheint es ihm noch zu früh. Er beginnt zu lesen.
»Fantômas.«
»Was sagtet Ihr?«
»Ich sagte: Fantômas.«
»Und was bedeutet das?«
»Nichts … alles!«
»Aber wer ist es?«
»Niemand … und doch, ja, es ist jemand!«
»Und was tut dieser Jemand?«
»Er verbreitet Angst und Schrecken!«
Vincenzo liest weiter. Der Mann mit dem Strohhut hat nicht zu viel versprochen. Die Geschichte ist hoch spannend. Dieser Fantômas scheint kein Mann aus Fleisch und Blut zu sein, er ist tatsächlich ein Phantom. Er ist eiskalt, mordet ohne Reue. Er ist ein Meisterdieb. Fantômas’ unheimliche, beinahe übersinnliche Fähigkeiten verleihen ihm unglaubliche Macht. Ihm ist nicht beizukommen. Den Polypen ist er stets eine Nasenlänge voraus. Besonders Letzteres gefällt Vincenzo.
Nach einer Weile legt er den Roman beiseite, starrt zur Decke. Er hatte gehofft, das Buch werde ihn schläfrig machen, aber er ist noch aufgewühlter als zuvor. Wäre er doch auch so ein verwegener Kerl wie Fantômas. Er stellt es sich vor. Es ist eine schöne Vorstellung.
In der Ferne hört er die Glocken von Saint-Laurent zwei Uhr schlagen. Vincenzo reibt sich die Augen. Er muss wenigstens ein paar Stunden schlafen.
Rasch entkleidet er sich. Unter dem Bett holt er eine Schachtel hervor, entnimmt ihr ein braunes Apothekerfläschchen mit der Aufschrift »Laudanum«. Er gießt ein wenig davon in ein Glas, gibt Wasser und einen Löffel Zucker dazu. Sobald er die Medizin intus hat, schwinden ihm die Sinne. Vincenzo lässt sich aufs Bett fallen, schließt die Augen.
Nachdem er ein, zwei Stunden traumlos geschlafen hat, wird er von einem Geräusch geweckt. Er schlägt die Augen auf. Ein Windhauch weht ihm ins Gesicht. Das Fenster steht offen. Hatte er es geöffnet? Er kann sich nicht erinnern.
Am Bettende steht eine Gestalt.
Vincenzo fährt zusammen, kriecht ans obere Ende des Betts. Im Mondschein ist die Gestalt nur schemenhaft auszumachen. Es handelt sich um einen Mann in Abendgarderobe. Er ist hochgewachsen, und der Chapeau claque auf seinem Kopf lässt ihn noch größer wirken.
»Guten Abend, Vincenzo«, sagt eine tiefe Männerstimme. »Du bist ausersehen, Großes zu vollbringen.«
Der Mann tritt einen Schritt vor. Mondlicht fällt auf sein Gesicht. Vincenzo sieht, dass die obere Hälfte von einer Maske verborgen wird. Dann schwinden ihm die Sinne.
2
Man sollte meinen, es gäbe an solch einem Sommerabend Besseres, als sich in einem stickigen Untergeschoss auf dem Montmartre zusammenzudrängen. Doch vermutlich geht es den meisten wie Jelena: Wenn Victor spricht, vergisst man Konzertcafés und Lustbarkeiten. Man vergisst das Leben, das ist. Stattdessen berauscht man sich an dem Leben, das sein könnte.
»Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist nichts anderes als Terror zum Vorteil der besitzenden Klassen. Von einem reichen Mann zu stehlen, galt schon immer als ein größeres Verbrechen, als einen armen Mann zu töten.«
Jelena steht hinten, neben einem Tisch, auf dem verschiedene Schriften der syndikalistischen Föderation CGT ausliegen: »Das Verbrechen des Gehorsams« oder »Die Unmoral der Ehe«. Die meisten Zuhörer sind Männer, sie versperren der zierlichen Jelena den Blick auf den Redner. Nur ab und an lugt sein Gesicht zwischen den Hinterköpfen hervor. Es ist ein schönes Gesicht, ebenmäßig, mit hohen Wangenknochen, tiefbraunen Augen und einer dichten, beinahe schwarzen Mähne. Victor kann kaum älter als fünfundzwanzig sein. Vermutlich ist er sogar jünger.
»Den reichen Mann zu bestehlen, ist kein Verbrechen. Es ist eine Tugend! Wenn die Gesellschaft dir das Recht am Leben verweigert, musst du es dir nehmen. Die Polizei verhaftet uns im Namen des Gesetzes. Wir schlagen sie im Namen der Freiheit.«
Es gibt zustimmende Zwischenrufe. Als treue Leserin von »l’anarchie« kennt Jelena die Argumentation Victors, der dort unter dem Pseudonym Le Rétif schreibt, in- und auswendig. Doch es ist etwas anderes, seine Ideen zur Propaganda der Tat und zur Individuellen Expropriation vorgetragen zu bekommen.
Victor Kibaltschitschs Augen verschießen Blitze, seine Stimme ist Donner. Dass schon den ganzen Abend eine gewittrige Schwüle über der Butte liegt, erscheint da nur passend. Die Ideen des Anarchismus werden wie ein Sturm über die Welt kommen.
»Denkt«, sagt Victor, »an die Helden von Tottenham.«
Viele Zuhörer nicken aufgeregt. Die Geschichte ist bereits eine Weile her, doch sie gilt vielen Genossen immer noch als leuchtendes Vorbild – oder als abschreckendes Beispiel, je nachdem, auf welcher Seite man steht. In Nord-London stahlen zwei Männer die Lohngelder einer Maschinenfabrik. Die Polizei verfolgte die beiden. Die Anarchisten versuchten, sich den Weg freizuschießen, feuerten auf jeden, der ihnen im Weg stand. Drei Menschen starben, darunter ein zehnjähriger Bursche. Vor allem Letzteres stößt vielen Genossen sauer auf. Einen Polizisten erschießen, natürlich. Aber irgendwelche zufällig Anwesenden? Kinder gar?
Am Ende erschossen die beiden sich selbst – aber erst nachdem sie die expropriierten Lohngelder einem Genossen übergeben hatten. Diese Selbstaufopferung erscheint vielen heldenhaft. Andere halten Tottenham hingegen für Wahnsinn, für den Beweis, dass der Illegalismus eine Sackgasse ist.
»Ich entdecke einen sentimentalen Einwand auf manchen eurer Gesichter: Aber diese armen zweiundzwanzig Menschen, auf die deine Genossen geschossen haben, waren unschuldig! Empfindest du keine Reue?
Nein! Denn jene, die sie verfolgt haben, konnten nur ehrliche Bürger sein, die an Staat und Autorität glaubten. Unterdrückte vielleicht, aber unterdrückte Menschen, die durch ihre kriminelle Tätigkeit ihre Unterdrückung aufrechterhalten: Feinde! Für uns ist der Feind, wer immer uns am Leben hindert. Wir sind diejenigen, die attackiert werden, und wir wehren uns!«
Victor neigt den Kopf und tritt zurück, um zu signalisieren, dass er fertig ist. Applaus brandet auf.
Die Menge beginnt, sich zu zerstreuen. Man drängt hinaus auf die Rue de la Barre, um der stickigen Hitze des Kellers zu entkommen. Auch Jelena steigt hinauf ins Erdgeschoss, wo die Druckpressen und die Papierrollen stehen. Sie tritt hinaus. Zwei Dutzend Männer und Frauen stehen auf dem Trottoir herum. Jemand schenkt Wasser aus. Jelena zöge einen Weißwein vor, aber den gibt es bei »l’anarchie« nur, wenn Raymond »La Science« Callemin nicht anwesend ist. Wie der Vorsitzende einer protestantischen Temperanzgesellschaft wacht der belgische Genosse darüber, dass es streng antialkoholisch zugeht.
Also nimmt sie sich ein Wasser, schaut sich um. In einiger Entfernung steht Rirette, Victors Freundin. Wo sie ist, kann er nicht weit sein, und Jelena ist vor allem gekommen, um Le Rétif einige Fragen zu stellen. Gerade hat sie Kropotkins »An die jungen Leute« durchgearbeitet, und einiges ist ihr unklar.
Als sie an Raymond Callemin vorbeigeht, hört sie ihn sagen: »Nein, nein, Jules. Es ist ja nicht nur der Alkohol. Die Wissenschaft sagt, dass Salz Gift … Oh, Genossin Jelena, guten Abend.«
Jelena hatte gehofft, sich an La Science vorbeischleichen zu können. Aber daraus wird wohl nichts.
»Guten Abend, Genossen«, sagt sie und lächelt die beiden an. Im letzten Moment vermeidet sie es, einen Knicks zu machen. Freie Frauen knicksen nicht, ebenso wie freie Männer nicht dienern. Aber der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Jahrelang hat man sie in Nertschinsk geschlagen, wenn sie vor den Aufsehern nicht knickste. Was einem mit der Birkenrute eingedroschen wurde, lässt sich nicht so leicht ablegen.
»Darf ich bekannt machen«, sagt Raymond, der es liebt, den Zeremonienmeister zu spielen, »Jelena Zhernakowa, eine neue Autorin. Die Genossin hat in der letzten Ausgabe einen bemerkenswerten Text mit dem Titel ›Warum ich Anarchistin bin‹ geschrieben.«
»Sehr erfreut«, sagt Raymonds Gesprächspartner. Er ist älter als sie, wohl Mitte dreißig, und sieht nicht aus wie ein Anarchist. Jelena schaut immer zuerst auf die Kleidung der Leute, denn sie arbeitet als Näherin. Deshalb sieht sie, dass ihr Gegenüber in feinstes Tuch gekleidet ist. Sie erkennt es an der sogenannten Wolke seines Sommerflanells, der Gleichmäßigkeit der Farbübergänge. Jelena tippt auf einen Stoff von Fox Brothers. So etwas kann sich nur jemand leisten, der reich ist – oder die Reichen expropriiert. Welches von beiden trifft wohl auf den Mann mit dem Schnauzer zu?
»Genosse Jules Bonnot«, sagt Raymond. Ein gönnerhaftes Lächeln liegt auf seinem bleichen, jungenhaften Gesicht. Raymond klopft Bonnot auf die Schulter, so als sei der Kerl seine Entdeckung.
Die Blicke Jelenas und Bonnots treffen sich. Ein Schauer läuft ihr den Rücken hinunter. Sie kennt diese Art von Blick. In Paris begegnet er einem nur selten. Doch in Sibirien hat sie viele Männer mit diesem Blick gesehen. Männer, deren Augen sagen, dass sie keine Furcht mehr verspüren. Dass sie alles, was einem Angst machen kann, bereits gesehen, durchlitten oder getan haben.
»Angenehm«, sagt Jelena.
Bonnot nickt ihr freundlich zu.
»Und warum«, sagt er, »seid Ihr Anarchistin?« Seine Stimme klingt wie rostiges Eisen.
Sie will erwidern, dass jene, die über keinerlei Subsistenzmittel verfügen, keine Verpflichtung haben, das Eigentum anderer anzuerkennen, da die Prinzipien des sozialen Pakts zu ihrem Nachteil verletzt werden – und dass sich dieser Gedanke bereits bei Johann Gottlieb Fichte findet.
Stattdessen sagt sie: »Weil ich nicht anders kann.«
»Ihr solltet den Artikel lesen, Jules. Er ist wirklich gut«, sagt Raymond.
»Das werde ich. Wie lautet Euer Pseudonym, Genossin?«
»Voltairine.«
Anders als Raymonds Stimme ist die Bonnots erfrischend frei von Überheblichkeit. Jelena ist fasziniert von ihm, allerdings auf andere Weise als etwa von Victor Kibaltschitsch. Letzterer ist ein Vordenker. Jelena ist sich allerdings nicht sicher, ob er auch handelte, wenn es darauf ankäme. Im Falle von Jules Bonnot hegt sie diesbezüglich keinerlei Zweifel. Die Propaganda der Tat ist für diesen Mann nicht nur bloße Theorie, das spürt sie.
»Und Eurer?«, fragt sie.
»Mein …? Ich habe keines.«
Raymond lacht meckernd.
»Das stimmt nicht ganz. Manche nennen ihn ›Le Bourgeois‹.«
Bonnot verzieht das Gesicht.
»Ich muss mich jetzt verabschieden«, sagt er, »der Genosse Octave Garnier und ich haben noch ein Stück zu fahren.«
»Nach Romainville?«, fragt Raymond.
Jelena weiß, dass eine Gruppe von Genossen östlich der Stadt ein Haus gemietet hat, in dem nach den Prinzipien der Freiheit und des Individualismus gelebt wird. Bonnot nickt stumm, schaut Jelena an.
»Ihr solltet uns einmal in Romainville besuchen, falls …«
»Ja?«
»Falls ihr an der Tat interessiert seid.«
»Vielleicht werde ich das tun. Gute Fahrt, Genosse.«
Bonnot geht zu einem Automobil, das in einiger Entfernung am Straßenrand steht, und beginnt, es fahrbereit zu machen.
Jelena schaut ungläubig zu.
»Er besitzt ein eigenes Auto?«
»Er besitzt jedes Mal ein anderes«, flüstert Raymond.
Sie schaut ihn fragend an.
»Ein beeindruckender Mann, dieser Jules. Gelernter Mechaniker. Ehemaliger Scharfschütze der Armee.«
In diesem Moment schlagen die Glocken einer nahe gelegenen Kirche. Jelena zuckt zusammen.
»Ist es schon sechs?«
Raymond zuckt mit den Achseln.
»Schätze schon. Die Redner haben lange gesprochen, vor allem Victor. Er kann einen wirklich die Zeit verg-«
»Ich muss los.«
Jelena drückt Raymond ihr Wasserglas in die Hand. Er will noch etwas sagen – La Science will immer noch etwas sagen –, aber sie ist bereits fort. Sie wird zu spät kommen, und Monsieur Poiret wird außer sich sein. Er ist bei Weitem nicht der übelste Chef, den sie je hatte, ganz im Gegenteil. Doch der Modeschöpfer neigt zu Jähzorn. In diesem Fall wäre seine Wut wohl sogar gerechtfertigt. Er hat ihr eingeschärft, spätestens um sieben im Atelier zu sein. Sie soll einer Stammkundin bei der Anprobe helfen.
Am liebsten würde Jelena rennen, doch dafür ist der Weg zu steil. Also nimmt sie die Stufen, so schnell es geht. Sie lässt die Sacré-Cœur hinter sich, die viele ihrer Genossen am liebsten in die Luft sprengen würden, weil sie ein revanchistisches Bauwerk ist, weil sie den Montmartre bestrafen soll für seine revolutionäre Gesinnung während der Pariser Kommune. Jelena kommt etwas von Proudhon in den Sinn, seine Kritik an Rousseau, zur Religion als Instrument der Herrschaft. Sie bleibt an einem losen Pflasterstein hängen, stolpert. Erst im letzten Moment fängt sie sich.
Schlag dir die Revolution aus dem Kopf, Mädchen. Zumindest, bis du heil in Paul Poirets Atelier angekommen bist und die Maße dieser Fabrikantentochter oder Bankierswitwe genommen hast.
Jelena erreicht den Boulevard de Clichy. Es ist noch früh am Abend, dennoch herrscht bereits Hochbetrieb. Überall sind Menschen unterwegs, auf dem Weg ins »Moulin Rouge« oder ins »Grand-Guignol«. Die Außenbereiche der Cafés sind proppenvoll, an der Place Pigalle spielen südländische Musikanten eine Tarantella.
Jelena schaut auf die Uhr über dem Eingang der Métro-Station. Es ist Viertel nach sechs. Eigentlich wollte sie zu Fuß zum Atelier laufen, denn Métro-Tickets sind teuer. Von den fünfundzwanzig Centimes kann sie zwei Tage essen. Nun jedoch bleibt ihr keine Wahl. In ihrem schwarzen Umhängebeutel kramt Jelena nach Münzen.
»’tschuldigung, Mademoiselle. Darf ich dich was fragen?«
Als sie aufblickt, schaut sie in das Gesicht eines jungen Mannes. Sein Versuch, sich einen Kinnbart stehen zu lassen, ist spektakulär gescheitert. Er lächelt breit. Zwei seiner Schneidezähne fehlen.
Nach ihrem Dauerlauf atmet Jelena schwer, Flecken tanzen vor ihren Augen. Und so dauert es etwas, bis sie realisiert, mit wem sie es zu tun hat – genauer gesagt, womit. Die keck auf dem Hinterkopf sitzende Mütze, das gestreifte Hemd, die rote Schärpe, die der Jüngling um seine Hüfte gebunden hat – es gibt keinen Zweifel. Nun sieht Jelena auch seine Kumpanen, drei an der Zahl. Sie lehnen in einiger Entfernung an einer Platane und tun so, als seien sie anderweitig beschäftigt.
Apachen. Die haben ihr an diesem Abend gerade noch gefehlt. Diese Banden terrorisieren inzwischen halb Paris. Die meisten ihrer Mitglieder stammen aus den Elendsvierteln. Sie haben keine Arbeit und schlagen sich mit Gaunereien durch. Der Apachismus ist gesellschaftlich erklärbar, aber aus Jelenas Sicht eine Verschwendung revolutionären Potenzials. Wenn all diese jungen Männer doch stattdessen den Klassenkampf aufnähmen.
Aber sie hat keine Zeit, mit dem Kerl über Marx und Engels zu sprechen.
»Bleib mir bloß vom Leib«, blafft sie.
Der Apache breitet beschwichtigend die Arme aus. Seine Hände sind leer, vermutlich hat er das Messer im Ärmel. Wenn sie Glück hat, ist es nur ein Messer.
»Ich wollte ja nur fragen, ob …«
»Ich hab’s eilig, Kleiner. Gib den Weg frei.«
Jelena hat immer noch die Hand in ihrem Täschchen. Sie tastet nach etwas. Der Apache lächelt inzwischen nicht mehr. Er wähnt sich in seiner Ehre verletzt. Dass seine Freunde zuschauen, wie er eine Abfuhr kassiert, macht die Sache nicht besser.
»Jetzt hör mal zu, du kleine Dirne. So spricht man nicht mit den Loups de la Butte.«
Jelenas Hand umschließt den kleinen Deringer. Sie zieht die Pistole aus der Tasche, hält sie dem Apachen direkt vors Gesicht. Sein Blick ist unbezahlbar. Er weicht ein, zwei Schritte zurück. Das reicht Jelena. Schon ist sie am Eingang zur Métro, eilt die Treppe hinab. Hinter sich hört sie wütende Schreie. Im Laufen lässt sie die kleine Pistole wieder in der Tasche verschwinden.
Als die Apachen auf der Treppe auftauchen, ist sie bereits auf dem Gleis. Dort steht ein Zug. Sie steigt ein, rennt durch den Waggon. Glücklicherweise ist er nicht sehr voll. Sie schlängelt sich zwischen Handwerkern, Frauen in Ausgehkleidern und Touristen mit Reiseführern hindurch. Das Blut rauscht in ihren Ohren. Als sie einen Blick aus dem Fenster wirft, sieht sie die Apachen am Fuße der Treppe, zusammen mit zwei erbosten Schaffnern. Einer der Wölfe der Butte hebt den Arm. Eine Messerklinge blitzt auf. Dann setzt sich der Zug in Bewegung. Schweißgebadet lässt sich Jelena auf einen Sitz sinken.
Als sie Poirets Atelier betritt, ist es bereits halb acht. Die Tische mit den Nähmaschinen im Rückgebäude sind verlassen. Auch der Maître selbst ist nirgendwo zu sehen. Jelena geht als Erstes in den Waschraum. Sie hat geschwitzt wie ein Schwein, der Staub der Straße klebt in ihren Haaren und auf ihrem Gesicht. So kann sie weder Poiret noch seiner hochmögenden Kundschaft gegenübertreten, egal, wie spät sie dran ist. Anschreien wird er sie so oder so.
Jelena wäscht sich den Dreck aus dem Gesicht, geht sich durch die Haare. Als sie wieder halbwegs präsentabel aussieht, geht sie zu einem Samtvorhang. Auf dessen anderer Seite befindet sich das eigentliche Geschäft, in dem Poiret Kunden empfängt und Anproben vornimmt. Jelena stellt sich an den Vorhang, lauscht. Sie vernimmt ein leises Trällern. Es klingt nach Verdi. Jelena atmet tief durch, schiebt den Vorhang beiseite.
Poiret lehnt an einem Stehpult und skizziert etwas. Er ist ein kleiner, runder Mann, eine Kugel auf Beinen. Das Jackett seines lindgrünen Anzugs aus Dugdale-Brothers-Leinen hat er abgelegt, die Krawatte ins himmelblaue Hemd gestopft, damit sie ihm beim Zeichnen nicht im Weg ist. Dunkle Flecken bedecken Poirets Rücken und Achselpartien. Wenigstens, denkt sie, bin ich nicht die Einzige, die so schwitzt.
Sie tritt näher. Poiret bemerkt sie nicht, er scheint völlig in seine Arbeit versunken zu sein. Sie kann nun erkennen, dass ihr Chef eine Frau zeichnet. Sie trägt Pumphosen und ein Oberteil, das sich nach unten weitet – ein Lampenschirm auf Beinen. Auf dem Kopf der Frau sitzt ein Turban, von einer Pfauenfeder gekrönt.
Jelena räuspert sich. Poiret fährt herum, fasst sich an die Brust.
»Mein Gott, Mädchen! Schleich dich doch nicht so an.«
»Ich bitte um Verzeihung, Monsieur Poiret.«
»Was gibt es denn, hm? Kann man nicht mal zu dieser späten Stunde in Ruhe arbeiten?«
»Entschuldigt bitte die Störung, aber …«
Er hört ihr nicht zu, hält Jelena stattdessen die Skizze hin.
»Was fällt dir dazu ein? Nur zu!«
Wenn die besitzenden Klassen die Ausbeutung des Proletariats neuerdings dadurch zelebrieren, dass sie sich in die Kostüme osmanischer Sklaventreiber werfen, hat das eine erfrischende Ehrlichkeit.
Das ist es, was Jelena dazu einfällt. Stattdessen sagt sie: »Es sieht wunderbar aus.«
»Wunderbar bequem vor allem, hm? Ach, könnte ich doch auch so etwas tragen. Diese Hitze bringt mich noch um.«
Poiret watschelt zu einem Kabinett, in dem verschiedene Liköre stehen. Er entnimmt ihm eine Flasche Chartreuse Jaune und einen Eiskübel, holt zudem ein kleines Baccarat-Glas hervor. Während er sich eingießt, sagt er: »Aber was gibt es denn jetzt?«
»Ich sollte herkommen wegen einer Anprobe, Monsieur.«
»Ach so?«
An dem Likör nippend, geht Poiret zu einer Schublade, holt ein Kontorbuch hervor. Er blättert darin.
»Ah, Isadora Duncan. Da bist du aber ein bisschen früh dran, hm?«
Jelena ist froh, ihre Tasche hinten im Atelier gelassen zu haben. Ansonsten würde sie nun möglicherweise ihren Deringer zücken und diesem kleinen Wichtigtuer ein Loch in den Wanst schießen.
»Ich, Sie haben …«
Poirets Stirn legt sich bedrohlich in Falten.
»Ich habe was?«
Jelena ist sich sicher, dass er sie für sieben herbestellt hat. Aber wenn sie ihm das sagt, erinnert Poiret sich möglicherweise auch daran, wie sehr er Unpünktlichkeit – Unpünktlichkeit anderer Menschen, wohlgemerkt – verabscheut.
»Ich wollte schon einmal alles vorbereiten. Aber Monsieur haben mir noch nicht gesagt, in welcher Schublade sich Madame Duncans Stücke befinden.«
»Schublade zehn. Und ja, tu das, tu das. Wann genau sie kommt, weiß ich nicht. Diese Kalifornier haben ja überhaupt kein Zeitgefühl. Aber irgendwann taucht sie schon auf, sei unbesorgt. Sie benötigt die Sachen nämlich für eine Vorstellung.«
»Ist sie Schauspielerin?«
Der Modeschöpfer schaut sie verdutzt an. Dann beginnt er schallend zu lachen. Hundert Kilo beben vor Vergnügen.
»Du weißt nicht, wer Isadora Duncan ist?«
Und du weißt nicht, wer Kropotkin ist, du kleiner Bourgeois.
»Ich befürchte, ich weiß es nicht, Monsieur.«
»Sie ist eine Tänzerin! Na, nicht irgendeine. Die Verkörperung des antiken Traums der tänzerischen Darbietung, von der Terpsichore geküsst. Ich glaube, Polignac hat das über sie gesagt.«
Jelena weiß auch nicht, wer Polignac ist.
»Du wirst schon sehen. Die Stücke sind quasi fertig, es geht nur noch um die letzten Änderungen.«
Poiret greift nach seinem Jackett, legt es an. Vor einem Spiegel inspiziert er dessen Sitz, zupft sein Einstecktuch zurecht. Währenddessen wirft er Jelena einen strengen Blick zu.
»Hol die Stücke vor und warte im Geschäft auf sie. Egal, wie lange es dauert, hörst du? Ich muss leider weg. Meine Frau hat sich in den Kopf gesetzt, heute Abend zum Hippodrome de Longchamp zu gehen. Irgendein Hengst«, er kichert, »muss ihr wohl den Kopf verdreht haben.«
Poiret greift nach Spazierstock und Hut, geht zur Tür.
»Und ich will keine Klagen hören, ja? Mach es so, wie sie es will. Sie kann manchmal ein wenig exzentrisch sein.«
»Ihr könnt Euch auf mich verlassen, Monsieur.«
Poiret trinkt den letzten Schluck Likör. Das leere Glas, in dem noch ein Eiswürfel schwimmt, drückt er Jelena in die Hand. Dann tritt er hinaus auf die Straße, winkt nach einem Taxi.
Sobald Poiret außer Sicht ist, lässt Jelena sich auf eine Ottomane niedersinken. Sie fischt den Eiswürfel aus dem Glas, drückt ihn sich in den Nacken. Während das kühle Wasser ihren Rücken hinabläuft, starrt sie durch die Panoramascheiben hinaus auf die Champs-Élysées.
3
Sie sitzen in der »Closerie des Lilas«, natürlich im Außenbereich. Ihr Lohengrin ist immer noch nicht aufgetaucht. Der Mann ist einfach unglaublich. Isadora Duncan fühlt Wut in sich aufsteigen. Am liebsten möchte sie aufspringen und ihren Zorn hinaustanzen, einen wilden Veitstanz aufführen, mitten auf dem Boulevard de Montparnasse, trotz der Hitze, trotz der Leute. Oder vielleicht gerade wegen der Leute. Wenn sie sich halb nackt auf dem Trottoir verrenkt, gibt das einen schönen Skandal. Alle wären außer sich, nicht zuletzt ihr unpünktlicher Paramour.
»Du schaust aber ungehalten, Liebes«, sagt Madeline. Isadoras Begleiterin kommt aus New York, eine alte Bekannte aus früheren Tagen, die gerade eine Europatour macht. Sie ist Malerin, möchte sich von Paris inspirieren lassen. Isadora hat sich wahnsinnig gefreut, Madeline wiederzusehen, obwohl sie ein wenig, nun, ihr fehlt einfach das tiefere künstlerische Verständnis. Ihre Aquarelle sind schrecklich gewöhnlich. Wenn Madeline stattdessen Postkartenansichten irgendwelcher Pariser Straßenmaler kaufte, ersparte sie sich eine Menge Arbeit. Natürlich würde Isadora ihr das nie sagen. Die Wahrheit ist es trotzdem.
»Ich hatte«, sagt Isadora, »gehofft, dir Paris vorstellen zu können.«
Madeline schaut einen Augenblick lang irritiert drein – etwas schwer von Begriff ist sie nämlich auch. Erst nach einer Weile realisiert sie, dass Isadora nicht die Stadt der Städte meint, sondern ihren Liebhaber, Paris Singer.
»Er sieht sehr gut aus, nicht wahr?«
»Das kann man wohl sagen, Maddy. Man weiß ja nie, was sich die Leute denken, wenn sie ihren Kindern Namen wie Desdemona oder Achill geben. Aber im Fall von Paris – oh, er ist einer der schönsten Männer, die ich je gesehen habe. Und stell dir vor: Er ist zwar zehn Jahre älter als ich, aber manche halten ihn für jünger.«
»Das kann ich mir kaum vorstellen, Isa. Du wirkst immer noch wie Mitte zwanzig.«
»Ich danke dir, du kleine Lügnerin. Aber es stimmt natürlich, meine Kunst hält mich jung und straff.«
»Wo ist er denn?«
»Er wollte mich heute Abend ins ›Paillard‹ schleppen.«
»Was ist das?«
»Ein Restaurant.«
Nicht irgendein Restaurant, sondern eines der besten, das die Stadt zu bieten hat. Man serviert dort russische Küche, die, wie Lohengrin zu sagen pflegt, die beste der Welt ist.
Es hat viele Vorteile, Paris Singer zum Freund zu haben. Neben gutem Aussehen und beachtlicher sexueller Ausdauer besitzt Paris ein enormes Vermögen. Seine Lebensmaxime lautet, dieses mit beiden Händen auszugeben. Aber bei dieser Augusthitze La Choucroute Impériale Russe oder Coulibiac zu essen, war nicht nach ihrem Geschmack. Morgen hat sie einen Auftritt, wird also quasi den gesamten Abend in einem großen, dunklen Gebäude verbringen – warum versteht er nicht, dass eine Künstlerin vor solch einem Auftritt das Licht und die Luft braucht?
Sie haben deswegen ein wenig gestritten. Am Ende waren sie übereingekommen, sich lieber in der »Closerie« zu treffen. Doch nun ist es bereits nach neun, und Paris ist immer noch nicht aufgetaucht. Der Mann ist es gewohnt, dass alle Welt auf ihn wartet. Alle Welt, aber sie nicht.
»Er wird bestimmt bald da sein«, sagte Madeline und tätschelt Isadora die Hand. Dann nimmt sie einen weiteren Schluck von ihrem grünlichen Getränk. Maddy hat Isadoras Rat ignoriert und Absinth bestellt. Nun, nach dem zweiten Glas, sieht sie bereits sehr träge aus. Vermutlich wird es ein kurzer Abend.
Für einen Moment schweigen sie. Madelines Blick streift über die Tische und mustert die teils eigenwilligen Gestalten. In der »Closerie« verkehren viele Künstler. Manche sehen abgerissen aus, andere sind herausgeputzt wie Pfauen. Dass es in Montparnasse derart viele Maler und Dichter gibt, ist eine neue Entwicklung. Als Isadora vor einigen Jahren schon einmal in Paris lebte, war der Montmartre die Heimat der hoffnungsvollen jungen Künstler. Inzwischen ist er jedoch ziemlich überlaufen. In jedem Harper oder Baedeker kann man nachlesen, wie pittoresk die Butte sei.
»Oh, schau dir bloß mal den an!«, ruft Madeline etwas zu laut und zeigt zu allem Überfluss auch noch auf den Mann. »Diese, wie sagt man? Montparnos? Die sind ja wirklich was ganz Besonderes.«
Der Herr, der es Madeline angetan hat, trägt einen himmelblauen Knickerbockeranzug nebst passender Kappe. Das pièce de résistance ist jedoch sein Spazierstock, der im selben Himmelblau lackiert ist.
»Das ist ein Engländer. Ich kenne ihn. Willst du ihn kennenlernen?«
»Ist er Maler?«
Isadora überlegt, ob sie Madeline die Wahrheit zumuten soll. Dann sagt sie: »Er ist ein berühmter Bergsteiger. Hat als Erster den K2 bestiegen.«
Madeline kichert albern.
»Und was besteigt er noch so?«
»Oh, Liebes, du solltest jetzt vielleicht wirklich mal einen Orangensaft trinken. Warte einen Moment, ich hole ihn.«
Isadora erhebt sich und geht zu dem am anderen Ende des Außenbereichs sitzenden Paradiesvogel. Vor ihm steht ein Glas Whiskey. Er liest in einem Buch.
»Guten Abend, Aleister.«
Die Stirn des Angesprochenen legt sich in Falten. Sobald er Isadora sieht, hellt sich seine Miene jedoch auf. Umgehend erhebt er sich, nimmt die Ballonmütze ab, verbeugt sich.
»Verehrte Isadora, welch eine Freude! Wie schön, Euch zu sehen.«
»Ich freue mich auch.«
Aleister ist Mitte dreißig, sein kahler Schädel und seine tief liegenden Augen lassen ihn jedoch älter wirken. Man kann sehen, dass er das Leben in vollen Zügen genießt.
Er bedeutet ihr, sich zu ihm zu setzen. Sie schüttelt den Kopf.
»Ich bin mit einer Freundin hier, die gerade Paris besucht. Sie ist wie ich Amerikanerin. Wollt Ihr Euch vielleicht einen Moment zu uns setzen?«
»Es wäre mir eine Ehre.«
Aleister greift sich seinen Drink und sein Buch. Sie gehen hinüber zu Madeline, die den Mann in Himmelblau mit großen Augen betrachtet. Isadora ist sich immer noch nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, die beiden aufeinander loszulassen. Aleister wird möglicherweise von Maddys Gewöhnlichkeit gelangweilt sein. Madeline ist im Gegenzug vielleicht schockiert. Der Mystiker legt es mitunter darauf an, Leute vor den Kopf zu stoßen.
Freilich ist das einer der Gründe, weswegen Isadora eine Seelenverwandtschaft mit Aleister verspürt. Der Mann will Grenzen überschreiten, Mauern niederreißen, genau wie sie. Bei seinen ausgedehnten Reisen durch Indien und den Himalaya hat der Brite tiefe Einblicke in die kosmischen Mysterien gewonnen. Aleister spricht nicht viel darüber, doch Isadora kann spüren, dass er eine tiefe Weisheit besitzt, die weit über das Fassbare hinausgeht.
»Darf ich vorstellen: Madeline Simmonds, Aleister Crowley.«
Aleister stellt sich ihrer Freundin recht artig vor. Er befragt sie zu ihrem Eindruck von London, das Madeline nach ihrer Ankunft in Southampton als Erstes besucht hat. Sie scheint ganz verzaubert von dem himmelblauen Sonderling. Isadora kann es ihr nicht verdenken. Mit seiner Glatze und seinem Bulldoggengesicht ist er nicht unbedingt ein schöner Mann. Aber sein Blick hat etwa Magnetisches. Und dann ist da diese Stimme, die gar nicht zu seiner Statur passen will: ein heller, butterweicher Bariton. Außerdem hat Aleister diesen Midlands-Akzent, er klingt einfach wahnsinnig englisch. Und dafür haben Amerikanerinnen bekanntermaßen eine Schwäche.
Während die beiden plaudern, nippt Isadora an ihrem bereits warmen Weißwein. Sie schaut sich den Rücken des Buchs an, das Aleister noch immer in seiner Armbeuge hält. Es trägt den Titel »Erzketzer & Co.«. Sie deutet darauf.
»Das? Ein sehr bemerkenswertes Buch. Ich habe es gestern bei Galignani gekauft und bereits verschlungen.«
»Ist es ein mystisches Werk?«
»Ja und nein. Kein Buch der Magick im engeren Sinne, aber eine Beschreibung fantastischer, mystischer Reisen. Kurzgeschichten, die an Poe erinnern oder vielleicht an Dunsany.«
»Wer ist der Autor?«
»Ein gewisser Apollinaire. Ich hatte ehrlich gesagt noch nie von ihm gehört. Es war eher …«, Aleister lächelt vieldeutig, »… der Titel, der mich angesprochen hat.«
»Guillaume Apollinaire? Oh, ich kenne ihn. Man sieht ihn öfters mit den Malern. Er ist Kunstkritiker, soweit ich weiß.«
»Ein interessanter Mann, so viel steht fest. Vor allem seine Figur des Ormesan ist großartig, ein verschlagener Abenteurer mit übersinnlichen Fähigkeiten. Sagt, könntet Ihr mir diesen Herrn beizeiten vielleicht einmal zuführen?«
»Vorstellen – ja. Zuführen – nein.«
Aleister lacht dreckig. Madeline schaut, als habe sie den Faden verloren. Ist vielleicht auch besser so.
»Ich wäre Euch zu Dank verbunden. Aber etwas anderes, sagt: Wie kommt Ihr mit den Karten zurecht?«
Nach ihrer Darbietung neulich im »Gaîté Lyrique« hat Aleister sie mit Lob überschüttet. Derlei ist Isadora gewohnt, aber der Mystiker pries nicht nur ihre apollonische Grazie und ihre Ausdrucksstärke. Er sagte, sie besitze ein magisches Bewusstsein. Das zeige sich in ihren Bewegungen. Indem Isadora ihre okkulten Energien auf der Bühne manifestiere, beeinflusse sie das gesamte Publikum, vollziehe einen heiligen Ritus.
Isadora hat viel darüber nachgedacht. Und es stimmt: Ihre Verbindung zum Publikum ist etwas Besonderes, sie selbst kann die Schwingungen spüren. Doch Aleister vermag sie aufgrund seiner langjährigen arkanen Ausbildung sogar zu sehen.
Bei ihrer letzten Zusammenkunft hat der Magier ihr nicht nur ein großes Stück Haschisch geschenkt, sondern auch ein Tarot. Es ist keines dieser alten, italienischen, sondern ein brandneues. Als sie die von der Malerin Colman Smith und dem Mystiker Arthur Waite konzipierten Motive das erste Mal sah, war sie völlig verzaubert.
»Ich arbeite fast täglich damit.«
»Gut. Wer ist Euer Signifikator?«
»Was ist ein Signifikator?«, fragt Madeline, die inzwischen das zweite Absinthglas geleert hat. Ihr Blick ist glasig.
»Ihr kennt das Tarot?«
»Ihr meint Wahrsagerkarten?«
Aleister schüttelt den Kopf. Seine Miene verrät Nachsicht, so als rede er mit einem ungebildeten Bauern, der es nicht besser wissen kann.
»Die Karten offenbaren die Mysterien.«
Er greift in eine Jacketttasche, holt eine abgewetzte, karmesinfarbene Schachtel hervor. Dieser entnimmt er die Karten des Rider-Waite-Smith-Tarots. Er zeigt Madeline einige der Großen Arkana – den Gehängten, den Turm, den Teufel.
»Der Signifikator symbolisiert den Fragesteller. Die Karten, die um ihn herumgelegt werden, sein Schicksal.«
»Und wer bist du, Isadora?«
»Die Königin der Stäbe«, erwidert sie leise.
Es war die offensichtliche Wahl. Mit der Königin der Stäbe hat sie die roten Haare gemein. Die Königin ist voller Feuer, voller Liebe, sie ist Leben, ist Bewegung.
Aleister nickt wissend. »Eine gute Wahl«, sagt er leise. »Aber wer«, er hebt theatralisch die Brauen, »mag unsere gute Madeline wohl sein?«
»Ihr wollt mir die Karten legen?«
»Wenn Ihr mögt? Der Tanz des Schicksals steht jedem offen.«
Als Aleister »Tanz« sagt, fällt es Isadora auf einmal wieder ein. Wie hat sie vergessen können, dass ihr Kostüm für die Aufführung noch bei Paul Poiret liegt? Es sind möglicherweise noch Änderungen zu machen, ansonsten kann sie es morgen nicht tragen. Isadora ist sehr eigen, was ihre Gewänder angeht. Am liebsten tanzt sie natürlich nackt, aber wenn dies nicht möglich ist, will sie sich zumindest fühlen wie im Evakostüm. Die Stoffe müssen sie umfließen wie Wasser. Der einzige Schneider, der das versteht, ist Paul. Deshalb hat sie ihn beauftragt, etwas zu entwerfen, das dem Chiton nachempfunden ist, dem Unterkleid der griechischen Antike.
»Isadora? Ist alles in Ordnung?«, fragt Aleister.
»Ich muss zum Kostümschneider.«
»Jetzt?«, sagt Madeline.
»Ich habe es ganz vergessen. Ach, daran ist nur dieser ganze Aufruhr mit Lohengrin schuld.«
»Lohengrin?«
»Ich meine Paris. Ich nenne ihn manchmal so. Lieber Aleister, ich bin untröstlich, aber ich werde gleich aufbrechen müssen.«
Madeline will sie natürlich begleiten. Isadora bittet ihre Freundin, doch noch sitzen zu bleiben, schließlich sei der Abend jung. Aber Madeline ist müde. Sie einigen sich darauf, dass Isadora die Toilette aufsucht und den Maître bittet, ihnen einen Wagen zu organisieren. Währenddessen kann Aleister ihrer Freundin noch schnell die Zukunft weissagen und dann ebenfalls aufbrechen; nach eigener Aussage hat er für Mitternacht eine Anrufung des Hermes geplant und muss noch Vorbereitungen treffen.
»Es war mir wie immer eine Freude, Isadora.«
»Mir ebenfalls, Aleister. Sagt, habt Ihr von der Séance bei Madame Filine gehört? Werdet Ihr dort sein?«
»Nur, wenn Ihr es auch seid.«
»Dann sehen wir uns. Adieu. Madeline, ich bin gleich zurück.«
Isadora betritt den Schankraum der »Closerie«, geht an der hell beleuchteten Cocktailbar vorbei. Sie winkt einem Kellner, lässt die Abrechnung für ihren Tisch und für den von Aleister machen. Es gibt keinen Grund, zu knausern. Paris Singer hat ihr am Morgen achtlos mehrere Scheine für die Ausgaben der Woche in die Hand gedrückt. Die Summe würde reichen, die ganze »Closerie« einzuladen. Sie bittet den Ober, ihr ein Taxi zu organisieren. An einem Abend wie diesem ist das kein leichtes Unterfangen, weswegen sie ihm ein üppiges Trinkgeld gibt.
Auf der Toilette wäscht sie sich Gesicht, Nacken und Achseln. Seit zwei Wochen ist es unerträglich in Paris, das Wetter erinnert an Südkalifornien. Heute Mittag hatte es vierunddreißig Grad. Viele macht die Hitze schlapp und träge, ihre Freundin ist das beste Beispiel dafür. Maddys irisches Blut ist zu dick für diese Temperaturen. Isadora hingegen bringt die Hitze in Wallung, ständig spürt sie dieses Kribbeln, das ihren Bauch und ihren Rücken hinunterläuft, in Richtung ihres Schoßes.
Sie vergewissert sich, dass sie allein in der Toilette ist. Dann schiebt sie die Hand unter ihr dünnes Kleid, nimmt eine Brustwarze zwischen Daumen und Zeigefinger. Es ist kaum auszuhalten. Wo ist dieser Paris Singer, wenn man ihn braucht? Wäre er da, würde sie ihn anweisen, ihr hier und jetzt Erleichterung zu verschaffen.
Die Tür geht auf. Rasch zieht Isadora ihre Hand zurück. Eine Frau tritt ein. Sie trägt ein Sommerkleid, das die Schultern frei lässt und erstaunlich viel von ihrer olivfarbenen Haut offenbart. Sie ist hübsch. Ihre Nase ist etwas zu groß, aber das findet Isadora durchaus apart. Das Mädchen könnte die Carmen spielen. Isadora schaut ihr nach, bis sie in einer der Kabinen verschwindet.
Während sie zurück zum Tisch läuft, sieht sie vor ihrem geistigen Auge die schöne Spanierin, die Hände ins weiße Laken gekrallt, Schreie der Lust ausstoßend. Sie muss sich zwingen, das köstliche Bild aus ihrem Kopf zu verbannen. Madeline wird sich sonst wundern, was mit ihr los ist.
Als Isadora den Tisch erreicht, sieht sie, dass etwas nicht stimmt. Madeline sitzt stocksteif auf ihrem Platz. Aleister ist fort. Die Blicke der anderen Gäste verraten Isadora, dass etwas vorgefallen ist.
»Maddy, ist dir nicht gut? Waren die Karten ungünstig?«
»Nein, nein. Er hat gesagt, meine Reise werde zu … zu neuen Offenbarungen führen, neuen Ufern.«
Isadora setzt sich.
»Aber das klingt doch wunderbar, Schätzchen.«
Madeline hat die Hände unter dem Tisch. Es sieht aus, als presse sie diese fest in den Schoß. Isadora ahnt etwas. Es würde zu Aleister passen.
»Er … er hat …«
»Seine Hand hingetan, wo sie nicht hingehört?«
»Nein, das nicht.«
»Sondern?«
»Er hat sich sehr höflich verabschiedet und einen Diener gemacht. Dann nahm er meine Hand, und er sagte: ›Madame, darf ich Ihnen den Schlangenkuss geben?‹ Ich konnte ja nicht ahnen, was …«
»Den Schlangenkuss?«
Madeline ist den Tränen nahe.
»Er hat sich vorgebeugt, so als wolle er meine Hand küssen. Und dann hat er, hat er …«
Madeline hebt ihren rechten Arm. Ihre Hand ist mit einer weißen Serviette umwickelt, auf der rote Flecken zu sehen sind.
»… hat er mich gebissen.«