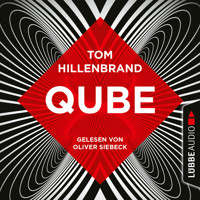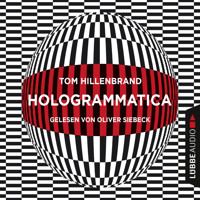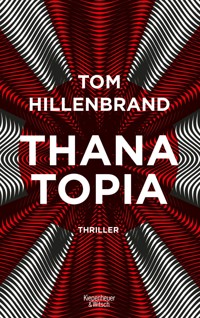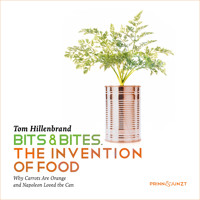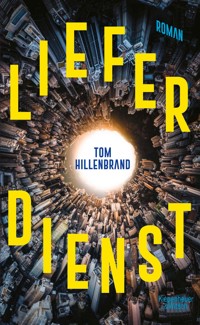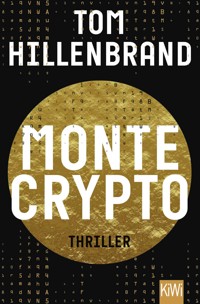Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Xavier-Kieffer-Krimis
- Sprache: Deutsch
»Mach's noch mal, Kieffer!« Radio Bremen Ein Glas Wein, Rieslingspastete und danach ein Stück Quetschetaart mit Sahne – auf der Luxemburger Sommerkirmes lassen es sich der ehemalige Sternekoch Xavier Kieffer und seine Freundin, die Gastrokritikerin Valerie Gabin, richtig gut gehen. Doch in einem Bierzelt drückt ihm ein Fremder plötzlich eine Magnetkarte in die Hand und verschwindet. Am nächsten Morgen wird der Mann unter der Roten Brücke tot aufgefunden. Warum hat er Kieffer diese Karte gegeben? Was hat es mit den Computercodes darauf auf sich? Und warum sind plötzlich so viele Leute hinter ihm her? Der Luxemburger Koch steht plötzlich im Zentrum einer Verschwörung und erkennt, dass seine Freundin in höchster Gefahr schwebt. »Tom Hillenbrand lässt ruhmsüchtige Fernsehköche auftreten, Foodhunter, Nahrungsmittelindustrielle, gemütliche Feinschmecker. Spannend, unterhaltsam und, fürchten wir, gar nicht so unrealistisch.« Der Feinschmecker über »Teufelsfrucht«
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tom Hillenbrand
Letzte Ernte
Ein kulinarischer KrimiXavier Kieffer ermittelt
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tom Hillenbrand
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tom Hillenbrand
Tom Hillenbrand studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Ressortleiter bei SPIEGEL ONLINE. Seine Sachbücher und Romane haben sich bereits hunderttausende Male verkauft, sind in mehrere Sprachen übersetzt, wurden vielfach ausgezeichnet und stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
www.tomhillenbrand.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein Glas Wein, Rieslingspastete und danach ein Stück Quetschetaart mit Sahne – auf der Luxemburger Sommerkirmes lassen es sich der ehemalige Sternekoch Xavier Kieffer und seine Freundin, die Gastrokritikerin Valérie Gabin, richtig gut gehen. Doch plötzlich wird sie von einem Fremden attackiert. Als er verschwindet, hinterlässt er eine Magnetkarte. Am nächsten Morgen wird der Mann unter der Roten Brücke tot aufgefunden. Was wollte er von Valérie Gabin? Was hat es mit der Chipkarte auf sich? Und warum sind plötzlich so viele Leute hinter Kieffer her? Der Luxemburger Koch steht plötzlich im Zentrum einer Verschwörung und erkennt, dass seine Freundin in höchster Gefahr schwebt.
»Tom Hillenbrand regt genussvoll den Appetit der Krimileser an.« Die Welt
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Dank
Glossar: Küchenlatein
Leseprobe »Teufelsfrucht«
Für meine Mutter
1
Er spürte das Brennen in den Armen, merkte, wie seine Beine immer schwerer wurden. »Du wirst es nicht bis zur anderen Seite schaffen«, raunte die Stimme in Piet Malherbes Hinterkopf. Er ignorierte ihre Einflüsterungen und zwang sich, den Rhythmus beizubehalten. Arm nach vorne, unter dem Körper durchziehen, links atmen. Drei weitere Armschläge, rechts atmen. Durch seine Schwimmbrille sah Malherbe den Boden vorbeiziehen, sah seine schwarzen Handschuhe mit den Schwimmhäuten unter sich vorbeigleiten. Der Schmerz in den Muskeln wurde stärker. Als er den Kopf aus dem Wasser hob, um Luft zu holen, konnte er sehen, dass er noch nicht einmal die Hälfte der Bahn geschafft hatte. Verbissen kraulte Piet Malherbe weiter. Er ahnte, dass er bereits hinter der optimalen Rundenzeit lag, die er mithilfe eines Pulsmessers errechnet hatte. Seinem Leistungsprofil zufolge lag diese für fünfzig Meter bei 0:45. Also 1:30 für einen Hundert-Meter-Abschnitt, danach jeweils zwanzig Sekunden Pause. Malherbe schnappte nach Luft. Sein Beinschlag, drei Schläge je Armzug, war ebenfalls aus dem Takt geraten. Und ihm fehlten immer noch zehn Meter bis zur Beckenkante.
Am Bahnende kam Malherbe keuchend aus dem Wasser hoch und schaute auf die Schwimmuhr an seinem Handgelenk. 2:05, fünfzehn Sekunden über der erlaubten Zeit. Er würde die fünfzehn Sekunden von der zwanzigsekündigen Verschnaufpause abziehen müssen, die ihm eigentlich zustand. So sah es sein selbst aufgestellter Trainingsplan vor: Pausieren durfte nur, wer Leistung brachte. Für Schwäche war kein Platz, Schwäche musste bestraft werden, umgehend. Er hatte seine kleine Pause fast vollständig verbummelt, also würde er sofort die nächste Schwimmeinheit absolvieren.
Malherbe wollte sich bereits abstoßen, als er aus dem Augenwinkel das hektisch blinkende rote Lämpchen wahrnahm. Er griff nach der durchsichtigen, mit einem Plastikclip verschlossenen Tüte am Beckenrand, in der sich sein Blackberry befand. Er besaß mehrere Telefone, doch nur dieses nahm er überall mit hin, auch nachts schaltete er es nie aus. Nicht einmal zehn Leute hatten die Nummer. Und sie alle wussten, dass man Piet Malherbe besser nicht wegen einer Lappalie anrief.
Scholz hatte ihn zu erreichen versucht. Der Deutsche war seit über drei Jahren der Sicherheitschef seiner Firma. Malherbe fluchte und drückte die Rückruftaste. Scholz meldete sich nach dem ersten Klingeln mit den Worten: »Guten Abend. Es gibt Entwicklungen in der Kats-Sache.«
Malherbe stemmte sich ein Stück am Beckenrand hoch, um besser telefonieren zu können. Es hatte wieder angefangen zu regnen, Tropfen fielen in den Außenpool und nun auch auf seine Schultern.
»Wissen wir endlich, wo er ist?«
»Wir wissen, wo er war«, erwiderte Scholz. »Da wir aber nicht direkt an ihm dranhängen, sondern nur seiner Datenspur folgen, können wir nie genau sagen, wo er ist. Wir haben immer eine Zeitverzögerung von drei, vier Stunden. Ein Problem asymmetrischer Information.«
Malherbe wusste um Scholz’ bisweilen oberlehrerhafte Art und war für gewöhnlich bereit, diese zu tolerieren. Nach den kolossalen Fehlern, die sein Sicherheitschef sich in den vergangenen Wochen geleistet hatte, verspürte er dazu momentan jedoch nicht die geringste Lust, zumal es bereits gegen Mitternacht ging und er einen anstrengenden Tag gehabt hatte. »Kommen Sie mir nicht mit dieser verquasten Scheiße, Scholz. Ich will einfach nur wissen, wo er ist!«
»Natürlich, Herr Malherbe. Und ich glaube, ich habe die Lösung.«
»Und zwar?«
»Ich würde vorschlagen, dass wir das unter vier Augen besprechen und nicht über das Swisscom-Netz. Soll ich zu Ihnen kommen?«
Scholz hatte natürlich recht. Sicherheit ging vor, und das Thema verlangte absolute Diskretion. »Gut. Kommen Sie so schnell wie möglich hoch.« Dann legte er auf.
Malherbe deponierte den noch immer durch die Plastiktüte geschützten Blackberry am Beckenrand, stieß sich mit den Armen aus dem Wasser und hievte seinen Körper über die Poolkante. Rasch schlang er sich ein Badetuch um die Schultern und eilte den mit Schieferplatten ausgelegten Weg vom in der nächtlichen Kälte der Alpen dampfenden Pool zum Gartenhaus seiner Villa hinauf. Als er dort etwas übergezogen hatte, stieg er die Treppe hinauf ins Hauptgebäude. Sein Haus lag in Mattberg, einem Dörfchen oberhalb des Vierwaldstättersees. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und schaltete die vier wie Schmetterlingsflügel angeordneten Monitore ein.
Scholz würde vom Firmensitz etwa zwanzig Minuten hierher brauchen. Das Hauptquartier des Unternehmens befand sich in Weggis, einer Gemeinde unten am See. Dort hatte der Konzern zwei große Villen und ein altes Kurhotel gekauft und die nebeneinanderliegenden Gebäude zu einem kleinen Campus für die rund hundertfünfzig Mitarbeiter umfunktioniert. Es gab nirgendwo ein Firmenschild, doch die Menschen in Weggis wussten, dass in ihrem Ort einer der mächtigsten Konzerne Europas ansässig war. Die Firma spülte trotz des sensationell niedrigen Gewerbesteuersatzes immense Summen in die Dorfschatulle. Dazu kam das, was Malherbe an Vermögenssteuer zahlte. Allein von diesem Betrag hätte Weggis die Seepromenade renovieren können – jedes Jahr.
Der Vorstandschef schaute auf die vier Monitore. Der Kämmerer von Weggis würde auch in diesem Jahr Grund zur Freude haben, die Aktionäre sowieso. Auf dem rechten oberen Bildschirm sah Malherbe das Saldo aller Börsengeschäfte, die seine Leute heute rund um den Globus getätigt hatten. Er wollte am Ende des Tages stets auf den Rappen genau wissen, wie viel sie verdient hatten. Insgesamt lagen sie im aktuellen Quartal mit nunmehr 6,4 Milliarden Franken im Plus. Malherbe überprüfte die Nachrichtenlage sowie die wichtigsten Indizes jener elektronischen Börsenplattformen in London und Chicago, die auch jetzt noch handelten. Er wollte sich gerade seinen E-Mails zuwenden, als der Pförtner Scholz’ Ankunft meldete.
Malherbe stand auf, ging von seinem Schreibtisch zu einer Sitzgruppe am anderen Ende des loftartigen Arbeitszimmers und ließ sich dort in einen Sessel fallen. Eine Minute später trat Scholz durch die Tür. Er trug wie immer ein weißes Hemd mit Krawatte und darüber einen schwarzen Lederblouson, dessen Ärmel er hochgekrempelt hatte. Scholz’ blondes Haar war raspelkurz geschnitten, der untere Teil seines kantigen Gesichts wurde von einem rötlichen Fünf-Tage-Bart verdeckt. Für den Manager eines Schweizer Finanzkonzerns war das ein eher ungewöhnliches Outfit. Einer von Malherbes Verwaltungsräten, der Scholz in herzlicher Abneigung verbunden war, hatte einst gegiftet, der Sicherheitsberater habe sich diesen Stil wohl von seinem ehemaligen Arbeitgeber abgeguckt.
Das klang wie üble Nachrede, aber Malherbe hatte erstaunt feststellen müssen, dass der Verwaltungsrat recht hatte. Es gab da dieses Foto. Darauf stand Scholz neben Udai Hussein, dem Sohn des ehemaligen irakischen Diktators: beide mit Lederjacke und Krawatte, beide mit hochgekrempelten Ärmeln und Stoppelbart, Arm in Arm, lachend. Udai war eine der widerwärtigsten Gestalten des irakischen Regimes gewesen, ein psychopathischer Sadist. Und der Deutsche hatte als sein persönlicher Sicherheitsberater fungiert. Dank des umfangreichen Hintergrundchecks, den er vor Scholz’ Einstellung hatte durchführen lassen, wusste Malherbe, dass der Dresdner nach dem abrupten Ende seiner NVA-Karriere mit einer Menge Leute gearbeitet hatte, die nicht gerade als große Menschenfreunde bekannt waren. Scholz hatte Syriens Präsident Assad bei der Reform der Geheimpolizei beraten und angeblich sogar die Nordkoreaner. Letzteres war nur ein Gerücht, wenn auch ein durch zahlreiche Indizien unterfüttertes. Man munkelte, Scholz habe für Kim Jong Il mehrere Spezialprojekte abgewickelt. Er hatte seine Spuren perfekt verwischt, was in Malherbes Augen ein weiterer Beweis für die herausragende Kompetenz seines Sicherheitschefs war. Manche im Konzern hielten Scholz’ frühere Nähe zu diversen Diktatoren für ein Zeichen moralischer Verfaultheit. Malherbe hingegen sah diese Engagements eher als Belege dafür, dass Oberstleutnant a.D. Klaus Scholz eine echte Spitzenkraft war. Staatschefs totalitärer Regime besaßen enorm tiefe Taschen und konnten sich als Sicherheitsberater die Besten der Besten leisten – und sie hatten sich alle für Scholz entschieden. Als Malherbe zu Ohren kam, dass der Mann zu haben war, hatte er keine Sekunde gezögert.
Scholz nickte ihm zu und setzte sich wortlos in den Ledersessel, der dem Malherbes gegenüber stand.
»Kaffee?«
»Ja, danke.«
Malherbe gab dem Butler, der diskret hinter einer Ecke auf Befehle wartete, ein Zeichen. »Geben Sie mir ein Update. Was ist passiert?«
Scholz lehnte sich zurück und strich sich mit der Rechten über das stoppelige Kinn. »Wir haben den Verlauf rekonstruiert. Kats ist vor vier Tagen gegangen. Sein letzter Log-in war nachmittags, zwei Stunden war er da im System. Zu wenig Zeit für einen Transfer, vor allem für einen ohne Spuren.«
»Was wollen Sie damit andeuten?«
Scholz lehnte sich vor und schaute Malherbe an. »Das heißt, er hatte das von langer Hand geplant. Ich denke, weitere Untersuchungen werden zeigen, dass er sie bereits vor ein oder zwei Wochen vollständig kopiert hat. Und wenn er das alles tatsächlich seit Monaten vorbereitet hat, wirft es natürlich auch die Frage auf, ob er nur die Daten gestohlen oder auch zusätzlich noch an unserem System herumgeschraubt hat.«
»Hätte er das denn so einfach gekonnt?«
»Nein. Er besaß zwar gewisse Befugnisse, aber umfassende Änderungen am Computersystem hätte er sich von einem Vorstand abzeichnen lassen müssen.«
Der Butler brachte zwei Schümli. Malherbe nippte und umschloss die warme Tasse mit beiden Händen. Ihn fröstelte. Er war sich nicht sicher, ob es daran lag, dass er den obligatorischen Saunagang nach dem Schwimmen hatte ausfallen lassen oder an dem, was ihm Scholz gerade erzählte.
»Ohne Vorstandsbeschluss würde unser EDV-Chef nie die erforderlichen Zugangscodes rausrücken«, fuhr Scholz fort. Er schaute unglücklich. »Aber …«
»Aber was? Ist Ihre Sicherheitsprozedur etwa nicht wasserdicht?«
»Normalerweise würde ich beschwören, dass niemand das System austricksen kann. In diesem Fall liegen die Dinge jedoch anders.«
»Was soll das heißen? Diese Codes sind das Wertvollste, das unsere Firma besitzt. Und Sie wissen nicht, ob dieser Bastard dran rumfummeln konnte?«
Scholz kehrte beide Handflächen nach außen und schaute zu Boden. »Laut Personalakte hat Kats einen IQ von hundertneunundsechzig. Er ist intelligenter als Einstein. Der Mann hat Einblicke in Mathematik und Informationstechnologie, die über alles für Normalsterbliche Vorstellbare hinausgehen. Und deshalb lässt sich nicht ausschließen, dass er trotz unserer extrem umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen einen Weg gefunden hat.«
Malherbe stand auf. »Was schlagen Sie vor?«
»Unsere Experten haben begonnen, das Computersystem zu überprüfen, jede einzelne Zeile Programmcode. Das dauert mehrere Wochen. Wir legen außerdem eine vollständige Kopie an, auf der Basis eines acht Wochen alten Backups. Damit wir umschalten können, falls Kats das System irgendwie manipuliert hat.«
Der Vorstandschef stand auf und lief ein paar Schritte im Raum hin und her. »Sie meinen, falls er ein Löschprogramm oder so etwas hinterlassen hat? Ist solch ein Parallelsystem nicht sehr teuer?«
»Ja, aber die Summe ist bescheiden im Vergleich zu dem, was unsere Leute für einen totalen Systemausfall berechnet haben.« Scholz ohnehin bleiches teutonisches Gesicht hatte jegliche Farbe verloren. »Hundertzwölf Milliarden Dollar.«
Die Stimme in seinem Hinterkopf riet Malherbe, Scholz augenblicklich von all seinen Aufgaben zu entbinden. Durch sein Versagen waren sie an den Rand des Abgrunds geraten. Er ignorierte die Stimme. Wenn er Scholz feuerte, dann würde sein eigener Kopf möglicherweise wenige Stunden später rollen. Sie mussten die Sache irgendwie unter Kontrolle bringen, bevor aus dem potenziellen Schaden ein realer wurde. Die einzige Lösung war, Kats an der Weitergabe der Daten zu hindern. Und dafür brauchte er Scholz.
»Ist das alles, Scholz? Sie schauen, als ob da noch mehr kommt.«
»Ich habe noch eine gute und eine schlechte Nachricht, Herr Malherbe.«
Er musterte den Deutschen. Sein Sicherheitsberater wusste, dass es bei ihrem Gespräch um seinen fürstlich dotierten Job ging und hatte sich deshalb noch einen Trumpf aufgespart. Dumme Spielchen waren das. Malherbe spürte, dass er gleich die Geduld verlieren würde. »Raus damit«, presste er hervor.
»Als Kats hierherkam … Sie wissen von der Silverstein-Green-Geschichte?«
»Ich weiß von nichts!«, zischte Malherbe. Dabei war ihm klar, worauf Scholz anspielte. Bevor Aron Kats ihr oberster Softwarearchitekt geworden war, hatte er mehrere Jahre für Silverstein Green die Handelsstrategie eines der hauseigenen Hedgefonds betreut. Die New Yorker Investmentbank tätigte ganz ähnliche Geschäfte wie Malherbes Unternehmen, und Kats hatte von dort gewisse wertvolle Firmeninterna mitgebracht. Silverstein wusste es, Malherbe wusste es auch. Nur beweisen ließ sich die Sache erfreulicherweise nicht. Und deshalb war es das Beste, nicht darüber zu reden.
»Natürlich«, begann Scholz vorsichtig von Neuem. »Lassen Sie es mich folgendermaßen formulieren. Es gab einmal eine Klage gegen Kats. Silverstein Green bezichtigte ihn vor dem Lower District Court of Manhattan, Daten kopiert und auf Server außerhalb des Einflussbereiches der Bank transferiert zu haben. Die Klage scheiterte. Wir haben damals gegenüber Silverstein an Eides statt versichert, dass uns davon nichts bekannt war. Und der Vorstand unserer Gesellschaft hat Herrn Kats ausdrücklich angewiesen, in seiner neuen Funktion keine möglicherweise unrechtmäßig bei früheren Arbeitgebern erlangten Informationen zu verwenden.«
Malherbe ahnte, worauf Scholz hinauswollte. »Sprechen Sie weiter.«
»Was aber wäre, wenn sich Kats dieser unmissverständlichen Anweisung widersetzt hätte? Was wäre, wenn er aus persönlicher Profitgier gestohlene Codes in unser System eingefügt hätte? Ohne unser Wissen, versteht sich.« Scholz schaute in den Kaffee vor sich, den er bisher nicht angerührt hatte. »Für den Fall, dass dem so wäre, müssten wir davon ausgehen, dass er da draußen mit einem Datensatz herumläuft, anhand dessen ein Experte wohl zweifelsfrei und stichhaltig darlegen könnte, dass wir – ohne es zu wissen, wie ich betone – gestohlene Codes von Silverstein und Enlightment auf unseren Servern liegen hatten.«
»Wieso Enlightment?« Kats hatte früher einmal bei Enlightment gearbeitet, einem weiteren US-Hedgefonds. Davon, dass der Mathematiker auch dort Interna hatte mitgehen lassen, war Malherbe allerdings tatsächlich nichts bekannt. Er schaute fragend.
Scholz nickte nur.
»Sie müssen ihn finden. Schnell. Wo ist er jetzt?«
»Immer noch in Luxemburg, glauben wir.«
»Es wäre besser für das Unternehmen, wenn Sie zur Abwechslung mal etwas wüssten. Vor allem wäre es besser für Sie.«
»Zwei Teams sind bereits dort. Wir hatten ihn schon unter Observation, unsere Leute waren ganz nah dran. Vorhin ist er uns dann entwischt. Aber keine Sorge, Sie wissen doch, wie er tickt. Kats ist ein Gewohnheitstier, und jetzt muss er plötzlich improvisieren, ohne feste Abläufe. Er wird Fehler machen, in Panik geraten, und dann kriegen wir ihn. Außerdem, und das ist die gute Nachricht, haben wir seine Kontaktperson ausfindig gemacht. Er hat ganz augenscheinlich Komplizen.«
»Was für eine Kontaktperson?«
Scholz stand auf, entnahm seiner Jackentasche ein Foto und legte es vor Malherbe auf den Glastisch. Der beugte sich vor und betrachtete das Bild. Es zeigte eine ausgesprochen hübsche junge Frau. Sie mochte Mitte dreißig sein. Ihr ebenmäßiges Gesicht war braun gebrannt, und sie trug ein dunkelblaues T-Shirt, auf dem eine Comicfigur zu sehen war. Ihre langen kastanienfarbenen Haare steckten unter einer Baseballkappe. Im Hintergrund erkannte Malherbe eine Art Festzelt. An einer der Wände hing eine ihm unbekannte Flagge: Blau-weiß gestreift, mit einem roten Bären oder Löwen in der Mitte. »Wer zum Teufel ist das?«
»Wissen wir noch nicht – sie ist ein Gespenst. Wir haben alle Datenbanken durchforstet, aber es scheint überhaupt keine Fotos von ihr zu geben. Meiner Ansicht nach ein weiteres Indiz dafür, dass wir es hier mit Profis zu tun haben. Er hat ihr irgendwas übergeben.«
»Die Daten?«
»Unwahrscheinlich. Meine Männer sagten, es habe sich um etwas Kleines gehandelt. Für die Daten braucht man mindestens einen Koffer, eher zwei.«
»Bringen Sie die Sache in Ordnung, Scholz. Und zwar schnell.«
Der Sicherheitsmann nickte, dann stand er auf und ging. Malherbe nippte an seinem Schümli und schaute sich nochmals das Bild der Frau an. Sie hatte grüne Augen. Wirklich außerordentlich hübsch. Wenn auch vermutlich nicht mehr allzu lange.
2
Keuchend wuchtete Xavier Kieffer die letzte Kartoffelkiste auf das Laufband. Er stemmte die Hände auf die Oberschenkel und schaute schwer atmend zu, wie sie die Schräge hinunterruckelte und im Halbdunkel des Kellers verschwand. Der Koch richtete sich auf und klopfte eine Ducal aus der Schachtel. Fünfundzwanzig Kisten Kartoffeln hatte er beim Großhändler gekauft, aber er fühlte sich, als hätte er hundert davon auf das Transportband gewuchtet. Kieffer zündete die Zigarette an und wischte sich mit der Rechten die schweißverklebten Haare aus dem Gesicht. Es musste am Wetter liegen. Die Sonne stand bereits hoch über der Luxemburger Oberstadt, für heute Mittag hatte der Radiosprecher von RTL zweiunddreißig Grad angedroht. Vielleicht lag es aber auch an den zwei Flaschen Riesling, die er gestern Abend zusammen mit seinem finnischen Freund Pekka Vatanen geleert hatte. Oder an der Tatsache, dass er für derlei Knochenarbeit allmählich zu alt wurde. Kieffer schaute vom Parkplatz des »Deux Eglises« hinauf gen Oberstadt. Er musste seine Augen mit der Hand beschirmen, so hell war das Licht des über der Notre-Dame schwebenden Glutballs. Er spürte ein Stechen hinter seiner Stirn, das sich bis tief in die Schläfen zog. Es war das verdammte Wetter, kein Zweifel.
Nachdem er zu Ende geraucht hatte, trottete Kieffer die Kellertreppe hinunter. Das »Deux Eglises«, dessen Koch und Besitzer er war, lag am Hang des Kirchbergs und war in einem alten Garnisonsgebäude untergebracht. Das Untergeschoss hatten französische, deutsche oder österreichische Besatzer, so genau ließ sich das nicht mehr rekonstruieren, mit Sprengstoff in den Fels getrieben; weit über die Grundfläche des kleinen Gebäudes hinaus erstreckte es sich in den Berg hinein. Angenehme Kühle legte sich auf Kieffers feuchte Stirn, als er den Keller betrat. Er ging vorbei an den Regalen mit Schengener Riesling und Elsässer Gewürztraminer, bog nach links ab und betrat den Raum, in dem das Laufband endete, über das man vom Vorplatz aus Waren in den Keller befördern konnte. Einer seiner Leute hatte die Kartoffelkisten dort bereits säuberlich gestapelt, fast die gesamte Bodenfläche stand damit voll. Xavier Kieffer machte sich daran, sie durchzuzählen. Es waren exakt fünfundzwanzig Boxen à zwanzig Kilo, wie bestellt.
Normalerweise würde er einen ganzen Monat benötigen, um eine derart große Menge Gromperen zu verbrauchen, wie man Kartoffeln in Luxemburg nannte. Doch falls alles gut lief, würde er diese fünfhundert Kilogramm binnen einer Woche verkochen. Denn morgen begann die Schueberfouer, die luxemburgische Version des Oktoberfests. Auf der Place du Glacis gab es dann drei Wochen lang Liebesäpfel und Zuckerwatte, außerdem Fahrgeschäfte und Schießbuden. Vor allem aber galt die Schobermesse Kieffers Landsleuten als willkommener Anlass, sich endlich einmal wieder an Luxemburger Klassikern satt zu essen. Festdeeg si Friessdeeg, wie man im Großherzogtum sagte, und so stopfte man sich auf der Kirmes voll: mit Gebakene Fësch, Fierkel um Spiess und Gromperekichelcher, vor Fett triefenden Reibekuchen.
Kieffer liebte Gromperekichelcher. Schon seit vielen Jahren versuchte er, einen Stand auf der Schueberfouer zu bekommen – ein schwieriges Unterfangen, da der Glacis deutlich kleiner war als die Münchner Theresienwiese und die Luxemburger Kirmes aus allen Nähten platzte. Aber dieses Jahr hatte er endlich eine der heißbegehrten Lizenzen ergattern können. Wochenlang würde er nonstop Fisch und Kartoffelpuffer frittieren. Kieffer überlegte, wie viel Speiseöl er für dieses Unterfangen wohl brauchte. Besser er bestellte gleich noch ein paar Hundert Liter, dann war er auf der sicheren Seite.
Durch seine Kellerpartie erfreulich erfrischt stieg er die Treppe in den noch leeren Schankraum des »Deux Eglises« hinauf. Er ging in sein Büro im hinteren Teil des Restaurants und nahm die Rechnung des Trierer Großhändlers zur Hand, von dem die Gromperen stammten. Als Kieffers Blick auf die Gesamtsumme fiel, stutzte er. Der Koch griff zum Telefon und wählte die Nummer des Großhändlers.
»Gemüse Meinhardt, Guten Tag.«
»Guten Morgen, Wolfgang.«
»Hallo, Xavier. Was gibt’s?«
»Ich rufe wegen der Kartoffeln an. Mit deiner Rechnung stimmt was nicht.«
»Wieso?«
»Ich habe ›Rose de France‹ bestellt, biologischer Anbau, aus der Auvergne.« Kieffer hatte eine ganz bestimmte, vorwiegend festkochende Kartoffelsorte geordert. Er experimentierte für seine in der ganzen Stadt berühmten Gromperekichelchen seit Jahren mit verschiedenen Varianten, und »Rose« war für Reibekuchen am besten geeignet.
»Und? Hast du die falschen bekommen?«, fragte der Großhändler.
»Nein, das nicht. Aber auf der Rechnung steht, dass die Kiste 19,44 Euro kostet, und das kann ja wohl nicht stimmen.«
»Einen Moment.«
Kieffer hörte Tastaturklackern. Er zündete sich eine Zigarette an und wartete. Nach etwa einer halben Minute meldete sich sein Lieferant zurück. »Das Problem ist, dass es sich bei dieser Sorte um einen Exoten handelt. Das Angebot ist sehr begrenzt.«
»Weiß ich, Wolfgang. Aber im Juni hat die Kiste noch die Hälfte gekostet. Und seitdem hat sich der Preis verdoppelt?«
»Leider ja. Irgendjemand muss viel ›Rose de France‹ gekauft haben. Deshalb ist der Preis durch die Decke gegangen. Wenn du es mir nicht glaubst, dann guck dir die Notierung an der Matif an.« Die Matif war die Pariser Rohstoffbörse, an der die Preise für Weizen, Schweinehälften oder Sojabohnen festgelegt wurden – und auch die für Kartoffeln. Alle Großhändler orientierten sich an den Kursen, die dort täglich festgelegt wurden.
»Ich zweifle nicht an deinen Worten, Wolfgang. Aber der doppelte Preis …«
»… vielleicht hätte ich dich nach Bestelleingang noch mal anrufen sollen, Xavier. Tut mir leid. Aber wenn du so große Mengen benötigst, solltest du dir vielleicht einen Future kaufen.«
»Einen was?«
»Eine Kaufoption, die dir garantiert, dass du die Ware zu einem vorher fixierten Preis geliefert bekommst. Kann man im Internet machen.«
Kieffer schnaufte ärgerlich. »Mensch, Wolfgang. Ich wollte Kartoffeln kaufen. Ich bin Koch, kein Börsenhändler.«
»Es tut mir leid, aber die Lebensmittelpreise schwanken in letzter Zeit wieder sehr stark. Keine Ahnung warum, ich habe mir den Mist nicht ausgedacht. Hör zu: Ich gebe dir zwanzig Prozent auf die Rechnung, weil du so ein guter Kunde bist. Oder meinetwegen nehme ich sie auch zurück. Aber nächstes Mal musst du mir einfach Bescheid sagen, wenn deine Order ein Limit hat, okay?«
Order? Limit? Nichts davon fand Kieffer okay. Wenn er sich mit derartigem Unsinn hätte herumschlagen wollen, hätte er einen Job bei einer Investmentbank auf dem Luxemburger Kirchberg angenommen, statt Gromperekichelcher zu frittieren. Aber es half ja nichts – keine Kartoffeln, keine Kirmes. Der Koch dankte dem Großhändler für dessen Entgegenkommen und legte auf. Es würden die unprofitabelsten Reibekuchen in der Geschichte der Schueberfouer werden, aber immerhin die besten.
Kieffer verließ sein Büro und stieg die Treppe ins Obergeschoss hinauf. Das »Deux Eglises«, oder »Zwou Kierchen«, wie es die Einheimischen auch nannten, war nicht sehr groß, das Erdgeschoss bot lediglich dem Schankraum Platz. Die Küche befand sich im ersten Stock. Er und die anderen Köche mussten deshalb viele Male am Tag die dreiundvierzig steinernen Stufen der gewundenen Treppe hinauf- und hinunterklettern. Kieffer machte das nichts aus; Bewegung war schließlich gesund, und dieses Küchenstepping war in Wahrheit neben dem Schleppen von Kartoffelkisten oder Lammkeulen der einzige Sport, den er ausübte.
Oben instruierte er einen Vorbereitungskoch, für morgen früh einen Teil der Kartoffeln zu schälen und Teig für den Backfisch vorzubereiten. Die Küche seines Stands auf der Schueberfouer hatte eine Fläche von drei, höchstens vier Quadratmetern, und er war froh, sich die meisten Zutaten kochfertig anliefern lassen zu können. Dann ging Kieffer wieder auf den Parkplatz, zu seinem Lieferwagen. Er setzte sich hinein und kramte im Handschuhfach nach einem Album der B52s, das sich irgendwo zwischen Quittungsblöcken und zerknüllten Strafzetteln versteckte. Als er die Kassette gefunden hatte, steckte er sie ein und fuhr los.
Kieffers Restaurant befand sich in Clausen, einem der Luxemburger Unterstadtviertel. Im Westen und Süden umgeben vom Bockfelsen lag die ville basse im Alzette-Tal, weit unter der etwa fünfzig Meter darüber thronenden Oberstadt. Auf der Nordostseite Clausens erhob sich das Plateau de Kirchberg, auf das Kieffer nun zusteuerte. Sein Lokal lag direkt am Hang, und so musste man mit dem Auto zunächst im Schritttempo die schmale Rue Jules Wilhelm hinauffahren, bis zu einem mittelalterlichen Torbogen, der vor einer Haarnadelkurve die alte Stadtgrenze markierte. Dahinter schlängelte sich eine Milliounewee genannte Serpentine den Hang empor. Oberhalb der Straße konnte Kieffer bereits die Hochhäuser auf dem Plateau sehen. Jedes Jahr wurden es mehr, und eines Tages würde der Kirchberg vollständig von ihnen bedeckt sein. In seiner Jugend waren dort oben noch große Wiesen gewesen, außerdem Kühe. Dann kamen die Bagger. Zuerst hatte sich die Europäische Union auf dem Berg angesiedelt. In den Neunzigern hatte dann die Finanzbranche Luxemburg für sich entdeckt, Äcker und Wiesen hatten Glasbunker um Glasbunker Platz gemacht. Inzwischen stellten Investmentbanker und Steuerberater auf dem Kirchberg die Mehrheit und hatten die Beamten der EU zahlenmäßig abgehängt, von den Kühen ganz zu schweigen.
Der Milliounewee endete unterhalb der Luxemburger Philharmonie. Von dort steuerte Kieffer seinen Peugeot auf die Avenue John F. Kennedy. Am Ende der breiten Straße konnte er nun bereits das Riesenrad und die Fahrgeschäfte der Schueberfouer erkennen. Kieffer passierte die goldenen Doppeltürme des Europäischen Gerichtshofs, überquerte die Brücke, die sich über die zwischen dem Kirchberg-Plateau und der Stadt liegende Alzette-Schlucht spannte und fuhr auf den Glacis. Nachdem er einem Wächter seinen Ausstellerausweis gezeigt hatte, rollte er langsam einen der Hauptwege hinunter, vorbei an Autoscootern und Wurfbuden. Überall waren Messebauer damit beschäftigt, Stände zu errichten, Gabelstapler fuhren zwischen halb fertigen Kettenkarussells und Geisterbahnen hin und her. In nicht einmal vierundzwanzig Stunden würde die Schobermesse eröffnen, und wie stets bei derartigen Veranstaltungen erschien es völlig undenkbar, dass die Aussteller bis dahin fertig würden. Kein Einziger der Stände, die Kieffer passierte, schien bereit für Kundschaft.
Sein eigener sah zumindest bereits ganz passabel aus. Er besaß, anders als viele der anderen im nördlichen Teil des Geländes, bereits Wände, ein Dach sowie ein angrenzendes Zelt mit Bierbänken. Draußen flatterte eine Girlande mit mehreren kleinen Nationalflaggen in Rot-Weiß-Blau. Im Innenraum hinter der Theke war das Staatswappen angebracht, ein gekrönter roter Löwe auf blau-weiß gestreiftem Grund. Als Kieffer seinen Stand betrachtete, war er froh, beim Namen nicht nachgegeben zu haben. Da sie in gewisser Weise Luxemburger Fastfood anboten, hatte seine Souschefin Claudine dafür plädiert, ihre Frittierbude »McMousel« zu taufen. Der Wortwitz war nicht nach seinem Geschmack gewesen. Auf seinen Einwand, dass er mit diesen amerikanischen Burgerbratern nicht einmal im Entferntesten zu tun haben wolle, hatte Claudine beleidigt reagiert: Er besitze in etwa so viel Humor wie die Preußen jenseits der Grenze. Kieffer war hart geblieben. Nun hieß sein Stand »De Roude Léiw«, der Rote Löwe, und das war auch gut so.
»Moien, Claudine. Alles an der Rei?«
Kieffers Souschefin kniete auf dem Boden und machte sich gerade an der Verkabelung des Herds zu schaffen. »Moien. Alles gut, außer, dass wir noch keinen Strom haben, die Kirmesleitung was an unserem Zelt auszusetzen hat und die Menükarten längst gedruckt sein sollten.«
Der Koch entnahm der Gesäßtasche seiner Cordhose einen kleinen Notizblock und notierte sich die offenen Punkte. »Ich suche einen Elektriker und spreche mit den Spinnern von der Fouer. Die Karten kommen heute Mittag. Wie steht es mit Reservierungen?«
Claudine ließ von der Verteilerdose ab und stand auf. »Wir sind fast die ganze erste Woche gesteckt voll, und auch danach sieht es schon ganz gut aus. Wir werden uns eine goldene Nase verdienen.«
Kieffer beschloss, ihr lieber nichts von den Kartoffeln zu sagen und nickte stattdessen nur. Er würde für die zweite Woche billigere Gromperen auftreiben. Trotz dieses Patzers teilte er Claudines Einschätzung, dass die Kirmes ein gutes Geschäft für sie werden würde. Das »Deux Eglises« war bei den Einheimischen beliebt, weil es eines der wenigen Lokale war, das noch echte Luxemburger Kost servierte: Judd mat Gaardebounen, gepökelten Schweinenacken mit Saubohnen oder Wäinzoossiss mat Moschterzooss, Bratwürste in Senfsauce. Er hatte all seinen Stammkunden vom »Roude Léiw« erzählt – und da sich in der kleinen Stadt alles schnell herumsprach, wusste jeder Liebhaber frittierter Köstlichkeiten inzwischen, dass er hier sein würde. Kieffer fischte eine Ducal aus seiner Lederjacke. Vielleicht musste er doch eine weitere Fuhre der sündhaft teuren »Rose de France« bestellen. Sie schmeckten einfach am besten, und es galt schließlich, seinen Ruf als Kichelchen-König zu verteidigen.
»Apropos Reservierungen, ich brauche für morgen Abend um sieben noch einen Tisch.«
»Für dich?«
»Ja. Pekka kommt vorbei. Und Valérie. Warum lachst du?«
Claudine nahm ein Klemmbrett von der Wand und trug die Reservierung ein. »Na, weil es komisch ist! 19 Uhr, Valérie G-A-B-I-N. Ich werde das Personal informieren, damit man ihr etwas Kaviar auf die Gromperekichelchen streicht.«
»Sie ist überhaupt nicht so«, brummte Kieffer. »Sie mag ehrliches Essen.« Trotzdem musste er zugestehen, dass Valérie in der Imbissbude für Außenstehende tatsächlich eine seltsame Vorstellung sein mochte. Nachvollziehbarerweise wollte Kieffer Valérie seinen Stand auf der Kirmes zeigen. Aber die Französin war eben nicht nur seine Freundin, sondern auch die Chefin des legendären Pariser Gastronomieführers Guide Gabin. Sie aß wöchentlich in Sternerestaurants auf der ganzen Welt, und die Vorstellung, dass La Gabin in einem Zelt Reibekuchen von einem Pappteller aß, war auf jeden Fall ungewöhnlich.
Kieffer freute sich auf das Treffen mit ihr, denn er hatte sie seit über vier Wochen nicht gesehen. Valérie war auf einer kulinarischen Tour durch Asien gewesen, danach in Russland. Er hatte schon befürchtet, sie würde ihr Treffen in Luxemburg absagen, doch bisher sah es so aus, als komme sie. Bereits in drei Stunden würde die Maschine aus Moskau auf dem Flughafen von Findel landen.
Kieffer lächelte. »Ich finde, unsere Gromperekichelchen hätten durchaus einen Stern verdient.«
3
Es gab ein lautes Zischen, als Kieffer die Wäinzoossiss und die Merguez wendete und das Fett in die Glut tropfte. Als er sämtliche Würstchen umgedreht hatte, schaute er zu seinen Gästen hinüber. Am Gartentisch hinter seinem Haus saßen Pekka Vatanen, Valérie sowie eine weitere Frau in der Abendsonne. Der schlaksige Finne gestikulierte lebhaft und schien sich sehr für das T-Shirt der Pariserin zu interessieren. Das beunruhigte Kieffer nicht sonderlich; Pekkas neuer Flamme hingegen stand die Eifersucht ins Gesicht geschrieben. Es war ihm ein Rätsel, wo sein bester Freund immer all diese hinreißenden Geschöpfe auftrieb. Gab es in der EU-Verwaltung oben auf dem Kirchberg derart viele einsame Herzen? Es schien so, denn alle vier bis sechs Monate wechselte die Begleitung des Finnen. Es handelte sich stets um den südländischen Typ, dem Vatanen nach eigenen Angaben »völlig verfallen« war: markante Nase, olivfarbene Haut, kurvige Figur. Diese Attribute galten als gesetzt, der Abteilungsleiter für agronomische Analysen ließ lediglich bei der Nationalität seiner Gespielinnen Variationen zu. Seine aktuelle Freundin hieß Maria und war Spanierin. Davor hatte es sich um eine Korsin gehandelt, wenn sich Kieffer richtig erinnerte. Es war schwer, den Überblick zu behalten. Kieffer überprüfte die Glut. Die Sache mit den Frauen irritierte ihn. Es war nicht Neid, der ihn den Kopf über Vatanens Eskapaden schütteln ließ – er war noch immer in Valérie verliebt und außerdem überzeugter Monogamist. Was ihn verwunderte, war schlichtweg, wie der Mann das anstellte. Vatanens enormer Schlag beim anderen Geschlecht wäre erklärbar gewesen, hätte der Finne über Geld, Berühmtheit oder ein sportliches Äußeres verfügt. Aber Pekka war – und Kieffer betrachtete ihn aufgrund ihrer langjährigen Freundschaft sehr wohlwollend – ein versoffener fünfundvierzigjähriger EU-Beamter, spindeldürr und mit bereits sehr lichtem blonden Haar. Seine Haut war fahl, »gesunde Bürobräune«, wie er selbst zu sagen pflegte. Einzig die Nase hatte etwas Farbe, vor allem dann, wenn der Finne wieder einmal dem Riesling zusprach. Die Spanierin sagte etwas zu Vatanen, stand dann auf und zog ihren knapp bemessenen Rock zurecht. Dann stöckelte sie durch die Küchentür ins Haus.
Kieffer fluchte. Fast wären ihm die Bratwürste angebrannt. Rasch transferierte er Wäinzoossiss und Lammwürste auf eine bereitstehende Platte. Dazu stellte er ein kleines Schüsselchen mit Senfsauce sowie eines mit Harissa, einer scharfen libanesischen Chilipaste. Zum Schluss holte er mit einer Zange noch gegrilltes Gemüse vom Rost und träufelte mit Knoblauch, Thymian und Fenchelsamen aromatisiertes Olivenöl darüber. Dann ging er zu seinen Gästen.
Maria war gerade dabei, wieder Platz zu nehmen. Kieffer hatte schon befürchtet, sie sei geflohen. Vatanen war immer noch mit Valéries T-Shirt beschäftigt; aus der Nähe konnte Kieffer nun aber erkennen, dass der Finne sich offenbar weniger für dessen Inhalt als vielmehr für den Aufdruck interessierte.
»Und woher genau stammt diese Comicfigur? Habe ich noch nie gesehen. Ich dachte immer, das Logo des Guide Gabin ist ein goldenes G. Das ist zumindest vorne auf euren blauen Gastroführern aufgedruckt.«
»Das stimmt auch, Pekka«, antwortete Valérie. »Aber in den Zwanzigerjahren, als mein Großvater Auguste den Gabin gründete, da gab es auch diese Werbefigur: Georges, le p’tit chef.«
Sie zog mit beiden Händen die Frontpartie ihres T-Shirts glatt, sodass die darauf abgebildete Figur besser zu erkennen war. Es handelte sich um einen kleinen kugelrunden Mann mit Schnauzbart, auf dessen Kopf eine lächerlich große Kochmütze saß; die Toque war fast so hoch wie das Männchen. Georges, der kleine Koch, grinste breit. Mit Daumen und Zeigefinger der zum Mund erhobenen linken Hand formte er einen Kreis, in seiner rechten hielt er einen überdimensionierten Holzlöffel.
Vatanen legte den Arm um seine Begleiterin und signalisierte ihr, ihm Riesling nachzuschenken. »Danke, mi corazón. Und wieso heißt er Georges?«
»Das weiß man nicht mehr so genau. Die Werbefigur ist vom Gabin nur in den Zwanzigern und frühen Dreißigern verwendet worden, danach fand man sie zu unmodern oder vielleicht auch zu unseriös. Unsere Mitarbeiter mussten das halbe Hausarchiv durchforsten, bis sie die alten Vorlagen fanden. Ich glaube, dass er Georges heißt, weil der Name mit G anfängt, wie Guide Gabin. Möglicherweise ist es auch eine Verneigung vor Georges Auguste Escoffier. Mein Großvater war gut mit ihm befreundet, und ich finde, der kleine Koch sieht ihm ein bisschen ähnlich.«
»War das ein Koch?«, fragte Vatanen.
»Ja, einer der berühmtesten Köche des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Derjenige, der die klassische französische Küche eigentlich erfunden hat.«
Kieffer stellte die Platte ab. »Ah!«, rief Vatanen. »Richtiges Essen.« Er grunzte wie ein Neandertaler und sagte: »Fleisch auf Feuer gut.« Der Finne wandte sich seinem Gastgeber zu. »Wolltest du noch einmal etwas Vernünftiges essen, bevor du dich ab morgen mehrere Wochen lang ausschließlich von frittierter Kartoffelpampe ernährst?«
»Ich mag Gromperekichelcher, Pekka. Aber es könnte tatsächlich sein, dass ich sie nach der Schueberfouer etwas satthabe.«
Kieffer verteilte die Wäinzoossiss und das Gemüse, dann öffnete er eine weitere Flasche Schengener Riesling. Während sie aßen, fiel ihm wieder einmal auf, was für ein Glücksfall sein Garten war. Dieser lag zwischen seinem kleinen Haus in der Rue St. Ulric und dem Fluss Alzette, der durch das Unterstadtviertel Grund murmelte. Gut geschützt vor den Blicken Fremder und fernab der Straße ließ sich hier wunderbar im Liegestuhl dösen oder mit Freunden vespern. Es gab nichts Besseres, man würde ihn hier mit den Füßen zuerst hinaustragen müssen.
Vatanen zeigte mit seiner Gabel auf Georges. »Und jetzt habt ihr dieses Maskottchen wiederbelebt?«
Valérie nickte. »Unsere Marketingleute meinen, so eine Kultfigur im Archiv verschimmeln zu lassen, sei eine Sünde. Mein T-Shirt ist nur ein Probedruck, unsere Werbeagentur feilt noch an der Kampagne. Aber dann wollen wir den kleinen Koch wieder überall einsetzen und Merchandise verkaufen – P’tit-Georges-Puppen, Baseballkappen, Vintage-Emailleschilder, das ganze Programm.«
»Das hat aber eigentlich nichts mit Haute Cuisine und Gastroführern zu tun, oder?«, brummte Kieffer.
»Nicht im engeren Sinne. Aber ein bisschen mehr Coolness könnte dem Gabin nicht schaden. Es gibt viele Leute, die halten den Guide für etwas angestaubt. Die Geschäfte liefen … schon mal besser.«
»Was ist denn das Problem?«, fragte Kieffer.
Vatanen kicherte. »Sie verkauft dicke gedruckte Bücher, in denen Restaurants aufgelistet sind. Das ist das Problem.«
Valérie schüttelte den Kopf. »Wir sind nicht ganz so rückständig, wie du denkst. Es gibt den Guide Gabin natürlich auch im Internet. Das Problem ist eher, dass Frankreich nicht mehr der unbestrittene Mittelpunkt des gastronomischen Universums ist. Und deshalb werfen uns manche vor, wir seien zu wenig international, zu gallisch, zu foie-gras-fixiert, was weiß ich.«
Kieffer legte den Arm um seine Freundin. »Also für mich bleibt ihr immer der kulinarische Mittelpunkt.«
»Ja, aber für dich ist U2 auch immer noch die größte Band der Neuzeit«, frotzelte Vatanen. »Da ich fast ausschließlich ins ›Deux Eglises‹ gehe, müsst ihr Kulinariker mir jetzt mal helfen. Wo liegt das neue kulinarische Paradies denn heutzutage eigentlich?«
Maria reckte das Kinn nach vorne und sagte laut und bestimmt: »in España.« Es war das Einzige, was sie an diesem Abend sagte.
4
Mit bloßen Händen riss Valérie Gabin ein Stück von ihrem Gromperekichelchen ab und biss hinein. Kieffer beobachtete seine Freundin, während sie mit einem Plastikmesser etwas Crème fraîche auf den Kartoffelpuffer strich. In Luxemburg gab es dazu kein Apfelmus, eher aß man die Reibekuchen mit etwas Herzhaftem wie einem Bouneschlupp genannten Eintopf oder eben mit Sauerrahm.
»Lecker sind die. Interessant, dass ihr gehackte Petersilie reintut, habe ich noch nie gesehen«, sagte Valérie. Sie stupste ihn mit der Nase an die Wange. »Und sie riechen genauso wie du.«
Kieffer verstand, was sie meinte. Den ganzen Nachmittag hatte er in der kleinen Küche des »Roude Léiw« gestanden und in siedendem Fett Hunderte Kichelcher goldgelb gebacken. Es war inzwischen fast zwanzig Uhr, und er machte sich etwas Sorgen, ob die Kartoffeln bis zum Ende des Fouertages reichen würden. Denn der Andrang übertraf alles, was er erwartet hatte.
Es mochte an seinen köstlichen Gromperekichelcher liegen, vielleicht aber auch am Wetter. Der häufig wolkenverhangene Luxemburger Himmel zeigte sich heute in seltenem Knallblau, es waren immer noch fünfundzwanzig Grad. Nicht nur das gesamte Großherzogtum schien sich auf dem Glacis eingefunden zu haben, sondern auch Ausflügler-Bataillone aus Lothringen, dem Saarland und der Eifel. Wie zäher Teig wälzte sich die Menschenmasse über die Fouer, quetschte sich durch die zu engen Gänge, drang in jede Ecke und Ritze. Alle Plätze in Kieffers Zelt waren belegt, vor dem Stand und im Eingangsbereich drängten sich die Menschen aneinander.
Viele waren wegen der Band gekommen, die Kieffer als Stëmmungskanoun engagiert hatte. Eine Sängerin schmetterte seit mehreren Stunden alte luxemburgische Zech- und Fresslieder:
Bei einem kühlen Humpen
Da saß Cojellico’s Jang
Mit einem Zigarstumpen
Und einem Belschen Frang
Ihm graute vor dem Bezahlen
Er dachte mit Schreck an sein Kett
Gedachte mit höllischen Qualen
Des Besens neben dem Bett
Viele der Einheimischen sangen mit. Der Lärm war ohrenbetäubend, die Stimmung prächtig – sah man von jenen kleineren Streitereien ab, zu denen es zwischendurch immer wieder kam. Diese waren angesichts der Enge und des reichlich fließenden Moselweins allerdings nichts Besonderes, und so schenkte Kieffer dem Gerangel im vorderen Teil des »Roude Léiw« zunächst keine Beachtung, sondern sah Valérie lieber weiter beim Essen zu. Das war eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Sie hatte ihren ersten Kartoffelpuffer vertilgt und wandte sich nun dem zweiten zu. Als das vom Eingang zu ihm herüber dringende Gezeter jedoch immer lauter wurde, stand Kieffer auf, um sich die Sache genauer anzuschauen.
Ein hagerer Mittdreißiger versuchte, an den anderen Gästen vorbei ins Zelt zu gelangen. Der Mann hatte das Kinn auf die Brust gesenkt, die Arme vor dem Bauch verschränkt und rempelte sich durch die Menge wie ein Rugbyspieler, der mit dem Ball geradewegs durch die Abwehrkette will. Er schob und schubste, Kieffer sah einen Becher fliegen. Die anderen Gäste reagierten auf dieses rüpelhafte Verhalten mit wütenden Flüchen und Ellbogenknuffern. Kieffer betrachtete den Mann, der etwa zehn Meter von ihm entfernt war. Er trug ein froschgrünes Button-down-Hemd und eine Nickelbrille, hinter der vor Aufregung geweitete Augen zu sehen waren. Sein Gesicht hatte einen seltsam konzentrierten Ausdruck, und er schien mit sich selbst zu reden, während er sich einen Weg durch die Menge bahnte. Mit rudernden Armen brach der Mann aus dem Menschenknäuel hervor.
Den Stachel trug er im Herzen
Den belschen Frang in der Täsch
Und voll Verzweiflungsschmerzen
Bestellte er eine Fläsch
Die an den Tischen sitzenden Gäste warfen ihm argwöhnische Blicke zu. Bevor Kieffer reagieren konnte, tauchten hinter dem ungehobelten Gast zwei weitere Männer auf. Einer versuchte, den Nickelbrillenträger zu fassen zu bekommen, griff jedoch ins Leere. Denn der Mann hatte inzwischen einen Satz nach vorne gemacht und lief nun torkelnd auf Kieffer zu. Der wohlgenährte Koch baute sich vor ihm auf. Es war ohnehin nicht viel Platz zwischen den Tischen, und er füllte den schmalen Gang komplett aus. Hier war Endstation. »Ganz ruhig, junger Mann. Was ist denn das Problem?«
Der Kerl sah ihm nicht ins Gesicht, sondern starrte weiter zu Boden und murmelte dabei ununterbrochen vor sich hin. Er sprach Englisch, mit einer seltsam hohen, knödelnden Stimme, zwischen den Wogen von Musik und Gelächter drangen nur Wortfetzen zu Kieffer hinüber: »659, 661. 809, 811. 821, 823 … 1019, 1021 …«
Was zählte der da?, fragte er sich. Der Gast mit dem knallgrünen Hemd war zweifelsohne ein seltsamer Bursche – wobei Kieffer auf der Fouer schon ganz andere Dinge gesehen hatte.
Wie tief bist du gesunken