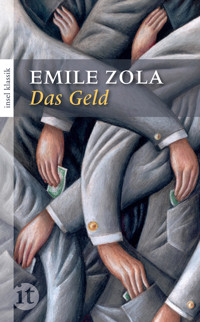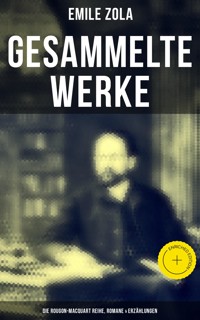Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mittelpunkt des vierten Teils des Rougon-Macquart-Zyklus von Émile Zola ist ein Kleriker, dessen Intrigen Unglück über eine ganze Familie bringen: Als der Abbé Faujas mit seinen Verwandten bei der Familie Mouret einzieht, gewinnt er bald die Oberhand und drängt die Mourets ins Abseits. Aus politischem Kalkül treibt er nicht nur die psychisch labile Marthe in den religiösen Wahn, sondern er schafft es auch, deren Mann, den Hausherrn François, mit Anschuldigungen außer Gefecht zu setzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emile Zola
Die Eroberung von Plassans
Übersetzt Gerhard Schewe
Saga
Die Eroberung von Plassans ÜbersetztGerhard Schewe OriginalLa conquête de PlassansCoverbild/Illustration: Shutterstock Copyright © 1874, 2020 Emile Zola und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726683301
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
KAPITEL I
Désirée klatschte in die Hände. Sie war ein Kind von vierzehn Jahren, kräftig für ihr Alter und hatte das Lachen eines fünfjährigen Mädchens.
„Mama, Mama!“ rief sie. „Sieh mal, meine Puppe!“
Sie hatte ihrer Mutter ein Stückchen Stoff weggenommen, an dem sie seit einer Viertelstunde herumarbeitete, um eine Puppe daraus zu machen, indem sie es zusammenrollte und an einem Ende mit Hilfe eines Fädchens abschnürte.
Marthe blickte von dem Strumpf auf, den sie mit einer Sorgfalt stopfte, die man bei einer Stickerei aufwendet. Sie lächelte Désirée zu.
„Das ist ja ein Wickelkind“, sagte sie. „Da nimm, mach eine Puppe. Du weißt, sie muß einen Rock haben wie eine Dame.“ Sie gab ihr einen Flicken Indienne, den sie auf ihrem Arbeitstisch fand; dann machte sie sich wieder sorgsam über ihren Strumpf her.
Sie saßen beide an einem Ende der schmalen Terrasse, das Mädchen auf einer Fußbank zu Füßen der Mutter. Die untergehende Sonne, eine noch warme Septembersonne, badete sie in ruhigem Licht, während der Garten vor ihnen schon in grauem Schatten einschlief. Kein Geräusch stieg draußen von diesem verlassenen Winkel der Stadt auf. Unterdessen arbeiteten sie schweigend reichlich zehn Minuten. Désirée gab sich unendliche Mühe, ihrer Puppe einen Rock zu machen.
Hin und wieder hob Marthe den Kopf und betrachtete das Kind mit etwas trauriger Zärtlichkeit. Als sie sah, daß es Désirée sehr schwerfiel, fing sie wieder an:
„Warte, ich werde ihr die Arme ansetzen.“
Sie nahm die Puppe, als zwei große Burschen von siebzehn und achtzehn Jahren die Freitreppe herabkamen. Sie küßten Marthe.
„Schimpf nicht mit uns, Mama“, sagte Octave heiter. „Ich habe Serge zur Musik mitgenommen . . . Es waren viele Leute auf dem Cours Sauvaire!“
„Ich habe geglaubt, ihr wäret im Gymnasium aufgehalten worden“, murmelte die Mutter, „sonst wäre ich recht unruhig gewesen.“
Aber Désirée hatte sich, ohne weiter an die Puppe zu denken, Serge an den Hals geworfen und klagte ihm laut:
„Mir ist ein Vogel weggeflogen, der blaue, den du mir geschenkt hast.“ Sie hätte am liebsten geweint. Ihre Mutter, die diesen Kummer vergessen glaubte, zeigte ihr vergeblich die Puppe. Sie hielt ihren Bruder am Arm, und während sie ihn zum Garten hinzog, wiederholte sie mehrmals: „Komm sehen!“ Serge folgte ihr in seiner bereitwilligen Sanftheit und suchte sie zu trösten. Sie führte ihn zu einem kleinen Gewächshaus, vor dem ein Käfig auf einen Sockel gestellt war. Dort erklärte sie ihm, daß der Vogel in dem Augenblick entflohen sei, als sie die Tür geöffnet habe, um ihn daran zu hindern, sich mit einem anderen zu balgen.
„Bei Gott! Das ist nicht verwunderlich“, rief Octave, der sich auf das Terrassengeländer gesetzt hatte, „sie ist immerzu dabei, sie anzufassen, sie sieht nach, wie sie beschaffen sind und was sie in der Kehle haben zum Singen. Neulich hat sie sie einen ganzen Nachmittag lang in ihren Taschen spazierengetragen, damit sie es schön warm hatten.“
„Octave!“ sagte Marthe in vorwurfsvollem Ton. „Quäle das arme Kind doch nicht.“
Désirée hatte nichts gehört. Sie erzählte Serge in allen Einzelheiten, auf welche Weise der Vogel weggeflogen war.
„Siehst du, so ist er entwischt, er hat sich nebenan auf Herrn Rastoils großen Birnbaum gesetzt. Von da ist er hinten auf den Pflaumenbaum gehüpft. Dann ist er über meinen Kopf wieder zurückgekommen und ist in die hohen Bäume der Unterpräfektur 1 geflogen, wo ich ihn nicht mehr gesehen habe, nein, überhaupt nicht mehr.“ Tränen stiegen ihr in die Augen. „Vielleicht kommt er wieder“, wagte Serge einzuwerfen.
„Meinst du? — Ich möchte die anderen am liebsten in eine Schachtel sperren und den Käfig die ganze Nacht über offenlassen.“
Octave konnte nicht umhin zu lachen; aber Marthe rief Désirée zurück.
„Komm doch mal sehen, komm doch mal sehen!“
Und sie hielt ihr die Puppe hin. Die Puppe war prächtig, sie hatte einen steifen Rock, einen aus einem Stoffbausch geformten Kopf, und ihre Arme waren aus einem Band gemacht und an den Schultern festgenäht. Eine plötzliche Freude erhellte Désirées Gesicht. Sie setzte sich wieder auf die Fußbank, dachte nicht mehr an den Vogel, küßte die Puppe, wiegte sie mit kleinmädchenhafter Kindlichkeit in der Hand.
Serge war neben seinen Bruder getreten und stützte sich mit den Ellenbogen auf das Terrassengeländer. Marthe hatte ihren Strumpf wieder zur Hand genommen.
„Nun“, fragte sie, „hat die Musik gespielt?“
„Sie spielt jeden Donnerstag“, antwortete Octave. „Es ist nicht recht von dir, Mama, nicht hinzukommen. Die ganze Stadt ist da, die Fräulein Rastoil, Madame de Condamin, Herr Paloque, die Frau und die Tochter des Bürgermeisters . . . Warum kommst du nicht?“
Marthe blickte nicht auf; sie murmelte, während sie ein Loch fertigstopfte:
„Ihr wißt doch, Kinder, daß ich nicht gerne fortgehe. Ich bin hier so ungestört. Außerdem muß jemand bei Désirée bleiben.“
Octave öffnete die Lippen, aber er sah seine Schwester an und schwieg. Er blieb da, pfiff leise vor sich hin, schaute zu den Bäumen der Unterpräfektur hoch, die vom Spektakel schlafen gehender Spatzen erfüllt waren, und musterte Herrn Rastoils Birnbäume, hinter denen die Sonne unterging. Serge hatte ein Buch aus seiner Tasche hervorgeholt, das er aufmerksam las. Es herrschte eine andächtige, von stummer Zärtlichkeit warme Stille bei dem angenehmen gelben Licht, das nach und nach auf der Terrasse verblich. Marthe, die inmitten dieses Abendfriedens keinen Blick von ihren drei Kindern ließ, machte lange, regelmäßige Stiche.
„Kommt denn heute alles zu spät?“ fing sie nach einer Weile wieder an. „Es ist gleich sechs Uhr, und euer Vater kommt nicht nach Hause . . . Ich glaube, er ist nach Les Tulettes hinübergegangen.“
„Ach ja!“ sagte Octave. „Dann ist das nicht verwunderlich . . . Die Bauern von Les Tulettes lassen ihn nicht mehr los, wenn sie ihn haben . . . Handelt es sich um einen Weinkauf?“
„Ich weiß es nicht“, antwortete Marthe, „ihr wißt ja, daß er nicht gern von seinen Geschäften spricht.“
Von neuem trat Schweigen ein. Im Wohnzimmer, dessen Fenster zur Terrasse hin weit offenstand, deckte die alte Rose seit einer Weile den Tisch und klapperte mit dem Geschirr und dem Tafelsilber. Sie schien sehr schlechter Stimmung zu sein, stieß die Möbel hin und her und brummelte abgehackte Worte. Dann pflanzte sie sich an der Tür zur Straße auf, reckte den Hals und schaute in die Ferne zum Place de la Sous-Préfecture. Nach einigen Minuten Wartens kam sie auf die Freitreppe und rief:
„Na, kommt Herr Mouret nicht zum Abendessen nach Hause?“ „Doch, Rose, warten Sie“, antwortete Marthe friedfertig.
„Es brennt nämlich alles an. Da ist kein Sinn und Verstand bei. Wenn der Herr solche Ausflüge unternimmt, sollte er doch vorher Bescheid sagen . . . Mir ist es ja schließlich gleichgültig. Das Abendessen wird nicht zu genießen sein.“
„Glaubst du, Rose?“ sagte hinter ihr eine ruhige Stimme. „Wir werden es trotzdem verspeisen, dein Abendessen.“ Das war Mouret, der nach Hause kam.
Rose wandte sich um, sah ihrem Herrn ins Gesicht, war gleichsam drauf und dran loszuplatzen; aber angesichts der absoluten Ruhe dieses Antlitzes, in dem ein Schimmer bürgerlicher Spottlust hervorbrach, fiel ihr nicht ein Wort ein, und sie machte sich davon.
Mouret ging auf die Terrasse hinunter, wo er, ohne sich hinzusetzen, umherstapfte. Er begnügte sich damit, Désirée, die ihm zulächelte, mit den Fingerspitzen einen leichten Klaps auf die Wange zu geben. Marthe hatte aufgeblickt; nachdem sie ihren Gatten angesehen hatte, schickte sie sich an, ihr Nähzeug in ihren Tisch zu räumen.
„Sind Sie nicht müde?“ fragte Octave, der auf die weißbestaubten Schuhe seines Vaters sah.
„Doch, ein bißchen“, antwortete Mouret, ohne weiter von dem langen Weg zu sprechen, den er eben zu Fuß zurückgelegt hatte. Aber er erblickte mitten im Garten einen Spaten und eine Harke, die die Kinder wohl dort vergessen hatten. „Warum werden die Geräte nicht wieder reingebracht?“ schrie er. „Ich habe es hundertmal gesagt. Wenn es geregnet hätte, wären sie verrostet.“ Er ärgerte sich nicht weiter. Er ging in den Garten hinunter, holte selber den Spaten und die Harke, die er hinten in dem kleinen Gewächshaus sorgsam aufhängte. Während er wieder zur Terrasse hinaufstieg, durchstöberte er mit den Augen alle Winkel der baumbestandenen Gartenwege, um zu sehen, ob alles schön aufgeräumt war.
„Lernst du deine Schulaufgaben?“ fragte er, als er an Serge vorbeikam, der nicht von seinem Buch abgelassen hatte.
„Nein, Vater“, antwortete der Junge. „Das ist ein Buch, das mir Abbé Bourrette geliehen hat, der Bericht über die ,Missionen in China‘.“
Mouret blieb plötzlich vor seiner Frau stehen.
„Was ich fragen wollte“, begann er, „ist niemand gekommen?“ „Nein, niemand, mein Freund“, sagte Marthe mit überraschter Miene.
Er wollte weitersprechen, schien sich aber anders zu besinnen. Er stapfte noch eine Weile umher, ohne irgend etwas zu sagen, ging dann zur Freitreppe vor und rief:
„Na, Rose! Und das Abendessen, das anbrennt?“
„Wahrhaftig!“ schrie hinten aus dem Hausflur die wütende Stimme der Köchin. „Jetzt ist nichts mehr fertig, alles ist kalt. Sie müssen warten, Herr Mouret!“
Mouret lachte still vor sich hin; er blinzelte mit dem linken Auge und schaute dabei seine Frau und seine Kinder an. Roses Zorn schien ihn sehr zu ergötzen. Dann vertiefte er sich in den Anblick der Obstbäume seines Nachbars.
„Es ist verblüffend“, murmelte er, „Herr Rastoil hat dieses Jahr prächtige Birnen.“
Marthe, die seit einer Weile unruhig war, schien eine Frage auf den Lippen zu liegen. Sie entschloß sich und sagte schüchtern:
„Hast du heute jemanden erwartet, mein Freund?“
„Ja und nein“, antwortete er und fing an, auf und ab zu wandern.
„Hast du etwa das zweite Stockwerk vermietet?“
„Ja, in der Tat, ich habe es vermietet.“ Und da ein verlegenes Schweigen entstand, fuhr er mit friedfertiger Stimme fort: „Heute früh, ehe ich nach Les Tulettes aufbrach, bin ich zu Abbé Bourrette hinaufgegangen. Er hat mir sehr zugesetzt, und, meiner Treu, da habe ich zugesagt . . . Ich weiß wohl, daß es dich verdrießt. Denk bloß mal ein bißchen nach, du bist unvernünftig, meine Gute. Wir brauchen diesen zweiten Stock überhaupt nicht; er verfällt. Das Obst, das wir in den Zimmern aufbewahrten, hat dort eine Feuchtigkeit aufkommen lassen, die die Tapeten ablöste . . .Weil ich gerade daran denke, vergiß nicht, das Obst gleich morgen wegschaffen zu lassen: unser Mieter kann jeden Augenblick eintreffen.“
„Wir fühlten uns doch so wohl, allein in unserem Haus“, ließ sich Marthe mit halblauter Stimme entschlüpfen.
„Ach was!“ entgegnete Mouret. „Ein Priester, der stört nicht sehr. Er lebt für sich und wir für uns. Diese Schwarzröcke, die verstecken sich, um ein Glas Wasser hinunterzugießen . . . Du weißt, wie gerne ich sie habe. Faulenzer größtenteils . . . Na ja! Das hat mich ja gerade zum Vermieten bewogen, daß ich einen Priester gefunden habe. Bei denen ist nichts wegen des Geldes zu befürchten, man hört sie nicht einmal den Schlüssel ins Schloß stecken.“
Marthe blieb untröstlich. Sie betrachtete um sich her das glückliche, in der scheidenden Sonne badende Haus, den Garten, in dem der Schatten grauer wurde; sie betrachtete ihre Kinder, ihr eingeschlafenes Glück, das dort in diesem engen Winkel lag. „Und weißt du, wer dieser Priester ist?“ begann sie wieder. „Nein, aber Abbé Bourrette hat in seinem Namen gemietet, das genügt. Abbé Bourrette ist ein biederer Mann . . . Ich weiß, daß unser Mieter Faujas heißt, Abbé Faujas, und daß er aus der Diözese Besançon kommt. Er wird sich mit seinem Pfarrer nicht haben verstehen können; man wird ihn hier an der Kirche Saint-Saturnin zum Vikar ernannt haben. Vielleicht kennt er unseren Bischof, Monsignore Rousselot. Schließlich sind das nicht unsere Angelegenheiten, verstehst du . . . Ich, ich verlasse mich in alldem auf Abbé Bourrette.“
Marthe beruhigte sich allerdings nicht. Sie bot ihrem Gatten Widerpart, was bei ihr selten vorkam.
„Du hast recht“, sagte sie nach kurzem Schweigen, „der Abbé ist ein ehrenwerter Mann. Nur erinnere ich mich, daß er mir, als er gekommen ist, um die Wohnung zu besichtigen, gesagt hat, er kenne denjenigen nicht, in dessen Namen zu mieten er beauftragt sei. Das ist einer von diesen Aufträgen, wie man sie sich unter Priestern von einer Stadt zur anderen erteilt . . . Es scheint mir, du hättest nach Besançon schreiben, dich erkundigen können, um schließlich zu wissen, wen du bei dir aufnimmst.“ Mouret wollte sich nicht aufregen; er lachte selbstgefällig.
„Es ist nicht der Teufel, vielleicht . . . Du zitterst ja am ganzen Körper. Ich wußte nicht, daß du so abergläubisch bist. Du glaubst doch wenigstens nicht, daß die Priester Unglück bringen, wie man sagt. Sie bringen auch kein Glück, das stimmt. Sie sind wie andere Menschen . . . Na schön! Wenn dieser Abbé da ist, wirst du sehen, ob mir eine Soutane Angst einjagt!“
„Nein, ich bin nicht abergläubisch, das weißt du“, murmelte Marthe. „Ich bin irgendwie sehr betrübt, das ist alles.“ Er pflanzte sich vor ihr auf, er unterbrach sie mit einer barschen Handbewegung.
„Das genügt, nicht wahr?“ sagte er. „Ich habe vermietet, sprechen wir nicht mehr davon.“ Und im spöttischen Ton eines Bürgers, der ein gutes Geschäft abgeschlossen zu haben glaubt, fügte er hinzu: „Klipp und klar ist jedenfalls eines, ich habe für hundertfünfzig Francs vermietet. Das sind hundertfünfzig Francs mehr, die jedes Jahr ins Haus kommen.“
Marthe hatte den Kopf gesenkt, erhob nur noch durch ein unbestimmtes Wiegen der Hände Einspruch, wobei sie sacht die Augen schloß, wie um die Tränen, von denen ihre Lider ganz geschwollen waren, nicht herabrinnen zu lassen. Sie warf einen verstohlenen Blick auf ihre Kinder, die während der Auseinandersetzung, die sie eben mit ihrem Vater hatte, nicht zugehört zu haben schienen, weil sie zweifellos an solche Auftritte gewöhnt waren, in denen sich Mourets spottsüchtige Laune gefiel.
„Wenn Sie nun essen wollen, können Sie kommen“, sagte Rose mit ihrer mürrischen Stimme und trat dabei auf die Freitreppe vor.
„Recht so. Zum Essen, Kinder!“ rief Mouret fröhlich und schien nicht die geringste schlechte Stimmung zu behalten.
Die Familie erhob sich. Da brach in Désirée, die in ihrer armen Einfalt ernst geblieben war, der Schmerz gleichsam wieder auf, als sie jedermann sich bewegen sah. Sie warf sich ihrem Vater an den Hals und stammelte:
„Papa, mir ist ein Vogel weggeflogen.“
„Ein Vogel, mein Liebling? Wir werden ihn wieder einfangen.“ Und er liebkoste sie, er gab sich sehr schmeichlerisch. Aber auch er mußte hingehen und sich den Käfig ansehen.
Als er das Kind zurückbrachte, befanden sich Marthe und ihre beiden Söhne bereits im Wohnzimmer. Die untergehende Sonne, die durch das Fenster schien, machte die Porzellanteller, die Becher der Kinder, das weiße Tischtuch ganz heiter. Das Zimmer war lau, andächtig, mit dem grünen Hintergrund des Gartens.
Als Marthe, durch diesen Frieden beruhigt, lächelnd den Deckel der Suppenschüssel abnahm, entstand ein Geräusch im Hausflur. Rose eilte verstört herbei und stammelte:
„Der Herr Abbé Faujas ist da.“
KAPITEL II
Mouret machte eine ärgerliche Handbewegung. Er erwartete seinen Mieter wirklich erst frühestens übermorgen. Er erhob sich rasch, als Abbé Faujas an der Tür im Hausflur erschien. Es war ein großer und kräftiger Mann, ein vierschrötiges Gesicht mit breiten Zügen, erdiger Hautfarbe. Hinter ihm, in seinem Schatten, hielt sich eine alte Frau, die kleiner war, derber aussah und ihm erstaunlich ähnelte. Beim Anblick des gedeckten Tisches stutzten beide, sie traten taktvoll einen Schritt zurück, ohne sich zurückzuziehen. Die hohe schwarze Gestalt des Priesters bildete einen Fleck Trauer auf der Heiterkeit der weißgetünchten Wand.
„Wir bitten um Entschuldigung, daß wir Sie stören“, sagte er zu Mouret. „Wir kommen von Herrn Abbé Bourrette, er hat Sie wohl benachrichtigt . . .“
„Aber keineswegs!“ rief Mouret. „Der Abbé macht es nie anders; er sieht immer so aus, als ob er aus dem Paradies herabsteigt . . . Noch heute morgen, mein Herr, versicherte er mir, daß Sie nicht vor zwei Tagen hiersein würden . . . Kurzum, man wird Sie trotzdem unterbringen müssen.“
Abbé Faujas entschuldigte sich. Er hatte eine tiefe Stimme mit großer Sanftheit im Tonfall der Sätze. Er war wirklich untröstlich, in einem solchen Augenblick einzutreffen. Als er sein Bedauern ohne Geschwätz, in zehn deutlich gewählten Worten ausgedrückt hatte, wandte er sich um, um den Dienstmann zu bezahlen, der seinen Koffer hergetragen hatte. Seine großen, wohlgeformten Hände zogen aus einer Falte seiner Soutane eine Börse hervor, von der man lediglich die Stahlringe gewahrte; er suchte einen Augenblick darin herum, wobei er gesenkten Kopfes mit den Fingerspitzen sorgfältig herumtastete.
Dann ging der Dienstmann davon, ohne daß man das Geldstück gesehen hätte.
Der Abbé begann von neuem mit seiner höflichen Stimme: „Ich bitte Sie, mein Herr, setzen Sie sich wieder zu Tisch . . . Ihre Wirtschafterin wird uns die Wohnung zeigen. Sie wird mir helfen, dies hier hinaufzuschaffen.“ Er bückte sich schon, um einen Koffergriff zu fassen. Es war ein kleiner, durch Ecken und Bänder aus Blech gesicherter Holzkoffer; an einer Seite schien er mit Hilfe eines Spannriegels aus Fichtenholz ausgebessert worden zu sein.
Mouret blieb überrascht stehen und suchte mit den Augen die anderen Gepäckstücke des Priesters; aber er gewahrte nur einen großen Korb, den die betagte Dame mit beiden Händen vor ihren Röcken hielt, trotz der Müdigkeit eigensinnig darauf bestehend, ihn nicht auf die Erde zu stellen. Unter dem ein wenig hochgehobenen Deckel guckte zwischen Wäschebündeln die Ecke eines in Papier eingewickelten Kammes und der Hals einer schlecht verkorkten Literflasche hervor.
„Nein, nein, lassen Sie das“, sagte Mouret und stieß mit dem Fuß leicht gegen den Koffer. „Er dürfte nicht schwer sein. Rose wird ihn gut allein hinaufbringen.“ Er war sich zweifellos nicht der geheimen Geringschätzung bewußt, die in seinen Worten durchbrach.
Die betagte Dame starrte ihn mit ihren schwarzen Augen an; dann kam sie zurück in das Wohnzimmer, an den gedeckten Tisch, den sie musterte, seit sie da war. Mit zusammengekniffenen Lippen ließ sie den Blick von einem Gegenstand zum anderen schweifen. Sie hatte nicht ein Wort gesprochen.
Indessen willigte Abbé Faujas ein, seinen Koffer stehenzulassen. Im gelben Sonnenstaub, der durch die Gartentür hereinkam, wirkte seine fadenscheinige Soutane ganz rot; an den Säumen war sie mit Ausbesserungen geradezu bestickt; sie war sehr sauber, aber so dünn, so jämmerlich, daß Marthe, die bis dahin mit einer Art unruhiger Zurückhaltung sitzen geblieben war, nun ebenfalls aufstand. Der Abbé, der nur einen raschen Blick auf sie geworfen und sich sogleich abgewandt hatte, sah sie ihren Stuhl verlassen, obwohl er sie keineswegs zu betrachten schien.
„Ich bitte Sie“, wiederholte er, „bemühen Sie sich nicht; wir wären untröstlich, Ihr Abendessen zu stören.“
„Nun ja, ganz recht!“ sagte Mouret, der Hunger hatte. „Rose wird Sie führen. Fragen Sie sie nach allem, was Sie brauchen . . . Richten Sie sich ein, richten Sie sich nach Belieben ein.“
Abbé Faujas wandte sich, nachdem er gegrüßt hatte, bereits zur Treppe, als Marthe an ihren Mann herantrat und flüsterte: „Aber, mein Freund, denkst du nicht an . . .“ „An was denn?“ fragte er, als er sah, daß sie zögerte.
„An das Obst, du weißt doch.“
„Ah, zum Teufel! Das stimmt, da ist ja das Obst“, sagte er bestürzt. Und da Abbé Faujas zurückkam und ihn fragend ansah, begann er von neuem: „Es verdrießt mich wirklich sehr, mein Herr. Pater Bourrette ist sicherlich ein ehrenwerter Mann, nur ist es ärgerlich, daß Sie ihn mit Ihrer Angelegenheit beauftragt haben . . . Er hat nicht für zwei Heller Verstand . . . Wenn wir Bescheid gewußt hätten, würden wir alles vorbereitet haben, statt daß wir jetzt einen Umzug bewerkstelligen müssen . . . Sie verstehen, wir benutzten die Zimmer. Da oben liegt auf dem Fußboden unsere gesamte Obsternte, Feigen Äpfel, Rosinen . . .“
Der Priester hörte ihm mit einer Überraschung zu, die seine große Höflichkeit nicht mehr zu verbergen vermochte.
„Oh, aber das dauert nicht lange“, fuhr Mouret fort. „In zehn Minuten, wenn Sie sich die Mühe nehmen wollen zu warten, wird Rose Ihre Zimmer in Ordnung bringen.“
Eine lebhafte Unruhe auf dem erdfarbenen Gesicht des Priesters nahm zu.
„Die Wohnung ist möbliert, nicht wahr?“ fragte er. „Keineswegs, es steht nicht ein Möbelstück drin; wir haben sie nie bewohnt.“
Nun verlor der Priester seine Ruhe; ein Schimmer trat in seine grauen Augen. Er rief mit zurückgehaltener Heftigkeit:
„Wie! Aber ich hatte in meinem Brief ausdrücklich darum ersucht, eine möblierte Wohnung zu mieten. Ich konnte in meinem Koffer wahrhaftig keine Möbel unterbringen.“
„Na, was habe ich gesagt?“ rief Mouret lauter. „Dieser Bourrette ist unglaublich . . . Er ist gekommen, mein Herr, und er hat die Äpfel bestimmt gesehen, denn er hat selber einen in die Hand genommen und dabei erklärt, daß er selten einen so schönen Apfel bewundert habe. Er hat gesagt, daß ihm alles sehr gut erscheine, daß es das sei, was er brauche, und daß er mieten wolle.“
Abbé Faujas hörte nicht mehr hin; eine Zorneswoge war in seine Wangen gestiegen. Er wandte sich um und stammelte mit ängstlicher Stimme:
„Mutter, hören Sie? Es sind keine Möbel da.“
Die alte Dame, die in ihren dünnen schwarzen Schal eingewikkelt war, hatte gerade in verstohlenen Schrittchen, ohne ihren Korb loszulassen, das Erdgeschoß besichtigt. Sie war bis zur Tür der Küche vorgedrungen, hatte deren vier Wände gemustert; dann war sie auf die Freitreppe zurückgekommen und hatte mit einem Blick langsam vom Garten Besitz ergriffen. Vor allem aber interessierte sie das Wohnzimmer; sie blieb wieder gegenüber dem gedeckten Tisch stehen und schaute zu, wie die Suppe dampfte, als ihr Sohn mehrmals zu ihr sagte:
„Hören Sie, Mutter? Wir werden ins Hotel gehen müssen.“
Sie hob den Kopf, ohne zu antworten; ihr ganzes Gesicht weigerte sich, dieses Haus, dessen kleinste Winkel sie bereits kannte, zu verlassen. Sie zuckte unmerklich die Schultern, während die verschwommenen Augen von der Küche zum Garten und vom Garten zum Wohnzimmer schweiften.
Mouret verlor unterdessen die Geduld. Als er sah, daß weder die Mutter noch der Sohn entschlossen zu sein schienen, das Feld zu räumen, begann er wieder:
„Wir haben nämlich keine Betten, leider . . . Auf dem Boden steht wohl ein Gurtbett, mit dem Madame zur Not bis morgen fürliebnehmen könnte; nur sehe ich nicht recht, worauf der Herr Abbé sich schlafen legen soll.“
Da öffnete Frau Faujas endlich die Lippen. Sie sagte kurz in etwas rauhem Ton:
Mein Sohn wird das Gurtbett nehmen. Ich, ich brauche nur eine Matratze in einer Ecke auf dem Fußboden.“
Der Abbé billigte diese Regelung mit einem Kopfnicken.
Mouret wollte laut Einspruch erheben, wollte etwas anderes suchen; aber angesichts des zufriedenen Aussehens seiner neuen Mieter schwieg er und begnügte sich, mit seiner Frau einen Blick des Erstaunens zu wechseln.
„Morgen ist auch ein Tag“, sagte er mit der ihm eigenen, etwas spitzen und biedermännischen Art. „Sie können sich mit Möbeln einrichten, wie Sie es wünschen. Rose wird hinaufgehen, um das Obst wegzuschaffen und die Betten herzurichten. Wenn Sie einen Augenblick auf der Terrasse warten wollen . . . Los, Kinder, bringt zwei Stühle her.“
Die Kinder waren seit der Ankunft des Priesters und seiner Mutter ruhig am Tisch sitzen geblieben. Sie musterten sie neugierig. Der Abbé schien sie nicht bemerkt zu haben; aber Frau Faujas war bei jedem von ihnen einen Augenblick stehengeblieben und hatte sie dabei scharf ins Auge gefaßt, als wollte sie auf Anhieb in diese jungen Köpfe eindringen. Als sie die Worte ihres Vaters hörten, bemühten sich alle drei und brachten Stühle hinaus.
Die alte Dame setzte sich nicht. Als sich Mouret, weil er sie nicht mehr gewahrte, umdrehte, sah er sie vor einem der halbgeöffneten Fenster des Salons aufgepflanzt; sie machte einen langen Hals und beendete ihre Musterung mit gelassener Ungezwungenheit wie jemand, der ein zu verkaufendes Anwesen besichtigt. In dem Augenblick, da Rose den kleinen Koffer aufhob, kam sie in die Diele zurück und sagte einfach:
„Ich gehe nach oben, ihr helfen.“ Und sie ging hinter der Wirtschafterin nach oben.
Der Priester wandte nicht einmal den Kopf; er lächelte den drei Kindern zu, die vor ihm stehengeblieben waren. Sein Gesicht hatte, wenn er wollte, trotz der Härte der Stirn und den strengen Falten des Mundes einen Ausdruck großer Sanftmut.
„Ist das Ihre ganze Familie, Madame?“ fragte er Marthe, die herzugetreten war.
„Ja, Herr Abbé“, antwortete sie, durch den scharfen Blick, mit dem er sie anstarrte, in Verlegenheit gebracht.
Aber er betrachtete wieder die Kinder und fuhr fort:
„Das sind zwei große Burschen, die bald Männer sein werden . . . Sind Sie mit Ihrer Ausbildung fertig, mein Freund?“ Er wandte sich an Serge.
Mouret schnitt seinem Sohn das Wort ab.
„Der hier ist fertig, obwohl er der Jüngere ist. Wenn ich sage, er ist fertig, meine ich damit, daß er Baccalaureus ist, denn er ist wieder ins Gymnasium zurückgekehrt, um ein Jahr Philosophie zu machen: das ist der Gelehrte der Familie . . . Der andere, der Ältere, dieser große Lümmel, ist nicht viel wert, sage ich Ihnen. Er hat es schon zweimal zuwege gebracht, beim Baccalaureat durchzufallen, und dabei ein Taugenichts, immer die Nase in der Luft, führt sich immer auf wie ein Gassenjunge.“
Octave hörte diese Vorwürfe lächelnd an, während Serge unter den Lobsprüchen den Kopf gesenkt hatte.
Faujas schien sie noch einen Augenblick schweigend zu mustern; zu Désirée übergehend und sein sanftes Aussehen wiederfindend, fragte er dann:
„Mademoiselle, werden Sie mir erlauben, Ihr Freund zu sein?“
Sie antwortete nicht; fast erschreckt verbarg sie ihr Gesicht an der Schulter ihrer Mutter. Diese drückte sie, anstatt ihr das Gesicht frei zu machen, noch stärker an sich, indem sie ihr einen Arm um die Taille legte.
„Verargen Sie ihr das nicht“, sagte sie mit einiger Traurigkeit, „sie hat nicht viel Verstand, sie ist ein kleines Mädchen geblieben . . . Sie ist einfältig . . . Wir quälen sie nicht mit Lernen. Sie ist vierzehn Jahre alt, und sie weiß noch nichts weiter, als die Tiere zu lieben.“
Désirée hatte sich unter den Liebkosungen ihrer Mutter wieder beruhigt; sie hatte den Kopf gewandt, sie lächelte. Dann sagte sie mit kühner Miene:
„Ich will schon, daß Sie mein Freund sind . . . Bloß tun Sie nie den Fliegen etwas zuleide, nicht wahr?“ Und als sich alles um sie her erheiterte, fuhr sie ernsthaft fort: „Octave zerquetscht sie, die Fliegen. Das ist sehr schlecht.“
Abbé Faujas hatte sich gesetzt. Er schien sehr müde zu sein. Er gab sich einen Augenblick dem lauen Frieden der Terrasse hin und ließ seine träger gewordenen Blicke über den Garten, über die Bäume der angrenzenden Anwesen schweifen. Diese große Ruhe, dieser verlassene Kleinstadtwinkel verursachten ihm eine Art Überraschung. Sein Gesicht überzog sich mit dunklen Flecken.
„Man ist hier sehr gut aufgehoben“, murmelte er. Dann wahrte er Schweigen, gleichsam in Gedanken versunken und verloren. Er fuhr leicht zusammen, als Mouret lachend zu ihm sagte: „Wenn Sie erlauben, mein Herr, begeben wir uns nun zu Tisch.“ Und auf den Blick seiner Frau hin fügte er hinzu: „Sie sollten es uns gleichtun und einen Teller Suppe annehmen. Das würde es Ihnen ersparen, ins Hotel essen zu gehen. Tun Sie sich keinen Zwang an, ich bitte Sie.“
„Ich danke Ihnen tausendmal, wir benötigen nichts“, antwortete der Abbé mit äußerster Höflichkeit, die eine zweite Einladung nicht zuließ.
Da gingen die Mourets in das Wohnzimmer zurück, wo sie sich an den Tisch setzten. Marthe füllte die Suppe auf. Bald gab es ein lustiges Löffelgeklapper. Die Kinder schwatzten. Désirée lachte mehrmals hell auf, während sie einer Geschichte lauschte, die ihr Vater erzählte, der entzückt war, endlich bei Tisch zu sein.
Unterdessen blieb Abbé Faujas, den sie vergessen hatten, reglos, die untergehende Sonne im Gesicht, auf der Terrasse sitzen. Er wandte nicht den Kopf, er schien nicht zu hören. Als die Sonne sich anschickte, zu verschwinden, nahm er seine Kopfbedeckung ab, weil er zweifellos fast erstickte. Marthe, die vor dem Fenster saß, gewahrte seinen dicken bloßen Kopf mit den kurzen Haaren, die zu den Schläfen hin bereits grau wurden. Ein letzter roter Schein setzte diesen harten Soldatenschädel in Brand, auf dem die Tonsur wie die Narbe eines Keulenschlages aussah; dann erlosch der Schein, der in den Schatten eingehende Priester war nur noch ein schwarzes Profil auf der grauen Asche der Dämmerung.
Da Marthe Rose nicht rufen wollte, holte sie selber eine Lampe und trug den ersten Gang auf. Als sie aus der Küche zurückkam, traf sie am Fuß der Treppe eine Frau, die sie erst nicht erkannte. Es war Frau Faujas. Sie hatte eine Leinenhaube aufgesetzt; mit ihrem baumwollenen Kleid, das am Mieder durch ein gelbes, hinter der Taille geknotetes Tuch zusammengehalten wurde, ähnelte sie einer Magd; und mit bloßen Handgelenken, von der Arbeit, die sie gerade verrichtet hatte, noch ganz außer Atem, tappte sie mit ihren derben Schnürschuhen über die Steinplatten des Hausflurs.
„Das wäre geschafft, nicht wahr, Madame?“ sagte Marthe lächelnd zu ihr.
„Oh, eine Lappalie“, antwortete sie, „die Sache ist im Handumdrehen erledigt gewesen.“
Sie ging die Freitreppe hinab, sie gab ihrer Stimme einen sanfteren Klang: „Ovide, mein Kind, willst du nach oben gehen? Oben ist alles fertig.“
Sie mußte ihren Sohn an der Schulter berühren, um ihn aus seiner Träumerei zu reißen. Die Luft wurde kühler. Er fröstelte; er folgte ihr, ohne zu sprechen. Als er an der Tür des Wohnzimmers vorbeikam, das, ganz weiß von der grellen Helle der Lampe, vom Geschwätz der Kinder erfüllt war, steckte er den Kopf hinein und sagte mit seiner geschmeidigen Stimme: „Erlauben Sie mir, Ihnen nochmals zu danken und uns wegen dieser Störung zu entschuldigen . . . Es ist uns außerordentlich peinlich . . .“
„Aber nein, aber nein!“ rief Mouret. „Wir sind untröstlich, daß wir Ihnen für diese Nacht nichts Besseres anzubieten haben.“ Der Priester grüßte, und Marthe begegnete abermals diesem hellen Blick, diesem Adlerblick, der sie erregt hatte. Es schien, als husche auf dem Grunde des Auges, das für gewöhnlich von einem düsteren Grau war, jäh eine Flamme vorüber, wie jene Lampen, die hinter den Fassaden eingeschlafener Häuser herumgetragen werden.
„Er ist anscheinend ein forscher Kerl, der Pfarrer“, sagte Mouret spöttisch, als Mutter und Sohn nicht mehr da waren.
„Ich halte sie für wenig glücklich“, murmelte Marthe.
„Was das anbelangt, so bringt er gewiß nicht das Gold Perus in seinem Koffer mit . . . Der ist aber schwer, sein Koffer! Ich hätte ihn mit der Spitze meines kleinen Fingers hochgehoben.“ Aber er wurde in seinem Geschwätz durch Rose unterbrochen, die eben die Treppe heruntergerannt kam, um die überraschenden Sachen zu erzählen, die sie gesehen hatte.
„Na“, sagte sie und pflanzte sich vor dem Tisch auf, an dem ihre Herrschaften aßen, „das ist mir ein Frauenzimmer! Diese Dame ist mindestens fünfundsechzig Jahre alt, und das merkt man kaum, sage ich Ihnen! Sie stößt einen herum, sie arbeitet wie ein Pferd.“
„Hat sie dir geholfen, das Obst rauszuschaffen?“ fragte Mouret neugierig.
„Das will ich meinen, Herr Mouret. Sie trug das Obst so weg in ihrer Schürze; richtige Wagenladungen, als wolle sie alles kurz und klein schlagen. Ich sagte mir: Bestimmt wird das Kleid dabei draufgehen. — Aber nicht die Spur; das ist haltbarer Stoff, Stoff, wie ich ihn selber trage. Wir haben mehr als zehnmal gehen müssen. Mir waren die Arme wie zerbrochen. Sie brummte, daß es nicht vorangehe. Ich glaube, ich habe sie, mit Verlaub, fluchen hören.“
Mouret schien sich sehr zu ergötzen.
„Und die Betten?“ fing er wieder an.
„Die Betten, die hat sie zurechtgemacht . . . Man muß sehen, wie sie eine Matratze umwendet. Die ist für sie nicht schwer, versichere ich Ihnen; sie nimmt sie an einem Ende, wirft sie in die Luft wie eine Feder . . . Dabei sehr sorgsam. Sie hat das Gurtbett wie ein Kinderbettchen bezogen. Hätte sie das Jesuskind zu Bett bringen müssen, würde sie die Laken mit nicht mehr Andacht zurechtgezogen haben . . . Von den vier Decken hat sie drei auf das Gurtbett gelegt. Genauso mit den Kopfkissen: für sich hat sie keins gewollt; ihr Sohn hat beide.“ „Sie wird also auf der Erde schlafen?“
„In einer Ecke, wie ein Hund. Sie hat eine Matratze auf den Fußboden des anderen Zimmers geworfen und dabei gesagt, daß sie da besser als im Paradies schlafen würde. Ich habe sie nie und nimmer dazu bewegen können, sich anständiger einzurichten. Sie behauptet, sie friere niemals und ihr Kopf sei zu hart, um den Fliesenfußboden zu fürchten . . . Ich habe ihnen Wasser und Zucker gegeben, wie mir Madame aufgetragen hatte, und das wäre es . . . Macht nichts, das sind komische Leute.“
Rose trug das Essen fertig auf. An diesem Abend zogen die Mourets die Mahlzeit in die Länge. Sie plauderten ausführlich von den neuen Mietern. In ihrem Leben, das mit der Regelmäßigkeit einer Uhr ablief, war die Ankunft dieser beiden Fremden ein großes Ereignis. Sie sprachen davon wie von einer Katastrophe, mit jenem kleinlichen Eingehen auf Einzelheiten, das die langen Provinzabende totschlagen hilft. Besonders Mouret fand an den Kleinstadtklatschereien Gefallen. Während er beim Nachtisch die Ellenbogen auf den Tisch stützte, wiederholte er im lauen Wohnzimmer mit der zufriedenen Miene eines glücklichen Menschen zum zehnten Mal:
„Das ist kein schönes Geschenk, das Besançon Plassans macht . . . Habt ihr den Hinterteil seiner Soutane gesehen, als er sich umgedreht hat? — Es sollte mich sehr wundern, wenn die Betschwestern dem da nachliefen. Er sieht zu schäbig aus; die Betschwestern lieben die hübschen Pfarrer.“
„Seine Stimme klingt sanft“, sagte Marthe, die nachsichtig war.
„Aber nicht, wenn er zornig ist“, erwiderte Mouret. „Habt ihr ihn denn nicht gehört, wie er böse wurde, als er erfuhr, daß die Wohnung nicht möbliert ist? Das ist ein rücksichtsloser Mann; der wird in den Beichtstühlen nicht lange fackeln, sage ich euch! Ich bin sehr neugierig, wie er sich morgen einrichten wird. Wenn er nur wenigstens zahlt. Tut mir leid! Ich werde mich an Abbé Bourrette wenden; ich kenne nur ihn.“
Man war wenig fromm in der Familie. Selbst die Kinder machten sich über den Abbé und seine Mutter lustig. Octave ahmte die alte Dame nach, wie sie einen langen Hals machte, um tief in die Zimmer hineinzusehen, was Désirée zum Lachen brachte. Serge, der ernsthafter war, verteidigte „diese armen Leute“. Für gewöhnlich nahm Mouret, wenn er seine Partie Pikett nicht spielte, Punkt zehn Uhr einen Leuchter und ging zu Bett; aber diesen Abend widerstand er dem Schlaf noch um elf Uhr. Désirée war schließlich eingeschlafen, den Kopf auf Marthes Schoß. Die zwei Jungen waren in ihr Zimmer hinaufgegangen. Mouret saß seiner Frau allein gegenüber und schwatzte noch immer.
„Wie alt schätzt du ihn?“ fragte er unvermittelt.
„Wen?“ sagte Marthe, die gleichfalls einzunicken begann.
„Den Abbé, bei Gott! He? Zwischen vierzig und fünfundvierzig, nicht wahr? Das ist ein stabiler Kerl. Wenn das nicht schade ist, daß so einer die Soutane trägt! Er hätte einen ausgezeichneten Karabinier abgegeben.“ Nach kurzem Schweigen sprach er dann allein und führte mit lauter Stimme seine Überlegungen fort, die ihn ganz nachdenklich machten: „Sie sind mit dem Zug sechs Uhr fünfundvierzig angekommen. Sie haben also nur Zeit gehabt, bei Abbé Bourrette vorbeizugehen und hierherzukommen . . . Ich wette, daß sie nicht zu Abend gegessen haben. Das ist klar. Wir hätten sie wohl gesehen, wenn sie herausgekommen wären, um ins Hotel essen zu gehen . . . Ah! Das würde mir zum Beispiel Vergnügen machen, zu erfahren, wo sie wohl gegessen haben.“
Rose strich seit einer Weile im Wohnzimmer umher und wartete, daß ihre Herrschaften schlafen gehen würden, damit sie Türen und Fenster schließen konnte.
„Ich weiß, wo sie gegessen haben“, sagte sie. Und als sich Mouret lebhaft umwandte, fuhr sie fort: „Ja, ich bin noch einmal hinaufgegangen, um zu sehen, ob ihnen nichts fehlt. Da ich kein Geräusch hörte, habe ich nicht gewagt anzuklopfen; ich habe durch das Schlüsselloch geguckt.“
„Das ist aber schlecht, sehr schlecht“, unterbrach Marthe streng, „Sie wissen doch, Rose, daß ich das gar nicht liebe.“
„Laß doch, laß doch!“ rief Mouret, der unter anderen Umständen gegen die Neugierige aufgebraust wäre. „Sie haben durch das Schlüsselloch geguckt?“
„Ja, Herr Mouret, es geschah in guter Absicht.“ „Offensichtlich . . . Was machten sie denn?“
„Nun ja! Also, Herr Mouret, sie aßen . . . Ich habe gesehen, wie sie auf einer Ecke des Gurtbettes aßen. Die alte Dame hatte eine Serviette ausgebreitet. Jedesmal wenn sie sich Wein einschenkten, legten sie die verkorkte Literflasche wieder gegen das Kopfkissen.“
„Aber was aßen sie?“
„Ich weiß nicht genau, Herr Mouret. Es hat mir wie ein Rest Pastete ausgesehen, in eine Zeitung eingewickelt. Sie hatten auch Äpfel, kleine, mickrige Äpfel.“
„Und sie unterhielten sich, nicht wahr? Haben Sie gehört, was sie sagten?“
„Nein, Herr Mouret, sie unterhielten sich nicht . . . Ich habe ihnen eine gute Viertelstunde zugeschaut. Sie sagten nichts, nicht soviel, versichere ich Ihnen! Sie aßen, sie aßen!“ Marthe war aufgestanden, hatte dabei Désirée geweckt und machte Anstalten hinaufzugehen; die Neugierde ihres Gatten verletzte sie. Dieser entschloß sich endlich, ebenfalls aufzustehen, während die alte Rose, die fromm war, mit leiserer Stimme fortfuhr:
„Der arme liebe Mann mußte tüchtig Hunger haben . . . Seine Mutter reichte ihm die größten Bissen und sah ihm zu, wie er mit Behagen schluckte . . . Kurz und gut, er wird in schön weißen Bettüchern schlafen. Sofern ihn der Obstgeruch nicht belästigt. Es riecht nämlich nicht gut in dem Zimmer; Sie wissen, dieser säuerliche Geruch von Birnen und Äpfeln. Und nicht ein Möbelstück, nichts als das Bett in einer Ecke. Ich hätte Angst, ich würde das Licht die ganze Nacht brennen lassen.“
Mouret hatte seinen Leuchter genommen. Er blieb einen Augenblick vor Rose stehen und faßte als ein Bürger, den man aus seinen gewohnten Vorstellungen herausgerissen hat, den Abend in folgendem Ausspruch zusammen:
„Das ist ungewöhnlich.“
Dann holte er seine Frau am Fuß der Treppe wieder ein. Als er noch den leisen Geräuschen lauschte, die aus dem oberen Stockwerk kamen, lag sie schon im Bett, schlief sie bereits. Das Zimmer des Abbé lag genau über dem seinen. Er hörte ihn sacht das Fenster öffnen, was ihn sehr neugierig machte. Er hob den Kopf vom Kissen, kämpfte verzweifelt gegen den Schlaf an, weil er wissen wollte, wie lange der Priester am Fenster bleiben würde. Aber der Schlaf war der Stärkere; Mouret schnarchte fest, ehe er das dumpfe Knirschen des Fensterriegels erneut hatte wahrnehmen können.
Oben am Fenster schaute Abbé Faujas barhäuptig in die schwarze Nacht. Er blieb lange dort, glücklich, endlich allein zu sein, sich in jene Gedanken vertiefend, die ihm so viel Härte auf die Stirn prägten. Unter sich fühlte er den ruhigen Schlaf dieses Hauses, in dem er seit einigen Stunden war, der Kinder reinen Atem, Marthes ehrbaren Hauch, Mourets schweres und regelmäßiges Luftholen. Und es lag eine Verachtung in der Art, seinen Ringkämpferhals geradezurücken, während er den Kopf hob, als wolle er in der Ferne der eingeschlafenen kleinen Stadt bis auf den Grund sehen. Die großen Bäume im Garten der Unterpräfektur bildeten eine düstere Masse; Herrn Rastoils Birnbäume reckten hagere und verrenkte Glieder; dann war das nur noch ein Meer von Finsternis, ein Nichts, aus dem kein Laut aufstieg. Die Stadt war unschuldig wie ein Mädchen in der Wiege.
Abbé Faujas streckte mit einer Miene ironischer Herausforderung die Arme aus, als wolle er Plassans ergreifen, um es mit einer Anstrengung an seiner stämmigen Brust zu ersticken. Er murmelte:
„Und diese Schwachköpfe, die heute abend lächelten, als sie sahen, wie ich ihre Straßen überquerte.“
KAPITEL III
Am nächsten Tag verbrachte Mouret den Morgen damit, seinen neuen Mieter zu belauern. Dieses Nachspionieren füllte die leeren Stunden aus, die er sonst in der Wohnung damit zu verbringen pflegte, daß er sich mit Kleinigkeiten abgab, herumliegende Sachen aufräumte, Streitereien mit seiner Frau und seinen Kindern suchte. Von nun an würde er eine Beschäftigung haben, einen Zeitvertreib, der ihn aus seinem alltäglichen Leben herauszog. Er liebte die Pfarrer nicht, wie er sagte, und der erste Priester, der in sein Dasein hereinplatzte, interessierte ihn in ungewöhnlichem Maße. Dieser Priester brachte einen geheimnisvollen Geruch, ein beinahe beunruhigendes Unbekanntes in sein Heim. Obwohl er den Freigeist spielte, sich als Voltairianer hinstellte, empfand er dem Abbé gegenüber ein Erstaunen, einen spießbürgerlichen Schauder, in dem eine Spitze kecker Neugier durchbrach.
Kein Geräusch kam aus dem zweiten Stock. Mouret lauschte im Treppenhaus; er wagte es sogar, auf den Dachboden hinaufzusteigen. Als er den Schritt verlangsamte, während er den Flur entlangging, erregte ihn ein Pantoffelschlurfen aufs äußerste, das er hinter der Tür zu hören glaubte. Da er nichts Genaues hatte erhaschen können, ging er in den Garten hinab, spazierte hinten unter der Gartenlaube umher, blickte hoch und trachtete, durch die Fenster hindurchzusehen, was in den Zimmern geschah. Aber er gewahrte nicht einmal den Schatten des Abbé. Frau Faujas, die zweifellos keinerlei Vorhänge besaß, hatte einstweilen Bettlaken hinter den Scheiben aufgehängt.
Beim Mittagessen wirkte Mouret sehr verärgert.
„Sind die da oben gestorben?“ fragte er, während er den Kindern Brot schnitt. „Hast du nicht gehört, wie sie sich bewegen, Marthe?“
„Nein, mein Freund, ich habe nicht darauf geachtet.“
Rose rief aus der Küche:
„Sie sind schon eine ganze Weile nicht mehr im Hause; wenn sie immer noch laufen, sind sie weit.“
Mouret rief die Köchin und fragte sie ganz genau aus.
„Sie sind weggegangen, Herr Mouret; die Mutter zuerst, der Pfarrer danach. Ich hätte sie nicht gesehen, so leise gehen sie, wären ihre Schatten nicht über den Fliesenfußboden meiner Küche gehuscht, als sie die Tür geöffnet haben. Ich habe auf die Straße geschaut, um nachzusehen; aber sie waren auf und davon, und zwar blitzschnell, versichere ich Ihnen.“
„Das ist sehr überraschend . . . Aber wo war ich denn?“
„Ich glaube, der Herr war hinten im Garten, um nach den Trauben im Laubengang zu sehen.“
Das versetzte Mouret vollends in eine abscheuliche Laune. Er zog über die Priester her: Das seien alles Geheimniskrämer; sie führen so viele Sachen im Schilde, in denen sich der Teufel nicht auskenne; sie heuchelten eine lächerliche Prüderie, und zwar derart, daß niemand je gesehen habe, wie sich ein Pfarrer das Gesicht wasche. Schließlich bereute er, an diesen Abbé, den er nicht kannte, vermietet zu haben.
„Das ist auch deine Schuld“, sagte er zu seiner Frau und erhob sich vom Tisch.
Marthe wollte sich dagegen verwahren, wollte ihn an ihre Auseinandersetzung vom Vorabend erinnern, aber sie blickte auf, sah ihn an und sagte nichts.
Er entschloß sich indessen, nicht auszugehen, wie es seine Gewohnheit war. Er ging hin und her, vom Wohnzimmer zum Garten, schnüffelte herum, behauptete, daß alles herumliege, daß im Haus alles drunter und drüber gehe; dann ärgerte er sich über Serge und Octave, die, wie er sagte, eine halbe Stunde zu früh zum Gymnasium aufgebrochen seien.
„Geht Papa heute nicht fort?“ fragte Désirée ihre Mutter ins Ohr. „Er wird uns schön ärgern, wenn er bleibt.“ Marthe hieß sie schweigen.
Endlich sprach Mouret von einem Geschäft, das er im Laufe des Tages zum Abschluß bringen müsse. Er habe keinen freien Augenblick, er könne sich nicht einmal einen Tag zu Hause ausruhen, wenn er das Bedürfnis dazu empfinde. Untröstlich darüber, nicht auf der Lauer bleiben zu können, brach er auf.
Als er am Abend heimkam, hatte er ein regelrechtes Neugierfieber.
„Und der Abbé?“ fragte er, noch ehe er seinen Hut abgenommen hatte.
Marthe arbeitete an ihrem gewohnten Platz auf der Terrasse. „Der Abbé?“ wiederholte sie mit einiger Überraschung. „Ach ja, der Abbé . . . Ich habe ihn nicht gesehen, ich glaube, er hat sich eingerichtet. Rose hat mir gesagt, daß Möbel gebracht worden sind.“
„Da haben wir, was ich befürchtete“, rief Mouret. „Ich hätte dasein wollen; denn schließlich sind die Möbel meine Sicherheit . . . Ich wußte genau, daß du dich nicht von deinem Stuhl wegrühren würdest. Du bist nicht ganz bei Trost, meine Gute . . . Rose! Rose!“ Und als die Köchin da war: „Für die Leute vom zweiten Stock sind Möbel gebracht worden?“
„Ja, mein Herr, auf einem Wägelchen. Ich habe das Wägelchen von Bergasse, dem Trödler, erkannt. Ich sage Ihnen, schwer beladen war’s nicht. Madame Faujas ging hinterher. Bei der Steigung in der Rue Balande hat sie dem Mann, der hinten schob, sogar ein bißchen geholfen.“
„Haben Sie die Möbel wenigstens gesehen, haben Sie sie gezählt?“
„Gewiß, Herr Mouret; ich hatte mich an die Tür gestellt. Sie haben alles an mir vorbeigetragen, was selbst Madame Faujas kein Vergnügen gemacht zu haben schien. Warten Sie . . . Zuerst hat man ein eisernes Bett hinaufgebracht, dann eine Kommode, zwei Tische, vier Stühle . . . Meiner Treu, das ist alles . . . Und keine neuen Möbel. Ich würde dafür keine dreißig Taler geben.“
„Aber Sie hätten meiner Frau Bescheid sagen müssen; unter solchen Bedingungen können wir nicht vermieten . . . Ich werde mich auf der Stelle mit Abbé Bourrette aussprechen.“
Er ärgerte sich und wollte hinausgehen; da gelang es Marthe, ihn plötzlich aufzuhalten, indem sie sagte:
„Hör doch, ich vergaß . . . Sie haben sechs Monate im voraus bezahlt.“
„Ach! Sie haben bezahlt?“ stammelte er in fast verärgertem Ton.
„Ja, die alte Dame ist heruntergekommen und hat mir das hier überreicht.“ Sie kramte in ihrem Nähtisch und gab ihrem Gatten fünfundsiebzig Francs in Hundertsousstücken, die sorgfältig in ein Stück Zeitung eingewickelt waren.
Mouret zählte das Geld und murmelte dabei:
„Wenn sie zahlen, können sie tun, was sie wollen . . . Einerlei, das sind komische Leute. Es kann nicht jeder reich sein, das stimmt; nur ist das kein Grund, sich auf solche Art und Weise ein verdächtiges Benehmen zuzulegen, wenn man kein Geld hat.“
„Ich wollte dir auch sagen“, begann Marthe wieder, als sie sah, daß er beruhigt war, „die alte Dame hat mich gefragt, ob wir geneigt seien, ihr das Gurtbett zu überlassen; ich habe ihr geantwortet, daß wir es nicht brauchen, daß sie es behalten könne, solange sie wolle.“
„Das hast du gut gemacht, man muß sie sich verpflichten . . . Ich habe es dir gesagt, es ärgert mich an diesen verteufelten Pfarrern, daß man nie weiß, was sie denken noch was sie tun. Abgesehen hiervon, gibt es unter ihnen oft sehr ehrenwerte Menschen.“
Das Geld schien ihn getröstet zu haben. Er scherzte, quälte Serge mit dem Bericht der „Missionen in China“, den dieser gerade las. Während des Essens tat er so, als kümmere er sich nicht mehr um die Leute vom zweiten Stock. Als aber Octave erzählt hatte, er habe Abbé Faujas aus der bischöflichen Residenz kommen sehen, konnte sich Mouret nicht mehr halten. Beim Nachtisch nahm er das Gespräch vom Vorabend wieder auf. Dann schämte er sich irgendwie. Unter der Unbeholfenheit eines Kaufmanns im Ruhestand hatte er einen klugen Geist; vor allem hatte er einen gesunden Menschenverstand, eine Geradheit des Urteils, die ihn inmitten der Provinzklatschereien meistens das rechte Wort finden ließ.
„Alles in allem“, sagte er beim Schlafengehen, „ist es nicht gut, seine Nase in die Angelegenheiten anderer zu stecken . . . Der Abbé kann machen, was ihm gefällt. Es ist langweilig, immer von diesen Leuten zu reden; ich wasche mir nun die Hände in Unschuld.“.
Acht Tage vergingen. Mouret hatte seine gewohnten Beschäftigungen wieder aufgenommen; er strich im Haus herum, stritt mit den Kindern, verbrachte seine Nachmittage außerhalb, um zum Vergnügen Geschäfte abzuschließen, von denen er nie sprach, aß und schlief wie ein Mann, für den das Dasein ein sanfter Abhang ist, auf dem es keinerlei Erschütterungen und Überraschungen gibt. Die Wohnung schien wieder tot. Marthe saß an ihrem gewohnten Platz auf der Terrasse an ihrem Nähtischchen. Désirée spielte an ihrer Seite. Die beiden Jungen brachten zur gleichen Stunde die gleiche Ausgelassenheit mit. Und Rose, die Köchin, wurde böse, schalt auf jedermann, während der Garten und das Wohnzimmer ihren verschlafenen Frieden wahrten.
„Ich will nicht wieder davon anfangen“, meinte Mouret wiederholt zu seiner Frau, „aber du siehst wohl, daß du dich täuschtest, als du glaubtest, es würde unser Leben stören, den zweiten Stock zu vermieten. Wir leben ruhiger als zuvor, das Haus ist kleiner und glücklicher.“
Und er blickte zuweilen zu den Fenstern des zweiten Stockwerkes hoch, an denen Frau Faujas schon am zweiten Tag grobe baumwollene Vorhänge angebracht hatte. Nicht eine Falte dieser Vorhänge bewegte sich. Sie hatten ein stillzufriedenes Aussehen, jene strenge und kalte Züchtigkeit einer Sakristei. Hinter ihnen schien sich eine klösterliche Stille und Reglosigkeit zu verdichten. Dann und wann waren die Fenster halb geöffnet und ließen zwischen dem Weiß der Vorhänge den Schatten der hohen Zimmerdecken erkennen. Aber Mouret mochte sich noch so oft auf die Lauer legen, nie gewahrte er die Hand, die das Fenster öffnete oder schloß; er hörte nicht einmal das Knirschen des Fensterriegels. Kein menschliches Geräusch drang aus der Wohnung herab.
Am Ende der ersten Woche hatte Mouret Abbé Faujas noch nicht wieder gesehen.
Dieser Mann, der neben ihm lebte, ohne daß er auch nur seinen Schatten erblicken konnte, verursachte ihm schließlich eine Art nervöser Unruhe. Trotz der Anstrengungen, die er unternahm, um gleichgültig zu wirken, verfiel er wieder auf seine Verhöre, begann er eine Untersuchung.
„Siehst du ihn denn nicht?“ fragte er seine Frau.
„Gestern habe ich geglaubt, ihn zu sehen, als er nach Hause gekommen ist; aber ich bin nicht ganz sicher . . . Seine Mutter trägt immer ein schwarzes Kleid; vielleicht war sie es.“ Und als er sie mit Fragen bedrängte, sagte sie ihm, was sie wußte. „Rose versichert, daß er jeden Tag aus dem Haus geht; er bleibt sogar lange auswärts . . . Was die Mutter anbetrifft, so geht bei ihr alles nach der Uhr; morgens um sieben Uhr kommt sie herunter, um ihre Besorgungen zu machen. Sie hat einen stets verschlossenen großen Korb, in dem sie wohl alles mitbringen muß: Kohlen, Brot, Wein, Lebensmittel, denn man sieht nie irgendeinen Lieferanten zu ihnen kommen . . . Übrigens sind sie sehr höflich. Rose sagt, daß sie sie grüßen, wenn sie ihr begegnen. Aber meistens hört sie sie nicht einmal die Treppe herunterkommen.“
„Sie müssen eine komische Kocherei machen da oben“, murmelte Mouret, dem diese Auskünfte nichts besagten.
Als Octave an einem anderen Abend sagte, er habe gesehen, wie Abbé Faujas in die Kirche Saint-Saturnin hineinging, fragte ihn sein Vater, wie er ausgesehen habe, wie die Vorübergehenden ihn angeblickt hätten, was er wohl in der Kirche getan habe.
„Oh! Sie sind zu neugierig“, rief der junge Mann lachend. „Er sah nicht schön aus mit seiner in der Sonne ganz roten Soutane; das ist es, was ich weiß. Ich habe sogar bemerkt, daß er längs der Häuser in dem spärlichen Schattenstreifen ging, wo seine Soutane schwärzer wirkte. Wissen Sie, er sieht nicht stolz aus, er senkt den Kopf, er trabt schnell . . . Zwei Mädchen haben zu lachen angefangen, als er den Platz überquerte. Er hat den Kopf gehoben und sie mit viel Sanftmut angeschaut, nicht wahr, Serge?“
Serge erzählte seinerseits, daß er auf dem Heimweg vom Gymnasium Abbé Faujas, der aus der Kirche Saint-Saturnin zurückkam, mehrmals von weitem begleitet habe. Er gehe durch die Straßen, ohne mit irgend jemandem zu sprechen; er scheine keine Menschenseele zu kennen und Scham über den heimlichen Spott zu empfinden, den er rings um sich fühle.
„Aber man spricht in der Stadt doch über ihn?“ fragte Mouret aufs höchste interessiert.
„Zu mir hat niemand über den Abbé gesprochen“, antwortete Octave.
„Doch“, entgegnete Serge, „man redet über ihn. Abbé Bourrettes Neffe hat mir gesagt, daß er in der Kirche nicht sehr gut angesehen sei; man liebe diese Priester nicht, die von weit her kämen. Zudem sehe er so elend aus . . . Wenn man sich an ihn gewöhnt hat, wird man ihn in Ruhe lassen, diesen armen Mann. In der ersten Zeit muß man wohl viel verstehen.“
Marthe riet den jungen Leuten nun, nicht zu antworten, wenn sie jemand über den Abbé ausfrage.
„Oh! Sie können antworten“, rief Mouret. „Wir wissen über ihn ganz sicher nichts, was ihn Unannehmlichkeiten aussetzen würde.“
Mit dem besten Glauben der Welt und ohne an Böses zu denken, machte er von diesem Augenblick an seine Kinder zu Spionen, die er dem Abbé an die Fersen heftete. Octave und Serge mußten ihm alles wiedererzählen, was in der Stadt gesagt wurde; überdies erhielten sie den Auftrag, dem Priester nachzugehen, wenn sie ihm begegnen sollten. Aber diese Nachrichtenquelle war schnell erschöpft. Die gedämpfte Aufregung, die durch die Ankunft eines fremden Vikars in der Diözese verursacht worden war, hatte sich gelegt. Die Stadt schien „dem armen Mann“, dieser schäbigen Soutane, die im Schatten ihrer Gäßchen dahinglitt, Gnade erwiesen zu haben; sie hegte weiterhin für ihn nur eine große Geringschätzung. Andererseits begab sich der Priester schnurstracks zur Kathedrale und kam von dort immer durch dieselben Straßen zurück. Octave sagte lachend, er zähle die Pflastersteine.
Daheim wollte Mouret Désirée, die nie fortging, zum Auskundschaften benutzen. Abends nahm er sie mit hinter in den Garten, hörte ihr zu, wie sie über das plapperte, was sie tagsüber getan und gesehen hatte; er versuchte, das Gespräch auf die Leute vom zweiten Stock zu bringen.
„Hör mal“, sagte er eines Tages zu ihr, „wenn morgen das Fenster offensteht, wirst du deinen Ball in das Zimmer werfen und hinaufgehen, um ihn zurückzuerbitten.“
Am nächsten Tag warf sie ihren Ball hinauf; aber sie war noch nicht auf der Freitreppe, als der Ball, von einer unsichtbaren Hand zurückgesandt, wieder auf der Terrasse aufsprang. Ihr Vater, der auf die Artigkeit des Kindes gerechnet hatte, um die seit dem ersten Tag abgebrochenen Beziehungen wieder anzuknüpfen, gab jetzt die Hoffnung auf; er stieß offensichtlich auf den unzweideutig gefaßten Willen des Abbé, sich daheim verbarrikadiert zu halten. Aber dieser Kampf machte seine Neugier nur glühender. Es kam so weit mit ihm, daß er in den Ecken mit der Köchin klatschte, zum lebhaften Mißvergnügen Marthes, die ihm Vorwürfe über seinen Mangel an Würde machte; aber er brauste auf, er log. Da er sich im Unrecht fühlte, unterhielt er sich mit Rose über die Faujas nur noch im geheimen.
Eines Morgens machte Rose ihm ein Zeichen, ihr in die Küche zu folgen.
„Nun, Herr Mouret!“ sagte sie und schloß die Tür. „Seit über einer Stunde lauere ich darauf, daß Sie aus Ihrem Zimmer herunterkommen.“
„Hast du etwas erfahren?“
„Sie werden gleich sehen . . . Gestern abend habe ich mehr als eine Stunde mit Madame Faujas geplaudert.“
Mouret fuhr vor Freude zusammen. Er setzte sich auf einen Küchenstuhl, dessen Strohgeflecht ausgefranst war, mitten zwischen Wischlappen und Abfälle vom Vorabend.
„Sag schnell, sag schnell“, flüsterte er.
„Also“, begann die Köchin wieder, „ich war an der Tür zur Straße, um Herrn Rastoils Dienstmädchen guten Abend zu sagen, als Madame Faujas heruntergekommen ist, um einen Eimer Schmutzwasser in den Rinnstein zu entleeren. Anstatt sofort wieder hinaufzugehen, ohne den Kopf zu wenden, wie sie es gewöhnlich tut,ist sie einen Augenblick dageblieben, um mich anzuschauen. Da habe ich zu verstehen geglaubt, sie wolle sich mit mir unterhalten; ich habe ihr gesagt, daß es tagsüber schön gewesen sei, daß der Wein gut sein würde . . . Sie antwortete, ohne sich zu beeilen: ,Ja, ja‘, mit der gleichgültigen Stimme einer Frau, die kein Land besitzt und die solche Sachen überhaupt nicht interessieren. Aber sie hatte ihren Eimer hingestellt, sie ging nicht fort; sie hat sich sogar neben mir an die Mauer gelehnt . . .“
Kurzum, was hat sie dir erzählt?“ fragte Mouret, den die Ungeduld marterte.
„Sie verstehen, ich bin nicht so dumm gewesen, sie auszufragen; da wäre sie abgezogen . . . Ohne es mir anmerken zu lassen, habe ich sie auf Dinge gebracht, die sie angehen könnten. Als der Pfarrer von Saint-Saturnin, dieser brave Herr Compan, vorbeigekommen ist, habe ich ihr gesagt, er sei sehr krank, er werde es nicht mehr lange machen, man könne ihn an der Kathedrale schwer ersetzen. Sie war ganz Ohr, versichere ich Ihnen. Sie hat mich sogar gefragt, was für eine Krankheit Herr Compan habe. Wie eben eines das andere gibt, habe ich dann zu ihr von unserem Bischof, von Monsignore Rousselot, gesprochen. Das ist ein sehr braver Mann. Sie wußte sein Alter nicht. Ich habe ihr gesagt, daß er sechzig Jahre alt ist, daß auch er recht weich ist und sich ein wenig an der Nasenspitze herumführen läßt. Man rede genug über Herrn Fenil, den Generalvikar, der im Bistum alles macht, was er will . . . Sie war gefesselt, die Alte; sie wäre da auf der Straße bis zum nächsten Morgen geblieben.“ Mouret machte eine verzweifelte Handbewegung.
„In alledem sehe ich“, rief er, „daß du ganz alleine geredet hast . . . Aber sie, sie, was hat sie gesagt?“
„Warten Sie doch, lassen Sie mich ausreden“, fuhr Rose seelenruhig fort. „Ich habe mein Ziel erreicht . . . Um sie dazu zu bringen, daß sie sich mir anvertraut, habe ich zu ihr schließlich von uns gesprochen. Ich habe gesagt, daß Sie Herr François Mouret seien, ein früherer Geschäftsmann aus Marseille, der es in fünfzehn Jahren verstanden habe, im Wein-, Öl- und Mandelhandel ein Vermögen zu erwerben. Ich habe hinzugefügt, Sie hätten es vorgezogen, Ihre Jahreszinsen in Plassans zu verzehren, einer ruhigen Stadt, in der die Eltern Ihrer Frau wohnen. Ich habe sogar ein Mittel gefunden, ihr beizubringen, daß Ihre Frau Ihre Cousine ist, daß Sie vierzig Jahre alt sind und Ihre Frau siebenunddreißig ist; daß Sie eine sehr gute Ehe führen; daß man Sie im übrigen nicht oft auf dem Cours Sauvaire trifft. Kurzum, Ihre ganze Geschichte . . . Sie hat sich sehr interessiert gezeigt. Sie antwortete, ohne sich zu beeilen, immer: ,Ja, ja‘. Wenn ich anhielt, nickte sie so mit dem Kopf, um mir zu sagen, daß sie höre, daß ich weiterreden könne . . . Und bis die Nacht hereinbrach, haben wir uns so, mit dem Rücken an der Hauswand, wie gute Freundinnen unterhalten.“ Von Zorn erfaßt, war Mouret aufgestanden.
„Wie!“ schrie er. „Das ist alles! — Sie hat Sie eine Stunde lang schwatzen lassen, und sie hat Ihnen nichts gesagt!“
„Sie hat, als es dunkel geworden war, zu mir gesagt: ,Die Luft wird kühl.‘ Und sie hat ihren Eimer genommen und ist wieder hinaufgegangen . . .“
„Hören Sie, Sie sind ein Schaf! Diese Alte da würde zehn von Ihrer Sorte verkaufen. Na ja! Die können nun lachen, wo sie über uns alles wissen, was sie wissen wollten . . . Verstehen Sie, Rose, Sie sind ein Schaf!“
Die alte Köchin war nicht gerade langmütig; sie begann ungestüm umherzulaufen, stieß die Pfannen und Töpfe durcheinander, drehte die Wischlappen zusammen und warf sie hin. „Wissen Sie, Herr Mouret“, stammelte sie, „wenn Sie in meine Küche gekommen sind, um mir Grobheiten zu sagen, war es nicht der Mühe wert. Da können Sie wieder gehen . . . Was ich getan habe, habe ich einzig und allein getan, um Sie zufriedenzustellen. Würde Ihre Frau uns hier zusammen finden und sehen, was wir machen, würde sie mit mir schimpfen; und sie hätte recht, denn das ist nicht gut . . . Schließlich konnte ich ihr die Worte nicht von den Lippen reißen, dieser Dame. Ich habe die Sache angepackt, wie sie jedermann anpackt. Ich habe geredet, ich habe Ihre Angelegenheiten erzählt. Da ist Ihnen eben nicht zu helfen, wenn die Dame ihre Angelegenheiten nicht erzählt hat. Fragen Sie sie doch danach, wenn Ihnen das so am Herzen liegt. Vielleicht sind Sie nicht so dumm wie ich, Herr Mouret . . .“ Sie hatte die Stimme erhoben.
Mouret hielt es für klug, sich davonzustehlen, wobei er die Küchentür wieder zumachte, damit seine Frau nichts hörte.
Aber Rose riß die Tür hinter seinem Rücken wieder auf und rief ihm in den Hausflur nach:
„Daß Sie’s wissen, ich kümmere mich um nichts mehr; Sie können Ihre schmutzigen Aufträge geben, wem Sie wollen.“ Mouret war geschlagen. Er blieb über seine Niederlage verbittert. Aus Groll gefiel er sich darin zu sagen, diese Leute aus dem zweiten Stock seien sehr unbedeutende Leute. Nach und nach verbreitete er unter seinen Bekannten eine Meinung, die die Meinung der ganzen Stadt wurde. Abbé Faujas wurde als ein mittelloser Priester ohne jeden Ehrgeiz angesehen, der gänzlich außerhalb der Ränke der Diözese stehe; man glaubte, er schäme sich seiner Armut, weil er die schlechtesten Arbeiten an der Kathedrale annahm, sich so tief wie möglich in den Schatten drückte, wo er sich wohl zu fühlen schien. Eine einzige Neugier blieb, nämlich die, zu erfahren, warum er von Besançon nach Plassans gekommen war. Heikle Geschichten waren im Umlauf. Aber die Vermutungen erschienen gewagt. Mouret selbst, der seinen Mietern zum Zeitvertreib nachspioniert hatte, ganz so, als wenn er Karten oder Billard gespielt hätte, begann zu vergessen, daß er einen Priester bei sich beherbergte, als ein Ereignis sein Leben von neuem mit Beschlag belegte.