
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Herzerwärmend und voller großer Gefühle - eine YA-Romance für die schönste Zeit im Jahr!
Nachdem die 16-jährige Letitia jahrelang unter dem Leistungsdruck ihrer Eltern gelitten hat, schmeißt sie alles hin und wagt einen Neuanfang: Ein Nebenjob muss her, und so hilft sie in der örtlichen Kinderklinik aus. Hier soll sie für weihnachtliche Stimmung sorgen und an einem Wunschbaum für die Kinder arbeiten. Da wäre nur ein Problem: Letti hasst Weihnachten! Zur Seite gestellt wird ihr dabei der ein Jahr ältere Matteo. Mit seiner Begeisterung für Christbäume und Weihnachtsmusik kann Letti zunächst überhaupt nichts anfangen. Doch durch seine humorvolle Art schafft er es Stück für Stück, ihr den Zauber der Adventszeit näherzubringen und sich dabei in ihr Herz zu schleichen. Doch dann erfährt sie den wahren Grund für Matteos Hilfsbereitschaft, und auf einmal droht alles zu zerbrechen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
1. Letti
2. Matteo
3. Letti
4. Letti
5. Matteo
6. Letti
7. Letti
8. Letti
9. Matteo
10. Letti
11. Letti
12. Matteo
13. Letti
14. Matteo
15. Letti
16. Matteo
17. Letti
18. Matteo
19. Letti
20. Letti
21. Matteo
22. Matteo
23. Letti
24. Letti
25. Matteo
26. Letti
27. Matteo
28. Letti
29. Letti
30. Matteo
31. Letti
32. Letti
33. Matteo
34. Letti
35. Letti
Epilog – Letti
Weihnachtliches Nürnberg Meine Tipps für euch!
Danke
Impressum
Über das Buch
Die Eltern der 16-jährigen Letitia haben Großes mit ihr vor: Sie soll eine Karriere im Eiskunstlaufen einschlagen. Als der Druck auf Letti zu groß wird, schmeißt sie hin – und jobbt stattdessen in der örtlichen Kinderklinik. Hier soll sie für weihnachtliche Stimmung sorgen und an einem Wunschbaum für die Kinder arbeiten. Da wäre nur ein Problem: Letti hasst Weihnachten! Helfen soll ihr außerdem der ein Jahr ältere Matteo. Durch seine humorvolle Art schafft er es nicht nur, ihr den Zauber der Adventszeit näherzubringen, sondern weckt auch tiefe Gefühle in ihr. Doch als sie den wahren Grund für Matteos Hilfsbereitschaft in der Klinik herausfindet, droht auf einmal alles zu zerbrechen ...
Über die Autorin
Larissa Schira, geboren 1995 in Nürnberg, verfasste während ihres Lehramtsstudiums ihren ersten Roman und entdeckte dabei ihre Liebe für das Schreiben wieder. Bereits im Alter von 5 Jahren schrieb sie ersten Geschichten und hatte mit 10 Jahren sämtlichen Lesestoff aus dem örtlichen Bücherbus verschlungen. Sie liebt Konzertbesuche, Kochen und verwöhnt ihre Meerschweinchen wo sie nur kann. DIE FARBE VON SCHNEEFLOCKEN ist ihr Debüt bei ONE.
1. Letti
34 Tage bis Weihnachten
»Übermorgen um sechzehn Uhr bei mir – und bring Grillanzünder mit. Oder Benzin. Irgendwas, das gut brennt.«
Ich konnte das Schweigen am anderen Ende der Leitung nicht deuten. Entweder war Nina gerade vor Schreck beim Radfahren das Handy aus der Hand gefallen, oder sie überlegte, mich einweisen zu lassen.
Ihr anschließendes Fluchen und das atemlose Keuchen ließen mich eher auf die erste Variante schließen. Ganz sicher aber fragte sie sich gerade, warum sie es jemals für eine gute Idee gehalten hatte, meine beste Freundin zu werden.
»Mein Gott, Letti. Bitte sag mir, du hast nur Lust auf Wintergrillen und nicht vor, das ganze Haus abzufackeln.«
Ein Lächeln huschte über meine Lippen. »Traust du mir wirklich zu, mein Zuhause anzuzünden?«
Als ich auf der hölzernen Brücke die Pegnitz überquerte, verlangsamten sich meine Schritte.
»Hm. Eigentlich nicht. Das Verbotenste, das du jemals gemacht hast, war, dich zwanzig Minuten vor dem Öffnen in die Schulbibliothek zu schleichen. Nach den letzten Wochen bin ich mir da allerdings nicht mehr so sicher.«
Ich rollte mit den Augen. Wenn sie das so sagte, klang es, als wäre ich der langweiligste Mensch der Welt. Aber das würde sich nun ändern. Endlich konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Und das würde ich auch.
Auf der Mitte der Brücke blieb ich stehen und lehnte mich ans Geländer. Der Winter hatte kein Blatt mehr an den Bäumen gelassen. Trotzdem beruhigte mich der Ausblick auf den Fluss, der unermüdlich an den romantischen Fachwerkhäusern vorbeiströmte.
»Also, kommst du oder nicht?«, fragte ich Nina. Bevor sie einen Rückzieher machen konnte, fügte ich noch schnell hinzu: »Und nein, das Haus wird nicht abgefackelt. Versprochen.«
Sie seufzte. »Na gut. Aber ich werde ganz sicher nichts Brennbares mitbringen.«
Dann würde ich eben selbst etwas auftreiben – das konnte ja nicht so schwer sein. »Hauptsache, du kommst. Bis später.«
Ihre Verabschiedung drang nur noch als gedämpftes Murmeln an mein Ohr, bevor ich auflegte.
Mein Blick schweifte zum anderen Ende der Brücke. Zwischen den kahlen Bäumen blitzte bereits die Fassade der Nürnberger Kinderklinik hervor. Während die Kinder von innen einen wunderbaren Ausblick auf Wiese und Fluss hatten, war der Anblick von außen eher trostlos. Da halfen auch die gelben und blauen Farbakzente nicht, die neben den Fenstern angebracht waren.
Ein Blick auf mein Handy verriet mir, dass ich mal wieder viel zu früh dran war. Trotzdem stieß ich mich vom Geländer ab und folgte dem leicht ansteigenden Weg zur Klinik hinauf. Frau Möller hatte nie etwas dagegen, wenn ich früher anfing. Im Gegenteil. Da ich nur als Freiwillige arbeitete und sie mir keine Überstunden bezahlen musste, freute sie sich immer, wenn ich länger blieb, um die Kinder zu unterhalten.
Der Geruch von Desinfektionsmittel und aufgewärmtem Braten stieg mir in die Nase, während ich mich auf den Weg zum Stationszimmer von Frau Möller machte. Die meisten Menschen verbanden diesen speziellen Krankenhausgeruch mit Angst, Schmerzen und schrecklichen Erinnerungen. Doch für mich war es der Duft von Freiheit. Die Freiheit, endlich das tun zu können, was ich liebte. Für mich bedeutete das, den Kindern genug schöne Erinnerungen aus dem Krankenhaus mitzugeben, damit sie später nicht ebenfalls vor dem Geruch davonliefen, sondern mit einem Lächeln auf diese harte Zeit zurückblicken konnten.
Schon von Weitem sah ich Frau Möller durch die offene Tür hinter ihrem Bildschirm sitzen. Mit einer Hand hielt sie das Telefon, die andere hatte sie angespannt auf ihre Schläfe gepresst. Zögernd blieb ich vor dem Stationszimmer stehen. Normalerweise meldete ich mich zunächst an und besprach die Aufgaben für den Tag mit ihr, bevor ich zu den Kindern ging. Die tiefen Sorgenfalten auf ihrer Stirn verrieten mir aber, dass ich sie besser nicht stören sollte.
Zum Glück sah sie in diesem Moment kurz auf und winkte mir zu. Ein kleines Lächeln zuckte über ihre Lippen, das jedoch sofort wieder verschwand. Die grauen Locken hüpften auf und ab, als sie energisch den Kopf schüttelte. »Nein, Frau Lindner, damit tun Sie Ihrem Sohn keinen Gefallen. Sie dürfen ihm keine Schokolade mehr mitbringen. Er ...« Sie machte eine Pause und stöhnte auf. »Ja, natürlich. Uns tut es auch leid, wenn er immer wieder danach fragt und dann weint. Aber da müssen wir alle konsequent sein, es ist doch nur zu seinem Besten. Wenn Sie ihm weiterhin Süßes geben, ohne uns zu informieren, können wir seine Diabetes-Medikation nicht richtig einstellen.«
In Bens Zimmer nach versteckter Schokolade suchen, notierte ich in Gedanken einen Punkt auf der heutigen To-do-Liste. Ich schenkte Frau Möller ein aufmunterndes Lächeln und deutete den Flur hinunter. Sie gab mir mit einem Daumen nach oben ihr Okay und widmete sich wieder voll und ganz Bens Mutter am Telefon.
Bevor ich mich um die geheimen Süßigkeitenvorräte kümmerte, zog es mich allerdings zu einem anderen Zimmer.
Während man sich mit den gelb und blau bemalten Wänden auf der Station Mühe gegeben hatte, um den Flur weniger steril und trist aussehen zu lassen, sahen die Türen alle gleich aus.
An dieser Tür prangte jedoch die kunterbunte Zeichnung eines Einhorn-Drachens. Mila hatte darauf bestanden. Sie war davon überzeugt, er würde von dort aus auf sie aufpassen und Monster in die Flucht schlagen. Zum Glück hatte Frau Möller immer ein offenes Ohr für die Wünsche der Kinder. Sie hatte nichts dagegen gehabt, dass wir ihn gemeinsam dort festklebten.
»Herein«, antwortete eine zarte Stimme auf mein Klopfen.
Vorsichtig steckte ich den Kopf durch den Türspalt, um sicherzugehen, dass ich nicht bei einer Visite störte. Doch das Einzige, was mir entgegendröhnte, war der Klang des Fernsehers. Mila saß alleine auf ihrem Bett, hatte das eingegipste Bein auf ein Kissen gelegt und winkte mich aufgeregt zu sich.
»Letti! Da bist du ja endlich!«
Von ihrem Strahlen angesteckt, zog ich schnell die Tür hinter mir zu und setzte mich zu ihr auf die Bettkante. Zu meiner Überraschung schaltete sie sofort den Fernseher aus und rutschte näher zu mir.
Automatisch scannte ich ihr Aussehen. Ihr blondes Haar war heute akkurat zu zwei Zöpfen geflochten, und ihre Wangen hatten einen rosigen Ton. Keine Spur von der Blässe, die mich vor ihrer OP jedes Mal hatte erschauern lassen, wenn ich ihr Zimmer betrat.
»Du bist ja schon wieder topfit. Und deine Zöpfe sind auch sehr hübsch. War deine Mama heute Morgen da und hat sie dir geflochten?«
Mila schien gar nicht zu bemerken, dass ich mit ihr redete. Skeptisch kniff sie die Augen zusammen. »Du siehst irgendwie komisch aus.«
Ich lachte auf. Natürlich wusste ich sofort, was sie meinte. Was für ein wunderbares Kompliment. So direkt konnte es nur ein Kind ausdrücken.
»Gut beobachtet. Fällt dir auch auf, was anders ist?«
Sie sah mich aufmerksam mit ihren großen, braunen Augen an, als könnte sie die Antwort aus meinen Gedanken lesen, wenn sie mich nur lange genug anstarrte. Dann klappte ihr Mund auf.
»O nein! Deine Haare! Die sind weg!« Ihr entsetzter Gesichtsausdruck ließ mich schmunzeln.
Ich schaute an mir hinunter. Der Anblick war immer noch seltsam. Ich konnte meine hellbraunen Haarspitzen nur noch mit Mühe auf Schulterhöhe erahnen. Mein Oberkörper sah ohne die langen Strähnen, die ihn umspielten, ungewohnt leer aus.
»Gut erkannt. Aber weg sind sie ja zum Glück nicht. Nur kürzer.« Ich zögerte, entschloss mich aber doch, sie zu fragen. Von Mila würde ich im Gegensatz zu meinen Freundinnen wenigstens eine ehrliche Antwort bekommen. »Wie gefällt dir meine neue Frisur?«
Sie beugte sich nach vorne und streckte die Hände nach meinen Haaren aus. Mein Blick schnellte sofort zum Tropf mit dem Schmerzmittel und dem Zugang in ihrer Hand. Sie durfte auf keinen Fall damit zwischen verknoteten Strähnen hängen bleiben. Doch das bunte Klebepflaster saß noch gut, und ich wollte ihr den Spaß nicht verderben.
Mila vergrub prüfend die Finger in meinen Haaren. Ich konnte mir ein Lachen nicht verkneifen.
»Die sind schön kuschelig.« Sie rutschte wieder von mir weg und schien zu überlegen. »Aber du schaust jetzt nicht mehr aus wie eine Prinzessin.«
Ihre Reaktion beruhigte mich. »Genau. Ich wollte auch nicht mehr aussehen wie eine Prinzessin. Sondern einfach nur wie Letti.«
Die Antwort schien ihr zu gefallen. Sie nickte bestimmt. »Ja, wie Letti. Also total cool!«
»Danke«, gab ich lachend zurück und deutete auf den Bücherstapel neben ihrem Nachttisch. »Und, bereit für das nächste Abenteuer vom kleinen Fuchs? Ich hab heute viel Zeit mitgebracht und bin schon ganz gespannt, wie es weitergeht.«
Das war nicht einmal geflunkert. Unsere gemeinsamen Lesestunden waren immer das Highlight meiner Schicht. Die Bücher, die ihre Mama aussuchte, waren witzig, tiefgründig und wunderschön illustriert. Außerdem war Mila einfach etwas Besonderes. Ich liebte es, wie gebannt sie beim Vorlesen lauschte und danach noch stundenlang über die Geschichten philosophieren wollte. Vielleicht erinnerte sie mich auch ein wenig an mich selbst, als ich sechs Jahre alt gewesen war.
»Nein, kein Fuchs heute. Mama hat ein neues Buch mitgebracht. Das müssen wir unbedingt lesen. Schau mal! Toll, oder?« Mila streckte sich zum Nachttisch und zog ein riesiges Buch hinter dem Stapel hervor. Dann drückte sie es mir in die Hand und schaute mich erwartungsvoll an.
Mein Magen zog sich schon beim Anblick des Covers zusammen. Zuckerstangen, Geschenke und zwei Elche vor einem geschmückten Baum. Eddie Elch und der Zauber von Weihnachten. Mein Lächeln verrutschte.
Ich schloss für einen Moment die Augen, um meinen Gesichtsausdruck wieder unter Kontrolle zu bekommen. Mila durfte nicht sehen, wie viel Abneigung dieses Buch in mir auslöste. Ich wollte ihr den Spaß daran nicht verderben. Aber vorlesen würde ich es auf keinen Fall.
Schnell öffnete ich die Augen wieder. Dann gab ich ihr das Buch zurück, bevor ich es noch versehentlich in die Ecke knallte, und bemühte mich um einen sanften Tonfall.
»Es ist erst November. Weihnachtsbücher sind was für die Adventszeit. Außerdem haben wir unser Fuchsbuch ja noch gar nicht zu Ende gelesen.« Die Ausreden sprudelten nur so aus mir heraus. »Und bestimmt will es deine Mama dir selbst vorlesen.« Ich streichelte über Milas gesundes Bein. Hoffentlich hatte ich nicht übertrieben, und sie war nicht zu enttäuscht.
Zu meiner Überraschung kniff sie jedoch die Lippen zusammen. Ein trotziger Ausdruck trat in ihr Gesicht. »Mama hat gesagt, ich soll es mit dir lesen. Und in zehn Tagen darf ich das erste Türchen vom Adventskalender aufmachen. Es ist also schon Weihnachten.« Sie schob das Buch zurück in meine Richtung. »Vorlesen. Bitte.«
Unentschlossen starrte ich auf den Einband. Ich konnte das unruhige Flattern in meinem Bauch nicht ignorieren. Alles in mir sträubte sich bei der Vorstellung, eine lustige Weihnachtsgeschichte zu lesen. Aber ich wusste genauso gut, wie lächerlich ich mich gerade benahm. Wegen eines dämlichen Kinderbuchs. Immerhin war ich hier die Erwachsene. Diejenige, die ihre Gefühle im Griff haben sollte. Und wenn Mila es unbedingt lesen wollte, musste ich mein Unwohlsein eben für ein paar Minuten ignorieren.
Seufzend hob ich es vom Bett und schlug die erste Seite auf. Mila klatschte aufgeregt in die Hände. Ihre Freude ließ das flaue Gefühl in meinem Magen sofort abklingen. Wie hätte ich ihr diesen Wunsch ausschlagen können?
Ich rutschte zu ihr ans Kopfende. Sie lehnte den Kopf an meine Schulter und kuschelte sich an meinen Arm.
Schon die Illustrationen auf der ersten Seite trieften vor Kitsch und Klischees und ließen mich erschaudern. Trotzdem begann ich mit einer lustigen Elchstimme zu lesen.
Als Mila mich nach einer geschlagenen Stunde endlich gehen ließ, machte ich mich auf den Weg zu Bens Zimmer. Das Quietschen von Gummisohlen am anderen Ende des Flurs ließ mich jedoch aufhorchen. Frau Möller bog um die Ecke, hob eilig die Hand und passte mich ab.
»Kommst du kurz mit mir ins Büro? Es gibt einiges für die nächsten Wochen zu besprechen.«
Ob sie wieder unterbesetzt waren? Das würde gerade noch fehlen. Meistens bat mich Frau Möller dann, ein paar Tage zu Hause zu bleiben. Als minderjährige Freiwillige war ich auf die Betreuung einer volljährigen Arbeitskraft angewiesen. Zumindest auf dem Papier. In der Praxis lief sowieso alles anders als in der Theorie.
Obwohl es nicht zu meinen Aufgaben zählte, hatte ich schon Bettwäsche gewechselt, Pflaster aufgeklebt oder die Pfleger und Pflegerinnen beim Verteilen der Medikamente begleitet. Wenn zu wenige von ihnen im Dienst waren, störte ich aber mehr, als dass ich helfen konnte. Immerhin war ich keine ausgebildete medizinische Fachkraft.
Ich folgte Frau Möller ins Stationszimmer und ließ mich auf einem der knarrenden Stühle ihr gegenüber nieder.
»Was gibt's?«
Sie schob den Bildschirm zur Seite und faltete die Hände auf dem Tisch. »Zuerst wollte ich mich nochmal für deine Hilfe bedanken. Ich bin froh, dass du so mutig warst, dich hier zu bewerben. Die Kinder lieben dich. Sie fragen die ganze Zeit nach dir. Wir hatten leider nie genug Zeit, uns so intensiv mit ihnen zu beschäftigen, wie du es tust.« Mit ihren schmalen Lippen formte sie ein Lächeln, das direkt in mein Herz floss.
Ich öffnete den Mund, stockte aber. Was sollte ich darauf nur antworten? Sie wusste genau, dass sie mich damit in Verlegenheit brachte. »Dafür bin ich ja da«, erwiderte ich nur und zuckte mit den Schultern.
Zu meiner Erleichterung ging sie nicht weiter darauf ein, sondern öffnete eine Schublade zu ihrer Rechten und zog einen Schlüssel daraus hervor.
»Und weil das alles in den letzten Wochen so gut geklappt hat, würde ich dir gerne eine weitere Aufgabe anvertrauen.«
Ich rutschte auf meinem Stuhl weiter nach vorne. Die Beschriftung auf dem roten Anhänger konnte ich allerdings nicht entziffern. Eine neue Aufgabe? Wozu gehörte der Schlüssel?
»Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Die schönste Zeit des Jahres. Vor allem für die Kinder.«
Ihre Worte hinterließen ein Stechen in meiner Brust. Meine Neugierde verflog ebenso schnell, wie sie gekommen war. Da konnte sie ihren blöden Schlüssel auch behalten. Ich lehnte mich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust.
Glaubte sie den Quatsch wirklich, den sie da erzählte?
»Nicht für jedes Kind.« Die Worte kamen härter über meine Lippen als beabsichtigt.
Frau Möller runzelte die Stirn. »Nein, nicht für jedes Kind. Vor allem nicht für die Kinder, die die Adventszeit und die Feiertage im Krankenhaus verbringen müssen. Aber deshalb bist du ja hier.«
Sie zählte auf mich. Und die Kinder auch.
Ich schaffte es nicht, ihr in die Augen zu sehen, während sie redete. Stattdessen starrte ich auf ihre Hände, die unermüdlich mit dem Schlüssel spielten. »Du wirkst nicht begeistert. Trotzdem fände ich es schön, wenn du dich um ein bisschen weihnachtliche Stimmung auf der Station kümmern würdest. Das ist in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen. Wir hatten dafür keine Zeit. Aber jetzt bist du ja da. Ich finde es wichtig für unsere kleinen Patienten.«
Sie legte den Schlüssel auf dem Tisch ab und schob ihn zu mir. »Damit kommst du in unsere kleine Rumpelkammer am Ende des Flurs. Dort lagern viele Kisten mit Weihnachtsdekoration.«
Ich wollte etwas erwidern, doch Frau Möller ließ mich nicht zu Wort kommen. »Du hast freie Hand. Benutz ruhig alles, was du findest. Und wenn du Hilfe brauchst, hätte ich noch ein paar Ideen für kleine Überraschungen parat. Denkst du, du kriegst das hin?«
»Ich weiß nicht«, murmelte ich. »Ist das wirklich nötig? Ich bin ... nicht gerade ein Fan von Weihnachten. Tut mir leid. Mir fallen aber hunderte Möglichkeiten ein, die Kinder ein bisschen glücklicher zu machen, die nichts mit Weihnachten zu tun haben. Kann ich mir da nicht etwas anderes überlegen?«
Frau Möller sah mich über den Rand ihrer Brille hinweg verständnisvoll an. Sofort beruhigte sich mein nervöser Herzschlag. Mein Gefühl hatte mich nicht getäuscht. Mit Ehrlichkeit konnte ich bei ihr nichts falsch machen.
»Hm.« Sie hob den Schlüssel wieder vom Tisch und ließ ihn durch die Finger gleiten. »Das ist schade. Ich weiß, dass du tolle Ideen hast. Aber es ist nun mal Advent. Das entgeht den Kindern ja nicht. Viele von ihnen freuen sich schon jetzt auf ihre Geschenke, haben einen Adventskalender hier oder hören Weihnachtsmusik. Dabei sollen sie sich wohlfühlen und nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, ob sie an Heiligabend zu Hause ihre Geschenke auspacken dürfen. Sie sollen spüren, dass Weihnachten hier trotz allem genauso schön sein kann wie daheim.« Sie seufzte. »Oder eben schöner.«
Mit jedem ihrer Worte sank ich ein Stück tiefer in den Stuhl. In meinem Kopf brach ein Sturm los. Vor meinen Augen tauchte Mila auf, die mir voller Stolz und Vorfreude ihr Weihnachtsbuch zeigte. Und verdammt, ich wollte der Freude der Kinder auf keinen Fall im Weg stehen. Vielleicht könnte ich mich dazu überwinden, wie gerade zum Vorlesen. So schwer konnte das nicht sein.
Trotzdem fühlte sich mein Herz mit einem Mal an, als hätte jemand Bleiketten darumgelegt. Warum musste ausgerechnet ich das machen? Es würde schon schlimm genug werden, jeden zweiten Tag in einem Weihnachtswunderland zu arbeiten und dabei so tun zu müssen, als würde ich mich über die Stimmung freuen. Das Krankenhaus war in den letzten Wochen zu einem Rückzugsort, meinem zweiten Zuhause geworden. Nirgendwo konnte ich so sehr ich selbst sein wie hier. Würde ich mich auf der Station überhaupt noch wohlfühlen? Aber mir blieb nichts anderes übrig. Die Kinder gingen vor. Ich wollte nicht diejenige sein, die ihnen den Spaß an Weihnachten verdarb.
»Na gut. Ein bisschen Weihnachtsstimmung sollte ich schon hinbekommen.« Die Worte kamen mir nur schwerfällig über die Lippen. Aber ich war froh, sie ausgesprochen zu haben. Ich musste meine Abneigung überwinden, wenn es die Kinder glücklich machte. Hier ging es nicht um mich.
Frau Möllers Züge hellten sich auf. »Oh, na, das ist doch toll. Du wirst sehen, die Kleinen werden es lieben.«
Sie drückte mir den Schlüssel in die Hand. »Hier, du kannst ihn erstmal behalten. Aber geh sorgsam damit um. Der Zweitschlüssel ist schon seit ein paar Jahren verschwunden. Wir können nicht schon wieder ein Schloss austauschen lassen, sonst muss ich wieder eines dieser Gespräche mit dem Chef führen.«
Ich verkniff mir ein Schmunzeln.
Obwohl sie sich bemühte, ihre Zerstreutheit vor ihren Kollegen und Vorgesetzten zu verbergen, gelang es ihr nur selten. Aber ihre chaotische Art war genau das, was wir alle an ihr liebten. Nur den Chef brachte sie damit regelmäßig zur Verzweiflung. Doch selbst er konnte ihr nie lange böse sein.
»Und ich versuche, dich mit den Weihnachtsplänen zu unterstützen, wo es geht. Leider kann ich dir nur nicht alles abnehmen. Du weißt, wir brauchen jede Hand in der Pflege. Aber ich werde sehen, was sich machen lässt und ... oh.«
Sie zückte ihren schweren Silberkugelschreiber und kritzelte etwas auf einen der unzähligen Notizzettel, die auf dem Schreibtisch verstreut waren.
Hin- und hergerissen von ihrer Reaktion richtete ich mich im Stuhl auf. Musste sie wegen mir nun etwas umplanen? Das konnte ich kaum mit meinem Gewissen vereinbaren. Andererseits hatte ich ja zugestimmt. Wenn sie nun trotzdem etwas umwerfen wollte, war das nicht meine Schuld.
»Danke. Das weiß ich zu schätzen. Ich werde gleich morgen anfangen zu dekorieren und wie immer helfen, wo ich kann.«
Frau Möller blickte kaum von ihrem Zettel auf. »Ist gut.« Hatte sie mir überhaupt zugehört?
Ich nutzte die Gelegenheit, um aufzustehen. Es war besser, sie erstmal alles ordnen zu lassen. Und ich hätte etwas Zeit, um mich selbst mit meiner neuen Aufgabe anzufreunden. »Dann werde ich mal Bens Zimmer durchforsten.«
»Mach das«, murmelte sie und begann, hektisch in ihrem Zettelhaufen zu wühlen.
Was suchte sie? Was war ihr plötzlich so Wichtiges eingefallen? Oder war sie doch ein bisschen genervt, weil ich ihre Begeisterung für die Weihnachtszeit nicht teilte?
Leise schlich ich zur Tür, um sie nicht zu stören. Als ich sie hinter mir zuzog, lockerte sich langsam die bleierne Schwere in meiner Brust.
Ich verhielt mich lächerlich. Es war alles in Ordnung. Und es würde auch so bleiben, ein bisschen Weihnachtsdeko hin oder her.
Hoffentlich.
2. Matteo
33 Tage bis Weihnachten
Mit einem ohrenbetäubenden Quietschen öffneten sich die Aufzugtüren. Ich machte einen Schritt hinaus in den Flur. Der Gestank, der mir entgegenschlug, machte es jedoch schwer, nicht gleich wieder zurückzustolpern und abzuhauen. Zigarettenqualm, der sich über die Jahre in die Wände gefressen hatte, vermischte sich mit abgestandenem Bier. Kein Wunder. Der Alte von nebenan hatte mal wieder das Altglas der letzten Wochen im Flur deponiert, statt die Flaschen zu entsorgen.
Ich zog mir die Kapuze meines Hoodies tiefer ins Gesicht. Sie schirmte den Geruch zwar etwas ab, konnte mich jedoch nicht vor all den Erinnerungen schützen, die in diesem Moment über mich hereinbrachen. Ich musste den Besuch so schnell wie möglich hinter mich bringen.
Unentschlossen tastete ich nach dem Schlüsselbund in meiner Tasche. Ob ich aufsperren oder es nochmal mit Klopfen probieren sollte? Dass mir unten schon niemand geöffnet hatte, war kein gutes Zeichen. Wahrscheinlich war heute wieder einer der schlechteren Tage. Doch ich hatte Mikes alte Karre nirgendwo entdeckt. Das bedeutete zumindest, dass Mama alleine war und ich ihm nicht über den Weg laufen würde. Was hatte ich also zu verlieren?
Während ich den Schlüssel ins Schloss schob, entschied ich mich aber, doch noch zu klopfen. »Ich bin's, Mama. Ich komm rein, okay?«
Zu meiner Erleichterung empfing mich im Inneren ein angenehmerer Geruch. Dennoch zog sich mein Magen schmerzlich zusammen.
Ich schlüpfte schnell durch die Tür und schloss sie hinter mir, bevor der abgestandene Rauch aus dem Flur hineinziehen konnte. Mein Blick huschte über die Schuhe, die kreuz und quer vor der Garderobe verstreut lagen. Aber es waren keine Männerschuhe dabei.
Dann hielt ich inne und lauschte. Nichts. Nur das Rattern des uralten Kühlschranks durchschnitt die Stille.
»Mama? Bist du zu Hause?«, rief ich in Richtung Wohnzimmer.
»Matteo?«
Ich atmete auf. Sie war hier. Alleine. So würde ich wenigstens kurz mit ihr reden können. Unachtsam warf ich meinen Rucksack auf den Schuhhaufen.
Als ich das Wohnzimmer betrat, war ich mir plötzlich jedoch nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee war. Ich hatte recht gehabt. Heute war wirklich einer der schlechten Tage.
Die Vorhänge waren zugezogen. Tassen, Gläser und Teller stapelten sich auf dem Couchtisch. Mist. Meine Finger verkrampften sich um den Schlüssel in meiner Hand.
Mama richtete sich eilig auf dem Sofa auf. Krümel fielen von ihrem ausgeblichenen Pulli. »Was machst du denn hier? Du sollst doch anrufen, bevor du vorbeikommst.« Sie fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Ich kannte diesen Anblick nur zu gut. Sie hatte es bestimmt zwei oder drei Tage lang nicht gekämmt.
Woher sollte ich nun schon wieder die Kraft nehmen, das alles in Ordnung zu bringen?
Schnell wandte ich mich ab, lief zum Fenster und zog die Vorhänge auf. »Hab ich doch versucht. Die letzten zwei Wochen. Jedes Mal hängt Mike hier rum, oder es passt dir gerade nicht. Da bleibt mir doch nichts anderes übrig, als einfach ungefragt aufzukreuzen.«
Mama kniff die Augen zusammen und blinzelte gegen das Sonnenlicht an. Mein Herz zog sich zusammen. Wie lange sie wohl schon in der Dunkelheit gesessen hatte?
»Es geht eben nicht anders. Du weißt doch, es ist ... es ist nicht ... ich will doch nur ...« Sie verstummte.
»Ja, ich weiß«, erwiderte ich und lief zur Couch zurück. »Aber so kann es trotzdem nicht weitergehen. Deswegen bin ich auch hier. Ich wollte dir was erzählen.« Ich ließ mich neben sie in die durchgesessenen Polster sinken.
»Was denn?« Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
Ich schloss für ein paar Sekunden die Augen und holte tief Luft.
Einerseits wollte ich sie damit nicht belasten. Doch andererseits musste sie es erfahren. Wir mussten endlich darüber reden. »Hast du den Brief vom Gericht gelesen?«
Ihr Blick huschte panisch zur Seite. Ich folgte ihm und entdeckte den Stapel mit Briefen, die sie achtlos auf den Tisch geworfen und offensichtlich nie geöffnet hatte. Ich stöhnte auf und rieb mir die Stirn, hinter der es leise zu pochen begann. Warum fragte ich überhaupt?
»Mein Gott, es interessiert dich einfach einen Scheiß, was mit mir passiert, oder?« Ich hatte mir vorgenommen, ihr keine Vorwürfe zu machen. Aber ich konnte nicht anders. Obwohl ich damit gerechnet hatte, riss mir die Enttäuschung ein Loch in die Brust. Welcher Mutter war ihr Sohn schon so egal, dass sie nicht mal einen offiziellen Brief über ein gerichtliches Urteil öffnete?
»Schatz, bitte, sei nicht böse. Es interessiert mich natürlich. Ich hatte nur nicht die Kraft ...« Sie rutschte näher zu mir. Plötzlich spürte ich ihren Arm um meine Schultern. Doch ihre Berührung fühlte sich an wie ein Stromschlag. Ich sprang auf.
»Die haben mich zu vierzig Sozialstunden verdonnert. Eigentlich müsstest du was unterschreiben. Den Empfang bestätigen und so. Aber ich hab ihnen schon erzählt, wie das bei uns läuft. Ist also wahrscheinlich nicht nötig. Ich dachte nur, du solltest es wissen.«
Sie schlug die Hand vor den Mund und sah zu Boden.
Mit jeder Sekunde, die ich sie anstarrte und auf eine Antwort wartete, rauschte es lauter in meinen Ohren. Verdammt, ich hätte nicht herkommen sollen. Selbst ohne Mike war es hier nicht auszuhalten. Und eigentlich wusste ich das auch. Warum trieb es mich trotzdem immer wieder zurück in dieses Drecksloch?
»Es ist wahrscheinlich besser, du gehst jetzt«, brachte sie mit schwankender Stimme hervor. »Mike wird bald nach Hause kommen. Es wäre mir lieber, wenn er nicht mitbekommt, dass du hier warst.« Sie sah zu mir auf. In ihren blauen Augen lag ein verdächtiger Schimmer. Das Rauschen nahm meinen ganzen Kopf ein.
»Wie wäre es, wenn du dich einfach mal durchsetzt und ihn wegschickst statt mich?« Ich winkte ab. Es hatte sowieso keinen Sinn. Ich würde mit ein paar kläglichen Gesprächsversuchen niemals weiterkommen. Das hatte ich schon zu oft versucht. »Ich weiß, ich weiß, das ist völlig unmöglich. Mach dir wegen mir nur keine Umstände.«
»Es tut mir alles so leid, Schatz. Wirklich.«
Schnaubend drehte ich mich um. Ihre Entschuldigungen konnte sie sich sparen. Sie waren nichts als leere Worte ohne Bedeutung.
»Ich hol noch ein paar Sachen aus meinem Zimmer. Dann bin ich wieder weg, keine Sorge.«
Sie wollte noch etwas erwidern, doch ich eilte zum Raum gegenüber und schlug die Tür hinter mir zu. Ich lehnte mich mit dem Rücken dagegen und nahm mir einen Moment Zeit, um durchzuatmen. Der Anblick meines Zimmers ließ mich jedoch nicht zur Ruhe kommen.
Alles sah noch genauso aus wie vor ein paar Monaten, als ich es verlassen hatte – bis auf den Schrott, der sich auf meinem Bett türmte. Fremde Shirts, eine Sammlung billiger Männerparfüms, die aus einer Sporttasche quollen, Kartons ...
Was dachte sich dieser aufgeblasene Idiot eigentlich? Auch wenn er es geschafft hatte, mich für ein paar Monate in die Flucht zu schlagen, konnte er doch nicht einfach alles an sich reißen. Das war immer noch mein Zimmer. Mein Bett. Und meine Mutter.
In meiner Wut fegte ich mit einer schnellen Handbewegung den ersten Karton vom Bett. Er fiel rumpelnd zu Boden. Mein Herz wurde mit jedem Gegenstand, den ich vom Bett stieß, leichter. Papier segelte hinunter, Parfümdeckel rollten durchs Zimmer – und es war mir völlig egal, ob dabei etwas kaputtging.
Zufrieden betrachtete ich mein Werk. Zu gerne würde ich Mikes blöde Fratze sehen, wenn er später merkte, was ich angerichtet hatte. Aber dafür extra hierzubleiben und zu warten, bis ich ihm in die Arme lief, war keine gute Idee. Die Vorstellung musste reichen.
Ich riss den Kleiderschrank auf. Wahllos griff ich nach ein paar Pullis und Mützen. Eigentlich hatte ich noch vorgehabt, ein bisschen Kram aus meiner Weihnachtskiste rauszusuchen und mitzunehmen. Aber mir war die Lust vergangen, mich auch nur eine Sekunde länger als nötig in dieser Wohnung aufzuhalten.
Ich stapfte zurück in den Flur, stopfte meine Ausbeute in den Rucksack und warf ihn mir über die Schulter. Mit einem Mal waren meine Füße jedoch zu schwer, um sie auch nur einen Zentimeter anzuheben.
Verdammt. Ich wollte gehen. Und ich wollte vor allem nicht schon wieder nachgeben. Aber ich konnte auch nicht einfach wortlos verschwinden.
»Ich bin dann mal weg. Und ... ruf mich an, wenn du was brauchst. Zumindest, solange Mike nicht da ist.«
Auf eine Antwort wartete ich jedoch nicht. Sobald ich die Worte ausgesprochen hatte, gehorchten mir meine Füße wieder, und ich flüchtete aus der Wohnung.
Am Aufzug lief ich vorbei. Das Letzte, was ich nun noch gebrauchen konnte, war eine Begegnung mit Mike. Also nahm ich das Treppenhaus. Die Stufen flogen unter meinen Füßen vorbei. Mit jedem Stockwerk geriet ich mehr außer Puste. Aber das war gut so. Mit jedem Atemzug wandelte sich ein Hauch meiner Wut in neue, positivere Energie.
Zwölf Treppenabsätze. Dann umhüllte mich die frostige Frische des nahenden Winters und brachte mich zurück ins Hier und Jetzt.
Ich machte mich auf den Weg zur U-Bahn. Um auf andere Gedanken zu kommen, kramte ich die Kopfhörer aus der Hosentasche und schloss sie an mein Handy an.
Let It Snow.
War es dafür im November noch zu früh? Ach, egal. Wenn es meine Stimmung hob, war es genau das Richtige.
Ich drückte auf Play. Michael Bublés Stimme verfehlte ihre Wirkung nicht. Sofort lockerten sich meine angespannten Kiefermuskeln, und meine Atmung beruhigte sich endlich. Die weihnachtlichen Klänge drangen direkt in mein Herz ein. Verstohlen warf ich einen Blick über die Schulter und spähte die Straße entlang. Außer ein paar Kindern am Spielplatz hinter dem benachbarten Hochhaus war niemand zu sehen. Also ließ ich mich beim Refrain dazu hinreißen, leise mitzuträllern. Obwohl eine graue Wolkenschicht die Sonne verdeckte, schien sich alles um mich herum aufzuhellen. Als wäre die Straße wirklich von einer dichten Schneeschicht bedeckt.
Mitten im Song stoppte die Musik allerdings plötzlich. Mist, war das Datenvolumen schon wieder verbraucht? Ein Blick auf das Display ließ mich jedoch erstarren. Ich wurde angerufen – von Jörg.
Mein Finger nahm mit einem Mal die Konsistenz eines Gummispielzeugs an. Ich brauchte drei Versuche, um fest genug über den grünen Hörer zu wischen.
»Hey, gibt es endlich was Neues?«, brachte ich atemlos hervor. Wow, sogar in meinen Ohren klang das ganz schön verzweifelt.
Statt einer Antwort schallte Jörgs tiefes Lachen durchs Telefon.
»Sag schon, was ist los?« Seine fröhliche Reaktion beruhigte mich und ließ meine Neugierde wachsen.
»Wie kommst du darauf, dass etwas los ist? Vielleicht wollte ich mich ja nur erkundigen, wie es bei dir so läuft. Das gehört auch zu meinen Aufgaben.«
»Alles bestens. Ich war heute sogar in der Schule. Hab dann jemanden besucht und bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Also schieß los.« Ich betete, dass er nicht weiter nachhakte. Denn ich wollte ihn nicht anlügen.
Ich wusste, wie er zu den Besuchen bei meiner Mutter stand. Wenn es nach ihm ging, sollten wir uns erstmal nur an neutralen Orten treffen. Im Café. Bei einem Spaziergang. Aber das hatte fast noch nie geklappt. Sie konnte nicht. Und ich musste ab und zu bei ihr vorbeischauen, um sicherzugehen, dass es ihr gut ging.
»Klasse. Deine Lehrerin hat in ihrer letzten Mail auch nur Positives berichtet. Du gibst dir wirklich Mühe, hm?«
»Na klar. Ich will den ganzen Mist möglichst schnell und unkompliziert über die Bühne bringen.«
»Und deswegen will ich dir auch dabei helfen. Fleiß wird bekanntlich belohnt. Also habe ich mich noch ein bisschen für dich eingesetzt und tolle Neuigkeiten.«
Ich drückte mir die Kopfhörer fester in die Ohren, um bloß kein Wort zu verpassen. Tolle Neuigkeiten?
Mit Jörg hatte ich unglaubliches Glück gehabt. Er war der beste Betreuer, den ich mir vorstellen konnte. Er machte nicht einfach nur seinen Job. Er nahm sich Zeit, hatte immer ein offenes Ohr und blickte hinter die Fassade, statt mich und die anderen Jugendlichen als missratene Straftäter abzustempeln, die sowieso keine Zukunft hatten. Ganz im Gegenteil: Er glaubte an mich und setzte sich für mich ein. Keine Moralpredigten und Vorwürfe, nur grenzenlose Unterstützung. Und vielleicht sogar ein bisschen Freundschaft.
Ich konnte also gar nicht anders, als mir Mühe zu geben. Denn ihn zu enttäuschen war keine Option.
»Die Kinderklinik hat sich noch mal gemeldet. Sie haben es sich anders überlegt. Vielleicht geben sie dir doch eine Chance.«
Mein Herz begann zu flattern.
»Vielleicht? Was heißt vielleicht?«, stieß ich hervor.
»Sie haben sich noch nicht endgültig entschieden. Dafür würden sie dich gerne zu einem Gespräch und einem Kennenlernen einladen. Ich hab ihnen gesagt, dass das nicht nötig ist und nochmal ein gutes Wort für dich eingelegt. Aber da kommst du wohl nicht drum rum, wenn du die Stelle willst.«
»Ja, natürlich will ich! Kann ich gleich hinfahren? Oder wann soll ich dort sein?«
Jörg lachte erneut. »Immer langsam. Ich schicke dir die Durchwahl zu der Stationsleitung. Dort kannst du anrufen und einen Termin vereinbaren. Aber wenn du das tust ... zeig dich doch bitte etwas geduldiger und ruhiger, okay?«
Ich schnaubte. Als wüsste ich nicht, wie man sich benimmt. Da müsste er mich inzwischen doch besser kennen. »Natürlich. Und danke! Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet.«
»Das freut mich. Und ich hoffe, du weißt andersherum genauso, dass ich das nicht für jeden tun würde. Wenn da etwas schiefläuft, bin ich derjenige, der den Kopf hinhalten muss. Also zeig, was du kannst. Versau es nicht.«
»Niemals. Her mit der Nummer. Ich muss da sofort anrufen. Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit gehören ja bekanntlich auch zum guten Ton.«
Er seufzte. »Also schön. Gib mir Bescheid, wie es gelaufen ist. Bis bald.«
Ich hämmerte auf das Auflegen-Symbol. Erst nach dem Piepton fiel mir auf, dass ich in meiner Aufregung vergessen hatte, mich zu verabschieden. Aber Jörg würde es mir nicht übelnehmen.
Das hier war so verdammt wichtig. Ich hatte die Chance, die Sozialstunden so umzusetzen, wie ich es mir gewünscht hatte. Die Arbeit in der Kinderklinik abzuleisten war immerhin meine Idee gewesen. Bei der Aussicht, wie die anderen Müll vom Straßenrand zu sammeln oder in einer Suppenküche Kartoffeln zu schnippeln, erschauderte ich. Das war zwar auch eine sinnvolle Arbeit, die anderen Menschen half, doch leider nichts für mich – ich brauchte Abwechslung. Etwas, bei dem ich im besten Falle nicht nur etwas bewirkte, sondern auch noch Spaß hatte.
Kaum hatte ich aufgelegt, schickte mir Jörg auch schon die Nummer seiner Kontaktperson.
Ich ließ Michael Bublé weiter in mein Ohr singen und hüpfte mit federnden Schritten die Stufen zur U-Bahn hinunter. Vielleicht würde heute doch noch ein guter Tag werden.
3. Letti
30 Tage bis Weihnachten
Als ich die Station betrat, rechnete ich mit allem. Damit, dass Frau Möller bereits Weihnachtsmänner und Rentiere aufstellte oder mir eine rote Mütze über den Kopf ziehen und mich zum Singen von Weihnachtsliedern zwingen würde. Aber nicht damit, was mich stattdessen erwartete: dass alles ruhig und unberührt vor mir lag und ich bei dem Gedanken an meine heutigen Aufgaben nicht einmal schlechte Laune bekam.
Ich hatte mir vorgenommen, gleich das Schlimmste zu erledigen. So hatte ich es hinter mir, konnte mich schon einmal an den Anblick der Weihnachtsdeko gewöhnen und schneller wieder zu den Aufgaben übergehen, die mir wirklich Spaß machten.
Auf dem Weg zum Stationszimmer riss mich jedoch ein lautes Rumpeln aus den Gedanken. Hoffentlich war keines der Kinder beim Rumturnen aus dem Bett gefallen oder hatte einen Tropf umgestoßen. Alarmiert riss ich den Kopf herum. Doch eigentlich war das Geräusch zu nah gewesen, um aus einem der Patientenzimmer zu kommen. Vielleicht aus dem Raum mit den Putzutensilien?
Es rumpelte erneut. Dann bemerkte ich zu meiner Linken eine Tür, die einen Spalt breit offen stand.
Ungläubig starrte ich auf das Schild. Die Zimmernummer, die darauf geschrieben war, ließ mich stutzen.
Wie konnte das sein? Ich warf meine Tasche zu Boden, zerrte den Reißverschluss auf und wühlte darin herum. Bis ich endlich den Schlüssel ertastete, den Frau Möller mir anvertraut hatte. Ich verglich die Nummer vom Anhänger mit der auf dem Schild. 302. Meine Erinnerung hatte mich nicht getäuscht. Es war die gleiche.
Mein Herz stolperte und verpasste mir einen kleinen Stoß gegen die Rippen.
Was war hier los? Sie hatten wohl kaum wegen eines Vormittags, an dem ich mit dem Schlüssel nicht hier gewesen war, die Kammer aufgebrochen.
So leise wie möglich schlich ich auf das Zimmer zu.
Ich beschloss, erstmal zu beobachten, was dort vor sich ging, bevor ich mich in etwas einmischte, das mich nichts anging – oder einen Einbrecher aufschreckte.
O Gott. Das würden doch nicht irgendwelche Junkies sein, die Medikamente stehlen wollten?
Mit trommelndem Herzen lugte ich durch den Spalt. Die Ursache für den Lärm erkannte ich sofort. Ein Karton lag seitlich auf dem Boden, und Weihnachtsdeko verteilte sich über den ganzen Raum. Der Übeltäter hatte mir jedoch den Rücken zugekehrt. Und trug keine Arbeitsbekleidung. Kein weißes Shirt, keinen Kittel. Dafür einen dunkelblauen Hoodie, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Seine Statur ließ mich allerdings auf einen Mann schließen. Eindeutig.
Als er sich zur Seite drehte, zog ich schnell den Kopf zurück. Hatte er mich bemerkt? Plötzlich kam mir sogar das Atmen zu laut vor. Ich legte die Hand vor die Nase, um meine eigenen Geräusche zu dämpfen.
Und jetzt? Da stand eindeutig ein fremder Mann, der nicht hier arbeitete, in der Kammer. Er musste noch dazu die Tür aufgebrochen haben, falls Frau Möller sich neulich nicht geirrt hatte und es doch noch einen Zweitschlüssel gab.
Hilfesuchend blickte ich den Flur hinunter. Ausgerechnet jetzt war von dem sonst so hektischen Treiben nichts zu sehen. Niemand, den ich zu mir winken konnte. Ganz toll. Ich musste mir also selbst etwas ausdenken. Dass dieser Fremde am Ende noch zur Gefahr für die Kinder wurde, konnte ich auf keinen Fall zulassen.
Ich wagte erneut einen vorsichtigen Blick hinein. Der Kerl kniete vor der Kiste und sammelte die herausgefallenen Tannenzapfen und LED-Kerzen ein. Als er zu Boden sah, erhaschte ich trotz der Kapuze einen Blick auf sein Gesicht.
Er war jung. Höchstens zwei oder drei Jahre älter als ich. Und er sah überhaupt nicht aus wie ein Junkie. Vielleicht war das der Grund, warum mein Herzschlag plötzlich in einen anderen Takt wechselte und ruhiger wurde.
Abgesehen davon: Wer war schon so blöd und suchte in der Abstellkammer nach Medikamenten? Oder brach in einem Krankenhaus ein, um Weihnachtsdeko zu klauen?
Bestimmt gab es eine Erklärung dafür. Es sollte kein Problem sein, einfach reinzugehen und ihn darauf anzusprechen. Oder?
Ich nahm all meinen Mut zusammen und schob die Tür weiter auf. Der Fremde bemerkte es nicht. Er stand gerade mit dem Rücken zu mir vor einem der Regale und schien etwas zu suchen. Nein, gefährlich war er definitiv nicht. Dazu wirkte er zu ruhig. Vorsichtig hob er einen länglichen Gegenstand vom obersten Brett.
Ich räusperte mich. Doch er drehte sich immer noch nicht um. Stattdessen begann er, laut vor sich hin zu pfeifen. Sofort erkannte ich die Melodie von Last Christmas. Stirnrunzelnd blieb ich hinter ihm stehen.
»Hallo?« Zögerlich trat ich noch einen letzten Schritt nach vorne und tippte ihm auf die Schulter.
Das Pfeifen brach ab, und ein Ruck ging durch seinen Körper. Er fuhr herum. Zu schnell für mich, um zu reagieren. Im nächsten Moment donnerte der Gegenstand in seiner Hand gegen meine Wange. Ein dumpfer Schmerz schoss mir vom Wangenknochen bis in die Nasenwurzel.
»Ahhh, spinnst du?!« Entgeistert blickte ich zu ihm auf. Er starrte mit offenem Mund zurück.
Bitte, lass nichts gebrochen sein!
Ich hob die Hand und tastete vorsichtig die pochende Stelle ab. Die Berührung ließ den Schmerz noch stärker aufflammen, doch es fühlte sich zum Glück alles an wie immer. Puh. Ich musste in den nächsten Tagen also höchstens einen blauen Fleck überschminken. Einen zertrümmerten Wangenknochen rekonstruieren zu lassen, wäre sicher komplizierter geworden.
Der Kerl blickte auf die überdimensionierte hölzerne Zuckerstange, die er immer noch in der Hand hielt.
»Verdammt, das wollte ich nicht! Tut mir leid!« Er warf sie unachtsam zur Seite. »Aber warum schleichst du dich auch so an?«
Endlich besaß er die Höflichkeit, sich die Kapuze abzustreifen. Seine dunklen Haare luden sich dabei elektrisch auf und standen in alle Richtungen von seinem Kopf ab. Trotz des Pochens in meiner Wange musste ich grinsen.
Sofort kam mir Mila in den Sinn. Wir hatten erst letzte Woche mit Luftballons gespielt. Über den Kopf reiben und dann an die Decke kleben – damit hätte ich sie stundenlang beschäftigen können. Sie hatte jedes Mal wieder über unsere abstehenden Haare und die bunten Ballons an der Decke gekichert.
Mit den kurzen Haaren des Typen sah es noch viel witziger aus. Mila hätte sich bestimmt krummgelacht.
Er schien meinen Blick zu bemerken und fuhr sich mit beiden Händen über den Kopf. Mit Erfolg. Seine Frisur war immer noch wild, doch hatte nun eher etwas Ungezähmtes an sich.
Gleichzeitig stachen mir die roten Kabel ins Auge, die unter seinem Pulli hervorkamen – und an den Stöpseln in seinen Ohren endeten. Kopfhörer. Last Christmas. Deswegen hatte er mich also nicht kommen hören. Endlich nahm er sie heraus und ließ sie achtlos am Kragen herunterbaumeln.
»Anschleichen? Wenn du dir weiter mit diesem Song die Gehirnzellen abtöten willst, dreh ihn wenigstens leiser. Dann hörst du nämlich auch, wenn jemand mit dir redet und musst ihm nicht zur Begrüßung eine verpassen.«
Unsere Blicke trafen sich. Ich konnte das Schimmern in seinen blauen Augen nicht deuten. Tat es ihm leid? Oder war ich mit meiner Antwort zu weit gegangen? Immerhin hatte ich nach wie vor nicht die geringste Ahnung, wer er war und was er hier zu suchen hatte.
Doch irgendetwas an ihm verriet mir, dass ich keine Angst vor ihm haben musste.
Statt mir meine Worte übelzunehmen, zuckten seine Mundwinkel jedoch nach oben. »Du musst Letitia sein.«
Irritiert runzelte ich die Stirn. Woher wusste er das? Arbeitete er doch hier? War ich ihm nur noch nie über den Weg gelaufen? Das wäre verdammt peinlich. Inzwischen war es mir aber egal, ob ich mich blamierte. Schlimmer konnte diese Begegnung sowieso nicht mehr werden.
»Äh, ja ... Letti. Einfach nur Letti. Aber wieso ... und was machst du hier überhaupt? Wer zur Hölle bist du?«
Er lachte. An seinen Nasenflügeln bildeten sich dabei kleine Grübchen. Faszinierend. Erst, als er antwortete, fiel mir auf, dass ich sie einen Moment zu lange angestarrt hatte. Ertappt wandte ich mich ab und versuchte die Hitze zurückzudrängen, die mir ins Gesicht schoss.
»Ganz einfach. Du hältst Last Christmas für gehirnschädigend. Frau Möller hat mich schon vorgewarnt, dass du nicht gerade ein Weihnachtsfan bist.« Sein Zwinkern machte es mir endgültig unmöglich, nicht den gleichen Rotton anzunehmen wie die Zuckerstange, mit der er mir eine verpasst hatte.
Er streckte mir die Hand entgegen. »Matteo. Dein neuer Kollege. Und übrigens auch leidenschaftlicher Verfechter von Last Christmas, dem größten weihnachtlichen Meisterwerk, das jemals geschaffen wurde.«
Wow. Also hatte ich mit meiner ursprünglichen Vermutung gar nicht so falschgelegen. Ihm war wirklich nicht zu helfen.
Eigentlich wäre seine Vorliebe für Weihnachten Grund genug gewesen, ihm nicht die Hand zu schütteln. Trotzdem ergriff ich sie aus einem Impuls heraus. Ein Schnauben konnte ich mir jedoch nicht verkneifen.
»Das heißt, du bist hier, um dich um diesen Weihnachtskram zu kümmern?«
Obwohl es sicher anstrengend werden würde, mit einem Weihnachtsfanatiker auf der gleichen Station zu arbeiten, glomm ein Funken Hoffnung in mir auf. Vielleicht hatte Frau Möller vor, ihm diese Aufgabe zu überlassen. Dann würde ich mich in Ruhe mit den Kindern auf ihren Zimmern beschäftigen können, während er den Aufenthaltsraum unter Kunstschnee begrub und mit Wham! beschallte.
»Jap. Ich helfe bis Ende Dezember hier aus. Für Weihnachtsstimmung und strahlende Kinderaugen.«
»Na, das kann ja was werden«, entfuhr es mir. Toll. Warum konnte ich nicht ein einziges Mal nachdenken, bevor ich den Mund aufriss? Schnell fügte ich hinzu: »Aber danke, dass du dich drum kümmerst. Dann muss ich nicht so tun, als hätte ich Spaß dabei.«
Er vergrub die Hände in der Bauchtasche seines Hoodies. Sein linker Mundwinkel zuckte nach oben. »Wie es aussieht, sind es nicht nur die Kinder, die ein bisschen Weihnachtsstimmung gebrauchen können.«
Hatte ich einen so frustrierten Eindruck hinterlassen? Bevor ich etwas erwidern konnte, kniff er jedoch die Augen zusammen, trat einen Schritt näher und beugte sich zu mir.
Was hatte er nun vor? Seine plötzliche Nähe umschloss meine Gedanken mit Watte und machte es mir schwer, einen von ihnen zu greifen.
Sein warmer Atem streifte meine Wange. Der Duft von Lebkuchen umhüllte mich. Obwohl meine Muskeln gerade zum Zerreißen angespannt waren, musste ich schmunzeln. Dieser Typ war wirklich eine Nummer für sich. Natürlich roch er nach Lebkuchen. Wonach auch sonst? Es würde mich nicht einmal wundern, wenn er morgen mit grau gefärbten Haaren, Weihnachtsmannbart und rotem Mantel hier auftauchen würde.
»Oh. Deine Wange sieht irgendwie nicht so gut aus. Wird ganz schön dick.« Er trat wieder einen Schritt zurück, und die Watte in meinem Kopf flog davon. »Ich besorg dir was zum Kühlen, okay?«
Ich runzelte die Stirn. Ja, das war eine gute Idee. Meine linke Gesichtshälfte pochte inzwischen unaufhörlich. Eine so aufmerksame Geste hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Er drückte sich an mir vorbei und schlängelte sich zwischen den gestapelten Kartons hindurch. Im Türrahmen machte er jedoch abrupt Halt.
Sein hilfloser Gesichtsausdruck verriet mir sofort, wo das Problem lag.
»Lass mich raten ... du bist erst seit heute hier und hast keine Ahnung, wo du Kühlpacks findest?«
Er zuckte mit den Schultern und nickte.
Trotz steigender Schmerzen musste ich grinsen. »Komm mit, ich zeig's dir.« Ich folgte ihm in den Flur. »Aber ... trotzdem danke. Und sorry. Ich wollte dich nicht erschrecken.«
Er winkte ab. »Kein Ding. Und nichts zu danken. Ich kann dich ja nicht zuerst fast niederschlagen und dann tatenlos zusehen, wie du zu Quasimodo mutierst.«
O Gott. Hoffentlich übertrieb er nur. Ich wollte nicht, dass er mich für immer als das Mädchen mit dem zugeschwollenen Gesicht in Erinnerung behielt.
»Solange ich nicht noch plötzlich den dazu passenden Buckel bekomme ... keine Sorge, das ist bis morgen wieder ...«
»Ach, sieh an!« Frau Möllers begeisterter Ausruf übertönte den Rest meines Satzes.
Sie eilte aus ihrem Büro und blieb mit den Händen in den Hüften vor uns stehen. »Ihr habt euch also schon kennengelernt. Wie schön!« Ihr Lächeln bröckelte jedoch, als ihr Blick von Matteo zu mir wanderte. »Ojemine, was ist dir denn passiert, Letitia? Soll ich einen Arzt holen?« Mist. War es wirklich so geschwollen?
»Alles in Ordnung. Sieht schlimmer aus, als es ist«, versuchte ich sie zu beruhigen.
»Ich hoffe nur, das ist dir draußen passiert? Sonst müssen wir dich untersuchen lassen und einen Arbeitsunfallbericht ausfüllen ... das ist immer so viel bürokratischer Aufwand, und ... o Gott, wo habe ich die Vordrucke nur abgelegt?«
Ich tauschte einen schnellen Blick mit Matteo. Er presste die Lippen aufeinander und hob kaum merklich die Schultern. Sehr gut. Wenigstens in diesem Punkt waren wir einer Meinung.
»Nein, keine Sorge, das war ... vor der Schule. Ich wollte Matteo nur etwas rumführen und mir dabei noch ein Kühlpack mitnehmen.«
Frau Möller atmete auf. »Ja, Schätzchen, das solltest du auf jeden Fall. Komm doch schon mal in mein Büro und ruh dich ein paar Minuten aus. Ich wollte sowieso die weitere Planung mit euch beiden durchgehen.« Sie tätschelte mir den Arm und wandte sich dann Matteo zu. »Sei doch so gut, geh zu Jessica ins Stationszimmer dort drüben. Sie kann dir etwas zum Kühlen geben.«
Ohne etwas zu erwidern, machte er sich auf den Weg. Ich folgte Frau Möller ins Büro und ließ mich von ihr über den heutigen Zustand der Kinder informieren. Sie war noch nicht einmal bei den Neuzugängen angekommen, als Matteo schon wieder zu uns stieß.
Er zog die Tür hinter sich zu und setzte sich auf den Stuhl zu meiner Rechten. In der Hand hielt er ein Kühlpack, doch er zögerte, es mir zu geben.
»Irgendwie ist das gar nicht richtig kalt, sorry. Diese Jessica hat nur gelacht, als ich es ihr gesagt habe, also keine Ahnung, vielleicht gehört das so?«
Frau Möller prustete los. Ich biss mir auf die Zunge. Ich wollte ihn wirklich nicht in Verlegenheit bringen. Doch ihr Lachen war so ansteckend, dass ich mich nicht lange zurückhalten konnte.
Irritiert sah Matteo zwischen uns hin und her. »Okay, was ist daran so witzig?«
Statt einer Erklärung nahm ich ihm das Kühlpack aus der Hand. Dann holte ich aus und schlug es mit aller Kraft gegen die Tischkante.
Er zuckte beim Knall des Aufpralls zusammen und sah mich an, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Sofort kroch mir Kälte über die Handfläche. Sie half, mein Lachen wieder unter Kontrolle zu bekommen.
Ich hielt ihm das nun kühle Gelkissen entgegen, und er strich misstrauisch über die Oberfläche.
»Krass.« Er räusperte sich und rieb sich verlegen den Nacken. »Ich kenn nur diese Taschenwärmer. Wusste nicht, dass das mit Kühlkompressen auch funktioniert.«
»Mach dir nichts draus. Da hast du doch gleich an deinem ersten Tag etwas dazugelernt«, sagte Frau Möller und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »So, jetzt aber zum Wesentlichen.«
Ich fing währenddessen an, meine Wange zu kühlen. Das Pulsieren ließ sofort nach und wurde von einem wohltuenden Prickeln auf meiner Haut abgelöst.
»Nachdem ihr dieses Jahr zu zweit seid, habe ich mich entschieden, eine alte Weihnachtstradition wieder aufleben zu lassen.«
Sie zog ein Foto unter ihrer Tastatur hervor und schob es zu uns herüber. Matteo beugte sich nach vorne und betrachtete es genauer. Mir genügte schon ein kurzer Blick. Darauf war ein riesiger, kitschig geschmückter Weihnachtsbaum zu sehen.
»Karten statt Kugeln?«, fragte er und zeigte auf die Äste.
»Ganz genau. Das ist unser Wunschbaum.« Sie strahlte uns an, als hätte sie uns gerade den ewigen Weltfrieden verkündet. »Er hat immer für so viel Glück und Festlichkeit auf der Station gesorgt. Jedes Kind bekommt eine Karte und schreibt oder malt darauf seinen größten Weihnachtswunsch. Dann hängt es die Karte an den Baum.« Mit jedem Wort schien sie in ihrem Stuhl zu wachsen. Ich dagegen hatte schon genug gehört, um zu wissen, dass ich damit nichts anfangen konnte.
»Eure Aufgabe ist es, die Karten zu lesen und ihre Wünsche an Weihnachten wahr werden zu lassen.«
Der missglückte Weihnachtsmannklon neben mir nickte eifrig. Ich hatte nichts anderes erwartet. Damit dürfte er voll in seinem Element sein.
»Seid kreativ. Setzt alles um, was möglich ist. Kauft Spielzeug und Kuscheltiere. Alles, was ihr benötigt, um ihre Wünsche zu erfüllen. Dafür bekommt ihr natürlich auch ein Budget von uns zur Verfügung gestellt.«
Sie rollte mit dem Bürostuhl zur Seite, steckte einen Schlüssel in die Geldkassette neben den Ablagefächern und nahm ein Bündel aus blauen, roten und orangefarbenen Scheinen heraus.
»Es ist nicht viel. Natürlich können wir niemandem eine Konsole oder ein Pony kaufen. Aber das ist auch nicht nötig. Für einen hübschen Baum und ein Geschenk für alle Kinder sollte es reichen. Und mit etwas Einfallsreichtum könnt ihr jeden Wunsch erfüllen.«
Schnell zählte sie die Scheine durch und schob sie dann in meine Richtung. Es war also beschlossene Sache, dass wir gemeinsam daran arbeiten mussten. Ich drückte das Kühlpack fester gegen meine Wange und versuchte, an nichts weiter als die glücklichen Kinder an Weihnachten zu denken. Vielleicht würde die Kälte nicht nur das Pulsieren lindern, sondern auch meine dunkle Gedankenspirale stoppen.
Zögerlich nahm ich das Geld an mich. Kaum zu fassen, dass sie mir so sehr vertraute, mir nicht nur einen Schlüssel, sondern auch noch ein ganzes Geldbündel auszuhändigen.
Also musste ich ihr Vertrauen erwidern. Wenn sie so begeistert von diesem Wunschbaum war, hatte das seine Gründe, und ich sollte mich darauf einlassen. Es würde bestimmt tolle Stimmung auf die Station bringen und Freude in die Kinderherzen zaubern. Und darum ging es schließlich.
Matteo bedankte sich überschwänglich und diskutierte mit Frau Möller direkt über unnötige Details. Meine Gedanken schweiften hingegen zu Mila, und ich beobachtete den Sekundenzeiger an der Uhr hinter dem Schreibtisch.
Obwohl mich gleich wieder Eddie Elch erwarten würde, konnte ich es kaum abwarten, zu ihr zu kommen. Sie würde mir wieder die Leichtigkeit zurückbringen, die die vielen Weihnachtsdiskussionen vertrieben hatten.
Als wir schließlich das Büro verließen, machte ich mich sofort auf den Weg zu Mila.
Doch Matteo heftete sich an meine Fersen. »Bist du Samstagnachmittag hier? Und hast du zufällig einen Schlitten?«
Ich blieb stehen und drehte mich zu ihm um. Nichts ließ darauf schließen, dass er einen Scherz gemacht hatte.
Was zum Teufel meinte er damit? Er wollte sich garantiert keinen Schlitten von mir leihen. Bevor ich nachdenken konnte, plapperte mein Mund allerdings schon fröhlich drauflos.
»Wenn das eine Einladung zu einem Date sein soll, ist die nicht besonders gut. Habe ich auf dich den Eindruck gemacht, als würde ich gerne Schlitten fahren? Außerdem liegt nicht mal Schnee.«
Ich bereute die Worte im selben Moment, in dem ich sie ausgesprochen hatte. Denn Matteos Grinsen konnte nur bedeuten, dass ich seine Frage völlig falsch interpretiert hatte. Aus dem Augenwinkel spähte ich zu Milas Zimmer hinüber. Wie viele Schritte ich wohl brauchen würde, um rüberzusprinten und mich die nächsten Wochen darin einzusperren, damit ich ihm nie wieder in die Augen sehen musste?
»Ich weiß, man sagt über mein Geschlecht, wir wären unaufmerksam ... aber dass du ein Schlittendate hassen würdest, hab selbst ich mitbekommen.«
Ich wünschte, ich hätte das Kühlpack nicht im Büro liegen lassen. Dann hätte ich wenigstens eine Ausrede gehabt, warum ich schon wieder rot anlief. Blieb nur zu hoffen, dass es auf meiner demolierten Wange nicht weiter auffiel.
»Am Wochenende soll es schneien. Ich wollte den Baum drauf transportieren. Mal schnell eine Tanne unter den Arm klemmen und damit durch die Stadt marschieren, stelle ich mir verdammt anstrengend vor.«
»Äh ... ach so«, stammelte ich. Ausgerechnet jetzt fiel mir kein blöder Spruch mehr ein, um die Situation aufzulockern.
Als ich aufsah, lag ein amüsiertes Funkeln in seinen blauen Augen. Wenigstens schien er es mir nicht übelzunehmen.
»Also, hast du einen? Oder willst du mir das nicht verraten?«
»Doch, doch. Wenn wirklich Schnee liegt, bringe ich ihn mit.«
»Super. Und falls du danach doch noch auf ein Date bestehst, können wir das ja gerne dranhängen.«
Da war es wieder. Dieses Zwinkern. Für einige Schläge spürte ich mein Herz in meinem Magen. Ohne meine Antwort abzuwarten, steckte er sich die Kopfhörer zurück in die Ohren und zog sich die Kapuze über den Kopf.
Dann verschwand er in Richtung Materialraum und ließ mich alleine mit meinem Gedankenchaos und dem letzten Hauch seines Lebkuchendufts zurück.
4. Letti
29 Tage bis Weihnachten
Nina hockte vor ihrem Fahrrad und kettete es am Gartenzaun fest. Weder die Länge der Strecke noch die Kälte hatten sie davon abgehalten, einen ihrer geliebten Pünktchenröcke anzuziehen. Schon von Weitem erkannte ich jedoch ihren besorgten Gesichtsausdruck. Und dass sie wirklich nichts mitgebracht hatte.
Ob es richtig gewesen war, sie einzuladen? Wenn sie jetzt schon so schaute, würde sie gleich erst recht die Moralkeule auspacken. Sie meinte es ja nur gut. Aber ein bisschen Unterstützung und aufmunternde Worte wären mir lieber gewesen. Eigentlich war das der Grund gewesen, warum ich sie dabeihaben wollte.
»Das Haus steht ja wirklich noch«, stellte Nina fest, während sie übers Gartentor kletterte.
»Und es wird auch stehen bleiben. Hab ich doch versprochen. Ich bin nicht plötzlich völlig durchgeknallt. Das Einzige, was brennen soll ...« Ich bedeutete ihr, mir zu folgen. Gemeinsam gingen wir an den beiden Apfelbäumen vorbei zur Gartenhütte. »... sind die hier.« Ich bückte mich und ertastete hinter der Rückwand der Hütte das kalte Leder. Dann zog ich meine Schlittschuhe hervor und hob sie triumphierend in die Luft.
Nina sah mich an, als hätte ich gerade verkündet, statt der Gartenhütte das ganze Haus anzünden zu wollen. »Ist das dein Ernst? Ich weiß ja, dass du im Moment mit ihnen auf Kriegsfuß stehst, aber ... das kannst du doch nicht machen. Du wirst es bereuen. Ganz sicher.«
Ich wollte mich von ihren Worten nicht verunsichern lassen. Die Entscheidung hatte mich bereits viele schlaflose Nächte gekostet, und ich war mir immer noch nicht sicher, ob ich die richtige Wahl getroffen hatte. Aber es war nötig, um mit meiner Vergangenheit abzuschließen. Wichtig, um ein Zeichen zu setzen. Nur so würde ich ein neues Leben in Freiheit beginnen können.
Der Anblick des makellosen, glänzenden Weiß dieser Schuhe erinnerte mich jeden Tag daran, wie wenig ich in diese Welt gepasst hatte. Obwohl alle um mich herum mein Leben lang versucht hatten, mich hineinzuquetschen. In meinem Hals stieg eine Welle brodelnder Hitze auf.
»Ganz sicher nicht. Bitte, hilf mir, sie loszuwerden. Ich ertrage es nicht mehr, jeden Tag über sie zu stolpern. Das wird mein persönlicher Schlussstrich. Ich brauche etwas, das mir wirklich bewusst macht, dass es vorbei ist. Nicht etwas, das mich jeden Tag daran erinnert.« Das Atmen wurde mit jedem Satz schwerer.
Nina kam ein paar Schritte näher und hörte einfach nur zu. Ohne Ermahnung oder Vorwürfe.
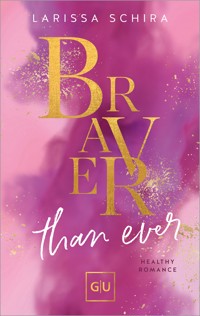
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











