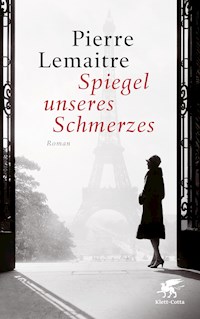11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs regieren Habgier und Neid in den Straßen von Paris, und so bahnt sich ein Komplott an, um das mächtige Bankimperium Péricourt zu Fall zu bringen. Doch Alleinerbin Madeleine weiß, die Verhältnisse in Europa für sich zu nutzen, und dreht den Spieß kurzerhand um. Als der berühmte französische Bankier Marcel Péricourt im Jahr 1927 verstirbt, steht seine Tochter Madeleine, deren Exmann nach einem landesweiten Skandal im Gefängnis sitzt, plötzlich völlig allein an der Spitze eines Bankimperiums – in einer Epoche, in der es Frauen nicht einmal gestattet war, selbst einen Scheck zu unterschreiben. Während Gustave Joubert, der Prokurist der Bank, Charles Pericourt, Madeleines verschwenderischer Onkel, und André Delcourt, ihr Liebhaber mit dichterischen Ambitionen, um die junge Erbin und ihren Sohn schwirren wie Motten um das Licht, zeichnen sich am Horizont bereits die Vorboten des Zweiten Weltkriegs ab. Im Schatten von Börsenskandalen und politischen Wirrnissen arbeiten die Neider auf das Verderben der Familie hin. Doch für Madeleine ist das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen. Um ihres Sohnes willen beginnt sie ihren ganz persönlichen Rachefeldzug zu planen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Pierre Lemaitre
Die Farben des Feuers
Roman
Aus dem Französischen von Tobias Scheffel
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Zitate von Jakob Wassermann (S. 7) und Victor Hugo (S. 479) sind den folgenden Ausgaben entnommen:
Jakob Wassermann, Der Fall Maurizius, München, Wien, 1981, S. 197 (Siebentes Kapitel, 3)
Victor Hugo, Die Elenden, Deutsch von Ludwig von Alvensleben, Berlin (Hasselberg) 1863
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Couleurs de l’incendie« im Verlag Albin Michel, Paris
© 2018 by Pierre Lemaitre
Für die deutsche Ausgabe
© 2019 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung eines Fotos von © Keystone-France/Getty Images
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96338-0
E-Book: ISBN 978-3-608-11554-3
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Für Pascaline
Für Mickaël, mit Zuneigung
1927–1930
Es gab, genau besehen, nicht Gute und Böse, Ehrliche und Schwindler, Lämmer und Wölfe, es gab nur Bestrafte und Unbestrafte, das war der ganze Unterschied.
Jakob Wassermann
1
Wurden die Trauerfeierlichkeiten von Marcel Péricourt auch durcheinandergebracht und endeten sie sogar auf eindeutig chaotische Weise, so begannen sie doch pünktlich. Vom frühen Morgen an war der Boulevard de Courcelles für den Verkehr gesperrt. Das im Hof versammelte Musikkorps der Republikanergarde ließ gedämpfte Klangproben der Instrumente hören, während Automobile vorfuhren und Botschafter, Parlamentarier, Generäle, auswärtige Delegationen heranschafften, die sich würdevoll auf dem Bürgersteig begrüßten. Akademiemitglieder liefen unter dem großen, schwarzen, silberverzierten Baldachin mit dem Monogramm des Verstorbenen hindurch, der die breite Freitreppe überspannte, und folgten den diskreten Weisungen des Zeremonienmeisters, der damit betraut war, in Erwartung der Überführung des Leichnams die Menge zu ordnen. Man sah viele bekannte Gesichter. Ein solch bedeutendes Begräbnis glich einer herzoglichen Hochzeit oder der Präsentation einer Kollektion von Lucien Lelong, es war der Ort, an dem man sich zeigen musste, wenn man einen gewissen Rang einnahm.
Obwohl der Tod ihres Vaters Madeleine schwer erschüttert hatte, war sie überall, tatkräftig und verhalten, gab unauffällig Anweisungen, war auf die kleinsten Einzelheiten bedacht. Und war umso bemühter, als der Staatspräsident hatte wissen lassen, er werde persönlich erscheinen, um sich vor den sterblichen Überresten »seines Freundes Péricourt« in Andacht zu verneigen. Dadurch war alles schwieriger geworden, das republikanische Protokoll war anspruchsvoll wie das einer Monarchie. Das Haus Péricourt, in dem es von Sicherheitsbeamten und Verantwortlichen für das Protokoll wimmelte, hatte keinen Moment Ruhe mehr gehabt. Von der Menge der Minister, Höflinge und Berater nicht zu reden. Der Staatschef war eine Art Fischtrawler, dem beständig Schwärme von Vögeln folgten und sich aus seiner Bewegung nährten.
Zur vorgesehenen Zeit stand Madeleine oben auf der Freitreppe, die schwarzbehandschuhten Hände sittsam vor sich verschränkt.
Der Wagen traf ein, die Menge verstummte, der Präsident stieg aus, grüßte, ging die Stufen hinauf und drückte Madeleine einen Moment an sich, ohne ein Wort, großer Kummer ist stumm. Dann machte er eine elegante und schicksalsergebene Geste, um ihr den Vortritt auf dem Weg zum Aufbahrungsraum zu überlassen.
Die Anwesenheit des Präsidenten war mehr als eine Freundschaftsbekundung gegenüber dem verstorbenen Bankier, sie war auch ein Symbol. In der Tat war die Situation außergewöhnlich. Mit Marcel Péricourt war »ein Wahrzeichen der französischen Wirtschaft entschlafen«, hatten die noch zurückhaltenden Zeitungen getitelt. Bei anderen hieß es: »Er hat den dramatischen Selbstmord seines Sohnes Édouard keine sieben Jahre überlebt.« Wie auch immer. Marcel Péricourt war eine zentrale Figur der Finanzwelt des Landes gewesen, und sein Tod, das spürte jeder auf unbestimmte Weise, symbolisierte einen umso besorgniserregenderen Epochenwechsel als die Dreißigerjahre eher düstere Aussichten eröffneten. Die Wirtschaftskrise, die dem Weltkrieg gefolgt war, hatte nie geendet. Die politische Klasse Frankreichs, die mit der Hand auf dem Herzen geschworen hatte, das besiegte Deutschland würde alles, was es zerstört hatte, bis zum letzten Centime zurückzahlen, war durch die Tatsachen bloßgestellt worden. Die Nation, dazu aufgefordert abzuwarten, dass wieder Wohnungen gebaut würden, dass die Straßen repariert würden, dass die Versehrten entschädigt würden, dass die Pensionen gezahlt würden, dass Arbeitsplätze geschaffen würden, kurz, dass sie wieder zu dem würde, was sie gewesen war – sogar besser, da man den Krieg ja gewonnen hatte –, die Nation also hatte sich damit abgefunden: Dieses Wunder würde nie stattfinden, Frankreich würde allein zurechtkommen müssen.
Marcel Péricourt nun war just ein Vertreter des alten Frankreichs, des Frankreichs, das einst wie ein guter Familienvater die Wirtschaft gelenkt hatte. Man wusste nicht genau, was man nun zu Grabe tragen würde, einen bedeutenden französischen Bankier oder die vergangene Epoche, die er verkörperte.
Im Aufbahrungsraum musterte Madeleine lange das Gesicht ihres Vaters. Seit einigen Monaten war das Altern zu seiner Hauptbeschäftigung geworden. »Ich muss ständig auf mich achten«, pflegte er zu sagen. »Ich habe Sorge, alt zu wirken, die Worte zu vergessen, ich habe Angst zu stören, Angst davor, dabei überrascht zu werden, wie ich Selbstgespräche führe, ich spioniere mir selbst nach, das nimmt all meine Zeit in Anspruch, wie anstrengend ist es, wenn man alt wird …«
Im Schrank hatte sie auf einem Bügel den zuletzt gekauften Anzug gefunden, ein gebügeltes Hemd, die perfekt blank geputzten Schuhe. Alles war bereit.
Am Vorabend seines Todes hatte Monsieur Péricourt das Abendessen mit ihr und Paul eingenommen, seinem Enkel, einem siebenjährigen Jungen mit hübschem Gesicht, blassem Teint, der schüchtern war und stotterte. Im Gegensatz zu den anderen Abenden aber hatte Marcel Péricourt sich nicht bei ihm nach dem Fortschritt im Unterricht erkundigt, danach, wie sein Tag gewesen war, hatte nicht vorgeschlagen, ihre Dame-Partie fortzusetzen. Er war gedankenvoll gewesen, nicht besorgt, nein, eher nachdenklich, das entsprach nicht seiner Gewohnheit; er hatte seinen Teller kaum angerührt, hatte sich damit begnügt, zu lächeln, um zu zeigen, dass er anwesend war. Und da die Mahlzeit ihm zu lang erschienen war, hatte er seine Serviette zusammengefaltet, ich gehe hoch, hatte er gesagt, esst ohne mich zu Ende, er hatte Pauls Kopf einen Augenblick an sich gedrückt, also, schlaft gut. Obwohl er häufig über Schmerzen klagte, war er mit geschmeidigem Schritt zur Treppe gegangen. Gewöhnlich verließ er das Esszimmer mit einem »Seid brav«. An diesem Abend vergaß er es. Am nächsten Tag war er tot.
Während im Hof des Stadtpalais’ der von zwei geharnischten Pferden gezogene Leichenwagen vorfuhr, der Zeremonienmeister Angehörige und Familie versammelte und die Position eines jeden in der protokollarischen Ordnung überwachte, standen Madeleine und der Staatspräsident nebeneinander, den Blick auf den Eichensarg geheftet, auf dem ein breites Silberkreuz glänzte.
Madeleine durchfuhr ein Schauder. Hatte sie einige Monate zuvor die richtige Entscheidung getroffen?
Sie war ledig. Geschieden, um genau zu sein, aber in diesen Zeiten war das dasselbe. Ihr Ex-Mann, Henri d’Aulnay-Pradelle, versauerte nach einem aufsehenerregenden Prozess im Gefängnis. Und ihrem Vater, der an die Zukunft dachte, hatte die Situation einer Frau ohne Ehemann Sorgen bereitet. »In dem Alter heiratet man wieder!«, sagte er. »Eine Bank mit ihren Beteiligungen an vielen Handelsgesellschaften ist keine Frauensache.« Madeleine war einverstanden, aber unter einer Bedingung: ein Gatte, schön und gut, aber keinen Mann, Henri hat mir gereicht, vielen Dank, eine Ehe, schön und gut, aber was das Sie-wissen-schon angeht, sollte man nicht auf mich zählen. Auch wenn sie häufig das Gegenteil behauptet hatte, hatte sie doch einige Hoffnung in diese erste Verbindung gesetzt, die sich als Unglück erwiesen hatte, ihr war jetzt klar, ein Gatte mochte vielleicht noch angehen, aber auch nicht mehr, umso weniger als sie keinerlei Absicht hatte, weitere Kinder in die Welt zu setzen, Paul genügte reichlich zu ihrem Glück. Das war im letzten Winter gewesen, zu der Zeit, als alle merkten, dass Marcel Péricourt es nicht mehr lange machen würde. Es schien klug, Maßnahmen zu ergreifen, weil noch einige Jahre vergehen würden, bevor sein Enkel, Paul der Stotterer, die Leitung des Familienunternehmens übernehmen würde. Abgesehen davon, dass man sich diese Nachfolge schlecht vorstellen konnte, bei dem kleinen Paul kamen die Worte nur mühsam, meistens gab er auf, etwas zu sagen, zu schwer, na, von wegen Führungskraft …
Gustave Joubert, der Prokurist der Péricourt-Bank, ein kinderloser Witwer, hatte da wie die ideale Partie für Madeleine gewirkt. Fünfzig Jahre alt, sparsam, besonnen, gut organisiert, selbstbeherrscht, vorausschauend, man kannte an ihm nur eine Leidenschaft, die für Motoren: für Autos – er verabscheute Benoist, aber vergötterte Charavel – und für Flugzeuge – er hasste Blériot, aber verehrte Daurat.
Monsieur Péricourt hatte energisch für diese Lösung plädiert. Und Madeleine hatte akzeptiert, aber:
»Gustave, damit das klar ist«, hatte sie ihn gewarnt. »Sie sind ein Mann, ich werde nichts dagegen haben, dass Sie … Nun, Sie wissen, was ich sagen will. Aber unter der Bedingung, dass es diskret geschieht, ich weigere mich, ein zweites Mal lächerlich gemacht zu werden.«
Joubert hatte die Forderung umso leichter begriffen als Madeleine von Bedürfnissen sprach, die er selten verspürte.
Aber dann hatte sie einige Wochen später ihrem Vater und Gustave plötzlich verkündet, die Heirat werde doch nicht stattfinden.
Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Gelinde ausgedrückt, hatte Monsieur Péricourt sich gegen seine Tochter ereifert, deren Argumente irrational waren: Sie war sechsunddreißig und Joubert einundfünfzig, als würde sie das jetzt erst bemerken! Und außerdem, war es nicht im Gegenteil eine gute Sache, einen Mann mit einem gewissen Alter und mit Urteilsfähigkeit zu heiraten? Aber nein, Madeleine konnte sich ganz entschieden »nicht mit dieser Eheschließung abfinden«.
Es hieß also nein.
Und sie hatte die Diskussion beendet.
Zu anderen Zeiten hätte Monsieur Péricourt sich mit einer solchen Antwort nicht begnügt, aber er war bereits sehr erschöpft. Er argumentierte, insistierte, dann gab er nach, an dieser Art Verzicht merkte man, dass er nicht mehr der Alte war.
Heute fragte Madeleine sich besorgt, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hatte.
Als der Präsident den Raum mit dem aufgebahrten Toten verließ, wurden draußen alle Aktivitäten unterbrochen.
Im Hof begannen die Gäste, die Minuten zu zählen, man war gekommen, um sich zu zeigen, man wollte aber auch ungern den ganzen Tag dort verbringen. Das Schwierigste war nicht, die Kälte zu vermeiden, das war unmöglich, sondern einen Weg zu finden, nicht zu zeigen, dass man die Sache gern zu Ende gebracht hätte. Nichts wollte helfen, selbst geschützt wurden Ohren, Hände, Nasen eisig, man stampfte unauffällig mit den Füßen, bald würde man beginnen, den Toten zu verfluchen, wenn er weiter auf sich warten ließ. Man harrte ungeduldig aus, dass der Leichenzug sich in Bewegung setzte, dann würde man wenigstens laufen.
Das Gerücht verbreitete sich, der Sarg komme nun endlich herunter.
Im Hof ging der Priester im schwarz-silbernen Rauchmantel den Ministranten, die in violette Soutanen und weiße Chorhemden gehüllt waren, voraus.
Der Zeremonienmeister sah unauffällig auf die Uhr, ging gemessenen Schrittes die Stufen der Freitreppe hinauf, um einen besseren Überblick über die Situation zu haben, und sah sich suchend nach denen um, die in wenigen Minuten den Zug anführen sollten.
Alle waren da, mit Ausnahme des Enkels des Verstorbenen.
Nun war aber vorgesehen, dass der kleine Paul an der Spitze bei seiner Mutter gehen sollte, beide ein paar Schritte vor dem restlichen Zug, ein Bild, das immer gut ankam, ein Kind hinter einem Leichenwagen. Umso mehr, als dieses hier mit seinem Mondgesicht und den leicht verschatteten Augen einen Eindruck von Schwäche vermittelte, der dem Schauspiel eine sehr berührende Note verleihen würde.
Léonce, Madeleines Gesellschafterin, näherte sich André Delcourt, Pauls Hauslehrer, der sich gerade fieberhaft Notizen in einem kleinen Heft machte, und bat ihn, sich nach seinem jungen Schüler zu erkundigen. Er sah sie pikiert an.
»Aber, Léonce …! Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin!«
Die beiden hatten sich nie gemocht. Dienstbotenrivalität.
»André«, antwortete sie. »Sicher sind Sie eines Tages ein großer Journalist, das bezweifle ich nicht, aber einstweilen sind Sie nur Hauslehrer. Also suchen Sie Paul.«
Wütend schlug André mit dem Heft gegen den Oberschenkel, steckte den Stift ein und versuchte, sich mittels vieler Entschuldigungen und unter zerknirschtem Lächeln einen Weg zum Eingang zu bahnen.
Madeleine begleitete den Präsidenten zurück, dessen Wagen dann den Hof durchquerte; die Menge wich bei seiner Durchfahrt zur Seite, als wäre er selbst der Tote.
Unter dem Trommelwirbel der Republikanergarde traf endlich der Sarg von Marcel Péricourt im Vestibül ein. Weit öffneten sich die Türen.
In Abwesenheit ihres Onkels Charles, den man nirgends gefunden hatte, schritt Madeleine, gestützt von Gustave Joubert, hinter den sterblichen Überresten ihres Vaters die Stufen hinab. Léonce suchte den kleinen Paul bei seiner Mutter, aber da war er nicht. André war zurückgekommen und machte eine machtlose Geste, er hatte vergeblich gesucht.
Der Sarg, getragen von einer Abordnung der Ingenieurshochschule, wurde auf dem Leichenwagen abgesetzt. Kränze und Bukette wurden drapiert. Ein Amtsdiener trat vor, er trug das Kissen, auf dem das Großkreuz der Ehrenlegion ruhte.
Mitten im Hof erfasste die Menge der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens plötzlich ein Schwanken. Fast tat sich in ihr ein Graben auf, sie schien kurz davor auseinanderzuweichen.
Sarg und Leichenwagen standen nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Die Blicke hatten sich der Hausfassade zugewandt. Einmütig erstickte ein Schrei.
Madeleine hob ihrerseits den Blick und riss den Mund auf: Dort oben, im zweiten Stock, stand der kleine, siebenjährige Paul mit weit ausgebreiteten Armen auf der Fensterbank. Vor dem Abgrund.
Er trug seinen schwarzen Festtagsanzug, aber mit herausgerissener Krawatte, das weiße Hemd war weit geöffnet.
Alle sahen in die Luft, als beobachtete man den Start eines Luftschiffs.
Paul beugte leicht die Knie.
Bevor noch Zeit war, etwas zu rufen oder zu ihm zu rennen, ließ er die Fensterflügel los und sprang, während Madeleine aufschrie.
Im Sturz bewegte sich der Körper des Kindes hin und her wie ein von einem Schuss getroffener Vogel. Am Ende des raschen und wilden Sprungs prallte er auf den großen schwarzen Baldachin, auf dem er einen kurzen Moment verschwand.
Man unterdrückte ein erleichtertes Aufseufzen.
Aber der gespannte Stoff ließ ihn abprallen, und wie ein Springteufelchen tauchte er wieder auf.
Man sah, wie er erneut in die Lüfte stieg, über den Vorhang flog.
Und auf den Sarg seines Großvaters prallte.
In dem mit einem Male stillen Hof verursachte der dumpfe Aufprall seines Schädels auf dem Eichenholz bei allen Anwesenden einen Schock.
Alle standen da, wie vom Donner gerührt, die Zeit blieb stehen.
Als man zu ihm stürzte, lag Paul auf dem Rücken.
Blut floss ihm aus den Ohren.
2
Der Zeremonienmeister wurde überrascht. Dabei war er, was Beisetzungen betraf, ein Meister seines Fachs, er hatte die Trauerfeierlichkeiten einer unermesslichen Zahl von Akademiemitgliedern und vier auswärtiger Diplomaten durchgeführt, er hatte sogar drei aktive beziehungsweise ehemalige Präsidenten beerdigt. Er war berühmt für seinen Gleichmut, ein Mann, der sein Geschäft beherrschte, aber dieser Junge, der aus dem zweiten Stock auf den Sarg seines Großvaters geprallt war, entzog sich seinen Kategorien. Was sollte er tun? Man sah ihn mit verlorenem Blick, schlaffen Händen, orientierungslos. Man muss zugeben, er war vollständig überfordert. Im Übrigen starb er einige Wochen später, in gewisser Weise war er der François Vatel des Bestattungswesens.
Professor Fournier stürzte als Erster los.
Er kletterte auf den Wagen, schob brutal die Kränze zur Seite, die aufs Pflaster fielen, und machte sich, ohne das Kind zu verschieben, an eine rasche klinische Prüfung.
Das verdiente Anerkennung, denn die Menge hatte zu reagieren begonnen und veranstaltete einen teuflischen Radau. Aus den festlich gekleideten Menschen waren Schaulustige geworden, die angesichts eines Unfalls vor Neugier zappelten, man hörte Ohs, Ahs, haben Sie gesehen? Ja wie, das ist doch der Sohn Péricourt! Nein, unmöglich, der ist in Verdun gefallen! Nein, nicht der, der andere, der Kleine! Wie, durchs Fenster, ist er gesprungen? Ist er ausgerutscht? Also ich glaube, jemand hat ihn geschubst … Nein, aber …! Doch, schauen Sie, es ist noch offen, Ach, stimmt, ja so eine Scheiße, Michel, benimm dich! Jeder berichtete das, was er gerade gesehen hatte, anderen, die dasselbe gesehen hatten.
Zu Füßen des Leichenwagens klammerte Madeleine sich an die hölzerne Rüstleiter, ihre Nägel drückten sich ein wie Krallen, sie brüllte wie eine Besessene. Léonce, ebenfalls in Tränen, versuchte, sie an den Schultern zurückzuhalten, nicht zu glauben, ein Kind, das einfach so aus dem Fenster des zweiten Stocks fällt, ja war das denn die Möglichkeit, aber man brauchte nur den Blick zu den durcheinandergeworfenen Kränzen zu heben, dann konnte man trotz der Menschenmenge Pauls Körper sehen, der wie eine liegende Skulptur auf dem Eichensarg ruhte, über sich Doktor Fournier, der nach dem Herzschlag, nach Anzeichen für Atem suchte. Er erhob sich blutverschmiert, der Smoking bis zur Hemdbrust befleckt, aber sah nichts und niemanden an, das Kind hatte er auf die Arme genommen. Ein glücklicher Fotograf schoss das Bild, das im ganzen Land bekannt werden sollte: Professor Fournier neben dem Sarg von Marcel Péricourt auf dem Leichenwagen, in den Armen ein Kind, dem das Blut aus den Ohren läuft.
Man half ihm hinunter.
Die Menge wich zur Seite.
Er hielt den kleinen Paul an sich gedrückt und rannte zwischen den Reihen hindurch, gefolgt von einer vor Angst panischen Madeleine.
Wo er vorüberkam, verstummten die Kommentare, die plötzliche Andacht war noch trübseliger als das Begräbnis. Ein Wagen wurde beschlagnahmt, der Sizaire-Berwick von Monsieur de Florange, dessen Gattin an der Wagentür stand und die Hände rang, weil sie Sorge hatte, das Blut auf den Sitzen würde nicht mehr rausgehen.
Fournier und Madeleine setzten sich nach hinten, den Körper des Kindes, schlaff wie ein Sack, quer über die Beine gelegt. Madeleine warf Léonce und André einen flehenden Blick zu. Léonce zögerte keine Sekunde, André hingegen konnte sich nicht entschließen. Er drehte sich zum Hof um, sah rasch zum Leichenwagen mit den Kränzen, zum Sarg, zu Pferden, Uniformen und Anzügen … Dann senkte er den Kopf und stieg in den Wagen. Die Türen schlugen zu.
Sie rasten Richtung Hôpital Pitié Salpêtrière.
Alle waren erstarrt. Die Ministranten hatten sich die Schau stehlen lassen, ihr Pfarrer glaubte sichtlich an gar nichts mehr; die Republikanergarde zögerte, die Trauermusik anzustimmen, die auf dem Programm stand.
Und dann war da das Problem mit dem Blut.
Denn so ein Begräbnis mag hübsch sein, aber es ist doch immer nur ein geschlossener Sarg, Blut hingegen ist organisch, macht Angst, erinnert an Schmerz, und der ist schlimmer als der Tod. Und Pauls Blut fand sich auf dem Pflaster bis zum Bürgersteig, Tropfen, deren Spur man folgen konnte wie auf einem Bauernhof. Kaum sah man sie, sah man den kleinen Mann vor sich, mit seinen baumelnden Armen, es lähmte einen bis in die Knochen, und nach so einer Sache gelassen einem Begräbnis beizuwohnen, das nicht das eigene ist …
Im Glauben, das Richtige zu tun, streuten die Hausangestellten Sägemehl aus, es wirkte sofort: Alle Welt begann zu husten und wandte den Blick ab.
Dann wurde den Anwesenden bewusst, dass man schicklicherweise nicht den Sarg eines Mannes zum Friedhof bringen konnte, von dem das Blut eines jungen Kindes troff. Man suchte nach einem schwarzen Tuch, es gab keines. Ein Hausangestellter, der mit einem dampfenden Eimer warmen Wassers auf den Wagen gestiegen war, versuchte, das versilberte Kruzifix mit dem Schwamm zu säubern.
Gustave Joubert, ein Mann der Tat, verfügte daraufhin, man solle den großen blauen Vorhang von Monsieur Péricourts Bibliothek abhängen. Es war ein schwerer, blickdichter Stoff, den Madeleine hatte anbringen lassen, damit ihr Vater sich tagsüber ausruhen konnte, wenn die Sonne auf die Fassade schien.
Von unten sah man an dem Fenster, aus dem das Kind sich einige Minuten zuvor gestürzt hatte, Menschen auf Trittleitern, die die Arme zur Decke streckten.
Schließlich wurde das eilig zusammengerollte Stück Stoff heruntergebracht. Man entfaltete es respektvoll über dem Sarg, aber es blieb ein breiter Vorhang, was den Eindruck vermittelte, man beerdige einen Mann im Schlafrock. Umso mehr, als es nicht gelungen war, drei Messingringe zu lösen, die beim geringsten Windhauch starrsinnig gegen die Sargwand zu klirren begannen …
Man konnte es kaum erwarten, dass die Dinge wieder ihren normalen Gang offizieller, das heißt, anekdotischer Trauerfeierlichkeiten gingen.
Paul, der quer über den Knien seiner schluchzenden Mutter lag, zuckte während der Fahrt mit keiner Wimper. Sein Puls ging sehr langsam. Der Chauffeur hupte beständig, sie wurden durchgeschüttelt wie in einem Viehlaster. Léonce hielt Madeleines Arm an ihren gedrückt. Professor Fournier hatte dem Kind seinen weißen Schal um den Kopf gewickelt, um die Blutung zu stoppen, aber das Blut verbreitete sich unaufhörlich weiter, es begann, auf den Boden zu tropfen.
André Delcourt, der unglücklicherweise Madeleine gegenübersaß, wandte den Blick ab, so weit das in der Situation möglich war, sein Herz war bedrückt.
Madeleine hatte ihn in einer kirchlichen Einrichtung kennengelernt, in der sie Paul unterbringen wollte, sobald er alt genug dafür wäre. Delcourt war ein großer, schmaler junger Mann mit gewelltem Haar, ein bisschen ein Klischee der Zeit, mit recht freudlosen braunen Augen, aber einem fleischigen, redegewandten Mund. Er war Repetitor für Französisch, es hieß, er spreche Latein wie ein Engel und helfe, wenn erforderlich, sogar im Zeichnen aus. Was die italienische Renaissance betraf, seine große Leidenschaft, war er unerschöpflich. Da er Dichter sein wollte, gewöhnte er sich einen fiebrigen Blick an, setzte eine erleuchtete Miene auf, drehte immer wieder plötzlich das Gesicht zur Seite, was seiner Vorstellung nach ein Zeichen dafür war, dass ihn ein funkelnder Gedanke durchfahren hatte. Nie trennte er sich von seinem Notizheft, alle naselang zog er es heraus, notierte hektisch etwas, wobei er sich abwandte, und kehrte mit dem Ausdruck desjenigen zum Gespräch zurück, der gerade eine schmerzhafte Krankheit überwunden hat.
Madeleine mochte sofort seine eingefallenen Wangen, die langgliedrigen Hände und das unbestimmt Feurige, das intensive Momente voraussehen ließ. Sie, die keinen Mann mehr wollte, fand an diesem einen unerwarteten Reiz. Sie wagte einen Versuch, und André machte seine Sache gut.
Er machte sie sogar verdammt gut.
In seinen Armen fand Madeleine Erinnerungen wieder, die alles andere als unangenehm waren. Sie fühlte sich begehrt, er war sehr lieb, auch wenn er viel Zeit brauchte, zum Punkt zu kommen, weil er immer noch einen Eindruck teilen, Vorstellungen ausdrücken, Ideen kommentieren musste, er war ein Schwätzer, der noch in Unterhose Verse rezitierte, der sich im Bett aber gut zu benehmen wusste, wenn er schwieg. Die Leser, die Madeleine kennen, wissen, dass sie nie sehr hübsch gewesen war. Nicht hässlich, eher banal, von der Art, die man nicht bemerkt. Sie hatte einen sehr schönen Mann geheiratet, der sie nie geliebt hatte; daher entdeckte sie mit André das Glück, begehrt zu werden. Und eine Dimension der Sexualität, die ihr für sich selbst nie in den Sinn gekommen war: Als die Ältere glaubte sie sich verpflichtet, die ersten Schritte zu tun, zu zeigen, durch Tun zu erklären, kurz, einzuführen. Das war selbstverständlich unnötig, André war zwar ein poéte maudit, hatte aber nicht eben wenige Freudenhäuser besucht und an einigen Orgien teilgenommen, im Laufe derer er eine große geistige Aufgeschlossenheit und unbestreitbare Adaptationsfähigkeit bewiesen hatte. Aber er war auch ein Realist. Als er begriffen hatte, dass Madeleine, auch wenn sie nur bedingt die Kompetenz dafür besaß, verrückt nach dieser Initiatorinnenrolle war, hatte er sich mit einer umso aufrichtigeren Lust in dieser Situation gefallen, als sie eine gewisse Neigung zur Passivität bei ihm unterstützte.
Ihre Beziehung wurde durch den Umstand ungemein kompliziert, dass André in seiner Einrichtung wohnte und Besuch dort verboten war. Zunächst nahmen sie ein Hotelzimmer in Anspruch, auf dem Weg dorthin drückte Madeleine sich an den Häusern entlang, sie verließ es mit gesenktem Kopf wie eine Diebin im Vaudeville. Sie gab André Geld, damit er den Hotelier bezahlte, und wandte alle möglichen Tricks an, es ihm zu geben, ohne den Eindruck zu bekommen, ihn zu kaufen, sich einen Mann zu gönnen. Sie ließ Geldscheine auf dem Kamin liegen, aber das wirkte wie im Bordell. Sie steckte sie ihm in die Weste, aber an der Rezeption fand er die Scheine erst, nachdem er alle Taschen durchwühlt hatte, tolle Diskretion. Kurz, man musste eine andere Lösung finden, was umso dringlicher war, als Madeleine sich nicht darauf beschränkt hatte, sich einen Geliebten zu nehmen, nein, sie hatte sich verliebt. André war so ungefähr alles, was ihr vorheriger Gatte nicht gewesen war. Gebildet, aufmerksam, passiv, aber kraftvoll, verfügbar, niemals vulgär – letzten Endes hatte André Delcourt nur einen einzigen Nachteil, er war arm. Nicht, dass das für Madeleine etwas bedeutet hätte, sie war reich für zwei, aber sie hatte sich eines Standes würdig zu erweisen, hatte einen Vater, der es nicht gern gesehen hätte, einen Schwiegersohn zu haben, der zehn Jahre jünger als seine Tochter und grundlegend unfähig war, in die Geschäftswelt einzutreten. Da nicht daran zu denken war, André zu heiraten, fand sie eine zweckmäßige Lösung: Sie machte André zum Hauslehrer von Paul. Das Kind würde in den Genuss maßgeschneiderten Unterrichts kommen, in einer privilegierten Beziehung zu seinem Lehrer, und vor allem würde es keine Einrichtung besuchen müssen, die Gerüchte, die darüber umgingen, was dort geschah – selbst in den besten Anstalten – jagten ihr schreckliche Angst ein, die lehrende Geistlichkeit hatte auf diesem Gebiet bereits einen handfesten Ruf.
Kurz, Madeleine fand nur Vorteile an ihrer List.
André war also oben ins Stadtpalais der Familie Péricourt gezogen.
Der kleine Paul nahm die Idee mit Freude auf, weil er sich vorgestellt hatte, er werde einen Spielkameraden haben. Er musste zurückstecken. Zwar ging einige Wochen lang alles gut, aber Paul zeigte sich immer weniger begeistert. Latein, Französisch, Geschichte, Geographie, das mag doch niemand, sagte sich Madeleine, alle Kinder sind gleich, umso mehr als André seine Aufgabe sehr ernst nahm. Pauls abnehmendes Interesse für seinen Privatunterricht tat Madeleines Begeisterung keinen Abbruch, die einigen Nutzen aus ihm zog: Sie brauchte nur unauffällig zwei Stockwerke hinaufzugehen. Oder André hinab. So wurde die Beziehung zum offenen Geheimnis im Hause Péricourt. Die Angestellten vergnügten sich damit, ihre verstohlen die Dienstbotentreppe hinaufsteigende Hausherrin nachzuahmen, und verzogen dazu genießerisch das Gesicht. Spielten sie André, der in entgegengesetzter Richtung zurückging, so taten sie es taumelnd und erschöpft, ja, in der Küche wurde nicht wenig gelacht.
Für André, der sich ein Leben als homme de lettres erträumte, der sich vorstellte, wie er zum Journalisten wurde, ein erstes Buch veröffentlichte, ein zweites, einen großen Literaturpreis bekam, warum nicht, war der Umstand, der Geliebte von Madeleine Péricourt zu sein, ein unbestreitbarer Trumpf, aber gleichzeitig war das Zimmer da oben, direkt unter den Dienstboten, eine unerträgliche Demütigung. Er sah ja, wie die Zimmermädchen lachten, wie der Chauffeur gönnerhaft lächelte. In gewisser Weise war er einer von ihnen. Sein Dienst war ein sexueller, aber es war ein Dienst. Was bei einem Gesellschaftstänzer den Wert gesteigert hätte, war für einen Dichter demütigend.
Diese entwürdigende Stellung musste daher dringend überwunden werden.
Deshalb war er an jenem Tag so unglücklich: Die Trauerfeierlichkeiten von Monsieur Péricourt hatten für ihn eine große Gelegenheit sein sollen, weil Madeleine Jules Guilloteaux hatte anrufen lassen, den Direktor des Soir de Paris, um zu verlangen, dass André den Bericht über die Beisetzung ihres Vaters schriebe.
Stellen Sie sich vor: ein langer Artikel, der auf der Titelseite beginnen würde! In der meistverkauften Tageszeitung von Paris!
André durchlebte das Begräbnis seit drei Tagen, mehrmals war er die Strecke des Leichenwagens zu Fuß abgelaufen. Er hatte sogar schon ganze Textpassagen im Voraus geschrieben: »Die unzähligen Trauerkränze machen den Leichenwagen schwer und verleihen ihm etwas Majestätisches, das an den ruhigen, machtvollen Gang erinnert, den man an jenem Riesen der französischen Wirtschaft kannte. Es ist elf Uhr. Der Trauerzug wird sich in Bewegung setzen. Auf dem ersten Fahrzeug, das unter dem Gewicht der Huldigungen schwankt, erkennt man deutlich …«
Was für ein unverhofftes Glück! Sollte der Artikel erfolgreich sein, würde er vielleicht von der Zeitung eingestellt … Ach, anständig seinen Lebensunterhalt verdienen, sich von den verletzenden Verpflichtungen befreien, zu denen er gezwungen war … Besser: Erfolg haben, reich und berühmt werden.
Und jetzt hatte dieses Unglück alles ruiniert, und er stand wieder am Anfang.
Hartnäckig sah André aus dem Fenster, um den Blick nicht auf Pauls geschlossene Augen zu heften, auf Madeleines tränenaufgelöstes Gesicht oder das verschlossene, gespannte von Léonce. Und auf die sich vergrößernde Lache am Boden. Er empfand für das tote Kind (oder fast tote, der Körper lag wie hingegossen, die Atmung war unter dem blutdurchtränkten Schal kaum erkennbar) einen Schmerz, der ihm das Herz zermalmte, aber da er auch an sich dachte, an all das, was sich gerade verflüchtigt hatte, seine Hoffnungen, seine Erwartungen, diese verpasste Gelegenheit, begann er zu weinen.
Madeleine nahm seine Hand.
Vor Ort, bei den Trauerfeierlichkeiten seines Bruders, erwies Charles Péricourt sich nun als das letzte noch anwesende Mitglied der Familie. Endlich hatte man ihn unweit der Freitreppe ausfindig gemacht, wo ihn »sein Harem« umgab, wie er Frau und Töchter nannte, er war keiner von der subtilen Sorte. Er lebte in dem Glauben, seine Frau, Hortense, möge Männer nicht ausreichend, um Jungen zur Welt zu bringen. Er hatte zwei hochaufgeschossene Töchter mit mageren X-Beinen und blühender Akne, die ständig glucksten, weshalb sie gezwungen waren, sich die Hand vor ihre entsetzlichen Zähne zu halten, die ihre Eltern zur Verzweiflung brachten; man hätte meinen können, ein entmutigter Gott habe jeder der beiden nach ihrer Geburt wild eine Handvoll Zähne in den Mund geworfen, die Zahnärzte waren erschüttert; wenn man nicht alles herausriss und ihnen bereits am Ende der Wachstumsphase die dritten Zähne einsetzte, wären sie dazu bestimmt, ihr ganzes Leben hinter einem Fächer zu leben. Man würde nicht eben wenig Geld für die Zahnklinik ausgeben müssen oder für die Mitgift, die an deren Stelle treten würde. Diese Aussicht trieb Charles um wie ein Fluch.
Charles hatte einen schweren Bauch, weil er die Hälfte der Zeit bei Tisch verbrachte, seit jeher weißes Haar, das er nach hinten kämmte, gedrungene Züge und eine kräftige Nase (das Zeichen entschlossener Charaktere, wie er unterstrich) sowie einen Schnauzbart. Es sei hinzugefügt, dass er seit zwei Tagen den Tod seines älteren Bruders beweinte, sein Teint war gerötet, die Augen verquollen.
Kaum hatten seine Gattin und seine Töchter ihn entdeckt, als er von der Toilette kam, waren sie zu ihm gestürzt, in der Aufregung gelang es aber keiner, ihm die Situation klar zu beschreiben.
»Wie, was?«, fragte er und drehte sich nach hier, nach da, »wie, gesprungen, wer ist gesprungen?«
Gustave Joubert schob alle mit ruhiger und entschiedener Hand zur Seite, kommen Sie Charles, er drückte ihn an sich, und während sie Richtung Hof gingen, gab er ihm zu verstehen, er repräsentiere jetzt die Familie, was ihm eine gewisse Verantwortung verlieh.
Charles sah sich verstört um, verzweifelt versuchte er, die Situation zu erfassen, die nichts mit der zu tun hatte, die er verlassen hatte. Die Aufregung der Menge entsprach nicht der bei einem Begräbnis, seine Töchter kreischten, die Finger vor dem Mund zum Fächer gespreizt, seine Frau schluchzte laut. Joubert hielt ihn am Arm, in Abwesenheit von Madeleine werden Sie den Zug anführen müssen, Charles …
Und Charles war umso hilfloser, als er sich mit einem schmerzhaften Fall von Gewissenskonflikt konfrontiert sah. Der Tod seines Bruders verursachte ihm unermesslichen Kummer, aber er war auch wie gerufen gekommen, um ihm aus großen persönlichen Schwierigkeiten herauszuhelfen.
Charles war, wir haben es begriffen, nicht von überragender Intelligenz, aber er war gewieft und konnte unter gewissen Umständen aus seinen Vorräten eine unerwartete Schläue schöpfen, die seinem Bruder Marcel die Zeit verschaffte, ihn aus der Affäre zu ziehen.
Er tupfte sich die Augen mit dem Taschentuch ab und stellte sich auf die Zehenspitzen, und während gerade der blaue Vorhang über den Wagen gespannt wurde, man die Kränze wieder darauf verteilte, während die Ministranten wieder ihren Platz einnahmen und die Musik einen langsamen Marsch anstimmte, um den peinlichen Augenblick zu überspielen, entzog er sich dem Griff Jouberts und lief zu einem Mann, den er überraschend unter dem Arm packte, weshalb es kam, dass in Missachtung jeglichen Protokolls Adrien Flocard, stellvertretender Berater des Ministers für öffentliches Bauwesen, sich zwischen dem Bruder des Verstorbenen, dessen Frau Hortense und den Töchtern Jacinthe und Rose am Kopf des Zuges wiederfand.
Charles war dreizehn Jahre nach Marcel zur Welt gekommen, das sagt alles. Alles war er etwas weniger als sein Bruder. Weniger alt, weniger brillant, weniger fleißig und demnach weniger begütert; 1906 war er dank des Geldes des Älteren Abgeordneter geworden. »Was das kostet, sich wählen zu lassen«, kommentierte er mit erstaunlicher Naivität. »Verrückt, was man an Wähler, Zeitungen, Kollegen, Konkurrenten verteilen muss …«
»Wenn du dich in diese Schlacht stürzt«, hatte Marcel gewarnt, »kommt es nicht in Frage, dass du scheiterst. Ich will nicht, dass ein Péricourt von irgendeinem obskuren radikal-sozialistischen Kandidaten geschlagen wird!«
Die Wahl war erfolgreich gewesen. War man einmal gewählt, profitierte man von zahlreichen Vorteilen, die Republik war gutmütig, nicht nachtragend, ja gegenüber Gerissenen seiner Art sogar großzügig.
Viele Abgeordnete dachten an ihren Wahlkreis, Charles hingegen dachte an nichts als an seine Wiederwahl. Dank der Begabung eines großzügig entlohnten Genealogen hatte er sehr alte und sehr weitläufige Wurzeln im Département Seine-et-Oise ausgegraben, er hatte sie als jahrhundertealt dargestellt und nannte sich allen Ernstes ein Kind der Scholle. Er hatte schlicht keinerlei politische Fähigkeit, seine Mission bestand ausschließlich darin, den Wählern gefällig zu sein. Mehr aus Intuition denn aus Überlegung hatte er sich einem äußerst populären Gebiet zugewandt, das geeignet war, weit über das eigene Lager hinaus zu vereinen, Reiche wie Arme zufrieden zu stellen, Konservative wie Liberale: dem Kampf gegen die Steuer. Ein fruchtbares Feld. Bereits 1906 hatte er schonungslos den von Joseph Caillot eingebrachten Gesetzentwurf einer Einkommensteuer angegriffen und betont, das erschrecke »alle, die besitzen, alle, die sparen, alle, die arbeiten«. Fleißig zog er jede Woche durch seinen Wahlkreis, schüttelte Hände, wetterte gegen »die unerträgliche Steuerinquisition«, saß Preisverleihungen, Landwirtschaftsausstellungen, Sportwettkämpfen vor und zeigte sich pünktlich bei religiösen Feiern. Er führte Karteikarten in verschiedenen Farben, auf denen er gewissenhaft alles vermerkte, was eine Bedeutung für seine Wiederwahl haben könnte: örtliche Persönlichkeiten, Ambitionen, sexuelle Angewohnheiten der einen wie der anderen, Einkünfte, Schulden und Laster seiner Gegner, Anekdoten, Gerüchte und auf allgemeinerer Ebene alles, was im geeigneten Moment nützlich sein könnte. Er stellte schriftliche Anfragen an Minister, um sich für seine Mitbürger einzusetzen, und schaffte es zweimal im Jahr, für ein paar Minuten ans Rednerpult der Nationalversammlung zu treten, um dort ein für seinen Wahlkreis interessantes Problem anzuschneiden. Diese gewissenhaft im Gesetzblatt erwähnten Stellungnahmen erlaubten es ihm, sich erhobenen Hauptes vor seinen Wählern zur Wiederwahl zu stellen und zu beweisen, dass er sein Möglichstes für sie getan und niemand es besser getan hätte.
Die ganze schöne Tatkraft wäre nichts gewesen ohne Geld. Es war nötig für die Wahlplakate, für Versammlungen, aber während der gesamten Legislaturperiode auch, um Mitarbeiter und Zuträger zu entschädigen, die seine Kartei versorgten, hauptsächlich Pfarrer, Gemeindesekretäre und einige Caféwirte, und um allen zu zeigen, dass es unvergleichliche Vorteile mit sich brachte, den Bruder eines Bankiers zu wählen, da er Sportvereine unterstützen, Bücher für Schulpreisverleihungen stiften, Gewinne bei Tombolas spenden, den Veteranen Fahnen und jedem oder jedenfalls fast jedem Medaillen und Auszeichnungen aller Art schenken konnte.
Der selige Marcel Péricourt hatte ihm 1906, 1910 und dann 1914 unter die Arme gegriffen. 1919 hatte er eine Ausnahme machen können, weil Charles, der in einer Verwaltungseinheit bei Chalon-sur-Saône mobilisiert worden war, mühelos von der gewaltigen, sogenannten »blaugrauen« Welle getragen wurde, die unzählige ehemalige Frontkämpfer ins Abgeordnetenhaus befördert hatte.
Beim letzten Mal, 1924, hatte Marcel sehr viel mehr für seinen Bruder ausgeben müssen als zuvor, um dessen Wiederwahl zu garantieren, weil das Linkskartell einen guten Lauf hatte und ein Abgeordneter der Rechten mit einer sehr schmalen Bilanz deutlich schwerer durchzubringen war als beim vorherigen Mal.
So hatte Marcel Charles und dessen Karriere immer unterstützt. Und selbst tot würde er ihn, wenn die Dinge abliefen wie Charles erhoffte, noch aus einer recht katastrophalen Situation befreien.
Just darüber wollte Charles sich unverzüglich mit Adrien Flocard unterhalten.
Der Zug begann sich in Bewegung zu setzen. Charles schnäuzte sich geräuschvoll.
»Die Architekten sind so was von gierig …«, begann er.
Der stellvertretende Berater (Staatsbeamter bis ins Mark, gesäugt mit dem Code civil, noch auf dem Totenbett würde er das Roustan-Gesetz über die Versetzung von Beamten im Falle einer Eheschließung mit Beamten, die nicht am selben Ort arbeiten, aufsagen), der stellvertretende Berater also runzelte die Stirn. Der Leichenwagen bewegte sich mit majestätischer Langsamkeit voran. Alle standen noch unter dem durch Pauls Fenstersturz bewirkten Schock, einem Schock, den Charles nicht empfand, weil er nichts gesehen hatte, aber auch weil in diesem Moment der eigene Ärger größere Bedeutung hatte als der Tod seines Bruders und der mögliche Tod seines jungen Neffen.
Da Flocard nicht reagierte wie erwartet, fügte Charles, der zugleich durch das, was er dachte, und durch die mangelnde Reaktion des Ministerialbeamten einigermaßen erregt war, hinzu:
»Also wirklich, die nutzen die Situation aus, finden Sie nicht?«
Mit seinem Ärger beschäftigt, hatte er sich vom Sarg abhängen lassen und musste seinen Schritt beschleunigen, um zu seinem Gesprächspartner aufzuschließen. Er begann bereits zu schnaufen, er war es nicht gewohnt zu laufen. Er wiegte den Kopf hin und her … Wenn das so weitergeht, dachte er, wird es bei Einbruch der Nacht nicht einen lebenden Péricourt mehr in Paris geben!
Empörung war die Grundlage seines Temperaments: Seiner Ansicht nach war das Leben ihm gegenüber nie fair gewesen, die Art, wie die Welt sich drehte, sagte ihm nie zu. Die Geschichte, die er mit dem PGW erlebte, war nur ein zusätzlicher Beweis.
Um auf die gewaltige Wohnungskrise in der Hauptstadt zu reagieren, hatte das Seine-Département ein großes Programm für sogenannten »preisgünstigen Wohnungsbau« aufgelegt. Eine Goldgrube für Architekten, Bauunternehmer, Baustoffhändler. Und für die Politiker, die gebieterisch über Genehmigungen, Enteignungen, Vorkaufsrechte herrschten … Geheime Provisionen und Schmiergelder flossen wie Wein im Paradies, und im Zuge dieser verborgenen, aber üppigen Orgie hatte Charles es nicht zu vermeiden gewusst, ein paar Flecken auf seine weiße Weste abzubekommen. Als Mitglied des Départements-Zuteilungsausschusses hatte er darauf hingewirkt, dass die Firma Bousquet & Frères die erstklassige Baustelle in der Rue des Colonies erhielt, ein Gelände von zwei Hektar, auf dem man eine hübsche Reihe von Wohngebäuden für einfache Haushalte errichten könnte. Bis dahin hatte Charles seine Provision erhalten wie jeder andere, so weit, so gewöhnlich. Aber er nutzte die Goldgrube, um bei Sables et Ciments de Paris einzusteigen, einem bedeutenden Baustofffabrikanten, den er daraufhin dem Bauunternehmer als Lieferanten aufgezwungen hatte. Von da an war Schluss gewesen mit knauserigen Umschlägen und nur symbolischen Schmiergeldern! Mit prozentualen Beteiligungen auf Holz, Eisen, Beton, Gebälk, Teer, Putz, Mörtel erlebte Charles, wie aufsehenerregende Summen auf ihn niederprasselten. Seine Töchter verdreifachten Garderobe und Zahnarzttermine, Hortense erneuerte das gesamte Mobiliar bis hin zu den Teppichen und kaufte einen völlig überteuerten Hund, der einen Hundewettbewerb gewonnen hatte, einen abscheulichen Kläffer, der permanent schrill bellte und den man tot auf dem Bettvorleger fand, sicherlich Herzstillstand, die Köchin schmiss ihn mit den Gemüseabfällen und Fischgräten in den Müll. Charles wiederum schenkte seiner aktuellen Geliebten, einer Boulevardschauspielerin, die sich auf Parlamentarier spezialisiert hatte, einen Edelstein, dick wie eine Weinbeere.
Endlich bewegte sich Charles’ Leben auf der Höhe, die er erwartet hatte.
Aber nach dieser fast zweijährigen finanziellen Zwischenaufheiterung begann das Leben erneut, ihn schlecht zu behandeln. Ja, sogar sehr schlecht.
»Also wirklich …«, murmelte Adrien Flocard. »Dieser Arbeiter war schon ziemlich …«
Charles schloss schmerzvoll die Augen. Ja, denn da Sables et Ciments de Paris überall Provisionen zahlte, war die Firma gezwungen, weniger teure Materialien zu liefern, um weiter Gewinne zu machen, weniger trockenes Holz, weniger dichten Mörtel, Beton mit weniger stabilen Armierungen. Beinahe wäre ein komplettes erstes Stockwerk zum Erdgeschoss geworden, ein Maurer war durch die Zwischendecke gefallen, eilig hatte man alles abgestützt. Und die Bauarbeiten waren unterbrochen worden.
»Ein kaputtes Bein, ein paar Brüche!«, verteidigte sich Charles. »Das ist doch keine nationale Katastrophe.«
Tatsächlich lag der Arbeiter seit acht Wochen im Krankenhaus, es war immer noch nicht gelungen, ihn auf die Beine zu bringen. Glücklicherweise hatte man es mit einer Familie zu tun, die ebenso bescheiden war wie ihre Forderungen, mit einem Bündel Geldscheinen hatte man ihr Schweigen erwirkt, kein Grund zur Panik. Für die mäßige Summe von dreißigtausend Francs in bar hatten die Beamten der PGW-Gesellschaft auf Fahrlässigkeit des im Krankenhaus liegenden Arbeiters geschlossen und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten gestattet, aber sie waren nicht schnell genug gewesen, um zu verhindern, dass die Wellen sich bis zum Ministerium für öffentliches Bauwesen verbreiteten, wo der zuständige Abteilungsleiter trotz der zwanzigtausend Francs, die er erhalten hatte, nicht die Ernennung zweier Architekten hatte blockieren können, von denen jeder fünfundzwanzigtausend Francs verlangte, um den Unfall wirklich zu einem Unfall zu erklären.
»Glauben Sie, man könnte auf Seiten der Stadt oder des Ministeriums etwas … Ich meine …«
Adrien Flocard verstand sehr gut, was Charles sagen wollte.
»Also das …«, antwortete er ausweichend.
Einstweilen blieb die Geschichte auf ein paar Beamte beschränkt, die guten Willens waren, aber die ungefähr fünfzigtausend Francs, über die Charles verfügte, waren dahingeschmolzen und die unbestimmte Antwort von Flocard bedeutete, dass vor Abschluss der Affäre weitere Mittelspersonen ihr Pflichtbewusstsein und ihre republikanische Integrität auf horrende Summen taxieren würden. Um den Skandal zu ersticken, würde man mindestens fünfmal so viele Umschläge wie normal verteilen müssen. Guter Gott, und alles war so gut gelaufen!
»Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Nichts anderes. Eine Woche oder zwei, nicht mehr.«
Alle Hoffnungen von Charles konzentrierten sich darauf: In ein paar Tagen würde der Notar das Erbe abwickeln, Charles seinen Anteil übereignen.
»Eine Woche oder zwei kann man immer rausschlagen …«, wagte Flocard.
»Bravo!«
Mit dem, was ihm von seinem Bruder zufallen würde, würde er bezahlen, was man von ihm forderte, und das wär’s.
Die Geschäfte würden wieder in Gang kommen wie zuvor, er würde diese abscheuliche Erinnerung weit hinter sich lassen.
Ein oder zwei Wochen.
Charles kamen erneut die Tränen. Ganz entschieden hatte er den besten Bruder gehabt, den man sich vorstellen kann.
3
Bei der Ankunft im Hof des Krankenhauses lief Madeleine hinter dem Arzt und drückte dabei die tote Hand ihres kleinen Jungen. Man wandte unendliche Vorsicht auf, als man das Kind auf einen Rollwagen legte.
Ohne weiteres Warten ließ Professor Fournier ihn in einen Untersuchungsraum bringen, den seine Mutter nicht betreten durfte. Das Letzte, was sie sah, war Pauls Kopf und die widerspenstigen Strähnen, über die sie sich immer beklagte, unmöglich, sie zu bändigen.
Sie ging zu Léonce und André, die beide stumm dastanden.
Die Bestürzung überlagerte alles.
»Also …«, fragte sie, »wie konnte das passieren?«
Léonce wurde von der Frage verunsichert. Man brauchte sich nur an das Ereignis zu erinnern, um zu verstehen, »wie das passiert« war, aber sichtlich war Madeleine noch nicht so weit. Sie sah André eindringlich an. Kam nicht ihm die Aufgabe zu, Madeleine die Dinge zu erklären? Aber auch wenn der junge Mann physisch anwesend war, war er mit den Gedanken doch woanders, er entzog sich, infolge der Krankenhausatmosphäre war ihm wohl unbehaglich.
»War sonst noch jemand auf dem Stockwerk?«, fragte Madeleine nach.
Das war schwer zu sagen. Das Haus Péricourt beschäftigte zahlreiche Bedienstete, zu denen noch die Aushilfen kamen, die für den Tag angestellt worden waren. Hatte jemand Paul gestoßen? Wer konnte das sein? Ein Hausangestellter? Und warum hätte jemand etwas Derartiges tun sollen?
Madeleine hörte nicht, wie die Krankenschwester kam, die sie informierte, dass ihr im zweiten Stock ein Zimmer zur Verfügung stehe. Spartanisch: Ein Bett, eine Kommode, ein Stuhl, man fühlte sich eher in einem Kloster denn in einem Krankenhaus. André blieb stehen, sah weiter durchs Fenster und betrachtete das Hin und Her der Autos und Krankenwagen im Hof. Léonce brachte Madeleine dazu, sich aufs Bett zu legen, wo diese nicht aufhörte zu schluchzen. Léonce selbst nahm auf dem Stuhl Platz und hielt ihr die Hand, bis der Professor kam, bei dessen Eintreten Madeleine zusammenfuhr wie bei einem elektrischen Schlag.
Sie stürzte zu ihm.
Er trug inzwischen einen Arztkittel, aber hatte noch den zerrissenen Kragen um, was ihm das Aussehen eines Landpfarrers verlieh, der sich ins Krankenhaus verirrt hatte. Er setzte sich auf die Bettkante.
»Paul lebt.«
Paradoxerweise spürte jeder, dass das nicht unbedingt eine gute Nachricht war, dass es da noch etwas anderes zu verstehen gab, worauf man sich gefasst machen sollte.
»Er liegt im Koma. Wir denken, dass er in den nächsten Stunden daraus erwachen wird. Ich kann es Ihnen nicht garantieren, aber sehen Sie, Madeleine, danach müssen Sie mit einer … schmerzlichen Situation rechnen.«
Sie nickte, ungeduldig, dass man ihr endlich erklärte, was sie wissen musste.
»Mit einer sehr schmerzlichen«, wiederholte Fournier.
Da schloss Madeleine die Augen und wurde ohnmächtig.
Der Trauerzug machte gehörig Eindruck. Der Leichenwagen bewegte sich mit einer für die Teilnehmer enervierenden Langsamkeit, aber die Schaulustigen auf den Bürgersteigen blieben unweigerlich stehen, wo er vorüberzog. Sobald der Wagen bei ihnen ankam, zuckten sie jedoch zusammen. Der große Vorhang, der im Tageslicht ein für den Anlass etwas unüberlegtes Blau zeigte, die auf dem Sarg aufgeschichteten Kränze, die ebenso gelitten zu haben schienen wie der Verstorbene, und das Klackern der Ringe gegen den Leichenwagen – all das verlieh der Veranstaltung etwas Ungefähres, was Gustave Joubert allen anderen voran bedauerte.
Er lief in der zweiten Reihe, folgte wenige Meter hinter Charles und Hortense Péricourt und ihren schlaksigen Zwillingen, die sich mit den Ellbogen schubsten. Selbst Adrien Flocard, der doch bei dieser Gelegenheit keinerlei Gewicht hatte, war vor ihm platziert worden, weil Charles die Gelegenheit genutzt hatte, um mit ihm über seine Angelegenheiten zu reden, von denen Gustave natürlich alles wusste. Gustave wusste fast alles über fast alle, in dieser Hinsicht war er ein exemplarischer Bankier.
Er war groß und schmal, mit kantigen Zügen, breiten Schultern über einer eingesunkenen Brust, ein Mann aus Haut und Knochen, der vollständig in seiner Aufgabe aufging, die er als heiliges Amt ansah, ganz der Typ, den man sich in der Uniform der Schweizer Garde vorstellt. Er hatte helle aquamarinfarbene Augen, die selten blinzelten und einem großes Unbehagen verursachen konnten, wenn sie sich bohrend auf einen richteten. Man hätte meinen können ein mittelalterlicher Inquisitor. Er drückte sich gut aus, auch wenn er von Natur aus nicht redselig war. Er war ein Mensch von beschränkter Phantasie, aber großer Charakterstärke.
Der Chef hatte ihn eingestellt, als er die Ingenieurshochschule beendet hatte, aus der er selbst hervorgegangen war, immer hatte er dort seine Mitarbeiter gesucht. Gustave Joubert war nur um Haaresbreite nicht der Erste seines Jahrgangs gewesen, er war sehr begabt in Mathematik und Physik. Mit Ausnahme der Kriegsjahre, als er im Generalstab eingesetzt worden war, weil er fließend Englisch, Deutsch und Italienisch sprach, hatte Joubert seine gesamte Laufbahn in der Péricourt-Gruppe verbracht. Gewissenhaft, unendlich fleißig, berechnend und ohne übermäßige Bedenken, perfekt programmiert, um Bankier zu werden, war er zügig und erfolgreich aufgestiegen. Monsieur Péricourts Vertrauen war ihm wieder und wieder ausgesprochen worden, bis er im Jahr 1909 zum Generaldirektor der Gruppe und Prokuristen der Bank ernannt worden war.
Als sein Chef nach dem Tod seines Sohnes 1920 allmählich schwächer wurde, hatte häufig er die Geschäfte geführt. Seit zwei Jahren hatte Monsieur Péricourt sogar die Zügel schießen lassen, und Joubert war in den Genuss fast vollständiger Vollmacht gekommen.
Als Monsieur Péricourt ein Jahr zuvor die Möglichkeit einer Heirat mit seiner einzigen Tochter erwähnt hatte, hatte Gustave Joubert den Kopf gewiegt wie angesichts einer Entscheidung des Verwaltungsrats, in Wirklichkeit aber empfand er hinter der scheinbaren Distanz gewaltige Freude. Mehr noch, Stolz.
Er war, wie man so sagt, aus eigener Kraft bis an die Spitze der Bankhierarchie aufgestiegen, hatte sich in der Geschäftswelt Respekt erworben, nun fehlte ihm nur Eines: Vermögen. Er war zu gewissenhaft, um sich selbst zu bereichern, und hatte sich immer mit einem dank seines Gehalts recht komfortablen Lebensstil begnügt sowie einigen weiteren Vorteilen, die nichts Extravagantes hatten, eine bürgerliche Wohnung und eine Leidenschaft für Motoren, die ihn häufiger den Wagen wechseln ließ als üblich, nichts Übermäßiges.
Viele seiner Jahrgangsfreunde hatten Erfolg als Geschäftsleute, es war persönlicher Erfolg. Sie hatten ein Familienunternehmen übernommen und entwickelt oder ein Gewerbe gegründet, das Erfolg hatte, sie hatten vorteilhaft geheiratet, er hingegen hatte nur im Auftrag Erfolg gehabt. Auf den unerwarteten Vorschlag hin, Madeleine Péricourt zu heiraten, setzte sich etwas bei ihm in Gang, was ihm nie bewusst gewesen war: Er hatte sein Leben dieser Bank gewidmet und erwartete seit Langem eine seinem Engagement und den erwiesenen Diensten angemessene Geste der Dankbarkeit, die jedoch nie erfolgt war. Monsieur Péricourt, der den Moment, sich erkenntlich zu zeigen, immer hinausgezögert hatte, hatte jetzt die Möglichkeit dazu gefunden.
Die Nachricht war noch nicht offiziell, da war bereits ganz Paris vom Gerücht dieser künftigen Ehe erfüllt. Die Aktien der Privatbank stiegen um ein paar Punkte an Wert, ein Zeichen dafür, dass Gustave Joubert vom Markt als verantwortungsbewusste Wahl angesehen wurde. Er hatte gespürt, wie seine Person der köstlich frische Windhauch umwehte, den neidische Gerüchte bewirken.
In den darauffolgenden Wochen begann Gustave, das Stadtpalais der Familie Péricourt mit anderen Augen zu betrachten. Er malte sich aus, wie er in den Bibliothekssesseln sitzen und dabei nun im eigenen Zuhause sein würde, oder in dem großen Esszimmer, in dem er so oft in Gesellschaft seines Chefs zu Abend gegessen hatte. Und nach so vielen Jahren selbstloser Anstrengungen schien ihm das nicht im Geringsten unverdient.
Er hatte hochfliegende Pläne. Wenn er abends zu Bett ging, gestaltete er neu, plante. Und als Erstes: Schluss mit den Diners bei Voisin, dem Restaurant, in dem Monsieur Péricourt Stammgast war, man würde nun »im Hause« empfangen. Er dachte bereits an einige junge Küchenchefs, die er abwerben könnte, dachte darüber nach, einen dieses Wortes würdigen Weinkeller aufzubauen. Seine Tafel würde zu einer der besten von Paris werden. Man würde sich bei ihm drängen, er bräuchte unter den unzähligen Kandidaten für diese Soireen nur diejenigen auszuwählen, die besonders nützlich für seine Geschäfte wären. So würden gastronomische Exklusivität und unaufdringliche Eleganz des Ambientes als Hebel für den Erfolg der Bank dienen, aus der Joubert eine der bedeutendsten des Landes zu machen gedachte. Heute musste man sich anpassen, neuartige Finanzprodukte entwickeln, sich kreativ zeigen, kurz, das Modell der modernen Bank erfinden, das Frankreich brauchte. Er konnte sich nicht vorstellen, wie der kleine Paul eines Tages die Nachfolge seines Großvaters antreten sollte, ein Stotterer als Vorsitzender der Verwaltungsratssitzungen, das wäre katastrophal für die Geschäfte. Gustave würde es machen wie Monsieur Péricourt selbst und zu gegebener Zeit einen Kronprinzen für sich finden, der dem Erfolg, den er für das Familienkonsortium vor Augen hatte, gewachsen wäre.
Wie man sieht, fühlte er sich als der Richtige.
Als Madeleine ohne das geringste Vorzeichen plötzlich angekündigt hatte, diese Heirat werde nicht stattfinden, war Joubert daher brutal zu Boden gestürzt.
Die Vorstellung, sie könne ihren Plan allein deswegen annulieren, weil sie mit diesem kleinen Französisch-Einpauker schlief, war ihm vollständig irrational vorgekommen. Sollte sie sich doch die Liebhaber nehmen, die sie wollte, inwiefern wäre das eine Bedrohung für ihre Ehe? Er war absolut bereit, mit den außerehelichen Verhältnissen seiner Gattin Kompromisse einzugehen – wenn man sich bei solchen Überlegungen aufhalten würde, was würde dann aus der Welt! Aber er hatte nichts gesagt, er fürchtete, wenn er in dieser Weise ihr »Leben als Frau« erwähnte, und sei es in Andeutungen, würde sie das als Mangel an Respekt ansehen, fürchtete, dass er das Risiko eingehen würde, sich in seinem Missgeschick bestätigt zu sehen und der Lächerlichkeit noch die Demütigung hinzuzufügen.
Tatsächlich schwebte der Schatten von Henri d’Aulnay-Pradelle, dem einstigen Ehemann von Madeleine, über der ganzen Geschichte. Er war markant, siegesgewiss, viril, ein Verführer, autoritär, zynisch, skrupellos (ja, ich weiß, das ist viel, aber alle, die ihn kannten, werden Ihnen sagen, dass in diesem Portrait keinerlei Übertreibung liegt) und hatte so viele Geliebte gehabt, wie es Tage im Jahr gibt. Gustave hatte das eines Tages verstanden, als er das Büro seines Chefs verließ, er hatte ein paar Worte eines Gesprächs mit Léonce Picard aufgeschnappt, in dem Madeleine erklärte, wie sehr sie früher gelitten hatte:
»Ich will Gustave nicht dasselbe antun, ihn seinerseits zum Gespött von ganz Paris machen. Man kann jemandem ein Leid antun, den man liebt, aber jemandem, den man nicht liebt … Nein, das ist gemein.«
Nachdem Madeleine die Entscheidung ihrem Vater verkündet hatte, hatte sie sich verpflichtet gefühlt, Joubert etwas zu sagen:
»Gustave, ich versichere Ihnen, sehen Sie darin nichts Persönliches. Sie sind ein Mann, der absolut …«
Das Wort hatte nicht kommen wollen.
»Was ich meine, ist … Beziehen Sie es nicht auf sich.«
Er hatte das Bedürfnis zu antworten: Ich beziehe es nicht auf mich, ich beziehe es gegen mich, aber er hatte sich einer Antwort enthalten. Er hatte Madeleine einfach angesehen, sich dann verbeugt, wie er es sein ganzes Leben getan hatte. Er tat, was jeder Gentleman in solch einer Situation getan hätte, empfand Madeleines Umschwenken aber als Kränkung.
Sein Rang als Prokurist schien ihm plötzlich kümmerlich. Bald spürte er die spöttischen Blicke um sich. Der köstliche frische Windhauch des Gerüchts war ironischem Schweigen und schadenfrohen Anspielungen gewichen.
Monsieur Péricourt übertrug ihm den stellvertretenden Vorsitz über mehrere Gesellschaften, die zur Unternehmensgruppe gehörten. Gustave dankte, betrachtete die Ernennungen aber als eine ungenügende Entschädigung für den Verlust, den er gerade erlitten hatte. Er erinnerte sich einer Jugendlektüre und der Verbitterung von d’Artagnan, dem der Kardinal das Hauptmannspatent versprochen hatte und der doch Leutnant geblieben war.
Drei Tage zuvor, als sein ehemaliger Chef eingesargt worden war, hatte er bei Madeleine gestanden, leicht abseits, wie ein Butler. Es genügte, ihn zu beobachten, um eine ziemlich genaue Vorstellung seiner inneren Empfindungen zu bekommen, und jene Starrheit, jene Anspannung wahrzunehmen, die man in Fällen langsam schwelender Wut antrifft, die bei Kaltblütigen noch schlimmer ist.
Als der Zug den Boulevard Malesherbes erreichte, begann eisiger Regen zu fallen. Gustave öffnete seinen Schirm.
Charles drehte sich um, sah Joubert, streckte den Arm aus, deutete mit entschuldigender Geste auf seine Töchter und packte den Schirm.
Die beiden jungen Mädchen drückten sich daraufhin unter dem Schutz ihres Vaters dicht zusammen. Hortense stampfte durchgefroren mit den Füßen und versuchte, ein paar Zentimeter Schutz zu erhaschen.
Gustave hingegen setzte seinen Gang Richtung Friedhof barhäuptig fort. Der Regen wurde sofort stärker.
Erschüttert, bewusstlos musste Madeleine ihrerseits ins Krankenhaus aufgenommen werden. Wenn man von Charles’ Zweig absah, befand sich jetzt die Hälfte der Familie Péricourt im Krankenhaus, die andere auf dem Friedhof.
Alles in allem war das eine Umwälzung der Situation, die voll und ganz im Gleichklang mit ihrer Epoche stand. Innerhalb weniger Stunden hatte eine reiche und anerkannte Familie gerade den Tod ihres Patriarchen und den verfrühten Sturz ihres einzigen männlichen Nachkommens erfahren, defätistische Gemüter hätten darin den Ausdruck einer Prophezeiung sehen können. Für einen intelligenten und gebildeten Mann wie André Delcourt hätte es Anlass für Mutmaßungen gegeben, nur grübelte der, nachdem er den schrecklichen Schock überwunden hatte, den der Sturz des kleinen Paul in ihm bewirkt hatte, über seine wahnsinnige Enttäuschung nach. Sein Artikel, der ausführlich von den Trauerfeierlichkeiten von Marcel Péricourt berichtete, seine Hoffnung auf Erfolg, alles war ins Wasser gefallen. Anlass, lange über den Zufall, das Schicksal, das Fatum, die Kontingenz zu philosophieren, er, der hochtrabende Worte liebte, hätte sich ganz bei der Sache fühlen müssen, aber er verlor sich immer wieder in deprimierenden Gedanken.
Am Abend wurde das Kind, das nach zehn Stunden Koma wieder erwacht war, schließlich in das Zimmer gebracht, eingeschnürt in eine Art starres Wams, das ihm bis ans Kinn ging.
Jemand musste bei ihm wachen. André meldete sich freiwillig. Léonce kehrte ins Haus Péricourt zurück, um Kleidung zum Wechseln zu holen und sich ein bisschen herzurichten. In dem Zimmer standen jetzt zwei Betten, das, in dem Paul bewusstlos da lag, und wenige Zentimeter entfernt dasjenige, in dem eine von Medikamenten betäubte Madeleine untergebracht worden war, die sich aber unaufhörlich bewegte, sich wälzte, das Opfer von Alpträumen war, die sie im Traum murmeln ließen.
André setzte sich und hing weiter trüben Gedanken nach. Die beiden Körper in ihren Betten verursachten ihm Unbehagen, das Kind in seinem vegetativen Zustand machte ihm Angst. Und auf gewisse Weise war er ihm böse.
Der Leser kann sich mühelos vorstellen, was es für ihn bedeutet hatte, über die Beisetzungsfeierlichkeiten von nationalem Ruhm berichten zu können, und wie schwer es ihn jetzt belastete, dass das nicht möglich war. Wegen Paul. Wegen dieses Kindes, das alles erbte. Dem er, neben vielem, eine gleichsam väterliche Behandlung hatte zuteilwerden lassen.
Sicher, er war ein anspruchsvoller Hauslehrer gewesen, und Paul mochte das Joch bisweilen als ein wenig lastend empfunden haben, aber das ist bei allen Schülern so, er selbst, André, hatte tausendmal Schlimmeres in der kirchlichen Lehranstalt Saint-Eustache kennengelernt, er war daran nicht gestorben. Mit Begeisterung hatte er die Mission übernommen, die darin bestand, ein Kind nicht zu erziehen, sondern es zu bilden. Es lag ihm daran, ihm alles zu vermitteln, was er wusste. Ein Kind, so sagte er häufig, ist wie ein Steinblock, und der Lehrer ist der Bildhauer. André war zu Ergebnissen gelangt, die seine Bemühungen überreich belohnt hatten. Etwa beim Stottern. Es blieb noch einiges zu tun, aber Paul redete unbestritten immer besser. Auch, was seine rechte Hand betraf. Es war noch keine perfekte Hand, aber dank Disziplin und Konzentration erreichte Paul offenkundige und ermutigende Ergebnisse. Der eine lehrte, der andere lernte, das war kein immer leichter Weg, bei weitem nicht, aber André und Paul waren, ja, es rührte ihn, das jetzt zu denken, Freunde geworden.
André machte seinem Schüler Vorwürfe, weil er dessen Tat nicht verstand. Dass der Tod seines Großvaters ein gewaltiger Kummer gewesen war, wusste er, aber warum war er nicht gekommen, um mit ihm zu sprechen? Ich hätte die Worte gefunden, sagte er sich.
Es war zweiundzwanzig Uhr. Allein die in weiten Abständen stehenden Laternen im Hof tauchten den Raum in einen blassen, gelblichen und verschwommenen Schimmer.
André beschäftigte sich immer noch mit seinem Misserfolg, als er sich fragte, ob ihm wirklich nicht einmal der Hauch einer Chance blieb. Konnte er einen Artikel schreiben, obwohl er an den Trauerfeierlichkeiten nicht teilgenommen hatte?
Es war natürlich ein aussichtsloses Unterfangen, aber während er Paul auf seinem Bett betrachtete, stellte er sich Fragen. Wäre es nicht ein Zeichen der Treue und des Vertrauens in die Zukunft, sich trotzdem zu bemühen, diesen Artikel zu verfassen? Wäre Paul, sobald er ins Leben zurückkehrte, nicht stolz, den Namen seines Freundes André Delcourt unten auf einer Seite des Soir de Paris zu entdecken?
Sich die Frage zu stellen, hieß bereits antworten.
Er erhob sich, lief auf Zehenspitzen durchs Zimmer und ging zur Nachtschwester, einer dicken Frau, die in einem Korbsessel schlief und aus dem Schlaf hochfuhr, wie, was, Papier? Ihr Blick fiel auf das hübsche Lächeln Andrés, sie riss ein Dutzend Seiten aus einem Krankenregister, hielt ihm zwei der drei Stifte hin, die sie besaß, und schlief mit einem Jungmanntraum wieder ein.
Als er zurückkam, sah er als Erstes Pauls weit geöffnete, glänzende und starre Augen. Er war davon nachhaltig beeindruckt. Er zögerte. Sollte er sich ihm nähern? Etwas sagen? Er wusste nicht, wie er sich verhalten sollte, und begriff, dass er unfähig wäre, einen Schritt zu tun. Er setzte sich wieder.
Er legte die Blätter auf einen Oberschenkel, nahm sein Heft, in dem er bereits so viel notiert hatte, und begann. Es war eine schwierige Übung, er hatte nur den Anfang gesehen, was war geschehen, nachdem er gefahren war? Die Journalisten, die über das Ereignis berichteten, würden präzise und sensationelle Einzelheiten über den weiteren Ablauf der Zeremonie liefern, um die er gebracht war. Er entschied sich also für einen ganz anderen Ansatz: das Lyrische. Er schrieb für den Soir de Paris und wandte sich an eine einfache Leserschaft, die von einem entschieden literarischen Artikel geschmeichelt wäre.
Seine verknitterten, durchgestrichenen, gefalteten Blätter waren bald nicht mehr lesbar, daher kehrte er gegen drei Uhr morgens, aufgeregt wie nie zuvor, zum Schwesternzimmer zurück, um erneut ein paar Blätter zu erbitten, die die Krankenschwester ihm diesmal, verärgert darüber, geweckt worden zu sein, quasi an den Kopf warf. Er achtete nicht darauf, er hatte etwas, um wacklig auf einem Oberschenkel seinen Artikel ins Reine zu schreiben.
Da bemerkte er den immer noch starren, glänzenden Blick des kleinen Paul, der auf ihn gerichtet war. Er drehte sich auf seinem Stuhl, sodass er das seltsam weiße Gesicht dieses vom Kopf bis zu den Füßen eingeschnürten Kindes nicht mehr im Blickfeld hatte, das starr wie eine Stricknadel da lag.
4
Als Léonce gegen sieben Uhr morgens zurückkam, um ihn abzulösen, ging er nicht nach Hause, sondern schnappte sich ein Taxi und ließ sich in die Zeitungsredaktion fahren.
Jules Guilloteaux kam um Viertel vor Acht, wie es seiner Gewohnheit entsprach.
»Ähh … Was machen Sie da?«
André hielt ihm seine Blätter hin, die der Direktor nur mit Mühe greifen konnte, weil er bereits andere, mit breiter, siegesgewisser Schrift beschriebene in der Hand hielt.
»Ich … ich habe Sie doch ausgetauscht!«