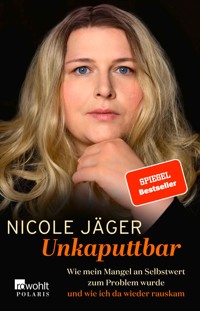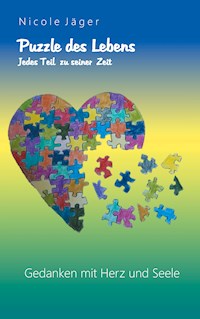Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
«Der Spiegel sagte, ich sei fett. Die Waage sagte: Bitte nicht in Gruppen aufsteigen! Mein Umfeld sagte schon lange nichts mehr. Die ungeschönte Wahrheit: Ich war Mitte 20, sah unmöglich aus und fühlte mich schrecklich. Ich konnte vor Rückenschmerzen kaum laufen und war so beweglich wie eine Wanderdüne. Im Krankenhaus sagte man mir, mein Gewicht läge bei weit über 340 Kilogramm. Dreihundert WAS? Das konnte einfach nicht sein. Ich kaufte mir also Waagen. Zwei. Denn eine allein, selbst wenn sie bis 250 Kilo ging, zeigte mein Gewicht nicht an. Einen Heulkrampf später stellte ich mich darauf, einen Fuß auf jeder Waage. Es reichte nicht. Also begann ich, Kleinigkeiten zu verändern. Gute acht Monate später gab es endlich eine Zahl. Und was für eine: 315 Kilogramm! Seit diesem Tag habe ich über 160 Kilo abgenommen und bin noch lange nicht am Ziel – und erst recht nicht am Ende. Es geht eben doch! Und das will ich zeigen: ohne Operationen, ohne zu hungern, ohne dauerhaften Verzicht, ohne Pillen, dafür aber mit Sport, Ernährung, Wissen, Aufklärung, viel, viel Ehrlichkeit und vor allem einem Augenzwinkern. Ich bin die Fettlöserin. Und wenn ich es kann, dann kann es jeder.» Nicole Jäger bezeichnet sich selbst als fette Frau – sie weiß, was es heißt, übergewichtig zu sein und abnehmen zu wollen. Über 160 Kilo hat sie schon geschafft, ohne Operation und absurde Diäten, und sie hat aus ihren Erfahrungen und ihrer Expertise als ausgebildete Heilpraktikerin ein Coaching für all jene entwickelt, denen es ähnlich geht. Der Erfolg gibt ihr recht, denn nicht jede/r Übergewichtige hat Lust darauf, sich von einer durchtrainierten Size-zero-Beauty erklären zu lassen, wie man Gewicht verliert. Nun erzählt Nicole Jäger ihre ungewöhnliche Geschichte – witzig, frech, inspirierend und sehr unterhaltsam.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicole Jäger
Die Fettlöserin
Eine Anatomie des Abnehmens
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Der Spiegel sagte, ich sei fett. Die Waage sagte: Bitte nicht in Gruppen aufsteigen! Mein Umfeld sagte schon lange nichts mehr. Die ungeschönte Wahrheit: Ich war Mitte 20, sah unmöglich aus und fühlte mich schrecklich. Ich konnte vor Rückenschmerzen kaum laufen und war so beweglich wie eine Wanderdüne. Im Krankenhaus sagte man mir, mein Gewicht läge bei weit über 340 Kilogramm. Dreihundert WAS? Das konnte einfach nicht sein. Ich kaufte mir also Waagen. Zwei. Denn eine allein, selbst wenn sie bis 250 Kilo ging, zeigte mein Gewicht nicht an. Einen Heulkrampf später stellte ich mich darauf, einen Fuß auf jeder Waage. Es reichte nicht. Also begann ich, Kleinigkeiten zu verändern. Gute acht Monate später gab es endlich eine Zahl. Und was für eine: 315 Kilogramm! Seit diesem Tag habe ich über 160 Kilo abgenommen und bin noch lange nicht am Ziel – und erst recht nicht am Ende. Es geht eben doch! Und das will ich zeigen: ohne Operationen, ohne zu hungern, ohne dauerhaften Verzicht, ohne Pillen, dafür aber mit Sport, Ernährung, Wissen, Aufklärung, viel, viel Ehrlichkeit und vor allem einem Augenzwinkern. Ich bin die Fettlöserin. Und wenn ich es kann, dann kann es jeder.»
Nicole Jäger bezeichnet sich selbst als fette Frau – sie weiß, was es heißt, übergewichtig zu sein und abnehmen zu wollen. Über 160 Kilo hat sie schon geschafft, ohne Operation und absurde Diäten, und sie hat aus ihren Erfahrungen und ihrer Expertise als ausgebildete Heilpraktikerin ein Coaching für all jene entwickelt, denen es ähnlich geht. Der Erfolg gibt ihr recht, denn nicht jede/r Übergewichtige hat Lust darauf, sich von einer durchtrainierten Size-zero-Beauty erklären zu lassen, wie man Gewicht verliert. Nun erzählt Nicole Jäger ihre ungewöhnliche Geschichte – witzig, frech, inspirierend und sehr unterhaltsam.
«Schonungslos ehrlich, aber mit charmantem Humor.» (ZDF)
Über Nicole Jäger
Nicole Jäger lebt mit ihrem Mann in Hamburg. Sie studierte Sprachwissenschaften und Gebärdensprache und schloss eine Ausbildung zur Heilpraktikerin ab. Heute arbeitet sie als Ernährungsberaterin und Personal Coach.
Inhaltsübersicht
Dieses Buch ist für …
… MQ, weil mich deine Beharrlichkeit, immer wieder aufzustehen oder zu landen, egal wie tief du fällst oder wie hoch du fliegst, inspiriert.
… Stan, ’cause you are my biggest fan.
Vorwort
Oh. Ein Buch übers Abnehmen. Wie originell! Endlich wieder einmal jemand, der dir erklären will, was du dieses Mal nicht essen darfst. Toll. Darauf hat die Welt ja geradezu gewartet. Stellst du dann zu deinen anderen 40 Büchern übers Abnehmen, ja? Irgendwo zwischen Steinzeitdiät, «Fette Frau jammert übers Dicksein, die gemeine Gesellschaft und die schlimme Kindheit» und «Schlank über Nacht in 30 Tagen». Nur warum die Olle auf dem Cover selbst fett ist, das muss dir mal jemand kurz erklären.
Ja, also das ist so. Die Dicke da auf dem Cover, das bin ich. Sehr erfreut, dich kennenzulernen. Wobei du vermutlich eher mich kennenlernen wirst auf den nächsten Seiten. Man sieht es vielleicht nicht sofort, aber ich habe ein paar Kilo zu viel auf den Hüften. Ganz marginal. Knappe 170 Kilo wiege ich nur noch. Ein Witz im Vergleich zu den 340 Kilo, die ich mal gewogen habe. Dies ist übrigens kein Abnehmratgeber. Sorry. Dies ist auch kein Buch über den neuesten heißesten Scheiß in Sachen Diäten oder die Schablone für deinen nächsten Ernährungsplan, und ich verspreche dir, du findest hier drin nicht ein einziges Rezept. Es ist noch viel schlimmer als das. Dies ist ein Buch über das Abnehmen, genauer gesagt über meinen Weg abzunehmen und über die ungeschönte Wahrheit in Sachen Übergewicht. Dies ist ein Buch über Dinge, die das Fettsein echt lästig machen, und darüber, wie unfassbar ätzend Abnehmen sein kann. Dies ist ein Buch über mein Leben, und es wird ganz schön eklig und traurig und dramatisch, und ich hoffe, dass du laut lachen wirst. Dies ist ein Fick-dich-Diät-Buch und ein Suhle-dich-in-all-den-Vorurteilen-über-dicke-Menschen-Buch. Dies ist ein Wohlfühl- und ein Auf-Zehen-getreten-fühlen-Buch. Dies ist ein ehrliches Buch übers Abnehmen ganz ohne Diäten. Dies ist mein Buch, und ich möchte dich mitnehmen auf die ganz schön fettige Reise durch 170 Kilo Gewichtsverlustwahnsinn. Wenn du danach aus Versehen einige Kilo abnimmst, na ja, dann ist das auch okay. Das ist übrigens mein Job. Mein Name ist Nicole Jäger, und ich bin Abnehmcoach. Sieht man gleich, oder?
Dies ist mein Buch, und es ist für dich. Diesem Buch ist es übrigens egal, was du wiegst.
Dieses Buch ist für dicke Menschen. Dieses Buch ist für schlanke Menschen. Dieses Buch ist für Menschen, die fette Menschen hassen, und es ist für all jene, die sich selbst hassen. Dies ist ein Buch für In-die-Tasche-Lügner und für Satthaber und Nie-satt-Werder. Dies ist ein Buch für Menschen, die sich lieben oder es lernen müssen, die fließend ironisch sprechen, gerne lachen, und für jene, die sich nur zu gern angegriffen fühlen. Dies ist ein Buch über Hoffnung und Erfolg, Niederlage und Arschhochkriegen. Dieses Buch ist für Frauen. Dieses Buch ist für Männer. Dieses Buch ist für alle, die mich lieben, und für alle, die mich schon immer so richtig scheiße fanden.
Dies ist ein Buch für all jene, die schon einmal scheiterten, und die, die es noch ganz dringend vorhaben. Dieses Buch ist für all jene, die nicht aufgeben wollen. Dieses Buch ist für jeden, nur für einen nicht: Wenn du das hier in der Hand hast, weil du glaubst, ich verschwende meine und deine Zeit damit, dir vorzulügen, dass es den einen geheimnisvollen Tipp oder eine tricky Zauberformel gibt, um Gewicht zu verlieren, dann ist es nichts für dich.
Dies ist ein Buch, das dir vielleicht hilft abzunehmen, vielleicht auch nicht. Ich schicke 170 Kilo Gewichtsverlust ins Rennen, du solltest es also vielleicht darauf ankommen lassen.
Vermutlich fragst du dich gerade, warum nun ausgerechnet die Fette vom Cover dir erklären will, wie das denn so ist mit dem Abnehmen, dem Übergewicht und dem ganzen Drumherum. Nun ja, auf den Punkt gebracht würde ich sagen: Weil ich es kann.
Was bisher geschah
Ich habe keine Ahnung, wie alt ich war, als ein Kinderarzt erstmals diagnostizierte, dass ich dringend eine Kur machen müsste. Andernfalls würde ich schon bald auseinandergehen wie ein Hefekloß. Aus heutiger Sicht war ich ein wenig propper; damals, ich bin Baujahr 82, war es eine Zumutung, ein dickes Kind zu haben.
Diese Ratschläge hörten meine Eltern immer öfter, und irgendwann war es dann so weit: Ich wurde mit 5 Jahren zur Kur geschickt, sechs Wochen lang, irgendwo in Deutschland. Die erste von insgesamt fünf Kuren dieser Art und Länge, bevor ich volljährig wurde. Für meine Eltern muss es fürchterlich gewesen sein, wer lässt schon gern ein 5-jähriges Kind allein. Wenn aber ein Arzt sagt, dass es so sein müsse, dann wurde das so gemacht. Immerhin hatte er einen schicken weißen Kittel an, der nach Kompetenz roch. Ich war eines von insgesamt zwei dicken Kindern in der Kinder-Kurklinik; alle anderen Patienten waren zwar im gleichen Alter, aber schlank bis hager. Man trennte die schlanken Kinder von uns dicken, räumlich wie in der Behandlung durch die Betreuer. Kann ja am Ende keiner wissen, ob Fett nicht doch ansteckend ist.
Die schlanken Kinder bekamen Schokolade zum Nachtisch. Ich bekam eine halbe Kiwi. Mit uns wurde täglich geschimpft und darauf hingewiesen, wie dick und unnütz und faul wir wären, wohingegen wir uns einmal ein Beispiel an den besseren Kindern nehmen sollten. Die, die vorn saßen und umarmt wurden.
Wir zwei Dicken saßen also an einem separaten Tisch, ganz hinten links, teilten uns ganz feudal unsere Kiwi und dienten den Betreuerinnen, die dafür abgestellt waren, sich um uns zu kümmern, gerne als schlechtes Beispiel: «Wenn ihr also nicht so enden wollt wie Nicole und Mädchen XY, dann sagt euren Eltern, dass …», und so weiter.
Ich erinnere mich an Betten, an deren Seiten nachts Gitter befestigt wurden, damit man nicht herausfiel. Und ganz nebenbei hielt diese Maßnahme die Örtlichkeiten so schön sauber, weil niemand nachts auf Klo gehen konnte. Praktisch!
Ich erinnere mich daran, dass ich mittags durch den Speisesaal schlich und den schlanken Kindern die Schokolade klaute. Nicht viel, immer nur von jedem so ein kleines bisschen, sodass es nicht auffiel.
Sollte unter euch also jemand sein, der schmerzlich ein Stück Schokolade vermisst – das habe ich.
Ich erinnere mich an den Nachtwächter, der aus meiner Perspektive groß wie ein Baum war und wahrscheinlich wegen seiner Kernkompetenzen «schlechte Laune» und «macht Kindern Angst» eingestellt worden war. Mr. Kinderschreck flanierte nachts über den großen Stationsflur, und wenn man nicht schlief oder «lieb» war, musste man bei ihm im Zimmer auf der Pritsche unter einer kratzigen grauen Decke schlafen. So was kennt man heute nur aus alten Knastfilmen. Unter «nicht lieb sein» fiel auch, nachts aufs Klo zu müssen, zu weinen, weil man Heimweh hatte, was bei Kindern ab und an vorkommen soll. Nicht lieb war auch ich, als Eiter und Blut aus meinen beiden Ohren lief. Die Mittelohrentzündung wurde mit den Worten «Stell dich nicht so an, sonst geben deine Eltern dich ins Heim!» behandelt, und jeder Morgen begann damit, dass das Kissen an meinem Kopf klebte. Das war aber nicht so schlimm, denn nach einigen Tagen konnte ich solche Sätze schlichtweg nicht mehr hören. Auch den Kinderschreck nicht, was mir eine weitere Nacht auf der Pritsche einbrachte. Seither gehe ich Nachtwächtern aus dem Weg. Nach Hause wurden aber nur schöne Dinge geschrieben. Kunststück, ich war 5 und musste von den Betreuern schreiben lassen. Ich habe euch lieb, alles ist gut, das Essen ist lecker, die Sonne scheint auch, und wenn ich wieder zu Hause bin, bin ich auch ganz still und nicht mehr so dick. Versprochen.
Bis auf die saftige Ohrenentzündung, an der ich beinahe ertaubte, Angst vor dem Alleinsein und einen großen Hunger auf Schokoweihnachtsmänner brachte mir diese erste sogenannte Kur rein gar nichts.
Zurück in der Heimat zu sein hieß auch, zurück im alten Trott zu sein.
Ich wuchs heran, wie man nun einmal so wächst. Bei mir insgesamt 177 Zentimeter in die Höhe und 2 Meter in die Breite.
Lacht da gerade jemand?
Das stimmt!
Am Ende der Reise hin zu meinem Gewichtshöhepunkt war ich wirklich weitaus breiter, als ich hoch war. Nun, zumindest war mein Umfang mit einem normalen Maßband nicht mehr zu ermitteln.
Während ich mich fröhlich in alle Himmelsrichtungen entwickelte, lernte ich so einiges über das Leben, über Ernährung aber etwas ganz Spezielles, und zwar: Egal was es ist, es ist stets zu viel.
Gemein, ich habe doch immer so gern gegessen.
Unheimlich gern!
Und irgendwann dann gern heimlich.
Mit 10 Jahren ging es dann in die zweite Kur. Dieses Kind wollte aber auch einfach nicht dünner werden!
Nach der Kur schleppte man mich zu einer Psychotherapeutin, die sich auf dicke Kinder spezialisiert hatte.
Was für ein Ereignis! Vor der guten Frau hatte ich solche Angst, dass ich nicht mehr schlafen konnte und in den Sitzungen außer Schuld, daran erinnere ich mich noch sehr genau, nicht viel empfand. Schuld und Angst sind Gefühle, die sich übrigens wunderbar wegessen lassen. So wie sich Probleme auch wegtrinken oder Einsamkeit wegvögeln lassen kann.
Nicht.
Kur Nummer 3 stand an, und kurz vor meinem 14. Geburtstag auch die Nummer 4.
Als ich alt genug war, um mich nicht mehr in Betten einsperren zu lassen, und zu schwer, um auf einer Pritsche in der Besenkammer schlafen zu müssen, war es ab und an sogar ganz witzig. Man muss sich um nichts kümmern, alle betüdeln einen, man bekommt Mahlzeiten vorgesetzt und braucht sie nur zu essen – und essen konnte ich schon immer hervorragend –, ging zwischenzeitlich zum Sport, alle sahen gleichermaßen scheiße aus, und abends giggelte man mit Taschenlampen unter den Bettdecken und schwärmte für Jungs.
Ich auch!
Was war ich schlimm verliebt in einen Jungen namens Martin! Martin war groß, blond, ein wenig übergewichtig, schön, und als ich ihn einige Jahre später durch Zufall wiedertraf, da war von dem Mädchen, dass sich in ihn verliebt hatte, genauso wenig übrig wie von dem Martin, den ich so angehimmelt hatte. Eine der ersten wirklich großen Enttäuschungen meines Lebens.
Aber hey, Martin, du warst mein Erster.
Also, mein erster Tanzpartner.
Jugenddisko, im Keller des Kurheims; ich trug eine lila Leggins, schimmernd und eng, einen grünen Haarreifen auf straßenköterfarbenem, dünnem Haar, und sah aus, als hätte mich ein betrunkener Stylist im Schlaf überfallen. Ich fand mich unwiderstehlich schön.
Martin schlief dann übrigens auf der gleichen Kur noch mit dem Mädchen, das ich am wenigsten leiden konnte, nur um, wie er sagte, mir zu zeigen, wie gern er mich hat und dass er damit die Trauer zum Ausdruck bringen wollte, dass wir nicht zueinanderfanden.
Martin, schönen verschissenen Dank auch!
Ich hoffe, du hast deine Strategie über die Jahre noch einmal ein winziges bisschen überarbeitet. Idiot.
Nun möchte man aus diesen Zeilen schließen, dass ich dickes Kind meine Zeit damit verbrachte, möglichst viel zu essen und mich möglichst wenig zu bewegen, traurig zu gucken und mich ansonsten hänseln zu lassen. Zu meiner Ehrenrettung darf ich sagen, dass das so nicht ganz stimmte. Ich fing sehr früh an, Sport zu treiben, und hatte selbst im Abiturzeugnis trotz des zum damaligen Zeitpunkt schon abstrus hohen Gewichts eine 2 in Sport.
Ich liebte Sport und tat lange Zeit nichts anderes. Ich war in einem Verein angemeldet und nahm von «Sportübernachtungspartys» bis hin zu allerhand Wettkämpfen als Jugendliche an allem teil, was mir vor die Sportschuhe fiel. Noch heute bekomme ich beim typischen Geruch von Turnhallen ein Kribbeln im Bauch.
Meine Hauptdisziplin war der Gerätesport und das Bodenturnen, und wenn ich mir nicht gerade die Schienbeine am Stufenbarren aufschlug, spielte ich zum Ausgleich Squash, ging schwimmen, fuhr mit dem Rad oder brach mir den Arm beim Inlineskaten. Leider den linken, weswegen ich am nächsten Tag doch die Klausur mitschreiben musste. Kurzum, ich war viel draußen und noch mehr beim Sport, weswegen ich leider mit dem Vorurteil vom verfressenen Couchpotato-Kind aufräumen muss.
Meine große Leidenschaft war jedoch das Trampolinspringen, was ich sogar ziemlich gut konnte. Bis auf dieses eine Mal, als ich aus Gründen, die mir im Nachhinein nicht mehr klar sind, in der Luft die Orientierung verlor und statt wie geplant mit dem Rücken auf der Sprungfläche mit meiner Hüfte auf dem Trampolingestell aufschlug und nach einer kurzen, sicher sehr galanten Drehung auf dem Hallenboden aufkam. Dadurch wurde mein Sturz dann erst einmal gebremst.
Ich weiß nicht, ob jedem meiner Leser Trampoline in der Größe bekannt sind, aber sicher kennt noch jeder diese kleinen, viereckigen, die es im Sportunterricht gab. In der Mitte ein ehemals weißes, jetzt durch Hunderte Turnschuhe ergrautes Sprungtuch, umrandet von einer dünnen, meist blauen oder auch orangefarbenen Matte, die eigentlich nur dafür Sorge tragen soll, dass man dem Metallgestell, das das Sprungtuch hält, nicht ins Gehege kommt.
Turniertrampoline sehen in etwa genauso aus, sind nur weitaus größer und höher, und man kann auch höher springen. Sieht toll aus, tut dann aber scheiße weh, wenn man so wie ich danebenspringt.
Beim Kampf Hüfte gegen Eisengestell gewinnt übrigens im Regelfall die Eisenstange.
So auch bei mir.
Mit einem hässlichen Geräusch und einem satten «Flatsch» endete mein Sportlerdasein auf der dezent kühlen Metallplatte eines OP-Tisches.
Meine Hüfte war hin, und das auf beiden Seiten.
Es folgten viele hässliche Monate, in denen mehrere Schläuche aus meinen Beinen hingen, ich in Bettpfannen pullern musste und vieles dank der Medikamente nur recht vernebelt wahrnahm. Die Operation selbst dauerte weit über 12 Stunden, und ich wäre beinahe verblutet, was gar nicht so schlimm war, ich bekam davon ja nichts mit. Allerdings ist es ziemlich kalt, wenn man aufwacht und der ein oder andere Liter Blut im Körper fehlt.
Krankenhäuser sind irgendwie auch ein wenig wie Kurheime, nur weißer. Aber die Nachtschwestern sind oft ähnlich gut gelaunt, und niemand läuft herum, weil alle eingegipst oder frisch aufgeschnitten oder anderweitig immobil sind, aber ansonsten war es manchmal sogar fast lustig.
Nur dieses elendige Krankenhausessen …
Aber das ist ein anderes Thema.
Ich lag einige Wochen faul auf meinem Rücken und zählte die Löcher in den Rigipsplatten an der Decke über meinem Bett – es sind übrigens 441 – und harrte der Dinge, die da kommen mögen.
Und es kam einiges. Zunächst ein Rollstuhl, der mich in den folgenden Monaten von A nach B brachte, da ich weder laufen durfte noch konnte, und er brachte seinen Freund mit, das große schwarze Loch, in das ich mich irgendwann legte, um dort in aller Seelenruhe in meinem Leid zu baden und die Welt, den Sport, Gott und die Telekom dafür zu hassen, dass alle so gemein zu mir waren.
Tatsächlich war dies der Anfang meiner abstrusen Übergewichtskarriere.
Wohlgemerkt: Nicht der Grund.
Das hier ist kein Buch, in dem sich eine fette Frau seitenweise darüber auslässt, wie gemein das Leben zu ihr war und deswegen alles ganz schlimm und außerdem und überhaupt buhuhu.
Nein, das alles ist keine Ausrede dafür, dass ich mich auf weit über 300 Kilo gefressen habe. Besser gesagt: Es ist heute keine Ausrede mehr.
Ich wurde nach zwei Monaten mit einer miesen Prognose, mit langen Narben an den Beinen und einigen Titanschrauben in den Hüften entlassen. Und mit einem Abschiedsgruß: Mein behandelnder Arzt verkündete mir, ich könne das mit dem Sport vergessen und solle mich lieber mit dem Gedanken anfreunden, mein Leben sitzend zu verbringen, da das mit dem Laufen ja so eine Sache sei.
Wenn das nicht genau die Sätze sind, die man mit 14 hören will, dann weiß ich auch nicht!
Bei allem Selbstmitleid steckte in mir allem Anschein nach auch eine Art trotziger Kampfgeist, und so fand ich mit Hilfe mehrerer Krankengymnasten und einem Stufenbarren Schritt für Schritt auf meine Beine zurück. Lautstark fluchend und obszönst motzend übrigens.
Es dauerte etwa zwei Jahre, bis ich freihändig zumindest gut stehen konnte; zur Belohnung gab es einen weiteren Krankenhausaufenthalt, in dem das Alteisen in meinen Beinen wieder entfernt wurde.
Ein mächtiger Spaß, das alles.
Heute laufe ich wieder auf beiden Beinen, und das freihändig. Mehr oder weniger gut. Eher weniger gut, da ich aus der Zeit nicht ganz unbeschadet hervorging. Hinzu kommt, dass eine kaputte Hüfte nicht so super gern abstrus hohes Übergewicht trägt. Eine gesunde übrigens auch nicht. Komisch.
Aber ich gehe und stehe, und das war noch nie so viel wert wie heute.
Ich bin diesen Weg zurück auf die eigenen Beine zweimal in voller Länge gegangen, einmal nach meinem Unfall und ein weiteres Mal, als es darum ging, nach dem Höhepunkt meiner Gewichtslaufbahn wieder in Bewegung zu kommen. Beim ersten Mal war es Pech, beim zweiten Mal Idiotie.
Übergewichtig war ich also schon immer, und ebenso lange war mein Gewicht allem Anschein nach ein Problem. Früher mehr das Problem anderer, später dann nur noch mein eigenes und das aller Sitzmöbel um mich herum. Sorry, Sofa, das war nicht persönlich gemeint.
So richtig bergab – oder bergauf, je nachdem ob man meine Gesundheit oder die Waage fragt – ging es dann irgendwann nach dem Abi. Bis dahin war ich ein übergewichtiges Kind, eine übergewichtige Jugendliche und eine recht dicke Abiturientin.
Ich ging zur Schule wie jeder andere auch, war geschlagene 14 Tage lang Punk, bis ich fand, dass mir das alles nicht steht, und wurde erst Gothic, dann Metalmädchen. Letzteres bin ich bis zum heutigen Tage geblieben. Meine Jugend war schrecklich langweilig bis normal, aber ich fand sie zwischenzeitlich super. Ich feierte viel, meine Eltern waren anstrengend, wie sie es in der Pubertät immer werden, ließen mich aber fast jedes Wochenende meine Freunde einladen, welche dann auch schon mal meiner Mams in die Halbschuhe kotzten, weil sie den Weg ins Bad nicht mehr schafften. Ich ließ mich tätowieren und piercen, woraufhin mich meine Mutter am liebsten enterbt oder mindestens mal enthauptet hätte, und meine absolute Rebellion bestand darin, mir die Haare pink zu färben. Ich war schon ein echter Draufgänger. Ich räumte nie auf, ließ immer das Licht an, womit ich noch heute meinen Papa zur Weißglut bringen kann, und heizte bei offenem Fenster. Wooohooo! Rock ’n’ Roll!
Ich kam zu spät nach Hause, räumte nie den Geschirrspüler aus, und es brauchte ewig, bis ich begriff, dass aus mir wohl kein Rockmusiker mehr wird. Ich rauchte nicht, hatte nur wenig komischen Umgang und nahm keine Drogen, aber das musste ich auch nicht, denn ich aß oder hungerte ja. Stets im Wechsel und beides oft so lange, bis es weh tat, da bleibt nicht viel Zeit fürs Kiffen.
Fragte man meine Eltern, klänge deren Zusammenfassung dieser Zeit vermutlich eher nach «Und dann haben wir das Mädchen vom Drogenstrich holen müssen», und eines Tages klingelte tatsächlich das Telefon, und meine Oma brüllte mich an, man könne ein Mädchen zwar aus der Gosse, die Gosse aber nicht aus dem Mädchen holen und ich würde als Nichtskönnerin auf der Straße enden, so, wie ich mit meinem Leben umging, man sähe ja, ich bekäme mein Gewicht doch schon nicht auf die Reihe, kein Wunder, dass aus mir nichts würde.
Der telefonische Wutausbruch bezog sich lediglich darauf, dass ich mich dazu entschieden hatte, nun doch kein Graphikstudium an der Privatuni zu absolvieren, weil ich schlicht und ergreifend vollkommen untalentiert war und darüber hinaus viel zu ängstlich für eine Karriere als Straßennutte oder Junkie, weswegen auch die Gosse nicht in Frage kam.
Und ich war zu dick.
Und das war immer ein Thema.
Ich war von meinen 33 Lebensjahren etwa 27 Jahre lang auf Diät, und was das angeht, habe ich keinen Bereich ausgelassen. Ich aß nur Kohlsuppe und Ananas, ich aß nur Eier oder nur Kartoffeln, nur noch Knäckebrot und Gemüsebrühe, nur Fleisch oder nur noch Shakes. Oder gar nichts mehr. Ich wurde zu Ärzten geschleppt, die mir mit dem baldigen Tode drohten, und ich schluckte, anstatt zu essen, kleine Kapseln mit Schwämmen drin, die einen vollen Magen simulieren sollten. Oh ja, das ist genauso eklig, wie es klingt!
Ich stolperte von einer Ernährungsweise in die nächste, stets dem neuesten Trend, der nächsten Meinung, dem guten Ratschlag des einen oder der absolut bombensicheren Methode des anderen folgend. Alles an mir und meinem Leben war gähnend normal.
Nur mein Gewicht nicht.
Und mein Essverhalten erst recht nicht.
Ich lernte über die Jahre, dass ich es falsch machte. Dass ich falsch aß, zu viel aß, vor dem Fernseher aß oder nicht von blauen Tellern oder zu spät oder zu früh oder zu rechteckig oder zu wenig Sport machte oder, oder, oder …
Ich lernte, dass mein Essen nicht richtig war, dass ich nicht richtig war. Was allerdings «richtig sein» bedeutete, erzählte man mir nicht. Oder ich habe es beim Kauen überhört.
Ich zog mit 18 zu Hause aus und dann gefühlte tausendmal um, und irgendwann verließ ich meine Hamburger Wohnung so gut wie gar nicht mehr. Nachbarn und Freunde gingen für mich einkaufen, der örtliche Lebensmitteldealer lieferte meine Drogen in Form von Tiefkühlpizza, und ich wuchs von einer Kleidergröße in die nächsthöhere, bis ich irgendwann die Größe 72 überschritt und nur noch im Zeltfachhandel etwas zum Anziehen hätte finden können.
Nicht, dass mich das zum Nachdenken gebracht hätte – denn schuld waren stets die anderen. Ich war eventuell ein bisschen zu dick, aber solange der Schal noch passte, musste ich doch nicht abnehmen. Und schließlich hatte ich ja auch ein starkes Selbstbewusstsein, da war das bisschen Übergewicht schon okay.
Das sagte ich voller Überzeugung und war am gleichen Abend wieder auf Diät.
Solange jemand zuschaute, aß ich nicht. Nur heimlich, wenn ich alleine war oder mich alleine fühlte (und Letzteres tat ich sehr häufig), stopfte ich alles in mich hinein, was nicht alleine wieder aus meinem Mund herauskrabbeln konnte, kotzte mir die Seele aus dem Leib, nur um kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, und ließ irgendwann auch das, denn Lebensmittel sind teuer, und Erbrechen ist nicht gut für die Zähne. Eine wirklich wichtige Erkenntnis, wenn der Körper am Limit läuft: Hauptsache, die Zähnchen nehmen keinen Schaden.
Ich war 26. Mein Rücken litt so sehr unter meinem Gewicht, dass ich nur am Stock gehen konnte, meine Haare fielen aus, weil mein Körper aufgrund des vielen Fettes ein Hormonproblem entwickelte. Ich konnte nicht mehr im Stehen duschen, musste mich überall, an jeder Wand, bei jedem Schritt festhalten, um überhaupt ins Bad und aufs Klo zu gelangen. Langsam. Sehr langsam. Ich konnte das Wasser oft nicht halten, weil mein Gewicht so auf die Blase drückte. Ich konnte nicht mehr im Liegen schlafen, weil ich sonst an meinem eigenen Gewicht erstickt wäre, und ich sah die Welt nur noch aus meinem Wohnzimmerfenster oder wenn ich in meinem mit Holzbohlen verstärkten Bett lag und in den Park hinausschaute. Die Welt kam entweder zu Besuch, oder sie fand schlicht nicht statt.
Eines Morgens dann riss mein Körper mich aus dem Schlaf. Draußen schien die Sonne und drinnen, in meinem 65-Quadratmeter-Universum, ging die Welt unter. Ich bekam kaum Luft, mein Herz schlug so heftig und so schnell, dass ich es fast hochgewürgt hätte, mir war schwindelig, schlecht und kalt, ich hatte Todesangst und war allein.
Ich war Mitte 20, wog 340 Kilogramm und hatte einen Herzinfarkt.
Und hier beginnt meine Geschichte.
Der Morgen: Tod durch Dummheit
Ich würde sterben.
Das war keine vage Vermutung, sondern absolute Gewissheit. Ich würde hier und jetzt, in meinem hässlichen Bigshirt und ohne Unterwäsche auf meinem Bett sitzend, sterben. Hat Mama nicht gesagt, ich solle immer einen sauberen Schlüpper tragen, man wisse ja nie, wann man vielleicht mal ins Krankenhaus müsse? Ja, toll, nun hatte ich den Salat. Ob ich es wohl noch zum Schrank schaffen würde? Aber dann würde man mich auf dem Boden finden, mit einem Slip am Fuß, oder in den Kleiderschrank gekippt, mit dem nacktem Hintern nach oben gereckt und dem Gesicht in den Socken.
Es würde schnell gehen, bis die Lichter aus waren, aber es würde ein wenig dauern, bis man mich findet. Mindestens bis zum Abend, und ich würde daliegen wie ein Berg Pudding, während die Polizei erst den Krankenwagen, dann die Feuerwehr und den Leichenbestatter rufen würde, um mich aus dem Haus zu bekommen.
Ich wohnte damals im 7. Stock mit zwei Fahrstühlen. Beide viel zu klein, um dort liegend hineinzupassen, und bei einem überschritt ich allein schon die Maximallast, was ich aber erst Jahre später feststellte. Vermutlich hätten sie ein Tragetuch genommen, weil ich für eine Liege viel zu breit und schwer war; der Bestatter wäre längst schon wieder auf dem Weg nach unten, denn ich hätte nie und nimmer auf die Bahre gepasst. Und selbst wenn, wie hätten sie mich aus der Wohnung bekommen sollen? Vielleicht hätte man ein wenig amüsiert darüber diskutiert, ob sie mich durch das Treppenhaus hinuntertragen können, nur um dann festzustellen, dass sie mich nicht durch den engen Flur bekommen. Ein Funkspruch, vielleicht zwei, dann hätten sie eine Leiter geordert. So eine schöne Drehleiter, die auf einem vollkommen unauffälligen Feuerwehrwagen montiert ist. Sie hätten aufs Bett steigen und das Schlafzimmerfenster heraushebeln müssen, weil der Mittelsteg im Weg wäre, und dann hätten sie mich in diesem Bergetuch aus dem Fenster gehoben, und dann genau so, wie man Schwerlasten hinablässt, wäre ich schwankend gen Boden abgesenkt worden. In der Zwischenzeit wäre die Presse eingetroffen, und auch wenn sich die Jungs in Rot sicher bemüht hätten, meine Privatsphäre zu schützen, wäre ich zur Schlagzeile im Regionalteil der Tageszeitung geworden. «Hamburger Schwergewicht passt nicht in den eigenen Sarg.» Oder so ähnlich. Die Dame aus dem Nebenhaus hätte es «schon immer gewusst» und sich halb hämisch, halb erstaunt das Maul darüber zerrissen. Und eine ganze Weile hätte ich die Gespräche meiner Nachbarn dominiert.
Einer meiner engsten Vertrauten sagt gern in solchen Momenten, dass ein Mann, der 1000 Brücken baut und nur eine Ziege fickt, nicht länger der Brückenbauer, sondern der Ziegenficker ist. Das Zitat stammt, etwas abgewandelt, aus einem wirklich schlechten Film, aber der Inhalt stimmt leider.
Ich sitze also auf meinem Bett und bin eigentlich ganz plietsch, gut erzogen und höflich, und man sagt mir nach, ich sei weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen. Ich bin empathisch und sympathisch und manchmal ein wenig nervig, aber all das ist vollkommen egal, denn ab jetzt bin ich nur noch der metaphorische Ziegenficker, der von der Feuerwehr durchs Fenster gehoben werden musste, weil er gestorben ist an …
Ja, an was eigentlich?
An meinem Übergewicht.
Tod durch Fett. Tod durch Arsch-nicht-Hochgekriegt. Tod durch «Ich habe zu lange gewartet».
Tod durch Dummheit!
Das alles ging mir durch den Kopf.
Ich sterbe, weil ich es so weit habe kommen lassen. Ich, mein Ego, meine Überheblichkeit, weil es so schlimm ja noch nicht sein konnte. Ich würde es doch nie so weit kommen lassen. Ich doch nicht! Ich bekomme das doch hin, habe ich das nicht immer behauptet? Gerade gestern erst noch. Ich wollte es doch der Welt zeigen! Sobald die Schmerzen weniger würden, würde ich die Weltherrschaft an mich reißen und abnehmen, gesund werden und Dinge tun, die ich tun will. Ich wollte doch nicht in Schönheit sterben, sondern irgendwann im Wald von einem Klavier erschlagen werden, weil ich das Drama so liebe! Ich habe doch noch so viel auf meiner Geile-Dinge-To-do-Liste stehen und noch so wenige Haken daran!
Es ist am Ende des Tages egal, wie groß die Pläne sind, wie schön das Gesicht und wie frei die Gedanken, wenn der Körper an ein Sofa gefesselt ist. Deiner Gesundheit ist es egal, wie toll, warmherzig, intelligent und großzügig du bist, denn auch mit einem guten Ruf kannst du viel zu früh ins Gras beißen, wenn du es nur dolle genug provozierst.
Dieser Moment, dieser vermeintlich letzte Moment, hat nur in Filmen etwas Verklärt-Romantisches. Mein vermeintlich letzter Moment war erbärmlich.
Ich hatte es versaut.
Ich habe viele Chancen gehabt, so viele helfende Hände weggestoßen.
Ich war die Meisterin der Ausreden und des Selbstbetrugs, und der Preis dafür, der jetzt gefordert wurde, war hoch.
«Ich hab’s versaut, tatsächlich versaut» waren auch meine ersten ehrlichen Worte seit Jahren zu diesem Thema und vielleicht sogar die ersten wirklich ehrlichen Worte, die ich jemals an mich richtete. Natürlich hatte ich immer wieder kritisch in den Spiegel geschaut, und natürlich war mir klar gewesen, dass ich immer dicker, kranker und hässlicher wurde, und ich überhörte auch nicht die Mahnungen und das Getuschel der Menschen um mich herum, ich bin weder taub noch dämlich. Aber ich bin gut darin wegzusehen, wenn es um meine eigenen Probleme geht, und ich kann Dinge gut schönreden und die Spiegelung in Schaufenstern meiden.
Doch dieser eine Moment traf mich wie ein Kinnhaken. Unerwartet und heftig, und ich kann noch heute spüren, wo er landete. Ganz tief in mir, auf Höhe meines Solarplexus, und dort hinterließ er einen tiefen Eindruck. Ich hatte bis dahin so viel von mir gehalten, und nun fragte ich mich zum ersten Mal, warum eigentlich? Natürlich kann man auch als fetter Mensch ein großartiger Geist sein, aber was bringt es, wenn man sich selbst nicht zumindest so weit in den Griff bekommt, dass man nicht an seinem eigenen Fett erstickt, Himmelherrgott noch einmal?
Ich saß breitbeinig auf dem Bett. Nicht weil das so sexy gewesen wäre, sondern weil es nicht anders ging. Meine Oberschenkel waren derart massig, dass ich, selbst wenn sie aneinanderlagen, wie eine dieser Puppen aus meinen Kindertagen saß, halb aufrecht, meinen Oberkörper auf meine Arme hinter dem Körper gestützt. Nach vorn ging es nicht, wirkten meine Arme doch eh viel zu kurz für die Massen meines Rumpfes; außerdem war noch ein riesiger Bauch im Weg, der halb auf meinen Oberschenkeln und halb auf der Matratze lag. Dies war die einzige Position, in der ich meine Füße ab und an mal sehen konnte, und dass ich Knie hatte, wusste ich nur, weil sie schmerzten. Mein Doppelkinn hatte schon vor einigen Monaten wiederum ein eigenes Kinn bekommen, und meine Arme glichen den Oberschenkeln anderer Leute. Dennoch wirkte mein Oberkörper immer noch am schlanksten, was ich auch auf den wenigen Fotos aus dieser Zeit zu betonen versuchte. Warum eigentlich? Absurd!
Mir war nie so sehr bewusst geworden, wie fürchterlich ich aussah, wie in diesem Moment. Wie unattraktiv, ungepflegt und ungesund. Meine Haut war blass und teigig, meine Haare dünn, ich hatte Wasser in den Knöcheln und Beinen, was zur schlechten Wundheilung beitrug.
Ich wollte das nicht. Ich hatte das nie gewollt. Mein Selbstbild war ein ganz anderes, und der Spiegel der Realität haute mir in diesem Moment mal gepflegt auf die Fresse.
«Halte durch! Bitte halte durch!» Ich flüsterte und versuchte, den Panikkloß im Hals herunterzuschlucken.
«Ich weiß, ich bin ein Riesenarschloch, aber bitte gib mich nicht auf! Ich mache es wieder gut. Ich verspreche dir, ich kann vielleicht nichts, und ganz sicher habe ich den Bogen überspannt, aber bitte verlass mich nicht. Ich mache es irgendwie wieder gut. Keine Ahnung, wie, aber ich werde mir die größte Mühe geben! Nicht sterben, bitte nicht sterben. Nicht so und nicht hier und nicht jetzt. Ich mache uns wieder heile, wenn du nur durchhältst. Versprochen!»
Thomas D. richtete einst in einem meiner Lieblingslieder sein Gebet an den Planeten, ich richtete meines an mein eigenes Herz und an meinen Körper.
Ich kann noch heute nicht darüber schreiben oder sprechen, ohne jedes Mal wie ein kleines Mädchen zu heulen anzufangen oder zumindest einen riesigen Kloß im Hals zu haben. Nicht weil ich mich selbst bemitleide, sondern weil es mich so traurig und wütend macht, dass ich es überhaupt so weit habe kommen lassen, dass ich jede Warnung in den Wind schoss und glaubte, es besser zu wissen. Ich habe so viel Zeit und Leben damit verschwendet herumzusitzen, nicht metaphorisch, sondern buchstäblich, und Himmel, es war mir damals und ist mir auch heute noch unfassbar unangenehm. Ich schäme mich, und ich spreche nicht darüber, weil es so witzig, sondern die eklige Wahrheit ist und weil diese Wahrheit ausgesprochen werden muss, um zu verstehen und endlich mit dem Selbstbetrug aufzuhören.
Ich kann ihn noch ganz genau spüren, diesen Moment des Absturzes und der Selbsterkenntnis. Ich spüre noch immer den Schmerz, die Angst und die Scham, den Abscheu vor mir selbst und auch die Hoffnungslosigkeit, und ich glaube nicht, dass ich das jemals ablegen werde. Letztlich ist es auch gut so, da es mich aufrecht hält und vorantreibt. Aber wenn wirklich jeder Mensch seinen ganz eigenen wunden Punkt hat, dann ist das hier ganz sicher meiner.
Ich starb nicht.
Mein Herz entschloss sich, nach einiger Zeit seinen Rhythmus wiederzufinden, und auch sonst normalisierte sich alles. Dass es kein Herzinfarkt, sondern eine Störung meiner Schilddrüse war, die zu gelegentlichem Herzstolpern führt, und sich der Rest wohl auf eine daraus entstandene Panikattacke zurückführen lässt, war mir damals nicht klar. Heute bin ich nicht unglücklich darüber, dass es zu diesem Moment kam; ich bin mir sehr sicher, dass du sonst nicht diese Zeilen vor Augen hättest und ich Kompost wäre.
Nicht tot zu sein ist übrigens ausgesprochen hilfreich, wenn man sich vornimmt, doch noch irgendwie den dicken Hintern hochzubekommen, um etwas zu verändern.
Meine erste Überlegung widmete sich der «Was nun»-Frage, und ich beschloss, todesmutig, wie ich nun einmal bin, für den Anfang erst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Getreu dem Motto: Du musst deinen Feind kennen. Und angetrieben durch diese Mischung aus Panik und Tatendrang, beschloss ich, mich nach Jahren mal wieder auf die Waage zu stellen.
Als ich mich das letzte Mal gewogen hatte, waren 147 Kilogramm angezeigt worden. Frauen in den besten Jahren entscheiden bisweilen, offiziell nicht mehr älter zu werden, und so hielt ich es auch mit meinem Gewicht. Egal wer fragte, egal wie viel Zeit verging, und egal was es die Wochen zuvor zu essen gegeben hatte: Ich wog immer 147 Kilogramm. Mit Kleidergröße 58 wie mit Kleidergröße Ü72. Hundertsiebenundvierzig. Punkt.
Die Zahl klingt gut und ist für die meisten Menschen bereits jenseits von Gut und Böse, sodass niemals jemand auf die Idee kam, mich zu fragen, ob ich mich da vielleicht ein klein wenig verschätzt haben könnte. So um, na, sagen wir, knappe 100 bis 200 Kilo?!
Also, jetzt, hier! Tatendrang! Auf 3 … 2 …
Ich musste wissen, wie viel ich wiege.
Hinter der Küchentür stand sie, mein mit einem Digitaldisplay versehenes Feindbild. Ich hasste es schon als Jugendliche, auf die Waage zu steigen; ganz besonders schlimm war es beim Arzt, der noch eine dieser alten Waagen hatte, bei der man die Gewichte von Hand verschieben musste. Darauf stand ich dann in meinem unvorteilhaften Schlüpfer in freundlich verwaschenem Weiß, weil es in meiner Größe nichts anderes gab, zog den Bauch ein und betete, dass dieser Moment enden möge. Der Arzt nahm mit einem Naserümpfen zur Kenntnis, dass ich zu schwer sei. Nicht, dass man das auch ohne Waage hätte herausfinden können.
Das letzte Mal auf der Waage war also wirklich lange her, und allein der Gedanke daran, gleich zu erfahren, wie schlimm es wirklich aussah, drehte mir den Magen um. Ich stellte die Waage auf den Küchenboden und tippte mit den Zehen auf die Trittfläche. Kurzes Warten, bis sie sich eingeschaltet hatte.
Durchatmen.
Flaues Gefühl im Magen ignorieren.
Ausatmen.
Jetzt nur nicht kneifen.
Einatmen.
Wird schon.
Ausatmen.
Mich mit der Hand am Küchentresen festhalten, erst den rechten Fuß auf die Waage, ausatmen, dann den linken Fuß.
Einatmen. Wie schlimm kann es schon kommen?! Solange es keine 200 Kilo sind, kriege ich das schon irgendwie hin.
Ich atmete ein letztes Mal aus und ließ den Tresen los.
Es gibt Sätze, die sollte man nicht einmal denken, denn immer wenn man meint, es würde schon nicht so schlimm werden, kommt es gerne erst mal ganz dicke.
Ab auf die Kartoffelwaage
Die Waage war kaputt.
Zumindest redete ich mir das ein, als sie plötzlich nur «Error» anzeigte. Kein Grund zur Panik, sie hatte ja lange herumgestanden, ich versuchte es einfach noch einmal. Wieder: Error.
Also stimmte wohl irgendwas nicht mit dem Gerät. Gut, sie ging auch nur bis 160 Kilo, und es konnte schon sein, dass ich ein wenig mehr wog, aber wahrscheinlich war sie einfach kaputt.
Ich besorgte mir noch am gleichen Tag eine neue Waage. Um genau zu sein, ließ ich sie besorgen, ich selbst kam ja kaum noch aus der Bude, und wenn, dann wäre ich ganz sicher nicht in einen Laden gegangen, um eine Waage zu kaufen. Es gibt ein paar Dinge, die macht eine fette Frau nicht. Oder nicht mehr. Waagen im Einzelhandel kaufen, Kniebeugen, Langstreckenläufe oder Pommes im Stehen an einem Stand essen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben.
Die neue Waage ging bis 180 Kilo und war eine Art Leihgabe, kaum benutzt, und sie funktionierte super, wie mir versichert wurde. Also stellte ich mich, noch immer sehr aufgeregt, ein weiteres Mal auf die hübsche Gewichtsmesserin und war gewappnet. Komme, was wolle, nun würde ich der Wahrheit in ihr hässliches Auge blicken! Und gleich danach könnte mich niemand mehr aufhalten, in spätestens einem Jahr würde ich schlank sein!
Error.
Gingen Waagen jetzt schon durch meine bloße Anwesenheit kaputt?
Nun hätte ich eigentlich langsam auf die Idee kommen können, dass ich schlicht zu schwer für eine normale Waage war – aber mir das einzugestehen war weitaus schwieriger, als erst einmal alles Mögliche zur Kontrolle zu wiegen. Seither weiß ich, dass eine Pfanne genau so viel wiegt wie drei Handtücher, eine Eieruhr, eine Hand voll Kaffeefilter und eine Packung Mozzarella zusammen. Man lernt ja nie aus.
Es nützte nichts. Entweder musste ich das Urteil der Waage persönlich nehmen – sie lachte mich aus! –, oder aber, und das war die wahrscheinlichere Variante, sie konnte aufgrund ihrer Einstellungen nicht anders. Es war zwecklos. Ich war offenbar doch schwerer als 180 Kilo, und auch wenn mir das tief in der schmerzenden Magengegend absolut klar war, warf es mich um.
Ich schleppte mich zurück ins Schlafzimmer und setzte mich auf meine knarzende Bettkante.
Ich hatte ein Problem.
Handelsübliche Personenwaagen wiegen tatsächlich nur bis 180 Kilo. Wenn man etwas mehr Geld ausgeben möchte, dann bekommt man eine, die bis 200 oder gar 250 Kilo anzeigt, aber dann ist Schluss. Ein Bekannter von mir, der in der Küche eines Krankenhauses arbeitete, berichtete mir einst laut lachend, dass sie einen Patienten auf der Kartoffelwaage gewogen hatten und dass Patienten, die selbst dafür zu schwer waren, auf einer Lkw-Waage ihr Gewicht bestimmen lassen mussten. Man setzt sich als fetter Mensch allerhand Unannehmlichkeiten aus in seinem Leben, aber die Vorstellung, jemanden zu bitten, mich auf einen Schrottplatz zu fahren, damit ich mich dort wiegen kann, sorgte dafür, dass sich mein Ego mit lautem Zetern und Kopfschütteln einen Strick knüpfte und schon einmal den Stuhl in die Zimmermitte rückte. Mit anderen Worten: unvorstellbar und hochnotpeinlich.
Ich habe heute ein Rückgrat aus Stahlbeton, aber auch heute würde ich diesen Weg nur unter Waffengewalt gehen.
Eine Bestellung im Internet, drei Tage und einen klingelnden Boten später war eine weitere, identische Waage bei mir eingetroffen. Ich nahm mir vor, mich auf zwei Waagen zu stellen. Irgendwas musste dabei ja herauskommen.
Tatsächlich stellte sich das Unterfangen als etwas komplizierter heraus, als ich gedacht hatte, zumal ich zum damaligen Zeitpunkt nicht länger als 10 Sekunden stehen konnte, ohne dass mein Rücken mich umbrachte. Ich hatte Angst vor dem Ergebnis und hoffte, das Wiegen würde irgendetwas ergeben, was ich in den Griff bekommen könnte. Irgendetwas, aber sicher nicht die über 300 Kilogramm, die das Display anzeigte.
Seither weiß ich, was es bedeutet, wenn einem vor Schreck die Luft wegbleibt. Dass ist nicht einfach nur eine Metapher. Meine Lunge sah diese Zahl allem Anschein nach auch, packte ihren Koffer, faltete sich zusammen und hinterließ mir einen Zettel auf dem Küchentisch, auf dem stand: Den Scheiß hier machst du mal schön alleine, ich bin weg, deine Lunge.
Das konnte schlicht nicht sein! Niemand wiegt über 300 Kilo! Und ich erst recht nicht. Können Menschen überhaupt so schwer werden?
Ich setzte mich auf den Küchenstuhl und rief einen Freund an, den ich noch aus Schulzeiten kenne. Physiker, Mathematiker und Pragmatiker. Er sollte mir erzählen, dass es da irgendwelche ominösen mathematischen Probleme gibt, weswegen ein Gewicht nicht korrekt auf zwei Waagen angezeigt werden könne, oder dass da irgendwas mit Reibung oder Licht oder einer Formel wäre, weswegen das so leider alles nicht ginge und das Ergebnis demnach zwangsläufig falsch wäre oder man pauschal immer 100 Kilo abziehen müsse. Natürlich fragte ich nicht für mich, sondern weil mich das, wie ich ihm versicherte, schon immer interessiert hatte und ich da eben im Fernsehen «so eine Doku» gesehen hatte und sich mir nun diese vollkommen alltägliche Frage stellte.
Seine Antwort war so simpel wie niederschmetternd. «Wenn beide Waagen intakt sind, werden die Ergebnisse auf nicht geeichten Waagen vielleicht minimal um ein paar 100 Gramm schwanken, aber generell ist es absolut kein Problem, und das Ergebnis ist auf zwei Waagen ebenso genau wie auf einer. Man sollte nur in der Lage sein, zwei Zahlen zu addieren.»
Das war genau das, was ich nicht hören wollte.
Ich bedankte mich, legte auf und fragte mich, was ich jetzt tun sollte.
Zweifelsohne wog ich doch ein bisschen mehr als 147 Kilo. Es waren um die 341,2 Kilo. Ich korrigierte zu meinen Gunsten auf 340, aber das machte den sprichwörtlichen Kohl auch nicht weniger fett.
Über 340 Kilo. Eine Zahl, so unvorstellbar wie Einhörner.
Fuck!
Was hat dich bloß so ruiniert?
Wenn uns im Leben etwas passiert, das wir als ungerechtfertigt, gemein oder schlicht schlimm empfinden, dann liegt es in unserer Natur, den Übeltäter fassen zu wollen, ihn zur Rede zu stellen, notfalls zu bestrafen und dafür im Austausch etwas zu bekommen, das wir Gerechtigkeit, Gewissheit oder zumindest Genugtuung nennen können. Kurzum, wenn dir jemand eine Tüte mit brennender Hundescheiße vor die Haustür stellt, willst du wissen, wer das war und wohin du die Rechnung für die Reinigung deiner Schuhe schicken kannst.
Meine Tüte voll brennender Scheiße wog 340 kg. Und wer hatte schuld?
Richtig! Der Hund!
Und der Tütenhersteller!
Und die Jungs aus der Steinzeit, die das mit dem Feuer entdeckt haben.
So zumindest war meine Argumentationskette zu diesem Zeitpunkt.
Dass ich derart schwer geworden war, hatte selbstverständlich erst einmal nichts mit mir zu tun. Wie gesagt, ich war die Königin des Selbstbeschisses und konnte glorreiche und zu Tränen rührende Geschichten darüber erzählen, wie fürchterlich es ist, wenn man als Kind schon Diäten machen muss, wie fies Ärzte zu mir waren und dass sie nie sehen wollten, dass nicht mein Gewicht schuld ist an meinen Schmerzen, sondern irgendeine, vielleicht noch nicht so bekannte Krankheit. Ich wollte nicht hören, dass ich abnehmen müsse, um meine Schmerzen zu lindern, ich war auch nicht zu dick für Autos, die Autoindustrie beschäftigte nur schlicht verdammte Gurt-Faschisten, und dass es überhaupt Drehkreuze gibt, war reine Schikane fetten Menschen gegenüber. Natürlich hätte ich zum Sport gehen können, aber wie denn, ich war ja erst zu arm und später zu dick für ein Auto, das mich dort hätte hinfahren können, und wer macht schon zu Hause oder draußen Sport? Außerdem muss man sich für Sport bewegen, und das nervt doch! Natürlich hätte ich mich auch besser ernähren können, aber ich aß doch sowieso schon kaum was, und die paar Mal, wenn es vielleicht ein bisschen zu viel gab, mein Gott, daran kann es doch nicht liegen! Außerdem war es gar nicht so einfach, sich gut zu ernähren, schließlich war Obst doch so teuer. Viel schlimmer aber war, dass ich doch so krank war. Ich habe es arg mit der Schilddrüse, Hashimoto-Thyreoiditis, eine Stoffwechselerkrankung, und habe ich nicht bei Dr. Google gelesen, das könne Gewichtszunahmen begünstigen? Ja bitte! Und dann habe ich noch PCOS