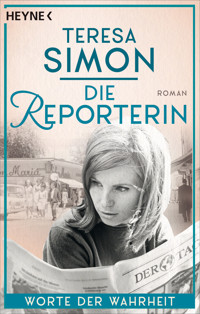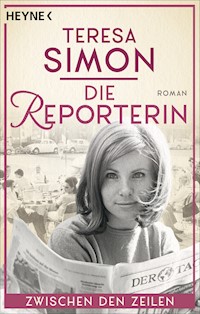9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine geheimnisvolle Schneekugel. Das Erbe einer starken Frau. Eine Liebe, die sich nie erfüllt hat.
Berlin 1936. Die Sängerin Luzie Kühn steht ganz am Anfang ihrer Karriere und träumt von einem Leben im Rampenlicht. Doch als Jüdin fühlt sie sich nicht mehr sicher und verlässt Berlin in Richtung Wien. Sie verliebt sich in den charismatischen Bela Król und schwebt im siebten Himmel, doch schon bald wird klar, dass Luzie auch in Wien nicht sicher ist ...
Berlin 2018. Paulina Willke wird von ihrer mütterlichen Freundin Antonia gebeten, in Wien ein Erbstück für sie abzuholen. Sie ahnt nicht, dass die Reise nach Wien ihr Leben verändern wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Eine geheimnisvolle Schneekugel. Das Erbe einer starken Frau. Eine Liebe, die sich nie erfüllt hat.
Berlin 1936. Die Sängerin Luzie Kühn steht ganz am Anfang ihrer Karriere und träumt von einem Leben im Rampenlicht. Doch als Jüdin fühlt sie sich nicht mehr sicher und verlässt Berlin in Richtung Wien. Sie verliebt sich in den charismatischen Bela Król und schwebt im siebten Himmel, doch schon bald wird klar, dass Luzie auch in Wien nicht sicher ist …
Berlin 2018. Paulina Willke wird von ihrer mütterlichen Freundin Antonia gebeten, in Wien ein Erbstück für sie abzuholen. Sie ahnt nicht, dass die Reise nach Wien ihr Leben verändern wird …
Die Autorin
Teresa Simon ist das Pseudonym einer bekannten deutschen Autorin. Sie reist gerne (auch in die Vergangenheit), ist neugierig auf ungewöhnliche Schicksale, hat ein Faible für Katzen, bewundert alles, was grünt und blüht, und lässt sich immer wieder von stimmungsvollen historischen Schauplätzen inspirieren.
Lieferbare Titel
Die Frauen der Rosenvilla Die HolunderschwesternDie Oleanderfrauen
TERESA SIMON
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Für Lilly
Das Glück is a Vogerl,gar liab, aber scheu,es lasst si schwer fangen,aber fortg’flogn is glei.Das Herz is der Käfig,und schaust net dazua,so hast du auf amal dannka Glück und ka Ruah.
Wiener Lied, Alexander von Biczo, (1868–1935)
Prolog
Berlin, Herbst 1999
Das Kruschtelzimmer am Ende des langen Flurs ist Paulinas heimliches Paradies. Früher hat es ihrem Vater gehört, und noch immer meint sie dort eine Spur seines englischen Pfeifentabaks zu riechen. Dabei ist er doch schon vor vielen Monaten gestorben. Mamasi, wie sie ihre Mutter Simone nennt, hat es seitdem mit Beschlag belegt – fliederfarbene Wände, ihre antike Nähmaschine, der große Korb voller Wollknäuel und ein zierlicher Sekretär unter dem Fenster zeugen davon.
Aber es gibt nach wie vor Papas Regale und Vitrinen, in denen seine Ammoniten stehen, die funkelnden Kristalldrusen, und jene famose Blechspielzeugsammlung, die so kostbar ist, dass Paulina sie früher nur anschauen, aber auf keinen Fall anfassen durfte.
Heute erschafft sie aus alldem ihre eigenen Welten, sobald die Mutter bei der Arbeit und sie zu Hause ungestört ist. Den Freundinnen verrät die Elfjährige nichts davon, weil die anderen Mädchen sie sonst kindisch finden könnten. Dabei ist es doch so aufregend und jeden Tag wieder ganz anders! Aus ein paar Edelsteinen und Stoffresten hat sie eine kleine Theaterbühne gezaubert, auf der sie die bunten Figürchen auftreten lässt. Sie reden so, wie es Paulina in den Sinn kommt, und sagen all jene Dinge, die sie selbst lieber hinunterschluckt, um ihre Mamasi nicht noch trauriger zu machen.
Dass sie Angst vor dem Umzug hat, weil sie dann in eine neue Schule muss.
Dass sie mit Herz und Seele an dieser geräumigen Altbauwohnung hängt und sich nicht vorstellen kann, künftig in viel kleineren Räumen zu leben.
Dass sie jeden Abend im Bett vor dem Einschlafen weinen muss, weil Papas Bart sie nicht mehr beim Gute-Nacht-Kuss kitzelt.
Dass sie ihre heitere, stets gut aufgelegte Mutter wieder zurückhaben möchte, die jede Angst wegbläst.
Und wie sehr Paulina es hasst, dass ihre Mamasi auf einmal Geheimnisse vor ihr hat.
Um sich vor weiteren Überraschungen zu wappnen, durchforstet sie seit Neuestem sogar deren Handtasche, wann immer sich die Möglichkeit dazu ergibt. Leider hat sie bislang noch nichts von Bedeutung gefunden, doch Paulina studiert trotzdem selbst die allerkleinsten Notizen eingehend.
Mit Toni reden?, steht beispielsweise auf einem verknitterten gelben Post-it.
Aber warum schreibt sie sich das auf?
Mit Antonia, die in Potsdam lebt, reden sie doch ohnehin dauernd. Die ältere Dame ist für Paulina so etwas wie eine Wahloma, da sie keine eigenen Großeltern mehr hat, und seit Papas Tod sind sie sogar noch häufiger mit ihr zusammen.
Sie müsste Mamasi fragen.
Doch dann wüsste die ja, dass sie heimlich in ihrer Tasche kramt …
Seufzend setzt sich Paulina an den Sekretär und zieht nur mal für alle Fälle an der Schublade.
Unverschlossen!
Sie ist so verblüfft, dass sie für einen Moment erstarrt. Dann jedoch fasst sie sich wieder und öffnet die Schublade ganz.
Es riecht ein wenig bitter nach vergossener Tinte. Vorne liegen ein paar gespitzte Buntstifte und ein altes Holzlineal, das bei Zentimeter 15 abgebrochen ist. Als sie ein wenig tiefer tastet, berühren ihre Finger Papier, so weich, als hätte jemand es viele Male in der Hand gehabt. Gebraucht und geliebt, muss Paulina unwillkürlich denken, dann zieht sie es hervor und faltet es auf.
Eine runde Handschrift mit großzügigen Unterlängen, die sie auf Anhieb mag. Die türkisfarbene Tinte ist schon leicht verblasst, aber noch immer gut lesbar.
Jetzt wird auch noch die Zeit zu unserer Feindin, geliebte Freundin …
Paulina lässt das Blatt sinken.
Ein Brief also. Von klein auf haben die Eltern ihr eingeschärft, dass man das Briefgeheimnis unter allen Umständen wahren muss und Schreiben, die an andere Menschen gerichtet sind, tabu sind. Sie müsste ihn also sofort wieder zurücklegen und die Schublade zuziehen. Paulina beginnt, sich am Nasenflügel zu kratzen, wie immer, wenn sie verlegen wird.
Aber sie ist schon zu weit gegangen, um jetzt noch zurückzukönnen. Die Neugierde ist einfach übermächtig.
Sie beginnt noch einmal ganz von vorn.
Jetzt wird auch noch die Zeit zu unserer Feindin, geliebte Freundin, dabei hatten wir uns alles so perfekt ausgemalt. Doch mein bockiger Körper hält sich leider nicht an unseren genialen Plan. Es wird schneller gehen, als wir gedacht hatten, das haben sie mir heute mitgeteilt, in jener aalglatten medizinischen Betroffenheit, mit der sie vielleicht andere hinters Licht führen können, aber nicht mich.
Wen schert es hier schon, was aus mir wird?
Störrische Patienten sind alles andere als beliebt, und ich habe mir mehr als einmal erlaubt, gegen die Ärzte aufzubegehren. Wäre es nach ihren Ratschlägen gegangen, hätten sie das kleine Wesen, das in mir wächst, schon vor Monaten entsorgt.
Dieses Kind wird Sie das Leben kosten …
Doch wie hätte ich mich noch von ihm trennen können, als ich nach Wochen widerlichster Übelkeit zum ersten Mal in mir sein zartes Flügelschlagen wie ein freundliches Hallo gespürt habe?
Natürlich wusste ich von dem gefräßigen Monster in meiner linken Brust, das die gesunden Zellen angreift und mich über kurz oder lang ganz verschlingen wird, und es gab viele Morgen, an denen ich so traurig und zerschlagen erwacht bin, dass ich nicht mehr weiterwusste. Doch dann kamst du ins Spiel, mit deiner Frische, deiner Großzügigkeit, deinem nie endenden Mut. Das hat mich gerettet.
Wir beide zusammen gegen den Rest der Welt – so lautete unser Motto. Und für ein paar wunderbare atemlose Monate, in denen wir jede Menge Unsinn angestellt und einträchtig nebeneinander die Entwicklung der Ultraschallbilder studiert haben, schien es auch zu funktionieren.
Nun aber hat mich die rabenschwarze Diagnose wieder eingeholt, und ich bin nichts als ein einziges heulendes Häuflein Elend. Nicht dabei sein zu können, wenn ihre Zähnchen kommen, sie zu laufen beginnt, Rad fahren und Schwimmen lernt, wenn sie eingeschult wird und sich zum ersten Mal unsterblich verliebt, erscheint mir unerträglich. Die ganze Welt wollte ich ihr zu Füßen legen und vermag doch rein gar nichts mehr davon in meinem elenden Zustand.
Ich weiß, dass sie bestens behütet ist, aber sie wird das alles ohne mich erleben, das macht es so schwer.
Nicht einmal bis zum Ende der Schwangerschaft darf sie bei mir bleiben, das haben sie mir heute ebenfalls verkündet. Das Würmchen muss jetzt schon aus dem Mutterleib, vor der eigentlichen Zeit, hinaus aus der dunklen, warmen, schützenden Hülle in die grelle, kalte Welt, damit wenigstens sie eine Chance hat.
Und ich? Was wird aus mir?
Mit einem Mal habe ich große Angst vor dem Sterben, obwohl viele ja behaupten, der Körper fahre in jener letzten Phase sein eigenes Programm, eine Art langsames Herunterdimmen, ohne Pein, ohne große Schmerzen, langsam, beinahe sachte. Aber vielleicht ist das nichts als freundliche Propaganda, ein wohlgemeinter Versuch, um den Abschied vom Leben nicht noch schwerer zu machen – und jemanden, der das wahrhaftig aus eigener Erfahrung bezeugen könnte, gibt es ja leider nicht.
Man ist so verdammt allein dabei, einsam auf weiter Strecke sozusagen, und das ist vielleicht das Schlimmste daran. Ich fühle das Dunkel wie einen Meteor auf mich zurasen und klammere mich verzweifelt an alles Tröstliche, das mir in den Sinn kommt: freundliche Erinnerungen, spannende Begegnungen, kluge Sätze aus Büchern, die ich mir aufgeschrieben hatte, Witze, über die ich einmal lachen musste, Fotos, die Gnade vor meinen Augen fanden, was selten genug vorkam.
Von irgendwoher ertönt Klaviermusik, wahrscheinlich aus dem hintersten Zimmer, in dem die Angehörigen Luft holen können, bevor sie wieder zu den Sterbenden hineingehen, ein altes Rhythm & Blues-Stück, das mir in die Beine fährt, die mich nicht mehr tragen wollen, und für ein paar Augenblicke fühle ich mich besser.
Doch viel zu schnell bricht der Song wieder ab, und erneut stürzt alles auf mich ein.
Die Schnodderschnauze, mit der ich viele verletzt habe, besonders jene, die mir nahestanden, ist mir schon vor geraumer Zeit abhandengekommen. Und das Bedürfnis, unbedingt immer cool sein zu müssen, liegt ebenfalls weit hinter mir. Dafür steigen Empfindungen in mir auf, so tief und wahrhaftig, wie ich sie noch nie zuvor erlebt habe.
Zurück in die Vergangenheit kann ich nicht mehr, dafür habe ich selbst gesorgt, weil alle Brücken abgerissen sind. Eine Zukunft gibt es für mich nicht, wenn ich den Ärzten glauben kann. Doch in der Gegenwart bist du es, geliebte Freundin, deren Namen ich wie ein Mantra immer wieder vor mich hin flüstere.
S & L.
Du & ich.
Der Himmel hat dich geschickt. Keine Schwester könnte mir näher sein …
»Paulina? Wo steckst du denn?«
Sie sitzt noch immer vor dem Brief, den sie nicht ganz verstanden hat, so benommen, dass sie ihn nicht rechtzeitig verstecken kann, bevor die Mutter im Zimmer steht. Mit einem Blick erfasst diese die Situation, zieht ihre Tochter vom Stuhl hoch und umarmt sie zärtlich, während sie das Schreiben unauffällig an sich nimmt.
»Was ist das, Mamasi?«, flüstert Paulina. »Das ist ja so traurig und gleichzeitig so wunderschön.«
»Ja, das ist es. Und sicherlich nicht die richtige Lektüre für neugierige kleine Mädchen.«
»Ist sie wirklich gestorben?«
»Leider. Schon vor vielen, vielen Jahren.«
»Wer war sie?«, will Paulina weiter wissen.
»Ein wundervoller Mensch. Sie kennen zu dürfen, war eine besondere Ehre.«
»Erzählst du mir von ihr?«
»Das werde ich. Eines Tages, wenn du alt genug dazu bist.«
»Alles? Großes Ehrenwort?«
»Alles, meine Kleine. Großes Ehrenwort.«
1
Berlin/Wien, Mai 2018
Paulina Wilke kam erst wieder richtig dazu durchzuatmen, als sie auf ihrem Platz in der Ersten Klasse des ICE 93 saß. Sie war tatsächlich auf dem Weg nach Wien, worum Antonia sie gebeten hatte. Toni, wie alle sie nannten, gehörte zur Familie, seit Paulina denken konnte, dabei waren sie ja eigentlich gar nicht miteinander verwandt. Doch Toni hatte ihr immer wieder Naschgroschen zugesteckt, ihr stundenlang vorgelesen und war bereitwillig als Babysitter eingesprungen, wenn die Eltern etwas vorgehabt hatten. Paulina hatte es geliebt, in Tonis verwinkeltem Häuschen übernachten zu dürfen, das in Potsdam im Holländischen Viertel stand. Vielleicht, weil dort die Wände mit bunten Zeichnungen bedeckt waren, die von Tonis eigener Hand stammten. Sogar die Bettwäsche hatte sie selbst entworfen, und so zog sich über Kissen und Plumeau ein Reigen fantastischer Gestalten, die sich mehr als einmal in Paulinas Kinderträume gestohlen hatten.
Schon der Dreijährigen hatte Toni Buntstifte in die Hand gedrückt, blütenweißes Papier vor ihr ausgebreitet und jeden Kringel freudig begrüßt. Später hatten sie oft Seite an Seite gezeichnet, und jene langen sonnendurchfluteten Nachmittage gehörten zu Paulinas kostbarsten Kindheitserinnerungen. Nie hätte Toni ihr geholfen oder gar die Hand geführt, und doch genügte ihre Nähe, um sich sicherer zu fühlen und an Motive zu wagen, die sie allein niemals zustande gebracht hätte.
»Du hast geschickte Hände und einen klugen Kopf«, hatte Toni anerkennend geäußert, da war Paulina erst sieben gewesen. »Wenn du beides kombinierst, muss man sich später keine Sorgen um dich machen.«
Sie wusste, wovon sie sprach, denn Zeichnen bedeutete für sie ebenso Leidenschaft wie Profession; ein ganzes Bücherregal, gefüllt mit eigenen Werken, kündete davon. Weit über das übliche Renteneintrittsalter hinaus war Toni Ostermann noch immer als Illustratorin erfolgreich, weil die Verlage ihre ungewöhnlichen Zeichnungen nicht missen wollten. Doch in den vergangenen beiden Jahren hatten ein fortschreitendes Rückenleiden sowie Herzrhythmusstörungen und gelegentlich auftretendes Vorhofflimmern sie gezwungen, aus gesundheitlichen Gründen deutlich kürzer zu treten. Mittlerweile konnte sie keine langen Strecken mehr ohne Schmerzen zurücklegen, und auch beim Treppensteigen japste sie viel zu schnell nach Luft. Eigentlich hätte sie am besten gar nicht mehr arbeiten sollen, aber das brachte sie nicht fertig, und so nahm sie nur noch ausgewählte Aufträge an, jene, an denen ihr am meisten lag.
»Ist doch sonst schon wie im Grab. Ausruhen kann man sich noch lang genug, wenn man einmal tot ist!«
Mit einer ausladenden Geste wischte sie all die gut gemeinten ärztlichen Ratschläge wie ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung ohne ihren geliebten Weißwein und regelmäßige Krankengymnastik vom Tisch, und das so lebhaft und charmant, dass niemand ihr böse sein konnte. Ein Quirl wie Toni Ostermann ließ sich die Lust am Leben eben nicht verbieten – nicht bis zum letzten Atemzug.
Gestern allerdings hatte ihre Stimme am Telefon aufgeregt geklungen, fast schon schrill.
»Kannst du bitte gleich kommen, Paulina?«
»Ist etwas passiert?«, fragte diese alarmiert zurück.
»Allerdings. In der Post war heute so ein seltsamer Brief aus Wien. Angeblich eine Art Vermächtnis, das mit mir zu tun haben soll. Und jetzt brauche ich dringend deinen schlauen jungen Kopf, damit ich altes Mütterchen nicht von irgendwelchen ausgebufften Erbschleichern über den Tisch gezogen werde.«
Kein Mensch wäre auf die Idee verfallen, die Fünfundsiebzigjährige als altes Mütterchen zu bezeichnen. Mit ihrem Faible für japanische Designermode, dem fedrig geschnittenen weißen Haar und den dicken Ketten aus Koralle, Bernstein oder Türkis, die sie am liebsten lagenweise trug, fiel sie überall auf, so klein und zart, wie sie war. Beim lebhaften Gestikulieren, das zu Toni gehörte, klimperten die vielen Armreifen, die sie nicht einmal zum Zeichnen ablegte. Geistig hellwach, konnte sie mit ihrem Wissen und dem bisweilen reichlich schwarzen Humor ganze Tischgesellschaften unterhalten. Ihr Koboldlachen, mit dem sie alles Unangenehme zum Schrumpfen brachte, war legendär. Besonders gerührt aber war Paulina, wenn Toni in ihrer ehrenamtlichen Funktion als Lesepatin fungierte und Kinder jeden Alters fasziniert an ihren Lippen hingen, während sie von ihr auf unwiderstehliche Weise in die Welt der Fantasie entführt wurden.
Allein die Vorstellung, diese wunderbare Mentorin für alle Lebenslagen jemals zu verlieren, ließ Paulina die Kehle eng werden. Und so fuhr sie auf ihrer knallroten Elektro-Schwalbe gleich nach dem Anruf nach Potsdam, trank dort Tonis eigenwilligen Minztee und las das Schreiben aus Wien dreimal hintereinander sorgfältig durch.
»Also, Erbschleicher sind diese Brunners aus Wien schon mal nicht, denn die wollen dir ja nichts wegnehmen, sondern dir etwas geben«, sagte Paulina erleichtert. »Hast du den Namen Peter Matusek, von dem hier die Rede ist, schon mal gehört?«
»Niemals!« Tonis Armreifen stimmten ein kurzes Konzert an, so aufgeregt war sie. »Das habe ich seiner Tochter auch gesagt, dieser Lena Brunner, die mir geschrieben hat. Ganz spontan habe ich sie vorhin angerufen, gleich, nachdem wir beide miteinander gesprochen hatten. Sie war reizend – allein dieser umwerfende Dialekt, den man sonst nur aus dem Fernsehen kennt! –, aber so richtig mit der Sprache rausrücken wollte sie nicht. Ich müsse nach Wien kommen und sei natürlich herzlichst eingeladen, bei ihnen zu wohnen. Dort und nur dort könne sie mir die Hinterlassenschaft ihres Vaters übergeben.«
Jetzt klang Toni richtig erschöpft.
»So eine Reise nach Wien ist für mich jedoch bis auf Weiteres ein Ding der Unmöglichkeit. Fliegen darf ich wegen der Thrombosegefahr ohnehin nicht, und eine Zugfahrt von mehr als acht Stunden? Ausgeschlossen! Das schaffe ich einfach nicht mehr. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass jetzt auf einmal sogar von einem Herzschrittmacher die Rede ist? Angeblich würde ich mich dann besser fühlen. Aber da habe ich schließlich auch noch ein Wörtchen mitzureden!«
»Vielleicht gar keine so schlechte Idee«, sagte Paulina. »Lass uns in Ruhe darüber beraten, sobald Simone wieder aus Italien zurück ist.«
»Das machen wir.« Der Blick der blassblauen Augen wurde zwingend. »Frage: Würdest du vielleicht an meiner Stelle nach Wien fahren? Sozusagen als meine Botschafterin? Mir ist schon klar, was ich da von dir verlange, aber ich weiß momentan keine andere Lösung.«
Im letzten Jahr hatte Paulina wegen der Krise mit Bruno nur fünf Tage Urlaub genommen, und selbst die hatten ihre Streitereien ordentlich verhagelt. Ein wenig Erholung konnte also nicht schaden. Außerdem gab es kaum einen Wunsch, den sie Toni abschlagen würde – trotz ihrer alten Angst, mit der sie noch immer fertigwerden musste.
»Ja«, erwiderte sie lächelnd. »Für dich doch immer.«
Lena Brunner war einverstanden, nachdem Toni und Paulina ihr unisono versichert hatten, wie nah sie sich standen.
Und so saß Paulina nun in diesem noblen Triebwagen mit der grauen Polsterung, die eine Paspelierung in Pink modern machen sollte. Noch nie zuvor war sie derart feudal verreist, aber Toni hatte darauf bestanden, ihr diese Fahrkarte zu buchen, wenn sie schon nicht fliegen wollte, und ihr zusätzlich Geld für die »Wiener Ausgaben« in die Hand gedrückt, wie sie es nannte. Vorhin hatte alles sehr schnell gehen müssen, weil sie gestern im Vorreisefieber lange nicht hatte einschlafen können und den morgendlichen Wecker um ein Haar überhört hätte. Im buchstäblich letzten Moment war noch die alte Schneekugel mit dem Wiener Riesenrad, die Paulina schon seit Kindertagen begleitete, in ihrem Rucksack gelandet.
Außer ihr saß nur noch ein weiterer Fahrgast im Abteil, ein Mann mit grau melierten Locken und Dreitagebart, der ihr direkt gegenübersaß und ihr nur kurz zugenickt hatte, um sich dann sofort wieder in sein Lesegerät zu vertiefen. Neben ihr lag eine mehrseitige Speisekarte, durchaus verheißungsvoll, die sie vorerst jedoch geschlossen ließ, weil ihr Magen in der Regel erst später wach wurde. Nach der Fahrscheinkontrolle schloss Paulina kurz die Augen und nickte dann tatsächlich ein.
Sie wurde erst wieder wach, als der Zug in Erfurt hielt – ziemlich verlegen, weil sie nicht gern in Gegenwart fremder Menschen schlief. Doch ihr Gegenüber war noch immer mit Lesen beschäftigt und schien sich gar nicht um sie zu kümmern.
Erleichtert zog Paulina einen Taschenspiegel aus dem silbermetallicfarbenen Rucksack. Wie zu erwarten, war ihr Augen-Make-up wieder einmal leicht verschmiert, was sich mithilfe des Kajalstifts jedoch leicht beheben ließ. Sonst mochte sie, was sie da sah: kurze, verwuschelte Haare, deutlich blonder, als die Natur sie ihr eigentlich zugedacht hatte, lagunenblaue Augen, die ein dunkler Wimpernkranz unterstrich, schmale Wangen und ein sinnlicher Mund mit schön geschwungenem Amorbogen, der gerne lachte. Nur mit der Nase, die ihr zu prominent erschien, haderte sie gelegentlich, heute jedoch fand sie sie ganz okay.
Sie nahm den Wien-Führer, den sie noch auf die Schnelle gekauft hatte, aus der Seitentasche und begann, darin zu blättern.
»Zum ersten Mal auf dem Weg nach Wien?«, fragte ihr Mitreisender nach einer Weile.
»Ganz genau. Geplant war es schon öfter, aber dann ist immer etwas dazwischengekommen. Und Sie?«
Sein markantes Gesicht verschloss sich.
»Meine Vorfahren stammen ursprünglich aus Ungarn und haben über hundert Jahre in Wien gelebt. Heute sind unsere Verwandten in alle Himmelsrichtungen verstreut. Manche sind sogar da gestrandet, wo sie niemals sein wollten. Sozusagen der Furor des 20. Jahrhunderts. Uns hat er mitten ins Herz getroffen.«
Es klang wie eine Anklage, die da ganz unvermutet aus ihm herausgebrochen war, und vermutlich war es das ja auch.
Was sollte sie darauf antworten?
Mit Banalitäten wäre keinem von ihnen gedient. Deshalb schwieg Paulina und beschränkte sich darauf, ihn aufmerksam anzusehen.
»Beruflich oder eher privat?«, fragte er weiter, als sei er froh, von sich ablenken zu können.
Dabei starrte er auf ihre kurzen Fingernägel, von denen jeder in einer anderen leuchtenden Farbe lackiert war, was sie heimlich amüsierte. Wahrscheinlich hielt er sie für ein Hippie-Mädchen, wie viele andere auch, die sie zum ersten Mal sahen und aus ihrer Aufmachung aus Ripped Jeans, abgewetzter Nietenlederjacke und einem halben Dutzend Ibiza-Armbändern die falschen Schlüsse zogen. Wegen ihrer Schlaksigkeit wurde sie oft jünger als dreißig geschätzt; neulich erst hatte der Türsteher vor dem neuen Club in Mitte sogar nach ihrem Ausweis gefragt. Dabei stand Paulina seit Jahren mit beiden Beinen fest im Berufsleben und war sogar gerade dabei, sich mit ihren Aktionen in Berlin und darüber hinaus einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erobern.
»Sehr privat«, sagte sie lächelnd, weil sie an Toni denken musste, die ihr vertraute. »Familienangelegenheiten.«
»Dann sollten Sie sich von Ihren Verwandten unbedingt zum Hofzuckerbäcker Demel am Kohlmarkt führen lassen und Sachertorte bestellen. Die schmeckt dort noch um Klassen besser als im Café Sacher selbst.«
Paulina zog die Schultern hoch.
»Leider steh ich aber so gar nicht auf Sachertorte«, sagte sie.
»Dann eben Apfelstrudel. Oder den mit Mohn. Oder irgendeine andere Mehlspeise. Eigentlich schmeckt dort alles vorzüglich. Ganz hinten im Erdgeschoss können Sie durch eine Glaswand sogar in die Backstube schauen, die im überdachten Innenhof liegt, und dabei zusehen, wie diese Köstlichkeiten entstehen. Und wenn Sie ein besonderes Geheimnis hören wollen: Vom Demel aus führt ein unterirdischer Gang direkt ins Burgtheater. Auf diese Weise konnte Kaiserin Elisabeth – also Sissi – während der Vorstellungen ungestört Veilchenkonfekt naschen, ohne dass andere ihr beim Essen zusahen, was sie so gar nicht mochte.«
»Ich spekuliere, ehrlich gesagt, eher auf ein echtes Wiener Schnitzel«, gestand Paulina, »schön kross goldbraun in Butterschmalz ausgebraten, mit Kartoffelsalat …«
»Erdäpfelsalat«, korrigierte er. »So heißt das bei uns in Wien.«
»Auch recht, wenn es nur schmeckt.« Sie lachte. »Ich fürchte, mein Wienbild ist ohnehin denkbar simpel gestrickt: Neujahrskonzert, Opernball mit diesem Mörtel oder wie dieser schreckliche Kerl wirklich heißt, weißer Flieder, Lipizzaner, Sissi rauf und runter, Kaffeehäuser, die wunderbare Bibi aus dem ORF-Tatort, Vorstadtweiber, eine Fernsehserie, die ich grandios finde, Zentralfriedhof – und nicht zu vergessen natürlich das hier: das große Riesenrad aus dem Prater.« Sie holte die Schneekugel aus dem Rucksack.
»Hübsch«, sagte er. »Sieht ziemlich alt aus. Woher haben Sie die?«
»Das ist mein Talisman. Hat früher meiner Mutter gehört und ging dann weiter an mich, als ich zur Welt kam. Unten ist die Jahreszahl 1936 eingraviert, sehen Sie? Damals gab es weder Sie noch mich.«
Paulina lächelte, ihr Gegenüber dagegen blickte eher grimmig drein.
»Allerdings haben Sie bei Ihrer Aufzählung über Wien ein paar Kleinigkeiten vergessen«, sagte er. »Sigmund Freud zum Beispiel, Alfred Adler, Viktor Frankl, die Maler Klimt und Schiele, um nur einige wenige zu nennen, Autoren wie Stefan Zweig, Franz Werfel, Arthur Schnitzler, Hilde Spiel, Vicky Baum oder die Musiker Gustav Mahler, Emmerich Kálmán und Leo Fall.«
»Mir hinlänglich bekannt«, erwiderte Paulina ein wenig scharf, weil es sie ärgerte, dass er ihre Ironie nicht kapiert hatte. »Stellen Sie sich vor, ich weiß sogar, dass Mozart in Wien gestorben ist, und wer Friedensreich Hundertwasser und Oskar Kokoschka waren. Ich liebe die Romane von Joseph Roth, Elias Canetti und Hermann Broch, habe Qualtingers Der Herr Karl auf DVD und höre ab zu gern mal die frühen Heller-Chansons. Die meisten dieser famosen Künstler waren Juden, wollten Sie mir das sagen? Ja, das waren sie – und ohne sie gäbe es nicht das Wien, das die ganze Welt heute so fasziniert.«
»Jetzt habe ich Sie gekränkt«, sagte er, und klang zum ersten Mal richtig liebenswürdig. »Das lag nicht in meiner Absicht.«
»Ach, nein?«, gab sie zurück. »Der ahnungslosen Berliner Tussi mal so richtig Kultur einschenken? Ihre Augen haben gerade noch verräterisch geglitzert.«
»Das mit der Tussi haben Sie gesagt«, wehrte er sich.
»Und Sie gedacht. Geben Sie es ruhig zu!« Paulina hatte ihre Lockerheit wieder zurück. »Dabei bin ich eigentlich alles andere als eine Tussi.«
»Was sind Sie dann?«
Sie ließ sich Zeit mit ihrer Antwort. Aus irgendeinem Grund lag ihr daran, dass er sie mochte. Wie alt konnte er sein? Schwer zu schätzen, irgendetwas um die vierzig.
»Auf der Suche«, sagte sie schließlich. »Das trifft es vielleicht am besten. Kunst hilft mir dabei, egal, in welcher Form. Sie zu erleben, ist für mich wie Atmen, ein tiefes Inhalieren, so lange, bis ich satt bin. Dann setzt sich das Gesehene und Gehörte in mir ab, trudelt nach unten und verdichtet sich im Lauf der Zeit zu einer Art Sediment. Um eines Tages in gewandelter Form in meiner Arbeit wieder aufzutauchen. Ich bin manchmal selbst erstaunt, was da wieder nach oben strebt.«
Jetzt besaß sie sein ganzes Interesse. Er beugte sich ein Stück nach vorn.
»Das klingt aber spannend. Darf ich fragen, was Sie machen?«
»Träume«, sagte Paulina. »Ich fabriziere Träume.«
»Träume«, wiederholte er perplex. »Und was darf ich mir darunter vorstellen?«
»Was immer Sie wollen. Denn mehr dazu verrate ich jetzt nicht. Erzählen Sie mir lieber noch mehr über Wien. Für mich hört es sich so an, als wüssten Sie jede Menge darüber!«
Nach einem anregenden Gespräch machte er sich in Nürnberg zum Aussteigen bereit. Paulina hatte sich zwischendrin mit Milchkaffee und einem Curryhuhn-Sandwich gestärkt, während er bei stillem Wasser geblieben war. Wenn sie all das unternehmen wollte, was er ihr vorgeschlagen hatte, müsste sie ihren Aufenthalt in Wien auf Monate ausdehnen, wenn nicht länger, aber es war dennoch überaus spannend gewesen, ihm zuzuhören. Was er nicht alles wusste! Wie ein wandelndes Lexikon war er ihr vorgekommen. Auf seine Frage hin hatte sie ihm ihren Namen verraten, aber leider versäumt nachzufragen, wie er hieß.
Schon im Stehen holte er das nun nach, indem er eine Visitenkarte aus der Brieftasche zog und sie ihr reichte.
»Wie lange werden Sie in Wien bleiben, Frau Wilke?«
»Kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Ich denke, höchstens ein paar Tage.«
»Ich bin ab übermorgen wieder dort. Melden Sie sich, falls Sie Lust auf weitere Kulturinfusionen verspüren.« Sein Grinsen war plötzlich spitzbübisch. »Oder sonst etwas brauchen sollten. Was woaß ma scho? Hat mich übrigens sehr gefreut. Auf Wiedersehen und baba.«
Dr. Viktor C. Bárány, las sie. Rechtsanwalt. Kärntnerstraße 26, Wien, I.
Der erste Bezirk lag direkt in der Innenstadt, wie ihr der Stadtplan verriet, der hinten im Reiseführer eingeheftet war – aber in Wien gab es 23 Bezirke!
Paulina spürte, wie leise Panik sie erfasste.
Du musst dich nicht auf Anhieb allein in der Stadt zurechtfinden, dachte sie. Lena Brunner holt dich erst einmal vom Bahnhof ab. Hellblaues Kleid, braunes kinnlanges Haar, nicht mehr ganz jung.
Du wirst sie auf Anhieb erkennen.
Doch das mulmige Gefühl hielt sich hartnäckig, und Paulina wusste auch, weshalb. In den letzten vier Jahren hatte Bruno dafür gesorgt, dass sie ihr avisiertes Ziel erreichten, wenn sie gemeinsam auf Reisen waren. Hundertprozentig hatte sie sich dabei auf ihn verlassen können, immer und überall, und ohne ihn fühlte sie sich nun noch hilfloser als zuvor. Andere mochten unter Höhenangst oder Klaustrophobie leiden, bei ihr war es die Unfähigkeit, sich an fremden Orten allein zurechtzufinden. Natürlich verbarg sie diese Schwäche vor den allermeisten, weil sie so gar nicht zu ihrem sonst so selbstbewussten Auftreten passte. Man musste Paulina schon sehr nahekommen, damit sie sich offenbarte, und selbst dann tat sie es allenfalls zögerlich, weil sie sich dafür schämte. Oft schon hatte sie gegrübelt, woher dieses Manko rühren mochte, ohne bislang zu einer brauchbaren Antwort zu gelangen.
Tief in ihr gab es jedenfalls einen schwarzen Fleck, das spürte sie, eine Art Verlies, das sie in Angst versetzte, sobald sie ihm zu nahe kam. Es besaß die Macht, sie auszulöschen, so jedenfalls fühlte es sich an, und wenn sie irgendwann verloren ging, wie es ihr zum Beispiel einmal als Vorschulkind an einer Haltestelle passiert war, weil der Bus zu schnell abgefahren war, reagierte sie vollkommen panisch. Unfähig zu reden, ja, sich in irgendeiner Art zu bewegen, hatte sie damals in Stockstarre verharrt, bis ihre Mutter angelaufen gekommen war und sie tröstend in die Arme geschlossen hatte. Erst da hatte sie weinen können und sich wieder erlöst und geborgen gefühlt.
Vielleicht war das ja auch einer der Gründe, warum sie die Trennung mit Bruno noch immer nicht konsequent vollzogen hatte, obwohl die schwelende Dauerkrise zwischen ihnen enervierend war: ihre Angst, nicht mehr zu existieren, wenn er sie verließ.
Waren sie eigentlich überhaupt noch ein Paar, das nur eine längere Auszeit genommen hatte?
Paulina hätte es nicht genau sagen können.
Zum Glück war er gerade mit einem Freund zum Wandern auf La Gomera und ließ sie, abgesehen von ein paar knappen WhatsApps, in Frieden. Seit ein paar Tagen hatte er sich gar nicht mehr gemeldet. Vielleicht hatte Bruno ja auf der Insel, die so viele Aussteiger aus der ganzen Welt anzog, eine neue Frau kennengelernt und schwelgte in jungem Liebesglück …
Gefiel ihr auch nicht, diese Vorstellung, wie sie sich eingestehen musste, obwohl dann zumindest endlich Klarheit geherrscht hätte. Auf jeden Fall würde sie Bruno erst erzählen, dass sie in Wien war, wenn er wieder etwas von sich hören ließ.
Und noch jemand ahnte nichts von ihrer Unternehmung: Simone, ihre Mutter, der sie für gewöhnlich fast alles aus ihrem Leben erzählte. Ihre Bindung war seit jeher innig gewesen; seit dem Tod des Vaters vor nunmehr fast zwanzig Jahren waren Tochter und Mutter noch enger zusammengerückt. Erst vorgestern war Letztere zu einer vierzehntägigen Pilgerwanderung in Italien aufgebrochen. Nach Jahren ohne Urlaub hatte sie es erstmals gewagt, ihr Geschäft Tolle Wolle für zwei Wochen einer Vertretung zu überlassen, um sich einen Traum zu verwirklichen – den rund fünfhundert Kilometer langen Franziskusweg von Assisi bis in die Ewige Stadt zu laufen. Geplant waren zwei Etappen, die eine in diesem Jahr, die andere im nächsten.
»Ich wollte schon lange einmal in Ruhe über einige Dinge in meinem Leben nachdenken«, hatte sie ihrer Tochter gesagt, die zunächst mit Erstaunen reagiert hatte, weil die Mutter alles andere als religiös war. »Und das kann ich nun einmal beim Laufen am besten. Heike kommt mit, die ist keine Quasselstrippe, wie du weißt, und wird mich dabei nicht stören. Außerdem ist es abends doch viel netter, mit jemand Vertrautem zusammenzusitzen oder sich gar ein Zimmer zu teilen.«
»Also doch die Sinnsuche in der Lebensmitte?« Ein wenig frotzeln hatte Paulina schon müssen.
»Wenn du so willst – vielleicht. Und einfach die Kondition verbessern, wieder einmal Italienisch reden, fantastisch essen, Kultur und vor allem viel Natur erleben. Umbrien soll ja ein echtes Paradies sein, wild und grün. Darauf freue mich am allermeisten. Wir nehmen übrigens nur ein Handy für uns beide mit. Und das sollte zumindest in der ersten Woche ganz aus bleiben. Also melde dich bitte nur, wenn es gar nicht anders geht.«
Kein Wunder, dass Simone so lange gezögert hatte, sich vertreten zu lassen. Tolle Wolle, vor fünfzehn Jahren gegründet, war inzwischen viel mehr als nur ein Geschäft für Wolle, Garne, Stricknadeln, Knöpfe und Reißverschlüsse. Nahe des idyllischen Savignyplatzes gelegen und dementsprechend mit unmittelbarer S-Bahn-Anbindung, zog der kleine Laden längst nicht nur Kundinnen aus Charlottenburg an. Aus allen Teilen der Stadt kamen die Frauen, aus Zehlendorf, Pankow, Lichterfelde, Weißensee, einige sogar bis aus Potsdam. Man bekam Strickanleitungen und – muster, konnte sich Ratschläge für neue Ideen holen und um Hilfe bitten, wenn etwas beim Handarbeiten danebengegangen war. Doch das Wichtigste war die herzliche persönliche Note, und so stellte das kleine Geschäft auch noch Café, Kummerecke und Sozialstation in einem dar. Niemand ging ungetröstet von hier nach Hause. Beziehungsstress konnte man abladen, berufliche oder häusliche Probleme so lange diskutieren, bis eine Lösung am Horizont auftauchte. Und wenn gar nichts anderes mehr half, kredenzte Simone weißen Portwein oder servierte ihre sagenhaften Schokoküchlein.
Spätestens danach sah alles schon nicht mehr ganz so trüb aus.
Paulina musste lächeln.
Sie würde ihr alles erzählen, sobald sie beide wieder zurück in Berlin waren – und darauf freute sie sich schon jetzt.
Heiterer gestimmt als noch gerade eben, vertiefte sie sich wieder in ihre Lektüre, die sie so gefangen nahm, dass sie bis zum Einlaufen des Zugs am Wiener Hauptbahnhof dabeiblieb.
Sie nahm ihr kleines Gepäck, Rucksack und Trolley, und stieg aus. Leider befand sich der schicke Triebwagen aus Berlin nun am Zuganfang, und sie musste ein ganzes Stück in Richtung Ausgang laufen. Der Bahnsteig war brechend voll, Reisende, die auf den nächsten Zug warteten, Abholer, die den Hals nach ihren Liebsten reckten. Vergeblich hielt Paulina Ausschau nach der beschriebenen Person.
Hatte Lena Brunner sie vergessen?
Sie ging schneller.
Adresse und Telefonnummer hatte sie ja, und bestimmt standen vor dem Wiener Hauptbahnhof Taxen … Da fielen ihr plötzlich zwei junge Männer auf, die sich freundschaftlich anrempelten, blond und sommersprossig der eine, dunkel, markanter und ein paar Jahre älter der andere. Der Blonde hielt einen verknitterten Zettel in der Hand.
Paula Vilke, Berlin.
»Damit bin wohl ich gemeint.« Mit einem Lächeln blieb sie vor den beiden stehen. »Allerdings hatte ich eine Dame erwartet, hellblaues Kleid, braune, kinnlange Haare, nicht mehr ganz jung, so lautete die Beschreibung. Und so ganz haut es auch bei mir noch nicht hin. Ich bin Paulina, nicht Paula, und meinen Nachnamen schreibt man mit einem W. Ansonsten: hallo. Ich freue mich sehr, in Wien zu sein!«
»Typisch wieder einmal die Mami! Verspricht zuerst das Blaue vom Himmel, um anschließend wie immer in der Küche zu versandeln – und der Filius soll es dann richten.« Das jungenhafte Grinsen des Blonden wurde breiter. »War nur Spaß, liebe Frau Wilke! Es ist uns natürlich ein Vergnügen, Ihr Empfangskomitee zu sein.«
Er deutete eine Verneigung an.
»Moritz Brunner, Filmemacher meines Zeichens. Und das ist mein Freund Tamás Varga …« Er zögerte. »Sagen wir Lebenskünstler, das trifft es vielleicht am ehesten.«
»Hören Sie am besten gar nicht erst hin«, sagte Tamás, und Paulina gefiel sein dezent osteuropäischer Tonfall. »Er redet manchmal, bevor er denkt. Aber reden muss er, sonst ist ihm nämlich nicht wohl.«
»Das sagt er immer, der Ungar, wenn wir einer schönen Frau begegnen«, versicherte Moritz. »Um sich in den Mittelpunkt zu spielen. Und klappt es? Entscheiden Sie selbst! Darf ich vielleicht einstweilen das Gepäck übernehmen?« Schon hielt er den Griff des Trolleys in der Hand. »Der Wagen steht gar nicht weit, allerdings garantiert mit Strafzetteln bepflastert, aber das ist mir heute ganz wurscht.«
Er ging so schnell, dass Paulina trotz ihrer langen Beine große Schritte machen musste.
»Sollen wir nicht Du sagen?«, fragte sie halb im Laufen.
»Gern.« Moritz strahlte und streckte den freien Arm aus. »Moritz, Tamás, aber das weißt du ja eh schon. Und das hier ist er, der Sir Anthony, meine ganz große Liebe!«
Der dunkelgrüne MG mit dem offenen Verdeck wirkte wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Cognacbraune Ledersitze, das Armaturenbrett aus Echtholz, rechts gesteuert.
»Echte Vorkriegsware«, erklärte Moritz voller Stolz. »Baujahr 1938, soweit ich richtig informiert bin. Fährst du, Tamás? Dann kann ich unserem Besuch gleich a bissl Wien erklären. Unser Gast sitzt natürlich vorn.«
Tamás übernahm das Lenkrad, während Paulina es sich auf dem Beifahrersitz bequem machte. Moritz quetschte sich mit dem Gepäck nach hinten auf die Rückbank.
»Tolles Gefährt«, sagte sie, als der alte Wagen losröhrte. »Wo hast du den denn her?«
»Beim Pokern gewonnen«, kam es von hinten. »Unsinn – natürlich. Ein alter Schauspieler hat ihn über Jahrzehnte wie seinen Augapfel gehütet, in der Garage verwahrt und höchstens mal am Sonntag bewegt. Als er starb, hat sein Sohn ihn mir verkauft. Der steht eher auf SUV und Audi A8. Da hab ich ein Riesenglück gehabt!«
»Und du warst ausnahmsweise mal flüssig«, warf Tamás ein. »Ist bei ihm nämlich beileibe nicht immer so.«
»Du musst grad reden mit deiner bahnbrechenden Fotoausstellung, auf die wir alle schon seit drei Jahren vergeblich warten«, erfolgte prompt die Retourkutsche. »So ist das eben bei uns Kreativen: Mal geht es sich aus, und mal nicht.«
Ansatzlos verfiel er in den leiernden Singsang eines Fremdenführers.
»Bitte sehr, die Dame, wir sind nunmehr auf dem berühmten Ring angelangt, der die Innenstadt umschließt. Betrachten Sie die Staatsoper im Stil der Neorenaissance – ich sage nur Wiener Opernball –, inzwischen dreisterweise dutzendfach kopiert, aber natürlich nach wie vor weltweit unerreicht. Weiter das Parlament im neoattischen Stil, gefolgt vom Wiener Rathaus im Stil der flämischen Gotik. Vorbei fliegt das weltberühmte Burgtheater, Schicksalsort so vieler Triumphe und menschlicher Tragödien, ferner das Universitätsgebäude, belagert allerdings von Horden bildungswütiger Piefkes, die alle zu uns nach Wien strömen, weil es hier keinen Numerus clausus gibt, der die Dümmsten vom Studieren abhält …«
Paulina wusste nicht, nach welcher Straßenseite sie zuerst schauen sollte.
»Euer Wien ist wirklich wunderschön«, sagte sie beeindruckt. »Geräumig und prächtig. So breite Straßen kenne ich sonst nur aus Berlin. Und wie grün es hier ist! Kein Wunder, dass Wien erst jüngst zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt wurde. So stand es jedenfalls in meinem Reiseführer.«
»Woanders is es no schlimma«, sagte Tamás. »So würden das wahrscheinlich die Wiener kommentieren.«
»Und 1,7 Millionen Menschen, gebündelt auf einer Fläche von 41 487 Hektar, die an der niedrigsten Stelle 151 Meter über dem Meer liegt, können ja schließlich nicht irren, oder? Im Granteln haben es die Wiener jedenfalls zur absoluten Perfektion gebracht«, warf Moritz ein. »Darin übertrifft sie garantiert keiner.«
»Hast du mal als Fremdenführer gearbeitet?«, fragte Paulina. »Du hörst dich unwahrscheinlich professionell an.«
»Auch«, sagte er stöhnend, als quälten ihn auf einmal arge Schmerzen. »Gibt eigentlich so gut wie nichts, wo ich nicht schon gejobbt hätte. Sehr zum Leidwesen meiner geplagten Eltern, die mich am liebsten als Anwalt oder Zahnarzt gesehen hätten. Aber vergessen wir doch diese unerfreulichen Details meiner im Übrigen stocklangweiligen Vita, und konzentrieren wir uns stattdessen wieder auf das aufregende Geschehen im Außen.«
Er trommelte auf den Trolley.
»Wir fahren nämlich soeben in den 9. Bezirk ein. Willkommen im Alsergrund, liebe Paulina. Noch ein letzter Schlenker – danke, Tamás –, und voilà: Schon sind wir in der Harmoniegasse angelangt, dem Domizil der ehrenwerten Familie Brunner.«
Leichtfüßig sprang er heraus, lief um den Wagen herum und öffnete Paulina galant die Tür. Danach holte er das Gepäck von der Rückbank, während Tamás keinerlei Anstalten machte auszusteigen.
»Du kommst nicht mit?«, fragte Paulina.
»Mit dem auch noch zusammenwohnen?«, rief Moritz. »Bewahre mich davor, o Herr!«
»Wo er recht hat, da hat er recht«, sagte Tamás mit einem frechen Grinsen. »Außerdem gehört der Sir Anthony zur Hälfte mir. Damit das auch mal gesagt wäre. Wünsche allerseits wohl zu speisen. Ciao, Paulina, man sieht sich!«
Allein mit Moritz fühlte Paulina sich plötzlich leicht befangen. Das noble, dreistöckige Jugendstilhaus, vor dem sie ausgestiegen waren, gelb gestrichen und von grauen Pilastern gegliedert, tat ein Übriges dazu.
»Ihr müsst mich nicht unbedingt bei euch beherbergen«, sagte sie. »Schließlich bin ich ja nur Tonis Vertretung. Ich kann ebenso gut in ein Hotel gehen.« Sie deutete auf die gegenüberliegende Straßenseite. »Das dort drüben mit dem hübschen Vorgärtchen zum Beispiel sieht doch schon mal sehr einladend aus.«
»Das würde dir die Mami niemals verzeihen«, nuschelte Moritz wie einst Hans Moser in seinen Glanzrollen. »Und du hast ja keine Ahnung, wie nachtragend sie sein kann.« Sein Tonfall wurde wieder normal. »Also, komm. Wir haben es beinahe geschafft.«
Die massive Holztür mit dem verschlungenen Eisengitter war nur angelehnt. Moritz drückte trotzdem auf die kupferne Klingel.
»Sie weiß immer gern, was sie erwartet«, sagte er. »Komisch, darin sind wir zwei uns ganz ähnlich.«
Innen empfing sie ein zartgraues Treppenhaus mit gleichfarbigem Ölsockel, beides offenkundig erst jüngst frisch renoviert, denn es roch noch immer nach Farbe. Die alten Holztreppen ächzten bei jedem Tritt.
»Hundert Jahre und mehr«, kommentierte Moritz, der ohne zu fragen wieder Paulinas Trolley übernommen hatte. »Und ganz schlecht für Langfinger. Die würde man nämlich schon nach der ersten Stiege bis ganz oben hören – es sei denn, sie kämen in Wollsocken.«
Es war witzig, was er sagte, meistens jedenfalls, und doch spürte Paulina den enormen Druck, unter dem Moritz stand. Männer dieser Art konnten ihr schnell auf die Nerven gehen, doch bei ihm gab es da etwas, das sie anrührte.
Musste er der ganzen Welt beweisen, wie originell er war? Oder handelte es sich um eine Art Wettstreit zwischen ihm und seinem ungarischen Freund, auch wenn der gar nicht anwesend war?
Vermutlich würde sie nicht lang genug bleiben, um das herauszufinden.
Je höher sie kamen, desto mehr intensivierten sich die anregenden Essensgerüche, und Paulina spürte, wie hungrig sie war.
Vor der halb offenen rechten Wohnungstür im zweiten Stock stand eine Frau: hellblaues Kleid, braunes, kinnlanges Haar, nicht mehr ganz jung.
Ihr Lachen war warm und einladend.
»Willkommen in Wien«, sagte Lena Brunner. »Ich hoffe, Sie mögen Kalbsgulasch mit Serviettenknödeln!«
»Noch ein einziger Bissen, und ich platze!« Paulina hielt die Hand über ihren Teller, als Moritz ihr zum Dessert auch noch die dritte Palatschinke auflegen wollte.
»Aber, Paulina, die mit der Marillenmarmelade sind doch die allerbesten! Ur-köstlich …«
»Selbst wenn – ich kann wirklich nicht mehr!«
»Lass sie, Bub«, schaltete sich Ferdinand Brunner ein, von seiner Frau liebevoll Ferdi gerufen. »Und hör bittschön auf mit diesem schrecklichen ›ur‹, das ihr Jungen dauernd sagt. Ja, an diese gehaltvollen Wiener Köstlichkeiten muss man sich erst gewöhnen. Was mich betrifft, so habe ich Jahre dazu gebraucht.«
Er klopfte leicht auf seinen Bauch.
»Als dünner Spund hab ich meine Lena lieben gelernt. Und schauen Sie, Frau Wilke, wie dick ich heute bin. Dabei predige ich als Internist meinen Patienten tagein, tagaus, beim Essen maßzuhalten. Und dann komme ich nach Hause und sehe mich solchen Versuchungen gegenüber. Wahrhaft kein einfaches Los, das kann ich Ihnen verraten.«
»Sie sind doch nicht dick«, widersprach Paulina. »Sie sind stattlich. Ich mag Männer mit Format. Mein verstorbener Vater war auch kein Spargeltarzan. Er hat gutes Essen geliebt. Ich glaube, das hat er mir vererbt.«
Er warf ihr über den Tisch eine Kusshand zu und begann, zu strahlen.
»Und ich mag hübsche junge Frauen mit gutem Geschmack«, sagte er. »Stattlich, hat sie gesagt, stattlich. Hast du das gehört, Moritz?«
»Vielleicht will sie ja nur ur-höflich sein …«
»Jetzt reicht es aber!«, rief Ferdi in gespielter Entrüstung. »Was man sich von erwachsenen Söhnen nicht alles anhören muss.«
Er wandte sich wieder Paulina zu.
»Erzählen Sie doch noch ein bisschen über sich, wenn Sie mögen. Ich bin Internist, meine Frau arbeitet ein paar Tage die Woche in einer Buchhandlung. Moritz macht Dokumentarfilme, und gar keine schlechten, auch wenn der ganz große Durchbruch noch aussteht, aber wir glauben weiterhin fest daran. Und Sie …«
»Ferdi«, unterbrach ihn seine Frau liebevoll. »Du immer mit deiner Neugierde! Dafür ist doch morgen auch noch Zeit. Ich kann mir vorstellen, dass Frau Wilke erst einmal mehr über Papas Vermächtnis erfahren möchte. Dazu ist sie doch schließlich nach Wien gekommen.«
»Ja, bitte!«, sagte Paulina. »Toni fiebert wahrscheinlich schon meinem Bericht entgegen.«
»Dann will ich mal beginnen.« Sie legte die Fingerspitzen aneinander, als könne sie sich so besser konzentrieren. »Mein Vater, Peter Leopold Raimund Matusek, geboren 1928 in Wien, hat seine Frau Else, meine Mutter, um viele Jahre überlebt. Körperlich rüstig und geistig wach, konnte er sich auch noch im höheren Alter allein in seiner Wohnung versorgen. Ein Oberschenkelhalsbruch vor drei Jahren brachte dann leider die Wende. Der Papa kam nach dem Spital nicht mehr richtig auf die Füße und brauchte Hilfe. In ein Pensionistenheim wollte er auf keinen Fall, da haben wir ihn hier mit ein paar seiner Lieblingsmöbel bei uns aufgenommen. Unser Zusammenleben war nicht ganz reibungslos, aber ich würde sagen, summa summarum hat es gut funktioniert, meistens jedenfalls. Die ganze Familie hat mit angepackt, unterstützt vom Pflegedienst.«
»Den Löwenanteil hat allerdings meine Frau geleistet«, sagte Ferdi. »Moritz und ich haben eher in der Peripherie fungiert.«
»Ich hab es gern getan, und außerdem mochte ich, dass der Papa sich bis zuletzt seine Eigenständigkeit bewahrt hat. Ja, er konnte eigensinnig sein, manchmal bis zur Sturheit, aber er hatte dabei immer Eleganz und Stil. Wir durften erst in sein Zimmer kommen, nachdem er fertig angekleidet war. Und beim Waschen wollte er nur Lucian um sich haben, seinen rumänischen Pfleger, den er ins Herz geschlossen hatte.«
»Ich durfte ihm manchmal ein Hemd anziehen«, sagte Moritz. »Wenn er besonders gut aufgelegt war.«
»Das stimmt«, pflichtete Lena bei. »Dein Opapa und du, ihr wart sehr speziell, immer schon. Aber nicht einmal du hast etwas von diesem Vermächtnis gewusst, oder?«
Moritz schüttelte den Kopf. »Kein Wort hat er mir davon verraten. Er hat überhaupt nicht gern über jene dunkle Zeit gesprochen, die Nazis in Wien, den Krieg, die Bomben. Nur einmal, kurz vor seinem Tod, da hat er gesagt: ›Es trifft immer die Besten, Moritz, so ist es leider. Aber auch wenn man manchmal denkt, alles ist aus, ist es doch vielleicht noch nicht ganz aus. Die Kinder, die bleiben die Hoffnung. Merk dir das. Und mach das Beste draus.‹«
»Ich verstehe nicht ganz«, sagte Paulina. »Was genau wollte er damit sagen?«
»Vielleicht hat er ja hierüber gesprochen.« Lena stand auf, ging hinüber ins Wohnzimmer und kehrte mit einem Holzkästchen zurück, das sie vor Paulina auf den Tisch stellte.
»Machen Sie auf«, sagte sie. »Bitte.«
Der lose Deckel war schnell gelüftet. Innen lag ein dickes blaues Buch mit Goldornamenten, von denen manche abgeblättert waren. Auf dem Buch klebte ein Zettel. Die Bleistiftschrift war so verblichen, dass sie nur noch schwer zu lesen war.
Lotte Laurich, Berlin. Unbedingt suchen.
Tochter Antonia Laurich, geboren 1943!
»Sieht fast aus wie ein Poesiealbum«, sagte Paulina.
»Das dachte ich zunächst auch«, sagte Lena. »Bis ich reingeblättert und zu lesen begonnen habe – und dann nicht mehr aufhören konnte. Mit schlechtem Gewissen allerdings, denn etwas Persönlicheres als solche Aufzeichnungen gibt es ja schließlich nicht. Aber ich wollte unbedingt wissen, was mein Vater damit zu tun hat. Es ist das Tagebuch einer jungen Frau namens Luzie Kühn, die von 1936 bis 1944 in Wien lebte. Mein Vater kommt auch darin vor, er stand ihr näher, als ich anfangs dachte, und war offenbar heimlich bis über beide Ohren in sie verliebt. Er wollte ihr helfen, denn Luzies Leben war nicht einfach; aber er war zu jung, um ihr wirklich helfen zu können. Offenbar hat er sich zur Aufgabe gemacht, ihr wenigstens über den Tod hinaus etwas Gutes zu tun.«
Sie tippte auf den Zettel.
»Eine Lotte Laurich konnte ich in Berlin allerdings nicht ausfindig machen«, sagte sie. »Weder im Ost- noch im Westteil der Stadt.«
»Tonis Mutter hieß so«, sagte Paulina. »Aber die ist schon seit über dreißig Jahren tot, das hat Toni einmal kurz erwähnt. Es gibt noch Thea Laurich, Tonis ältere Schwester. Sie ist hinreißend, aber schon sehr dement. In ihrem Pflegeheim in Weißensee wird sie gut betreut. Toni besucht sie oft, doch meist erkennt Thea sie nicht mehr.«
»Genau das war auch mein Weg«, sagte Lena. »Über Thea Laurich bin ich schließlich zu Toni Ostermann gelangt, wohnhaft in Potsdam, geborene Antonia Laurich anno 1943 in Wien.«
»Ja, sie hat ganz jung Heinz Ostermann geheiratet. Die Ehe blieb kinderlos und zerbrach schon nach wenigen Jahren. Toni hat nach der Scheidung den Namen behalten, weil er ihr so gut gefiel. Geboren 1943 ist auch richtig. Aber in Wien? Ausgeschlossen! Toni ist eine waschechte Potsdamerin. Und das hört man. Sie haben doch selbst mit ihr telefoniert.«
»Wenn Sie sich da mal nicht täuschen«, entgegnete Lena. »Hat Ihre Freundin denn nie etwas über ihre Kindheit erzählt?«
»Natürlich«, erwiderte Paulina im Brustton der Überzeugung – um plötzlich kleinlaut zu werden. Sie wusste, was Toni gerne aß, welche Filme ihr gefielen, welche Bücher sie am liebsten las, kannte die Namen ihrer favorisierten Künstler sowie die Liste der Länder, die sie am liebsten noch bereisen würde. Ein bisschen was wusste sie auch noch über Thea und deren unaufhaltsame Krankheit – aber das war eigentlich auch schon alles.
Eltern? Kindheit? Fehlanzeige.
Weil Toni nicht darüber reden konnte – oder nicht darüber reden wollte?
Hatte sie Mutter und Tochter Wilke all die Jahre an der Nase herumgeführt? War sie in Wirklichkeit eine ganz andere als die, für die sie sich ihnen gegenüber ausgegeben hatte?
Paulina dachte an Tonis treuherzige wasserblaue Augen und ihr erfrischendes Koboldlachen, das sie nun schon so lange begleitete.
Es konnte nicht sein.
Aber es fühlte sich trotzdem merkwürdig an.
Lena schien zu spüren, wie es in ihr arbeitete.
»Es gibt noch einen Brief von meinem Vater, aber den heben wir uns besser für später auf«, erklärte sie. »Nehmen Sie das Tagebuch mit, und machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Ich bringe Sie jetzt ins Gästezimmer. Es ist nichts Großes, aber recht wohnlich, da können Sie sich ausruhen. Eine Wasserflasche habe ich Ihnen reingestellt, das Bett ist gemacht, und im kleinen Badezimmer nebendran stört Sie keiner von uns. Falls Sie mehr Durst haben oder nachts hungrig werden sollten: Unser Kühlschrank ist auch Ihr Kühlschrank.«
Sie lächelte.
»Kommen Sie, Paulina, es war ein langer, anstrengender Tag. Morgen reden wir dann weiter.«
»Nichts Großes« waren geschätzte achtundzwanzig Quadratmeter, geräumiger als jedes Zimmer ihrer Kreuzberger Wohnung, mit pompöser Stuckdecke und edler, aber minimalistischer Möblierung. Ein schmaler Spiegel rechts von der Tür, ein grauer Schlaffuton, weiß bezogen, ein kleiner Schreibtisch, ein schwarzer Sessel, neongelbe Vorhänge. An einer der weißen Wände hing in Plakatgröße eine gerahmte Schwarzweißfotografie, die Paulina zunächst Rätsel aufgab.
Ein ausgetrocknetes Flussdelta?
Afrikanische Gesteinsaufwerfungen?
Mondkrater?
Erst als sie weit genug entfernt davon stand, erkannte sie das stark vergrößerte Hautrelief einer sehr alten Hand.
Am allerbesten gefiel ihr der kleine Balkon, der zum Innenhof hinausging. Ein Mosaiktischchen und zwei Klappstühle, einer davon mit Sitzkissen, machten ihn wohnlich. Große alte Bäume rauschten im Abendwind. Und hatte sie nicht soeben ein rötliches Eichhörnchen den Stamm hinunterflitzen sehen?
Sie ging wieder hinein, wählte Tonis Nummer und ließ es lange läuten.
Niemand nahm ab. Nicht einmal der Anrufbeantworter sprang an, den einzuschalten die alte Dame in letzter Zeit allerdings gern mal vergaß. Gegen ein Mobiltelefon sträubte sie sich nach wie vor vehement, weil sie gar nicht überall und jederzeit erreichbar sein wollte, wie sie gerne wiederholte.
Wo konnte Toni stecken?
Im Kino, das sie ab und zu gern mit einer ihrer Freundinnen besuchte? Aber ausgerechnet heute, wo sie doch sicherlich auf Nachrichten aus Wien wartete?
Paulina blieb nichts anderes übrig, als den Anruf zu verschieben. Sie selbst jedoch konnte sich nicht länger gedulden. Sie holte ihren alten Talisman, die Schneekugel mit dem Wiener Riesenrad, aus dem Rucksack und stellte sie neben dem Futon auf den Boden.
Danach trug sie das blaue Buch auf den Balkon, ebenso wie die Wasserflasche. Dass sich unweit der Tür nach draußen eine Steckdose befand, hatte sie bereits gecheckt. Also konnte sie die Schreibtischlampe einschalten, mit ins Freie nehmen und hatte auf diese Weise ausreichend Licht, obwohl es schon bald ganz dunkel sein würde.
Sie ließ sich auf dem bequemeren der beiden Stühle nieder.
Dann schlug sie Luzies Tagebuch auf und begann zu lesen.
2
Berlin/Wien, Oktober 1936
Hätte mein Fuß doch niemals diese verfluchte Havelinsel Schwanenwerder betreten! Warum nur habe ich dem verführerischen Angebot meines ehemaligen Chefs nicht widerstanden, für den ich früher im Kabarett am Palmenhaus getanzt habe? Aber dieser Géza von Cziffra ist klug und sehr charmant dazu. Als Journalist und Drehbuchautor kennt er Gott und die Welt und kann mit seinen dunklen ungarischen Augen unter den schweren Lidern sehr überzeugend sein.
»Begleiten Sie mich an diesem Abend, Fräulein Kühn«, hat er mich gebeten, »es wird Ihr Schaden nicht sein.« Und ich Dussel war zu gierig und zu naiv, um lieber vorher gründlich nachzudenken, und hab ihm jedes Wort geglaubt.
Seitdem stecke ich mittendrin im größten Schlamassel!
Ja, der Abend war glamourös, betörend, einzigartig: Das wunderschöne veilchenblaue Seidenkleid, das ich ausleihen durfte, die ganze Havelinsel magisch illuminiert, ein Spalier blutjunger Fackelmädchen, das jeder Gast passieren musste, später dann die flotte Tanzmusik, die köstlichen Speisen, die erlesenen Getränke – und hinter all dem meine brennende Sehnsucht, endlich für den Film entdeckt zu werden.
Das Verfallsdatum für Tingeltangelmädchen läuft rasend schnell ab …
So bringt es Vera aus Budapest gnadenlos auf den Punkt. Sie kümmert sich bei uns im Varieté um die Gästegarderobe und hat mir diesen Floh mit der Filmerei erst so richtig ins Ohr gesetzt.
Und wie recht sie hat!
Natürlich macht es auf Dauer keinen Spaß, mit zweiundzwanzigdreiviertel noch in der zweiten Reihe einer Revue zu hopsen, und wenn sie noch so begeistert beklatscht wird. Meine Stimme ist ganz ordentlich, die Beine können sich sehen lassen, ich habe ein Gesicht, das vielen gefällt, und was mein Talent für Komik betrifft, so habe ich dafür schon zahlreiche Komplimente bekommen.
Aber was hilft das alles?
Mit dem wöchentlichen Hungerlohn im Varieté kann ich kaum satt werden, geschweige denn, mir etwas Vernünftiges kaufen. Ohne Großpapas monatlichen Zuschuss könnte ich mir ja nicht einmal das Zimmer in der Pension von Fräulein Gräulich in der Spandauer Vorstadt leisten. Außerdem gibt es so gut wie keinen Besuch, bei dem mir Großmama nicht noch rasch ein Scheinchen zugesteckt hätte, weil sie genau weiß, wie teuer mein Leben ist: Schminke, Tanzschuhe, hübsche Kleider und all das andere, das eine junge Frau so braucht, wenn sie hoch hinaus will.
Zu hoch, wie ich inzwischen weiß – denn seit jenem Fest ist der Bock von Babelsberg hinter mir her, so der heimliche Spitzname von Dr. Joseph Goebbels. Er hat offenbar Feuer gefangen und möchte mich bald »intensiver kennenlernen«, wie er mir zum Abschied zugeflüstert hat.
Ein großer Rosenstrauß ist bereits für mich abgegeben worden, und Goebbels hat schriftlich angekündigt, unsere Vorstellung demnächst wieder besuchen zu wollen. Wenn ich Pech habe, droht mir sogar sein berüchtigtes »Besatzungsbett«, in dem früher oder später alle Sternchen landen, die auf die Leinwand möchten. Er scheint hemmungslos in seiner Geilheit, die er vorzugsweise in den Mittagspausen in einer eigens dafür angemieteten Wohnung befriedigt, wie man raunt, um die aufgebrachte Gattin nicht noch misstrauischer zu machen. Magda Goebbels bekommt ein Kind nach dem anderen, weil der Führer das so will, obwohl sie ihrem Ehemann schon lange nicht mehr traut.
Was für Abgründe!
Allein die Vorstellung, mich von diesem lüsternen Klumpfuß begrabschen zu lassen, dreht mir den Magen um. Sein Atem riecht essigsauer, sein Schweiß abgestanden, die Nägel sind abgebissen bis unter das Fleisch. Er spuckt beim Reden und findet sich ganz und gar unwiderstehlich.
Aber ich finde ihn einfach nur widerlich!
Wenn er erst einmal Witterung aufgenommen hat, dann gibt es so gut wie kein Nein.
Das sagen alle, und das macht mir Angst.
Noch ist meine Abstammungslegende zum Glück offenbar wasserdicht. Doch sollte der lüsterne Herr Reichspropagandaminister jemals herausbekommen, mit wem er es wirklich zu tun hat, bin ich geliefert – und meine heiß geliebten Großeltern mit dazu.
Ich muss also weg aus Berlin, besser gestern als morgen, denn die Nazis mögen nichts, was nicht in ihre enge braune Welt passt.
Vor allem keine Juden.
Jüdischen Anwälten haben sie bereits Berufsverbot erteilt; jüdische Mediziner wurden aus allen öffentlichen Ämtern entfernt, und es kursieren böse Gerüchte, dass bald schon gar kein Jude mehr als Arzt arbeiten darf. Jetzt, wo der Pomp der Olympiade verflogen ist und die Berichterstatter aus aller Herren Länder wieder abgereist sind, sind die Schikanen gegen Juden mit einem Schlag wieder zurück – ärger als zuvor.
Großpapa, der nicht umsonst mit Nachnamen Fröhlich heißt, bemüht sich weiterhin hartnäckig um Optimismus. »Einen Viechdoktor werden sie schon nicht behelligen«, sagt er immer wieder. »Dem Pudel Fritzi oder der Katze Murrchen ist es doch piepegal, wer ihnen hilft. Und ihren Haltern ebenso. Schnell soll es gehen, und kosten darf es auch nicht viel, so ist es ihnen am liebsten.«
Trotz seiner 73 Jahre steht er nach wie vor jeden Tag in der Praxis. Zudem kümmert er sich mit Großmamas Unterstützung rührend um die kleine Arche Noah, die die beiden seit vielen Jahren im Hinterhof eingerichtet haben. Hunde, Katzen, Vögel, Hasen, Hamster, Meerschweinchen, Schildkröten – als Kind war ich selig, mit all diesen bedürftigen kleinen Wesen aufzuwachsen. Noch heute bringen die Leute aus dem Viertel all die Tiere an, die kein Zuhause mehr haben, und ich kann mich nicht entsinnen, dass die beiden jemals eines abgewiesen hätten.
Meine Großeltern zu verlassen, bricht mir das Herz, aber ich darf nicht länger bleiben. Noch mögen sie sich kaum vorstellen, dass ihr einziges Enkelkind schon bald viele Kilometer entfernt von ihnen leben wird. Wir geben uns mutig und zuversichtlich, alle drei, und wissen dabei doch ganz genau, wie dünn das Eis unter uns ist. Ein falsches Wort, eine unbedachte Geste – und schon könnten Tränenbäche fließen, die so leicht nicht mehr zu stillen wären.
Deshalb habe ich den Abschied von ihnen auch bis zum allerletzten Augenblick hinausgeschoben. Doch heute steht er mir bevor, und ich habe schon jetzt eiskalte Hände, obwohl es ein warmer, sonniger Herbsttag ist. Für Großmama habe ich einen fliederfarbenen Schal gekauft, für Großpapa ein halbes Dutzend seiner geliebten Havannas, beides liegt eigentlich weit über meinem Budget, aber es ist das Mindeste, was ich für sie tun kann.
Jetzt bin ich so gut wie pleite, was allerdings nichts Neues für mich ist.
Tante Marie in Wien wird mich schon nicht verhungern lassen, und wohnen kann ich bei ihr ja auch erst einmal. Schließlich ist sie ja auf dem Papier meine Mutter, obwohl ich sie seit vierzehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Sie hat jetzt einen Ehemann, der Leopold heißt, und einen kleinen Sohn namens Peter, sozusagen mein Brüderchen, das ich noch gar nicht kenne. Am Telefon klang sie sehr nett, aber ein bisschen erschrocken war sie zunächst wohl schon, dass ich ihnen so schnell auf den Pelz rücke. Doch dann hat sie sich rasch wieder gefangen. Schließlich ist sie Papas Schwester und hat ihren großen Bruder zärtlich geliebt. Sie war total verzweifelt, ihn und ihre Schwägerin Leonie – meine Mutter – schon so früh zu verlieren.
Trotzdem hat sie in all der Trauer einen klaren Kopf behalten und meine Großeltern zu der Entscheidung gedrängt, von der ich heute profitiere.
In meiner Erinnerung sieht sie Papa ziemlich ähnlich – braune Locken, grüne Augen, gerade Nase, hohe Stirn, Brille. (Sie ist kurzsichtig, was ich leider geerbt habe!)
Und auch sonst ähnle ich ihr.
Auf ihren Jugendfotos könnte man uns zwei glatt verwechseln, wäre ich nicht ein Stückchen größer geraten und wären meine Haare nicht blond gefärbt. Von Mama habe ich eigentlich nur die Lust am Tanzen geerbt, den weichen Mund und den Hang zur Melancholie, der immer häufiger durchschlägt, je älter ich werde. Sonst gehe ich optisch ganz in die väterliche Richtung.
Aber was wird Marie ihren Nachbarn, Bekannten und Freunden sagen, wenn auf einmal wie aus dem Nichts eine erwachsene Tochter auftaucht, von der sie alle noch nie etwas gehört haben? Und was, wenn ich diesen Leuten selbst Rede und Antwort stehen muss?
Jetzt wird mir die Kehle plötzlich doch ganz eng, denn leider bin ich eine lausige Lügnerin.
Und so etwas will Filmschauspielerin werden?
Wahrscheinlich lande ich doch nur wieder in einem Wiener Hinterhofkabarett …
Ich wische mir die Tränen weg, die sich jetzt nicht mehr zurückdrängen lassen, ziehe meine weiße Bluse an, weil Großmama mich so gern darin sieht, und bürste mir die Haare.
Kein Rouge, nicht einmal ein Hauch Lippenstift. Ganz frisch will ich bei ihnen ankommen, natürlich von Kopf bis Fuß …
Manni, ebenfalls seit Jahr und Tag in der leicht ramponierten Pension von Fräulein Gräulich zu Hause, hatte ihr sein altes Damenfahrrad geliehen, weil Luzie heute die Enge einer U-Bahn nur schwer ertragen hätte.
Wie sehr sie diese bunte Truppe vermissen würde!
Allen voran ihn, ihren besten Freund, der sich mithilfe von Kleidern und Schminke allabendlich im Varieté in die schillernde Hélène verwandelte, eine Dame von Welt, die die Männer reihenweise um den Verstand brachte. Und dann natürlich die kleinwüchsige Flora, die sich mit Tarot-Karten und einer Kristallkugel mehr schlecht als recht durchs Leben schummelte – Seite an Seite mit Suzette, angeblich eine waschechte Pariserin, die in Wirklichkeit aus Tanger stammte und mit ihren begnadeten Händen die besten Massagen anbot – bei langjährigen Stammkunden auch schon mal mehr. Arthur, verrückt nach blonden, jungen Kerlen, hatte sich über Jahre mit Englischstunden über Wasser gehalten und war bereits wieder zurück in seiner Heimatstadt Manchester, weil ihm das Pflaster in Berlin zu heiß geworden war.