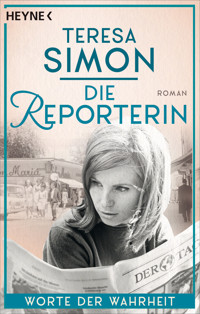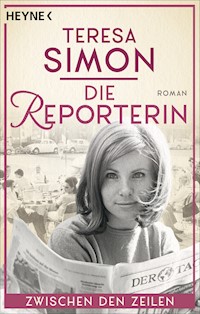
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Reporterin-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau kämpft für ihren großen Traum
Mai 1962: Marie Graf ist Anfang zwanzig und lebt ihr Leben so, wie von den Eltern geplant. Heimlich jedoch hat sie einen Traum: Sie will Reporterin werden. Sie will schreiben, informieren, aufrütteln. Als die neu gegründete Zeitung
Der Tag ihr ein Praktikum anbietet, kann sie ihr Glück kaum fassen. Doch Marie muss sich jeden Schritt ihres Weges hart erkämpfen, sich gegen egozentrische Kollegen, schwierige Interviewpartner und ihre eigenen Eltern durchsetzen. Dank der Hilfe ihres Mentors beim
Tag bekommt Marie die Gelegenheit, Größen wie Pierre Brice und Hildegard Knef kennenzulernen. Aus ihr wird Malou Graf, Gesellschaftskolumnistin. Doch der Erfolg im Beruf hat Schattenseiten, nicht zuletzt für Malous Liebesleben. Und dann ist da noch ein Familiengeheimnis, das alles zerstören könnte, was sie sich so mühsam aufgebaut hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Mai 1962: Marie Graf ist Anfang zwanzig und lebt ihr Leben so, wie von den Eltern geplant. Heimlich jedoch hat sie einen Traum: Sie will Reporterin werden. Sie will schreiben, informieren, aufrütteln. Als die neu gegründete Zeitung Der Tag ihr ein Praktikum anbietet, kann sie ihr Glück kaum fassen. Doch Marie muss sich jeden Schritt ihres Weges hart erkämpfen, sich gegen egozentrische Kollegen, schwierige Interviewpartner und ihre eigenen Eltern durchsetzen. Dank der Hilfe ihres Mentors beim Tag bekommt Marie die Gelegenheit, Größen wie Pierre Brice und Hildegard Knef kennenzulernen. Aus ihr wird Malou Graf, Gesellschaftskolumnistin. Doch der Erfolg im Beruf hat Schattenseiten, nicht zuletzt für Malous Liebesleben. Und dann ist da noch ein Familiengeheimnis, das alles zerstören könnte, was sie sich so mühsam aufgebaut hat …
Die Autorin
Teresa Simon ist das Pseudonym der promovierten Historikerin und Autorin Brigitte Riebe. Sie ist neugierig auf ungewöhnliche Schicksale und lässt sich immer wieder von historischen Ereignissen und stimmungsvollen Schauplätzen inspirieren. Die SPIEGEL-Bestsellerautorin ist bekannt für ihre intensiv recherchierten und spannenden Romane, die tiefe Emotionen wecken. Ihre Romane »Die Frauen der Rosenvilla«, »Die Holunderschwestern«, »Die Oleanderfrauen« und »Glückskinder« wurden alle zu Bestsellern.
Lieferbare Titel
Die Frauen der Rosenvilla
Die Holunderschwestern
Die Oleanderfrauen
Die Fliedertochter
Die Lilienbraut
Glückskinder
Teresa Simon
ZWISCHEN DEN ZEILEN
Roman
Band 1 der Reporterin-Reihe
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 03/2023
Copyright © 2023 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Katja Bendels
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design
unter Verwendung von Alamy Stock Foto (United Archives GmbH); Süddeutsche Zeitung Photo (Alfred Haase); Nele Schütz Design
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25526-8V003
www.heyne.de
Jeder spinnt auf seine Weise, der eine laut, der andere leise.
Joachim Ringelnatz (1883 – 1934)
Der Schlüssel zum Glück steckt von innen.
Lebensweisheit
Für Margaretha
Eins
Mai 1962
Da standen sie wieder an der Litfaßsäule auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die Pickelboys, wie Marie sie insgeheim getauft hatte, jene Horde blutjunger Halbstarker, die wie junge Hirsche vorzugsweise rudelweise auftraten. Samstags, wenn der Unterricht zu Ende war, schlugen sie nach der Schule in der Schwanen-Drogerie von Maries Eltern im Münchner Stadtteil Neuhausen auf. Die beiden hatten das Geschäft von Onkel Julius übernommen, dem Erfinder der berühmten Goldtinktur, einer Essenz, die Pickel auf Gesicht und Rücken zuverlässig zum Verschwinden brachte, ohne hässliche Narben zu hinterlassen – vorausgesetzt allerdings, man brachte es fertig, nach dem hauchdünnen Auftragen einige Tage lang geduldig zu warten und nicht sinnlos an den ungeliebten Übeltätern herumzupulen. Ein Kunststück an Selbstbeherrschung, das wahrlich nicht allen gelang.
Und so riss der Strom an Hilfesuchenden seit Jahren nicht ab, sondern schwoll im Gegenteil immer weiter an. Julius Schwan hatte sich stets standhaft geweigert, sein Geheimrezept preiszugeben, egal, wie verführerisch diverse Offerten auch ausgefallen sein mochten. Natürlich war die Zusammensetzung mittlerweile trotzdem heimlich analysiert worden, und eine namhafte Kosmetikfirma hatte ein verblüffend ähnliches Produkt auf den Markt gebracht, doch nichts wirkte so zuverlässig wie Julius Schwans bewährte Goldtinktur.
Inzwischen war Maries Vater als Einziger in die Rezeptur eingeweiht und fabrizierte den Verkaufsschlager regelmäßig im Hinterzimmer der Drogerie, das er etwas hochtrabend »Labor« nannte. Theo Graf, der so gern Apotheker geworden wäre, hätte ihm der Zweite Weltkrieg nicht einen dicken Strich durch diese ehrgeizige Rechnung gemacht, verstand sich auch so als Naturwissenschaftler und liebte diese Stunden in seinem persönlichen Heiligtum. Aus Heilerde, Zinksalbe, Teebaumöl, Vitamin B5 und einer gewissen orientalischen Geheimzutat jene Mischung herzustellen, um die so viele Kunden sich rissen, war für ihn ein heiliges Ritual.
Dass ihn der Russlandfeldzug den linken Unterschenkel gekostet hatte, trug Maries Vater mit bewundernswerter Fassung. Obwohl sie wusste, wie oft ihn der leidige Stumpf quälte, kamen nur selten Klagen über seine Lippen, und er gab sich die allergrößte Mühe, mit seiner Beinprothese »ganz normal« zurechtzukommen. Er war ihr Vorbild, die Sonne in ihrem Leben. Ihrem Vater nahm sie es nicht einmal übel, dass sie auf seinen Wunsch hin den hoffnungslos altmodischen Namen Marie-Louise trug, den, abgesehen von ihm, jedoch kaum jemand benutzte. Jammern lag ihrem Vater nicht; darin ähnelte Theo Graf seinem Lieblingsdichter Joachim Ringelnatz, dem er mit der markanten Nase und der kantigen Kinnpartie auch optisch nicht unähnlich war. Dass er wegen starker Kurzsichtigkeit eine dicke Brille aufsetzen musste und ihn von seiner hochgewachsenen Frau einige Zentimeter trennten, kommentierte Theo mit erfrischender Selbstironie.
»Karin ist und bleibt meine schlesische Schönheit, zu der ich aufschaue, während ich eben etwas schief ins Leben gebaut bin«, pflegte er augenzwinkernd zu sagen. »Und selbst, wenn ich immer näher dem Boden entgegenwachse, so habe ich doch viel Sinn fürs Geschäft und kann gut mit Menschen umgehen.«
Wie sehr beides zutraf!
Wenn er hinter der Theke stand, ging so gut wie niemand aus der Drogerie, ohne etwas gekauft zu haben, während Karins zurückhaltende Art weniger gut ankam und von einigen Kundinnen sogar als Arroganz ausgelegt wurde. Auch die Pickelboys vertrauten Theo Graf grenzenlos, während sie bei seiner Frau verschämt zu nuscheln begannen. Ganz verlegen jedoch wurden sie, sobald sie Marie hinter der Theke erblickten.
»Ist doch kein Wunder. Sie finden dich eben ungemein attraktiv«, sagte ihr Vater, mit dem Marie besser zurechtkam als mit der strengen Mutter, die stets etwas zu bekritteln hatte. »Ich kann diese Jungs gut verstehen. Schließlich habe ich die hübscheste Tochter der Welt!«
Wie charmant er war. Und wie lieb er lügen konnte …
Marie selbst fand ihr Aussehen bestenfalls durchschnittlich. Im Gegensatz zu den schönen, klassischen Zügen ihrer Mutter, die oft für eine Südländerin gehalten wurde, hatte sie eine Stupsnase und helle Haut, die beim Sonnenbaden schnell rot wurde, anstatt anständig zu bräunen, wie es jetzt Jahr für Jahr immer mehr in Mode kam. Zudem konnte Mama selbst mit über vierzig essen, was sie wollte, und passte trotzdem in ihre eleganten Bleistiftröcke.
Die harte Nachkriegszeit, in der alle Deutschen kollektiv gehungert hatten, war endgültig vorbei. Inzwischen hatte das bundesdeutsche Wirtschaftswunder die Menschen im ganzen Land wieder wohlbeleibt gemacht, und so erfreuten sich in der Schwanen-Drogerie Diätpillen und vor allem Abführtees größter Beliebtheit. Auch Marie brauchte ein Stück Kuchen leider nur anzusehen, um gleich ein Kilo mehr auf die Waage zu bringen. Und wem in aller Welt hatte sie eigentlich diesen merkwürdigen Schweif an Sommersprossen zu verdanken, der sich wie eine Milchstraße über ihren Rücken zog?
Auch heute Morgen vor dem Badezimmerspiegel hatte sie wieder einmal mit ihrem Aussehen gehadert. Ihren Teint fand sie zu blass, und die lockigen rotblonden Haare erwiesen sich als störrischer denn je. Mehr als eine halbe Stunde hatte Marie sich vergebens abgeplagt, sie in eine halbwegs ansehnliche Hochfrisur zu verwandeln. Als sie schließlich entnervt die Nadeln wieder herauszog und das Gestrüpp mittels eines Gummis zum schlichten Pferdeschwanz zwang, hätte sie sich am liebsten zurück ins Bett geflüchtet, doch daraus würde leider nichts werden. Mama plagte wieder einmal Migräne, wie so oft am Wochenende, und ihr Vater war ausnahmsweise gleich nach dem Frühstück auf dem Moped zu seinem geliebten Schrebergärtchen aufgebrochen. Dort wollte er nach seinen Nutzpflanzen sehen und zwei neue Hortensiensträucher anpflanzen. Also blieb es an Marie hängen, den ganzen sonnigen Samstag über in der Drogerie die Stellung zu halten.
Die Türglocke schlug an, und Marie schob unwillig ihren Lesestoff unter den Tresen – Der Tag, jene neue Boulevardzeitung, die erst seit ein paar Wochen erschien und doch schon Furore machte.
Die Pickelboys draußen vor dem Laden schienen endlich Mut gefasst zu haben. Der Älteste von ihnen, mit gelfixierter Haartolle und verschwitztem Nylonhemd zwar modisch, aber leider auch geruchsintensiv gestylt, schritt zum Tresen und ergriff mutig das Wort.
»Ist denn der Herr Drogist heute gar nicht da?«, wollte er wissen.
»Leider nein.« Marie lächelte kurz.
»Wie schade …« Resigniert sanken seine Schultern herab. »Klassenkameraden haben uns erzählt, dass er …«
»Kann ich euch vielleicht weiterhelfen?«, bot sie an. »Ich bin ebenfalls gelernte Drogistin.«
Maries Blick flog zu dem ledergebundenen Handbuch derDrogisten-Praxis, das wie eine Bibel aufgeschlagen auf einem Lesepult neben dem Tresen lag. Glaubte man Onkel Julius, so fand sich darin die Lösung nahezu aller Kundenwünsche.
»Sie? Also, ich weiß nicht so recht …« Hilfe suchend drehte er sich zu den anderen um.
Die Pickelboys tauschten skeptische Blicke.
Kein Wunder, dass sie unsicher waren, denn Marie hatte auch heute wieder den weißen Kittel boykottiert, den die Eltern im Verkauf stets trugen, ebenso wie ihre bewährte Fachkraft Agnes Federl, die bereits unter Onkel Julius der gute Geist der Schwanen-Drogerie gewesen war.
»Versucht es einfach«, ermunterte ihn Marie.
»Also, wir bräuchten nämlich jenes … Zeugs.« Ein kleiner pummliger Kerl, der bislang ruhig geblieben war, räusperte sich und lief dabei dunkelrot an. »Sie wissen schon. Das Mittel gegen diese Dinger hier.« Mit dem Zeigefinger tippte er auf seine Stirn, die mit ihren Aknebeulen und gelblich gekrönten Pusteln wirklich übel aussah.
»Unsere fabelhafte Goldtinktur also«, erwiderte Marie noch eine Spur freundlicher. »Aber gerne doch. Und wie viel davon darf es sein?«
»Für jeden erst mal eine«, brummelte der Gegelte. »Also fünf. Wie teuer käme uns das?«
»6,90 pro Fläschchen«, erfolgte prompt Maries Antwort. »Das reicht dann locker für zwei Monate.«
»Dafür bekommt man ja beim Bäcker sieben Brotlaibe!«, empörte sich der Pummlige.
»Bei uns sogar acht, wenn nicht gar neun«, piepste ein kleiner Dünner, der ebenfalls hoffnungslos verpickelt war.
»Mag sein. Aber die tun nichts für die Haut. Und wenn ihr sie dick bestrichen mit Butter vertilgt habt, blüht eure Akne anschließend womöglich nur noch stärker.«
Ihr Vater hätte Marie angesichts dieser unverblümten Antwort gerügt, denn für ihn war jeder Kunde König, aber er war ja nicht da, und Marie machte das Verkaufen schon lange keinen Spaß mehr. Sie wollte in keinem Laden mehr stehen, weder hier, noch irgendwann einmal in einer Apotheke. Deshalb hatte sie nach der Lehre ihr Pharmazie-Studium auch nur so halbherzig begonnen, dass sie bereits im zweiten Semester mehr und mehr den Boden unter den Füßen verlor. Pharmazie, das war stets Papas großer Traum gewesen. Nur ihm zuliebe hatte Marie sich nach einer halbjährigen Apotheken-Famulatur an der Ludwigs-Maximilians-Universität eingeschrieben. Doch die Vorlesungen – angefangen vom Atombau und dem Periodensystem der Elemente über Thermodynamik bis hin zu Phasendiagrammen – rauschten einfach an ihr vorbei, und beim Praktikum der anorganischen Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe im neu eröffneten Pharmazeutischen Institut ermüdete sie rasch.
Nein, ihre Interessen gingen eindeutig in eine ganz andere Richtung. Seit jeher hatten sie Zeitungen fasziniert. Manchmal kaufte sie sich ein halbes Dutzend auf einen Schlag und sog deren Inhalt begierig in sich auf. Politik, Sport, Lokales und besonders die Gesellschaftsspalten, die vom Leben der Prominenten berichteten – das alles fand sie so spannend, dass sie sogar selbst immer wieder kleine Artikel verfasste. Menschen in wenigen Zeilen zu vermitteln, was man gesehen oder gehört hatte – was konnte es Aufregenderes geben? Journalistin wollte sie werden, Artikel schreiben, am besten ein ganzes Leben lang!
»Gibt es hier vielleicht so was wie … Mengenrabatt?«, drängelte sich eine weitere kieksige Jungenstimme in ihre Gedanken. »Ich meine, weil wir doch ganz schön viele sind?«
Ausgeschlossen, wollte sie schon entgegnen. Doch nicht bei unserem Starprodukt! Dann aber fasste sie das verschreckte Rudel noch einmal intensiver ins Auge, und angesichts der offenkundigen Not überfiel sie schließlich Mitgefühl. Immerhin hatten sie sich hergetraut. Das war schon mal ein Anfang aus ihrer Misere.
»Dann will ich nicht so sein«, lautete ihre Antwort. »Ein Fünfer pro Fläschchen, okay? Aber nur heute und als absolute Ausnahme. Und hört mir bitte aufmerksam zu, wenn ich euch jetzt die Anwendung erkläre. Sonst bringt die ganze Goldtinktur nämlich nichts.«
Die allgemeine Erleichterung war mit Händen zu greifen. Gebannt lauschten sie ihr, zogen anschließend ihre Geldbörsen aus der Hosentasche und legten die blanken Markstücke auf den Tresen. Marie zählte gewissenhaft nach – den Fehlbetrag in der Kasse würde sie Papa schon erklären –, wickelte die Fläschchen ein und atmete erleichtert aus, als das Rudel mit all seinen spätpubertären Ausdünstungen den Laden wieder verlassen hatte.
Ein Blick zur Uhr.
Kurz nach eins. Ein knappes Stündchen noch, bis sie zuschließen konnte, und auch danach gab es noch jede Menge zu tun. Ein ganzer Stapel Pakete mit frisch angelieferter Ware musste ausgepackt werden. Zudem entblößte die helle Frühsommersonne unbarmherzig die feine Staubschicht auf der alten Theke aus Nussholz, was Papa nach seiner Rückkehr aus dem Garten unweigerlich auffallen würde. In den hohen Regalen hinter Marie, wo die vielen Flaschen und Porzellangefäße standen, sah es nicht viel besser aus: Das dunkle Holz schien Staub regelrecht anzuziehen. Solange noch Kundschaft zu erwarten war, konnte Marie mit der Reinigung nicht beginnen, was bedeutete, dass sie wieder einmal länger bleiben musste …
Ihr Seufzer kam aus tiefster Seele.
Erneut läutete die Türglocke.
»So melancholisch an diesem wunderbaren Samstag?«
Agnes Federls helle Stimme rang Marie ein Lächeln ab.
Fräulein Federl – die Anrede, auf der die über Siebzigjährige bestand – war wie immer die Perfektion in Person: Pepitakostümchen, weiße Bluse, rotes Einstecktuch, schwarze Pumps, schwarze Handtasche. Auf den silbernen, exakt ondulierten Wellen saß ein Hut mit einer kecken roten Feder. Das offizielle Renteneintrittsalter hatte sie längst überschritten. Aber was für die Allgemeinheit zutraf, galt noch lange nicht für sie!
»Raus mit dir, Mädchen. Draußen hockt deine Freundin auf einem dieser neumodischen Roller, dieser Vesna …« Kluge graue Augen ruhten auf Marie.
»Vespa«, korrigierte Marie. »Ach, Rosie ist schon da?«
»Und ob! Hautenge Hosen hat sie an, und auf dem Kopf trägt sie als Frisur einen auftoupierten Bienenkorb, schwarz wie Lackpapier. Lass dich davon bloß nicht anstecken, Mädchen! Deine Haare sind bildschön, so wie die Natur sie dir geschenkt hat …«
Marie nickte eilig.
»Und Sie würden wirklich für mich übernehmen …?«
»Aber natürlich«, erwiderte Fräulein Federl ebenso freundlich, wie bestimmt. »Die Maisonne lacht. Schließlich ist man doch nur einmal jung.«
Das ließ Marie sich nicht zweimal sagen. Zeitung und Handtasche waren im Nu gepackt, und schon stand sie draußen vor Rosie, die ihren Kaugummi gerade in einer dicken rosa Blase platzen ließ.
»Ich glaub es nicht«, sagte die fröhlich grinsend. »Mademoiselle Tugendsam macht tatsächlich einmal früher blau. Geschehen ja doch noch Zeichen und Wunder! Und, was sagst du zu meinem Baby?« Ihre knallrot lackierten Fingernägel strichen zärtlich über den silbernen Lenker.
»Die gehört wirklich dir, Rosie? Hast du im Lotto gewonnen?«
»Roxy«, verbesserte ihre Freundin leicht genervt. »Roswitha ist längst tot und begraben, wie oft soll ich dir das noch sagen? Mein Lottogewinn heißt Manni. Der war so freundlich.«
»Doch nicht etwa der Manni Stritter?«, bohrte Marie nach.
»Eben jener.«
»Hattest du mir nicht erst neulich gesagt, dass du dir eigentlich nicht sonderlich viel aus ihm machst?«
Roxy verdrehte die Augen. »Na ja, ein klein wenig musste ich ihm schon entgegenkommen. Männer wollen belohnt werden, wenn sie sich derart spendabel zeigen. Aber seitdem ich sein Schneewittchen bin« – sie spielte neckisch mit einer schwarzen Strähne, die sich aus ihrer Hochfrisur gelöst hatte –, »kann er die Finger nicht mehr von mir lassen. Und das hier ist die Belohnung.« Wieder strich sie stolz über den Lenker ihrer Vespa. »Schau mich nicht so an. Wieso sollte ich mir darüber den Kopf zerbrechen? Schließlich ist Geld bei Manni kein Problem. Seine Familie hat mehrere Lokale, unter anderem das elegante Café im Botanischen Garten. Eiskaffee und Torte ganz umsonst, wie wär’s damit?«
»Ich weiß nicht so recht.« Marie klang unschlüssig. »Ich lass mich nur ungern aushalten …«
»Dass ich nicht lache! Du bist jetzt Studentin, und mein Gehalt ist seltsamerweise immer schon am 20. des Monats ausgegeben. Diese Stritters sind so reich, dass die das gar nicht spüren. Außerdem reißt Manni sich darum, mir eine Freude zu bereiten. Und du solltest auch endlich klüger werden, sonst kommst du nämlich als Frau zu gar nichts.« Sie musterte Marie kritisch von oben bis unten. »An deinem Aussehen müssen wir allerdings noch feilen. Pferdeschwanz ist so was von passé, und Seidenstrümpfe bei dieser Hitze trägt heutzutage kein Mensch mehr! Dabei sind deine Beine spektakulär. Die solltest du mal zeigen …«
Marie schaute an sich hinunter.
Sie mochte das hellblaue Sommerkleid, das ihre Waden halb bedeckte, auch wenn es schon zwei Jahre alt war. Dazu trug sie Nylons, darauf legte Papa Wert, wenn sie im Laden bediente, egal, wie warm es auch sein mochte. Gegen Roxys knallenge Bluejeans und die weiße Spitzenbluse, unter der ein sexy BH durchschimmerte, kam sie natürlich nicht an. Rote BHs – wo gab es so etwas Verruchtes überhaupt? Im wieder aufgebauten Kaufhaus Oberpollinger, wo Marie seit Jahren ihre Unterwäsche kaufte, garantiert nicht. Ihre Freundin allerdings war stets nach dem letzten Schrei gekleidet, selbst damals, als sie noch gemeinsam die Berufsschule besucht hatten. Als Drogistin hatte Roxy es nur wenige Monate lang ausgehalten und sich lieber zur Kosmetikerin ausbilden lassen. Ob sie jemals eine Prüfung abgelegt hatte, darüber ließ sie ihre Umwelt im Unklaren. Aber ganz unfähig konnte sie nicht sein, sonst würde sie inzwischen nicht zur Zufriedenheit ihrer Chefin in einem renommierten Kosmetikinstitut am Marienplatz arbeiten.
»Egal, dann muss ich dich eben nehmen, wie du bist. Und jetzt steig schon auf, damit wir endlich loskönnen!«
Marie kletterte auf den Rücksitz.
»Hast du überhaupt einen Führerschein?«, fragte sie, während Roxy die Vespa startete.
»Klar hab ich den, was denkst du denn! Nur umlackiert muss mein Baby noch werden, das hab ich dem Manni schon gesagt. Rot soll es werden, rot wie die Liebe mit einem flotten weißen Rennstreifen, das passt doch viel besser zu mir.«
Roxy fuhr erstaunlich sicher, zügig, aber nicht waghalsig, und schon bald fand auch Marie Spaß daran. So entspannt an einem warmen Tag durch Neuhausen zu düsen, an das sich das weitläufiger bebaute Nymphenburg mit seinen Villen und stattlichen Gärten anschloss, war wirklich etwas anderes als die Arbeit in der Drogerie! Im Gegensatz zu anderen Stadtvierteln, wo die Bomben des Zweiten Weltkriegs so gut wie keinen Stein auf dem anderen gelassen hatten, waren hier kaum noch Kriegsschäden zu entdecken. Obwohl Marie damals noch sehr klein gewesen war, hatte sie ein paar verschwommene Erinnerungen an jene bedrückende Zeit, die sie bis heute manchmal noch als Albträume quälten.
»Schön hier, oder?«, rief Roxy ihr über die Schulter zu. »In einem dieser prachtvollen Anwesen werde ich später mal wohnen.«
»Dann musst du aber sehr reich heiraten«, erwiderte Marie lachend. »Am besten gleich einen König!«
»Mindestens! Und der ist garantiert bereits unterwegs zu mir, das spüre ich.«
Unvermittelt hielt Roxy die Vespa vor einer Villa an. Dezentes Grau mit weißen Türstöcken und lichtgrauen Fensterläden. Der Vorgarten war bestens gepflegt. Hinter der Villa erhoben sich schattige hohe Bäume.
»Wär das meins, würde ich den ganzen Garten voller Rosen pflanzen.« Roxy, die abgestiegen war, klang leicht entrückt. »In allen nur denkbaren Rot- und Rosatönen – was, glaubst du, wie herrlich so etwas aussieht! Und erst dieser Duft … riechst du ihn auch?«
Marie nickte lächelnd.
Roxy mochte manchmal ein verrücktes Huhn sein, aber sie konnte herrlich schwärmen, das gefiel Marie. Ihre eigenen Träume sahen ganz anders aus. Viele davon ruhten in der Ledermappe, die Onkel Julius ihr geschenkt hatte, niedergeschrieben auf der Princess 300, ebenfalls sein Geschenk an Marie zum bestandenen Abitur. Sie hatte sich das Zehn-Finger-System selbst beigebracht, und seitdem musste sie nicht mehr länger auf die Tasten starren, sondern konnte ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Mit Gedichten hatte sie begonnen, mehrere Kurzgeschichten folgen lassen, bis sie schließlich bei Reportagen und kleineren Artikeln gelandet war, die ihr am meisten Freude bereiteten. Inzwischen hatte sich eine beachtliche Menge davon angesammelt, und ein Ende war nicht abzusehen. Am liebsten hätte Marie von früh bis spät geschrieben. Auf diese Weise ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, reizte sie ungemein. Doch ihre Mutter hatte sich vehement gegen ihren Plan ausgesprochen, als sie ihr diesen anvertraut hatte, und auch ihr Vater, sonst offen für die meisten der töchterlichen Wünsche, reagierte ungewohnt skeptisch.
»Journalismus – das ist doch kein anständiger Beruf für eine junge Frau! Du bist abhängig von der Gunst deiner Vorgesetzten, in der Regel schlecht bezahlt, und wenn du Pech hast, auch noch ständig auf Achse. Drogistin, das ist eine solide Basis. Wenn du nun noch dein Pharmaziestudium erfolgreich beendest, führst du eines Tages eine eigene Apotheke, bist wohlhabend und gesellschaftlich hoch angesehen.«
»Hallo, hallo, Erde an Marie«, sagte Roxy. »Wo bist du denn gerade? Bei meinen Rosen?«
»So ungefähr. Ich träume auch von Rosen, Roxy. Nur sind meine schwarzweiß und passen auf DIN A4.«
»Dann hast du dich tatsächlich bei dieser elitären Journalistenschule beworben? Sag bloß!«
Marie nickte wieder.
»Und? Lass dir doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen!«
»Ich hab meine Reportage eingereicht, ganz vorschriftsmäßig, aber leider noch immer keine Antwort erhalten. Vielleicht finden sie mein Geschreibsel ja so unterirdisch, dass sie mir nicht einmal Bescheid geben …«
»Quatsch!«, widersprach Roxy. »Den Brief, den du mir geschickt hast, als Oma gestorben ist, hab ich inzwischen bestimmt hundertmal gelesen, und er hat mich immer wieder aufs Neue getröstet. Wie feinfühlig du sie geschildert hast – als hättest du Oma seit Jahren gekannt! Dabei bist du doch nur ein paarmal zum Kaffeetrinken bei uns gewesen …«
»Freut mich, dass du das sagst. Doch leider hat so ein Kondolenzbrief nur wenig mit Journalismus zu tun«, erwiderte Marie verzagt. »Da gibt es Regeln, die man beherrschen muss, verstehst du? Fabulieren allein genügt nicht, man muss wissen, was die Leute interessiert – und das dann auch noch perfekt zu Papier bringen.«
»Aber genau um so etwas zu lernen, ist diese Schule doch da, oder etwa nicht?«, bohrte Roxy nach.
»Schon. Aber der Weg dorthin ist dornig. Wenn die Reportage ankommt, wird man zu einem zweitägigen Bewerbungstest eingeladen. Das ist dann die nächste Hürde, und wahrlich keine kleine, denn viele andere Bewerber konkurrieren mit dir.«
»Du wirst garantiert eingeladen. Worüber ging deine Reportage denn überhaupt?«
»Einen Nachmittag im Seniorenheim von Onkel Julius.«
Wie lapidar sich das anhörte – doch wie lange hatte sie daran gefeilt! Geschätzte fünfzig Mal hatte Marie den kurzen Text umgeschrieben und poliert, bis sie endlich damit zufrieden gewesen war.
»Na, dann kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen. Dein heißgeliebter Großonkel bringt dir garantiert Glück. Komm, steig wieder auf, wir fahren weiter!«
Die Caféterrasse im Botanischen Garten erwies sich als gut gefüllt. Alle Tische waren besetzt, Kinder wuselten lachend dazwischen herum, und keiner der Gäste machte Anstalten zu zahlen oder zu gehen.
»Kein Problem. Wir versuchen eben hinten unser Glück.« Roxy gab nicht so schnell auf. »Da gibt es seit Neuestem eine zweite Terrasse – allerdings mit Selbstbedienung.«
Doch auch dort war so gut wie alles voll. Roxy wollte gerade auf einen Tisch zugehen, an dem ein Mann mit zwei hübschen Blondinen schäkerte, doch Marie hielt sie zurück.
»Ich kann solche Schnösel nicht leiden«, sagte sie, ohne ihre Stimme allzu sehr zu dämpfen. »Der Typ in der Lederjacke ist doch mindestens fünfzig! Hast du sein zerschrammtes Gesicht gesehen? Wetten, er fährt irgend so ein Angeberauto und ködert die Mädchen mit halbseidenen Versprechungen? Warum sonst sollten ihn zwei attraktive Zwanzigjährige derart anhimmeln?«
»Ich mag Männer mit Narben und Falten«, widersprach Roxy. »Die haben wenigstens was zu erzählen. Und hast du nicht die Riesenkamera auf dem Tisch gesehen? Vielleicht ist er ja Profifotograf. Von so einem abgelichtet zu werden, wünsche ich mir schon seit Langem. Was man mit solchen Fotos alles anstellen könnte! Komm schon, lass uns …«
Doch Marie zog sie weiter.
»Nichts da. Wir setzen uns da drüben zu dem älteren Paar. Dort haben wir garantiert unsere Ruhe. Ich geh schon mal unseren Kuchen holen.«
»Lass mich das machen«, sagte Roxy. »Manni soll schließlich sehen, dass wir da sind …«
Mit gekonntem Hüftschwung stolzierte sie los.
»Sind bei Ihnen noch zwei Stühle frei?«, fragte Marie.
»Aber gerne doch«, erhielt sie als Antwort und nahm Platz.
Mit seinen weißen Haaren und der hohen Stirn erinnerte der Mann sie an Onkel Julius. Auch der hatte solch sommerliche Ausflüge ins Grüne über alles geliebt. Aber seitdem seine Augen so schlecht geworden waren, fühlte er sich draußen schnell unsicher und verließ seine Seniorenresidenz nur noch ungern. Überhaupt war er Marie bei den letzten Besuchen erschreckend mager und ein wenig schusslig vorgekommen. Ob er krank war und ihr nur nichts davon erzählt hatte? Wenn ihrem Großonkel etwas zustieß …
Sie mochte gar nicht daran denken!
»Kurze Klarstellung, junge Frau«, sagte plötzlich eine heisere Stimme neben ihr. »Die Schrammen im Gesicht verdanke ich dem Einsatz fürs Vaterland. Ein Auge hat mich dieser Wahnsinn gekostet, und nur ein Riesendussel hat mich davor bewahrt, nicht gleich alle beide zu verlieren. Das ›Angeberauto‹, das Sie mir freundlicherweise angedichtet haben, ist in Wahrheit ein Austin Morris von 1937 mit Rechtslenkung, an dem ich mit geradezu schmerzlicher Zuneigung hänge, und meinen Fünfzigsten feiere ich erst in fünf Jahren. Krieg macht weder schöner, noch jünger, so könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen. Noch Fragen?«
Marie spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss.
»Tut mir leid«, murmelte sie. »Ich wollte Ihnen nicht …«
»Schon gut.« Der Typ in der Lederjacke grinste. »Die blonden Ladies sind übrigens meine Nichten. Zweieiige Zwillinge, und ausgesprochen fotogen.« Sein Grinsen wurde noch breiter. »Schönen Tag noch, die Dame.«
Er ging an den Tisch zu seinen Nichten zurück.
»Was war das denn gerade?« Roxy erschien mit einem voll beladenen Tablett: zwei Gläser mit Eiskaffee und Schlagsahne, zwei Piccolos nebst Sektflöten, Obstkuchen, Prinzregententorte und eine üppige Sahneschnitte mit roten Kirschen. »Hat er dich etwa belästigt?«
»Hat er nicht«, erwiderte Marie verlegen.
»Aber?«
»Mensch, das ist ja beeindruckend, was du da alles mitgebracht hast«, versuchte Marie sie abzulenken. »Dein Manni hat offenbar die halbe Kuchentheke geleert.«
»Er wollte gar nicht mehr aufhören, unser Tablett vollzuladen.« Roxy klang stolz. »Und wir können noch nachhaben, so viel wir wollen. Weil er heute nämlich leider keine Zeit für uns hat. Hochbetrieb bei schönem Wetter, so ist das eben in der Gastronomie. Also, wer von uns beiden erbarmt sich der Holländerkirsch?«
Das Kolibri hatte schon bessere Zeiten gesehen, damals, gleich nach dem Krieg, als es eines der angesagtesten Tanzlokale der Stadt gewesen war. In den Fünfzigerjahren dann hatte der Rock’n’Roll Einzug gehalten, was sich noch immer in der grellbunten, inzwischen jedoch schon reichlich verschlissenen Wanddeko mit Gitarren und Elvis-Tollen als Scherenschnitt widerspiegelte. Heute jedoch verrenkte das meist junge Publikum seine Glieder hier beim neuesten Modetanz Twist – und Roxy war ganz in ihrem Element.
Sie hatte keine Ruhe gegeben, bis Marie sich schließlich nach dem Cafébesuch zu einem Umstyling in der kleinen Erdgeschosswohnung bereit erklärt hatte, die Roxy seit dem Tod ihrer Großmutter allein bewohnte. Besonders aufgeräumt war es nicht; das Geschirr von mindestens zwei Tagen stand in der Spüle, und Staub gewischt hatte offenbar schon länger niemand mehr. Dennoch wirkten die beiden kleinen Zimmer mit ihren bunten Bildern an den Wänden und den vielen Kissen auf dem alten Küchensofa ausgesprochen gemütlich. Und bis zum Tanzlokal waren es nur wenige Schritte.
Zuerst kamen Make-up und Haare an die Reihe, was eine ganze Weile dauerte. Bis Roxy schließlich einen Pfiff ausstieß und Marie einen Spiegel in die Hand drückte.
»Jetzt schau dich an, Süße! Na, was siehst du? Eine Schönheit, oder?«
Das sollte die biedere Marie-Louise Graf sein?
Der leicht getönte Teint war samtig. Die dunkler konturierten Augenbrauen verliehen ihrem Gesicht etwas Geheimnisvolles, was das aufgetragene Rouge auf den Wangenknochen weiter verstärkte. Die üppig getuschten Wimpern wirkten lang und dicht; ein kräftiger Lidstrich hatte ihr Katzenaugen geschenkt, und noch nie zuvor waren ihre korallenrot geschminkten Lippen so üppig gewesen. Am eindrucksvollsten aber war die Verwandlung der Haare: aus trockenem Gestrüpp hatte Roxy einen elegant hochtoupierten rotgoldenen Turm gezaubert, der den Hals perfekt in Szene setzte.
»Jetzt brauchst du nur noch was Passendes zum Anziehen …« Aus Roxys Schrank flogen Röcke und Blusen nur so aufs Bett. »Zu brav … zu doof … zu eng … zu kindisch … zu …« Sie verstummte. »Den hier«, erklärte sie entschlossen und schwenkte einen schwarzen Rock. »Und obenrum den schwarzen Pulli, vorne V, hinten V – das fetzt!«
»Ich geh doch auf keine Beerdigung«, protestierte Marie. »Und außerdem hängt mir vorn ja der halbe Busen raus!«
»Dann nimmst du eben den grünen ärmellosen Pulli.«
»Aber der ist knalleng …«
»Wozu hat der liebe Gott dir Brüste geschenkt? Damit du sie präsentierst! Außerdem sieht man jetzt endlich mal deine nackten Beine, und die können sich sehen lassen. Also nix wie runter mit den Nylons! Liebe Güte, von nichts hat sie eine Ahnung! Du bist doch nicht vom Dorf, Marie, sondern lebst mitten in der Großstadt.«
»Und wenn mir kalt wird?«
»Dir wird schon nicht kalt, dafür garantiere ich.«
Nein, kalt wurde Marie nicht, denn sie kam so schnell nicht mehr runter von der Tanzfläche, dafür gingen ihr die englischen Songs zu sehr ins Blut. Wie befreiend es doch war, nicht mehr darauf warten zu müssen, aufgefordert zu werden – und das vielleicht auch noch von einem Mann, der ihr nicht einmal gefiel. Sie tanzte, wie sie wollte, und die Kerle guckten. Sollten sie ruhig! Marie fühlte sich sicher und stark. Zuerst musste sie die Bewegungen bei den anderen noch abschauen, doch schon bald ging es wie von selbst.
»Morgen hab ich garantiert überall Muskelkater«, japste sie, als sie sich zwischendrin eine Erfrischung bestellten.
»Und wenn schon! Lohnt sich doch, oder?«, erwiderte Roxy lachend in ihrem selbstgenähten Lurexkleid, das sie wie eine silberne Spacebraut wirken ließ. »Cola pur hast du bestellt? Ist nur was für Babys. Wir trinken hier alle Cuba libre. Und natürlich lassen wir uns dazu einladen!« Huldvoll nickte sie dem jungen Mann zu, der sich spontan erboten hatte, die Rechnung zu übernehmen, und schob Marie ihr Glas rüber. »Morgen kannst du dann wieder deine Schreibmaschine rauchen lassen, aber heute wird gefeiert!«
»Ganz schön süffig«, sagte Marie nach dem ersten Schluck. »Und geht ordentlich in den Kopf …«
»Das will ich meinen! Und in die Beine. Komm schon, worauf wartest du noch?«
Come on let’s twist again, sang Chubby Checker.
Wie frei Marie sich beim Tanzen fühlte – ganz leicht, fast schon übermütig! Kein Gedanke mehr an die anstehenden Klausuren, sogar ihre Ängste vor einer Absage der Journalistenschule waren für den Moment ganz vergessen. Dafür genoss sie die anerkennenden Blicke, die ihr folgten.
Du darfst in Gegenwart von Männern niemals den Verstand ausschalten, hatte ihre Mutter sie immer ermahnt. Glaub ja nicht ihren Versprechungen! Und pass bloß auf, dass du auf keinen Hallodri hereinfällst! Sonst ist dein guter Ruf ganz schnell im Eimer …
Dabei war sie doch selbst mit dem grundsoliden Papa verheiratet, der nur Augen für seine Karin hatte. Woher also rührte ihr Misstrauen? Weil die Gesellschaft es so von Frauen verlangte? Oder hatte sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht? Egal, Mama war gerade nicht da – und Marie würde sich heute Abend nach allen Regeln der Kunst amüsieren!
»Das machen wir ganz bald wieder«, sagte Roxy, als das Kolibri um kurz nach eins schließen musste. »Versprochen?«
»Versprochen!«, erwiderte Marie.
Waren es wirklich nun vier Cuba libre gewesen? Nüchtern waren die beiden Frauen auf jeden Fall nicht mehr. Eingehakt machten sie sich auf den Heimweg und standen schon nach wenigen Metern vor Roxys Haustür.
»So was von spießig, dieses München«, maulte Roxy. »Um eins macht hier alles dicht, abgesehen von einer Handvoll sündteurer Bars. Dort brauchst du allerdings einen ganz besonders spendablen Begleiter, und die sind rar gesät. In Berlin dagegen kannst du ganz entspannt unter Mädels ohne Sperrstunde um die Häuser ziehen, das haben mir Kundinnen erzählt. Da muss ich unbedingt mal hin.«
»Berlin teilt jetzt diese furchtbare Mauer«, erwiderte Marie. »Was die Menschen dort alles zu ertragen haben, auch die im Westen … Und wie eingesperrt sie sich fühlen müssen – selbst ohne Sperrstunde. Von Freunden und Verwandten getrennt zu sein, nie mehr ohne Kontrollen in den Rest der Republik reisen zu dürfen …«
»Du immer mit deiner langweiligen Politik«, unterbrach sie Roxy. »Interessiert mich, ehrlich gesagt, nicht die Bohne. Leben will ich, einfach so, jetzt und hier!« Sie breitete die Arme aus und drehte sich übermütig um die eigene Achse. »Magst du vielleicht bei mir übernachten? Sonderlich breit ist mein Bett allerdings nicht …«
»So verschwitzt, wie ich bin?« Marie zog die Nase kraus. »Das lassen wir besser. Dein Rock kommt natürlich in die Reinigung, und den Pulli bekommst du übermorgen gewaschen zurück. Dann hol ich auch die Tüte mit meinen Sachen ab.«
Roxy winkte lässig ab. »Soll ich dich schnell auf der Vespa heimbringen?«
»Bloß nicht! So beschwipst, wie du bist, fährst du noch Schlangenlinien und wirst verhaftet.«
Sie verabschiedeten sich mit einer Umarmung.
»Als Nächstes machen wir Schwabing unsicher«, erklärte Roxy beim Aufsperren der Haustür, wofür sie allerdings mehrmals ansetzen musste. »Beim Hahnhof kann man im Freien Wein trinken, im Cadore sitzen angeblich die schärfsten Typen, und im Schwabinger Nest muss es, wie ich gehört habe, später am Abend ganz besonders heiß hergehen. Das probieren wir alles aus!«
Marie lachte, winkte noch einmal und ging los.
Laue Nachtluft streichelte ihre erhitzte Haut. Die Stadt schien bereits zu schlafen, nur ein paar Autos waren noch unterwegs, so gut wie keine Fußgänger mehr. Oder tobte das Leben irgendwo anders, an Orten, von denen sie bloß nichts wusste?
»Wie vom Dorf«, murmelte sie im Gehen vor sich hin. Roxy hatte zielgenau ins Schwarze getroffen. »Und von nichts eine Ahnung. Aber damit ist Schluss! Jetzt wird gelebt und gefeiert!«
Schon bald hatte sie ihr Ziel erreicht, ein hellgraues Mietshaus mit stattlichen Balkonen in einer ruhigen Seitenstraße, in das die Familie Graf vor rund zehn Jahren gezogen war. Dort begann sie zunehmend nervöser in ihrer Handtasche zu kramen.
Verdammt, der Schlüsselbund – irgendwo musste er doch sein!
Hatte sie ihn unterwegs verloren? Vielleicht im Kolibri?
Schlagartig war Marie stocknüchtern. Nein, er lag im Labor auf Papas Schreibtisch, und sie hatte vergessen, ihn wieder einzustecken!
Und wie sollte sie nun in die Wohnung kommen?
Hilfe suchend schielte sie zum ersten Stock hinauf. Alle Fenster waren dunkel und der Balkon ohne Leiter für sie schlichtweg unerreichbar. Die Eltern schliefen garantiert längst. Sie aufzuschrecken, wäre ihr mehr als unangenehm.
Dann also doch wieder zurück zu Roxy? Aber die schlief mittlerweile sicherlich ebenfalls.
Seufzend lehnte Marie sich zum Nachdenken an die Haustür, die plötzlich nachgab. Im Freien übernachten musste sie also schon mal nicht. Vielleicht konnte sie sich unten hinlegen, wo manche Mieter ihre ausrangierten Möbel abgestellt hatten? Doch der Zugang zum Keller war abgesperrt, so wie es sich für ein anständiges Haus gehörte.
Sie zog die Pumps aus und schlich barfuß nach oben.
Wenn sie nur ganz kurz klingelte?
Papa hatte seit dem Krieg einen leichten Schlaf, der würde sie sicherlich gleich hören …
Die Wohnungstür ging auf, kaum dass sie die Klingel berührt hatte. Karin Graf im bestickten nachtblauen Seidenkimono musterte ihre Tochter vorwurfsvoll, bevor sie zur Seite trat, um sie in den Flur zu lassen.
»Fast zwei Uhr! Wo hast du dich nur herumgetrieben? Und wie siehst du überhaupt aus? Zum Fürchten!«
»Dann schau eben nicht so genau hin«, entgegnete Marie. »Wir waren tanzen, da ist es ein bisschen später geworden. Und leider hab ich meine Schlüssel in der Drogerie vergessen. Ich wollte dich nicht aufwecken. Tut mir wirklich leid.«
»Glaubst du vielleicht, ich könnte schlafen, solange du um die Häuser ziehst? Und wer ist wir?«
»Roswitha Bertram und ich. War ganz spontan und hat Riesenspaß gemacht …«
»Hätte ich mir ja denken können. Von dieser Bertram war ja noch nie etwas Gutes zu erwarten. Die ist doch wirklich weit unter deinem Niveau, Marie!«
»Ich mag es nicht, wenn du so über meine Freundin sprichst.«
»Freundin! Dass ich nicht lache – die nützt dich doch nur aus. War sie es, die dich so als Flittchen zurechtgemacht hat? Weißt du eigentlich, wie du gerade aussiehst? Wie ein gefallenes Mädchen! Getrunken hast du auch, und das offenbar nicht zu knapp. Du torkelst ja regelrecht!«
Marie spürte, wie sie immer ärgerlicher wurde.
»Ich bin schon lange keine acht mehr, Mama«, sagte sie ungewohnt scharf. »Ich ziehe an, was ich will. Außerdem entscheide ich selbst, ob ich Alkohol trinke und mit wem ich meine Zeit verbringe.«
»Wir machen uns Sorgen um dich, unser einziges Kind! Man kann ganz schnell abrutschen, wenn man noch so jung ist wie du, nur davor will ich dich bewahren. Wenn du in die falschen Kreise gerätst, wirst du es später einmal bitter bereuen …«
Die Mutter nahm Marie mit ihrer Überfürsorglichkeit den Atem, auch wenn es sicherlich gut gemeint war. In diesem Moment beneidete sie Roxy glühender denn je um die eigene Wohnung und ihre damit verbundene Unabhängigkeit. Ein Grund mehr, als Journalistin so schnell wie möglich auf eigene Füße zu kommen. Sie hoffte inständig, dass ihre Bewerbung Erfolg hatte. Lange hielt sie es so nicht mehr aus.
»Ich muss dringend ins Bett«, murmelte Marie, die keinen weiteren Eklat wollte.
»Das will ich meinen. Wir reden morgen beim Frühstück mit deinem Vater weiter …«
Darauf konnte sie lange warten.
Marie drehte sich abrupt zu ihrer Mutter um.
»Ich bin volljährig, Mama«, sagte sie und betonte jedes Wort. »Papa weiß das, und vielleicht solltest auch du diese Tatsache endlich zur Kenntnis nehmen.«
»Wie redest du überhaupt mit mir? Den ganzen Tag hat mich diese entsetzliche Migräne traktiert, und jetzt bist auch du noch so hässlich zu mir. Das habe ich wirklich nicht verdient!«
»Lass mich bitte in Frieden«, erwiderte Marie. »Ich bin müde und will nur noch ins Bett.«
Als sie ihre Zimmertür hinter sich geschlossen hatte, atmete sie tief aus. Als Kind hatte sie im Dunkeln nicht einschlafen können, aus dieser Zeit rührte noch die kleine, mittlerweile schon reichlich verbeulte Mondlampe, die sie jetzt anknipste. Papa hatte sie ihr von einer Wien-Reise mitgebracht, da war sie sieben gewesen, und seitdem hütete Marie die Lampe wie einen Schatz. Ihr diffuses Licht schimmerte hell genug, um sich im Taschenspiegel zu betrachten.
Die Mascara hatte sich abgesetzt, und die dunklen Schatten unter den Augen ließen sie aussehen wie ein müder Pandabär. Leicht verrucht wirkte sie, das musste sie einräumen, aber durchaus reizvoll.
»Typisch gefallenes Mädchen eben«, murmelte Marie und musste plötzlich grinsen. »Gar nicht so übel. Ich glaub, dabei bleib ich fürs Erste.«
Zwei
Juni 1962
Marie war schon fast aus der Küche, da fiel ihr Blick auf den Brotkasten, an dem ein heller Umschlag lehnte.
»Ist schon vorgestern angekommen«, sagte ihre Mutter und legte das Silberpoliertuch zur Seite. Feiertage wie diesen nutzte sie gern zu umfangreicheren Hausarbeiten, zu denen ihr sonst die Zeit fehlte, allerdings nicht ohne sich dabei lauthals darüber zu beklagen, dass immer alles an ihr hängen blieb. »Ich muss den Brief ganz in Gedanken eingesteckt haben. Klär mich doch bitte mal auf: Wer oder was ist dieser Absender – DJ?«
Deutsche Journalistenschule.
Die Antwort war da!
Marie wurde heiß und kalt zugleich, als sie das Schreiben hastig an sich nahm. Jetzt musste sie nur noch zusehen, die Wohnung so schnell wie möglich zu verlassen, um es ungestört lesen zu können.
»Nichts Wichtiges«, erwiderte sie und war froh, dass ihre Stimme halbwegs normal klang. »Allerdings wäre es mir lieb, wenn ich meine Post zukünftig gleich bekommen könnte.«
»Musst du dich jetzt bei allem aufregen, was von mir kommt?« Maries Mutter klang vorwurfsvoll. »Manchmal weiß ich ja kaum noch, was ich sagen soll! Ich erkenne dich gar nicht wieder, Marie. Wir haben uns doch immer so gut verstanden. Was ist nur in dich gefahren?«
Ja, das Eis, auf dem die beiden Frauen sich bewegten, war nach jener Nacht im Kolibri dünn geworden, und hätte Karin Graf gewusst, dass die Tochter seitdem so manchen Nachmittag keineswegs vor pharmazeutischen Versuchsanordnungen, sondern im gemütlichen Café Schneller hinter der Uni verbrachte, wäre es garantiert längst eingebrochen. Marie liebte diese gestohlenen Stunden in dem leicht dämmrigen Café, wo eigentlich nur noch ihre Schreibmaschine fehlte, um sich dort vollständig glücklich zu fühlen. Aber sie hatte stets ihr Notizbuch dabei, in das sie kleine Beobachtungsskizzen notierte, um sie später zu Hause weiter auszubauen. Es wimmelte hier nur so von skurrilen Persönlichkeiten – wie der Mann in den bunten Frauenkleidern, der mit Falsettstimme Lieder vortrug, oder die alte Dame, die erstaunliche Ähnlichkeit mit ihren beiden Möpsen besaß und sich lautstark mit ihnen in einer Fantasiesprache unterhielt.
Was hätte Maries Mutter wohl dazu gesagt?
Jetzt verplemperst du auch noch deine Zeit mit sinnlosem Herumsitzen oder etwas Ähnliches wahrscheinlich, daher sollte sie besser nichts davon erfahren.
»Ich mach mich jetzt auf den Weg zu Onkel Julius«, sagte Marie. »Wartet nicht auf mich. Könnte spät werden.«
»Aber wir wollten ihn doch ohnehin am Sonntag alle zusammen besuchen …«, hörte sie noch im Gehen.
Draußen schwang Marie sich auf ihr Fahrrad und fuhr los, langsamer als sonst, denn es war drückend heiß. Am Nymphenburger Kanal hielt sie an und suchte sich beim Hubertusbrunnen eine freie Parkbank im Schatten. Mit zitternden Händen riss sie den Brief auf.
»… müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Sie nicht unter den Kandidaten für die nächste Bewerbungsrunde sind …«
Sie musste die knappen Zeilen ganze drei Mal lesen, erst dann war ihr Gehirn in der Lage, die schlechte Nachricht aufzunehmen.
Der Brief sank auf ihren Schoß.
Wie hatte sie sich nur einbilden können, gut genug für diese Eliteausbildung zu sein? Natürlich hatte sie immer wieder an ihren Fähigkeiten gezweifelt – und doch gleichzeitig insgeheim so sehr gehofft, dort angenommen zu werden. Alles, alles in ihrem Leben hatte sie verändern wollen, und nun diese Abfuhr! Wenn sie das Pharmaziestudium schmiss, blieb ihr erst einmal nur der Alltagstrott in der Drogerie. Tag für Tag unter Mamas kritischen Blicken die Kunden zu bedienen und zugleich Papas abgrundtiefe Enttäuschung zu ertragen, weil sie aus freien Stücken aufgab, wonach er sich selbst ein Leben lang vergeblich gesehnt hatte …
Marie fröstelte bei dieser Vorstellung.
Auf der Nachbarbank saß ein innig knutschendes Pärchen, eine Bank weiter fütterte eine ältere Frau die Enten mit Brotresten. Ein Windhauch fuhr durch die Bäume. Alles um Marie herum war friedlich, nahezu idyllisch, nur in ihr selbst herrschte eisige, dunkle Leere.
Was nun? Sich einfach in den nächsten Zug setzen und alles hinter sich lassen?
Italien, ihr Sehnsuchtsland, erschien Marie verlockender denn je. Dabei war sie bislang nur bis zum Gardasee gekommen, wohin sie nach dem Abitur für ein paar Tage gefahren war. Obwohl diese kleine Reise schon drei Jahre zurücklag, war alles noch immer so lebendig in ihr gespeichert, als sei es erst gestern gewesen: der blaue See, die Berge, die bei einsetzender Abenddämmerung wie ein geheimnisvoller Scherenschnitt wirkten, die weiche Luft, aromatisiert von Blütenduft und würzigem Pinienaroma, sowie der Nachklang von Spaghetti und Rotwein auf der Zunge. Was hinderte sie daran, diesen Traum endlich wahr werden zu lassen, jetzt, wo ihr anderer Traum mit einem Schlag zerstört war?
Onkel Julius zum Beispiel, der sie bestimmt schon sehnsüchtig erwartete.
Marie stopfte den Brief in ihre Handtasche, ging zurück zum Fahrrad und stieg wieder auf. Sie fuhr noch ein Stück den Kanal entlang, dann bog sie ab und steuerte das Seniorenheim an, in dem ihr Großonkel seit einigen Jahren lebte.
Sie wusste, wie unendlich schwer es ihm gefallen war, seine Eigenständigkeit aufzugeben und sich professioneller Pflege anzuvertrauen. Doch eine fortschreitende Makula-Erkrankung erst auf dem einen, dann auch auf dem zweiten Auge hatte ihm keine andere Wahl gelassen. Julius Schwan, daran gewöhnt, mit präzisesten Mengenangaben zu hantieren, musste ertragen lernen, dass seine Welt zunehmend verschwamm. Irgendwann war er in seinem Häuschen nachts die Treppe hinuntergestürzt und hatte sich dabei einen komplizierten Knietrümmerbruch zugezogen. Es hätte noch weitaus schlimmer ausgehen können, aber auch so war er seitdem niemals wieder richtig auf die Beine gekommen. Sein Kopf jedoch funktionierte so schnell und klar wie eh und je, und sein trockener Humor war nach wie vor unwiderstehlich. Alle im Seniorenheim schätzten ihn, Marie jedoch hing mit zärtlicher Liebe an ihm. So war es schon gewesen, als sie mit den ersten unsicheren Schritten zu ihm getapst war und ihre kleine Hand in seine große gelegt hatte. Für Marie war er der Großvater – der einzige, den sie hatte. Sie war erst drei gewesen, als die Eltern ihres Vaters 1943 den britischen Bombenangriffen auf München zum Opfer gefallen waren, und der Vater ihrer Mutter war bereits vor ihrer Geburt in Schlesien verstorben. Onkel Julius aber war immer da gewesen, seit sie denken konnte, und verstand sie bis heute wie kein anderer. Manchmal hatte sie das Gefühl, er könne in ihr lesen wie in einem offenen Buch.
Julius Schwan ruhte auf dem schattigen Balkon in einem Liegestuhl, als Marie sein Zimmer im zweiten Stock betrat, ausgestattet mit einigen der liebevoll restaurierten Biedermeiermöbel und zahlreichen silbergerahmten Fotografien, die auch schon sein früheres Zuhause geziert hatten. Für einen Moment erschrak sie. Wie zerbrechlich er im Schlaf aussah, die silbernen Haare auf dem Kissen licht wie die eines Babys.
Der alte Mann schlug die Augen auf, als sie zu ihm trat. Sie waren nicht mehr so leuchtend blau wie früher, sondern inzwischen weißlich verwaschen.
»Du riechst aber gut, Malou«, sagte er schnuppernd. »Wie ein warmer Sommertag. Und wie schön dein Kleid knistert! Rot ist es, richtig? So viel kann ich gerade noch erkennen.«
Malou – der Name, der nur ihnen beiden gehörte. Marie liebte es, wenn er sie so nannte.
»Wie geht es dir?«, erkundigte sie sich, froh darüber, wie fest ihre Stimme klang. »Und natürlich hast du es richtig erkannt – ich bin heute ganz in Rot.«
»Wie soll es einem alten Knochen wie mir schon gehen? Sehen kann ich kaum noch was, Laufen wird zunehmend zum Problem, nur die Nase ist noch halbwegs zu gebrauchen – und zum Glück auch meine Ohren. Komischerweise wachsen die immer weiter. Keine Ahnung, wohin das noch führen wird! Vielleicht findest du ja eines Tages statt meiner einen Elefanten im Zimmer …« Er grinste verschmitzt, wurde jedoch schnell wieder ernst. »Was ist los, meine Kleine? Ich hör doch ganz genau, dass dich etwas bedrückt. Lass uns zusammen einen schönen Tee trinken, und dabei erzählst du mir, was es ist.«
Marie holte die Teekanne, die schon im Zimmer bereitstand, und füllte zwei Tassen.
»Kuchen?«, fragte sie, während sie sich einen Klappstuhl heranzog.
»Aber immer! Agnes, die treue Seele, war so lieb, mir gestern ihren herrlichen selbstgebackenen Nusszopf vorbeizubringen. Steht drinnen zugedeckt auf der Kommode. Was täte ich nur ohne sie? Selbst bei dieser Hitze schwingt sie das Nudelholz für mich.«
Marie schnitt von dem Kuchen ab. Dabei fiel ihr Blick auf die Fotos im Silberrahmen, die sie immer wieder gern betrachtete: Mama und Papa als Hochzeitspaar, ein süßes Babyfoto von ihr, drei junge Männer in Seglerkluft – Onkel Julius mit seinen Cousins Franz und Gustl, der eine dunkel, der andere blond.
Wie jung er damals noch gewesen war!
Ein hübscher Mann mit einer kecken Himmelfahrtsnase.
Jetzt war er alt und auf ihre Hilfe angewiesen. Marie brachte ihm das Gewünschte. Julius kostete zunächst und verzehrte danach zwei Stücke mit sichtlichem Genuss, während sie ihres auf dem Teller nur zerkrümelte.
Anschließend lehnte Julius sich mit einem behaglichen Seufzer zurück.
»Und jetzt raus damit: Was liegt dir auf der Seele?«
Jetzt kamen die Tränen doch, obwohl Marie sich felsenfest vorgenommen hatte, nicht zu weinen.
»Sie wollen mich nicht«, sagte sie schluchzend. »Die Journalistenschule, an der ich mich beworben habe, hat abgesagt. Ich fühl mich so … so …«
Sie konnte nicht weitersprechen.
»Dann probierst du es eben im nächsten Jahr noch einmal«, erwiderte Julius aufmunternd. »So mancher berühmte Schauspieler musste sich x-mal bewerben, bis ihn eine Schule angenommen hat – und heute kennt ihn ganz Deutschland. Das ist doch kein Beinbruch.« Er tätschelte zärtlich ihre Hand. »Bei jedem Versuch lernt man etwas dazu.«
»Ich will aber nicht zur Bühne …«
»Weiß ich doch, war ja nur ein Beispiel dafür, dass man niemals gleich aufgeben sollte.«
»Aber so lange halte ich es nicht mehr aus, verstehst du? Ja, ich weiß, die Drogerie war dein Leben, und bei Mama und Papa ist das nicht anders, aber ich fühle mich zwischen Vollwaschmitteln, Damenbinden, Pinzetten und Klosterfrau Melissengeist einfach nur eingesperrt. Ich könnte schreien, wenn eine Kundin mich nach Fleckenmitteln fragt, oder ich ihr teure Faltencremes empfehlen soll. Und wenn dann auch noch diese verklemmten Pickelboys auftauchen …«
»Unsere treuesten Kunden«, unterbrach er sie. »Mach mir die bloß nicht madig.«
»Mach ich doch gar nicht. Meinetwegen sollen die bis zum Kinn in deiner Goldtinktur baden. Aber ich gehe ein dabei, Onkel Julius. Und das mit der Pharmazie ist erst recht nichts für mich! Ich war zu Schulzeiten nicht einmal schlecht in Physik und Chemie, aber inzwischen verstehe ich in den Vorlesungen nur noch Bahnhof. Im Labor bin ich so was von tollpatschig, du solltest mich nur mal sehen – eine einzige Katastrophe! Weil meine Gedanken nämlich ständig abschweifen …« Sie schlug mit der Hand auf die Stuhllehne. »Journalistin möchte ich werden, und nichts anderes, verdammt noch mal!«
Er musterte sie schweigend.
»Wenn du so energisch wirst, erinnerst du mich an deine Mutter in jungen Jahren, weißt du das?«, sagte er dann. »Karin hat damals ihr Leben auch ganz fest in die eigenen Hände genommen. Da war sie kaum älter als du heute.«
»Mama? Die ist doch ganz anders als ich«, protestierte Marie. »Schon rein äußerlich, und dann auch vom Charakter her …« Sie brach ab. »Wir beide haben in letzter Zeit ganz schön oft Zoff«, räumte sie ein. »Sie will einfach nicht wahrhaben, dass ich erwachsen bin. Und wenn ich noch weiter unter ihren Fittichen bleibe, wird sich das auch so schnell nicht ändern. Am liebsten würde sie mir noch Pausenbrote für die Uni schmieren, dabei will ich doch gar nicht mehr studieren!«
»Dann hör auf, wenn das Studium dir so wenig bringt, wie du sagst. Lebenszeit ist viel zu kostbar, um sie zu vergeuden.«
»Einfach so?«
»Einfach so«, bekräftigte Julius. »Manchmal muss sich eine Tür erst ganz schließen, bevor sich eine neue auftun kann. Wovor hast du Angst, Malou? In München gibt es doch genügend Zeitungen, bei denen du dich um ein Volontariat bewerben kannst.«
»Eine Drogistin, die unbedingt zur Presse will? Ist das nicht unfassbar lächerlich?«
»Ganz und gar nicht! Du bist klug, liebst Sprache und kannst wunderbar formulieren. Außerdem strebst du ja sicherlich nicht sofort den Chefredakteursessel an, oder?«
»Natürlich nicht. Aber …«
»Kein Aber, sondern los!«
»Du weißt, wie schüchtern ich bin«, wandte sie ein. »Mich einfach blind bewerben …« Sie schüttelte den Kopf. »Das würde mich große Überwindung kosten. Aber du hast recht. Einen Versuch wäre es auf jeden Fall wert.«
»Siehst du.« Julius wirkte zufrieden. »Alles andere hätte mich auch gewundert, ich kenne dich schließlich! Leg deiner Bewerbung unbedingt ein sympathisches Foto bei, damit sie gleich sehen, wer da bei ihnen anklopft. Aber keins aus dem Automaten, auf denen sieht man immer aus wie ein Verbrecher.«
»Einverstanden. Und wenn mich alle Zeitungen in München ablehnen?«
»Dann musst du deine Suche eben ausdehnen. Augsburg, Landshut, Regensburg …«
»Dann wäre ich allerdings weit weg von dir …«
»Schlimm für mich«, entgegnete er bewegt. »Aber mein Leben habe ich gelebt, und deines fängt jetzt erst an. Also nur Mut, Malou!«
»Ich versuche es«, sagte sie. »Nur die Eltern sollten vorerst bitte nichts davon erfahren, sonst wird mein Druck noch größer.«
»Bist du dir sicher?«
»Bin ich. Vor allem Mama reagiert immer so komisch, wenn ich das Wort Journalismus in den Mund nehme. Und Papa ist auch total dagegen, das weiß ich. Kann ich mich auf dich verlassen?«
»Was für eine Frage!« Er klang ehrlich empört. »Habe ich jemals etwas verraten, das du mir anvertraut hast?«
Marie streichelte seinen Arm.
»Nie wieder frage ich dich das«, murmelte sie verlegen. »Versprochen.«
»Über kurz oder lang solltest du aber schon vor Karin und Theo Farbe bekennen, das ist dir doch klar, oder?«, fuhr er fort. »Sonst müsstest du ja eine Art Doppelleben führen, und so etwas geht niemals lange gut.«
Sie nickte.
»So weit wären wir also schon mal.« Julius klang zufrieden.
»Weißt du, eigentlich hab ich mein Bewerbungsschreiben sogar schon im Kopf«, sagte Marie. »Wollen wir es gleich mal zusammen durchgehen?«
»Ausgezeichnete Idee!« Julius grinste spitzbübisch und wirkte auf einmal jünger, so sehr schien ihn ihr Vorschlag zu inspirieren. »In der obersten linken Kommodenschublade findest du Papier und Kugelschreiber. Und dann nichts wie los!«
»Dein alter Onkel ist echt klasse«, sagte Roxy, während sie ihre frisch umlackierte Vespa in einer ruhigen Nebenstraße abstellte, damit sie sich unbeschwert in das abendliche Getümmel stürzen konnten. »Könntest du mir den nicht mal borgen?«
Marie hatte ihr ausgiebig von ihrer gemeinsamen Aktion erzählt, die einige Zeit in Anspruch genommen hatte, bis Julius und sie mit dem Ergebnis zufrieden gewesen waren. Jetzt musste sie die Bewerbungen nur noch ins Reine tippen, sich ansprechend fotografieren lassen und dann alles losschicken. Es hatte sich gut angefühlt, aktiv zu werden. Die erdrückende Schwärze in ihr war wieder lichter geworden. Und obwohl ihr klar war, dass sie erneut Geduld aufbringen musste, blickte sie nun wieder hoffnungsfroher in eine Zukunft ohne Verkaufstresen. Daher hatte Roxy sie zu dieser abendlichen Vergnügungsfahrt nach Schwabing nicht erst lange überreden müssen. Schließlich war heute Feiertag, die Uni morgen fiel aus, und Marie war zudem jeder Grund willkommen, die elterliche Wohnung zu meiden.
»Das müsstest du schon ihm selbst überlassen«, erwiderte Marie lächelnd, als sie Seite an Seite losspazierten. »Aber wenn Onkel Julius erfährt, dass ich meine Bewerbungsantworten an deine Adresse schicken lassen darf, damit meine Eltern nicht gleich Lunte riechen, stehen deine Chancen vermutlich ganz gut.«
Marie war schon ewig nicht mehr in Schwabing gewesen. Alles wirkte irgendwie lockerer und bunter. Es war fast neun Uhr abends, aber noch immer so warm, dass man keine Jacke brauchte. Halb Schwabing schien auf den Beinen; bärtige Studenten und feierlustige Passanten jeden Alters flanierten unter den hohen Pappeln der Leopoldstraße an Künstlern in farbigen Hemden vorbei, die auf dem Gehweg ihre Bilder zum Kauf ausstellten. Frauen und junge Mädchen zeigten, was sie zu bieten hatten – Schultern, Dekolleté, Beine. Marie war froh, dass sie ihr rotes Kleid mit dem Carmenausschnitt und der breiten Lederschärpe trug – natürlich trotzdem kein Vergleich zu Roxys aufregendem Spaghettitop in leuchtendem Zitronengelb zur passenden Caprihose, die ihr so manch bewundernde Blicke einbrachten.
Jeder Tisch im Freien war besetzt. Aus den offenen Türen der Cafés und Lokale tönte Musik.
»Dort vorn ist der Hahnhof«, sagte Roxy, die auf ihren hohen Absätzen so entspannt stöckeln konnte, als trüge sie Wanderschuhe. »Und jetzt Zähne zeigen, Schätzchen, und ganz, ganz liebreizend dreinschauen! Schließlich brauchen wir zwei freie Plätze …«
Doch auch das hinreißende Lächeln, das sie beide aufsetzten, half leider nichts, denn alles war hoffnungslos voll. Notgedrungen zogen sie weiter und ergatterten im Eiscafé Cadore ein paar Meter weiter einen der winzigen Tische. Roxy bestellte Campari, während Marie sich für einen doppelten Espresso entschied.
»Ist doch wirklich herrlich hier, findest du nicht?«, schwärmte Roxy. »Die warme Sommernacht, das bunt gemischte Publikum – und siehst du die heißen Sportwagen, die vor dem Café hupend Corso fahren? Ich wette, das sind lauter Filmproduzenten auf der Suche nach neuen Gesichtern.«
»Du willst zum Film?« Marie zog die Brauen hoch. »Das höre ich heute zum ersten Mal.«
»Warum nicht? Manni hat erst neulich wieder gesagt, wie fotogen ich bin. Warum sollte es dann vor laufender Kamera anders sein? Das bisschen Text ist doch wirklich kein Problem. Ich hab gehört, die haben da so Tafeln, von denen liest du alles ab, was du zu sagen hast. Beim Theater wäre das natürlich anders, da musst du ellenlange Monologe auswendig lernen, aber ein kurzes Wortgeplänkel mit meinem Filmpartner …«
Roxys Geplapper verschmolz mit dem Straßenlärm und dem aktuellen Schlager von Conny Froboess, der gerade aus der Musikbox neben der offenen Tür dudelte.
Zwei kleine Italiener.
Ein Ohrwurm, den man so schnell nicht wieder aus dem Kopf bekam. Beim diesjährigen Grand Prix in Luxemburg war die Sängerin damit für Deutschland angetreten und hatte es nur bis ins Mittelfeld geschafft, doch die Kassen dürften für sie klingeln, denn seitdem wurde ihr Schlager im Radio rauf und runter gespielt.
Unwillkürlich hatte Marie im Takt mitgewippt, doch sie hörte damit auf, als ein junger Mann ungefragt auf den dritten freien Stuhl neben ihr sank.
»Was für ein gnadenloser Kitsch«, spöttelte er. »Aber damit werden die Spießer herrlich verarscht – und nichts anderes haben sie verdient!«
Er hatte ein flächiges Gesicht, große dunkelblaue Augen und trotzige Lippen. Seine Züge waren ein wenig zu grob, um anziehend zu wirken, aber er strahlte eine gewisse aggressive Sinnlichkeit aus. Das karierte Hemd war nur lässig zugeknöpft und entblößte eine glatte Brust, auf der zaghaft ein paar schwarze Haare sprossen. Nicht einmal sein blasierter Tonfall vermochte darüber hinwegzutäuschen, wie jung er noch war.
Was für ein vorlauter Pennäler, dachte Marie. Achtzehn, höchstens neunzehn. Und reißt schon so weit die Klappe auf.
»Was bist du denn für ein freches Kerlchen?« Roxy klang amüsiert. »Ich mag die Conny nämlich. Sehr sogar. Und meine Freundin mag sie auch.«
»Nicht dein Ernst, oder?« Sein Blick flog neugierig zwischen Marie und ihr hin und her. »Zwei so scharfe Chics wie ihr – und dann fliegt ihr auf so einen langweiligen Scheiß?« Er fuhr mit der Zunge über seine Lippen. »Ich bin übrigens der Baader Andi, und das hier ist mein Kiez.« Eine große Geste. »Und wer seid ihr?«
»Dornröschen und Schneewittchen«, erwiderte Marie rasch, bevor Roxy ihre echten Namen preisgeben konnte.
»Der war gut!« Andi lachte schallend. »Ich steh auf schlagfertige Weiber, musst du wissen. Aber verdammt trocken ist es hier, findet ihr nicht auch? Ich bestell uns mal was Anständiges zu trinken.« Er winkte den Kellner herbei. »Drei Gin Fizz, Angelo«, bestellte er großspurig. »Aber mit ordentlich Alkohol, wenn ich bitten darf!«
Im Handumdrehen standen die hohen Gläser vor ihnen auf dem Tisch.
»Ich kann Gin nicht ausstehen«, sagte Marie, als Andi ihr zuprosten wollte. »Und erst recht keine Milchbubis, die mir vorschreiben wollen, was ich trinken soll.«
»Milchbubi? Ich seh schon: Dornröschen stellt die Stacheln auf. Macht die ganze Angelegenheit gleich noch interessanter.« Er leerte sein Glas in einem durstigen Zug und griff dann nach Maries. »Dann werd ich mich mal gnädigerweise deines Drinks erbarmen.«
Rasch war auch ihr Glas halb leer.
»Manieren hast du aber keine, oder?«, fragte Roxy spitz. Sogar ihr schien sein Auftritt langsam zu viel zu werden.
»Nur wenn ich mag. Was allerdings relativ selten vorkommt.« Andi fläzte sich wie hingerotzt auf seinem Stuhl und rülpste ungeniert. »Lust auf richtig gute Musik? Am Wedekindplatz steigt gerade ein grandioses Livefolk-Konzert, falls ihr wisst, was das ist …«
»Blöd sind wir nicht, falls du das meinst«, fiel Roxy ihm leicht säuerlich ins Wort.
»Umso besser! Die Typen mit ihren Gitarren haben echt was drauf. Die Bullen haben sie aus dem Englischen Garten vertrieben, ungeheuer eigentlich, wo all das saftige Grün doch dem Volk gehört. Aber die Jungs haben sich zum Glück nicht einschüchtern lassen, und das werde ich mir jetzt anhören.«
Inzwischen war Maries Glas vollkommen leer.
Andi beugte sich nach vorn und sah ihr tief in die Augen.
»Also, wie wär’s?«, fragte er. »Muss ja nicht unbedingt nur bei Musik bleiben. Rotblonde Wildkatzen rangieren bei mir nämlich ganz weit oben, damit du Bescheid weißt. Und ich hätte heute ganz zufällig sturmfrei …«
»Null Komma null Interesse, damit du Bescheid weißt. Aber lass dich bloß nicht aufhalten«, lautete Maries kühle Antwort. »Wir wollen nämlich endlich unsere Ruhe haben.«