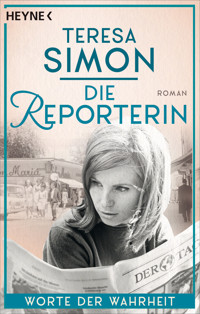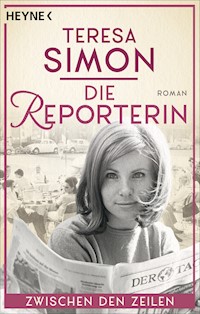9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Garten der Villa verbirgt sich ihr Geheimnis ...
Anna Kepler, Erbin einer alten Schokoladendynastie, hat gerade ihre zweite Chocolaterie in der Dresdner Altstadt eröffnet. Auch die Familienvilla hat Anna wieder in Familienbesitz gebracht. Als sie den legendären Rosengarten, der der Villa einst ihren Namen gab, neu anlegt, stößt sie auf eine alte Schatulle. Sie enthält das Tagebuch einer Frau, die vor hundert Jahren in der Villa gelebt hat. Doch Anna hat noch nie von dieser Emma gehört und begibt sich auf Spurensuche. Dabei stößt sie auf ein schicksalhaftes Familiengeheimnis ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
TERESA SIMON
DieFrauen derRosenvilla
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Zum Buch
Anna Kepler, Erbin einer alten Schokoladendynastie, hat gerade ihre zweite Chocolaterie in der Dresdner Altstadt eröffnet. Auch die Familienvilla hat Anna wieder in Familienbesitz gebracht. Als sie den legendären Rosengarten, der der Villa einst ihren Namen gab, neu anlegt, stößt sie auf eine alte Schatulle. Sie enthält das Tagebuch einer Frau, die vor hundert Jahren in der Villa gelebt hat. Doch Anna hat noch nie von dieser Emma gehört und begibt sich auf Spurensuche. Dabei stößt sie auf ein schicksalhaftes Familiengeheimnis …
Zur Autorin
Teresa Simon ist das Pseudonym einer bekannten deutschen Autorin, die mit ihrem Mann in München lebt. Sie reist gerne (auch in die Vergangenheit), ist neugierig auf ungewöhnliche Schicksale, hat ein Faible für Katzen, bewundert alles, was grünt und blüht, hat sich schon seit Jugendtagen für die aufregende Geschichte der Schokolade interessiert – und liebt die wunderschöne Elbmetropole Dresden, aus der ein Teil ihrer mütterlichen Linie stammt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Originalausgabe 03/2015
Copyright © 2015 by Teresa Simon
Copyright © 2015 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: © Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Nejron Photo
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN: 978-3-641-14472-2V002
www.heyne.de
Schokolade ist der Stoff, aus dem die Träume sind.
Üppige, dunkle, samtweiche Träume,
die die Sinne umhüllen und Leidenschaft wecken.
Schokolade ist Wahnsinn, Schokolade ist Entzücken.
Judith Olney(amerikanische Autorin)
Wenn der Sommer sich verkündet,
Rosenknospe sich entzündet,
wer mag solches Glück entbehren?
Prolog
Dresden, Juni 1913
Dieser Brief ist an Dich gerichtet, meine geliebte Emma, obwohl er Dich niemals erreichen darf, selbst dann nicht, wenn meine Augen für immer geschlossen sind. Aber ich muss ihn schreiben, weil die Schuld mir sonst den Atem raubt.
Während ich hier an dem zierlichen Biedermeiersekretär aus Wien sitze, der noch von Gustavs Großmutter Hermine stammt, schläfst Du nur wenige Türen weiter in Deinem Himmelbett – kein Kind mehr, das kann ich deutlich sehen, und dazu wären nicht einmal die bewundernden Männerblicke nötig, die jetzt immer öfter Dir anstatt mir folgen, wenn wir beide zusammen im Großen Garten flanieren. Aber natürlich bist Du auch noch keine erwachsene Frau. Noch lange nicht.
Ich weiß, Du bräuchtest die Mutter, die Dich auf diesem schwierigen Weg begleitet. Niemand hätte es mehr verdient als Du, mein Zaubermädchen! Mit Deinem Lachen, Deiner Fröhlichkeit, der Lebendigkeit, die aus Dir sprudelt, hast Du uns alle angesteckt, vom allerersten Tag an, als ich in Deine dunklen Augen geschaut habe.
Manche behaupten ja, alle Kinder kämen blauäugig zur Welt, doch Deine Augen waren so rund und groß wie polierte Kastanien, und genauso sind sie bis heute geblieben. Ich kann mich in ihnen verlieren, Dein Vater tut es für sein Leben gern – und nicht anders wird es einmal dem Glücklichen ergehen, der in Liebe zu Dir entbrennt.
Wie sehr würde ich mir wünschen, sein Werben um Dich mit jeder Faser auskosten zu können, doch es wird mir nicht vergönnt sein, meine Emma. Ich spüre, wie meine Kraft schwindet, von Tag zu Tag ein wenig mehr. Sie rinnt aus mir heraus, und ich finde nichts, womit dies aufzuhalten wäre.
Was habe ich getan!
Und tat es doch nur Deinetwegen …
Bis jetzt ist mir noch niemand auf der Spur, aber ich rechne jeden Tag mit einem herrischen Pochen an unserer Tür. Ob Dein Vater das überleben wird, weiß ich nicht. Gustav ist nicht so stark, wie er scheint. Das wirst Du auch noch bemerken, falls Du es nicht schon längst weißt, was ich vermute. Sein Ordnungssinn, sein Streben nach Redlichkeit und Anstand sind nichts anderes als eine geschickt kaschierte Furcht vor den starken, wilden Gefühlen, die in ihm brodeln. In dieser Hinsicht ist er wirklich Dein Vater, Emma.
Manchmal kann ich es kaum ertragen, welch starke Verbündete Ihr beide geworden seid, obwohl es auch ganz anders hätte kommen können, so, wie die Dinge nun einmal liegen …
Es gibt Tage, da fühle ich mich fast wie eine Fremde, wenn ich Euch beide zusammen sehe. Ich erschrecke darüber und bin gleichzeitig froh, denn es wird Dir den Abschied von mir leichter machen. Das niederzuschreiben fällt mir schwer. Und doch muss ich es tun, wenigstens ein einziges Mal, bevor ich Euch verlasse.
Ja, Du hast richtig gehört, Emma: Ich kann nicht länger bleiben, obwohl ich mir nichts anderes wünsche. Das Glück mit Euch beiden war alles, was ich jemals wollte. Dafür habe ich alles riskiert – und alles verspielt. Das Unsagbare lässt sich nicht mehr abwischen. Wie ein feiner roter Film hat es sich auf meine Haut gelegt, verfolgt mich im Wachen, im Träumen.
Wenn ich überhaupt noch schlafe …
Die Nächte, früher Freunde, die mir bunte Träume geschenkt haben, sind längst zu Feinden geworden. Ich liege im Bett neben deinem Vater, hellwach und mit entzündeten Augen, in denen ungeweinte Tränen brennen. Du würdest dich voller Grauen von mir abwenden, hättest Du nur die geringste Ahnung, Du, die jedes aus dem Nest gefallene Vögelchen, jedes weinende Kind, jedes Unrecht dieser Welt berührt. An Gustavs Reaktion will ich lieber erst gar nicht denken …
Ich habe den Faden zerschnitten, der mich unlösbar an Euch beide band. Dabei habe ich sie niemals gehasst – nicht einmal an jenem schrecklichen Tag, an dem sie mir alles nehmen wollte. Denn was ich in ihr sah, hat mich weich gemacht, versöhnlich. Ich spürte ihre Not, hatte sie ja viele Jahre selbst durchlitten. Doch dann kam jener kalte, jener entsetzliche Moment, in dem sie mir drohte – und ich außer mir geriet.
Eine schwarze Wand. Dumpfes, leeres Rauschen. Und dann – nichts.
Ich weiß nur noch, dass sie plötzlich auf dem Boden lag. Leblos. Unfassbar jung, fast wie ein schlafendes Mädchen, wäre da nicht ein rotes Rinnsal aus ihrem Kopf geflossen … Ich wusste, dass ich fliehen musste, so schnell wie möglich. Niemand war in der Nähe. Keiner hatte uns beobachtet – bis auf jenes seltsame Kind. Ein Junge. Sechs, höchstens sieben Jahre alt. Mager, fast schon spillerig. Auf dem Kopf eine dunkle Schiebermütze, unter der er beinahe verschwand. Darunter ein weißes, dreieckiges Gesicht mit einem energischen Kinn. Nie werde ich seinen Blick vergessen. Kieselgraue Augen, wissend und abwägend, als würden sie einem erwachsenen Mann gehören.
Einem Mann, der seine Rache plant …
Ach, meine Emma, ich verliere mich in Ängsten und habe dabei noch nicht einmal das Wichtigste zu Papier gebracht:
Du bist das Licht meines Lebens.
Das Kind, das ich mir stets gewünscht habe.
Mein über alles geliebtes, kluges Mädchen.
Verzeih mir, wenn Du kannst! Und bring mir eine Rose, wenn sie mich gefunden haben, eine cremeweiße Damaszenerrose mit zartrosa Innenleben, wie wir beide sie so sehr lieben.
Ich fürchte, ich bin die schlechteste Mutter der Welt. Und wollte Dir doch vom ersten Tag an die allerbeste sein! Ich küsse Dich und schicke Dir einen Engel, der über Dich wachen soll.
Leb wohl, geliebtes Herz!
Deine Mutter
1
Dresden, April 2013
Anna liebte Freitage, seit sie ein kleines Mädchen war.
Vielleicht weil die Woche dann beinahe aufgeräumt schien? Oder weil sie an einem Freitag kurz vor Mitternacht geboren war, und in einer Glückshaube noch dazu, wie ihr Großvater immer so gern erzählt hatte?
Jedenfalls hatte sie ihre neue Schokoladenmanufaktur unbedingt an einem Freitag eröffnen wollen, auch wenn zahlreiche Um- und Neubauten den Termin bis nach Ostern verschoben hatten. DieSchokolust,wie Anna sie genannt hatte, lag in der Dresdner Neustadt und unterschied sich bis auf die Namensgleichheit in so gut wie allem vom »Stammhaus« in der Altstadt. Hier gab es weder Goldornamente noch ovale Metalltischchen oder gedrechselte Stuhllehnen, keinerlei Schnickschnack, auf den die Touristen aus aller Welt abfuhren.
Stattdessen hatte sich Anna bei der Wandfarbe für ein duftiges Mint entschieden, das dem Raum angenehme Frische verlieh, und Tische und Stühle in hellem Ahorn gewählt, die in ihrer optischen Schlichtheit an Bauhausmöbel erinnerten. Es gab eine raffiniert zu öffnende Glaskühltheke, in der die hausgemachten Pralinen und Tartlets bestens zur Geltung kamen. Erst heute Morgen hatte Anna sie liebevoll dort drapiert. Und hinter dem Tresen stand eine der besten Kaffeemaschinen, die der Markt zu bieten hatte – die chromblinkende Vulcana, die nicht nur verführerischen Crema zaubern konnte, sondern auch Milch so duftig aufschäumte, dass sie jede der hochwertigen Trinkschokoladen aus ihrem Sortiment zum Hochgenuss veredelte.
An den Wänden waren schmale Holzregale angebracht, auf denen die edlen Tafeln präsentiert wurden: sortiert nach Kakaogehalt und Herkunftsland sowie raffinierten Zusätzen wie Chili, Meersalz, Hirschschinken, Nüssen oder diversen anderen ausgefallenen Beimischungen. Kleine elfenbeinfarbene Kärtchen, von Anna eigenhändig beschriftet, wiesen nicht nur die Preise aus, sondern erklärten in Stichworten das Wichtigste. Für Kinder gab es zwei große Glastrommeln, bestückt mit bunt eingewickelten Schokobonbons aus eigener Produktion, hochklassige Milchschokolade, die bei den Kleinen gut ankam. Ja, die Gäste konnten kommen.
»Aufgeregt, mein Mädchen?«, hörte sie eine rauchige Stimme hinter sich.
Anna fuhr herum. »Und wie! Musst du dich eigentlich immer anschleichen?« Ihr Schimpfen klang liebevoll. »Eines Tages werde ich vor Schreck noch tot umfallen!«
»Gewiss erst lange nach mir, mein Anna-Kind. Und jetzt sag mir, was es noch zu tun gibt, bevor wir aufschließen.«
Henny Kretschmar hatte Anna schon gekannt, als sie gerade laufen lernte. Eine Freundin und enge Vertraute ihres Großvaters und, wie Anna erst später begriff, noch viel mehr als das, obwohl die beiden ein stattlicher Altersunterschied trennte. Ihre mittlerweile fast siebzig Jahre sah man Henny nicht an, und zum alten Eisen, wie sie zu sagen pflegte, gehörte sie mit ihrem quirligen Wesen, der schlanken Figur im malvenfarbenen Twinset sowie passendem Bleistiftrock und den sorgfältig blondierten Haaren ohnehin noch lange nicht.
»Also, wenn du schon so fragst, dann richte doch bitte für jeden Tisch einen Probierteller her. Du weißt ja, wie wir das immer machen. Während ich mich …«
»… zum Zaubern in die Küche verziehe«, vollendete Henny.
Anna nickte lächelnd.
»Und wie wird sie dieses Mal heißen, die Praline des Monats?«, fragte Henny weiter. »Deine Mandel-Eier vom März waren wirklich ein Traum!«
»Zitronen-Nuss-Kuss, wenn du es genau wissen willst. Mein süßer Gruß an den Frühling.«
Anna stieg die drei Stufen zu den hinteren Räumen hinauf. Links ging es zu ihrem kleinen Büro, in dem es noch ziemlich chaotisch aussah, weil im Vor-Eröffnungsstress viel Papierkram unerledigt geblieben war. In der Mitte lag die Küche, vor der sie aus einer spontanen Laune heraus einen alten Wandspiegel angebracht hatte. Eigentlich entsprach er gar nicht ihrem sonstigen Geschmack, und vielleicht gefiel er ihr gerade deshalb so gut: oval, mit breitem Rahmen, auf dessen verblasstem Cremeton zahlreiche Keramikrosen in Pink und Rot prangten. Für einen Moment hielt sie inne und musterte ihr Spiegelbild. Natürlich war sie wieder einmal viel zu blass. Ihre Mutter würde sofort ihre unvermeidlichen Tees und Pastillen auspacken, um die einzige Tochter rosig und gesund zu kriegen, wenn sie sie jetzt sehen könnte. Aber wie sollte eine echte Rothaarige zu Frühlingsbeginn auch einen gebräunten Teint haben?
Das Gesicht, das ihr entgegenschaute, war dreieckig und besaß trotz aller Apartheit, die ihr immer wieder bescheinigt wurde, etwas flirrend Mädchenhaftes, obwohl Anna bereits zweiunddreißig war. Sie hatte rehbraune, weit auseinanderstehende Augen unter rötlichen Brauen, die so regelmäßig wuchsen, dass sie wie gestrichelt wirkten. Die Nase war kurz und gerade, das Kinn energisch. Dazwischen ein großer roter Mund mit blitzenden, nicht ganz geraden Zähnen, der gern lachte, sich aber ebenso schnell kritisch verziehen konnte. Und Myriaden von Sommersprossen, während der endlosen Wintermonate zwar dezent verblasst, nun aber, wie Anna nur allzu gut wusste, lediglich auf die ersten Sonnenstrahlen lauernd, um in alter Frische hervorzubrechen.
Eigentlich sah sie niemandem in der Verwandtschaft richtig ähnlich – mit Ausnahme ihres Großvaters, der als junger Mann ebenfalls rötliches Haar gehabt musste, schenkte man der Familienfama Glauben. Auf den verblichenen Schwarz-Weiß-Fotografien aus jener Zeit ließ sich das nicht verifizieren. Anna hatte ihn nur weißhaarig gekannt. Allerdings war seine Haut so empfindlich gewesen, dass Kurt Kepler sich in kürzester Zeit einen Sonnenbrand einfangen konnte, wenn er nicht aufpasste – genau wie sie.
Du könntest eigentlich ganz schön stolz auf mich sein, Opa Kuku,dachte sie.Meine zweite Schokomanufaktur steht unmittelbar vor der Eröffnung, und die erste läuft besser denn je.Nur so konnte ich seit Jahren jeden verfügbaren Cent in das Haus stecken, das man dir erst lange nach der Wende zurückerstattet hat – und das auch noch in äußerst marodem Zustand. Du würdest das ramponierte Gebäude, zu dem du mich als Siebenjährige zum ersten Mal geführt hast, kaum wiedererkennen, so prachtvoll sieht die Rosenvilla inzwischen wieder aus – auch wenn ich die Kredite für die Renovierung noch eine halbe Ewigkeit abstottern muss.
Aus dem Verkaufsraum hörte Anna fröhliches Trällern und warf einen letzten prüfenden Blick hinunter. Hennys Hände mit den akkurat manikürten Perlmuttnägeln steckten in Hygienehandschuhen, wie es sich gehörte. Sie hatte eben Gefühl und Geschmack! So lagen die Schokostückchen auch keineswegs planlos auf den mintgrünen Tellern, sondern waren wie kleine Dominosteine in Reih und Glied drapiert – und dennoch musste Anna bei diesem Anblick doch noch einmal hinunterlaufen.
»Doch niemals die weiße Venti mit Mandeln und Pistazien nach der gesalzenen 80 %igen von Carolla anbieten«, rief sie. »Wie sollen sie denn so jemals richtig schmecken lernen? Das ist für die Zunge ungefähr so, als müssten die Beine nach einem Tango ohne Vorwarnung in einen rustikalen Ländler übergehen!«
In Hennys grünen Augen standen auf einmal Tränen. »Du bist genau wie er«, murmelte sie. »Weißt du das eigentlich? Manchmal glaube ich Kurt zu hören, wenn du so redest! Und genau deshalb liegt dein neuer Laden ja auch hier – habe ich recht? Weil nur ein paar Häuser weiter früher seine alte Fabrik war!«
»Dann weißt du ja auch, was zu tun ist«, sagte Anna. Ja, sie wollte ihrem Großvater nah sein, und es gefiel ihr, dass sie es auf diese Weise sein konnte. Auf den zweiten Teil von Hennys Satz ging sie trotzdem nicht ein. Was sie zur Wahl dieses Standorts bewogen hatte, wollte sie für sich behalten. »Und jetzt muss ich wirklich ›zaubern‹ gehen, sonst wird das heute nichts mehr mit unserer Praline des Monats.«
Sie ging zurück nach oben in ihr kleines Reich. Auf den ersten Blick gab es hier nichts Besonderes: weiße Wände, viel Edelstahl, zwei sauber geplante Küchenreihen, die alles boten, was man zum Backen und Pralinenmachen brauchte: Herd, Vorratsschrank, zwei Kühleinheiten, Spüle, Spülmaschine, dazwischen große Arbeitsflächen, die einfach sauber zu halten waren.
Das wichtigste Gebot beim Pralinenmachen, Anna, ist und bleibt die Sauberkeit. Wer hierbei schlampert und kleckst, wird niemals zu den Großen gehören.
Heute bekam sie den Großvater wirklich nicht aus dem Kopf.
Jedes Mal, wenn sie hier zu hantieren begann, merkte sie wieder voller Stolz, wie gut alles durchdacht war. Weder musste sie sich verrenken, um an die zahlreichen Schüsseln und Gefäße zu gelangen, die sich auf einem langen Wandbord stapelten, noch bei den zahllosen Spülgängen, die zwischendrin unweigerlich anfielen. Selbst nach langen Stunden in ihrer Küche fühlte sich Anna selten erschöpft, sondern war meist noch in der Lage, sich weitere aufregende Variationen in Schoko, Nuss oder Frucht auszudenken. Wenngleich ihr der große, der einzigartige Wurf bis heute noch nicht gelungen war – doch der Wunsch danach ließ sich einfach nicht aus ihrem Kopf vertreiben …
Die Vollmilchkuvertüre im Wasserbad war mittlerweile entschieden zu warm geraten. Behutsam schüttete Anna eine weitere Ladung Schokochips hinein und begann zu rühren, um alles herunterzukühlen. Früher waren die Lippen des Patissiers der einzige Maßstab gewesen, heute jedoch verwendete Anna dafür ein handliches Thermometer. Doch eines hatte sich seit damals nicht geändert – rühren, rühren und noch einmal rühren lautete die Devise, um eine geschmeidige, sämige Grundmasse zu bekommen, die danach weiter veredelt werden konnte.
Zu diesem Zweck holte Anna die alten Metallformen aus dem Kühlschrank, die noch aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg stammten und die Dresdner Bombennacht vom Februar 1945 als eine der wenigen Stücke aus dem einstigen Familienbesitz überstanden hatten. Schon als Kind hatte Anna sie immer wieder neugierig inspiziert und sich, sobald sie lesen konnte, gefragt, was die verschlungenen Initialen EB auf der Rückseite wohl bedeuten mochten.
B – diesen Nachnamen trug niemand unter ihren Verwandten, soweit sie wusste, und auch jemand, dessen Vorname mit einem E begann, war nirgendwo bekannt.
Woher also stammten sie ursprünglich? Ihr Großvater, sonst ein Füllhorn an Wissen und Geschichten, wenn es um Schokolade ging, war auffallend einsilbig geworden, als sie ihn danach gefragt hatte – daran erinnerte sie sich noch genau. Immer wieder hatte sich Anna vorgenommen, noch einmal nachzubohren, es aber im Lauf der Jahre vergessen.
Nachdenklich strich sie mit den Fingern über die eingravierten Buchstaben. EB – welcher Patissier mochte sich einst hier verewigt haben? Oder war es gar eine Frau gewesen, worauf der Schwung und die Eleganz der Buchstaben eventuell hindeuten mochten?
Leider würde sie es nicht mehr erfahren. Der Großvater konnte es ihr nicht mehr sagen, denn er war nun schon seit zwölf Jahren tot, und aus ihren Eltern hatte sie alles Wissenswerte längst herausgequetscht. Im Gegensatz zu ihr schienen sich weder Greta noch Fritz Kepler sonderlich für die Familiengeschichte zu interessieren. Die Mutter ging ganz in ihrem Beruf als Apothekerin auf, besonders seit sie sich nach der Wende mehr und mehr auf Naturheilkunde spezialisiert hatte und schließlich zu einer begeisterten Jüngerin der Hildegard-Medizin geworden war. Der Vater, einstmals Lehrer und seit einem Herzinfarkt vor ein paar Jahren frühzeitig pensioniert, verbrachte die meiste Zeit bei seinen Kakteen.
Nicht einmal Henny hatte ihr weiterhelfen können, obwohl ihre Augen bei Annas Nachfrage eine Spur dunkler geworden waren. »Keine Ahnung«, hatte sie gemurmelt und sich jäh weggedreht. »Glaubst du vielleicht, er hätte mich in alles eingeweiht? Nein, Kurt hatte immer seine Geheimnisse. Bis zum Schluss. Wahrscheinlich hat er mich genau deshalb so fasziniert.«
Anna drehte die Form um, griff zu einem Wattebausch und wischte die Vertiefungen sorgfältig aus. Danach wiederholte sie die gleiche Prozedur mit Küchenkrepp.
Auf dem Herd wurden derweil Sahne und Zitronensaft warm, eine heikle Mischung, bei der man aufpassen musste, damit sie nicht umkippte. Anna zog den Topf von der Platte und gab seinen Inhalt in die Kuvertüre. Sie hob den Abrieb einer Zitrone darunter und begann erneut zu rühren, bis die Masse Zimmertemperatur erreicht hatte.
Ein samtig-frischer Geruch erfüllte die Küche, und Anna spürte, wie ihr das Wasser im Mund zusammenlief. Das beste Zeichen, denn ein absoluter Geschmackssinn ließ sich niemals betrügen. Zuerst füllte Anna die Metallformen mit temperierter Kuvertüre, um für die nachfolgende Ganache einen Schokoladenhohlkörper zum Füllen zu bilden und ein knackiges Erlebnis im Mund zu garantieren. Danach goss sie die Masse vorsichtig in die vorbereiteten Schokoladenhohlkörper. Zum Schluss setzte sie jeweils eine lohfarbene halbierte Pekannuss in die Mitte. Die neue Mischung musste mindestens zwei Stunden im Kühlschrank aushärten, bevor sie diese Pralinen zu den anderen in der Theke legen konnte.
Anna krempelte gerade die Ärmel ihrer tannengrünen Strickjacke auf, als ihr Handy vibrierte. »Jan?«, fragte sie. »Was gibt’s?«
»Wir rücken schon heute an. Ist das für dich okay?« Die Stimme des jungen Gartenbauers klang leicht verzerrt.
»Heute?« Annas Augen flogen zu der alten Uhr, die neben der Tür hing. »Wie stellst du dir das vor? Ich mache in ein paar Minuten meinen neuen Laden auf. Wir hatten doch extra morgen vereinbart …«
»… da müssen wir ganz überraschend nach Wittenberg. Lutherhaus. Großauftrag. Kann ich leider nicht sausen lassen. Die Zeiten sind hart, das weißt du ja.« Sie spürte sein Zögern mehr, als sie es hörte. »Dann eben nächste Woche. Dienstag? Würde das passen?«
»Nein«, widersprach Anna. »Geht es nicht doch morgen? Wir sind doch ohnehin sehr spät mit den Rosen dran, wenn sie richtig gut einwachsen sollen! Wer hätte denn auch gedacht, dass es so lange dauert, bis die Lieferungen aus Frankreich endlich eintreffen?«
»Na ja, es mussten ja auch partout die ausgefallensten Sorten sein …«
»Schluss damit«, unterbrach sie ihn. »Nicht schon wieder. Also, was ist nun?«
Jan zögerte.
»Ich könnte unter Umständen Hennig nach Wittenberg schicken«, sagte er schließlich. »Zusammen mit dem neuen Lehrling, aber besonders wohl ist mir dabei ehrlich gesagt nicht. Kannst du es nicht doch heute irgendwie einrichten?«
Anna spulte innerlich den Tag im Schnelldurchlauf ab. Die Journalisten würden gegen Mittag eintreffen, falls sie überhaupt kamen, und die ersten Kunden vermutlich bald nach dem Aufschließen der Schokolust. In der Regel wurde es gegen Nachmittag ruhiger. Außerdem konnte sie sich auf Henny blind verlassen.
»Also gut, meinetwegen«, seufzte sie. »Wenn es unbedingt sein muss!«
»Prima. Kommt mir sehr entgegen. Ich hasse es nämlich, dich zu enttäuschen.« Seine Stimme klang plötzlich angespannt.
Jan hätte sich so viel mehr von ihr gewünscht. Sie wussten es beide, obwohl wohlweislich keiner daran rührte. Ja, es hatte diese Nacht vor drei Jahren gegeben, doch danach hatte sich Anna für Ralph entschieden. Daran kaute Jan noch heute, obwohl Annas Beziehung mit Ralph längst vorbei war.
»Dann tu es doch einfach nicht«, sagte sie und spürte wieder den vertrauten Schmerz, den der Gedanke an Ralph immer noch in ihr auslöste. Dabei war sie es doch gewesen, die die Trennung vorangetrieben hatte – nicht er. Weil sich Anna plötzlich wie in einer Falle gefühlt hatte, voller Angst, sich doch nicht für den Richtigen entschieden zu haben. Wieso überkam sie jedes Mal dieses lähmende Gefühl der Ausweglosigkeit, sobald es mit einem Mann ernst wurde? Trotz endloser Grübeleien hatte sie noch keine Antwort darauf gefunden.
»Vor Nachmittag werde ich es heute nicht schaffen. Aber ihr könnt ja schon mal ohne mich anfangen. Du hast doch noch immer den Schlüssel für das Gartentor?«
»Habe ich. Gut – dann später bei dir in Blasewitz.« Wieder dieses Zögern, das Anna früher immer so anziehend gefunden hatte, weil es für sie nach Tiefe und ungewöhnlicher Ernsthaftigkeit geklungen hatte. »Ich freu mich auf dich – und die Setzlinge sind der Hammer. Wird alles genauso, wie du es dir vorgestellt hast: die Wiederauferstehung des Rosengartens!«
Anna hielt das Telefon noch einen Augenblick in der Hand, nachdem Jan aufgelegt hatte, weil ihr Herz plötzlich überlaut zu pochen begonnen hatte. Geschafft, dachte sie. Nun hat das lange Warten endlich ein Ende!
Dann legte sie es zurück auf das Regal, wusch sich die Hände und ging mit einem Lächeln hinunter in den Laden.
*
Sie war spät dran, obwohl sie so energisch in die Pedale getreten hatte, dass ihr auf der Lessingstraße sogar ein Polizist warnend nachgepfiffen hatte. Der neue Laden hatte sich gleich nach dem Aufsperren zügig gefüllt, und zu Annas großer Freude waren es nicht nur Neugierige gewesen, die schnell mal die Nase hereinstecken wollten, sondern echte Kunden, die großzügig eingekauft hatten. Allerdings waren trotz ihres ehrgeizigen E-Mail-Verteilers nur zwei Journalisten erschienen: eine aufgetakelte Blondine von Radio Energy, die den Probierteller blitzschnell abräumte, aber so lustlos Fragen stellte, dass Anna nichts Großes erwartete, und ein älterer Herr von der Sächsischen Zeitung, der sich überall umschaute und seine Eindrücke in einem schwarzen Ringbuch festhielt.
Dafür drängten sich noch lange nach Mittag die Kunden in der Schokolust, und als es ruhiger wurde und sie endlich Zeit hatte, auf die Uhr zu schauen, war sie erschrocken, wie spät es schon war.
Zum Glück hatte sie das alte Fahrrad von Großvater Kurt auch heute nicht im Stich gelassen. Einen wahrhaft stolzen Betrag hatte Anna bereits in seinen Erhalt gesteckt, eine Summe, für die sie sich gut und gern ein fabrikneues Exemplar der gehobenen Klasse hätte leisten können. Aber wer außer ihr kurvte heute noch mit einem Original Brennabor-Herrenrad von 1932 durch Dresden?
Als Anna abstieg, beschmierte sie sich die helle Jeans mit Öl. Fluchend nahm sie sich zum wohl hundertsten Mal vor, endlich für ein passendes Schutzblech zu sorgen – was sie jedoch ebenso wenig in die Tat umsetzen würde wie die anderen Male zuvor. Denn das Fahrrad war das Heiligtum ihres Großvaters gewesen und hatte ihn durch die dunkelsten Zeiten seines Lebens getragen. Dass er es ihr neben der Villa testamentarisch vermacht hatte, war für Anna Ehre und Ansporn zugleich. Deshalb blieb es genau so, wie er es ihr hinterlassen hatte, selbst wenn der alte Ledersattel alles andere als bequem war. Nur die stets defekte Lichtanlage hatte sie vor Kurzem durch moderne LED-Beleuchtung ersetzt.
Sie fuhr sich mit der Hand durch die zerzausten Haare. Dann holte Anna das kleine Kuchenpäckchen aus dem Korb und betrat durch die rückwärtige Pforte den Garten.
Beim ersten Mal hatte der Anblick ihr schier den Atem verschlagen, doch selbst jetzt, da der Garten ihr vertraut war und sie für sich beanspruchte, nahezu jeden Winkel zu kennen, war die Wirkung noch immer enorm. Die alten Eichen an der Ostseite, die Kirsch-, Apfel- und Pflaumenbäume im Westen. Nach Süden erstreckte sich vor dem großen Wohnzimmer die Terrasse, die sie im vergangenen Sommer mit mattgrauen Schieferplatten hatte auslegen lassen. Von dort führte zwischen großen Rasenflächen ein schmaler Kiesweg hinunter zur Elbe. Er gabelte sich vor dem Holzpavillon mit dem von außen optisch leicht verunglückten Dach, das von innen aber wie ein geöffneter Palmwedel wirkte und von einer schlanken Säule mittig gestützt wurde. Rechts ging es zu einer Pinien- und Zederngruppe, unter der eine alte Marmorbank stand; links zu dem ovalen Seerosenteich, umstanden von Japangras, an dessen Stirnseite ein bemooster Steinbuddha im Gras ruhte.
»Bin da!«, rief sie, als sie beim Näherkommen Jans aschblonden Kopf zwischen den bereits ausgepackten Setzlingen sah. Neben ihm kauerte Kito, sein sorbischer Mitarbeiter mit der schwarzen Igelfrisur, der in der Regel kein Wort zu viel verlor. »Tut mir leid, die Herren, ging beim besten Willen nicht eher! Soll ich euch eine Kleinigkeit bringen, damit die Arbeit noch mehr Spaß macht?«
»Endlich«, knurrte Jan, ohne aufzusehen, doch Anna wusste genau, dass er das nicht lange durchhalten würde. »Höchste Zeit, dass du hier aufschlägst. Sonst wird dein Garten nämlich so, wie ich es will!«
Sie lachte, um die schlechte Stimmung zu vertreiben – und weil sie genau wusste, dass er die Rosen niemals irgendwo gegen ihren Willen einsetzen würde. Schließlich hatten sie alles gemeinsam geplant, aufgezeichnet und außerdem wochenlang alte Bücher und aktuelle Kataloge gewälzt, um den Garten so traditionsgerecht wie möglich zu gestalten.
Über das Wie waren sie dabei allerdings ein paar Mal aneinandergeraten, weil Anna stets das letzte Wort behalten wollte. Verbissen hatte sie in ihrer Erinnerung nach den wenigen Sätzen gekramt, die der Großvater über den Garten geäußert hatte.
Ein Blumenparadies … Das war ihr schließlich wieder eingefallen. Überall nur die allerschönsten Rosen. Ihnen verdankt das Haus schließlich seinen Namen – Rosenvilla …
»Ich kann gar nicht verstehen, dass eine junge Frau wie du so stur am Gestern klebt«, hatte Jans Hauptvorwurf gelautet. »Damit wirst du die Vergangenheit auch nicht wieder lebendig machen – und wenn du noch so viele alte Rosensorten anschaffst!«
»Als ob ich das nicht wüsste«, lautete Annas Verteidigung. »Und stell dir vor, das will ich auch gar nicht! Ich möchte nur das Gestern in das Heute einladen und sehen, wie die beiden sich vertragen.«
Aber war das wirklich die ganze Wahrheit?
Etwas in ihr, das sie nicht genauer benennen konnte, sehnte sich nach Tradition und Kontinuität, und seitdem die Rosenvilla nach und nach ihr altes Gesicht wiederbekam, wuchs dieses Verlangen noch weiter. Anna erzählte niemandem davon, erst recht nicht Jan, weil sie sein Frotzeln über ihre altmodische Art, wie er es nannte, gründlich leid war.
Doch sie brauchte seine Erfahrung und sein Wissen, um den verwilderten Garten nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Was die Rosen betraf, hatten sie sich schließlich auf einen Kompromiss geeinigt, und heute, an diesem sonnigen Aprilnachmittag, an dem nur ein auffrischender Wind daran erinnerte, dass der hartnäckige Winter noch gar nicht so lange vorbei war, schien es, als könne vielleicht sogar ein kleines Wunderwerk daraus entstehen.
Wenn sie doch nur mehr Fotos von früher gehabt hätte! Ihr Großvater war in dieser Hinsicht äußerst zurückhaltend, ja fast schon knausrig gewesen, und Anna selbst war bei seinem Tod vor zwölf Jahren noch zu jung, um diese Erinnerungsstücke energisch genug einzufordern. Hatte er sie vernichtet oder an einem geheimen Ort deponiert? In Kurt Keplers Hinterlassenschaft jedenfalls fand sich nicht mehr als ein kleiner Stoß Fotografien, was sie zutiefst bedauerte. Dennoch hatte niemals die Ahnung sie verlassen, dass er nicht ganz bei der Wahrheit geblieben war, wenn er behauptete, Krieg, Bombardierung und vor allem die »Hunnenjahre« der frühen DDR, wie er zu sagen pflegte, seien schuld daran gewesen. Immer wieder hatte sie das Gefühl beschlichen, dass er etwas vor ihr verbergen wollte.
Er hatte es nicht anders gewollt, davon war sie mittlerweile überzeugt. Aber was genau gab es zu verbergen, das keiner sehen durfte?
Jetzt entdeckte sie voller Freude, dass Jan und Kito die Rosa Gallica bereits eingepflanzt hatten. Natürlich musste sie noch ein paar Wochen Geduld aufbringen, bis sie das kräftige Rot sehen und sich am betörenden Duft dieser alten Sorte erfreuen würde, die schon von den Apothekern des Mittelalters als Medizinpflanze verwendet worden war – aber ein Anfang war gemacht.
»Die Zentifolia setze ich unterhalb der Terrasse«, rief Kito. »Die Büsche müssen weit auseinander, also wundere dich nicht! Sonst gehen sie nämlich nicht richtig auf. Deine werden in Rosa und Pink blühen. Oder gibt es inzwischen andere Wünsche?«
»Nein«, sagte Anna, die spürte, wie die Freude in ihr immer größer wurde. »Alles prima. Ich kümmere mich um Kaffee und Kuchen. Bin gleich wieder bei euch!«
Sie sperrte die Terrassentür auf und ersparte sich damit die halbe Umrundung der Villa. Doch auch so hatte sie eine ordentliche Strecke zurückzulegen, bis sie endlich in der Küche angelangt war, von der sie ein ganzes Stück abgetrennt und zur neuen Vorratskammer umfunktioniert hatte.
Die geöffneten weißen Flügeltüren ermöglichten sogar von hier aus den Blick ins Grüne. Wo einst der Salon gewesen sein mochte, hatte Anna sich Bibliothek und Esszimmer eingerichtet, weil sie schon als Kind davon geträumt hatte, mit Freunden und Gästen vor gut gefüllten Bücherregalen zu speisen. Daneben schloss sich der Wohnraum an, den sie trotz seiner Größe nur spärlich möbliert hatte, um kein Gefühl von Enge aufkommen zu lassen. Am meisten liebte sie hier den geschwungenen Kamin aus hellem Marmor, vor den sie einen dicken Berberteppich gelegt und eine bequeme rote Couch gestellt hatte.
Was sie mit der Eingangshalle anfangen sollte, von der aus die leicht geschwungene Treppe zu den oberen Räumen führte, wusste Anna noch immer nicht. Man hätte hier ohne Weiteres mehrere Billardtische aufstellen oder sie zur Ausstellungsfläche mit wechselnden Gemälden oder Skulpturen machen können, so geräumig war sie. Wer auch immer dieses Haus geplant hatte, war an verschwenderischem Platz und Luftigkeit interessiert gewesen. Der gläserne Halbkreis mit den lasierten Strahlen, eingelassen in der Eichentür, durch die man von der Straßenseite aus hereinkam, machte den Eingang einladend und festlich.
Welch ein Wahnsinn, dass ich hier allein wohne, schoss es Anna nicht zum ersten Mal durch den Kopf, während sie die Kaffeemaschine anwarf. Aber ihre Eltern waren durch nichts aus ihrer gemütlichen Wohnung in der Albertstadt herauszubekommen und fast erleichtert gewesen, dass sie Kurts Erbe angenommen hatte.
Und Annas eigene Lebensplanung? Ein Haus wie dieses verlangt nach Reden und Lachen, dachte sie, nach stimmungsvollen Abendgesellschaften und gemütlichen Kaffeetafeln. Nach Kinderfüßen und regelmäßigen Größenmarken an den Türstöcken. Nach einem tapsigen Hund, der durch die Räume fegt und sich im Garten übermütig im Gras wälzt. Nach Katzen, die sich vor dem Kamin räkeln.
Es müsste ein Familienzuhause sein, voller Wärme, Aufregungen und Geborgenheit. Doch nichts von alldem war momentan in Sicht. Und seitdem Ralph und sie nicht mehr zusammen waren, erschien ihr dieser Traum manchmal sogar unerreichbar. Natürlich gab es jede Menge plausibler Gründe, die ihr dazu einfielen. Annas Arbeit für die Schokomanufakturen verschlang den Löwenanteil ihrer Zeit. Außer gelegentlichen Kinoabenden mit ihrer Freundin Hanka, den Besuchen bei ihren Eltern und wenigen Abendessen mit Jan, die sie bewusst selten stattfinden ließ, gab es nur noch die kostbaren Stunden, in denen sie über neuen Pralinenrezepten brütete.
Doch die Arbeit war nicht der wahre Grund für ihr Alleinsein, wie Anna sehr wohl wusste. Sie hatte sich zurückgezogen, als es mit Ralph ernster und verbindlich zu werden begann, als er immer häufiger vom Zusammenziehen gesprochen hatte, von Heirat.
Und von gemeinsamen Kindern.
»Worauf wartest du, Anna?« Seine verletzte Stimme, als sie wieder einmal ausgewichen war, hatte sie noch immer im Ohr, und auch den plötzlichen Schmerz in Ralphs blauen Augen vor sich – als sei es erst gestern gewesen und nicht schon Monate her. »Auf einen Prinzen, der dich mit seinem Schwert aus dem Dornendickicht heraushaut, das du mühsam um dich errichtet hast? Der bin ich leider nicht – sorry!«
Danach war er gegangen. Und hatte bis heute auf keine SMS mehr reagiert.
Mühsam scheuchte Anna diese Erinnerungen fort, während sie Kaffee durch die Maschine laufen ließ und die Tartlets auf einem Teller drapierte. Danach trug sie das Tablett zu den beiden Männern nach draußen.
Die Wolken, die zuvor an einem frühlingshaft blauen Himmel vorbeigezogen waren, hatten sich vermehrt. Jetzt blies der Wind nicht mehr frisch, sondern pfiff kalt. Anna fröstelte und war froh, dass sie im Vorbeigehen den alten Schal aus dem Wohnzimmer mitgenommen hatte, den sie sich nun um die Schultern schlang. Zartlila Rosenblüten auf verblasstem Grün, ein Gewebe so weich und leicht zerschlissen, dass es fast an Spinnweben erinnerte. Anna hatte den Schal, sorgfältig in Seidenpapier eingeschlagen, in einer der Kisten auf dem Dachboden gefunden, die ihr Großvater noch vor seinem Tod dorthin hatte bringen lassen.
Wer ihn wohl früher getragen haben mochte?
Großmutter Alma, die schon lange tot gewesen war, als Anna geboren wurde? Auf den wenigen Fotos, die es von ihr gab, wirkte sie mit den ondulierten dunklen Haaren und den zarten, leicht melancholischen Zügen abwesend, fast traumwandlerisch. Als sei sie in Gedanken weit fort. Körperlich erschien sie Anna so fragil, als könne der nächste Lufthauch sie umwehen. Wie passte das zu einem Mann wie Kurt, der vor Energie schier explodierte und selbst im hohen Alter noch voller Pläne und Ideen gesteckt hatte?
Neben Alma sah er kräftig aus, fast robust, als könnte ihm der Mangel der letzten Kriegsjahre nichts anhaben. Dichte helle Brauen in einem dreieckigen Gesicht, der Mund schmal und energisch. Die hellen Augen hatte er leicht zusammengekniffen. So hatte er meistens ausgesehen: kritisch, stets wachsam, innerlich auf der Lauer. Nur in Gegenwart seiner Enkelin war sein Blick manchmal weich geworden – daran erinnerte sich Anna bis heute gern.
Ein zarter Duft stieg ihr in die Nase. Magnolia, wenn sie nicht irrte. Für ihren Geschmack eigentlich zu süß und schwer, doch als Gedanke an die unbekannte Großmutter durchaus willkommen.
»Sie war eine Dame – vom Scheitel bis zur Sohle«, hatte Kurt über seine früh verstorbene Frau gesagt. »Nicht ganz von dieser Welt, wenn du weißt, was ich damit meine. Vielleicht ist es sogar besser, dass sie uns so früh verlassen hat und den harten Neuanfang nach Kriegsende nicht mehr erleben musste!«
Hatte sie einstmals in diesem Garten gestanden und bestimmt, wo die Rosen gepflanzt werden sollten – so wie Anna heute? Oder hatte Alma dies wie so vieles andere ihrem tatkräftigen Gatten überlassen, der ohnehin am liebsten seinen Willen durchgesetzt hatte?
Plötzlich wurde es Anna noch kühler. Sie schlang den Schal enger um sich. Jan und Kito hatten den Kaffee ausgetrunken und die Tartlets hungrig verschlungen. Wahrscheinlich hatten sie nicht einmal bemerkt, was da gerade an Raffinesse ihren Gaumen gekitzelt hatte.
»Die Rose de la Reine kommt also seitlich der Terrasse«, murmelte Jan, tief in seinen Plan versunken. »Richtig? An der wirst du lange Freude haben, Anna, die blüht nämlich fast den ganzen Sommer – und zwar lila-rosa.«
»Richtig«, bekräftigte Anna. »Und die karminrote Rose du Roi setzt du bitte in die Nähe. Stell dir vor, diese Sorte war schon alt, als sie in Frankreich die Revolution ausgerufen haben!«
»In Ordnung, Chefin«, sagte er mit leisem Spott. »Die Zufriedenheit unserer Kunden ist und bleibt unser Himmelreich.«
Kito hatte einstweilen weitere Rosenballen herbeigeschleppt. »Und hier die Königinnen«, sagte er. »Damaszenerrosen. Darf ich vorstellen? Madame Hardy, blüht cremeweiß, mit einem Hauch von Rosa. Wohin damit?«
»Zum Pavillon«, sagte Anna, ohne nachzudenken. »Ich möchte ihren Duft in der Nase haben, wenn ich dort sitze.«
Von dieser Rosensorte hatte der Großvater stets am meisten geschwärmt: die weiße Schönheit, in deren Mitte ein imaginierter Blutstropfen für die zarte Farbgebung sorgte.
Sie begleitete Kito, während er die wurzelnackten Rosen zum Pavillon trug. Der Garten war noch immer groß – und doch klein im Gegensatz zu dem, was einst zum Anwesen der Rosenvilla gehört hatte. Anna war nichts anderes übrig geblieben, als Teile des Grundstücks zu verkaufen, um den Kredit für die Renovierung nicht noch weiter aufzustocken. Was einst ihrem Großvater gehört hatte, war in Kriegs- und Nachkriegszeiten abgewohnt und zum Teil mutwillig zerstört worden.
Die anschließenden Jahre des SED-Regimes hatten nichts daran verbessert – ganz im Gegenteil. Bis zu zehn unterschiedliche Mietparteien waren hier untergebracht gewesen; Küche sowie Sanitärräume hatten niemals auch nur den Hauch einer Überholung erfahren. Im Nachhinein wunderte es Anna, dass das alte Eichenparkett überhaupt noch vorhanden und nicht irgendwann als Brennmaterial im Ofen gelandet war. Ähnliches galt für den zurückhaltenden Deckenstuck, der zu ihrer Verblüffung nur an wenigen Stellen beschädigt gewesen war, obwohl man unzählige Farbschichten abtragen musste, um das ursprüngliche Cremeweiß wieder zum Vorschein zu bringen.
Und auch den hölzernen Pavillon hatten sie erstaunlicherweise verschont, zumindest weitgehend. In seinem Inneren fanden sich zwar krude Spuren von Löchern und Nägeln, die sich aber mit einigem Aufwand wieder beseitigen ließen. Anna hatte den Pavillon abbeizen und die Holzbank, die um die Mittelsäule lief, neu schreinern lassen. Inzwischen war sie mit Kissen und bunten marokkanischen Kissenbezügen bestückt, die sie bei einem Schokoladen-Seminar in München entdeckt hatte. Sobald die Sonne darauf fiel, leuchteten sie in Curry, Magenta und Gold und verliehen dem Ganzen mit der sich ins Dach auffächernden Säule einen orientalischen Touch – und luden so die Opulenz des Orients an die Elbe ein.
Kito kniete vor dem Beet. Blank lag es vor ihm, penibel von allem Unkraut gesäubert.
»Lockeres Erdreich«, sagte er zufrieden. »Geradezu ideal.« Seine kräftigen Hände glitten durch die Erdkrumen, als wollten sie sie massieren, um sie noch aufnahmefähiger zu machen – als er plötzlich stutzte.
»Was ist los?«, fragte Anna besorgt. In den vergangenen Wochen hatte sie sich eifrig durch die entsprechende Fachliteratur gelesen. »Doch nicht irgendwelche dieser fiesen Wurzelunkräuter, die meine Rosen kläglich eingehen lassen werden?«
Er schüttelte den Kopf. »Jan!«, rief er. »Komm doch mal.«
Jan kam herbeigelaufen und kniete sich neben ihn.
»Fühlst du das?«, fragte Kito, als Jan ebenfalls seine Hände in der Erde vergaben hatte.
»Klar.« Auf Jans Stirn erschien eine tiefe Falte. »Hart ist es. Fühlt sich an – wie Metall.« Er wandte sich zu Anna um. »Bringst du uns bitte zwei Schaufeln?«
»Aber es ist doch keine – Bombe, oder?«, fragte sie erschrocken.
»Dafür ist es mir entschieden zu kantig«, sagte Jan. »Es sei denn, die Nazis hätten in letzter Verzweiflung viereckige Bomben gebaut.«
Anna mochte seinen sporadisch auftretenden Sarkasmus nicht besonders, erst recht nicht an diesem Tag. Trotzdem folgte sie Jans Aufforderung und holte zwei Schaufeln.
Die beiden Männer begannen zu graben. Schon bald hatten sie ein erdverkrustetes viereckiges Etwas zutage gebracht: eine längliche Schatulle aus Metall.
»Vielleicht ein Schatz?«, fragte Kito mit schiefem Lächeln. »Du machst es auf – und darin ist lauter Gold!«
»So sieht es nicht gerade aus«, murmelte Anna, die die Metallkiste oberflächlich mit den Händen zu reinigen versuchte. Doch die Erde klebte geradezu daran. Vermutlich musste sie mit heißem Wasser und Reiniger daran gehen.
»Könnte ein altes Bankschließfach sein«, rief Jan. »Ganz im Ernst, eines dieser Dinger, die sie im Film immer rausholen und ausleeren, wenn ihnen die Polizei schon auf der Spur ist.« Er rieb vorsichtig daran. »Ich tippe auf Zink. Dann könntest du Glück gehabt haben.«
»Glück – weshalb?«, fragte Anna.
»Weil Zink kein oder kaum Wasser durchlässt. Was immer sich darin auch befinden mag, ist vermutlich in keinem allzu schlechten Zustand.«
Jan zerrte an der Kiste. Doch sie ließ sich nicht öffnen.
»Solides Schloss«, fuhr er fort. »Alle Achtung. Wer auch immer sie vergraben hat, wollte den Inhalt wirklich schützen.« Sein Blick bekam etwas Bohrendes. »Sollen wir es für dich aufzwicken? Ich wette, deine Zangen kriegen das nicht hin!«
Anna zögerte.
»Keine Angst, dein Gold klaut dir schon keiner von uns!«, setzte er lachend hinzu. »Wir sind mit einmal Armensuppe pro Woche mehr als zufrieden.«
»Später vielleicht«, sagte sie aus einem plötzlichen Impuls heraus, den sie sich selbst nicht so recht erklären konnte. Aber sie wollte unbedingt allein sein, wenn sie die Schatulle öffnete – ohne neugierige Blicke. Und ohne Kommentare. »Wir sollten erst einmal zusehen, dass die Rosen in die Erde kommen. Dort hinten werden die Wolken nämlich ganz schwarz!«
*
Es dauerte bis zum frühen Abend, bis alles im Boden war. Dann hatten auch dieChinarosenden richtigen Platz nahe der Eichen gefunden, die sie mit ihren niedrigen Büschen und den fast stachellosen Blättern optisch auflockern würden. Der Schweizer Katalog hatte duftende, halb gefüllte, dunkelrote Blüten versprochen, ein reizvoller Gegensatz zu den lachsfarbenenRemontant-Rosen, die weiter unten angepflanzt waren und bis zu zwei Meter hoch werden konnten. Wenn Anna Glück hatte, erwartete sie im Herbst sogar eine zweite Blüte – aber jetzt mussten sie erst alle richtig im Erdreich wurzeln und überhaupt erst einmal zum Blühen kommen!
Jan schien enttäuscht, dass sie ihn nicht zum Abendessen eingeladen hatte, womit er offenbar gerechnet hatte. Stattdessen musste er mit Kito abziehen, tropfnass dazu, denn ein ordentliches Gewitter war über Blasewitz hinweggefegt, das seit seiner Eingemeindung um 1920 als eines der besten Viertel Dresdens galt. Beinahe wäre Anna im allerletzten Augenblick doch noch schwach geworden, als er so nass und kläglich vor ihr stand wie ein Welpe, der versehentlich in den Kanal gefallen war. Doch sie entschied sich dagegen.
Inzwischen war das Prasseln in rauschenden Dauerregen übergegangen, der die angenehme Tagestemperatur empfindlich gesenkt hatte. Garantiert unter fünf Grad, also war eher Novemberfrösteln angesagt anstatt launiger Aprilverheißung. Jetzt half auch der alte Schal nicht mehr viel, doch die Heizung wieder anzuwerfen hatte Anna wenig Lust. In ihrem Herzen herrschte heute eindeutig Frühling, mochte das Wetter auch noch so verrückte Kapriolen schlagen.
Sie ging zum Kamin im Wohnzimmer, der mit Gerümpel und verbranntem Stoff verstopft gewesen war und bei den ersten Versuchen derart gequalmt hatte, dass sie gefürchtet hatte, auf der Stelle ersticken zu müssen. Inzwischen hatte Bezirkskaminfeger Krause ihn gereinigt, gelüftet und wieder zum reibungslosen Abziehen gebracht.
Anna stapelte ein paar Scheite Buchenholz, legte Zweige dazu und platzierte den Anzünder an der Stelle, die Krause ihr gezeigt hatte. Dann hielt sie ein brennendes Streichholz daran.
Die Flammen leckten erst noch zögerlich an den Scheiten, flackerten dann aber auf und verbreiteten friedliche Wärme. Anna zog die rote Couch heran und schaute nach draußen. Noch ragten im Garten nur nackte Zweige in die Dämmerung, die sich langsam über Dresden senkte, doch schon bald würden Blüten in allen nur erdenklichen Farben diesem Haus den Namen zurückgeben, den es einst getragen hatte – Rosenvilla.
ENDE DER LESEPROBE