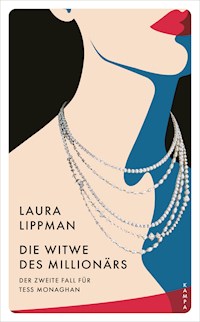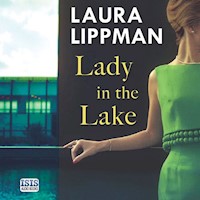Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Red Eye
- Sprache: Deutsch
Mit ihren 35 Jahren gilt Privatdetektivin Tess Monaghan als Risikoschwangere. Wenn sie nicht ein Kind »in der Größe einer Bratwurst« zur Welt bringen wolle, wie ihre beste Freundin Whitney es wenig sensibel formuliert, solle sie besser den Anweisungen der Ärzte folgen und die verbleibenden zwölf Wochen vor der Geburt Bettruhe halten. Natürlich könnte sie jetzt all die verpassten Bücher und Filme nachholen, lieber beobachtet sie aber aus dem Fenster die Spaziergänger im Park gegenüber. Eine junge Frau in einem grünen Regenmantel und mit einem Windhund fällt ihr ins Auge. Als der Hund eines Tages allein herumläuft, vermutet Tess ein Verbrechen und fängt an zu ermitteln: vom Bett aus, mit der besten Freundinals Assistentin und mit Crow, dem Vater des Babys, der jetzt nicht nur Essen holen, sondern auch Informationen beschaffen muss. Was zu Konflikten führt, denn der sonst so moderne Crow findet, dass Tess über ihre berufliche Zukunft nachdenken sollte. Oder will sie später Kinderwagen schiebend Verdächtige beschatten? Der Haussegen hängt schief, und es kommt noch viel schlimmer ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laura Lippman
Die Frau im grünen Regenmantel
Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
1
»Ich werde hier als Geisel gehalten«, flüsterte Tess Monaghan in ihr iPhone. »Von einer Terroristin. Ihre Forderungen sind vage, ihre Absichten unklar, aber sie könnte mich mindestens zwei Monate festhalten. Zwölf Wochen oder achtzehn Jahre, je nachdem, wie man es sieht.«
»Wirklich nett, wie du über unser künftiges Kind sprichst«, sagte ihr Freund Edward »Crow« Ransome und deckte sie mit einem Quilt zu, obwohl es ein typischer Baltimorer Herbsttag war, überhaupt nicht kühl. Die Decke war ein Geschenk von Crows Mutter, einer Künstlerin mit außergewöhnlich gutem Geschmack, was ihre Versäumnisse hinsichtlich des Spitznamens wettmachte, unter dem er noch immer zu leiden hatte. Unter normalen Umständen wäre Tess begeistert gewesen über diese moderne Version des in ihren Lieblingsfarben gestalteten Fliegende-Gänse-Motivs: gedeckte Grün- und Goldtöne, die hervorragend zu dem vor Kurzem winterfest gemachten Wintergarten passten. Kaum weniger als ein oranger Sträflingsoverall, erinnerte sie die Decke aber auch an ihre Gefangenschaft.
Den ganzen Sommer lang hatte sie sich darauf gefreut, im Anbau ihres Bungalows zu sitzen, zuzusehen, wie das Laub sich langsam färbte, und sich den Rücken an dem zweiseitigen Kamin zu wärmen, der auch das Wohnzimmer beheizte. Diese Vorfreude hatte jedoch auf der Annahme basiert, dass sie den Wintergarten jederzeit verlassen könnte, wenn ihr danach war, und nicht gezwungen wäre, dort tagaus, tagein zu liegen. Zu ihrem nicht geringen Entsetzen war die Sprache sogar auf Bettpfannen gekommen, und ihre Tante, sie hatte es natürlich nur gut gemeint, hatte ihr einen antiken Nachttopf geschickt. Tess’ Frauenärztin meinte allerdings, das müsse sie sich nicht antun, außer vielleicht nachts. »Solange Sie es nicht übertreiben«, fügte sie hinzu. Womit? Mit dem Ins-Bad-Watscheln? Das leuchtete Tess nicht ein. Mit dem Feiern konnte man es übertreiben. Mit dem Trinken konnte man es übertreiben. Auch mit fettem Essen oder Sport. Aber ein drei Meter kurzer Gang ins Bad?
»Bring Wein mit«, zischte sie ins Telefon. »Und eine Pizza von Matthew’s. Und die Limabohnen mit Feta von Mezze. Und Sopaipillas von Golden West. Aber mach schnell!«
Crow nahm ihr behutsam das Telefon aus der Hand. Wie zart und einfühlsam er war, sah man einmal davon ab, dass sein Sperma das Burgtor ihres Diaphragmas durchbrochen hatte, dem Spermizid entwischt war und sich in den Bergfried durchgewuselt hatte, ein absoluter Glückstreffer, der sich in Tess’ nichts ahnendes Ei gebohrt und das aufsässige Menschlein gezeugt hatte, das sie jetzt an die Korbchaiselongue im Wintergarten fesselte.
»Wir würden uns über deinen Besuch freuen«, sagte er zu Tess’ ältester und bester Freundin Whitney Talbot. »Und sie darf sogar etwas Salz nehmen, solange es im Rahmen bleibt, versteht sich. Das mit dem Wein sollte natürlich nur ein Witz sein.«
»Von wegen! Wenn sie in Maryland nicht so rückständig wären, könnte ich mir übers Internet Wein bestellen. Diese blöde übergriffige Alkohollobby. Jede Wette, dass die bei Eddie’s welchen liefern, wenn wir darauf bestehen.«
»Machen sie wahrscheinlich wirklich«, pflichtete Crow ihr bei, verabschiedete sich von Whitney und legte das iPhone auf den Stapel Bücher, die Tess’ Tante zusammen mit dem Nachttopf geschickt hatte, um Tess’ Launen und Stimmungsschwankungen vorzubeugen. »Allerdings habe ich bereits über unsere momentane Situation mit ihnen gesprochen und über die damit verbundenen ernährungstechnischen Probleme in den nächsten Wochen. Außerdem, halt deine Zunge im Zaum. Selbst gespielter Ärger kann deinen Blutdruck in die Höhe treiben. Nicht nur das, er …«
Er holte die Blutdruckmanschette raus. Schon der Anblick war Tess zuwider. »Das teuerste Armband, das ich je hatte«, murmelte sie, als er die Manschette um ihren linken Bizeps legte, und obwohl das Ding nur 89 Dollar gekostet hatte, entsprach es der Wahrheit. Diese 89 Dollar, wurde ihr jetzt bewusst, waren die erste von vielen Ausgaben, die nicht von der bescheidenen »Gruppenkrankenversicherung« übernommen wurden, die sie für ihre Firma abgeschlossen hatte. Sie brauchte eine Familienversicherung, die viermal so viel kostete, und selbst dann kämen noch unvorhergesehene Ausgaben auf sie zu, die an ihren Ersparnissen zehren würden. Sie versuchte mühsam, sich zu beruhigen, als sich die Manschette aufpumpte und dann wieder abschwoll. Andrerseits: lieber wütend als ängstlich. Und sie hatte enorme Angst gehabt, als sie vor drei Tagen in der Notaufnahme gelandet war.
Das erste Alarmsignal war, im Nachhinein betrachtet, die Gelassenheit gewesen, mit der sie die fünfstündige Observierung durchgestanden hatte. Normalerweise wäre für Tess Monaghan allein der Umstand, dass sich ihre Blase mehrere Stunden lang nicht bemerkbar gemacht hatte, ein Grund zum Feiern gewesen. Obwohl sich schon viele Hersteller an diesem Problem versucht hatten, gab es noch immer keine Lösung für das, was sie das weibliche Notdurftbedürfnis nannte. Männer hatten da mehr Optionen, vor allem, wenn sie keine Hemmungen hatten. Seit Tess vor sechs Jahren Privatdetektivin geworden war, hatte sie sich extremes Durchhaltevermögen antrainiert und dachte dann oft voller Dankbarkeit an ihren Vater zurück, der bei Familienausflügen immer strikt auf die Einhaltung seines Zeitplans gedrungen und damit Tess dazu angehalten hatte, ihre körperlichen Bedürfnisse den Treibstofferfordernissen ihres alten Familienkombis anzupassen. Kurz vor dem letzten Trimester hatte sie feststellen müssen, dass die Schwangerschaft ihren Tribut von ihrer tapferen Blase forderte und Observierungen immer schwieriger machte. Das war insofern ein Problem, als Observierungen den Hauptanteil der Dienstleistungen von Keys Investigations ausmachten. Neben dem Mülltauchen, das sie widerstrebend aufgegeben hatte, seit sie erfahren hatte, dass sie schwanger war.
Wie sich herausstellte, war ihre Schwangerschaft bei Observierungen jedoch auch eine hervorragende Tarnung. Frauen schauten ihr auf den Bauch, nicht ins Gesicht. Männer wendeten den Blick ganz ab. Vor allem ein ganz bestimmter Mann, den sie unbedingt mit ihrem iPhone fotografieren wollte, ein säumiger Vater namens Jordan Baum. Der gelernte Anstreicher machte über seinen Anwalt geltend, sich bei einem Arbeitsunfall einen unmöglich nachzuweisenden »Weichteilschaden« zugezogen zu haben. Die Mutter seines Kindes glaubte, dass Jordan in zweierlei Hinsicht ein Betrüger war: Er arbeitete schwarz für einen Bauunternehmer, von dem er sich bar bezahlen ließ, beschummelte also nicht nur sie, sondern auch den Staat.
Jordan Baum war allerdings vorsichtig genug, keine Aufträge anzunehmen, bei denen er bei der Arbeit zu sehen war. In der Woche, in der Tess ihn observiert hatte, war er regelmäßig bei einem großen sanierungsbedürftigen Gebäude unten am Hafen ein und aus gehumpelt. Nun war es zwar verdächtig, wenn ein arbeitsloser Anstreicher Tag für Tag in einem Gebäude verschwand, das gerade renoviert wurde, aber es bewies nichts. In ihrer Not hatte sie schließlich eine attraktive Blondine angeheuert, Jordan Baum »zufällig« über den Weg zu laufen und ihm dann allerdings mehr Unglück zu bringen, als das jede schwarze Katze gekonnt hätte.
Tess’ Freundin Whitney versteckte sich zum vereinbarten Zeitpunkt hinter einer Hausecke in der Nähe der besagten Baustelle, bis Tess sie per SMS benachrichtigte, dass Jordan Baum im Anmarsch war. Daraufhin bog Whitney mit einem riesigen Packen Papiere in den Armen um die Ecke. Tess hatte sie nur gebeten, sie fallen zu lassen, aber Whitney ging so in ihrer Rolle auf, dass sie selbst mit einem lauten Aufschrei vor Jordan Baum hinfiel. Nicht nur, dass dabei die Papiere in alle Richtungen davonflogen, sie täuschte auch noch eine Knieverletzung vor. Prompt kam der galante Jordan angerannt und half Whitney auf die Beine. Sie bestand darauf, ihn in einem Diner in der Nähe auf einen Kaffee einzuladen. Währenddessen machte Tess eifrig Fotos von dem auf wundersame Weise geheilten Jordan. Das genügte, damit er die ausstehenden Unterhaltszahlungen an seine Ex anstandslos beglich. Was das Finanzamt anging – die konnten selbst einen Ermittler beauftragen, um ihren Anteil einzutreiben.
»Einmal ein Gauner, immer ein Gauner«, erklärte Tess, als sie ihren Erfolg mit Whitney bei einem späten Mittagessen im Matthew’s Pizza feierte. »Eine Weile wird er zahlen, dann aber schnell wieder in Verzug geraten. Ohne pfändbares Konto dürfte es unmöglich sein, dauerhaft Geld von dem Kerl zu bekommen.«
»Wusstest du, dass er vier Kinder von drei verschiedenen Frauen hat?«, fragte Whitney. »Er hat allen Ernstes ihre Fotos aus seiner Geldbörse geholt und gesagt: ›Mache ich etwa keine hübschen Babys?‹ Soll das eine neue Anmache sein, mit seinen tollen Genen anzugeben? Ich führe natürlich ein relativ behütetes Leben, aber … was hast du denn auf einmal, Tess?«
Endlich war Tess das seltsame Ausbleiben der Forderungen ihrer Blase bewusst geworden. Dieser Erkenntnis folgte umgehend ein dringendes Bedürfnis – heftige Krämpfe, gefolgt von mehrmaligem Erbrechen, zuerst in der winzigen Toilette des Restaurants, dann auf dem Gehsteig, dann über einem Gully und schließlich neben Whitneys Suburban, mit dem diese sie darauf ins Johns Hopkins fuhr. »Halb so wild«, meinte Whitney, als sich Tess zwischen den einzelnen Brechattacken entschuldigte. »Die Corgis meiner Mutter haben ständig Durchfall.«
Alles Weitere ergab sich dann in der Notaufnahme, wo sich die Ärzte Tess’ mit beruhigender Zuversicht annahmen. Präeklampsie war für sie an der Tagesordnung. Mit fünfunddreißig galt Tess als Hochrisikoschwangerschaft. Sie war gefährdet, ihr Kind war gefährdet, und wenn sie kein Baby von der Größe einer Bratwurst gebären wollte – das delikate Bild stammte von Whitney –, musste sie den Rest ihrer Schwangerschaft im Bett verbringen.
»Weißt du noch, wie du immer gesagt hast, dass du dir gern mal freinehmen würdest, um einfach nur zu lesen und Filme zu schauen?«, fragte Crow sie jetzt. Er machte sich weiter im Wintergarten zu schaffen und stellte eine Blumenvase erst aufs Kaminsims, dann ans Fenster. Für einen Heteromann stand er in beängstigend gutem Kontakt zu seiner inneren Martha Stewart. Den Nestbautrieb, der eigentlich Tess’ Sache gewesen wäre, schien er übernommen zu haben. Allerdings war das schon vor der Präeklampsie-Diagnose so gewesen, als er das Kinderzimmer streichen und eine Babyparty hatte veranstalten wollen. In Rückbesinnung auf die jüdischen Traditionen ihrer Familie mütterlicherseits hatte Tess sich jedoch quergestellt, weil das Unglück brächte.
»Ich habe alles Mögliche gesagt.« Interessanterweise hatte sie nie gesagt, dass sie Mutter werden wollte, rieb das Crow aber nicht unter die Nase. Seine Begeisterung über die frohe Kunde war echt gewesen. Falls er jemals Ängste oder Zweifel wegen seiner Vaterschaft hatte, bekam Tess nichts davon mit. Crow, so verlässlich wie der Sonnenaufgang, gehörte nicht zu den Jordan Baums dieser Welt – oder doch? Sie hatte nicht vorgehabt, Mutter zu werden, aber sie hatte auch nicht vorgehabt, nicht Mutter zu werden. Alles in ihrem Leben wurde von Zufällen bestimmt – ihre berufliche Laufbahn, ihre Beziehung, sogar dieses Haus, das sie so mochte. Da passte es doch, dass ihre künftige Tochter diese Tradition aufrechterhielt.
Und falls sie sich als altkluge Nervensäge entpuppen sollte – Tess wusste jetzt schon, von wem sie das hätte.
»Da Mrs. Blossom Vollzeit für dich übernimmt«, sagte Crow, »musst du jetzt wirklich nicht mehr ins Büro gehen. Du hattest doch auch keine Probleme damit, dass sie während der Elternzeit für dich einspringt. Was machen da schon zwei Monate mehr?«
»Zwei Monate rückläufige Umsätze. Ungeachtet Mrs. Blossoms Fähigkeiten ist sie trotzdem nur eine einzige Frau.«
»Eine einzige Frau hat deine Firma mehrere Jahre lang geführt«, sagte Crow. »Das wird schon laufen.«
»Bist du da sicher?«
»Sicher ist letztlich gar nichts.«
Solche Worte konnten Trost oder Fluch sein. Tess beschloss, sie als Trost zu betrachten. Obwohl der Wintergarten nach Osten ging, sah sie an dem warmen gelben Licht, das durch das immer noch grüne Laub der Bäume fiel, dass die Sonne unterging. Der Wintergarten ragte auf Stützen über den steilen Hang des bewaldeten Hügels hinaus, an den das Haus gebaut war, und hatte deshalb etwas von einem Baumhaus. Umgeben von Büchern und Crows riesigem Stapel von Criterion-Collection-DVDs, konnte sie ihren Geist weiterbilden, während ihr Körper sie gefangen hielt. Sie konnte tolle Bücher lesen, Landkarten studieren, sich mit großen Ideen aus Philosophie und Wirtschaft befassen, die sie während des Studiums vernachlässigt hatte.
Oder aber wehmütig aus dem Fenster in den Park hinausblicken, wo gerade die Hundebesitzer aus dem Viertel eintrudelten. Vor einer Woche war sie noch eine von ihnen gewesen, wenn sie Esskay und Miata, ihren Greyhound und ihren Dobermann, ausgeführt hatte. Wie sehr ihr diese Spaziergänge fehlten, dachte sie – und vergaß darüber, wie oft sie sich über diese Pflicht beklagt und sich danach gesehnt hatte, ausschlafen zu können, wenn der Greyhound sie frühmorgens mit seinem heißen, fischigen Atem anhechelte. (Ein Grund, warum sie im Wintergarten lag, war, dass Esskay ihr die Chaiselongue nicht streitig zu machen versuchte, wie er das im Fall des Doppelbetts im Schlafzimmer tat.) Ja, sie hatte sich nach einer Auszeit gesehnt, danach, mehr zu lesen und von den Morgenspaziergängen befreit zu sein, für die sie zuständig war. Allerdings hatte sie davon geträumt, irgendwo am Strand zu liegen und nicht mit unaufhaltsam anschwellendem Bauch auf einem Sofa.
Ihr Blick fiel auf eine Miniaturausgabe von Esskay, einen Greyhound, der tatsächlich grau war; Esskay war nämlich schwarz und hatte nur auf der Brust einen weißen Flecken. Das kleine Windspiel trug einen grünen, von einem Riemen zusammengehaltenen Hundemantel und stolzierte mit dem unverschämten Selbstbewusstsein von jemandem einher, der es gewohnt war, Aufmerksamkeit zu erregen. Das galt auch für sein Frauchen, das einen eng gegürteten selleriegrünen Regenmantel trug, der farblich exakt zum Überwurf des Hunds passte. Aus der Ferne war das Alter der Frau schwer zu schätzen, aber ihr glattes blondes Haar und ihre Wespentaille waren nicht zu übersehen. Sie war der Typ hübsche Frau, die noch mit über vierzig als Mädchen bezeichnet wird. Sie schenkte den anderen Hundebesitzern keine Beachtung und hielt etwas, das vermutlich ein Handy war, an ihr Ohr. Tess war der Auffassung, dass sowohl die Hundebesitzer als auch ihre vierbeinigen Schützlinge auf ihren Spaziergängen in einen Zustand Zen-ähnlicher Gelassenheit gelangen sollten, und runzelte die Stirn. Sie hätte die Frau und vor allem ihren Gesichtsausdruck gern besser gesehen.
»Gibt es etwas, was diesen paradiesischen Zustand noch perfekter machen könnte?«, fragte Crow.
»Ein Fernglas«, sagte Tess.
Das war am Sonntag gewesen; am Montag hatte sie ein Fernglas. Und den Rest der Woche las Tess tatsächlich eine ganze Menge und fing an, sich die Filme anzusehen, die man Crows Meinung nach kennen musste, wenn man nicht als totaler Kulturbanause gelten wollte. Aber sie griff auch jeden Nachmittag nach ihrem Fernglas und beobachtete die Ankunft der Hunde im Park, bevor sie sich auf die Frau im grünen Regenmantel konzentrierte, die mit ihrem Windspiel an der Leine an den anderen vorbeistolzierte. Sie schien die ganze Zeit zu telefonieren, aber vielleicht war sie auch nur schüchtern und benutzte das Handy als Schutzschild. Die Hundebesitzer vom Stony Run Park konnten Neulingen gegenüber ganz schön herablassend sein. Selbst durch das Fernglas betrachtet, verriet das Gesicht der Frau kaum eine Regung. Ihre Spaziergänge dauerten länger als die der meisten anderen; immerhin bekam ihr überzüchteter Hund so reichlich Auslauf. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, es war immer das Gleiche. Nur das Schuhwerk änderte sich. Als der Boden trockener wurde, wichen ihre schicken Gummistiefel braunen Wildlederstiefeletten. Trotzdem nicht besonders praktisch, dachte Tess, als sie beobachtete, wie die Frau im grünen Regenmantel in den Park gestöckelt kam. Sprang der Hund nie an ihr hoch und hinterließ schmutzige Pfotenabdrücke?
»Das entwickelt sich langsam zu einer regelrechten Manie«, sagte Crow, als er das Tablett mit Tess’ Abendessen hereintrug. Die Hunde, die ihm folgten wie besorgte Dienerinnen, waren beunruhigt über Tess’ Verlegung aus dem Schlafzimmer in den Wintergarten, obwohl es Esskay genoss, im Bett mehr Platz zu haben. Die Hündin spürte wohl, dass tief greifende Veränderungen bevorstanden, und wusste nicht recht, was sie davon halten sollte.
Willkommen im Club, Schwester.
Tess hatte das Fernglas beiseitegelegt und zu essen begonnen, als sie merkte, dass Esskay, durch und durch Windhund, die Ohren spitzte und ans Fenster rannte. Vielleicht ein Eichhörnchen oder auch nur ein herabfallendes Blatt. Besonders gut sehen konnten Windhunde nämlich nicht.
Was jedoch in diesem Fall Esskays Aufmerksamkeit erregt hatte, war ihr kleiner Doppelgänger. Das Windspiel rannte völlig allein durch den Park und zog die selleriegrüne Leine hinter sich her. Und es rannte, als wäre ihm etwas dicht auf den Fersen – aber da war nichts. Solange Tess an diesem Abend – bis tief in die Nacht und dann bei ausgeschaltem Licht, um besser sehen zu können – auch nach der Frau im grünen Regenmantel Ausschau hielt, sie tauchte nicht wieder auf.
2
»Wenn du Fenster zum Hof spielen willst, muss Crow wohl in einem seidenen Negligé um dich herumscharwenzeln«, sagte Whitney am nächsten Tag, als Tess ihre Wache im Wintergarten fortsetzte. Weder Frau noch Hund waren zu ihrem gewohnten Sonnenuntergangsspaziergang erschienen.
»Eigentlich dachte ich bei Grace Kelly an dich, blond und mager, wie du bist«, sagte Tess mit einem skeptischen Blick auf das Essen, das ihr Crow gemacht hatte. Es war sehr gesund – Spinatsalat, Risotto mit Shiitake-Pilzen und Butternut-Kürbis vom Bauernmarkt. Und köstlich war es auch. Aber ihr ging gewaltig gegen den Strich, dass sie keine Alternative hatte. Ab und zu gönnte sie sich zum Mittagessen ein Goldenberg Peanut Chew oder eine Tüte Utz Crab Chips.
»Die Talbots und die Kellys sind ja auch entfernt miteinander verwandt«, sagte Whitney. Das war nicht ganz von der Hand zu weisen, obwohl derjenige Kelly, dem Whitney mit ihrem kantigen Kinn und ihrer sportlichen Figur am ehesten ähnelte, Jack, der Ruderer, war, nach dem der Kelly Drive in Philadelphia benannt war. Sowohl Whitney als auch Tess hatten im College gerudert, aber Whitney war besser gewesen. Und so ließ sich ihre langjährige Freundschaft wohl auch am besten zusammenfassen: Egal, was sie machten, Whitney war besser. Whitney schrieb bessere Noten. Whitney war schneller, eine ehrgeizigere Ruderin, die es nach Yale geschafft hatte und Schlagfrau eines Leichtgewichtsvierers geworden war. Auch in der Zeitungsbranche hatte sie sich bewährt, einem Betätigungsfeld, auf dem Tess versagt hatte. Doch dann schmiss Whitney alles hin, um für die Stiftung ihrer Familie zu arbeiten. Denn zu allem Überfluss war sie auch noch reich und hatte nie Geldsorgen gehabt. Whitney Talbot glänzte in allem – außer in Beziehungen. Sie wohnte im Gästehaus auf dem großen Grundstück ihrer Eltern draußen im Valley und bezeichnete sich selbst als alte Jungfer. Das war einfacher, als zuzugeben, dass sie einsam war, vermutete Tess.
»Ich bin eindeutig die Thelma Ritter in diesem Szenario«, sagte Whitney jetzt. »Nur größer. Erinnerst du dich noch an den Moment, in dem man Grace Kelly zum ersten Mal sieht – wenn Jimmy Stewart gerade von seinem Nickerchen aufwacht. Sie war so schön, dass es mir buchstäblich den Atem verschlagen hat.«
»Ich habe das eher als asthmatisches Pfeifen in Erinnerung, bei dem deine Knie hochgezuckt sind und einen Eimer Popcorn über deinen Vordermann gekippt haben.«
»Nein, das war in einem Horrorfilm«, sagte Whitney. »In Aliens? Oder war es Re-Animator? Wir waren im Charles – als es noch ein einziges riesiges Kino war. Weißt du noch? Wir sind immer in die Spätvorstellung gegangen und anschließend in den Club Charles, um bis zwei Uhr früh einen draufzumachen.« Sie wandte sich an Tess’ Bauch. »Ich kannte deine Mutter, als sie noch keine Trantüte war, du kleine Parasitin.«
Tess runzelte die Stirn, und Whitney merkte in einer seltenen Anwandlung von Feingefühl, dass sie zu weit gegangen war. »Habt ihr schon einen Namen?«
»Nicht wirklich«, log Tess. Sie und Crow hatten rasch gemerkt, dass sie sich dabei auf gefährliches Terrain begaben. »Wir werden uns an den jüdischen Brauch halten, den Namen von jemand zu nehmen, der nicht mehr am Leben ist. Wir werden uns auch sonst an die jüdischen Bräuche halten. Keine Babyparty, kein vorzeitiges Einrichten des Kinderzimmers. Wir wollen schließlich nicht, dass der böse Blick auf uns fällt.«
Das sagte sie in einem leichten, selbstironischen Ton, aber Whitney ließ sich nichts vormachen. »Es wird schon alles gut gehen, Tess.«
Tess versuchte beiläufige Zustimmung zu signalisieren, halb Achselzucken, halb Abwinken. Dummerweise wollte sie gerade eine Gabel Risotto in ihren Mund schieben und schaffte es, alles ans Fenster zu klatschen.
»Ein Gruß aus deiner Zukunft«, sagte Whitney, entfernte den Klumpen Reis von der Scheibe und verteilte ihn an die zwei Hunde, die, wie immer wenn gegessen wurde, wachsam bei Fuß standen.
»Warum ist sie nicht mehr aufgetaucht?«, kehrte Tess wieder zum Thema zurück. Sie konnte den Blick nicht vom Park losreißen, geschweige denn ihre Gedanken von dieser Frage.
»Wenn ihr der Hund weggelaufen ist, hat sie keinen Hund mehr zum Ausführen.«
»Aber sie wäre doch in den Park gekommen, um nach dem Hund zu suchen, oder nicht? Und wenn der Hund von allein nach Hause gekommen ist, wie Crow meint, würde sie auch wieder im Park mit ihm spazieren gehen. Es muss irgendwas passiert sein, Whitney. Haben sie in den Nachrichten was von einer vermissten Frau gebracht? Oder von einem rätselhaften Zwischenfall in North Baltimore?«
»Zum zehnten Mal – nein, Tess.«
»Ich habe dich doch gar nicht zehn Mal gefragt.«
»Aber Crow nervst du damit den ganzen Tag. Hat er mir erzählt. Lies lieber ein Buch.« Whitney sah den Stapel durch. »Der Geschmack deiner Tante Kitty ist so eklektisch wie eh und je. Das Einzige, was diese Schmöker gemeinsam haben, ist, dass sie fast alle ziemlich dick sind.«
»Wie ich«, sagte Tess voller Bitterkeit darüber, dass ihr Körper sie im Stich ließ. Nicht genug damit, dass sie wegen ihres Bluthochdrucks und des Babybauchs ständig Verdauungsstörungen hatte. Ihre Füße waren so stark geschwollen, dass sie nur noch in Pantoffeln oder ein altes Paar Uggs passte, wobei sie in Letztere erst hineinkam, seit Crow die Nähte aufgetrennt hatte.
»Ein schmales Bändchen ist aber auch dabei: Alibi für einen König von Josephine Tey.«
»Liest sich leicht, kenne ich schon in- und auswendig.« Und wie die Hauptfigur des Buchs war sie fest entschlossen, das Rätsel von ihrem Krankenbett aus zu lösen. »Kannst du dich nicht mit Crow ein bisschen in der Nachbarschaft umhören? Vielleicht kennt ja jemand den Hund oder die Frau.«
»Tess …«
»Ich bin wirklich besorgt.« Sie machte einen Schmollmund, wusste aber, dass ihr das nie gut gelang. »Und wenn ich mir Sorgen mache, steigt mein Blutdruck.«
Whitney ließ sich nichts vormachen, das konnte Tess sehen. Aber sie war eine gute Freundin und bereit, auf Tess’ Marotten einzugehen.
»Na schön, aber erst morgen«, sagte Whitney. »Am Sonntag sind die Leute zu Hause. Vielleicht finden wir Vermisstmeldungen für den Hund. Das würde bestimmt zu deiner Beruhigung beitragen. Aber jetzt mal ehrlich, Tess, warum kannst du dich nicht wie ein normaler Mensch mit Online-Poker oder Scrabulous ablenken?«
»Als ob du mit einem normalen Menschen befreundet wärst.«
Wie versprochen zog Whitney am nächsten Nachmittag mit Crow los, um herauszufinden, ob jemandem in der Nachbarschaft ein Italienisches Windspiel entlaufen war. Es war ein Herbsttag, wie Whitney ihn besonders mochte – nicht klar und golden. Das wäre zu banal gewesen. Nein, dieser Tag war neblig-trüb, der Boden war von buntem Laub bedeckt, und in der Luft hing der Geruch von Herbstfeuern. Der Winter war im Anzug, und Whitney mochte den Winter, zusammen mit den entsprechenden Sportarten, auch wenn der Fischteich, auf dem sie Eislaufen gelernt hatte, inzwischen nur noch selten zufror. Im letzten Jahr war überhaupt kein Schnee gefallen, und sie hatte nicht einen einzigen Tag langlaufen können. Whitney war intelligent genug, um zu wissen, dass ihre persönlichen Erinnerungen keine Beweiskraft hatten. Trotzdem glaubte sie an den Klimawandel und fürchtete, die Lage könnte wesentlich ernster sein, als irgendjemand ahnte. Wie konnte man ein Kind in diese gefährdete Welt setzen, die in ein paar Jahrzehnten vielleicht schon gar nicht mehr existierte? Und sie fragte sich immer wieder, ob Tess nun unglaublich mutig oder unglaublich dumm war.
Oder einfach beides zugleich.
Crow sagte: »Ich dachte, wir fangen drei Straßen nördlich von hier an, arbeiten uns die Woodlawn rauf, die Hawthorne runter, die Keswick wieder rauf, klingeln bei jedem zweiten Haus und grenzen es immer weiter ein.«
»Warum nur bei jedem zweiten?«
»Weil jeder in einer Straße weiß, ob jemand in der Nachbarschaft ein Windspiel hat. So können wir mehr Häuser abhaken.«
»Noch mehr könnten wir abhaken, wenn wir uns aufteilen.«
»Das habe ich mir auch schon überlegt«, sagte Crow. »Andererseits haben wir uns noch nie richtig miteinander unterhalten, Whitney. Nur wir beide. Sonst ist immer jemand dabei.«
»Stimmt.« Und so soll es auch bleiben