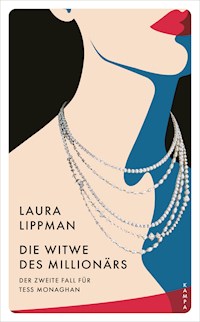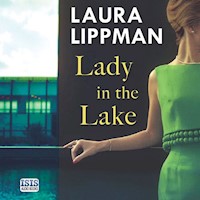Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schon vor acht Monaten ist Cleo Sherwood verschwunden. Abgesehen von ihren Eltern und ihren beiden Söhnen scheint sich niemand darum zu scheren. Im Jahr 1966 interessieren sich weder Polizei noch Öffentlichkeit oder Presse für eine schwarze Frau, die als vermisst gilt. Madeline »Maddie« Schwartz, die als Redaktionsassistentin beim Baltimore Star arbeitet, hat sich erst vor Kurzem von ihrem Mann getrennt und klare Vorstellungen von ihrem künftigen Leben: endlich nicht mehr bloß das Anhängsel eines erfolgreichen Mannes sein, endlich sich selbst verwirklichen - und den eigenen Namen unter ihren Artikeln lesen. Als Maddie von einer Frauenleiche hört, die im Brunnen eines Parks gefunden wurde, wittert sie die Story ihres Lebens. Ihr Ehrgeiz ist geweckt. Sie ahnt nicht, wie viel Ärger ihr diese Geschichte einbringen wird - eine Geschichte, die niemand hören will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Laura Lippman
Wenn niemand nach dir sucht
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Kathrin Bielfeldt und Jürgen Bürger
Kampa
In Gedenken an:
Rob Hiaasen
Gerald Fischman
John McNamara
Rebecca Smith
Wendi Winters
TEIL I
Einmal habe ich dich gesehen. Ich sah dich und du hast mich bemerkt, meinen auf dich gerichteten Blick. Hin und her, hin und her. So, wie gutaussehende Frauen es tun. Die Blicke treffen sich, man mustert einander. Mir war sofort klar, dass du nie an deinem guten Aussehen gezweifelt hast und aus reiner Gewohnheit noch immer jeden Raum auslotest, um dich zu vergewissern, dass du die Schönste bist. Dein Blick flog über die Menschenmenge auf dem Bürgersteig, blieb an meinen Augen hängen, wenn auch nur kurz, und glitt dann fort. Du hast mich gesehen, hast verglichen und die Punkte zusammengezählt. Wer hat gewonnen? Ich vermute, dass du dir selbst die Krone aufgesetzt hast, denn du hast eine Schwarze gesehen, noch dazu eine arme. Schon merkwürdig, dass es im Tierreich genau umgekehrt ist. Das Männchen wirbt um das Weibchen, lockt mit seinen wunderschönen Federn oder der wallenden Mähne und versucht immer, die Konkurrenten auszustechen. Warum ist es bei den Menschen andersherum? Das ergibt keinen Sinn. Die Männer brauchen uns mehr als wir sie.
Du warst in der Minderheit damals, warst in unserem Viertel, und fast jeder andere dort hätte mich gewählt. Mich, die ich jünger, größer und kurviger war. Vielleicht sogar Milton, dein Mann. Du fielst mir unter anderem deshalb auf, weil du neben ihm standst. Er sah inzwischen exakt so aus wie sein Vater, ein Mann, an den ich mich mit einer gewissen Zuneigung erinnere. Von Milton kann ich das nicht behaupten. So, wie die Leute sich auf den Stufen der Synagoge um ihn scharten, ihm auf den Rücken klopften und seine Hände in ihre nahmen, nahm ich an, dass es sein Vater gewesen sein musste, der gestorben war. Und die Art, wie die Leute warteten, um Milton Trost zu spenden, sagte mir, dass er ein hohes Tier sein musste.
In all den Jahren, in denen ich in der Nähe gewohnt habe, habe ich es nie geschafft, den Namen der Synagoge mit den vielen zusätzlichen Konsonanten richtig auszusprechen. Für mich hörte es sich so an, als würde ein Komiker aus der Ed Sullivan Show mit einem lustigen Akzent sprechen.
Die Synagoge lag einen Block vom Park entfernt. Der Park und der See und die Fontäne. Interessant, nicht? Ich habe an jenem Nachmittag wahrscheinlich einen Umweg gemacht und bin mit einem Buch in der Tasche zum Druid Hill gegangen. Nicht, dass ich so gerne draußen gewesen wäre, aber wir lebten zu acht in unserer Wohnung – mein Vater, meine Mutter, meine Schwester und zwei Brüder, meine beiden Jungs und ich – und man hatte nie eine ruhige Minute, um meinen Vater zu zitieren. Ich schmuggelte für gewöhnlich ein Buch in meine Handtasche – Jean Plaid oder Victoria Holt – und sagte: »Ich gehe in die Bibliothek«, und meine Mutter brachte es nicht übers Herz, es mir zu verbieten. Sie hat es mir nie zum Vorwurf gemacht, dass ich mir zwei Nichtsnutze ausgesucht hatte und hinterher wieder zu Hause auf der Matte stand. Ich war ihre Erstgeborene und ihr Liebling. Aber die Liebe war nicht so groß, als dass ich mit einem dritten Fehler davongekommen wäre. Mama hockte mir auf der Pelle, damit ich wieder in die Schule ging und Krankenschwester würde. Krankenschwester. Ich konnte mir nicht vorstellen, eine Arbeit anzunehmen, bei der ich Leute anfassen musste, die ich nicht anfassen wollte.
Wenn es mir zu Hause zu viel wurde, wenn da zu viele Körper und Stimmen waren, ging ich für gewöhnlich in den Park, spazierte auf den Wegen, genoss die Stille, ließ mich dann auf eine Bank fallen und versank im England alter Zeiten. Später sagten die Leute über mich, ich wäre eine schlechte Person gewesen, die einfach allein weggegangen sei und ihre Kleinen bei den Großeltern zurückgelassen hätte, doch ich habe immer an sie gedacht. Ich brauchte einen Mann und nicht nur irgendeinen alten Kerl. Das hatten die Väter meiner Jungs mir gezeigt. Ich musste einen Mann finden, der für uns sorgte, für uns alle. Um das zu tun, musste ich ein bisschen für mich allein sein, selbst wenn das bedeutete, dass ich bei meiner Freundin Laetitia wohnte, die im Grunde genommen Einzelunterricht darin gab, wie man Männer dazu brachte, für alles zu bezahlen. Meine Mama glaubte, dass es zumindest ein wenig appetitlich aussehen musste, wenn man Käse für eine Maus auslegte. Den Schimmel abschneiden oder das Stück so in die Falle legen, dass man den Schimmel nicht sieht. Ich musste gut aussehen und so wirken, als könnte mich kein Wässerchen trüben, aber das schaffte ich in unserer überfüllten Wohnung in der Auchentoroly Terrace nicht.
Okay, vielleicht konnte ich mir also doch vorstellen, einen Job anzunehmen, bei dem man Leute anfassen musste, die man eigentlich nicht anfassen wollte.
Aber, welche Frau tut das nicht? Bei dir war es vermutlich genauso, als du Milton Schwartz geheiratet hast. Denn in den Milton Schwartz aus meiner Jugend konnte sich niemand märchenhaft verlieben.
Es war – ich kann mich erinnern, wenn ich mir klarmache, wie alt meine Babys damals waren – im Spätherbst 1964, mit einem Hauch Kälte in der Luft. Du trugst einen schlichten Pillbox-Hut, keinen Schleier. Ich wette, die Leute haben dir gesagt, du würdest aussehen wie Jacky Kennedy. Und ich wette, das hat dir gefallen, selbst wenn du es mit einem lachenden Wer, ich? abgestritten hast. Der Wind zerzauste dein Haar, aber nur ein bisschen; die Frisur hielt, Haarspray sei Dank. Du hattest einen schwarzen Mantel an, mit Fellbesatz an Kragen und Ärmeln. An den Mantel erinnere ich mich, das kannst du mir glauben. Und, Himmel, sah Milton seinem Vater ähnlich, und erst da wurde mir bewusst, dass der alte Mr. Schwartz in meiner Jugend recht jung und recht gutaussehend gewesen war. Als ich ein kleines Mädchen war und mir in seinem Laden Süßigkeiten gekauft habe, fand ich ihn alt. Dabei war er noch nicht einmal vierzig.
Inzwischen war ich sechsundzwanzig und Milton musste fast vierzig sein, und da standst du neben ihm, und ich konnte gar nicht fassen, was für eine feine Frau er abbekommen hatte. Vielleicht ist er jetzt netter, dachte ich. Menschen ändern sich, das tun sie, in der Tat. So wie ich. Nur, dass niemand es je erfahren wird.
Was hast du gesehen? Ich erinnere mich nicht mehr daran, was ich getragen habe, und kann nur raten. Einen Mantel, selbst für die milde Jahreszeit zu dünn. Wahrscheinlich aus der Gemeinde-Kleiderkiste, also voller verfilzter Fusseln, formlos und mit schlaffem Saum. Abgewetzte Schuhe, abgelaufene Sohlen. Deine Schuhe waren schwarz und glänzten. Meine Beine waren nackt. Du trugst eine von diesen Strumpfhosen, die fast schimmern.
Als ich dich sah, erkannte ich den Trick dahinter: Um an einen Mann mit Geld zu kommen, musste ich aussehen, als würde ich kein Geld brauchen. Ich musste mir einen Job suchen, in dem das Trinkgeld aus gefalteten Scheinen bestand, nicht aus achtlos auf den Tisch geworfenen Münzen. Problem war nur, dass solche Läden keine Schwarzen einstellten, zumindest nicht als Kellnerinnen. Ein einziges Mal hatte ich einen Job in einem Restaurant und war Tellerwäscherin, hing dort fest, wo kein Trinkgeld hinkam. Die besten Restaurants stellten keine Frauen als Bedienung ein, selbst wenn sie weiß waren.
Ich musste kreativ werden und irgendwo einen Job finden, wo ich die Art von Männern kennenlernen würde, die einer Frau schöne Dinge kauften, die mich dann anziehender für jene Männer machte, die Größeres im Sinn hatten, wodurch ich mich hocharbeiten würde, hoch und immer höher. Ich wusste, was es bedeutete, welche Gegenleistung ich für diese Dinge erbringen musste. Ich war kein Kind mehr. Meine beiden Söhne sind der Beweis.
Als du mich also sahst – und das hast du, dessen bin ich mir sicher, denn unsere Blicke trafen sich –, hast du meine abgewetzten Klamotten gesehen, aber auch meine grünen Augen und die gerade Nase. Das Gesicht, dem ich meinen Spitznamen zu verdanken habe, obwohl ich später einen Mann kennenlernte, der meinte, ich würde ihn eher an eine Herzogin erinnern als an eine Kaiserin, und Helen passe besser zu mir. Er sagte, ich sei schön genug, um einen Krieg auszulösen. Und, habe ich das nicht auch? Ich weiß nicht, wie man es anders nennen soll. Vielleicht keinen großen Krieg, aber immerhin einen Krieg, in dem Männer aufeinander losgingen und Verbündete zu Feinden wurden. Und alles nur meinetwegen. Es war wie ein kurzes Aufblitzen, mit dem du mir gezeigt hast, wo ich hinwollte und wie ich dort hinkam. Ich hatte noch eine Chance. Ein weiterer Mann.
An jenem Tag hätte ich nicht gedacht, dass sich unsere Wege jemals wieder kreuzen würden, so klein Baltimore auch sein kann. Du warst einfach nur die Frau, die den widerlichen Teenager geheiratet hatte, der mich immer quälte, und jetzt war der widerliche Junge ein gutaussehender Mann, der seinen Vater beerdigte. So einen Ehemann brauche ich, dachte ich. Keinen Weißen, natürlich nicht, aber einen Mann, der mir einen Mantel mit Pelzbesatz am Kragen und Ärmeln kaufen kann, einen Mann, der allen Respekt abnötigte. Eine Frau ist nur so gut wie der Mann an ihrer Seite. Mein Vater hätte mir eine Ohrfeige gegeben, wenn er solche Worte aus meinem Mund gehört hätte, er hätte mich gezwungen, alle Bibelverse über Eitelkeit und Stolz herauszusuchen und auswendig zu lernen. Aber das war nicht Eitelkeit meinerseits. Ich brauchte einen Mann, der half, mich um meine Jungs zu kümmern. Ein gut situierter Mann braucht eine hübsche Frau. Das wurde mir an diesem Tag klar. Du warst da, um Milton zu trösten, ihm bei der Beerdigung seines Vaters zur Seite zu stehen, aber du warst auch eine Reklame für seine Arbeit und seinen Erfolg. Ich kann nicht glauben, dass du ihn ein Jahr später verlassen hast, aber der Tod kann Menschen verändern.
Mein Tod hat mich verändert, so viel steht fest.
Im Leben war ich Cleo Sherwood. Im Tod wurde ich zur Lady im See, zu einem ekligen, zersetzten Etwas, das man aus dem Brunnen der Fontäne zerrte, nachdem es dort monatelang eingeweicht wurde, den ganzen kalten Winter über, dann während des launischen Frühjahrs, fast bis in den Hochsommer. Gesicht weg, der Großteil meines Fleisches weg.
Und keinen Menschen interessierte das, bis du gekommen bist, mir diesen blöden Spitznamen verpasst und angefangen hast, an Türen zu klopfen und Leute zu belästigen und an Orten aufzukreuzen, an denen du nichts zu suchen hattest.
Niemand außerhalb meiner Familie hätte es eigentlich kümmern sollen. Ich war ein unvorsichtiges Mädchen, das mit dem Falschen ausgegangen war und nie mehr gesehen wurde. Du bist am Ende meiner Geschichte aufgekreuzt und hast sie zu deinem Anfang gemacht. Warum war das nötig, Madeline Schwartz? Warum konntest du nicht in deinem wunderschönen Haus und deiner passablen Ehe bleiben und mich auf dem Boden des Brunnens lassen? Dort war ich sicher.
Alle waren sicherer, als ich da unten war.
Maddie Oktober 1965
»Wie meinst du das, du hast Wallace Wright zum Abendessen eingeladen?«
Maddie Schwartz hätte die Frage am liebsten direkt wieder zurückgenommen, sobald sie ihr über die Lippen gekommen war. Maddie Schwartz benahm sich nicht so wie die Frauen in den Songs und Unterhaltungsshows im Fernsehen. Weder keifte sie, noch intrigierte sie. Sie brauchte keinen Song von Jack Jones, der sie daran erinnerte, dass sie ihre Frisur in Ordnung zu bringen und frisches Make-up aufzulegen hatte, bevor ihr Mann am Abend durch die Tür trat. Maddie Schwartz war stolz darauf, sich von nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Den Chef spontan zum Abendessen einladen? Mit zwei Cousins aus Toledo auftauchen, die noch nie erwähnt worden waren, oder einen alten Freund aus der Highschool mitbringen? Maddie war stets bereit für eine neue Herausforderung. Sie führte ihren Haushalt, wie ihre Mutter ihn geführt hatte, mit routiniertem Esprit und müheloser Effizienz – zumindest wirkte es mühelos.
Doch im Unterschied zu ihrer Mutter basierten ihre Haushaltswunder auf einem sehr großzügigen Umgang mit Geld. Miltons Hemden kamen in die beste Wäscherei von North Baltimore, obwohl sie dafür einen riesigen Umweg machen musste. (Sie brachte hin, Milton holte ab.) Zweimal die Woche kam eine junge Reinemachefrau. Maddies »berühmte« Hefebrötchen kamen aus der Dose, ihre Gefriertruhe war immer gut gefüllt. Für die anspruchsvolleren Gesellschaften der Schwartzens beauftragte sie Caterer, wie die Open-House-Party für Miltons Kollegen aus der Kanzlei am Neujahrstag und die spontane Frühlingsparty, die so ein Erfolg war, dass sie sich verpflichtet fühlten, sie jedes Jahr zu wiederholen. Die Leute liebten diese Party, sprachen das ganze Jahr über in aufrichtiger Vorfreude davon.
Ja, Maddie Schwartz war eine gute Gastgeberin, und es bereitete ihr Freude. Besonders stolz war sie darauf, fast ohne Vorlauf ein Abendessen auszurichten. Selbst wenn sie mal von einem Gast nicht begeistert war, nörgelte sie nie. Also war Milton an diesem Nachmittag über ihren gereizten Tonfall zu Recht überrascht.
»Ich dachte, du wärst begeistert«, sagte Milton. »Er ist, nun ja, relativ berühmt.«
Maddie fing sich schnell wieder. »Alles gut. Ich mache mir nur Sorgen, dass er Exquisiteres gewohnt ist als das, was ich auf die Schnelle improvisieren kann. Aber vielleicht kann man ihn mit Hackbraten und Kartoffelgratin bezaubern? Wenn man Wallace Wright heißt, besteht das Leben vermutlich nur aus Hummer Thermidor und Steak Diane.«
»Er meinte, er würde dich flüchtig kennen. Aus der Schule.«
»Oh, wir waren Jahre auseinander«, sagte Maddie in dem Wissen, dass ihr wohlwollender Ehemann annehmen würde, Wallace Wright sei der Ältere gewesen. Genau genommen war er zwei Jahre jünger, auf der Park School eine Klasse und auf der gesellschaftlichen Leiter der Highschool viele Stufen unter ihr.
Damals war er noch Wally Weiss. Heute konnte man kaum noch WOLDTV einschalten, ohne Wally Wright ausgesetzt zu werden. Er moderierte die Mittagsnachrichten und interviewte für die Sendung Berühmtheiten, die sich gerade auf der Durchreise in Baltimore befanden, und außerdem »Wright at Night«, ein relativ neues Abendformat, das sich mit Verbraucherbeschwerden befasste. In letzter Zeit sprang Wallace auch ein, wenn Harvey Patterson, der beliebte Chefmoderator von WOLD, sich einen seiner seltenen freien Abende nahm.
Und Wally war ebenfalls, obwohl eigentlich ein wohlgehütetes Geheimnis bei WOLD, der stumme Landstreicher, der Donadio moderierte, ein aufgezeichnetes und samstags ausgestrahltes Kinderprogramm. Donadio, Baltimores einfallslose Antwort auf Bozo den Clown, sprach nie ein Wort, und sein Gesicht war unter mehreren Lagen Schminke versteckt. Doch damals, als Seth noch klein war und die Sendung guckte, hatte Maddie die Maske sofort durchschaut.
Inzwischen war Seth auf der Junior High. Es war Jahre her, seit sie das letzte Mal Donadio gesehen hatte, oder sonst was auf WOLD. Sie bevorzugte WBAL, den Marktführer.
»Ist ein netter Kerl, dieser Wallace Wright«, fuhr Milton fort. »Überhaupt nicht eingebildet. Ich habe dir doch erzählt: Wir spielen immer Einzel in der neuen Tennishalle in Cross Keys.«
Milton neigte zum Namedropping und war gerade einfältig genug, um beeindruckt zu sein, wenn ein Fernsehpromi Tennis mit ihm spielte, selbst wenn es einer war, den man wegen seines unverkennbaren Baritons Mittagsnebel nannte. Süßer, ehrfürchtiger Milton. Maddie konnte ihm seinen Hang zur Heldenverehrung nicht übelnehmen, wenn man bedachte, wie sehr sie bisher davon profitiert hatte. Selbst nach achtzehn Ehejahren gab es noch unbeobachtete Momente, in denen er sie ansah, als wäre er nicht sicher, wie er je einen solchen Hauptgewinn hatte landen können.
Sie liebte ihn, das tat sie wirklich, und sie führten eine harmonische Ehe, und während sie, so, wie es sich gehörte, nach außen hin darüber klagte, dass ihr einziges Kind in zwei Jahren aufs College gehen würde, konnte sie es in Wahrheit kaum erwarten. Sie fühlte sich, als lebte sie in einem dieser Schukarton-Dioramen, die Seth in der Grundschule gebastelt hatte – die sie gebastelt hatte, seien wir ehrlich –, und inzwischen löste sich der Deckel und der Karton fiel langsam auseinander. Milton hatte kürzlich begonnen, Flugstunden zu nehmen, und sie gefragt, was sie von einem Zweitwohnsitz in Florida halte? Gefiele ihr der Atlantik besser oder der Golf? Boca oder Naples?
Mehr Auswahl gibt es nicht?, hatte Maddie sich gefragt. Die beiden Seiten von Florida? Die Welt ist doch sicher größer als das. Gesagt hatte sie allerdings nur, dass ihr Naples gefiele.
»Bis später, Liebling.« Sie legte den Hörer auf und erlaubte sich den Seufzer, den sie unterdrückt hatte. Es war Ende Oktober, die Hohen Feiertage waren endlich vorbei. Sie hatte keine Lust mehr, die Gastgeberin zu spielen und die Unterbrechungen ihrer gewohnten Tagesabläufe gingen ihr auf die Nerven. Rosch ha-Schana und Jom Kippur sollten Zeiten der Reflexion sein, der inneren Einkehr, doch Maddie konnte sich nicht erinnern, wann sie es zum letzten Male geschafft hatte, vor dem Fastenbrechen zu beten. Schließlich war der Haushalt wieder zur Normalität zurückgekehrt, da wollte Milton einen Gast mit nach Hause bringen, und ausgerechnet Wally Weiss.
Es war jedoch wichtig, Wallace Wright mit dem Abendessen zu beeindrucken. Die Hühnerbrust, die im Kühlschrank abtaute, hielt sich noch einen weiteren Tag. Und Hackbraten war, selbst mit überbackenen Kartoffeln, nicht der Ton, den sie anschlagen wollte. Maddie kannte einen cleveren Trick, ein Boeuf Bourguignon so zuzubereiten, dass es jedem schmeckte; es war zwar nicht à la Julia Child, jedoch blieb nie etwas übrig. Niemand ahnte, dass die Schlüsselzutat aus zwei Dosen Campbell’s Champignoncremesuppe bestand, plus zwei großzügig bemessenen Schuss Wein. Der Trick war, einen solchen Rinderschmortopf mit Dingen zu umgeben, die Eleganz und Planung durchschimmern ließen – Brötchen aus der Bäckerei Hutzler’s, die Maddie eigens zu diesem Zweck in der Tiefkühltruhe lagerte; einen Caesar Salad, den Milton erst am Tisch zubereitete und dann mit derselben Technik den Käse darüber hobelte, wie der Kellner im Marconi’s. Sie würde Seth zu Goldman’s schicken, um dort einen Kuchen zu kaufen. Immerhin war es eine gute Gelegenheit für ihn, Autofahren zu üben. Sie würde ihm zudem sagen, dass er sich Fast Food kaufen konnte, was immer er wollte. Zweifellos würde er sich etwas aussuchen, was treife war, aber Milton verlangte ja nur, dass sie zu Hause koscher lebten.
Maddie begutachtete die Bar, doch die war immer gut gefüllt.
Vor dem Abendessen würden sie zwei Runden Cocktails trinken – oh, sie würde etwas Raffiniertes mit Nüssen vorbereiten, oder vielleicht Pâté auf Toast-Ecken servieren –, während des Essens würde der Wein fließen und hinterher Brandy und Cognac. Sie wusste nicht, ob Wally viel trank, aber sie hatte ja auch seit dem Sommer, als sie siebzehn war, nicht mehr mit ihm gesprochen. Damals hatte niemand getrunken. Heute trank jeder in Maddies Umfeld.
Natürlich würde er sich verändert haben. Jeder verändert sich, aber ganz besonders pickelige Teenager. Man sagt, die Welt sei eine Männerwelt, aber man hört nie jemanden sagen, es sei eine Jungs-Welt. Das wurde Maddie sprichwörtlich klar, als Seth auf die Highschool kam. Sie hatte ihm gesagt, dass er Geduld haben solle. Irgendwann würde er so groß sein wie sein Vater, und sein Gesicht wäre glatt und hübsch, und ihre Prophezeiungen hatten sich bereits bewahrheitet.
Zu Wally hätte sie das nie sagen können. Trauriger, kleiner Wally. Wie er sich nach ihr verzehrt hatte. Wenn es ihr gerade gelegen kam, hatte sie diese Sehnsucht ausgenutzt. Aber das tun Mädchen nun mal, diese Macht besitzen sie. Wem wollte er etwas vormachen? Er mochte inzwischen größer sein, keine Pickel mehr haben, einen gebändigten Haarschopf, aber jeder in Northwest Baltimore wusste, dass er Jude war. Wallace Wright!
War Wally verheiratet? Maddie erinnerte sich an eine Frau, möglicherweise an eine Scheidung. Die Frau war keine Jüdin, dessen war sie sicher. Sie beschloss, zum Ausgleich noch ein weiteres Paar einzuladen, die Rosengrens, die für die staunende Bewunderung sorgen würden, zu der Maddie selbst mit Mühe nicht fähig wäre. Sie konnte Wallace nie ansehen, ohne Wally zu sehen. Würde es für ihn genauso sein? Würde er unter der Oberfläche der Maddie Schwartz die Maddie Morgenstern lauern sehen? Und würde er ihre neue Version als einen Fortschritt betrachten? Sie war damals ein hübsches Mädchen gewesen, daran gab es nichts zu deuteln, doch auch furchtbar, ja, geradezu tragisch naiv. In ihren Zwanzigern war sie darin aufgegangen, ihr Kind großzuziehen, und hatte riskiert, altbacken zu werden.
Jetzt, mit siebenunddreißig, genoss sie das Beste aus beiden Welten. Im Spiegel sah ihr eine wunderschöne Frau entgegen, immer noch jugendlich, aber in der Lage, sich all das leisten zu können, was dafür sorgte, dass dies auch so blieb. Sie hatte eine silberne Haarsträhne und sich entschieden, sie als eleganten Stilbruch anzusehen. Den Rest zupfte sie aus.
Als sie Wally an jenem Abend die Tür öffnete, freute sie sich über seine unverhohlene Bewunderung.
»Junge Dame, ist deine Mutter zu Hause?«
Das ärgerte sie. Es war ein so plattes Geschmeichel, etwas, was man zu einer einfältigen Oma sagte, die zu viel Rouge aufgetragen hatte. Dachte Wally, sie hätte diese Art von Aufmunterung nötig? Während sie die erste Runde an Drinks und Snacks servierte, versuchte sie, ihre Frostigkeit zu überspielen.
»Also«, sagte Eleanor Rosengren, nachdem sie ihren ersten Highball heruntergekippt hatte, »kennen Sie sich wirklich schon von der Park?« Wie Milton hatten die Rosengrens eine staatliche Highschool besucht.
»Flüchtig«, gab Maddie mit einem Lachen zu, einem Lachen, das signalisieren sollte: Es ist schon so lange her, langweilen wir die anderen nicht damit.
»Ich war in sie verliebt«, sagte Wally.
»Warst du nicht.« Lachend, ein wenig verlegen und – wieder – nicht geschmeichelt. Als machte man sich über sie lustig, als bereitete er einen Witz vor, dessen Pointe sie sein würde.
»Natürlich war ich. Weißt du nicht mehr – ich bin mit dir zum Abschlussball gegangen, als – wie hieß er noch gleich – dich versetzt hat.«
Ein neugieriger Blick von Milton.
»Oh, er hat mich nicht versetzt, Wally. Entschuldige, Wallace. Wir haben zwei Wochen vor dem Abschlussball Schluss gemacht. Das ist etwas ganz anderes, als versetzt zu werden.« Sie hätte auch gut auf den Ball verzichten können, wäre da nicht das neue Kleid gewesen. Es hatte 39,95 Dollar gekostet – ihr Vater wäre außer sich gewesen, wenn sie es nach all der Bettelei nicht getragen hätte.
Mit dem Namen, nach dem er gesucht hatte, half sie ihm nicht aus. Allan. Allan Durst Junior. Zu Beginn ihrer Beziehung hatte der Name jüdisch genug geklungen, um ihre Mutter zu besänftigen. Sein Vater war ja auch Jude, zumindest irgendwie. Aber nachdem Mrs. Morgenstern ihn erst einmal gesehen hatte, ließ sie sich nicht mehr täuschen. »Das sollte besser nichts Ernstes werden«, hatte ihre Mutter gesagt, und Maddie hatte nicht widersprochen. Mit jemand anderem wurde es gerade ernst, jemandem, der ihrer Mutter vermutlich noch weniger gefallen würde.
»Gehen wir ins Esszimmer?«, schlug Maddie vor, obwohl die Gäste ihre Cocktails noch gar nicht ausgetrunken hatten.
Wally – Wallace – war der Jüngste von den fünf, die am Tisch saßen, doch er war es eindeutig gewohnt, dass die Leute Wert auf seine Meinung legten. Die zuvorkommenden Rosengrens löcherten ihn mit Fragen. Wer würde für das Amt des Gouverneurs kandidieren? Was dachte er über Agnews neueste Entgleisung? Baltimores Kriminalitätsrate? Wie war Gypsy Rose Lee denn nun wirklich? (Sie war kurz zuvor in Baltimore gewesen, um Werbung für ihre eigene senderunabhängige Talkshow zu machen.)
Für jemanden, der seinen Lebensunterhalt mit Interviews verdiente, stellte Wallace nur wenige Fragen. Als die Männer ihre Meinungen zu aktuellen Ereignissen kundtaten, hörte er mit geduldiger Herablassung zu und widersprach ihnen dann. Maddie versuchte die Unterhaltung in Richtung eines Romans zu steuern, den sie gelesen hatte, Die Hüter des Hauses, der einige ausgezeichnete Argumente bezüglich der Rassenproblematik im Süden anführte, doch Eleanor meinte, sie hätte es nicht zu Ende lesen können, und die Männer hatten noch nie davon gehört.
Vermutlich war es aber doch ein gelungener Abend, dachte Maddie. Milton war hocherfreut, einen berühmten Freund zu haben, und die Rosengrens waren von Wallace überaus angetan. Er schien sie offensichtlich auch zu mögen. Später am Abend, tief in seinen Brandy versunken, das Licht gedämpft, sodass die Enden ihrer Zigaretten wirkten wie sich langsam durch das Wohnzimmer bewegende Glühwürmchen, sagte Wallace: »Du hast dich ja ganz ordentlich geschlagen, Maddie.«
Ganz ordentlich? Ganz ordentlich?
»Stell dir mal vor«, fuhr er fort, »du wärst bei diesem Kerl hängengeblieben. Durst, so hieß er. Er ist Anzeigentexter. Ein Werbefritze.«
Sie sagte, sie hätte Allan Durst seit der Highschool nicht mehr gesehen, was der Wahrheit entsprach. Dann ergänzte sie, sie wisse aus dem Ehemaligenblatt der Park School von seinem Job, was nicht stimmte.
»Ich wusste gar nichts von einer großen Highschool-Liebe«, meinte Milton.
»Weil’s keine gab«, erwiderte Maddie schärfer, als beabsichtigt.
Gegen elf hatten sie sie alle schwankend und darauf bestehend, dass es eine Wiederholung geben müsse, auf den Heimweg geschickt. Die Drinks und die Aufregung hauten Milton schlagartig um und er stolperte ins Bett. Normalerweise hätte Maddie das Saubermachen ihrer Freitagshilfe überlassen. Es war kein Verbrechen, schmutziges Geschirr im Becken stehen zu lassen, sofern man es abgespült hatte. Tattie Morgenstern hätte allerdings noch nicht einmal eine Gabel in ihrem Spülbecken liegenlassen.
Doch Maddie beschloss, aufzubleiben und Ordnung zu schaffen.
Im Jahr zuvor war die Küche umgebaut worden. Maddie war so stolz auf ihre neue Küche gewesen, als sie fertig war, so glücklich mit ihren neuen Geräten, doch die Freude war schnell verflogen. Jetzt erschien der Umbau töricht, regelrecht sinnlos. Was bedeutete es schon, die neuesten Geräte zu haben, all diese schicken Einbauten? Man sparte überhaupt keine Zeit, obwohl der Umbau der Schränke den Gebrauch zweier Essgeschirre einfacher machte.
Wally hatte sich überrascht gezeigt, als er während des Salats feststellte, dass die Familie Schwartz einen koscheren Haushalt führte, was ein Zugeständnis an Miltons Elternhaus war. Zwei Sets Geschirr, kein Vermengen von Fleisch und Milch, Vermeidung von Schweinefleisch und Schalentieren – es war nicht allzu schwer, und es machte Milton glücklich. Sie verdiente seine Hingabe, sagte sie sich, während sie die Kristallgläser einschäumte und abspülte, das gute Porzellan von Hand abtrocknete.
Als sie sich umdrehte, um die Küche zu verlassen, erwischte sie mit der Spitze ihres Ellenbogens ein Weinglas, das auf dem Abtropfgestell stand. Es stürzte zu Boden, wo es zersprang.
Wir müssen ein Glas zerbrechen.
Worüber redest du da?
Egal. Ich vergesse immer, was für eine Heidin du bist.
Das zerbrochene Glas bedeutete, dass sie fünf weitere Minuten mit Besen und Kehrblech zubringen musste, um jeden Splitter zu finden. Als sie fertig war, war es fast zwei Uhr, doch Maddie hatte Schwierigkeiten, einzuschlafen. Ihr schwirrte der Kopf, im Geiste ging sie Listen von unerledigten oder übersehenen Dingen durch. Doch nichts davon war Teil der Gegenwart. Die Dinge, die sie nicht getan hatte, lagen zwanzig Jahre zurück, damals, als sie Wally kennengelernt hatte – und ihre erste Liebe, denjenigen, von dem ihre Mutter nie etwas ahnte. Sie hatte sich geschworen, sie würde – ja, was eigentlich? Ein kreativer und origineller Mensch werden, jemand, der sich nicht im Geringsten um die öffentliche Meinung scherte. Sie – sie beide – würden nach New York City gehen und im Greenwich Village leben. Er hatte es versprochen. Er würde sie aus dem trübseligen Baltimore herausholen, und sie würden ein leidenschaftliches Leben führen, das der Kunst und dem Abenteuer gewidmet wäre.
All diese Jahre hatte sie ihn aus ihren Gedanken verbannt. Nun war er zurück, Elias, der kommt, um seinen Pessach-Wein zu trinken.
Maddie schlief ein, während sie einen imaginären Kalender durchblätterte und herauszufinden versuchte, welcher Zeitpunkt der beste wäre, um ihre Ehe hinter sich zu lassen. Nächsten Monat hatte sie Geburtstag. Dezember? Nein, nicht während der Feiertage, so unwichtig Chanukka auch war. Februar erschien zu spät, Januar ein Klischee, ein Nachäffen der guten Vorsätze fürs neue Jahr. Der 30. November ist es, entschied sie. Am 30. November würde sie gehen, zwanzig Tage nach ihrem siebenunddreißigsten Geburtstag.
Wir müssen ein Glas zerbrechen.
Worüber redest du da?
Egal.
Der Klassenkamerad
Ich umfasse das Lenkrad meines neuen Cadillac und führe den ganzen Weg von Maddies bis zu meinem Haus Selbstgespräche, so kurz er auch ist, eine scharfe Kurve die Greenspring runter, vorbei an der Park School – unsere Alma Mater, obwohl die Uni zu unserer Zeit noch woanders war –, dann links abbiegen und den Hügel hinauf nach Mount Washington. Ich rede mit mir wie ein Trainer, nicht, dass ich je für irgendein Team gespielt hätte. Habe es noch nicht mal bis zum Wasserträger geschafft. Konzentrier dich, Wally, konzentrier dich.
In meinem Kopf bin ich immer Wally. Jeder sieht zu Wallace Wright auf, ich eingeschlossen. Ich würde es nicht wagen, mit ihm genauso zu reden wie mit Wally.
Ich habe panische Angst, die Mittellinie zu überqueren und ein anderes Auto anzufahren, oder Schlimmeres. Verkehrsunfall – WOLD-Anchorman Wallace Wright in der Nähe seines Hauses in Northwest Baltimore wegen fahrlässiger Tötung verhaftet.
»Der Journalist darf nie als Schlagzeile enden, Wally«, ermahne ich mich. »Fokussiere dich.«
Von der Polizei angehalten zu werden wäre allerdings fast genauso schlimm. WOLD-Anchorman wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Nur deshalb eine Nachricht, weil ein Nachrichtenmann drin vorkommt. Wer fährt denn nicht von Zeit zu Zeit mal ein bisschen beschwipst? Doch ein Cop könnte mich auch weiterwinken, vielleicht sogar um ein Autogramm bitten.
Wo hat Maddie so zu trinken gelernt? Vermutlich ist es wie in dem alten Witz darüber, wie man es in die Carnegie Hall schafft: Üben, üben, üben. Ich hatte nie Gelegenheit mir das Cocktailtrinken anzugewöhnen, denn ich bin selten vor acht Uhr abends zu Hause und muss am nächsten Morgen spätestens um neun im Studio sein, um dann mittags auf Sendung zu gehen. Diese Routine eignet sich nicht für Alkohol. Oder die Ehe.
Mount Washington ist um Mitternacht so dunkel, so leise. Warum ist mir das noch nie aufgefallen? Das einzige Geräusch ist das Knirschen des Herbstlaubs unter meinen Reifen. Als ich endlich die South Road hochkrieche, erscheint es mir vernünftiger, am Bordstein zu parken, als zu versuchen, die Einfahrt hochzufahren, geschweige denn in die Garage.
Warum bin ich so lange geblieben? Es lag bestimmt nicht an der glänzenden Unterhaltung. Du bekommst nicht jeden Tag die Chance, deiner ersten großen Liebe zu zeigen, welchen Fehler sie begangen hat.
Selbst wenn man mich heute Morgen gefragt hätte – und die Leute fragen mich viele Sachen, Sie würden staunen, was für ein Orakel ich bin –, hätte ich aufrichtig geantwortet, dass ich nie an Maddie Morgenstern gedacht habe.
Doch in dem Moment, als ich sie auf ihrer Türschwelle stehen sah, wurde mir klar, dass sie immer bei mir gewesen war, mein Einpersonenpublikum. Von Montag bis Freitag, wenn ich zwischen zwölf und halb eins in den Mittagsnachrichten vor der Kamera stand, war sie dort. Mittwochabends, wenn ich »Wright sorgt für Ihr Recht« drehte. Wann immer ich das Glück hatte, für Harvey Patterson einzuspringen, dessen Job ich eines Tages übernehmen werde. Irgendwie hatte Maddie den Trick raus, ein siebzehnjähriges Mädchen zu sein und gleichzeitig eine Vorstadtmutti, die nach getaner morgendlicher Hausarbeit bei einer Tasse Kaffee daheim sitzt, Kanal 6 schaut und denkt: Hätte ich meine Karten richtig ausgespielt, könnte ich heute Mrs. Wright sein.
Selbst, wenn ich mein Make-up auflege und den Donadio gebe, den traurigen, schweigenden Clown, der mir durch Zufall die Tür zu WOLD-TV geöffnet hat, ist sie dort.
Ich hatte beim Radio gearbeitet, wo man mich wegen meiner Stimme schätzte, aber nicht für telegen hielt. Der Donadio-Auftritt bedeutete 25 Dollar mehr pro Woche. Einzige Bedingung war, dass ich nie jemandem davon erzählen durfte, und ich habe mehr als glücklich eingewilligt.
Eines Samstags, als ich mich gerade abschminkte, kam die Nachricht eines Polizistenmordes herein. Ich war der einzige verfügbare Journalist. Irgendwie war ich während der vierzehn Monate der Donadio-Maskerade ein Stück gewachsen, mein Haar war weicher und mein Teint seltsamerweise glatter. Vielleicht hatte ich mein Gesicht besser gereinigt, nachdem ich angefangen hatte, regelmäßig Make-up zu tragen. Jedenfalls passten mein Gesicht und mein Körper nun endlich zu meinem dröhnenden Bariton. Ich fuhr zum Tatort, ich trug die Fakten zusammen, ein Star ward geboren. Nicht Maddie, nicht dieser Poz, mit dem sie auf der Highschool gegangen ist, und auch nicht ihr tadelloser Anwaltsehemann. Ich, Wally Weiss. Ich bin der Star.
Kennengelernt haben wir uns ausgerechnet in der Amateurfunk-AG unserer Schule. Wir stellten schnell fest, dass wir beide Edward R. Murrow verehrten, dessen Kriegsberichterstattung aus London einen tiefen Eindruck bei uns hinterlassen hatte. Ich hatte vorher noch nie ein Mädchen getroffen, das sich über Murrow und Journalismus unterhalten mochte, und schon gar kein hübsches. Es war wie dieses erste große Kunstwerk, das einen in Bann schlägt, dieser eine Roman, der einen für den Rest des Lebens begleitet, selbst, wenn man später viel bessere liest. Ich konnte mich kaum zurückhalten, sie mit offenem Mund anzustarren.
Maddies Erscheinen in der Funk-AG stellte sich als ein einmaliges Ereignis heraus; sie hatte gedacht, es sei eine Hörfunk-AG, also für Leute mit Interesse am Schreiben und an Hörspielen, kein Raum voller Schluffis, die gern herumtüftelten. Sie wechselte zur Schülerzeitung, zog sich schnell eine Kolumne an Land und schloss sich einer sehr zügellosen, nichtjüdischen Clique an, zu der auch Allan Durst gehörte. Ganz offensichtlich konnte Maddie Morgenstern es nicht ernst mit ihm meinen, aber ihre Eltern waren schlau genug, nicht gegen eine Highschool-Liebelei einzuschreiten. Ich habe gehört, dass sie Allans Eltern sogar am Schabbes zu sich eingeladen haben. Die Mutter war eine bekannte Malerin riesiger abstrakter Bilder, die in Museen hingen, der Vater ein fähiger Porträtmaler, der sich auf Baltimore-Witwen spezialisiert hatte.
Kurz vor dem Abschlussball machte Allan mit Maddie Schluss. Ich entdeckte sie zufällig in einem leeren Klassenraum, weinend. Sie vertraute sich mir an, was eine Ehre für mich war. Ich schlug vor, dass sie mit mir zum Ball ging.
»Was könnte ihn mehr treffen?«, sagte ich und klopfte ihr mit einer streichenden Bewegung auf den Rücken, fast wie einem Baby, dem man beim Aufstoßen hilft. Meine Hand berührte etwas, das sich wie der Verschluss eines BHs anfühlte, meine bis dahin erotischste Erfahrung.
Sie stimmte meinem Plan mit fast schmerzlichem Eifer zu.
Fürs Handgelenk kaufte ich ihr ein Anstecksträußchen mit der teuersten Orchidee, die man in Baltimore auftreiben konnte. Und sie spielte mit, ignorierte Allan, der allein gekommen war, und lachte über meine Witze, als wäre ich Jack Benny. Irgendwann sprach Allan sie dann an und bat um einen Tanz, »der alten Zeiten wegen«. Maddie legte ihren Kopf schief, als versuchte sie sich zu erinnern, welche alten Zeiten genau sie miteinander geteilt hätten, und meinte dann: »Nein, nein, ich freue mich, den Abend mit meinem Rendezvous zu verbringen.«
Ich wirbelte mit ihr davon und fühlte mich vom Scheitel bis zur Sohle wie der junge Fred Astaire. Wenn man mal darüber nachdenkt, sah Astaire im herkömmlichen Sinn nicht wirklich gut aus. Er war nie der größte Mann im Raum, und er war kein Athlet. Aber er war Astaire.
Als ich sie nach dem Tanzabend im Buick meines Vaters nach Hause fuhr, rutschte sie über den Sitz zu mir und legte ihren Kopf auf meine Schulter. Sie vertraute mir an, dass sie schreiben wolle, wirklich schreiben, Gedichte und Romane, was fast aufregender war als ihr sehr realer Kuss vor der Haustür. Wieder im Wagen, entdeckte ich, dass die Blume von ihrer Schleife abgefallen war. Vielleicht duftete sie nur nach ganz gewöhnlicher Orchidee, aber für mich war es Maddies unverwechselbarer Duft, so einzigartig wie ihre für einen Teenager sehr dezente und rauchige Stimme. Maddie quiekte nie, so eine war sie nicht. Sie war würdevoll, majestätisch, das Mädchen, das bei der Purim-Aufführung immer die Königin Esther spielte.
Drei Tage später, in der Annahme, dies sei die angemessene Frist, rief ich sie an, um zu fragen, ob ich sie ins Kino ausführen dürfte, zu einem echten Rendezvous. Ich wollte weder zu eifrig klingen noch zu distanziert. Sehr Astaire.
Ihr Ton war verdutzt, aber höflich. »Das ist süß von dir, Wally, dass du dir meinetwegen Sorgen machst«, sagte sie. »Aber mir geht’s gut.«
Innerhalb eines Jahres war sie mit Milton Schwartz verlobt, groß, behaart und älter, er zweiundzwanzig, sie achtzehn. Er hatte das erste Jahr seines Jurastudiums bereits hinter sich. Ich war bei ihrer Hochzeit. Es war, als sähe man zu, wie Alice Faye mit King Kong davonläuft.
Über zwanzig Jahre hatte ich nicht mehr an Milton Schwartz gedacht, bis ich ihn in der Umkleidekabine der Tennishalle wiedertraf, aufgrund der räumlichen Nähe zum Television Hill der einzige geeignete Ort, an dem ich vor der Arbeit Sport treiben konnte.
Wir spielten Einzel, passten von der Spielstärke her gut zusammen, und Milton schien es offensichtlich zu freuen, einen berühmten Freund zu haben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er mich zum Abendessen zu sich nach Hause einlud. »Keine große Sache«, sagte er. »Nur meine Frau, vielleicht unsere Nachbarn, und Ihre Begleitung, wenn Sie mögen.«
Bettina und ich sind inzwischen seit zwei Jahren getrennt, und obwohl ich mit Frauen ausgehe, ist es mit keiner was Ernstes. Ich entschied, allein hinzugehen, wie Allan auf den Abschlussball. Milton wusste, dass ich dieselbe Highschool besucht hatte wie Mrs. Schwartz, sagte jedoch, seine Frau hätte mich nie erwähnt. Dass Maddie nicht mit unserer Bekanntschaft prahlte, versetzte mir jedoch keinen Dämpfer, ich betrachtete es eher als Kompliment. Wenn sie ihrem Mann gegenüber nicht erwähnt hatte, dass sie den »Mittagsnebel« von Baltimore kannte, dann bestimmt, weil sie in manchen Momenten darüber fantasierte, was hätte sein können. Am Küchentisch, bei ihrem Kaffee, eine brennende Zigarette zwischen den Fingern, ließ sie die Erinnerung an den Abschlussball und meinen Anruf drei Tage später noch einmal aufleben und ohrfeigte sich, dass sie nicht ja gesagt hatte. Ihr dunkles Haar vermutlich vorzeitig ergraut, ihre schlanke Figur mit Wespentaille inzwischen pummelig und plump. Wie sich herausstellen sollte, entsprach nichts davon der Wahrheit, aber so hatte ich sie mir vorgestellt.
Es überraschte mich herauszufinden, dass sie einen koscheren Haushalt führten. Ich habe mich nie bewusst vom Judentum distanziert, aber ein Fernsehstar wie ich muss zu seinem Publikum eine Verbindung aufbauen, und meine Zuschauer sind hauptsächlich Christen. Das ist der Preis dafür, ein Orakel zu sein. Andererseits gibt es orthodox und orthodox, und die Weigerung der Schwartzens, Fleisch und Milchprodukte zu mischen, war das einzige Zugeständnis ihres Haushalts an den Judaismus, den ich erkennen konnte. Ich war etwas entsetzt über die Dinge, die sie über die sich verändernden Wohngegenden im Süden sagten, die religiöseren Juden, die an der Park Heights Avenue leben, denen sie sich klar überlegen fühlten. Wenn Sie mich fragen, gibt es keine schlimmeren Antisemiten als Juden der Mittelschicht.
Aber wir haben nicht viel über das Judentum geredet. Wir haben über Politik diskutiert, wobei sich die Schwartzens und ihre Gäste meiner Meinung anschlossen, wie es Leute für gewöhnlich tun. Wir haben über Spiro Agnews neuesten Schnitzer gelacht, die Rede in Gettysburg, bei der er ganz offenkundig durcheinandergebracht hatte, wer auf dem Schlachtfeld den Sieg davongetragen hatte. Als wir bei den Drinks nach dem Essen angekommen waren, war die Atmosphäre herzlich und vertraut. Ich dachte, ich könnte das Thema gefahrlos auf den Abschlussball lenken – und Maddies anschließende Weigerung, erneut mit mir auszugehen.
Und sie hat es bestritten. Sie hat darauf beharrt, dass ich sie nie angerufen hätte. Ja, stimmte sie zu, wir seien zusammen auf den Ball gegangen, aber sie bestand darauf, ich hätte sie nie mehr angerufen, obwohl ich genau weiß, dass dem so war.
»Denn natürlich wäre ich dann mit dir ausgegangen!«, sagte sie als Argument dafür, dass sie recht hätte. Aber sie musste noch einen draufsetzen: »Und wenn auch nur aus reiner Höflichkeit.«
Dennoch war ihre hitzige Reaktion bei diesem Thema unangemessen. Es gab keinen Grund, sich deswegen so zu echauffieren.
Als ich wieder sicher vor meiner eigenen Tür stehe, lasse ich den Schlüssel zwei-, dreimal fallen, bevor ich in mein Haus stolpere, immer noch verdutzt über Maddies Feindseligkeit. Hat sie gemerkt, dass ich sie durchschaut hatte? Ich mochte derjenige mit dem Gojim-Namen sein, doch im Herzen war ich stets ein jüdischer Junge, während die Schwartzens mit ihren beiden Geschirrsets nur ersatz waren. Alles in ihrem Haus war nur Getue.
Mein Haus ist so still – und so staubig –, seit Bettina ausgezogen ist. Ich nahm an, sie würde darum kämpfen, es zu behalten. Während unserer sechs gemeinsamen Jahre war dieses Haus ihre Hauptbeschäftigung. Doch am Ende wollte Bettina nichts mehr damit zu tun haben. Oder mit mir. Wir haben keine Kinder. Ich weiß nach wie vor nicht, wie ich das finde. Ein Kind wäre begeistert gewesen, Donadio als Vater zu haben.
Obwohl ich erschöpft und stockbesoffen bin, gehe ich in das »Arbeitszimmer«, das Bettina im ersten, hoffnungsvollen Jahr unserer Ehe für mich eingerichtet hat. Nur Leder und Mahagoni, mit Drucken englischer Pferderennen, die mir peinlich sind, obwohl die Nähe zu Pimlico solche Allüren rechtfertigen. Bettina hat die Bücher nach Optik einsortiert, was mich in den Wahnsinn treibt, aber schließlich finde ich das Gesuchte: Meine alte, zerlesene Ausgabe von Arc de Triomphe, mit den anderen Taschenbüchern in eines der obersten Regale verbannt. Nachdem ich es das erste Mal gelesen hatte, wollte ich schreiben, wollte anderen Menschen die Gefühle vermitteln, die Romane mir vermittelten. Stattdessen teile ich ihnen die Schlagzeilen und das Wetter mit und hebe gelegentlich wegen eines Stars eine Augenbraue.
Und da ist sie, zwischen den Seiten 242 und 243, braun und vertrocknet, Maddies Orchidee.
Natürlich beweist die Existenz der Blume überhaupt nichts: Wir hatten verabredet, gemeinsam zum Abschlussball zu gehen. Und doch ist es der rauchende Colt, der unumstößliche Beweis – doch, von was? Dass alles so passiert ist, wie ich erzählt habe. Warum hat sie es bestritten? Meine Geschichte ist ein Beweis ihrer Macht, der Herrlichkeit ihrer Jugend.
Aber letztendlich ist es gut, dass aus der Sache nicht mehr geworden ist. Mit fünfunddreißig bin ich noch jung, mein Leben besteht aus lauter Möglichkeiten. Ich mag zwar momentan nur die zweite Garnitur interviewen, aber eines Tages werde ich mich mit Präsidenten und Königen unterhalten, vielleicht für einen der großen Sender arbeiten. Wohingegen Maddie Schwartz, die auf die vierzig zugeht, nichts mehr hat, worauf sie sich noch freuen kann.
Januar 1966
Erst, als der Juwelier die Lupe ans Auge hob, wurde Maddie bewusst, dass sie das Geld für den Verkauf ihres Verlobungsrings mental schon ausgegeben hatte. Was würde er ihr dafür geben? Tausend? Vielleicht sogar zweitausend?
Sie brauchte so viel. Die neue Wohnung hatte zwei Zimmer und war spärlich eingerichtet. Sie hatte angenommen, Seth würde bei ihr wohnen. Doch er weigerte sich und sagte, er würde lieber bei seinem Vater in Pikesville bleiben, in der Nähe seiner Freunde und der Schule. Selbst, nachdem sie ihm angeboten hatte, ihn zur Schule zu fahren, weigerte er sich umzuziehen. Miltons Einfluss, vermutete Maddie. Sie tröstete sich mit dem Wissen, dass Seth sowieso in zwei Jahren zu Hause ausziehen würde.
Aber hätte sie geahnt, dass Seth Widerstand leisten würde, hätte sie sich eine Einzimmerwohnung in einer besseren Gegend genommen. Und dann hätte sie auch ein Telefon gehabt, obwohl es kein großes Drama war, kein Telefon zu besitzen. Es bedeutete, dass ihre Mutter nicht jeden Tag anrufen konnte, um über Maddies Zukunft zu diskutieren und das, was Tattie Morgenstern stets ihre eingeschränkten Verhältnisse nannte.
Jetzt, da du in eingeschränkten Verhältnissen lebst, Madeline, willst du vielleicht Rabattmarken sammeln. Ich habe gesehen, dass die Hochschilds gute Sachen im Ausverkauf anbieten – du wirst dich an Ausverkäufe und Rabattmarken gewöhnen müssen, jetzt, bei deinen eingeschränkten Verhältnissen. Angesichts deiner eingeschränkten Verhältnisse ist es vielleicht sinnvoll, kein eigenes Auto zu besitzen.
Ärgerlich war, dass ihre Mutter recht hatte. Alles an Maddies Post-Milton-Leben war kleiner und schäbiger. Das Appartement war recht schön, aber wie sich herausstellte, war die Gist Avenue, obwohl auf der richtigen Seite des Northern Parkway, gar nicht schön. Der Vermieter hatte sie überredet, sich nachmittags mit ihm zu treffen, wenn das Viertel menschenleer und ruhig war. Zu dieser Tageszeit erinnerte die Wohnung Maddie an ein 3D-Bild von Paul Klee: Die warme Wintersonne malte goldene Quadrate auf den leeren Holzboden und glitzerte auf den winzigen blauen und rosafarbenen Kacheln im Bad. Sie sah nur Formen und Licht, Raum und Möglichkeiten.
Erst als sie mit dem Umzug begann, stellte sie fest, dass, so charmant die Wohnung auch war, die Nachbarschaft eindeutig gemischt war. Gemischt auf dem Weg zu weniger gemischt. Maddie hatte keine Vorurteile, natürlich nicht. Wenn sie jünger und kinderlos gewesen wäre, wäre sie vor ein paar Jahren in den Süden gezogen, um sich dem Wähler-Registrierungsprojekt anzuschließen. Dessen war sie sich fast sicher. Doch es gefiel ihr nicht, in ihrer neuen Nachbarschaft so sichtbar zu sein, eine einzelne Weiße, die zufällig einen Pelzmantel besaß. Nur Biber, aber dennoch. Sie trug ihn gerade. Vielleicht würde der Juwelier mehr zahlen, wenn sie wie jemand wirkte, der das Geld nicht brauchte.
Als Milton ihre neue Adresse erfuhr, sagte er, Seth könne sie überhaupt nicht besuchen, nicht über Nacht. Er sagte, sie könne die Wochenenden mit Seth in ihrem alten Zuhause verbringen, wenn sie wolle, Milton würde das Feld räumen, damit Mutter und Sohn zusammen sein könnten. Eine freundliche, eine großzügige Geste, aber Maddie fragte sich, ob Milton bereits eine Neue hatte. Diese Vorstellung ärgerte sie, doch sie tröstete sich damit, dass eine neue Frau an seiner Seite vermutlich die Einzige war, die Milton davon überzeugen könnte, in die Scheidung einzuwilligen.
Sie hatte sich tiefer über die Ladentheke gebeugt, als ihr bewusst war, so weit, dass ihr Atem kleine Wolken auf dem Glas hinterließ.
»Den haben Sie nicht hier gekauft?« Der Juwelier ließ es wie eine Frage klingen, doch diese Information hatte sie bereits gegeben.
»Nein, er ist aus einem Geschäft in der Innenstadt. Steiners. Ich glaube, die sind dort nicht mehr.«
»Ja, ich erinnere mich. Sehr nobler Laden. Die haben eine Menge Geld in die Einrichtung gesteckt. Wir halten es hier eher schlicht. Ich sage meinen Angestellten immer: In einem Juweliergeschäft sind es die Juwelen, die funkeln sollen. Wenn sie von guter Qualität sind, braucht man sie nicht auf Samt zu betten. Man braucht keine Innenstadtlage, wo die Mieten hoch sind und es keine Parkplätze gibt. Weinstein’s mag nicht besonders schick sein, aber wir sind nach wie vor im Geschäft und das genügt mir.«
»Und mein Ring …«
Er sah sie betrübt an, doch es war eine höfliche, zur Schau gestellte Betrübtheit, als wäre eine unsympathische Bekanntschaft gestorben und er täte jetzt so, als berührte es ihn mehr, als es tatsächlich der Fall war.
»Fünfhundert, mehr kann ich da nicht machen.«
Es war wie ein Schlag in die Magengrube, auch wenn Maddie nie geschlagen worden war.
»Aber mein Mann hat tausend Dollar bezahlt, und das ist fast zwanzig Jahre her.« Sie machte sich ein bisschen älter, denn sie war erst siebenunddreißig und hatte mit neunzehn geheiratet. Doch zwei Jahrzehnte wogen mehr als achtzehn Jahre.
»Ach, die Leute waren in den Vierzigern leichtfertiger, nicht wahr?«
Stimmte das? Sie war damals ein Teenager, ein hübsches Mädchen; leichtfertig zu sein war ihr Naturzustand. Doch Milton war ein pragmatischer junger Mann, stets vorsichtig, was Schulden betraf, und klug, wenn es um Investitionen ging. Er hätte keinen Ring ohne einen guten Wiederverkaufswert ausgesucht.
Nur – Milton hatte nie in Betracht gezogen, dass dieser Ring verkauft werden würde; selbst die Männer, die Elisabeth Taylor den Hof machten, glaubten, sie würden auf ewig mit ihr zusammen sein.
»Ich verstehe nicht, wie ein Ring, der 1946 tausend Dollar gekostet hat, heute nur noch halb so viel wert sein kann.« Schon beim Sprechen merkte sie, wie schnell sie von einer Übertreibung zu einer Lüge übergegangen war, wie aus »fast zwanzig«, im Grunde absolut richtig, zwanzig geworden war.
»Wenn Sie das wirklich wissen wollten, könnte ich Sie mit einem Vortrag über den Markt für gebrauchte Diamanten und Gewinnmargen langweilen. Ich könnte Ihnen etwas über Schliff und Reinheit erzählen und darüber, wie Moden sich ändern. Das alles erkläre ich Ihnen gern, aber unter dem Strich steht, dass ich Ihnen nicht mehr als fünfhundert Dollar geben kann.«
»Wir hatten ihn mit zweitausend Dollar versichert«, sagte sie. Stimmte das? Es klang richtig. Oder vielleicht hatte sie ja auch nur gehofft, zweitausend Dollar zu bekommen.
Milton zahlte ihr Unterhalt, seit sie ihn verlassen hatte, doch es reichte nicht und kam unregelmäßig, ohne ein festes Datum oder einen bestimmten Betrag. In der Annahme, Seth würde mit ihr ausziehen, hatte sie eine großzügigere Unterhaltssumme erwartet. Milton würde seinen einzigen Sohn nie verleugnen. Doch da Seth im Haus in Pikesville geblieben war, hatte sie keinen derartigen Hebel. Sie brauchte Geld. Milton versuchte, sie auszuhungern und durch Knauserigkeit zur Rückkehr zu zwingen.
»Was den langweiligen Teil angeht, macht er keine Witze«, sagte eine junge Frau mit rötlichem Haar, die gerade einen Schaukasten polierte. Maddie überraschte es, dass eine Angestellte es wagte, so frech mit ihrem Chef zu sprechen, doch Jack Weinstein lachte nur.
»Jetzt reicht es aber, Judith. Ich sag Ihnen was, Mrs. Schwartz – lassen Sie mir Ihre Nummer da, und wenn ein Kunde kommt und einen solchen Ring sucht, können wir vielleicht doch noch etwas machen. Es ist nicht der Stil –«
»Es ist ein klassischer Solitär.«
»Genau. Die jungen Mädchen, die heutzutage heiraten, haben interessante Vorstellungen. Manche wollen noch nicht mal Steine.« Jetzt blickte er aufrichtig betrübt.
»Ich habe noch kein Telefon. Ich warte darauf, dass es angeschlossen wird. C&P hat angeblich einen schrecklichen Auftragsüberhang.«
Er legte seine Lupe beiseite und gab Maddie den Ring zurück. Sie hasste es, ihn anstecken zu müssen. Das würde sich wie eine Niederlage anfühlen, genauso, als würde sie zurück nach Pikesville ziehen. Die junge Frau, Judith, begriff sofort, was Maddie bedrückte. Sie zog einen Umschlag hervor und sagte: »Zur sicheren Aufbewahrung. Ich würde Ihnen ja eine Schachtel geben, aber den darauf mit Sicherheit folgenden Vortrag meines Bruders, wie teuer heutzutage alles ist, würde ich nicht aushalten.«
»Ihr Bruder? Das erklärt einiges.«
»Sie haben ja keine Ahnung.«
Die junge Frau war eher adrett als hübsch. Aber sie drückte sich witzig aus, und ihre Kleidung war auf eine Art abgestimmt, die nur das Resultat von Stunden vor dem Kleiderschrank sein konnte, von Anprobieren, Kombinieren, Bügeln und Flicken, Bürsten und Polieren. Maddie wusste das, weil Maddie selbst eine solche Frau gewesen war. Der Stil dieser jungen Frau war schon fast zu sehr aufeinander abgestimmt, was sie ein wenig alt machte. Doch ihre Freundlichkeit war überwältigend, wie es Freundlichkeit manchmal ist, und es kostete Maddie enorme Selbstbeherrschung, nicht in Tränen auszubrechen.
Sie schaffte es bis hinters Lenkrad ihres Wagens, bevor sie anfing zu schluchzen.
Sie hatte fest mit dem Geld gerechnet. Sie hatte sich ausgemalt, ein neues Bett zu kaufen, ein schickes, modernes. Ein Telefon an der Küchenwand, vielleicht noch einen Anschluss im Schlafzimmer. Kein Telefon zu besitzen war doch schrecklich lästig.
Doch sie weinte nicht wegen der Dinge, die sie hätte haben können, sondern weil es ihr peinlich war, bei ihrer Sehnsucht danach ertappt worden zu sein. Es war schon lange her, seit Maddie zugelassen hatte, dass jemand mitbekam, wie sie wagte, sich etwas zu wünschen. Sie wusste, wie gefährlich es war, wenn die eigenen Sehnsüchte vor anderen aufblitzten, wenn auch nur für einen Moment.
Es klopfte am Fenster; das Gesicht des drolligen Mädchens – ihr Bruder hatte sie Judith genannt – füllte den Rahmen aus. Maddie tastete nach ihrer Sonnenbrille und kurbelte das Fenster herunter.
»Ganz schön grell heute«, bot Judith höflich als Rechtfertigung an.
»Stimmt. Ich glaube nicht, dass es Ende der Woche schneien wird – wenn wir den Wetterfröschen Glauben schenken dürfen.«
»Ein dickes Wenn. Hören Sie, wir kennen uns zwar nicht, aber ich weiß, wer Sie sind. Natürlich.«
Natürlich? Warum natürlich? Eine verwirrte Sekunde dachte Maddie, sie wäre die Frau, die sie beinahe geworden wäre, eine in einen Skandal verwickelte Siebzehnjährige. Aber, nein, dieses Schicksal hatte sie vermieden. Das Problem waren all die anderen Schicksale, die sie auch vermieden hatte, die Lügen, die sie sich eingeredet hatte und die sie inzwischen glaubte. Wenn Judith sagte, sie wüsste, wer Maddie sei, war es wahrscheinlich wegen des Klatsches im Club, dieser scheußlichen neuen Clique um Bambi Brewer, mit ihren Allüren, ihren Salem-Zigaretten und ihren Gefolgsleuten. Verglichen mit diesen Leuten waren die Morgensterns alter Geldadel.
»Benötigen Sie noch etwas von mir?«
Als würde irgendwer einen Rat von einer Frau mittleren Alters benötigen, die gerade versuchte, ihren Verlobungsring zu verkaufen. Die Welt hatte sich so verändert. Diese junge Frau, die sich da neben Maddies Wagen duckte, konnte unmöglich dieselben Probleme haben, wie Maddie sie vor zwanzig Jahren gehabt hatte. Heutzutage konnten Frauen sorgenfreien Sex haben, wenn sie täglich eine Pille nahmen. Wenn sie den Mann gefunden hatten, den sie heiraten wollten, taten die meisten wahrscheinlich immer noch so, als wären sie Jungfrauen, das allerdings mindestens so sehr für die Mütter wie für die Ehemänner.
»Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse, an einem Treffen im Stonewall Democratic Club teilzunehmen. In diesem Jahr gibt es bei der Gouverneurswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und es ist eine gute Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Mein Bruder – nicht Jack, Donald, Jack ist ein bisschen schräg, aber Donald ist süß –, er ist politisch sehr aktiv.«
»Ist das jetzt ein Verkupplungsversuch?«
Diese Frage schien Judith zu amüsieren. »Nein, nein, Donald ist nicht – zu haben, soweit ich weiß. Er ist Junggeselle und sehr zufrieden damit. Mit ›Leute kennenlernen‹ meinte ich genau das – Leute kennenlernen. Manche sind Männer. Manche sind Single. Für mich ist es eine Möglichkeit, ohne viele Fragen das Haus meiner Eltern zu verlassen. Und wenn ich zusammen mit einer netten Lady aus Northwest Baltimore hingehe, machen sie sich vielleicht nicht ganz so viele Gedanken darüber, wann ich wieder nach Hause komme.«
Maddie riskierte ein ängstliches Lächeln. Freundlichkeit konnte so viel schmerzvoller sein als Grausamkeit. Sie kramte in ihrer Handtasche nach einem Stück Papier, schrieb dann die Telefonnummer ihrer Mutter auf die Rückseite eines Kassenzettels von Rexall, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass nichts Peinliches draufstand, Hygieneartikel zum Beispiel.
Dann fuhr sie nach Hause, obwohl es ihr schwerfiel, die Wohnung an der Gist Avenue als ihr Zuhause anzusehen. Kein Seth, so wenig Möbel, und die Nachbarn schnitten sie, als wäre sie die Unerwünschte in dieser Wohngegend von Dienstmädchen und Wäscherinnen, Milchmännern und Straßenbahnschaffnern. In der Wohnung angekommen, war ihr merkwürdig warm; der Vermieter, normalerweise ziemlich geizig, was die Heizung betraf, hatte die Temperatur zu hochgestellt. Sie öffnete die Schiebetür ihres Schlafzimmers, die auf eine kleine Terrasse führte. Dann nahm sie, wie sie sich einredete einem Impuls folgend, den Verlobungsring und stopfte ihn tief in die Erde eines Usambaraveilchens, das auf einem klapprigen Tischchen neben der Terrassentür stand. Sie zog die Schiebetür so weit zu, dass nur noch ein leichter Hauch Winterluft durch den Schlitz hereinkriechen konnte. Systematisch schuf sie den Anschein von Chaos, indem sie in der Küche und im Schlafzimmer Schubladen aufzog und Kleidungsstücke auf den Boden warf.
Anschließend holte sie tief Luft, rannte auf die Straße und schrie um Hilfe. Von nicht weit entfernt kam ein farbiger Streifenpolizist auf sie zugelaufen.
»Ich bin ausgeraubt worden«, sagte sie. Wegen ihrer Kurzatmigkeit war es leicht, völlig verängstigt zu klingen.
»Hier, auf der Straße?«, fragte er und sah auf ihre Handtasche.
»Meine Wohnung«, sagte sie. »Schmuck – das meiste war nur Modeschmuck, aber ich hatte einen Diamantring, und der ist weg.«
Ferdie Platt, so hieß er – »Kurz für Ferdinand? Wie der Stier?«, fragte sie, erhielt jedoch keine Antwort –, begleitete sie zurück in ihre Wohnung. Sein Blick fiel auf die nicht ganz geschlossene Terrassentür und die Unordnung in der Wohnung. Glitten seine scharfen Augen auch über das Usambaraveilchen, analysierten es? Plötzlich meinte Maddie, man könne sehen, wo ihre Fingerspitzen Spuren in der Blumenerde hinterlassen hatten. Sie kontrollierte verstohlen ihre Hände auf Schmutz unter den Fingernägeln. Er war einer dieser Männer, die stets wie aus dem Ei gepellt wirken und immer nach Seife duften. Kein Aftershave oder Cologne, einfach nur Seife. Er war nicht besonders groß, hatte jedoch breite Schultern und bewegte sich wie ein Sportler. Er war vielleicht zehn Jahre jünger als sie und zu jung, um sich bereits Gedanken über ausreichend Bewegung machen zu müssen.
»Wir sollten das Einbruchdezernat anrufen«, sagte er.
»Ich habe kein Telefon. Das ist einer der Gründe, warum ich auf die Straße gerannt bin und nach Hilfe gerufen habe. Aber außerdem – ich hatte Angst, dass der Einbrecher noch hier sein könnte.«
Ihre Angst war fast echt. Sie fing an, selbst zu glauben, dass bei ihr eingebrochen worden war, dass ein Fremder all das getan hatte. Sie hätte eine sehr gute Schauspielerin sein können, wenn sie diesen Weg nur eingeschlagen hätte.
Streifenpolizist Platt antwortete: »Und ich hab kein Funkgerät, weil – nun, ich habe keins. Aber ich habe einen Schlüssel für die Rufsäule, die sich in der Nähe eines Drugstores befindet. Die werde ich benutzen, und dann warten wir dort. Wir wollen vermeiden, hier irgendwelche Spuren zu beseitigen.«
Nachdem er die Meldung durchgegeben hatte, gab er ihr im Drugstore eine Limonade aus. Maddie saß am Tresen, nippte daran und wünschte sich, es wäre ein Cocktail. Außerdem wünschte sie sich, er würde sich setzen, statt mit verschränkten Armen neben ihr zu stehen und sie wie ein Wachposten zu beobachten.
»Ich sehe Sie hier nicht«, sagte er.
»Ich wohne erst seit ein paar Wochen hier.«
»So hab ich das nicht gemeint. Ich meinte – das hier ist nicht die richtige Gegend für Sie. Sie sollten hier nicht wohnen.«
»Weil ich weiß bin?« Sie fühlte sich frech. Sie fühlte Dinge, die sie seit Jahren nicht mehr gefühlt hatte, falls überhaupt.
»Nicht unbedingt. Sie brauchen einen Ort, an dem Sie nicht so auffallen. Einen Ort, an dem Sie Ihre Privatsphäre haben. Vielleicht mehr im Zentrum, verstehen Sie?«
»Ich habe einen Mietvertrag unterschrieben. Eine Kaution hinterlegt.«
»Mietverträge kann man kündigen. Aus wichtigem Grund.«