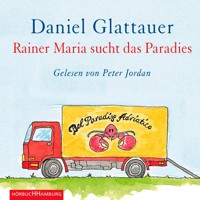Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eduard Brünhofer, ehemals gefeierter Autor von Liebesromanen, sitzt im Zug von Wien nach München. Nicht unbedingt in der Absicht, sich mit der Frau frühen mittleren Alters im Abteil zu unterhalten. Schon gar nicht in der Absicht, mit ihr über seine Bücher zu sinnieren. Erst recht nicht in der Absicht, über seine Ehejahre mit Gina zu reflektieren. Aber Therapeutin Catrin Meyr, die Langzeitbeziehungen absurd findet, ist unerbittlich. Sie will mit ihm über die Liebe reden. Dabei gerät der Schriftsteller gehörig in Zugzwang. »Was befähigt einen Autor, über die Liebe zu schreiben?«, fragt sie. »Ihre Frage ist klüger als jede Antwort darauf«, erwidere ich. »Danke. Probieren Sie es trotzdem.« »Wir haben so viel Spaß wie 2006 bei Daniel Glattauers Riesenerfolg ›Gut gegen Nordwind‹.« Elke Heidenreich, BUNTE »Einer der zauberhaftesten und klügsten Liebesdialoge der Gegenwartsliteratur« DER SPIEGEL über ›Gut gegen Nordwind‹
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Und Ihnen ist die Liebe ein Anliegen.« – »Wem nicht?«
Eduard Brünhofer ist mit seiner Frau Gina seit einer halben Ewigkeit glücklich verheiratet. Als Autor von Liebesromanen hat er sich einen Namen gemacht, aber mittlerweile die Lust verloren, von seiner Liebe etwas preiszugeben. Nun fährt er im Zug von Wien nach München, wo ihm diesbezüglich ein unangenehmer Termin bevorsteht.
Schräg gegenüber im Zugabteil sitzt eine Frau frühen mittleren Alters. Erst fürchtet Eduard Brünhofer, dass er sich mit ihr unterhalten muss. Bald lässt es sich nicht mehr vermeiden. Erst hofft er, dass sie bald aussteigt. Dann erfährt er, dass sie ebenfalls nach München fährt. Catrin Meyr heißt seine Zufallsbekannte. Sie tendiert zum vertraulichen Gespräch, stellt ungeniert die indiskretesten Fragen, lässt kein gutes Haar an Langzeitbeziehungen, möchte aber alles darüber erfahren.
Kurzum: Sie will über die Liebe reden. Und bringt dabei Eduard Brünhofer in ziemliche Bedrängnis.
»Glattauers Dialogtechnik ist frappierend, raffiniert. Das ist gekonnte Prosa auf Höhe der Zeit.«
TAGES-ANZEIGER
© Heribert Corn
Daniel Glattauer, geboren 1960 in Wien, war zwanzig Jahre Journalist beim Standard. Mit ›Gut gegen Nordwind‹ (2006) gelang ihm der schriftstellerische Durchbruch. Es folgten weitere erfolgreiche Romane. Seine Bücher wurden in mehr als vierzig Sprachen übersetzt und verkauften sich weltweit millionenfach. Außerdem verfasste Daniel Glattauer zahlreiche Theaterstücke, die zu den meistgespielten im deutschsprachigen Raum gehören. Mit seinem Roman ›Die spürst du nicht‹ (2023) stand er zuletzt wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
Daniel Glattauer
In einem Zug
Roman
E-Book 2025
© 2025 DuMont Buchverlag GmbH&Co.KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von §44bUrhG behalten wir uns explizit vor.
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © T.S.Harris. All rights reserved 2024/Bridgeman Images
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN
Wien-Hütteldorf
Schräg gegenüber sitzt eine Frau mittleren Alters. Eher frühen mittleren Alters. Mehr kann ich vorerst nicht über sie sagen. Ich bin keiner, der schräg gegenübersitzende Frauen im Zug taxiert, schon gar nicht mittleren, geschweige denn frühen mittleren Alters.
Kinder ja, die kann man stundenlang anglotzen, ob im Zug oder anderswo, die merken das gar nicht, und merken sie es, dann stört es sie nicht, sie sind es gewohnt. Erwachsene späten mittleren Alters, wie ich, blicken beim Beobachten von Kindern immer gern und oft verklärt in ihre eigene Kindheit zurück oder in die Kindheit ihrer Kinder, wenn sie welche haben. Und wenn es Kindeskinder gibt, versuchen sie, sich in ihnen zu erkennen, überhaupt, wenn sie gerade sehr stolz auf sie sind.
Oder sie sind von der anderen Sorte, zählen zu den Erwachsenen mit den bösen Blicken, gramgebeutelt bei jedem günstigen Anlass. Als solche prüfen und missbilligen sie jede Art von neuer, in Mode gekommener, verkommener Kindheit. Oft schütteln sie den Kopf und suchen Gleichgesinnte in ihrer Umgebung, die ebenso den Kopf schütteln und genauso denken: Was soll aus diesen Kindern werden? So etwas hätte es früher nie gegeben. Früher hätte man … Aber das darf man ja heute alles gar nicht mehr laut sagen.
Egal. Jedenfalls schauen Erwachsene, ob solche oder solche, jederzeit ungeniert hin, wo Kinder im Spiel sind.
Auch die sehr alten Leute lassen sich während einer Bahnfahrt ungehemmt begutachten. Die meisten von ihnen mögen und schätzen das, oft fühlen sie sich endlich wieder wahrgenommen. Man sollte ihnen aber schon gelegentlich aufmunternd zunicken. So quasi: Bravo, gut gemacht, wirklich alt geworden und noch immer wacker, wenn auch wackelig im Leben beziehungsweise hier im Zug.
Vorsicht aber. Wenn man bei sehr alten Mitmenschen zu lange hinschaut, besteht die Gefahr, dass Worte eintrudeln. Zuerst trudeln sie ein, dann prasseln sie auf einen ein, dann muss man sie abwehren. Und plötzlich ist man heillos in ein Gespräch verwickelt, aus dem man nicht mehr rauskommt.
Denn mit dem Alter potenziert sich die Mitteilungsbedürftigkeit. Da sollte man schon im Hinterkopf haben, wohin die Reise geht. In meinem Fall nach München. Wir befinden uns aber erst irgendwo zwischen Wien-Hütteldorf und Sankt Pölten. Das wären dann, würde es blöd laufen, gute vier Stunden Deckung der Mitteilungsbedürftigkeit eines sehr alten Gegenübers. Also bei so einer Ausgangslage wäre es ratsam, besser erst gar nicht hinzuschauen.
Egal. Schräg gegenüber sitzt eine Frau frühen mittleren Alters. Schräg gegenüber deshalb, weil sie einen Fensterplatz im offenen Viererabteil eingenommen und gleich den Mund verzogen hat, als ich dazugekommen bin und sich die Möglichkeit andeutete, ich könnte den Fensterplatz vis-à-vis beziehen, in Tuchfühlung zu ihr, Auge in Auge, Kniescheibe an Kniescheibe.
Kurzer Einschub: Ich hasse es, dazugesetzt zu werden. Und ich hasse es, wenn man mir wen dazusetzt. Zum Beispiel im Kaffeehaus.
»Entschuldigung, ist bei Ihnen noch ein Platz frei?«
»Ja, es sind sogar zwei Plätze frei, denn ich gehe«, würde ich darauf gern antworten.
Aber ich mache es eleganter. Ich antworte: »Ja natürlich, gerne.«
Zum Kellner: »Die Rechnung bitte.«
Einmal war ich mutig und antwortete: »Nein, leider nicht frei, es kommt noch wer.«
Der Geschasste hat dann gleich am Nebentisch Platz gefunden und mit mir geduldig darauf gewartet, dass meine angekündigte Begleitung endlich eintrifft. Erst hat er richtig mitgefiebert, in der Folge konnte er sich nicht entscheiden, ob er in mir einen Lügner oder einen Loser sehen soll.
Ich bemühte mich redlich um eine glaubwürdige Darstellung der Loser-Variante und schaute immer wieder verzweifelt auf Armbanduhr und iPhone. Seine auf mich gerichteten Blicke begannen die tiefe Melancholie einer Mitleiderregung auszustrahlen. Da blieb mir nur noch aufzustehen und zu gehen.
»Sind’s versetzt worden, gell?«, rief er mir nach.
Zurück zum Zug Wien–München: Ich konnte der Frau frühen mittleren Alters die Angst vor der Enge nachfühlen und setzte mich freiwillig auf den unattraktiveren Gangplatz schräg gegenüber von ihr. Ich machte es so schnell und entschlossen, dass sie annehmen konnte, das wäre mein gesuchter, gefundener, mich glücklich machender reservierter Platz. Sie sollte nicht das Gefühl haben, mir meinen Fensterplatz durch ihre Anwesenheit miesgemacht zu haben. Ich will niemanden beschämen. Ich will niemandem zu nahe treten. Und treten will ich schon gar nicht. So können wir wenigstens beide unsere Beine ausstrecken. Alles ist gut.
Was mir bald aus dem halb toten Winkel meines linken Auges auffällt: Die Frau macht das Gleiche wie ich – NICHT. Und zwar drei Dinge gleichzeitig. Sie liest nicht, sie hört nicht, sie schläft nicht. Kein Handy, kein Laptop, keine Ohrenstöpsel, kein Buch, kein Frauenmagazin, kein Männermagazin, kein Fachmagazin, kein Unterfachmagazin, gar nichts. Und ihre Augen sind offen und wach. (Okay, ich habe einmal kurz schräg hinübergeschaut. Sie hat es nicht bemerkt. Oder so getan, als hätte sie es nicht bemerkt.)
Menschen, die einfach einmal nichts tun, fallen sofort auf. Denn wir leben in einer Zeit, wo man nach zehn Sekunden Nichtstun, also ohne multimedial vollstreckte Ablenkung, normalerweise in ein Loch fällt. Überhaupt im Zug, da fällt man in ein Loch und atmet Zugluft, das ist an sich eine ernst zu nehmende Vorstufe zur Depression.
Faktum: Die Frau und ich tun schräg gegenüber voneinander seit gut fünfzehn Minuten tatsächlich nichts. Das ist revolutionär. Wir demütigen damit den gesamten Streaming-Markt mit seinen soeben frisch für uns ins Netz gegangenen Milliarden neuen Bildern, Texten, Postings, Videos und Podcasts.
Spontan mutmaße ich, dass sie gerade der gleichen im Aussterben begriffenen Beschäftigung nachgeht wie ich: Denken. Vielleicht sogar Nachdenken. Aber dann bemerke ich etwas, ja, ich erwische sie förmlich dabei, als mein insgesamt zweiter Sekundenblick über sie hinwegstreicht: Sie tut fast nichts, aber sie tut doch etwas. Sie schaut mich an.
Frauen frühen mittleren Alters, die mich anschauen, machen das, da gebe ich mich keinen Illusionen hin, aus dem einen bestimmten Grund, der einem noch immer als erster einfällt, sicher nicht. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass ich, seit ich an Frauen denken kann, noch nie von einer fremden Frau deshalb angeschaut wurde, weil sie praktisch nicht anders konnte, als optisch an mir haften zu bleiben, weil sie dachte: Wow, Wahnsinn, ich sehe wohl nicht recht!
Man kennt solche, ich sage einmal fressenden, Frauenblicke ausreichend aus der Filmwelt. Aber nicht nur. Es gibt Männer im realen Leben, denen passieren diese Blicke andauernd. Ein paar finden sich sogar in meinem engeren Bekanntenkreis, oder besser gesagt betrifft es die mittlerweile volljährigen Söhne von ihnen.
Mir ist so ein Blick jedenfalls noch nie passiert, und die Chance nimmt seit etwa zwanzig Jahren täglich ab. Frauenblicke, die an mir hängen bleiben, haben einen anderen Charakter. In der Sprache der Weinverkoster würde man mir die Begriffe »schal« und »abgestanden« zuordnen, wenn auch »nicht unharmonisch«. Aber es fehlt das Erfrischende, das Prickelnde. Da gab es schon bessere Jahrgänge. Solche Blicke kriege ich.
Darüber hinaus gibt es zwei Arten von Frauenblicken, mit denen ich mich seit Längerem konfrontiert sehe. Die eine Art sagt mir: »Du bist genau der Richtige.«
Das sind Frauen, die mir etwas andrehen wollen, ein Abonnement, ein Gewinnspiel, eine Rose für fünf Euro, einen Fragebogen, damit man endlich meine noch fehlenden Daten hat.
Und wollen sie mir nichts andrehen, dann wollen sie mir etwas abverlangen. Eine Unterschrift zum Schutz bereits so gut wie ausgestorbener Tiere. Die Zustimmung zur Rettung meiner Seele durch die religiöse Hintertür. Eine kleine Spende für etwas Wohltätiges, oft in eigener Sache. Solche Dinge. Das ist die eine Art von Frauenblicken.
Die andere Art ist spezifischer. Da geht es tatsächlich um mich als Person. Da werde ich ins Visier genommen, da stehe ich auf dem Prüfstand. Das sind konzentrierte, fokussierte, studierte Blicke. Dann wird es rasch verbal, und wir befinden uns mitten in der Millionenshow, bei der Fünfhundert-Euro-Frage.
So ein Blick trifft mich gerade. Deshalb weiß ich genau, was von schräg gegenüber im Zugabteil sogleich kommen wird. Ich bin vorbereitet, gelassen, ja, ich freue mich sogar ein bisschen darauf, ohne an die Konsequenzen zu denken.
»Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen?«, fragt die Frau.
Es folgt die kurze Phase, wo der Frauenblick staunende Züge, ja sogar dezente Anflüge von Faszination annimmt. Manchmal antworte ich sofort: »Ja, ich bin es.«
Damit erspare ich meinem Gegenüber die knifflige Ausformulierung und etwaiges Herumstottern. Diesmal koste ich es aus. Denn jetzt, wo ich sie ansehen kann, ja wo es geradezu ein Frevel wäre wegzuschauen, sehe ich sofort: Die Frau ist selbstbewusst, die schafft das auf Anhieb, die bringt das mit wenigen Worten rüber. Entweder kommt: »Sind Sie der Autor?«
Oder sie geht den direkten Weg und fragt: »Sind Sie Eduard Brünhofer?«
Oder, resoluter noch: »Sie sind Eduard Brünhofer, stimmt’s?«
Oder, gleich auch den Zauber der Exklusivität dazugepackt: »Sind Sie der Eduard Brünhofer?«
Spinnen wir die Szene weiter. Ich werde antworten: Ja, das bin ich. Ich werde ihr zublinzeln, nicken, schüchtern schmunzeln, also nicht wirklich schüchtern, nur damit sie weiß, dass ich mir nichts darauf einbilde, Eduard Brünhofer zu sein. So quasi: Einer muss ja Eduard Brünhofer sein, der Eduard Brünhofer. In diesem Fall ich.
Ich werde aber ein bisschen überrascht tun, als wäre sie die Erste, die das Geheimnis Eduard Brünhofer gelüftet hat. Das freut sie sicher. Ich drehe es damit praktisch um: Das Besondere ist nicht, dass ich Eduard Brünhofer bin. Das Besondere ist, dass sie erkannt hat, dass ich Eduard Brünhofer bin. Ihre Leistung, ich bin hier nur Statist.
Ja, und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie es weitergeht. Ihre Begeisterung über die Begegnung könnte sich als bahnbrechend erweisen, und sie sagt: »Sie sind es tatsächlich! Ich habe alle Ihre Bücher gelesen.«
Nachsatz: »Ich bin Ihr größter Fan.«
Oder wenigstens: »Ich bin ein großer Fan.«
Das passiert gar nicht so selten, auch jetzt noch. Okay, es ist schon einmal öfter passiert.
Na ja, und dann gibt es eben noch diverse Abstufungen. Zum Beispiel: »Einige Bücher von Ihnen finde ich ausgezeichnet.«
Ausgezeichnet. Sehr gut. Gut. Recht gut. Ganz gut. Gar nicht so schlecht. (Niemals würde ich nachfragen, welche.) Oder, wertneutral: »Ich habe schon einiges von Ihnen gelesen.«
Einiges. Manches. Weniges. Oder: »Ich habe erst kürzlich ein Buch von Ihnen gelesen.«
(Niemals würde ich nachfragen, welches, der Titel fällt ihr garantiert nicht ein.) Oder, schon weniger schmeichelhaft: »Ich habe erst kürzlich ein Buch von Ihnen in der Hand gehabt.«
Ehe es ihr aus den Fingern gerutscht ist. Oder, Worst Case: »Ich habe immer schon vorgehabt, etwas von Ihnen zu lesen. Welches Buch würden Sie mir empfehlen?«
Das würde dann in Knochenarbeit ausarten. Nein, ich würde möglichst freundlich erwidern: »Da fragen Sie am besten den Buchhändler oder die Buchhändlerin Ihres Vertrauens.«
Schreiten wir zum konkreten Ereignis. Die Frau frühen mittleren Alters im Zug, die ich jetzt, wo ich ihren Blick erwidere, natürlich schon näher beschreiben könnte, ich tue es aber nicht, denn um Äußerlichkeiten geht es hier nicht, diese Frau fragt: »Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen?«
Sie fragt es in einer Weise und mit einer Mimik und mit einem Glanz in den Augen, die mich vermuten lassen, dass sie schon einiges, wenn nicht alles, von mir gelesen hat und dass es ihr zumindest gut, wenn nicht sogar sehr gut gefallen hat.
Ich bin recht entspannt und antworte: »Ja, gerne.«
Jetzt ihre Frage: »Haben Sie früher in der Hegelgasse unterrichtet?«
Habe ich früher in der Hegelgasse unterrichtet? Den Schock muss ich erst einmal verdauen. Habe ich früher in der Hegelgasse unterrichtet? Habe ich nicht. Ich habe nie unterrichtet. Auch nicht in der Hegelgasse. Und »früher« schon gar nicht. »Früher« stört mich am meisten. Sie traut mir also nicht einmal zu, jetzt noch zu unterrichten, Hegelgasse hin oder her.
Ja genau, früher einmal, da hat er unterrichtet. Jetzt ist er im verdienten Ruhestand. Da fällt ihm natürlich die Decke auf den Kopf. Da setzt er sich in einen Zug und fährt nach München.
»Nein, habe ich nicht.« (Früher in der Hegelgasse unterrichtet.)
»Oh, Verzeihung«, sagt die Frau. »Ich hätte mir sicher sein können.«
»Tut mir leid. Da müssen Sie mich verwechselt haben.«
»Ja, Verzeihung.«
Sie dreht sich weg. Sie schüttelt den Kopf. Sie geniert sich. Ich bin der Grund für ihre Schande. Ich kann das jetzt nicht so stehen lassen.
»Wer dachten Sie, dass ich bin?«, frage ich.
»Mein Englischlehrer. Damals.«
»Englischlehrer?«
Ich tue so, als würde ich kurz nachdenken. Ich gebe ihr das Gefühl, dass es zumindest theoretisch möglich sein könnte. Dass es vielleicht gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt ist. Das schwächt ihren Irrtum ab und mildert meine Schmach.
Aber letztlich bleibe ich stur.
»Nein, ich war niemals Englischlehrer.«
»Verzeihung, aber die Ähnlichkeit ist verblüffend.«
Das ist inzwischen bei mir angekommen. Ich habe vor, das Gespräch abzustellen. Es befindet sich in einer Sackgasse. Ich suche nur noch die geeignete Parklücke, aber Sackgassen sind meistens verstopft.
»Wie lange haben Sie ihn nicht gesehen, Ihren Lehrer?«
»Schon eine ganze Weile. Seit ich bei ihm maturiert habe.«
(Für München: »Abitur gemacht habe«.) Ich könnte natürlich nachfragen, wann das war, um zu erfahren, wie alt beziehungsweise jung sie ist. Aber wozu?
»Der sieht heute wahrscheinlich ganz anders aus.«
Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Vielleicht will ich mich von ihm distanzieren. Ich wollte nie wie ein Englischlehrer aussehen, schon gar nicht zig Jahre danach.
»Er war mein Lieblingslehrer«, sagt sie.
Ich lächle. Das war entweder ein Trostpreis für ihren Irrtum oder ein echtes Kompliment. Sagen wir, das zweite. Ich erinnere sie an ihren Lieblingslehrer. Vielleicht nur zehn Jahre älter als sie. Ein Sunnyboy, Mädchenschwarm, bestimmt gebürtiger Brite, mit trockenem Humor, mit Sommersprossen auf den Schultern und rotem Haar.
Englischlehrer, O-Ton: I love beautiful Vienna, charming Hegelgasse, best school with the loveliest pupils of the world. Alle Herzen flogen ihm zu.
»Wie heißt er?«
Meine letzte Frage. Völlig irrelevant. Aber eine gute Gesprächsabrundung.
»Kowaricek. Magister Hubert Kowaricek«, sagt sie.
Oh, very british. Nein, der bin ich nicht.
Sankt Pölten
Sie ist nicht ausgestiegen. Es ist leider auch niemand zugestiegen, dem wir unseren jeweiligen Nachbarplatz anbieten hätten können und der für Ablenkung gesorgt hätte. Wir sitzen ungehindert und ungestört einander schräg gegenüber, sind weiterhin bekennend tatenlos, wie sie, oder täuschen Beschäftigungen vor, auf die wir keine Lust haben, wie ich. Zumindest habe ich keine Lust darauf, mich mit den Unterlagen für München zu beschäftigen. Ich habe generell keine Lust, mich mit Unterlagen zu beschäftigen. Ich hasse Unterlagen. Ich hasse Terminvorbereitungen. Und am meisten hasse ich Terminvorbereitungen mit Unterlagen.
Überdies irritiert mich mein Schräggegenüber. Es gibt nichts Unangenehmeres – doch, es gibt natürlich jede Menge Unangenehmeres, aber man kann es sich in solchen Situationen kaum vorstellen –, es gibt nichts Unangenehmeres als Stillschweigen nach einem auf Verwechslung aufgebauten und kartenhausmäßig in sich zusammengefallenen Gespräch mit einer ehemaligen Englischschülerin eines Magister Herbert oder Hubert Kowaricek, die man nicht kennt, wenn man keinen Sinn darin sieht, etwas daran zu ändern, ihr aber auch nicht entkommt und keine Ahnung hat, wann sie aussteigt. Ich schätze Linz oder Salzburg. Doch bis dahin wird es dauern.
Außerdem wundert es mich. Es wundert mich wirklich. Ich meine, ganz ehrlich, ich lege überhaupt keinen Wert darauf, dass einem mein Gesicht etwas sagt. Normalerweise genieße ich es, nicht erkannt zu werden. Die Chancen dafür stehen grundsätzlich nicht schlecht, ich habe meine mediale Präsenz stets auf ein Minimum beschränkt. Ich liebe zwar die Menschen, ich liebe sie wirklich, aber eher schriftlich und durchaus in ihrer Abwesenheit. Physisch sollen sie mich bitte weitgehend in Ruhe lassen. Ich meide daher die Öffentlichkeit, wo es nur geht.
Hier im Zug geht es nicht, und diese Frau sitzt nun einmal da, schräg gegenüber. Ich habe ihr in die Augen gesehen. Und glauben Sie mir, sie ist genau der Typ Frau, sie ist geradezu der Prototyp Frau, der meine Bücher liest, der zwangsläufig auch meine Porträtfotos in den Buchumschlägen kennt. Und es grenzt daher an ein Ding der Unmöglichkeit, dass ihr zu meinem Gesicht nichts Besseres, oder sagen wir nichts anderes, als ein ins Alter gekommener Englischlehrer einfällt.
Übrigens glaube ich, sie kann meine Gedanken lesen. Denn sie hat schon vorher ein paarmal Luft geholt, es dann aber noch bei wertneutralem Seufzen belassen. Nun ist es so weit. Sie dreht sich frontal zu mir und sagt: »Aber irgendwie kommen Sie mir trotzdem bekannt vor. Verzeihung, dass ich Sie noch einmal …«
»Nein, das tun Sie nicht«, erwidere ich. Ich hoffe, sie hat »stören« gemeint.
»Kann es sein, dass …?«
Ganz bestimmt, aber das darf sie jetzt selbst ausformulieren. Ihre zweite Chance sozusagen.
»Kann es sein, dass wir uns schon einmal begegnet sind?«
»Begegnet?« Ich bin überrascht, aber aufgeschlossen.
»Ja, ich denke die ganze Zeit nach. Beim Wiener Opernball vielleicht?«
»Bedauere, ich gehe auf keine Bälle.« Jetzt probiert sie es sicher gleich mit dem Münchner Oktoberfest. Beim Kotzen kommen die Leute oft näher zusammen als beim Walzertanzen.
»Oder beim Berlin-Marathon im vergangenen September?«, fragt sie.
»Den Berlin-Marathon lasse ich meistens aus. Ich bevorzuge Wrestling auf dem Wiener Heumarkt.« Ich schmunzle. Sie lächelt halb belustigt. Ich glaube schon, dass sie die Pointe verstanden hat.
Jedenfalls bewundere ich nicht nur ihren Spagat zwischen Abitur, Tanz und Marathon, sondern auch ihre immense Anstrengung, mich bereits kennengelernt zu haben. Jetzt nimmt sie einen neuerlichen, fast schon verzweifelten Anlauf.
»Entschuldigen Sie, es ist sonst nicht meine Art, aber ich kenne Sie und weiß einfach nicht, wo ich Ihr Gesicht hintun soll.«
Beenden wir das Drama.
»Vielleicht in eine Buchhandlung.«
»Sind Sie Buchhändler?«
»Nein.«
»Sondern?«
»Ich schreibe Bücher.«
»Dann sind Sie …«
»Genau.«
»Schriftsteller?«
»Ja.«
»Und wie, äh … wenn ich fragen darf … ist Ihr …«
»Ich heiße Eduard Brünhofer.«
Die nachfolgende Pause haben wir uns verdient.
»SIE sind Eduard Brünhofer?« Ich werde ihren Blick jetzt nicht beschreiben. Zu schwierig, ich müsste ihn erst einmal selbst analysieren.
»Ja, der bin ich.«
»Da sitze ich ja neben einer Berühmtheit.«
Daneben nicht, schräg gegenüber, genau genommen.
Außerdem: »Berühmt bin ich nicht, höchstens bekannt.«
»Wahnsinn«, sagt sie. Ja richtig, das ist ihr Blick.
»Ich habe natürlich schon sehr viel von Ihnen … gehört.«
Gehört? Hörbücher? Ich bin verwundert, lasse es mir aber natürlich nicht anmerken. Wobei ich mit dem Nicht-anmerken-Lassen momentan ziemlich inflationär umgehe.
»Aber ich habe, das muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie etwas von Ihnen gelesen«, sagt sie.
Ich bin entsetzt, mehr über mich selbst. Eine derartige Fehleinschätzung hätte ich mir nicht zugetraut.
»Dafür muss man sich wirklich nicht genieren«, sage ich in angestrengter Demut und jenem Gefühlszustand, der nach dem Hochmut steil bergab geht.
»Ich lese nämlich fast nur Sachbücher, kaum … äh … Belletristik«, sagt sie.
»Das verstehe ich. Mir geht es genauso«, erwidere ich. Übrigens wahrheitsgemäß.
»Und wenn, dann lieber angloamerikanische und britische Literatur.«
Das hat bestimmt der Englischlehrer angerichtet.
»Wunderbar. Dann sind Sie ja ohnehin bestens versorgt«, sage ich.
Wir nicken uns gegenseitig zu, wie man es tut, wenn man vorhat, das Gespräch zu beenden, weil nun wirklich alles Notwendige gesagt zu sein scheint. Nein, sie nickt ein bisschen anders. Sie nickt so, als würde sie darauf warten, dass von mir noch etwas kommt. Und da will ich vorsichtig sein. Nicht dass sie nachträglich zu ihren Freunden sagt: Stellt euch vor, ich habe im Zug Eduard Brünhofer kennengelernt. Er wollte aber nur von seinen Büchern reden. Ich selbst war für ihn Luft. Er hätte mich wenigstens fragen können …
»Und Sie? Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf?«, frage ich.
»Ich?« Okay, das war es offenbar nicht, worauf sie gewartet hat. Sie winkt auch gleich ab.
»Ach, das ist jetzt nicht so … Das ist natürlich bei Weitem nicht so interessant …«
»Das glaube ich nicht.« Musste ich sagen. Wollte ich auch sagen.
»Ich arbeite als … einerseits als Physiotherapeutin.«
»Ah«, erwidere ich.
Das Wort geht mir durch Mark und Bein, und instinktiv spanne ich meinen Beckenboden an, um mich zu vergewissern, dass er noch da ist. Physiotherapeuten haben bisher keinen festen Platz in meinem Leben gefunden, obwohl sie via hausärztliche Überweisung schon seit Längerem vehement an meine Tür klopfen und in mein Bewusstsein drängen. Einige Male habe ich es mit ihnen probiert. Nach längstens drei »Einheiten«, wie man ihre Folterstunden nennt, konnte ich mich stets aus ihrer Umklammerung befreien und mich als vorzeitig geheilt entlassen. Ich vertrage ihre Übungen nicht, auch nicht die schroffe Art ihrer Vorgaben und den Befehlston, in dem sie sich anschicken, die Kontrolle über meinen Körper an sich zu reißen. »Bis zum nächsten Mal machen Sie mir täglich …« waren jeweils ihre letzten Worte.
»Ich bin aber auch Psychotherapeutin«, ergänzt sie. Vermutlich hat sie gleich durchschaut, wie schwer ich mich mit dem rein Körperlichen tue.
»Interessant, und was ist da Ihr Spezialgebiet?«, frage ich vertiefend.
»Der Mensch«, erwidert sie. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Jetzt lacht sie, und ich merke erst, auf welch taktisch hohem Niveau sich unser Bahngeplänkel befindet. Keiner von uns beiden will mehr oder noch weniger von sich verraten, als ihm der gute Ton der Höflichkeit vorschreibt.
Bei mir kommt erschwerend hinzu, dass ich langsam den Drang verspüre, Sie wissen schon. Der Kaffee in der Früh. Und wenn ich einmal langsam den Drang verspüre, kann ich an nichts anderes mehr denken, wodurch sich der Drang rapide beschleunigt. Besonders rasant wird der Drang immer dann, wenn ich gerade absolut keine Muße habe, ihm zu Ehren in die Hocke zu gehen, zum Beispiel um vier Uhr früh.
Derzeit bereitet mir die Formulierung einer fremden Therapeutin (schräg) gegenüber Kopfzerbrechen, mit der ich anzukündigen gedenke, des gewissen Dranges wegen gleich meinen Sitzplatz verlassen zu müssen. Zu meiner Frau, bei der ich mir kein Blatt vor den Mund nehmen muss, würde ich sagen: »Du, ich muss rasch aufs Häusl.« (Für München: »Örtchen«.)
Bei Freunden und Bekannten würde ich mir überhaupt jeden Kommentar sparen, ich stünde auf und ginge, und wenn ich gleich darauf entspannt zurückkäme, würde mich keiner fragen, wo ich war und warum ich mich nicht abgemeldet habe.
Aber wie unterbreche ich am geschicktesten die schleppende Höflichkeitskonversation mit einer Therapeutin, die mich zwar wie eine Verehrerin ansieht, doch noch nie ein Buch von mir gelesen hat? Sage ich: »Ich muss mich kurz entschuldigen?« Wofür? Was habe ich getan?
Oder sage ich: »Ich bin gleich wieder da.« Viel zu aufdringlich. Oder begnüge ich mich mit einem Halbsatz: »Ich muss nur schnell.« Oder: »Kurze Unterbrechung.« Oder: »Geht gleich weiter.« Oder: »Geht nachher nicht mehr weiter.« Oder: »Na dann.« Tschüss. Gute Fahrt. Schönes Leben. Keine Ahnung. Da richtet sie sich plötzlich auf und sagt: »Verzeihen Sie, ich muss mich kurz entschuldigen, ich komme gleich wieder.«
»Gute Idee, da werde ich mich gleich anschließen«, erwidere ich erleichtert. Sie lächelt irritiert. Ja, Reden ist insgesamt nicht meine Stärke, und wenn es dabei schnell auf schnell geht, treffe ich selten die passenden Worte. Deshalb bin ich langsamer Schreiber geworden.
»Und nachher muss ich Sie etwas fragen«, kündigt sie an. Ich nicke wertneutral.
Wir wählen entgegengesetzte Toilettenwege, sie geht Richtung München, ich zurück nach Wien.
Ich bin als Erster wieder auf meinem Platz und fürchte mich vor ihrer Frage. Denn ich rechne mit einer Frage aus dem Sortiment der »Grausamen Fünf« an einen Schriftsteller.
Erstens: Wie kommen Sie auf die Ideen für Ihre Bücher?
Zweitens: Wo schreiben Sie, wenn Sie schreiben, und warum dort?
Drittens: Schreiben Sie, wenn Ihnen was einfällt, oder haben Sie geregelte Schreibzeiten wie in einem Büro?
Viertens (besonders grausam): Sind Ihre Romane autobiografisch? Wie viel von Ihnen steckt in den Figuren?
Fünftens: Was lesen Sie selbst gerne, wer sind Ihre Lieblingsautoren? Diese Frage hasse ich am allermeisten. Erst vor wenigen Wochen wurde sie mir wieder einmal gestellt, und zwar im Rahmen einer Prostata-Vorsorgeuntersuchung vom soeben Gummihandschuh überstreifenden Arzt meines Vertrauens, der sich leider auch für Literatur interessiert. Artig zählte ich ein paar Namen und Titel auf, die mir gerade einfielen. Nach seinem kurzen Eingriff, Sie wissen schon, hätte ich mich gerne revanchiert und Folgendes gefordert: »So, lieber Herr Doktor, und jetzt verraten Sie mir Ihre drei persönlichen Lieblingsurologen.«
Zurück nach Wien–München. Die Therapeutin hat Platz genommen und rutscht sich in eine offensive Frageposition.
»Herr Brünhofer, was mich wahnsinnig interessieren würde: Wie wird man so ein erfolgreicher Schriftsteller wie Sie? Was macht Ihr Schreiben aus, worauf kommt es Ihnen an? Ich weiß, die Frage klingt ziemlich blöd, aber …« Wenigstens weiß sie es. Ich beschließe spontan, die Frage in meine Hitliste der Grausamkeiten gegenüber Autoren aufzunehmen.
»Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten«, lüge ich schablonenhaft, um Zeit zu gewinnen. Tatsächlich spiele ich bereits mit dem Gedanken, den Zug leider schon bei der nächsten Station verlassen zu müssen. (Amstetten. Es wäre das erste Mal in meinem Leben.) Ich könnte aussteigen und den nächsten Zug nach München nehmen. Noch besser: Ich könnte aussteigen und im hinteren Waggon wieder einsteigen. Aber was, wenn sie mich dabei erwischt? Außerdem: Womöglich steigt sie sowieso in Amstetten aus, das wäre gar nicht so unrealistisch. Vielleicht ist sie Amstettnerin, das würde ihre Frage erklären. Also nichts gegen Amstetten, das möchte ich an dieser Stelle betonen. Ich befinde mich nur leider gerade in einer beinahe ausweglosen Gesprächssituation.
Ich entscheide mich für »Augen zu und durch« und antworte trotzig: »Die Frage ist natürlich, was Sie unter erfolgreich verstehen.« Betonung auf »Sie«. Ich gebe ihr alle Zeit der Welt, aber sie will es mir nicht erklären. Sie schaut mir lieber in die Augen, dabei verschwimmen ihre Pupillen und ziehen meine mit ins Tiefe, das hat schon leichten Hypnosecharakter. Sie meint, ich soll einfach weiterreden. Vielleicht glaubt sie sogar, es tut mir gut. Sie ist ja hier die Therapeutin, ich bin der Klient.
Also gut: Ich finde, man kann vier Arten erfolgreicher Autoren unterscheiden. Die einen sind schon erfolgreich, indem sie schreiben. Das sind die glücklichsten. Die brauchen sonst nichts. Ihr erstes Ziel ist erreicht, wenn sie geschrieben haben. Und ihr nachfolgendes Ziel ist es weiterzuschreiben. Diese Menschen beneide ich. Ihre Texte genügen ihnen. Sie selbst genügen sich.
Die anderen drei schreibenden Gruppen streben nach gesellschaftlicher Anerkennung für ihr Tun. Einige schaffen es, literarische Glanzlichter zu setzen. Ihr Erfolg definiert sich über Würdigungen in den Medien, früher, als noch Zeitung gelesen wurde, im Feuilleton, neuerdings in den hochkarätigen Literaturblogs oder Podcasts der digitalen Kanalschächte. Außerdem stauben sie die renommierten Buchpreise ab, da ist auch immer ein bisschen Geld dabei, aber im Wesentlichen geht es ihnen um die Wertschätzung der literarischen Qualität ihrer Texte.
Andere definieren Erfolg über Bekanntheit und Prominenz. Ihre oft mithilfe von Ghostwritern verfassten Bücher sind für sie nur Randprodukte ihres Aufenthalts im Rampenlicht, fungieren als Nebelleuchten ihrer persönlichen Strahlkraft. Oft kommen sie aus buchfernen Branchen, sind Ärzte, Juristen, Skisportler, Dachdecker, ganz egal. Dann werfen sie zum Beispiel die Dachdecker-Bibel Schwindelfrei und trittsicher durchs Leben auf den Markt. Mit dem Buch in der Hand setzen sie sich in jede Talkshow, so lange, bis sie eine eigene Sendung bekommen. Am Höhepunkt ihrer Karriere werden sie von jedem Menschen auf der Straße erkannt. Danach wird es still um sie. Erst Jahre später sieht man sie wieder – bei den »Dancing Stars«.
»Und Sie gehören der letzten Gruppe an?«, unterbricht mich die mir nun schon einigermaßen vertraute Frau frühen mittleren Alters schräg gegenüber.
»Wieso?«, frage ich. Ich konnte mich nicht zwischen »Wieso glauben Sie das?« und »Wieso wissen Sie das?« entscheiden.
»Weil man sich das Beste immer für den Schluss aufhebt«, sagt sie.
»Es ist nicht das Beste«, wehre ich mich. Sie lächelt. Ich habe es hier mit einem Psycho-Profi zu tun, der auch etwas vom dramaturgischen Aufbau einer Erzählung versteht. Jetzt zwingt sie mich allerdings zu dramaturgisch unangemessener Bescheidenheit.
»Also worüber definieren Sie Ihren Erfolg?«, bohrt sie nach.
»Über mein Publikum. Über Menschen, die meine Bücher lesen. Über Menschen, denen ich mit meinen Büchern Freude machen kann.« So. Das darf ruhig sitzen. Sie soll es spüren. So ergeht es einer, die noch nie ein Buch von mir gelesen hat.
»Und für die tut man dann alles?«
»Was meinen Sie mit alles?«
»Na ja, Sie schreiben ja dann nicht für sich selbst, sondern Sie schreiben für die anderen. Also schreiben Sie nicht, was Sie selbst schreiben wollen. Sondern Sie schreiben, was andere gerne lesen. Weil sie Ihrem Publikum eine Freude machen wollen.«
»Das ist beinahe richtig. Aber nicht ganz.«
»Was ist daran nicht ganz richtig?«
»Ich schreibe, was ich schreiben will. Und das deckt sich zum Glück mit dem, was andere gerne lesen.« Kurze Verschnaufpause. Ich stehe unmittelbar vor dem argumentativen Durchbruch. »Ja genau. Ich habe das verdammte Glück, dass es genug Menschen gibt, die gerne lesen, was ich gerne schreibe. Und ich glaube, exakt das macht meinen Erfolg aus. Weil Sie mich nämlich gefragt haben, wie man ein erfolgreicher Schriftsteller wird.«
Und ich es ihr hiermit punktgenau dargelegt habe. Ich lehne mich zurück. Gut gemacht. Amstetten kann kommen. Ich steige nicht aus. Ich fahre weiter. Ich fahre nach München, ob ich will oder nicht. Ich ziehe das durch. Niemand hält mich auf. Niemand hält mich ab.
Amstetten
»Und Sie schreiben gerne über die Liebe?«, fragt sie mich.
Aber der Reihe nach: Wir hatten zwei Minuten Stationsaufenthalt am Bahnhof, das hat für Amstetten genügt. Kaum eine Tür hat gequietscht, kaum wer ist ausgestiegen, kaum wer ist zugestiegen. Von einem Schaffner fehlt jede Spur. Ein paar platzsuchende Gestalten sind an unserem Viererabteil vorbeigehuscht, ohne nennenswertes Interesse zu zeigen, einen der beiden freien Sitze zu ergattern.
Diese Plätze sind im Übrigen von einer schwarzen Frauenumhängetasche und meinem hässlichen, studentische Brotlosigkeit vortäuschenden Autorenrucksack gut abgesichert. Das ist die eine scharfe Diagonale in unserem Viereck. Die andere, jene unseres respektvoll-distanziert zusammengeschweißten gegenseitigen Schräggegenübers, steht sowieso unter Strom. Im Grunde ist unser Abteil hermetisch abgeriegelt und von der Außenwelt abgeschnitten. Kurzum: Keiner wagt es, uns nahe zu kommen, keiner will bei uns sitzen, und das ist gut so.