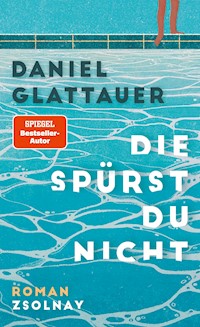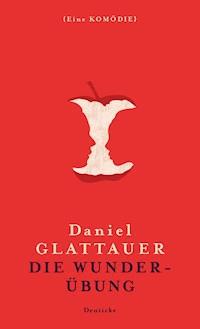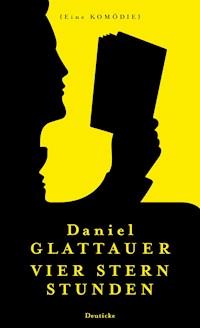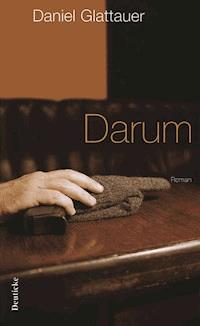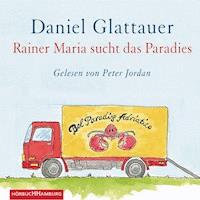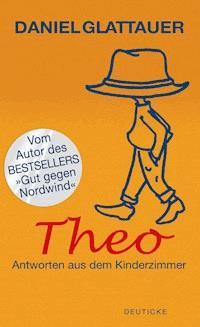Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Supermarkt lernt Judith, Mitte dreißig und Single, Hannes kennen. Kurz darauf taucht er in dem edlen kleinen Lampengeschäft auf, das Judith, unterstützt von ihrem Lehrmädchen Bianca, führt. Hannes, Architekt, ledig und in den besten Jahren, ist nicht nur der Traum aller Schwiegermütter - auch Judiths Freunde sind restlos begeistert. Am Anfang empfindet Judith die Liebe, die er ihr entgegenbringt, als Genuss. Doch schon bald fühlt sie sich durch seine intensive Zuwendung erdrückt und eingesperrt. All ihre Versuche, ihn wieder aus ihrem Leben zu kriegen, scheitern - er verfolgt sie sogar bis in ihre Träume ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Deuticke eBook
Daniel Glattauer
Ewig Dein
Roman
Deuticke
ISBN 978-3-552-06191-0
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2012
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Phase eins
1.
Als er in ihr Leben trat, verspürte Judith einen stechenden Schmerz, der gleich wieder nachließ. Er: »Verzeihung.« Sie: »Macht nichts.« Er: »Dieses Gedränge.« Sie: »Ja.« Judith überflog sein Gesicht, als wären es die täglichen Sportschlagzeilen. Sie wollte nur eine Ahnung davon haben, wie jemand aussah, der einem am Gründonnerstag in der überfüllten Käseabteilung die Ferse abhackte. Sie war wenig überrascht, er sah normal aus. Er war einer wie alle hier, nicht besser, nicht schlechter, nicht origineller. Warum musste die gesamte Bevölkerung zu Ostern Käse kaufen? Warum im gleichen Kaufhaus zur selben Stunde?
Bei der Kassa legte er, schon wieder er, neben ihr die Waren auf das Förderband. Sie registrierte ihn dank eines einschlägig riechenden rostbraunen Rauhlederjackenärmels. Sein Gesicht hatte sie längst vergessen, nein, sie hatte es sich gar nicht erst gemerkt, aber die geschickten, gezielten und dabei geschmeidigen Bewegungen seiner Hände gefielen ihr. Es wirkte ja auch noch im 21. Jahrhundert wie ein Wunder, wenn ein Mann um die vierzig im Supermarkt zu-, aus- und einpackte, als hätte er es vorher schon einmal getan.
Beim Ausgang war es beinahe kein Zufall mehr, dass er wieder dort stand, um ihr die Tür aufzuhalten und um mit seinem Langzeitpersonengedächtnis zu brillieren. Er: »Nochmals Verzeihung für den Tritt.« Sie: »Ach, längst vergessen.« Er: »Nein, nein, ich weiß, so was kann höllisch wehtun.« Sie: »So schlimm war es nicht.« Er: »Gut, gut.« Sie: »Ja.« Er: »Na dann.« Sie: »Ja.« Er: »Schöne Feiertage.« Sie: »Ihnen auch.« Sie liebte Gespräche dieser Art im Kaufhaus, das sollte jetzt aber für immer genügen.
Ihre vorerst letzten Gedanken an ihn galten seinen fünf bis sieben oder acht Bananen, der gelben Riesenstaude, die er vor ihren Augen eingepackt hatte. Wer fünf bis sieben oder acht Bananen kaufte, hatte bestimmt zwei bis drei oder vier hungrige Kinder daheim. Unter der Lederjacke trug er wahrscheinlich einen Pullunder mit großen Karos in Regenbogenfarben. Er war so ein richtiger Familienvater, dachte sie, einer, der für vier bis fünf oder sechs Personen Wäsche wusch und zum Trocknen aufhängte, die Socken vermutlich alle in einer Reihe, paarweise geschlichtet, und wehe, es brachte jemand seine Ordnung auf der Wäscheleine durcheinander.
Daheim klebte sie sich ein dickes Pflaster auf die rote Ferse. Zum Glück war die Achillessehne nicht gerissen. Sonst fühlte sich Judith ohnehin unverwundbar.
2.
Ostern verlief wie immer. Samstagvormittag: Besuch bei der Mama. Mama: »Wie geht es Vater?« Judith: »Ich weiß es nicht, ich bin am Nachmittag bei ihm.« Samstagnachmittag: Besuch beim Vater. Vater: »Wie geht es Mama?« Judith: »Gut, ich war am Vormittag bei ihr.« Sonntagmittag: Besuch bei Bruder Ali auf dem Land. Ali: »Wie geht es Mama und Vater?« Judith: »Gut, ich war gestern bei ihnen.« Ali: »Sie sind wieder zusammen?«
Am Ostermontag waren Freunde bei ihr zum Essen geladen. Eigentlich nur am Abend, aber bereits nach dem Aufstehen hatte sie darauf hingearbeitet. Sie waren zu sechst: zwei Paare, zwei Singles (einer davon ein ewiger, der andere − sie selbst). Zwischen den Gängen gab es niveauvolle Gespräche, hauptsächlich über vitaminschonende Garmethoden und neueste Entwicklungen in der Weinsteinbekämpfung. Die Gruppe war homogen, phasenweise sogar verschworen (gegen Krieg, Armut und Gänsestopfleber). Der frisch aufgehängte Jugendstilluster sorgte für warmes Licht und freundliche Gesichter. The Divine Comedy hatten rechtzeitig für den Anlass ihre aktuelle CD auf den Markt gebracht.
Ilse lächelte ihrem Roland sogar einmal zu, er massierte ihr zwei Sekunden die rechte Schulter – und das nach dreizehn Ehejahren und zwei Kindern in jenem Köcher, aus dem täglich Antileidenschaftspfeile verschossen werden. Das andere, jüngere Paar, Lara und Valentin, war noch in der Händchenhalteperiode. Hin und wieder umklammerte sie seine Finger mit beiden Händen, vielleicht um ihn fester zu halten, als es ihr auf Dauer gelingen würde. Gerd war natürlich wieder der Witzigste, ein großer Gesellschaftstiger, der mit der Aufgabe, spröde Menschen lockerer und mutiger im Wort zu machen, wuchs. Leider war er nicht schwul, sonst hätte Judith ihn gerne auch öfter alleine getroffen, um ihm persönlichere Dinge anzuvertrauen, als dies in einer Gruppe mit Pärchen möglich war.
Am Ende solcher Abende, wenn die Gäste abgezogen waren und nur noch Dunstwolken an sie erinnerten, testete Judith immer, wie es ihr ging, so im vertrauten Rahmen mit sich und Bergen von benütztem Geschirr. Oh doch, es war schon die deutlich höhere Lebensqualität, eine Stunde Küchendienst zu versehen, die Fenster aufzureißen und Frischluft ins Wohnzimmer zu lassen, tief durchzuatmen, noch schnell eine präventive Kopfschmerztablette einzuwerfen, dann endlich den geliebten Polster zu umarmen und ihn erst um acht Uhr morgens wieder freizugeben. Das war eindeutig besser, als in die Psyche eines vermutlich (ebenfalls) betrunkenen, chronisch schweigsamen, für private Sperrstunden nicht geschaffenen, aufräumungsarbeitsunwilligen »Partner« dringen zu müssen, um auszuloten, ob er sich Hoffnungen machte oder Befürchtungen hegte, es könnte sich noch Sex ergeben. Diesen Stress ersparte sich Judith. Nur in der Früh, da fehlte er manchmal, der Mann neben ihr unter der Decke. Aber es durfte halt nicht irgendeiner sein, nicht einmal ein gewisser, nur ein bestimmter. Und deshalb konnte es leider keiner sein, den sie bereits kannte.
3.
Judith ging gern in die Arbeit. Und wenn nicht, wie so gut wie immer nach Feiertagen, dann betrieb sie jeden nur erdenklichen Aufwand, es sich einzureden. Immerhin war sie ihre eigene Chefin, auch wenn sie sich mehrmals täglich eine andere, nachlässigere wünschte, zum Beispiel ihr Lehrmädchen Bianca, die nur einen Spiegel brauchte, um vollbeschäftigt zu sein. Judith führte ein kleines Unternehmen in der Goldschlagstraße im fünfzehnten Bezirk. Das klang zwar unternehmerischer, als es war, aber sie liebte ihr Lampengeschäft, mit keinem Lokal der Welt wollte sie es tauschen. Schon in der Kindheit waren dies die schönsten Räume auf Erden, voll glitzernder Sterne und funkelnder Kugeln, stets hell erleuchtet, immerzu festlich. In Opas glänzendem Freilichtmuseum ließ sich täglich Weihnachten feiern.
Mit fünfzehn fühlte sich Judith wie im goldgelben Käfig, beim Hausaufgabenmachen von Stehlampen überwacht, bis in die intimsten Tagträume von Wand- und Deckenlustern ausgeleuchtet. Ihrem Bruder Ali war es zu hell, er verweigerte sich dem Licht und zog sich in Dunkelkammern zurück. Mama kämpfte verbissen gegen den Konkurs und ihre eigene erdrückende unternehmerische Unlust. Vater zog bereits schummrigere Lokale vor. Die beiden hatten sich im guten Einvernehmen getrennt. »Gutes Einvernehmen« war der grausamste Ausdruck, den Judith kannte. Er hieß, Tränen auf lachend nach oben gekrümmten Lippen trocknen und versteinern zu lassen. Irgendwann wurden einem die Mundwinkel so schwer, dass sie absackten und für immer unten blieben, wie bei Mama.
Mit dreiunddreißig übernahm Judith das marode Lampengeschäft. In den vergangenen drei Jahren hat es wieder zu funkeln begonnen, nicht so schillernd wie zu Opas Glanzzeiten, aber Verkauf und Reparatur liefen gut genug, um Mama dafür zu entlohnen, dass sie daheim blieb. Das war das eindeutig beste Einvernehmen, in dem sich Judith bisher von irgendjemandem getrennt hatte.
Der Dienstag nach Ostern verging für sie bei außergewöhnlich ruhigem Geschäftsgang hauptsächlich im Hinterzimmer unter dem matten Licht der Bürolampe und war reine Pflichtübung, die ihr die Buchhaltung vorschrieb. Von Bianca hörte man zwischen acht und sechzehn Uhr nichts, wahrscheinlich schminkte sie sich gerade. Um zu beweisen, dass sie an diesem Tag jedenfalls anwesend war, schrie sie knapp vor der Sperrstunde plötzlich: »Frau Cheeeefin!« Judith: »Bitte! Nicht so laut! Kommen Sie her, wenn Sie mir was sagen wollen.« Bianca, jetzt neben ihr: »Da ist ein Mann für Sie.« Judith: »Für mich? Was will er?« Bianca: »Guten Tag sagen.« Judith: »Ah.«
Es war der Bananenmann. Judith erkannte ihn erst am Inhalt seiner Worte. Er: »Ich wollte Ihnen nur guten Tag sagen. Ich bin der, der Ihnen vor Ostern im ›Merkur‹ auf die Ferse gestiegen ist. Ich hab Sie in der Früh hier hineingehen gesehen.« Judith: »Und da haben Sie bis jetzt darauf gewartet, dass ich wieder herauskomme?« Sie kicherte unabsichtlich. Sie hatte das Gefühl, gerade ziemlich witzig gewesen zu sein. Auch der Bananenmann lachte, sehr schön sogar, mit zwei funkelnden, von hundert kleinen Fältchen umsäumten Augen und ungefähr sechzig strahlend weißen Zähnen. Er: »Ich hab hier nur ein paar Ecken weiter mein Büro. Da dachte ich …« Sie: »Sie sagen guten Tag. Das ist nett. Mich wundert, dass Sie mich erkannt haben.« Das hatte sie überhaupt nicht kokett, sondern völlig ernst gemeint. Er: »Das braucht Sie wirklich nicht zu wundern.« Jetzt sah er sie seltsam an, seltsam verklärt für einen Familienvater mit acht Bananen. Nein, das waren nicht die Momente, mit denen Judith etwas anzufangen wusste. Unter den Wangen wurde ihr heiß. Sie musste noch dringend einen Anruf erledigen, erkannte sie an den Zeigern ihrer Armbanduhr. Er: »Na dann.« Sie: »Ja.« Er: »Hat mich sehr gefreut.« Sie: »Ja.« Er: »Vielleicht sieht man sich wieder.« Sie: »Wenn Sie einmal eine Lampe brauchen.« Sie lachte, um die Situationstragik ihrer Bemerkung zu überlagern. Bianca kam dazu, diesmal zum günstigsten aller Zeitpunkte. »Darf ich, Frau Chefin?« Sie meinte, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen. Auch für den Bananenmann war das das Signal zum Aufbruch. Bei der Tür drehte er sich noch einmal um und winkte wie am Bahnhof, aber nicht wie zum Abschied, sondern wie einer, der jemanden abholte.
4.
Am Abend dachte Judith ein paar Mal flüchtig an ihn, nein, nicht flüchtig, aber an ihn. Wie hatte er gesagt? »Das braucht Sie nicht zu wundern.« Oder hatte er sogar gesagt: »Das braucht Sie wirklich nicht zu wundern«? Und hatte er dabei nicht »Sie« betont? Doch, er hat »Sie« betont. Er hat gesagt: »Das braucht SIE wirklich nicht zu wundern.« SIE im Sinne von: »So eine Frau wie Sie.« Nett, irgendwie, dachte Judith. Er hat vielleicht sogar gemeint: »Das braucht SIE, eine Frau, die so aussieht wie Sie, eine so schöne, interessante Frau«, hat er gemeint, »so eine wunderschöne Frau, so eine atemberaubend schöne, intelligent aussehende, kluge, coole Frau, ja so eine Frau wie SIE«, hat er gemeint, »so eine Frau braucht das wirklich nicht zu wundern«, dass er sie erkannt hat. Sehr nett, irgendwie, dachte Judith.
»So eine Frau wie Sie«, hat er nämlich gemeint, »so eine Frau, die sieht man einmal«, zum Beispiel wenn man ihr gerade in der Käseabteilung die Ferse zertrümmert hat, »die sieht man einmal und man kriegt sie nie wieder aus dem Sinn und schon gar nicht aus den Sinnen«, hat er gemeint. Eigentlich sehr, sehr nett, irgendwie, dachte Judith.
Sie wollte schon aufhören, daran zu denken, weil sie keine zwanzig mehr war, weil sie die Männer kannte und nicht mehr so leicht bereit war, in ihren Vorstellungen vom Plural abzuweichen, und weil sie bei Gott Wichtigeres zu tun hatte, weil sie gerade die Kaffeemaschine entkalken wollte, aber einmal dachte sie noch daran, nur ganz kurz, wie er das »Sie« betont hat, das »Sie« von »Das braucht SIE wirklich nicht zu wundern«. War es das »Sie« von »So eine Frau wie Sie«? Oder klang es nicht noch spezifischer und gewählter nach »Sie«, im Sinne von: »SIE. SIE. JA SIE! Einzig und alleine SIE.« Dann hat er wohl gemeint: »Jede Frau der Welt hätte das wundern dürfen, jede, nur nicht SIE, denn SIE, Sie sind nicht nur keine Frau wie alle anderen, nein, Sie sind eine Frau wie keine andere. Und SIE, SIE, JA SIE! Einzig und alleine SIE«, hat er gemeint, »braucht das wirklich nicht zu wundern«, dass er sie erkannt hat. Eigentlich sehr, sehr nett, ja sehr sogar, dachte Judith. Doch leider, daran war nicht zu rütteln: Es HAT sie tatsächlich gewundert, dass er sie erkannt hat. Und darum ging es. Und deshalb entkalkte sie jetzt die Kaffeemaschine.
Am nächsten Tag kam er ihr nur noch ein einziges Mal, zwangsläufig, in den Sinn. Bianca behauptete plötzlich: »Frau Chefin, ich hab was bemerkt.« Judith: »Echt? Da bin ich aber neugierig.« Bianca: »Der Mann steht volle auf Sie.« Judith, und das war hohe Schauspielkunst: »Welcher Mann?« Bianca: »Na, der große, der das Büro in der Nähe hat, der guten Tag gesagt hat, der hat Sie bitte volle arg angeschaut.« Bianca schaukelte mit ihrem Kopf und ließ ihre hübschen dunklen Pupillen ein paar Runden kreisen. Judith: »Geh, Blödsinn, das bilden Sie sich ein.« Bianca: »Das bilde ich mir bitte überhaupt nicht ein! Der ist volle verliebt in Sie, Chefin! Checken Sie das nicht?« Das war laut und unverschämt, aber ausgerechnet Bianca konnte sich bei ihr so etwas leisten, denn sie hatte keine Ahnung, dass sie es sich leisten konnte, sie tat es einfach. Judith schätzte ihre respektlose, reflexartige Aufrichtigkeit. Aber natürlich lag das Mädchen in diesem Fall vollkommen falsch. Der Mann stand nämlich überhaupt nicht auf sie, so ein Blödsinn, Lehrmädchenphantasien. Er kannte sie ja gar nicht, nur die Ferse, sonst nichts von ihr, absolut nichts.
5.
Am Sonntag feierten sie Gerds vierzigsten Geburtstag, im »Iris«, einem schummrig beleuchteten Lokal, das ihn zehn Jahre jünger wirken lassen sollte. Gerd war beliebt. Von den fünfzig geladenen Gästen kamen achtzig. Zwanzig von ihnen wollten nicht generell auf Sauerstoff verzichten und übersiedelten deshalb, bei aller Wertschätzung für Gerd, in die benachbarte Phoenix-Bar, die dank eines Live-Klavierspielers beinahe leer war. Judith war eine von ihnen.
Als überaus anhänglich erwies sich ein bedeutungslos gewordener Mann von erfreulich viel früher, Jakob hieß er, schade, dass dieser schöne Name nun ewig sein Gesicht tragen würde. Mit ihm war eigentlich längst alles besprochen (oder ausgeschwiegen). Nach drei Jahren zwischenmenschlicher Beziehung, und mehr als dazwischen war sie nie, hatte sich Judith gezwungen gesehen, selbige zu beenden. Der Grund: Jakob hatte eine hartnäckige Lebenskrise – namens Stefanie, die er bald danach heiratete.
Aber das lag schon sechs Jahre zurück, und deshalb war Jakob an jenem Samstagabend im »Phoenix« wieder objektiv genug, zu bemerken, dass es keine schöneren Lippen gab als jene Judiths. Diese formten sich sogleich zur Frage: »Und was ist mit Stefanie?« Jakob: »Stefanie?« Der Name schien ihm in diesem Zusammenhang sehr weit hergeholt. Judith: »Warum ist sie nicht hier?« Jakob: »Sie ist zu Hause geblieben, sie macht sich nicht viel aus solchen Festen.« Wenigstens war sie daheim nicht allein, Felix (4) und Natascha (2) unterhielten sie sicher gut. Judith bestand darauf, Fotos von den Kleinen zu sehen, wie sie jeder halbwegs bekennende Papa in der Brieftasche mitführte. Jakob wehrte sich eine Weile, zeigte die Bilder aber schließlich her. Danach war er entspannt genug, nach Hause zu gehen.
Judith wollte sich gerade einer an der Bar gegründeten Kriseninterventionsgruppe im Kampf gegen die globale Erwärmung zuwenden, da tippte ihr jemand, unangenehm kurz und punktuell, von hinten auf die Schulter. Sie drehte sich um und erschrak. Das war ein Gesicht, das nicht hierhergehörte. »So eine Überraschung«, sagte der Bananenmann. Judith: »Ja.« Er: »Ich dachte noch, ist sie es, oder ist sie es nicht?« Judith: »Ja.« Sie meinte, sie war es. Und sie fühlte sich in beklemmender Weise und unter heftigen Herzschlägen dabei erwischt. Jetzt half nur noch eines, jetzt musste sie reden. »Was machen SIE hier? Ich meine, was führt Sie hierher? Kennen Sie Gerd? Gehören Sie auch zum Geburtstagsfest? Sind Sie öfter hier? Sind Sie Stammkunde? Spielen Sie Klavier? Sind Sie der neue Pianist?« Einige dieser Fragen stellte sie, andere dachte sie nur. Darunter auch: »Haben Sie mich hier hineingehen gesehen?« Und: »Wollten Sie mir nur guten Tag sagen?«
Nein, er war mit zwei Kolleginnen hier, erklärte er. Sie saßen ein paar Meter weiter an einem runden Tisch im gelben Licht eines zu tief hängenden wuchtigen Lampenschirms aus den achtziger Jahren. Er zeigte hin, sie winkten her, Judith nickte ihnen zu. Sie sahen zweifelsfrei nach Kolleginnen aus, kolleginnenhafter als die beiden konnte man eigentlich gar nicht aussehen. Wahrscheinlich war es der monatliche Jour fixe einer Steuerberaterkanzlei, aufgelockert durch flotte Barpianomusik.
Der Bananenmann hieß Hannes Berghofer oder Burghofer oder Burgtaler oder Bergmeier, hatte eine große, warme rechte Handinnenfläche und einen derart durchdringenden Blick, dass sich sogar Judiths Nieren davon berührt fühlten. Sie spürte wieder, wie ihre Wangen von innen nach außen heiß wurden. Und dann sagte er auch noch: »Ich freue mich, Sie so oft zu sehen. Wir scheinen momentan irgendwie im gleichen Rhythmus zu leben.« Und dann fragte er auch noch: »Wollen Sie sich ein bisschen zu uns setzen?« Da musste Judith leider passen. Sie wollte nämlich gerade das Lokal wechseln, weil drüben im »Iris« das eigentliche Geburtstagsfest ihres Freundes, also ihres guten Bekannten Gerd stattfand. »Aber ein andermal gerne«, sagte sie, was immer ihr dabei eingefallen sein mochte. So offensiv war sie schon lange nicht gewesen.
»Vielleicht darf ich Sie ja einmal auf einen Kaffee einladen«, meinte daraufhin Berghofer oder Burghofer oder Burgtaler oder Bergmeier. »Ja, warum nicht«, erwiderte Judith, weil es auch schon egal war. Die Hitze hatte nun die äußerste Schicht ihrer Wangen erreicht. Sie musste jetzt wirklich gehen. Er: »Gut, gut.« Sie: »Ja.« Er: »Na dann.« Sie: »Ja.« Er: »Und was den Kaffee betrifft, da komme ich einfach irgendwann bei Ihnen im Geschäft vorbei, wenn es recht ist.« Sie: »Ja, tun Sie das.« Er: »Ich freue mich.« Sie: »Ja.«
6.
»Irgendwann« war am nächsten Morgen. Bianca rief: »Frau Cheeefin, Besuch!« Judith wusste sofort, was das zu bedeuten hatte. Hannes mit »Berg« oder »Burg« im Nachnamen blieb unter einem ihrer wertvollsten Stücke stehen, unter dem monströsen ovalen Kristallluster aus Barcelona, den seit fünfzehn Jahren jeder bewunderte und keiner kaufte. »Ich hoffe, ich störe Sie nicht«, sagte er. Er trug eine blaue Strickjacke mit hellbraunen Knöpfen und sah aus wie einer, der jeden Abend am offenen Kamin saß, Earl Grey trank und mit seinen Zehen das dichte Fell eines übergewichtigen Bernhardinerrüden massierte, während die Kinder um ihn herumtollten und ihre Bananenfinger am Sofa abwischten.
Judith: »Nein, Sie stören nicht.« Sie ärgerte sich, dass sie so aufgeregt war, es gab keinen logischen Grund dafür, ehrlich nicht. Sie fand diesen Mann nett, aber vordergründig überhaupt nicht spannend, und an Hintergründiges dachte sie bei Männern prinzipiell nur noch selten. Er war keineswegs ihr Typ, wobei sie zugeben musste, dass sie ihre Typen ohnehin nicht mehr kennenlernen musste, denn kannte man einen, kannte man alle.
Sie wusste nicht genau, was den Reiz des Herrn Hannes mit »Berg« oder »Burg« im Nachnamen ausmachte, vielleicht einfach nur die Dynamik, mit der er den Zufall nach ihr auszurichten verstand, die Unverhofftheit, in der er auftauchte, immer viel früher, als mit ihm zu rechnen war, und die Zielstrebigkeit, mit der er auf sie zuging, als gäbe es für ihn nichts und niemand anderen auf der Welt, nur sie.
Er durfte jetzt aber bitte nicht mit einem Kaffeetreffen daherkommen, das wäre wirklich zu früh gewesen, das hätte sie als Aufdringlichkeit empfunden, da hätte sie ihn leider sofort zurückweisen müssen, in aller Deutlichkeit. Sie hatte keine Lust, die erste Anlaufstelle für einen möglicherweise ein bisschen notgeilen Familienvater zu sein, dessen Frau daheim inzwischen blaue Westen strickte und hellbraune Knöpfe daraufnähte.
Er: »Ich will wirklich nicht aufdringlich sein.« Sie: »Aber nein, das sind Sie nicht.« Er: »Es ist nämlich so, es geht mir seit gestern Abend einfach nicht mehr aus dem Sinn.« Sie: »Was?« Er: »Sie, wenn ich ehrlich bin.« Wenigstens war er ehrlich, dachte sie. Er: »Ich würde Sie schrecklich gerne auf einen Kaffee einladen und ein bisschen mit Ihnen plaudern, einfach nur so. Haben Sie heute nach Geschäftsschluss schon etwas vor?« – »Nach Geschäftsschluss?«, fragte Judith, als wäre das der absurdeste Zeitpunkt gewesen, der ihr je zu Ohren gekommen war. Sie: »Ja leider, da habe ich schon etwas vor.«
Doch wie traurig er schaute, wie niedergeschlagen er die Schultern hängen ließ, wie tief er seufzte, wie verletzt er wirkte, wie ein kleiner Schulbub, dem man den Ball weggenommen hatte. Sie: »Aber ich kann das vielleicht ein wenig aufschieben. Ein schneller Kaffee, nachdem ich zugesperrt habe, das müsste sich schon irgendwie ausgehen.« Zur Sicherheit schaute sie noch einmal auf ihre Uhr. »Oh doch, ich denke, das ließe sich einrichten«, sagte sie.
»Das ist schön, das ist schön«, erwiderte er. Ja, das musste sie sich schon eingestehen, es war eine Freude, ihm beim Ausbreiten dieses Lachens zuzusehen, mehr noch, die Produzentin jener Dutzenden Fältchen zu sein, die sich, vom Licht ihres Lieblingslusters aus Katalonien widergespiegelt, wie Sonnenstrahlen um seine Augen legten.
7.
Sie trafen sich beim »Rainer«, ihrem Mittagspausen-Café, in der Märzstraße. Judith erschien zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit. Sie wollte unbedingt zuerst da sein, um einen Tisch auszusuchen, an dem man einander auf Stühlen gegenübersaß und sich nicht in einer Nische aneinanderquetschen musste. Aber er saß schon da, auf einem unbequemen Stuhl gegenüber einer einladenden Eckbank, die feiner Weise für sie allein bestimmt war.
Das Treffen war für eine Stunde anberaumt, was sich als zu knapp bemessen erwies. Danach ging es in die Verlängerung, der eine kurze Zugabe folgte. Dann setzte Judith der Begegnung ein taktisches Ende. Ihr Schlusswort: »Es war wirklich total angenehm, mit dir zu plaudern, Hannes. Das können wir gern wieder einmal machen.« Wie er sie dabei ansah, das wollte sie sich einprägen, um es abrufen zu können, wenn sie sich selbst wieder einmal so gar nicht gefiel. Und was er in diesen neunzig Minuten zu ihr und vor allem über sie gesagt hatte, das musste sie erst einmal verdauen. Jedenfalls freute sie sich auf das Danach, ungestört mit sich allein daheim, mit sich und den Gedanken an eine nette Neuentdeckung, einem Mann, der sie auf einen reich verzierten, im schönsten Licht erscheinenden Thron gesetzt hat. So hoch oben war sie schon lange nicht mehr gesessen. Auf diesem Platz wollte sie wenigstens ein paar Stunden verweilen, bis der Alltag sie wieder auf den Boden zurückholte.
8.
In der Badewanne fasste sie zusammen: Er baute Apotheken um, und wenn sie sich nicht umbauen ließen, dann baute er sie eben neu, zumindest zeichnete er die Entwürfe. Er war Architekt. Er war 42 Jahre alt. Er war noch nie beim Zahnarzt gewesen, das schöne Gebiss hatte er von seiner Großmutter, also nicht das Gebiss selbst, sondern die Veranlagung dazu.
Er war, wie gesagt, 42 Jahre alt und ledig, nicht schon wieder ledig, sondern noch immer ledig, das hieß: Er war noch nie verheiratet und deshalb auch noch nie geschieden. Er war für niemanden sorgepflichtig, das bedeutete, er hatte keine Kinder, auch keine Kleinkinder und auch keine Babys, und das noch dazu aus keiner einzigen Ehe. »Für wen sind dann diese Unmengen von Bananen? Isst du die alle selbst?«, hatte sie ihn gefragt. Da war er kurz zusammengezuckt. Hatte sie ihn beleidigt, war sie zu indiskret gewesen, hatte er einen Bananentick? – Aber dann ließ er Omas Gebiss aufblitzen und stellte die Dinge klar: Die Bananen gehörten seiner gehbehinderten Nachbarin, verwitwete Mutter dreier Kinder. Einmal in der Woche erledigte er Einkäufe für sie. Er machte das unentgeltlich, ohne Gegenleistung, einfach so, weil er selbst auch gerne Nachbarn hätte, die ihm helfen würden, wenn es ihm schlecht ging, hatte er gemeint.
Er war, wie gesagt, 42 Jahre alt und hieß definitiv Hannes Bergtaler. »Bergtaler«, pustete Judith in den Badeschaum. Was war von einem ledigen Apotheken-Umbauer im drittbesten Alter zu halten, der seine Höhen und Tiefen bereits im Namen trug? Roch das nicht förmlich nach einer ausgeglichenen Persönlichkeit? Wirkte er deshalb auf den ersten Blick ein wenig langweilig? War er denn langweilig? War ihr denn langweilig mit ihm gewesen? – Keine Sekunde, dachte sie. Das sprach für die Qualität der Sekunden, die sie soeben mit ihm verbracht hatte, und zweifelsfrei auch für ihn selbst, für Hannes Bergtaler, den ledigen Apotheken-Umbauer mit Omas prächtigem Gebiss im Mund.
So, und nun der Reihe nach: Als er ihr auf die Ferse gestiegen war und ihr Gesicht gesehen hatte, hatte es offenbar zwei Stiche gegeben, einen spürte sie in ihrer Ferse, der zweite ging ihm angeblich durch Mark und Bein. »Ich habe dich gesehen, Judith, und ich war wie von den Socken«, hat er gesagt. »Wie von den Socken« war zwar jetzt nicht gerade ihre Lieblingsmetapher, denn Socken haftete stets etwas Anrüchiges und Unerotisches an, aber so, wie er sie dazu anblinzelte, mit diesen vielen Sonnenstrahlenfältchen unter einer matten 60-Watt-Glühbirne im Café Rainer, das war schon nett, irgendwie, ja, sehr nett sogar.
»Und dann habe ich dich einfach nicht mehr vergessen können«, konnte sie sich erinnern, hat er gesagt. »Einfach nicht mehr vergessen können« war – ja, doch, ein Kompliment, ein nettes Kompliment. Judith ließ noch etwas heißes Wasser in die Badewanne ein, denn das Kompliment war wirklich außerordentlich nett.
Was sie denn auf Anhieb so unvergesslich für ihn gemacht hatte? »Dieses Bild, als du dich zu mir gedreht hast, dieser Drei-Sekunden-Film, die Bewegung der Schulter, deine angehobenen Augenbrauen, der gesamte Ausdruck im Gesicht«, hat er gesagt, »verzeih mir dieses banale Wort, aber ich fand dich einfach umwerfend.« Banal war es wirklich, das Wort, aber sie hatte schon schlimmere Beschreibungen von sich gehört als »umwerfend«, dachte sie. Vielleicht sollte sie sich öfter auf die Ferse steigen lassen.
Und dann hatte er einen Film nach dem anderen mit ihr erlebt. Regisseur: der pure Zufall. Produzentin: die höhere Bestimmung. Sie, an die er unentwegt gedacht hatte, sperrte plötzlich vor seinen Augen das benachbarte Lampengeschäft auf, vor dessen Auslage er schon so oft gestanden war. Sie, von der er seinen Kolleginnen gerade erst vorgeschwärmt hatte, stand plötzlich an der Bar im gleichen Lokal und wimmelte einen ihrer sicher zahlreichen Verehrer ab. Diese Chance, auf sie zuzugehen und mit ihr ins Gespräch zu kommen, konnte er sich nicht entgehen lassen. – Ja, das sah sie ein. Andererseits hatte er große Angst, aufdringlich zu erscheinen. – Ja, diese Angst war an sich berechtigt. Er hatte aber nicht das Gefühl, dass sie ihn grundsätzlich ablehnte. – Grundsätzlich nicht, da hatte er recht.
Sie stieg aus der Badewanne. Die große Hitze war bereits vorbei. Judith konnte wieder kühler denken. Dieser Hannes Bergtaler war einfach mächtig verschossen in sie. Das konnte vorkommen. Das konnte auch rasch wieder vorbeigehen. Daran ließ sich gelegentlich ein Treffen im Kaffeehaus anknüpfen. Sie mochte ihn gern. Seine Nasenspitze gefiel ihr. Er wirkte aufrichtig, entwaffnend ehrlich. Er sagte unglaublich nette Sachen. Er sagte geradeheraus, was er fühlte. Das tat ihr gut, ziemlich gut sogar.
Und wenn sie sich vorstellte, dass ihr gerade jemand die Ferse eingetreten hatte, und sie drehte sich zum Spiegel und funkelte ihn an, als wäre er der Täter, dann sah sie, ja, plötzlich, selbst mit nassem Haar und einer drei Zentimeter dicken Schicht Creme im Gesicht: eine umwerfende Frau. Und das war sein Verdienst.
Phase zwei
1.
Auf Judiths kleiner Dachterrasse blühte erstmals nach drei Jahren wieder das Hibiskus-Bäumchen, knallrot. Das waren gute Wochen. Es war etwas im Entstehen. Es entstand täglich neu und nahm alles eben erst Entstandene mit. Judith versuchte, die Anzahl der Begegnungen mit Hannes so gering wie möglich zu halten, also nicht fünfmal am Tag, was in seinem Sinne gewesen wäre, sondern nur ein- oder zweimal. Sie hatte Angst, der Reiz könnte für ihn verlorengehen, er hätte sich bald sattgesehen an ihr, ihren Drehbewegungen und Gesichtsausdrücken, Angst, er wüsste nicht mehr, welche Blumen er ihr noch schenken, welche Botschaft in Briefchen- oder E-Mail-Form er ihr noch zukommen lassen, welches Kompliment er ihr noch machen sollte und mit welchen Worten er ihr per SMS noch »guten Morgen« oder »gute Nacht« wünschen könnte.
Judith fand sich in einer neuen Situation. Nicht sie war es, die sich wieder einmal mehr von einem Mann erwartete, als dieser schon im Ansatz zu geben bereit oder fähig zu sein schien. Nein, da war nun ein Mann, der es offensichtlich nicht erwarten konnte, ihre Erwartungen zu erfüllen. Nun schraubte sie diese ihre Erwartungen so weit wie möglich herunter, damit der Vorrat seiner Erfüllungen noch lange reichen würde. Mit etwas Glück konnte sie damit erfüllt über den Sommer gelangen. Erfüllt von Hannes Bergtaler: 1,90 groß, 85 Kilo schwer, wuchtig, ungelenk, 42, ledig, sonnenfältchenäugig, ausgestattet mit Omas blendendem Gebiss.
Vieles an ihm fiel ihr auf, nichts davon störte sie. Nicht sein Wortwitz, der die Pointen voranstellte und die Vorgeschichten erst nachher zu erzählen pflegte. Nicht sein gewöhnungsbedürftiger Begriff von Frühjahrsmode. Nicht seine sattsam ausgewaschenen Unterleibchen, die man beim besten Willen nicht als T-Shirts bezeichnen konnte. Nicht einmal seine alle paar Minuten wiederkehrende Lieblingsformel »Wie-von-den-Socken«. Judith hatte es bislang vermieden zu fragen, ob er nicht zufällig noch bei seiner (Socken stopfenden) Mutter lebte.
Er war ein anderer Typ als alle bisher, nicht ihrer und auch keiner, den sie von irgendeiner Frau her kannte. Er war schüchtern und wagemutig zugleich, verschämt und unverschämt, beherrscht und getrieben, auf tolpatschige Weise zielstrebig. Und er wusste, was er wollte: ihr nahe sein. Das war ein durchaus ehrenwertes Verlangen, dachte Judith. Sie nahm sich vor, behutsam damit umzugehen und nichts zu überstürzen. Sie wollte keine falschen Hoffnungen in ihm wecken. Hoffnungen schon, aber keine falschen. Welche die richtigen waren, würde die Zukunft der Gegenwart früh genug einflüstern.
Die späten Abende und Wochenenden fanden vorerst noch ohne ihn statt, zumindest physisch. So paradox es klang: Die Zeit ohne ihn zählte für Judith zu den schönsten und stärksten Zeiten mit ihm. Egal welcher ihrer gewohnten Tätigkeiten sie nachging, alles rückte in den Hintergrund, alles geschah wie unter dem Einfluss von Glücksdrogen. Ja, sie war erstmals, wenn auch vermutlich nur kurzfristig, ein rundum glücklicher sorgenfreier Single. Sie konnte tun, was sie wollte: an Hannes Bergtaler denken. Es war wundervoll, ihre Sehnsucht nach ihm beim Wachsen zu beobachten. Möglicherweise war es auch bloß ihre Sehnsucht nach seiner Sehnsucht nach ihr, die da wuchs, aber Sehnsucht blieb Sehnsucht, und Judith war endlich wieder einmal süchtig danach.
2.
Am zweiten Samstag im Mai war sie abends bei Ilse und Roland zum Revanche-Essen für Ostern eingeladen. Auch Gerd und das beharrlich Händchen haltende Paar Lara und Valentin waren wieder dabei. Es war warm genug, um auf der Terrasse zu sitzen. Die billigen und wenig originellen Gartenlaternen störten nicht weiter, vier dicke Partykerzen rund um den Tisch wärmten das elektrische Licht auf und gaben ihm Farbe.
Gegen acht Uhr, als Roland den mit Shrimps besetzten, von Avocado belegten und mit Koriander geschmückten »Gruß aus der Küche« auftrug, waren Mimi (4) und Billi (3), nach aufwühlender Beschlagnahme jedes einzelnen Besuchers, bereits müde und quengelig. Um zehn Uhr, als Ilse zum Abschluss die »kinderleichte Käsetorte« nach Jamie Oliver servierte, hatten sich die Kleinen endlich erfolgreich in den Schlaf geplärrt, und so etwas wie Unterhaltung für Erwachsene konnte entstehen.