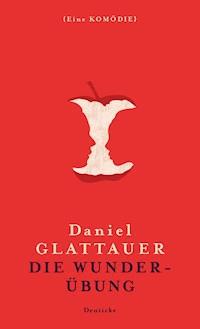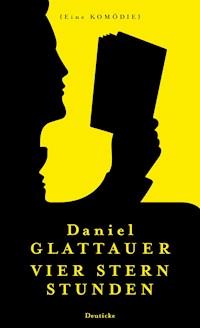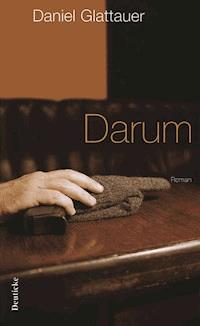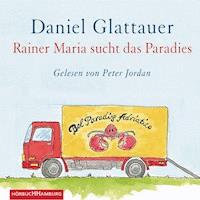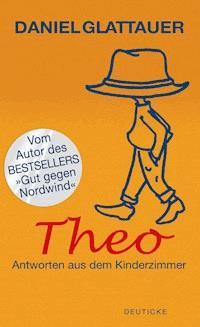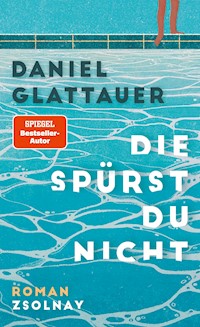
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Bestsellerautor Daniel Glattauer lässt in seinem neuen Roman Menschen zu Wort kommen, die keine Stimme haben – ein Sittenbild unserer privilegierten Gesellschaft.
Die Binders und die Strobl-Marineks gönnen sich einen exklusiven Urlaub in der Toskana. Tochter Sophie Luise, 14, durfte gegen die Langeweile ihre Schulfreundin Aayana mitnehmen, ein Flüchtlingskind aus Somalia. Kaum hat man sich mit Prosecco und Antipasti in Ferienlaune gechillt, kommt es zur Katastrophe.
Was ist ein Menschenleben wert? Und jedes gleich viel? Daniel Glattauer packt große Fragen in seinen neuen Roman, den man nicht mehr aus der Hand legen kann und in dem er all sein Können ausspielt: spannende Szenen, starke Dialoge, Sprachwitz. Dabei zeichnet Glattauer ein Sittenbild unserer privilegierten Gesellschaft, entlarvt deren Doppelmoral und leiht jenen seine Stimme, die viel zu selten zu Wort kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Der Bestsellerautor Daniel Glattauer lässt in seinem neuen Roman Menschen zu Wort kommen, die keine Stimme haben — ein Sittenbild unserer privilegierten Gesellschaft.Die Binders und die Strobl-Marineks gönnen sich einen exklusiven Urlaub in der Toskana. Tochter Sophie Luise, 14, durfte gegen die Langeweile ihre Schulfreundin Aayana mitnehmen, ein Flüchtlingskind aus Somalia. Kaum hat man sich mit Prosecco und Antipasti in Ferienlaune gechillt, kommt es zur Katastrophe.Was ist ein Menschenleben wert? Und jedes gleich viel? Daniel Glattauer packt große Fragen in seinen neuen Roman, den man nicht mehr aus der Hand legen kann und in dem er all sein Können ausspielt: spannende Szenen, starke Dialoge, Sprachwitz. Dabei zeichnet Glattauer ein Sittenbild unserer privilegierten Gesellschaft, entlarvt deren Doppelmoral und leiht jenen seine Stimme, die viel zu selten zu Wort kommen.
Daniel Glattauer
Die spürst du nicht
Roman
Paul Zsolnay Verlag
Kapitel EINS
Die ersten Bilder
Wir sehen einen gedeckten Terrassentisch, überdacht mit einer vanillefarbenen Plane, flankiert von Steinmauern eines Landhauses im warmen ockergelben Licht. Weiter hinten schlängelt sich die dunkelgrüne Zierleiste einer Platanenallee durch die luftflimmernde Landschaft. Vorne rechts eine kleine Irritation — ein winziger kosmetischer Eingriff in die Natur, ein scharf ins Auge stechendes azurblaues Rechteck, ein Swimmingpool. Dahinter erheben sich die sanften Hügel mit den von der Sommerhitze schon blassgrün gefärbten Weinzeilen und dem matten Hellbraun der Erde. Zur Linken hat man freie Sicht bis zum Horizont. Da schmiegen sich lebensdurstiger Himmel und abenteuerhungriges Meer in üppigen blauen Streifen aneinander. Das schafft kein Werbesujet. Das ist die Toskana in aller Echtheit. Und in Echtzeit.
Auf der Terrasse
Jetzt lernen wir die Urlaubsgäste kennen, zuerst die vier Kinder. An der Böschung spielen Lotte und Benjamin, beide neun Jahre alt. Lotte ist die Kleine der Strobl-Marineks und gibt den Ton an, nicht nur bei Benjamin, sondern in der gesamten Gruppe. Wenn sich Lotte wohl fühlt, kann es ein großartiger Urlaub werden. Nur dann.
Benjamin ist der Sohn der Binders und gilt als pflegeleicht. Sein Gemüt verrät einem nicht, ob er sich alles gefallen lässt oder ob ihm tatsächlich alles gefällt. Er zeigt niemals Präferenzen, will keine Entscheidungen treffen und nimmt die Dinge, wie sie kommen, wie sie gehen und wie sie sind, wenn sie eine Weile bleiben. Das gilt auch für Menschen, und allen Menschen voran für Lotte. Die beiden Kinder haben einander gesucht und gefunden. Lotte hatte gesucht, Benjamin wurde gefunden.
Sophie Luise hockt auf einer Steinbank und surft. Sie ist vierzehn Jahre alt, also volljährig, glaubt sie. Die Große der Strobl-Marineks lebt bereits in ihrer eigenen Erwachsenenwelt, die nichts damit zu tun hat, was ihr die Familie ständig vor Augen führen will. Jedes Drumherum verschwindet für sie, wenn es ein Drinnen gibt — drinnen im Netz. Sophie Luises Einsichten sind allesamt höchstens dreißig Zentimeter von ihrem jeweiligen Betrachtungspunkt entfernt, ihre Wirklichkeit spiegelt sich global im Display ihres Smartphones wider. Aber sie hält sich wacker gegenüber ihren Eltern und den zahlreichen Vertretern der alten Schule, die nur erleben, was sich riechen, schmecken und angreifen lässt, und die behaupten, das Hier und Jetzt wäre immer nur dort, wo sie sich gerade räumlich befinden.
Sophie Luise unterscheidet sich auf angenehme Weise von gut achtzig Prozent aller Gleichaltrigen — sie trotzt und revoltiert nicht. Nein, sie lächelt sich, zugegeben, ein wenig spöttisch, durch ihre Pubertät. Und sie verfolgt selbst in schmerzlichen Trennungsphasen vom Internet, im qualvollen Offline-Dasein, in der sogenannten physischen Geselligkeit ihrer Familie und Freunde, eine Art pädagogische Mission. Sie will ihrer Umwelt zeigen, was im Leben zählt und wie man alles besser machen könnte. (Wir lernen bald ihren Vater kennen.)
Da kommt ihr das zarte dunkelhäutige Mädchen, das neben ihr kauert und ihr schüchtern über die Schulter schaut, wie gerufen. Aayana ist ein Flüchtlingskind aus Mogadischu. Vor vier Jahren, als Aayana zehn war, floh die somalische Familie aus einem Lager in Äthiopien durch die Wüste nach Libyen, wurde ein halbes Jahr später auf die italienische Insel Lampedusa geschleppt und gelangte schließlich nach Österreich, wo alle vier nach vergleichsweise kurzer Zeit Asyl bekamen, ihre Eltern, ihr zwei Jahre älterer Bruder Abdulaziz und Aayana selbst.
Aayana hat gelernt, in sich hineinzukriechen und sich zu verstecken. Sie kommt sich offensichtlich verloren vor. Diesen Eindruck erweckt sie zumindest bei allen anderen, egal wo sie sich gerade befindet. Hier in der Toskana, mitten im Paradies der wohlsituierten Individualtouristen mit westlichem Kultur- und Genussanspruch, wirkt sie besonders deplatziert. Man fragt sich unweigerlich, wie um alles in der Welt es sie hierher verschlagen konnte.
Nun, sie war sozusagen Sophie Luises Reise-Bedingung. Ohne Aayana, ihre nachholbedürftige Schulfreundin, wäre die Große gar nicht mitgefahren. Und es war ein wahres Husarenstück der Strobl-Marineks, das somalische Flüchtlingskind mit auf die Reise zu nehmen, Aayana aus der muslimischen Zwangsjacke ihrer Familie zu schälen, vorübergehend vom Kopftuch zu befreien und in eine Geländelimousine zu setzen, die sie in echte europäische Sommerferien der gehobenen Klasse bringen würde.
Sophie Luise hat nun jedenfalls ihren Urlaubsauftrag. Sie will ihrer Freundin das Schöne am Guten der westlichen Welt zeigen und sie etwas vom Leben der Privilegierten lehren, das sie selbst freilich für das ganz normale Leben hält. Deshalb sind beide hier. Und die Erwachsenen können aufatmen und davon ausgehen, dass nun wohl alle vier Kinder eine Juliwoche lang sinnvoll miteinander beschäftigt sein werden.
Die beiden Elternpaare sitzen am Terrassentisch und unterhalten sich angeregt. Wir erleben sie im möglicherweise allerschönsten Augenblick des gesamten Urlaubs, nach dem rituellen Einstands-Prosecco, selbstverständlich auf nüchternen Magen, damit er besser einfahren konnte. Die Vorfreude auf ein erstes gemeinsames toskanisches Essen ist allen anzumerken.
Engelbert Binder, ein kleiner stämmiger Mann Mitte vierzig, ist der gesellige Mittelpunkt dieser und beinahe jeder Gruppe. Er tritt bodenständig auf und versprüht Herzlichkeit und Lebensfreude. Sein Lachen ist unabhängig vom durchwachsenen Spaßfaktor ansteckend und wird immer erst gegen Ende zu laut und polternd, wenn ohnehin bereits alle abgefüllt sind und schlafen gehen wollen. Er nicht, niemals.
An der Art, wie sich Engelberts Hand in die mit Oliven gefüllte Schüssel auf dem Tisch gräbt, gleich der Schaufel eines Baggers, erkennt man das Grobschlächtige an seinem Wesen. Daheim im niederösterreichischen Fels am Wagram führt er das Erbe einer Weinbauern-Dynastie fort, pflegt sechzig Hektar Weingartenfläche in besten Lagen und hat sich mittlerweile, wohl auch dank seiner Frau, in die erste Reihe der österreichischen Spitzen-Biowinzer emporgearbeitet.
Melanie, schlank, blond und nobel blass im Gesicht, ist ein paar Jahre jünger als ihr Mann. Sie greift ganz anders in die Olivenschale, fünfmal so langsam, zehnmal so selten, zaghaft, grazil mit zwei Fingerkuppen, und ihre Lippen sind dabei gespitzt. Melanie zeichnet für den zweiten Teil der gemeinsamen Wein-Kultur der Binders verantwortlich, für die Kultur.
Eigentlich wollte sie Schauspielerin werden, geriet aber auf die Werbeschiene und erreichte mit der Kür zur Wachauer Jahrgangs-Marillen-Königin ihren persönlichen Tiefpunkt — in ihrem Anspruch, eine starke, emanzipierte Frau zu sein, die nicht an Äußerlichkeiten gemessen werden soll.
Danach rettete sie sich ins Hotelfach. Sie studierte Kulturmanagement und organisierte erste größere Veranstaltungen, ehe ihr Engelbert über einen seiner Feldwege lief und seine Arme nach ihr ausstreckte. Sie ließ sich hineingleiten, zögerlich, grazil und garantiert mit gespitzten Lippen. Ohne seine Weingärten wäre er in ihrer Biografie vielleicht nur die Notiz einer naturbelassenen Affäre geblieben. So aber wuchsen sie füreinander als doppelte Lebensaufgabe heran, beruflich und privat. Wobei das Private der beiden die einfachere Übung zu sein scheint, wohl aber auch die weniger leidenschaftliche.
Ein ganz anderer Typ sitzt ihnen vis-à-vis. Er verträgt keine Oliven, zumindest keine aus einer Schüssel, in die auch andere hineingreifen, und seien es seine engsten Vertrauten.
Oskar Marinek ist ein großer hagerer Mann Ende vierzig, dem man beim Denken zusehen kann, wie er sich gerade wieder auf die Suche nach einem neuen, erfrischenden Standpunkt macht, egal welches Thema gerade zur Debatte steht.
Seine chronisch in Skepsis-Falten gelegte Stirn verdeutlicht, dass er prinzipiell keiner anderen Meinung zutraut, intellektuell an seine jeweils eigene heranzureichen. (Am ehesten noch jener seiner Tochter Sophie Luise, die ähnliche Argumentationstugenden besitzt wie er.) Wobei er sich wirklich mächtig anstrengt, immer der Originellste unter allen Anwesenden zu sein, das muss man ihm lassen.
An seinem Arbeitsplatz, der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, gab es leider hochrangige Stumpfköpfe, die seine Professur verhinderten, was zur Folge hatte, dass seine heiter-ironischen Wesenszüge mehr und mehr zynisch-sarkastischen Charakter annahmen. Er zog sich als Lektor in wenig herausfordernde Forschungsprojekte zurück und hielt sich geistig für den Privatgebrauch fit, sehr zum Leidwesen seiner zehn Jahre jüngeren Frau.
Wenn wir den Blick zu Elisa Strobl-Marinek hinüberschweifen lassen und sie im Gespräch beobachten, wundern wir uns, mit welcher Gelassenheit sie den Besserwissereien ihres Mannes begegnet. Elisa — kurze schwarze Haare, dunkler Teint, kantige Sonnenbrillen, muskulöse Figur — ist eine enge Freundin von Melanie Binder seit Jugendtagen und galt immer als die Robustere und Dynamischere der beiden. Sie haben schon im Schultheater Seite an Seite »Twelfth Night, or What You Will« von Shakespeare gespielt. Bei den gemeinsamen Demos gegen Rechts, die in Elisa die linke Kämpferin erwachen ließen, bog Melanie irgendwann in der Mitte ab, Richtung Marillen-Königin, und man verlor sich vorübergehend aus den Augen.
Elisa blieb als Umweltaktivistin engagiert und studierte Ökologie und Nachhaltigkeit.
Als nachhaltig genug — sogar für Ehe und Kinder — erwies sich die Begegnung mit dem spitzbübischen Oskar, der damals gerade Volkskunde zu lehren begann. Als Sophie Luise zwei Jahre alt war und Oskar in Väterkarenz ging, begann Elisas berufspolitischer Aufstieg bei den Grünen. Heute, mit knapp vierzig, sitzt sie im Nationalrat und gilt als aussichtsreiche Kandidatin für ein Ministeramt. Aber jetzt ist einmal Urlaub.
Und ein Blick in Elisas Augen verrät, dass sie ihn von allen Anwesenden am dringendsten braucht.
Was man so redet
»Wettermäßig hätten wir es gar nicht besser erwischen können«, meint Engelbert. Keiner widerspricht, alle essen. Ganz am Anfang schmeckt es immer am besten.
»Bleibt nicht so. Mitte der Woche dreht die Strömung auf Süd, dann kriegen wir Tropennächte«, wendet Oskar nun doch noch ein.
Lotte lässt von weiter drüben ihren ersten ohrenbetäubenden Schrei los.
»Was ist?«, fragt Elisa.
»Eine Riesenameise.«
»Benjamin, tu sie ihr bitte weg«, ruft Melanie hinüber.
»Nein!«, schreit Lotte. »Nicht töten.«
»Dann tu sie ihr bitte lebend weg«, schlägt Oskar vor.
»Nein!« — Das dürfte Lotte wiederum zu gefährlich sein. Ihr Lösungsansatz wäre, das Insekt in künstlichen Tiefschlaf zu versetzen und nach dem Urlaub wieder aufzuwecken. Elisa geht hinüber und befreit das Kind von dem Ungeheuer, beziehungsweise das Ungeheuer von der Ameise. Lotte steht noch eine Weile unter Schock, ihr Jammern lässt aber hörbar nach. Als es ihr gelingt, Benjamin am falschen Fuß zu erwischen und von der Böschung zu schubsen, lacht sie wieder.
Es wird dann länger über die Anreise gesprochen. Die Binders und Oskar mit den drei Mädchen sind — nach Zwischennächtigung in Parma — schon vormittags in zwei Autos am Zielort eingetroffen. Elisa kam allein und später. Sie ist nach Mitternacht aufgebrochen und mit Zügen und Bus angereist — zum nachhaltigen Unverständnis ihres Mannes. Elisas Begründungen: Sie hatte erstens am Vorabend noch einen wichtigen Termin im Ministerium. Und sie kann es sich zweitens aus umweltideologischen Gründen nicht leisten, Urlaubsreisen per Auto mit Verbrennungsmotor zu tätigen.
»Das ist absurd«, sagt Oskar.
»Was ist absurd?«
»Natürlich hättest du mit uns mitfahren können, ganz normal.«
»Neunhundert Kilometer im Auto sind zu viel.«
»Zu viel was?«
»Zu viel Stickstoff.«
»Das ist Umwelt-Heuchelei«, sagt Oskar.
»Hauptsache ist doch, dass wir alle gut angekommen sind«, meint Engelbert und will die Runde zum Heben der Gläser animieren. Gelingt nicht.
»Was ist Umwelt-Heuchelei?«, fragt Elisa.
»Bekanntlich sind es nicht die Menschen, die den Stickstoff ausstoßen, sondern die Motoren. Der Umwelt ist es scheißegal, ob vier oder fünf Personen im Auto sitzen.«
Jetzt schaltet sich Melanie ein.
»Verstehst du nicht, worum es geht, Oskar? Elisa will sich hier einfach keine Blöße geben. Wenn das wo in der Zeitung steht, dass sie mit der Familie Autoreisen in die Toskana macht, fallen sie mit Shitstorms über sie her.«
»Papa, sei froh, dass sie nicht mit dem Fahrrad gekommen ist«, wirft Sophie Luise von weiter drüben ein.
»Ich kann halt nicht Wasser predigen und Wein trinken, das geht einfach nicht«, sagt Elisa ermattet.
»Und damit Schluss. Ich bin für Wein predigen und Wein trinken. Prost, meine Lieben«, ruft Engelbert aus. »Schön, dass wir alle da sind.«
»Können wir jetzt endlich zum Swimmingpool gehen«, drängt Sophie Luise. Noch nicht. Die Sonne steht noch zu weit oben. Von den gesättigten Alten schafft es keiner, sich aus dem Sitz zu bewegen. Und die Kinder finden sich für Alleingänge in der neuen Umgebung noch nicht gut genug zurecht, meinen die Eltern.
Engelbert hat gerade eine zweite Bouteille Vernaccia di San Gimignano aufgemacht und vergleicht die Würze, das Spiel am Gaumen und den Abgang mit Merkmalen seiner eigenen Bio-Jungweine.
Oskar widerspricht, wo immer sich eine Chance dazu bietet. Mit »Spiel am Gaumen« kann er überhaupt nichts anfangen.
»Im Grunde geht es um das Spiel im Gehirn und um nichts anderes, wenn wir ehrlich sind«, sagt er. »Ohne den kontinuierlich wiederkehrenden Zustand der Berauschung wäre unser aller Leben nämlich unerträglich.«
Darüber will aber jetzt tatsächlich keiner diskutieren.
»Aayana, alles okay mit dir?«, ruft Elisa hinüber.
»Ja«, kommt es mit dünner Stimme zurück.
»Geht es dir gut?«
»Danke. Und Ihnen?«
»Du kannst ruhig du sagen. Ich bin die Elisa.«
»Danke.«
»Das ist ja wirklich eine Süße, und so brav, die spürst du gar nicht«, meint Engelbert.
»Sie spricht auch schon sehr gut Deutsch«, lobt Melanie.
»Zumindest ›Danke‹ kann sie gut, viel mehr hat sie noch nicht gesprochen«, bemerkt Oskar.
»Ich finde das jedenfalls großartig von euch«, sagt Melanie.
»Was?«
»Dass ihr ein Flüchtlingskind mitgenommen habt. Schon rein als Symbol.«
»Als Symbol wofür?«, fragt Oskar.
»Als Symbol dafür, dass … dass … dass auch die Chancenlosen einmal eine Chance kriegen. Es ist ja alles so verdammt ungerecht verteilt. Was kann das Kind dafür, dass es irgendwo im hintersten Afrika zur Welt gekommen ist und nicht in … in …«
»Wien-Döbling«, ergänzt Oskar.
»Ja genau.«
»Darf ich was dazu sagen? Aber ihr werdet es nicht gerne hören.«
»Dann behalte es für dich, Papa«, ruft Sophie Luise hinüber, die dem Gespräch mit einem halben Ohr beiwohnt.
»Nicht jetzt, Oskar, wir sind gerade erst angekommen. Gib uns ein bisschen Luft, bitte«, fleht Elisa.
»Okay, ich muss auch gar nichts mehr sagen.«
»Wie habt ihr es überhaupt geschafft, das Mädchen mitzubekommen?«, fragt Engelbert.
Das verlangt nach umfangreicheren Ausführungen.
Wer entscheidet, wer darf
Aayana sitzt seit einem Jahr in der Schulklasse von Sophie Luise, ohne gefragt, geprüft oder gar benotet zu werden, weil sie ja auch nur einen Bruchteil aller Inhalte versteht. Parallel dazu besucht sie theoretisch einen Deutschförderkurs, der aber praktisch nie stattfindet, weil die Lehrerin an einer hartnäckigen Krankheit laboriert. Wahrscheinlich Burnout.
Von den anderen wird Aayana gemieden, sie selbst geht auf niemanden zu. Keine Schülerin weiß irgendwas über sie, außer das Offensichtliche, dass ein schwarzes Kopftuch ihre schwarzen Haare und die schwarze Stirn ihres schwarzen Gesichts verhüllt.
Jedenfalls hat sie sich bis zum Schulschluss beharrlich geweigert, im Turnunterricht beinfreie Sporthosen und enge T-Shirts zu tragen. Das war rebellisch und antisexistisch, das gefiel Sophie Luise. Sie war die Erste überhaupt, die sich für Aayana zu interessieren begann. Und sie beschloss bald, sie zu ihrer neuen besten Freundin zu küren. Sie würden ein megacooles, ja ein geradezu krass ungleiches Paar abgeben, das nach Fotoserien auf Instagram und vielleicht sogar nach YouTube-Videos schrie. Carola, ihre vorherige beste Freundin, konnte sich jetzt mit ihren tausend »Likes« bei wem anderen reinschleimen und sich mit ihrem billigen Tussen-Outfit woanders wichtigmachen.
Tatsächlich freundeten sich die beiden rasch an und verbrachten täglich viele Stunden miteinander, nicht physisch, natürlich, aber in den gleichen Kanälen, Foren und Chatrooms, durch die Sophie Luise Aayana führte. Aayana war dankbar für alles und machte überall mit.
Der Countdown für den Urlaub begann mit folgendem WhatsApp-Dialog:
»Kannst du schwimmen?«
»Nein.«
»Was? Du musst schwimmen können!! Das ist wichtig!!!«
»Ja. Okay.«
»Soll ich es dir beibringen?«
»Ja. Cool. Danke.«
»Dann fährst du mit uns mit in den Sommerurlaub, dort gibt es einen Swimmingpool.«
»Cool. Aber das darf ich sicher nicht.«
»Wer sagt das?«
»Meine Eltern.«
»Aber das kostet nichts, das bezahlen alles wir.«
»Cool. Aber ich darf nicht.«
»Was machst du sonst den ganzen Sommer?«
»Nichts.«
»Krass. Dann fährst du mit uns mit!«
»Ich darf nicht. Sicher.«
»Doch.«
»???«
»Meine Eltern checken das.«
»Cool. Danke. Aber ich darf nicht.«
Oskar hielt das Unterfangen von Anfang an für eine Schnapsidee und war nicht bereit, etwas in der Aayana-Ferien-Causa zu unternehmen. Elisa aber formulierte auf Druck ihrer Tochter einen herzlichen Einladungsbrief, in dem alle Fakten zum Urlaub dargelegt waren. Dreimal betonte sie, dass für die somalische Familie keine Kosten anfallen würden und dass man sich fürsorglich um die Kleine kümmern werde. Sogar das Schwimmen wolle man ihr beibringen.
Die Reaktion von Aayanas Eltern war eindeutig: Sie blieb aus. Die Einladung war ihnen nicht einmal ein Dankeschön wert. Für ein persönliches Gespräch war Elisa zu sehr verärgert. Also kontaktierte sie die Schulbehörde und ließ sich einen Termin bei der Direktorin geben, die daraufhin eine Vertrauenslehrerin einsetzte, um die Flüchtlingsfamilie zu überzeugen, wie gut und wichtig (und darüber hinaus auch ehrenvoll) Ferien mit den (österreichweit angesehenen) Strobl-Marineks für das Kind wären, schon alleine wegen des Gratis-Deutschunterrichts, in dessen Genuss Aayana so kommen würde. (Elisa bestand darauf, dass auf die Beifügungen »ehrenvoll« und »österreichweit angesehen« verzichtet wurde.)
Nun, Aayana richtete dieser Lehrerin und Sophie Luise ein paar Tage später wörtlich aus: »Danke. Aber ich darf nicht.«
Für Elisa waren Widerstände und Sturheiten berufsbedingt nicht nur üblich, sondern sogar motivierend. Sie nahm Kontakt zur psychosozialen Betreuerin auf, bei der Aayana und ihre Mutter wegen ihrer Fluchttraumata angeblich regelmäßig zu Sitzungen geladen waren, und überzeugte sie von der Sinnhaftigkeit und vom Wert des geplanten Urlaubs.
Deren gutes Zureden führte zu einem Teilerfolg. Aayana zu Sophie Luise wörtlich: »Danke. Ich darf. Aber Abdulaziz muss mit.« — Abdulaziz, der zwei Jahre ältere Bruder.
Das ging für Elisa und Sophie Luise leider gar nicht. Einen muslimisch-mittelalterlich-machoiden Aufpasser, der rund um die Uhr die Einhaltung der Kopftuchpflicht, der ganzkörperlichen Bedecktheit und der Augendisziplin seiner Schwester kontrollierte, konnte in der Toskana keiner gebrauchen, am wenigsten wohl Aayana selbst, die dann wohl den gleichen Zwängen ausgesetzt wäre wie innerhalb der eigenen vier Wände.
Die letzte Hoffnung war Warsame, ein inzwischen eingebürgerter somalischer Koch, Anfang dreißig, der oft zum Dolmetschen herangezogen wurde und angeblich recht engen Kontakt zu Aayanas Familie pflegte. Bei einem Telefonat mit Elisa zeigte sich dieser pessimistisch:
»Ohne Bruder wird nicht gehen. Der Vater hat große Angst um sein Mädchen. Aber ich kann probieren.«
Er dürfte letztlich die richtigen Worte gefunden haben, denn Aayana richtete Sophie Luise ein paar Tage später aus:
»Danke. Vielleicht ich darf!« Aber nur unter folgender Bedingung:
»Dein Vater oder Mutter muss kommen sprechen.«
Der Vater schied von vornherein aus. Was Elisa von Anfang an verhindern wollte, war also plötzlich unumgänglich. Sie musste den Canossagang über die Donau in eine abgeschiedene Wiener Stadtrand-Siedlung antreten, wo hauptsächlich Asylanten untergebracht waren, und dort ihren persönlichen Werbefeldzug für eine Woche Gratis-Luxusurlaub mit allem Komfort für ein Flüchtlingskind führen.
Schon im Stiegenhaus wurde sie empfangen beziehungsweise abgefangen. Dort lehnte ein schlaksiger dunkelhäutiger junger Mann, dahinter stand eine gespenstisch anmutende schwarze Säule, bei der nur die Augen frei waren und aus der Umhüllung herausleuchteten.
»Guten Tag, ich bin die Mutter von Sophie Luise, und Sie sind sicher …«
Der junge Mann verbeugte sich und murmelte irgendetwas, vermutlich seinen Namen — Abdulaziz.
Die Begegnung dauerte keine drei Minuten. Die »Säule« bewegte sich langsam auf Elisa zu, kam ganz nah an sie heran und vergrößerte mit ihren Händen den Augenschlitz, um ihr Gegenüber besser und intensiver mustern zu können.
»Meine Mutter kann leider nicht sprechen«, erklärte Aayanas Bruder.
»Nicht deutsch sprechen«, präzisierte er. Und er selbst schien auch wenig Lust darauf zu haben. Die beiden zogen sich nämlich erstaunlicherweise auf einen somalischen Dialog zurück. Abdulaziz wirkte eher angespannt und war offenbar anderer Meinung als die »Säule«.
Gerade als Elisa das noch gar nicht vorhandene Gespräch aufs Thema Urlaub lenken wollte, schritt der Bursche auf sie zu und leitete die Verabschiedung ein. Er verbeugte sich und machte etwas Respektvolles oder sogar Tiefgläubiges mit seinen Händen. Die »Säule« dahinter tat es ihm gleich. Mit Worten blieben sie sparsam. Möglicherweise war ein knappes »Dankeschön« dabei. Elisa war jedenfalls heilfroh, diesen beklemmenden Besuchstermin hinter sich gebracht zu haben.
»Und was ist dabei herausgekommen?«, fragt Engelbert auf der Terrasse.
»Am nächsten Tag hat Aayana zugesagt«, erwidert Elisa.
»Warum plötzlich?«
»Keine Ahnung, vielleicht habe ich ihnen gefallen. Ich schätze, Vater und Bruder waren ohnehin dagegen, aber die vermummte Mama hat sich irgendwie durchgesetzt, man möchte es nicht für möglich halten. Kann sein, dass sie auch gern einmal schwimmen gelernt hätte …«
»Was ihr als muslimische Frau aus Ostafrika natürlich strikt untersagt war, wolltest du noch sagen«, schaltet sich Oskar ein.
»Ich wollte gar nichts dazusagen«, widerspricht Elisa.
»Ich würde an deiner Stelle momentan zu alldem nichts sagen, Oskar. Du hast Elisa das alles ganz allein machen lassen, das finde ich ehrlich gesagt nicht gerade sehr ehrenwert von dir.« Der Seitenhieb kommt von Melanie.
»Das war eine prinzipielle Sache«, erwidert Oskar.
»Wie prinzipiell? Was für ein Prinzip gibt es da?«, will Melanie wissen.
»Ich halte es hier mit Kant in seinem sehr klugen Aufsatz zur Aufklärung von 1784, oder war es 1785 …« Elisa lässt sich in ihren Sitz zurückfallen und macht die Augen zu.
»Nicht Kant. Du!«, stößt Melanie nach.
»Okay. Ich vertrete die Auffassung, dass man die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen sollte.«
»Aber man könnte Menschen gelegentlich aus den Zwängen ihres Unglücks befreien«, kontert Melanie. »Überhaupt, wenn sie noch Kinder sind.«
»Ich stelle in Abrede, dass uns das zusteht. Und ich stelle in Abrede, dass uns die Zwänge anderer Kulturen etwas angehen, wir haben genügend eigene Zwänge. Aber was tut man nicht alles für die Urlaubsfreuden des eigenen Töchterleins.« Oskar lächelt süffisant.
»Geht’s noch, Papa? Du hast ja eh nichts getan«, ruft Sophie Luise hinüber.
»Können wir mit dem Herumgehacke jetzt bitte langsam aufhören. Hey, Freunde, schaut doch einmal, wo wir hier sind. Genießen wir diesen idyllischen Platz, diese Ruhe«, schlägt Engelbert vor.
Lotte wartet noch ein paar Augenblicke, holt tief Luft und lässt dann einen ihrer gefürchteten Gewaltschreie los. Hintergrund: Die unsanft delogierte rote Riesenameise dürfte rachedurstige Geschwister auf sie angesetzt haben.
»Benjamin, tu sie ihr weg. Bitte. Schnell!«
»Mama, können wir jetzt endlich zum Swimmingpool gehen? Wozu sind wir sonst hier?«, ruft Sophie Luise in die allgemeine Aufregung hinein.
»Mama«, wiederholt sie. Elisa, versunken in ihrem Sitz, hält noch immer die Augen geschlossen und schweigt.
»Mama, hallo, huhu, wo bist du?«
Wo Mama war
Rückblende. Elisa liegt auf einer Couch. Halb neben ihr, halb auf ihr, halbnackt — ein Mann. Es ist nicht Oskar, so viel steht fest. Seine Stimme hat diesen charakteristischen, sanft kratzenden Klang, der sofort verrät, was gerade vor sich ging. Und dann raucht auch noch eine schlecht ausgedämpfte Danach-Zigarette vom Beistelltisch herüber.
»Wann fährt dein Zug?«
»Zwanzig nach Mitternacht, oder fünfundzwanzig«, haucht Elisa.
»Dann haben wir noch zwei gute Stunden.«
»Zwei sehr gute Stunden sogar, die besten für lange Zeit«, flüstert Elisa. Auch dieses beinahe lautlos triumphierende Lächeln, bei dem die Lust am Unerlaubten mitschwingt, gibt es nur in solchen Situationen.
Jetzt dreht sich der Mann auf den Rücken. Na ja, ausschließlich um das Körperliche dürfte es Elisa nicht gehen, zumindest legt sie bei ihm offenbar nicht die gleichen Maßstäbe an Athletik und Ernährungsbewusstsein an wie bei sich selbst. Aber seine Glatze glänzt lustig, sein Gesicht strahlt Wärme aus, sein Mund mit den breiten Lippen hat sogar etwas Verwegenes, und in seinem friedfertigen, etwas phlegmatischen Blick kann man gut ruhen. Die einen würden dabei einschlafen, andere schöpfen daraus ihre Energie. Elisa gehört eindeutig zu den anderen.
Stefan Schmidinger ist für sie ein gelebter Tabubruch im doppelten Sinn. Erstens schläft sie mit ihm, streng geheim, seit fast zwei Jahren, was ihr kein Mensch zutrauen würde, der sie auch nur irgendwie zu kennen glaubt.
Zweitens ist er Polizist. Politisch ist das für sie gerade noch verkraftbar, denn damals bei den Demos war er nur für Straßensperren zuständig. Und jetzt schiebt er eine ruhige Kugel im Innenministerium, in der Abteilung … der Abteilung … In welcher Abteilung? Sie weiß es nicht, sie reden nicht über die Arbeit, niemals.
Sie reden überhaupt wenig, vor allem er. Das schätzt Elisa vielleicht am meisten an ihm. Er stellt keine Fragen. Er diskutiert nicht. Er widerspricht nicht. Er will nicht klüger sein als sie. Stefan Schmidinger ist Elisas Anti-Oskar, ihre Oskar-Therapie.
Und er ist gleichzeitig die schärfste Geheimwaffe gegen ihren Mann. Denn es gibt etwas, das der Besserwisser nicht besser wissen kann als sie, weil er nämlich nichts davon weiß: Elisa hat einen Geliebten. Stefan Schmidinger, ihr Trumpf. Er ist der Grund, warum sie Oskar noch nicht verlassen hat. Er ist die Antwort auf die Frage, wie sie es schafft, die Familie noch immer zusammenzuhalten. Ein paar Jahre noch, dann ist auch Lotte alt genug für die Wahrheit und ihre logische Konsequenz.
Nach einer weiteren sehr guten Stunde fallen dann doch wieder Worte.
»Hast du etwas?«, fragt sie ihn.
»Was soll ich haben? Ich hab dich.« Er umarmt sie.
»Du hast heute so einen eigenen Blick, so ein bisschen traurig, täusche ich mich?«
»Du täuschst dich, Eli.« Er küsst sie.
»Aber irgendetwas ist doch mit dir«, sagt sie.
»Nein. Gar nichts. Nur …«
»Nur?«
»Nur gar nichts.« Er will sie küssen.
»Komm schon, sag!«
»Ich werde bald vierzig.«
»Ich auch. Das werden wir feiern.«
»Ja.«
»Aber das wolltest du nicht sagen.«
»Nein.«
»Sondern?
»Eli, ich muss langsam an die Zukunft denken.«
»Echt jetzt? Seit wann?«
»Wir können nicht ewig so weitermachen.«
»Warum nicht? Macht es dir keinen Spaß mehr?«
»Doch, enormen Spaß. Irren Spaß. Wahnsinn.«
»Na also.«
»Genau das ist das Problem.«
»Wieso?«
»Weil. Weil. Weil …« Er braucht eine halbe Stunde, um es ihr zu erklären. Dabei wäre es in einem einzigen Satz gegangen: Stefan Schmidinger will keine Frau für eine Nacht in der Woche, sondern für mindestens dreißig Tage und Nächte im Monat — okay, im Februar dürfen es ausnahmsweise nur achtundzwanzig sein.
Er ist ein wertkonservativer Mensch mit Biedermeier-Qualitäten. Er wünscht sich eine Familie mit Kindern und einem Hund und einem Gartenhäuschen mit Liebstöckl und Grillkohle.
Nach seiner Trennung von Patricia, mit der er acht Jahre liiert war, ehe sie auf seinen Inspektor-Kollegen Kramlechner umstieg, hat Elisa perfekt in seine Lebensphase gepasst. Alles war unverbindlich. Er hatte wen zum Wenig-Reden. Er hatte Intimität. Er konnte sein Selbstwertgefühl von null auf fünfzig erhöhen. Ja, es war einfach angenehm für ihn, regelmäßig Sex mit einer Frau zu haben, die Sex genau mit ihm haben wollte. Und er musste sich dabei nicht online in Reih und Glied zur Schau stellen und sich den mühsamen Versuch-und-Irrtum-Spielchen der Partnerbörsen ausliefern. Es hat einfach wirklich gut gepasst mit Elisa.
Aber jetzt will er grillen, die Kinder bewundern die Glut, der Hund bewacht die Koteletts, die Frau macht die Saucen und den Kartoffelsalat. Und diese Frau ist eher nicht, vermutlich nicht, schon vom Typ her nicht, sehr wahrscheinlich nicht, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht, also definitiv nicht — Elisa.
»Eli, ich hab wen kennengelernt.«
»Eine Frau?«
»Ja, eine Frau.«
»Musste das sein?«
Stefan lächelt. Er will sie küssen. Sie dreht sich weg.
»Warum erzählst du mir das? Ist es etwas Ernstes?«
»Das weiß ich nicht. Ich kenne sie ja noch nicht. Also fast nicht.«
»Hast du mit ihr geschlafen?«
»Aber nein, ich hab sie ja gerade erst …«
»Willst du mit ihr schlafen?«
»Nein, nein, daran hab ich eigentlich noch gar nicht …«
»Noch gar nicht gedacht? Das glaub ich dir nicht.«
»Eli, es geht mir nicht um …«
»Worum geht es dir?«
»Um … um … um …«
»Ich lausche andächtig.«
»Um die Zukunft.«
»Ah ja, die Zukunft. Genügt dir die Gegenwart nicht mehr?«
»Doch, Eli. Es ist nur … Ach, es ist ja noch gar nicht …« Er will sie umarmen.
Elisa presst die Augen zusammen. Sie spürt etwas Brennendes, Tränen, Schweiß oder eine Mischung aus beiden. Sie versucht, sich die Ohren zuzuhalten, ohne die Hände dorthin zu kriegen. Die dumpfen Geräusche rund um sie werden immer lauter, und schließlich setzt sich die Stimme ihrer Tochter Sophie Luise durch.
»Mama, hallo, huhu, wo bist du? Können wir jetzt endlich zum Swimmingpool gehen?«
Am Swimmingpool
Es ist ein prächtiger Pool, vermutlich der größte private in der gesamten Toskana mit dem tiefsten Blau, das Italien für seine Urlaubsgäste aufzubieten hat. Schon wenn man davorsteht und hineinschaut, und gar nie die Absicht hatte, ihn von innen kennenzulernen, fühlt man sich erfrischt, meint Engelbert Binder. Vielleicht ist das aber auch nur eine Schutzbehauptung, die ihm vorerst die Badehose erspart und den anderen den Anblick von Engelbert in der Badehose.
Lotte und Benjamin sind gleich hineingesprungen und spritzen und quietschen herum.
Oskar ist am anderen Ende, an dem das Becken am tiefsten ist, die kleine Treppe hineingestiegen und macht dort seltsam anmutende aufgescheuchte Bewegungen; diesen Stil nennt man Schmetterling-Schwimmen — praktiziert fast keiner, deshalb praktiziert ihn Oskar.
Elisa und Melanie haben sich Liegestühle im Schatten des mächtigen Pinienbaums aufgestellt, keine fünf Meter vom Becken entfernt, mit Blick auf die großen Kinder.
Schwimmlehrerin Sophie Luise und ihre Schülerin beginnen gerade mit dem Trockentraining auf der Luftmatratze. Da fällt ihnen Aayanas furchterregende Kostümierung erst auf. Sie sieht in ihrem Kapuzen-Anzug, der nur Gesicht, Hände und Füße ausnimmt und eher an die Montur einer Eisschnellläuferin erinnert, wie ein dünnes schwarzes Alien aus.
»Kind, ich bitte dich, zieh doch den Bikini an, den du von uns bekommen hast. Du verbrühst uns ja in dem Plastikzeug«, ruft ihr Elisa zu.
»Danke. Ich mache morgen«, erwidert Aayana und lächelt verkrampft.
»Du brauchst dich für deinen Körper nicht zu genieren, Mädel, du hast eine super Figur, da würden dich tausende Teenies drum beneiden«, sagt Melanie.
»Wir rennen hier alle so leicht bekleidet herum, wir sind unter uns, du kannst dich hier absolut frei fühlen«, fügt Elisa noch hinzu.
»Danke«, murmelt Aayana und rührt sich nicht vom Fleck.
»Lasst sie doch in Ruh’, sie will nicht«, fährt Sophie Luise energisch dazwischen. »Sie mag das nicht, wenn die Sonne auf ihre Haut scheint, hat sie mir gesagt. Sie mag nicht braun werden, sie ist schon braun genug.«
»Sie darf keinen Bikini tragen, ihre Familie hat es ihr verboten. Ihre Familie, ihr Clan und ihr Allah, nehmt das bitte zu Kenntnis, meine Damen.« Oskar hat sein Schmetterlings-Dasein im Becken unterbrochen und sich extra hierher bemüht, um kulturelle Klarheit in die Angelegenheit zu bringen.
»Wir sind nicht mehr im Mittelalter, lieber Herr Dozent«, rügt ihn Melanie.
»Wir nicht«, erwidert Oskar.
»Aber hier ist sie bei uns«, sagt Elisa.
»Bei uns zu sein heißt noch lange nicht, zu uns zu gehören oder gar uns zu gehören«, kontert Oskar.
»Aber bei uns gelten eben unsere Werte, für die wir Frauen jahrzehntelang hart gekämpft haben. Es ist unsere Pflicht, sie weiterzuverbreiten«, meint Elisa.
»Und gerade auch denen zu vermitteln, die da noch Jahre hintennach sind«, ergänzt Melanie.
»Das nennt ihr Werte vermitteln? Dass ihr dem Mädchen sagt, sie soll einen Bikini tragen, weil sie eine super Figur hat?«, spöttelt Oskar.
»Ich finde es immer wieder erstaunlich, worüber hier eigentlich diskutiert wird«, bemerkt Engelbert.
»Komm, Aayana, wir gehen jetzt ins Wasser«, sagt Sophie Luise.
»Okay. Oder morgen?«
»Nein, jetzt. Komm, wir gehen.«
»Dräng sie nicht, sie hat offensichtlich noch Angst«, ruft Melanie hinüber.
»Wir müssen einmal anfangen, sonst wird das nie was«, meint Sophie Luise.
»Okay«, sagt Aayana. »Oder später?«
Eine Stunde später
Die Sonne ist schon tief gesunken und legt einen orangen Filter über die Landschaft. Die Gruppe hat sich inzwischen großräumig aufgeteilt. Lotte konnte mit fairen Mitteln zum Schweigen gebracht werden. Sie und Benjamin quetschen sich im Kinderzimmer vor ein Tablet und bestaunen »Sea Monsters Trying Not to Get Caught«, ein pädagogisch wertvolles Video, weil die Kids dabei ja auch ein bisschen Englisch lernen.
Die Väter sitzen in Korbstühlen auf der Terrasse und degustieren einen Cuvée vom berühmten Weingut »Tenuta di Arceno«, bei dem Winzer Engelbert einen Petit Verdot herausschmecken will, was Oskar naturgemäß anzweifelt: »Ich schmecke Merlot und Cabernet Sauvignon.«
»Merlot und Sauvignon sowieso«, sagt Engelbert. (Steht im Übrigen auch auf dem Etikett.)
Elisa und Melanie sind immer noch unten am Pool in ihren hochgeklappten Liegestühlen. Sie haben synchron jeweils auf Seite eins aufgeschlagene Bücher auf ihren Bäuchen liegen. Versuche eines tiefergehenden vertraulichen Gesprächs scheitern schon im Ansatz.
Melanie: »Jetzt sag einmal, Elisa, wie geht es dir, ich meine — wirklich? Jetzt sind wir ja unter uns. Du wirkst nämlich so … so.«
Elisa: »Nein, nein, alles gut. Ich bin nur … ein bisschen. Es war viel los in letzter Zeit, viel auf einmal, weißt du.«
Melanie: »Ja, das versteh ich. Aber …«
Elisa: »Und bei dir?«
Melanie: »Bei mir? Alles gut, jaja, läuft gut.«
Elisa: »Und mit Engelbert, alles okay?«
Melanie: »Jaja, klar, alles bestens. Du kennst ihn ja. Er ist einfach, er ist so … er ist halt, wie er ist.« Sie lächelt. Es entsteht eine beklemmende Pause.
Melanie: »Elisa, was ich dich eigentlich fragen wollte … weil mir ja schon die längste Zeit auffällt … das ist ja praktisch nicht zu übersehen …«
Elisa: »Ich weiß, was jetzt kommt, Meli. Bitte, große Bitte — können wir das heute lassen, können wir vielleicht morgen darüber reden? Oder übermorgen? Ich bin heute einfach nicht mehr …«
Melanie: »Aber klar, entschuldige, das versteh ich natürlich. Ich wollte dich wirklich nicht …«
Elisa: »Weißt du, ich bin einfach …«
Melanie: »Ja, das versteh ich. Das sehe ich natürlich sofort, ich kenne dich ja.«
Ein paar Meter weiter unten, im seichten Bereich des Schwimmbeckens, läuft auch noch nicht alles nach Plan, zumindest nicht nach Sophie Luises Plan. Aayana liegt verkrampft auf einem Schwimmbrett und klammert sich an eine gelbe Plastik-Poolnudel. Alle ihre Versuche, die an der Luft erlernten Schwimm-Tempi auch im Wasser umzusetzen, sind bisher kläglich gescheitert. Und wenn Sophie Luise es wagt, sie zu berühren oder gar ihren Bauch zu umfassen, zuckt sie zusammen und strampelt mit Händen und Füßen.
»Ich kann nicht«, wimmert sie.
»Natürlich kannst du es, alle können es. Du musst dich nur trauen. Du musst deinen Körper freilassen. Du kannst gar nicht untergehen. Du musst dich richtig frei fühlen, dann geht es«, sagt Sophie Luise.
»Danke. Ich probiere.«
»Okay, dann versuchen wir es noch einmal.«
»Morgen«, sagt Aayana.
»Nein, jetzt.«
»Aber ich kann nicht.«
»Doch. Du kannst es, du schaffst es, du musst dich nur überwinden. Wenn du locker bist, kann nichts passieren. Du musst endlich locker werden, du musst dich so richtig frei fühlen, dann kannst du schwimmen, dann kannst du schweben, dann kannst du fast schon fliegen.«
»Wie ein Vogel?«, fragt Aayana.
»Ja, wie ein Vogel«, erwidert Sophie Luise. »Also fühle dich frei. Frei. Frei. Frei.«
Sonnenuntergang
Lotte und Benjamin spielen auf dem von Chips- und Kekspackungen umringten kleinen Terrassentisch Memory. Die von Lotte modifizierten Regeln sehen vor, dass die Siegerin der ersten Partie (Lotte) nun jeweils drei statt nur zwei Karten aufdecken darf, um nach den beiden gleichen Bildern zu suchen. Wir leben eben in einer Zeit, in der Erfolge zusätzlich belohnt werden, was dazu führt, dass die Sieger noch siegreicher und letztlich unschlagbar werden. Zum Glück gibt es nach wie vor gute Verlierer wie Benjamin, der zwar chancenlos, aber weiterhin mit Freude dabei ist, weil er einfach gerne Memory spielt.
Melanie verabschiedet sich auf der Anhöhe hinter dem Haus im Yoga-Lotussitz von der Sonne. Davor war sie im herabschauenden Hund und in diversen Kriegerinnen- und Heldinnen-Stellungen zu sehen.
Auch die Väter betrachten, mit Weingläsern in der Hand, den Untergang der Sonne im Meer. Er fällt wegen einer einzelnen mickrigen Schäfchenwolke, die sich offenbar keinen besseren Platz finden konnte, leider wenig spektakulär aus.
»Wenn du den besten Sonnenuntergang der Welt sehen willst, musst du einen Kamelritt in der Sahara machen«, erklärt Oskar. »Der Sand der Dünen macht aus der Sonne einen gigantischen Feuerball, der in allen Gelb- und Rot-Schattierungen strahlt.«
»Wow, das klingt großartig«, erwidert Engelbert. »Und du warst dort, du hast das echt erlebt?«
»Bist du wahnsinnig? Ich doch nicht. Was mache ich in der Sahara? Zum Beduinen bin ich nicht geboren.« Oskar lacht grell auf. »Nein, nein, das war eine Fotodokumentation von mir, auf der Uni. Es ging um Bilder, die unser Gemüt bewegen.«
»Ah so, ich verstehe. Und ich dachte schon, du warst wirklich dort, ich sah dich schon auf einem Kamel durch die Wüste ziehen, mit Strohhut und einer riesigen Telekamera um den Hals.« Jetzt lachen beide.
»Wie schmeckt dir eigentlich der Arcanum 2015?« Engelbert schwenkt mit bewegtem Gemüt sein Glas und hält die Nase hinein.
»Ja, ist okay, eine Spur zu warm, aber okay«, meint Oskar.
Elisa liegt noch immer am Pool, nickt manchmal kurz ein, wird aber von aufwühlenden Gedanken am überfälligen tieferen Schlaf gehindert. Geht es ihr gut? Lebt sie richtig? Ist es ihr eigenes Leben? Oder ist es nur das Leben für die anderen, denen sie glaubt, alles recht machen zu müssen, wie schon als Kind, um vom Vater beachtet und von der Mutter gestreichelt zu werden?
Ja, genau darauf kommt es ihr an — sie muss beachtet und gestreichelt werden. Dann geht es ihr gut, dann lebt sie richtig, dann lebt sie ihr eigenes Leben. Jetzt gerade nicht.
Sophie Luise hat nach dem abgebrochenen Schwimmunterricht etwa eine Stunde Haare geföhnt, Augen verziert, Lippen bemalt und Ähnliches, um sich in perfekte Selfie-Ausgangslage für den Sonnenuntergang zu bringen.
Jetzt sucht sie wie eine Wünschelrutengeherin nach geeigneten Plätzen mit idealen Hintergründen für den optimalen Vordergrund, für ihr One-Million-Followers-Gesicht. Ja, die Bilder werden vermutlich um die Welt gehen, und vielleicht kann sie das später einmal professionell ausüben, um ihr Geld damit zu verdienen. Es heißt ja immer, man sollte sein liebstes Hobby zum Beruf machen, dann bleibt auch der Erfolg nicht lange aus.
Eine zweite, provokantere Zoom-Serie, mit Zungen und Mittelfingern und Grimassen, also mehr in Richtung »Bad Girls«, soll dann mit Aayana entstehen.
»Wo ist Aayana eigentlich?«, fragt Melanie, die gerade vom Yoga-Ausflug zurückgekehrt ist.
»Weiß nicht, auf ihrem Zimmer, schätze ich«, sagt Sophie Luise.
»Habt ihr etwas vereinbart?«
»Nein, warum? Sie wird wahrscheinlich schlafen. War für sie sehr anstrengend heute.«
»Du musst dich aber schon ein bisschen um sie kümmern, gell«, sagt Melanie.
»Na klar, sie macht ja ohnehin keinen Schritt ohne mich.«
Irrtum. Aayana ist zunächst lange vor dem Spiegel gestanden und hat ein Mädchen angeschaut, das sie nicht kennt. Sie hat dann den rotgestreiften Bikini angezogen, zuerst verstohlen im Dunkeln, dann hat sie das Licht aufgedreht, ist noch einmal vor den Spiegel getreten, hat ihren Bauch berührt und mit der Handinnenfläche darauf Kreise gedreht. Frei, frei, frei, hat sie gedacht. Sie muss ihre Angst überwinden. Sie muss schwimmen können, dann kann sie schweben. Sie muss schweben können, dann kann sie fliegen. Einmal nur ein Vogel sein, dann würde sie alles hinter sich bringen, alles unter sich lassen. Sie würde aufsteigen, ohne schwindlig zu werden, und von oben würde sie plötzlich all das erkennen, wozu ihr die Sicht bisher verwehrt geblieben war. Mühelos würde sie diesen einen und einzigen Platz ausfindig machen, der für sie bestimmt war, und wenn er noch so klein war. Auf ihn würde sie zusteuern, lautlos, locker und frei. Punktgenau auf ihm würde sie landen. Dort würde sie sich geborgen fühlen. Dort wäre sie daheim. Dort bräuchte sie keine Flügel mehr. Dort müsste sie kein Vogel mehr sein. Dort wäre sie ein Mensch, den es nur einmal gibt. Dort fände sie zu sich. Dort fände sie sich, Aayana.
Und dann hat sie barfuß ihr Zimmer verlassen, hat sich an der hell beleuchteten Terrasse vorbeigeschlichen, hat die Stimmen hinter sich gelassen, ist über die Böschung auf feuchtem und kühlem Gras hinabgestiegen ins Finstere. Das Schwimmbecken hat seine Farbe gewechselt, dunkelviolett ist es ihr schon auf halbem Weg entgegengekommen. Jetzt steht sie davor und weiß, was sie sich schuldig ist und worin die Chance auf ihre Freiheit besteht.
Auf dem Liegestuhl liegt noch immer die fremde Frau, zu der sie »Elisa« sagen darf. Ihr Kopf ist ihr zugewandt, aber sie rührt sich nicht, wahrscheinlich schläft sie. Aayana muss ganz leise sein, um sie nicht aufzuwecken. Sie steigt vorsichtig ins Becken, das Wasser fühlt sich warm an. Sie findet mit ihren Füßen sogleich festen Halt auf dem Boden. Sie streckt die Arme vor, macht in der Luft noch einige Bewegungen, wie Sophie Luise es sie gelehrt hat. Dann lässt sie sich sachte nach vorne fallen, die Beine kippen automatisch in die Höhe. Jetzt liegt sie mit dem Bauch auf dem weichen violetten Spiegel, der Kopf bleibt darüber, Hände und Beine beginnen sich wie von selbst zu bewegen. Keine Angst mehr vor Nacht und Wasser. Locker bleiben. Frei sein. Schwimmen. Schweben. Fliegen. Alle können es. Alle schaffen es. Sogar Aayana.
Untergang
Oben auf der Terrasse ist ein kleiner Abendimbiss angedacht. Den Herren würde eine Wein-Begleitung, also eine etwas festere Unterlage, auf der sich der Wein dann weiter begleiten ließe, jedenfalls gut zu Gesichte stehen. Lotte zappelt bereits herum und wirft mit Memory-Karten nach Benjamin, der sie zuletzt nicht einmal mehr mit Niederlagen belustigen konnte, zu groß war der Klassenunterschied.
Man sollte vielleicht auch einmal nach Elisa schauen, um sie vom Liegestuhl abzuziehen, ehe sie sich dort noch verkühlt.
Sophie Luise kommt gerade von Aayanas Zimmer zurück. Sie wollte sie aufwecken und zum abendlichen Fotoshooting animieren. Nun aber wirkt sie eher ratlos, denn sie muss vor versammelter Runde erklären: »Aayana ist nicht da.«
»Was heißt nicht da?«, fragt Melanie.
»Nicht auf ihrem Zimmer.«
»Wo ist sie dann?«
»Ich weiß es nicht.«
»Wahrscheinlich auf der Toilette«, sagt Oskar.
»Hab ich nachgesehen, da ist sie nicht«, entgegnet Sophie Luise.
»Hast du sie schon angerufen?«, fragt Engelbert.
»Ihr Handy liegt auf dem Bett, sie kann also nicht weit sein.«
»Dann schlage ich vor, wir suchen sie schnell alle zusammen«, sagt Engelbert.
»Vielleicht ist sie wo gestolpert, hat sich den Fuß verknackst und kann nicht auftreten«, meint Melanie.
»Du musst natürlich gleich wieder das Schlimmste annehmen«, erwidert Engelbert.
Elisa im Liegestuhl ist in den Schlaf gestreichelt worden. Sie spürt Stefans Hand auf ihrer Wange.
»Eli, ich …«