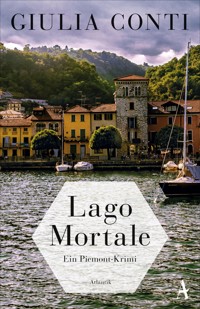13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Krimi
- Serie: Camilla di Salvo ermittelt
- Sprache: Deutsch
Das idyllische Turin, die FIAT-Dynastie und ein mysteriöser Mord am Ufer des Po Turin im Frühjahr: der Po führt nach einem schneereichen Winter viel Wasser, die Temperaturen steigen und die Stadt erwacht zu neuem Leben. Camilla di Salvo, eine junge Psychologin mit gutgehender Praxis, freut sich auf einen wunderschönen Sommer. Als aber die Leiche einer Frau im roten Kleid am Ufer des Po gefunden wird, die als die stadtbekannte Ehefrau eines FIAT-Funktionärs identifiziert wird, geht ein Beben durch die Stadt und Camilla wird unfreiwillig zur Ermittlerin. Ihr untrügliches Gespür für die Abgründe im Menschen ziehen die Psychologin immer tiefer hinein in ein Netz aus Intrigen, dessen Fäden vom FIAT-Konzern aus gesponnen werden und sie auf eine brandgefährliche Spur leiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Giulia Conti
Die Frau in Rot
Ein Turin-Krimi
Prolog
Aus der Ferne sah sie aus wie eine achtlos weggeworfene Schaufensterpuppe, in einer warmen Dezembernacht unter eine Brücke am Po auf den Müll gekippt, zwischen leere Bierdosen, Pizzakartons, Kippen und Plastiktüten, gar nicht weit weg von der aristokratischen Piazza Vittorio Veneto und dem historischen Zentrum Turins. Eine überdimensionierte Barbie mit fließendem blondem Haar und in eine rot eingefärbte, edle Pelzjacke gehüllt, darunter ein festliches rotes Seidenkleid, die Taille eng von einem silbrig glänzenden Gürtel geschnürt, der Rock plissiert, die weißen Beine darunter eigenartig verdreht. Das war der erste Eindruck. Bei näherem Hinsehen erkannte man eine nicht mehr ganz junge Frau, vielleicht Mitte vierzig, ein paar Falten im schmalen Gesicht. Sie musste schön gewesen sein, und sie wirkte trotz ihrer puppenhaften Aufmachung elegant. Die noch jungen Beine hatten in Stilettos gesteckt, die teuer aussahen und jetzt mit in den Himmel stechenden Absatzspitzen wie zufällig hingeworfen neben ihr lagen. Wenn man noch genauer hinsah, entdeckte man in ihrem hellen Haar das Blut, dunkelrot und verkrustet. Man würde die tote Frau la Signora in rosso, die Frau in Rot nennen.
1
»Wollen Sie zu mir?«
»Sind Sie Dottoressa di Salvo?«, kam es zurück.
Ich schaute in bernsteinfarbene Augen, die mich erwartungsvoll ansahen und zu einer vollkommen durchnässten jungen Frau gehörten, die vor mir auf der Treppe saß. Aus ihrem blonden Pagenkopf tropfte es wie aus einem undichten Wasserhahn, und unter ihr hatte sich schon eine kleine Lache gebildet. Seit einer Woche schüttete es in diesen Märztagen wie aus Eimern. Ein Hundewetter, das auch mich an diesem Morgen auf dem Weg in meine Praxis in der Turiner Altstadt, dem Quadrilatero Romano, trotz Regenschirms noch erwischt hatte. Aber das war kein Vergleich zu dem triefenden jungen Mädchen, das dort auf den Stufen kauerte, fröstelnd und verloren.
Ich nickte. »Ja, warum?«
»Ich habe auf Sie gewartet.«
Das passte mir gar nicht. Dafür hatte ich keine Zeit. Ich war spät dran und wollte möglichst schnell in mein Sprechzimmer, denn in gut zwanzig Minuten würde meine erste Patientin kommen. Eigentlich konnte ich der ungebetenen Besucherin nur einen Gesprächstermin zu einem anderen Zeitpunkt anbieten oder sie an die Ambulanz des psychoanalytischen Instituts verweisen, denn unangemeldet konnte ich keine Patienten annehmen. Stopp, Camilla, meldete sich aber eine innere Stimme, du lieferst gerade kein Glanzstück deines Einfühlungsvermögens! Natürlich würde ich meinen Unmut beiseiteschieben und sehen, was ich für sie tun konnte. Ohnehin bin ich zuweilen großzügig im Umgang mit den strengen Regeln meiner Zunft und höre im Zweifelsfall auf mein Gefühl. Erst später kam mir die Erkenntnis, dass es vielleicht doch besser gewesen wäre, die junge Frau wegzuschicken. Dann wäre mir einiges erspart geblieben.
»Wenn Sie gekommen sind, weil Sie eine Therapeutin suchen«, sagte ich, und als sie nickte, fuhr ich eilig fort, um angesichts meines ohnehin zu großen Patientenstamms gar nicht erst falsche Erwartungen bei ihr zu wecken, »dann muss ich Sie enttäuschen.« Setzte jedoch versöhnlich hinzu: »Aber kommen Sie einen Moment mit herein. Dann können Sie sich abtrocknen, und ich gebe Ihnen ein paar Adressen von Therapeuten, an die Sie sich wenden können, um einen Termin für ein Erstgespräch zu vereinbaren. Natürlich nur, wenn Sie das wollen.«
Im Flur bedeutete ich ihr zu warten und holte ein Handtuch aus meinem kleinen Badezimmer. »Nehmen Sie das und geben Sie mir Ihre Jacke. Die hänge ich kurz über die Heizung, wenn Sie einverstanden sind.« Ich wartete ihre Antwort nicht ab und griff zu einem Bügel. »Wie heißen Sie eigentlich?«, fragte ich noch.
»Alba.«
»Und wie weiter?«
»De Magris, Alba de Magris.«
Der Name sagte mir etwas. Wo hatte ich ihn nur schon einmal gehört? Es fiel mir nicht ein, und es war mir eigentlich auch egal, denn es galt jetzt, keine Zeit zu verschwenden. Ich machte der jungen Frau mit dem schönen Namen Alba ein Zeichen, und sie folgte mir in mein Sprechzimmer. Der große Raum ist mit seinen zwei hohen Fenstern zur Straße licht und eher nüchtern eingerichtet, aber dennoch behaglich. Als ich die Praxis übernommen habe, hatte ich ein klares Bild vor Augen: Weder zu klinisch noch zu persönlich sollte sie sein, und meine Patienten sollten sich im Sprechzimmer wohlfühlen, ohne dass es zu viel von mir verriet. Das ist mir, wie ich finde, auch ganz gut gelungen. Neben der unverzichtbaren Couch stehen auf dem alten Dielenboden zwei Ledersessel und mein Schreibtisch, ein antikes Schmuckstück aus Kirschholz, das ich an einem Sonntag vor ein paar Jahren auf dem Gran Balon, dem monatlich stattfindenden Antiquitätenmarkt von Turin, entdeckt habe. An die Wände habe ich nicht die üblichen Blumenkunstdrucke gehängt, wie man sie vorzugsweise in Krankenzimmern findet, da sie angeblich die Stimmung der Patienten aufhellen, sondern poetische Schwarz-Weiß-Fotografien von Pietro Donzelli, die er in den Nachkriegsjahren in der Po-Ebene aufgenommen hat und die die Schönheit der noch weitgehend unberührten Landschaft und das karge Leben der Menschen zeigen. Ein Italien zwischen Tradition und dem Aufbruch in die Moderne. Außerdem hängt dort eine bunte Karikatur, die Sigmund Freud mit einer dicken Zigarre in der Hand darstellt und die mir mein guter Freund Ennio zum Einstieg geschenkt hat. »Der ist ja sozusagen dein Staatspräsident, und den hängt man sich doch an die Wand, oder?«, hatte er schmunzelnd dazu bemerkt.
Meine Besucherin steuerte auf die mit dunkelrotem Samt bezogene Couch zu, während ich schon an meinem Schreibtisch saß.
»Nein«, stoppte ich sie und deutete auf den Sessel, der unter einem der beiden Fenster steht, während ich in einer Schublade hastig nach ein paar Unterlagen suchte. Der Regen prasselte währenddessen weiter gegen die Scheiben, und draußen am Himmel ballten sich die Wolken so tiefschwarz, dass es trotz der großen Fenster ganz düster im Raum wurde und ich das Licht anmachen musste.
Dem schlechten Wetter war auch meine Verspätung an diesem Donnerstagmorgen geschuldet, denn ich war auf dem Weg zu meiner Praxis beim Überqueren der Via Po ausgerutscht und umgeknickt. Der Knöchel hatte so wehgetan, dass ich mich einen Moment unter den Arkaden hinsetzen musste, bis der Schmerz langsam nachließ. Dadurch hatte ich einige Minuten verloren. Ein Grund mehr, die Begegnung mit der jungen Frau möglichst kurz und formell halten.
Aber kaum, dass sie saß, kamen ihr die Tränen, und sie schien mit dem Weinen gar nicht mehr aufhören zu können. Ich beobachtete sie schweigend, reichte ihr ein Taschentuch. Davon habe ich immer einen großen Vorrat griffbereit, denn dass Patienten im Verlauf der Sitzung in Tränen ausbrechen, kommt nicht selten vor.
Sie putzte sich etwas umständlich die Nase, und ich sah ihr schweigend dabei zu. Während sie weiter leise vor sich hin weinte, bündelte ich meine spontanen Eindrücke. Die allererste Begegnung mit potenziellen Patienten ist stets besonders aufschlussreich, nicht nur, was sie, sondern auch was mich selbst angeht, mein Verhalten, meine Gefühle und meine Reaktionen. Von Anfang an habe ich mir angewöhnt, meine ersten Wahrnehmungen unmittelbar nach den Terminen zu notieren, in den zehn Minuten Pause, die mir jeweils zwischen zwei Patienten bleiben. Wir sind Zaungäste, so hat eine ältere Kollegin einmal unsere Haltung gegenüber den Patienten beschrieben. Wir beobachten sie, hören uns ihre Geschichten an und versuchen, darin die unbewussten Vorstellungen, Bedürfnisse, Ängste und emotionalen Muster zu erkennen. Wir sind ein Gegenüber, das Abstand hält und doch mitfühlt.
Auch bei Alba de Magris schaute ich genau hin, obwohl ich entschlossen war, sie nicht als Patientin aufzunehmen. Als Erstes war mir ihre Kleidung ins Auge gefallen. Ein heller, glockig fallender Rock, darüber ein gut geschnittener blauer Blazer und edle weiße Sneaker, das sah fast wie eine Internatsuniform aus, jedenfalls ziemlich brav und nach einem wohlhabenden Elternhaus. Sie weinte immer noch, mit dem zerknüllten Taschentuch in der Hand, und so wie sie auf dem Sessel saß, steif und weit vorne, wirkte sie auf mich sehr unsicher. Aber da war noch etwas anderes. Etwas, das mich eigenartig berührte. Ich hätte nicht sagen können, was es war, hatte höchstens eine vage Ahnung, dass es nicht zu ihrer verlorenen Ausstrahlung passte. Wer war diese junge Frau? Was war mit ihr? Versteckte sich hinter ihrer Schüchternheit eine unvermutete Kraft? Immerhin hatte sie den Mut gehabt, einfach in meine Praxis zu platzen. Vorsicht, Camilla, bremste ich mich, urteile bloß nicht vorschnell! Ich konzentrierte mich wieder auf meine Beobachtungen. Wie alt mochte sie sein? Maximal zwanzig, schätzte ich. Vielleicht war sie keine Schülerin und lebte auch nicht mehr bei ihren Eltern. Das Auffälligste an ihr war zweifellos ihre große und eigenwillig gekrümmte Nase, an der mein Blick hängenblieb. Wahrscheinlich fiel sie mir auch deshalb besonders auf, weil Albas nasse Haare am Kopf anhafteten und ihr Gesicht dadurch ganz offen lag. War sie mit dieser Nase zur Welt gekommen oder war da erst später etwas passiert? Ein Unfall? Oder hatte gar jemand zugeschlagen? Natürlich konnte es auch eine harmlosere Erklärung geben, vielleicht war die auffällige Nase das Ergebnis einer missglückten Korrektur? Jedenfalls stand sie ihr gut, verlieh ihrem sonst eher unscheinbaren Gesicht mit seinen schmalen Zügen und hellen Augen etwas Faszinierendes.
Endlich hörte sie auf zu weinen. Ich hatte die ganze Zeit geschwiegen, sah sie auch weiter nur an, und sie blieb ebenfalls stumm. Mein Knöchel schmerzte noch, was ich zu ignorieren versuchte, aber jetzt griff ich doch unter den Schreibtisch, um diskret die angeschwollene Fessel zu massieren. Alba hielt das Infoblatt, das ich ihr schon gegeben hatte, noch in der Hand, hatte aber bisher keinen Blick darauf geworfen. Dann hob sie mit einem Mal abrupt den Kopf und sagte leise: »Darf ist Sie etwas fragen?«
Ich nickte.
»Sie haben doch bestimmt von der Frau in Rot gehört?«
Ich nickte erneut, wurde schlagartig neugierig und vergaß meinen Vorsatz, mich nicht auf ein Gespräch mit ihr einzulassen. Stattdessen fragte ich mich gespannt, was nun kommen würde.
»Das ist meine Mutter.«
Im selben Moment wusste ich, woher ich ihren Namen kannte, und sofort war alles da, die ganze Geschichte. »Das tut mir sehr leid«, sagte ich, und es war keine Floskel. Als wäre es gestern gewesen, hatte ich die alten Schlagzeilen wieder vor Augen: Tote Frau am Po-Ufer gefunden hatte La Stampa in fetten Lettern getitelt und kurz darauf gefragt: Die Frau in Rot: grausam ermordet? Die Mutter des jungen Mädchens war vor ein paar Monaten – ich meinte mich zu erinnern, dass es im Dezember gewesen war – in der Nähe der Muretti, eines Szeneviertels an den Dämmen des Po-Ufers, tot aufgefunden worden, wahrscheinlich ermordet. Die Medien hatten ihr das Etikett der Signora in rosso, der Frau in Rot verpasst, weil sie ein auffälliges rotes Abendkleid trug, als man ihre Leiche unter einer Brücke zwischen Müllresten entdeckte. Es war der Beginn eines sich tagelang hinziehenden Medienspektakels, denn die Tote war nicht irgendwer, sie war die Frau eines Mannes aus der Führungsetage von Fiat, und im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie schon länger ein Doppelleben geführt hatte: tagsüber als gut situierte, wohlanständige Turiner Bürgerin, nachts als Femme fatale unterwegs in zwielichtigen Milieus, so jedenfalls die Berichterstattung. Auch ich hatte – das musste ich zugeben – die Sensationsartikel mit Neugier verfolgt. Überhaupt üben Verbrechen eine eigenartige Faszination auf mich aus und wecken meinen Ermittlerinstinkt. »Wie lange ist das jetzt her?«, fragte ich.
»Es ist im Dezember passiert, kurz vor Weihnachten, ziemlich genau vor drei Monaten. Da wurde sie am frühen Morgen unter einer Brücke am Po gefunden. Mit gebrochenem Genick. Aber das wissen Sie ja bestimmt alles aus der Zeitung, oder?«
»Ich habe das gelesen, ja, aber an die Details kann ich mich nicht mehr erinnern. Sie ist ermordet worden, nicht wahr?«
»Davon bin ich überzeugt. Aber die Polizei hat den Täter nicht gefunden und die Ermittlungen vor kurzem eingestellt. Die vermuten, dass es doch Selbstmord war. Dass sie sich von der Brücke gestürzt hat. Ich glaube das nicht. Aber ich kann mich an das, was in diesen Tagen passiert ist, überhaupt nicht mehr erinnern. Da ist einfach ein großes Loch. Und dass ich nicht weiß, was passiert ist, macht mich ganz krank. Schlimm ist es vor allem nachts. Und deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Heute Nacht war es wieder besonders furchtbar …«
Sie war eine Weile gefasst geblieben, aber jetzt versagte ihr die Stimme, und sie brach erneut in Tränen aus. Ich reichte ihr ein weiteres Taschentuch, wurde aber mit Blick auf die Uhr langsam richtig unruhig, ärgerte mich, dass ich mich doch zu einem Gespräch mit ihr hatte hinreißen lassen. Und so leid mir die zweifellos hilfsbedürftige junge Frau tat, musste ich das abbrechen, denn in wenigen Minuten würde meine erste Patientin kommen. »Hören Sie, Alba«, sagte ich, »es tut mir leid, aber gleich beginnt meine Sprechstunde, und ich muss Sie leider verabschieden.« Ich unterbrach mich, überlegte einen Moment, ob ich ihr doch noch einen Vorschlag machen sollte, und entschied mich dann immer noch etwas zögernd dafür. »Aber wenn Sie wollen«, sagte ich, »kommen Sie am Montag noch einmal wieder.« Ich griff schon zu meinem Terminkalender, den ich noch ganz altmodisch auf Papier führe. »Wie wäre es am Nachmittag um 17 Uhr«, schlug ich vor, »dann habe ich ein bisschen mehr Zeit für Sie. Dass Sie eine Therapie beginnen wollen, ist ganz sicher eine gute Entscheidung. Lassen Sie uns also am Montag weitersehen, wie und wo das möglich wäre …«
Eigentlich war mir schon in diesem Moment vollkommen klar, dass ich ihr dieses Angebot zwar in erster Linie aus Mitgefühl und professioneller Verantwortung machte, dass dabei aber auch meine Neugier auf den mysteriösen Fall der Frau in Rot mitspielte. Trotzdem hatte ich nach wie vor nicht im Sinn, die junge Frau als Patientin aufzunehmen, und dabei sollte es auch bleiben.
Alba hörte sofort auf zu weinen, nickte heftig, und zum ersten Mal, seit ich sie auf der Treppe aufgelesen hatte, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Mit dem ungelesenen Infoblatt in der Hand stand sie auf, überlegte wohl einen Moment, ob sie mir zum Abschied die Hand geben sollte, aber als ich hinter meinem Schreibtisch sitzen blieb und ihr ebenfalls nur zunickte, verharrte sie kurz mitten im Raum, griff zu ihrem Taschentuch, putzte sich noch einmal ihre große Nase, verabschiedete sich leise, verließ dann das Sprechzimmer und verschwand nach draußen in den Regen.
2
Das Hundewetter wollte einfach nicht aufhören. Wieder hatte der Regen die ganze Nacht durch geprasselt und mich nicht in Ruhe schlafen lassen. Um drei Uhr morgens war ich aufgewacht, hatte mich mindestens eine volle Stunde in den Laken hin und her gewälzt und das Gedankenkarussell nicht anhalten können. Ich hatte meinen Patienten hinterhergegrübelt, aber vor allem war mir der spontane Besuch von Alba de Magris nicht aus dem Sinn gegangen. Auch ihre Mutter ließ mich nicht los. Wer war sie gewesen? Ein Fall für mich und meine Couch oder nur eine unkonventionelle Frau, die gegen die guten Sitten ihrer Klasse verstieß, sich gegriffen hatte, was sie vom Leben bekommen konnte? Wie Schlaglichter waren mir wieder die Fotos vor Augen getreten, die die meist reißerischen Zeitungsartikel begleitet hatten: die Signora im eleganten Kostüm an der Seite ihres Mannes, dann mit blonder Mähne im roten Glitzerkleid, und schließlich ihr mit einem Tuch bedeckter schmaler Körper unter der Brücke am Fluss, inmitten von schmutzigen Pfützen und Müll. Was für ein Leben und was für ein Tod! Die Bilder gingen mir nicht aus dem Kopf, aber irgendwann war ich endlich wieder weggedämmert, bis mich der Wecker um halb sieben aus dem Tiefschlaf riss.
Ich schaltete den Alarm aus, drehte mich unwillig auf die Seite, schlang die Bettdecke enger um mich, schloss die Augen, aber ich wusste, dass ich doch nicht mehr einschlafen würde. Als ich eine Viertelstunde später, noch im Nachthemd und auf nackten Füßen, zum Fenster ging, die Läden öffnete und in den Regen hinausschaute, überkam mich schlagartig der Widerwille gegen die Welt da draußen, die nassgraue Stadt, das Getriebe, den Ernst des Lebens und die Verantwortung, die mein Beruf mit sich brachte, und die Versuchung, mich zurück in die warmen Kissen zu legen, meine Termine abzusagen und mich von all dem wegzuträumen, war groß. Und vielleicht wäre ich an einigen dieser unbehaglichen Märzmorgen tatsächlich besser im Bett geblieben. Jedenfalls kam mir in den kommenden Wochen immer mal wieder dieser Gedanke.
Draußen wurde es gerade hell, unter einem bleigrauen Himmel, aus dem der Regen trommelnd auf die Uferstraße fiel und schon riesige Pfützen gebildet hatte, durch die in der erwachenden Stadt ein Auto nach dem anderen pflügte und Wasserfahnen produzierte, die sich mit einem Schwall auf den noch menschenleeren Bürgersteig ergossen. Es war der 17. März und ein Freitag, eine Kombination, die in der zutiefst abergläubischen Stadt als ein Unglücksdatum gilt und mir eigentlich ein Vorwand hätte sein können, doch noch dem ersten Impuls dieses Morgens zu folgen und mich zu verkriechen, allen und allem aus dem Weg zu gehen, das Haus nicht zu verlassen. Aber nein. Der Gedanke war zwar verlockend, da ich jedoch alles andere als abergläubisch bin, wollte ich dieser lächerlichen Anwandlung doch nicht folgen. Das war eher etwas für Franca, meine beste Freundin. Die handelte nach der Maxime: »Abergläubisch zu sein, ist etwas für Idioten, aber es nicht zu sein, bringt Unglück!«, und ließ sich auch an Tagen mit einem weniger unheilvollen Datum von einer Wahrsagerin gleich um die Ecke ihres Cafés die Karten lesen und stellte dann ihren gesamten Tagesablauf auf deren Prognose ab. Ich hatte es aufgegeben, ihr das ausreden zu wollen, ja, ihr überhaupt mit meiner Vernunft, die sie leidig nannte, zu kommen. Allerdings hatte ich an diesem verregneten Turiner Freitagmorgen nicht die geringste Vorstellung davon, wie nah ich selbst, die rational denkende Psychoanalytikerin, in den kommenden Tagen der Welt des Aberglaubens kommen würde.
Von meiner Wohnung im zweiten Stock habe ich einen guten Blick auf den Po, der nur etwa fünfzig Meter entfernt dahinfließt, normalerweise ziemlich träge, jetzt aber raste er, bildete hier und da sogar ein paar Wirbel und Stromschnellen, und Plastikmüll, Blätter und Zweige, ganze Baumstämme trieben über das Wasser, manche blieben an den Brückenbögen hängen, verkanteten sich, rissen sich dann wieder los und verschwanden mit der Strömung. Es kam mir so vor, als ob der Flusspegel wieder um einige Zentimeter gestiegen war, und viel fehlte nun nicht mehr, bis er über die Ufer treten würde. Und so ging in diesen Märztagen wieder einmal die Angst vor einem Hochwasser um. Niemand in Turin hatte vergessen, wie es ein paar Jahre zuvor gewesen war, als die reißenden Fluten die Ufer überschwemmt hatten, Turin von der Außenwelt abgeschnitten und den Flughafen lahmgelegt hatten. Außer Valentino und Valentina hatte es keine Opfer gegeben, und das waren bloß Schiffe. Wenn auch zwei sehr beliebte, traditionelle Ausflugsboote, mit denen man wunderbar auf dem Po herumschippern konnte. Tempi passati. Der aufgewühlte Fluss hatte beide Schiffe aus der Vertäuung gerissen, sie waren führungslos ein paar Hundert Meter weggetrieben und schließlich gegen eine Brücke gekracht. Danach waren sie nicht mehr seetüchtig und auch nicht reparabel, und ein Ersatz war nicht in Sicht.
Für mich hatte das auch das Ende einer Familientradition bedeutet, denn bis dahin hatte ich über lange Zeit hinweg immer am ersten Sonntag des Monats mit meinem Großvater eines der beiden Schiffe bestiegen, bei jedem Wetter und in fast jeder Verfassung. Ach, der nonno. Beim Gedanken an ihn regte sich sofort mein schlechtes Gewissen. Im Stress meines beruflichen Aufbruchs fand ich einfach zu wenig Zeit für ihn, der nun schon Mitte siebzig war. Seit ich vor vielen Jahren bei meinen Großeltern ausgezogen bin und meine Großmutter viel zu früh gestorben ist, lebt er allein, ist aber angeblich nicht einsam und tatsächlich noch sehr rege. Er hat nicht wenige Freunde, meist ehemalige Arbeitskollegen, und heute sehe ich das alles etwas gelassener, doch damals glaubte ich ihm nicht ganz, vermutete, dass er mich nicht zusätzlich belasten wollte. Vielleicht fehlte er mir aber auch mehr als ich ihm.
Eigentlich hatten wir das Schiffsritual durch ein anderes ersetzt, denn stattdessen lud er mich einmal im Monat zu sich nach Hause zum Abendessen ein, das dann immer nach Sizilien schmeckte. Dort kommt er ursprünglich her, aus einem kleinen Dorf bei Modica, das er in den frühen sechziger Jahren verlassen hatte, um erst in Deutschland in München, dann in Turin in der Automobilindustrie, bei BMW und bei Fiat, als Fließbandarbeiter sein Geld zu verdienen. So wie viele andere, die damals aus dem Süden in den Norden Italiens kamen und Turin zu einer Millionenstadt und zu der Stadt mit den meisten Sizilianern außerhalb Siziliens machten. Der nonno ist bis heute in einer Arbeitersiedlung im Stadtteil Mirafiori zu Hause, im Süden der Stadt, wo die Weltfirma ihre legendären Autos produziert hat und wo immer noch ein großer Firmensitz ist. Wenn ich ihn besuche, ist es für mich, die ich mich sonst im relativ überschaubaren Turin mit dem Fahrrad und meistens nur in dessen barockem Zentrum bewege, immer eine Reise in eine ganz andere Welt, nicht nur wegen der Entfernung.
Ich sah auf die Uhr und riss mich vom Anblick des wilden Flusses und den Gedanken an meinen Großvater los, eilte ins Badezimmer, duschte minutenlang sehr heiß, putzte mir die Zähne, fuhr mir noch schnell mit dem Kamm durch mein kurzes dunkles Haar und schminkte mir die Lippen dunkelrot – so viel Zeit musste sein. Im Spiegel entdeckte ich eine Falte, die ich vermutlich dem ruhelosen Herumwälzen in den Kissen verdankte und die sich bald wieder glätten würde. Oder auch nicht, denn warum sollte mein anstrengender Alltag auf Dauer keine Spuren hinterlassen? Hinter mir lag mal wieder eine aufreibende Woche. Der Besuch von Alba de Magris am Tag zuvor war nur das letzte Glied in einer Kette belastender Ereignisse gewesen. Angefangen hatte es damit, dass ein ehemaliger, mir lieb gewordener Patient plötzlich an einem Schlaganfall verstorben war, wie ich von seiner Frau erfuhr. Dann hatte ich vor drei Tagen einen meiner Patienten, der an einer Depression erkrankt war, mit seinem Einverständnis in die Psychiatrie einweisen müssen, da er sich selbst als suizidgefährdet einschätzte. So etwas passiert nicht allzu häufig, aber es gehört zu meinem Beruf, immer wieder entscheiden zu müssen, wann der Moment gekommen ist, wo Gespräche und Medikamente an eine Grenze kommen und an stationärer Behandlung kein Weg vorbeiführt. Und manchmal werde ich ganz unerwartet in eine solche Situation geworfen, wie bei diesem Patienten, der plötzlich in eine Krise geraten war. Gottlob war wenigstens mein Sturz auf der nassen Via Po am Vortag gut ausgegangen, und der Knöchel tat nicht mehr weh. In Gedanken überflog ich, welche Termine in meiner Praxis anstanden, ob auch dieser Freitag, der 17. ein schwieriger Tag werden könnte. Nein, das waren alles Patienten, die auf einem guten Weg waren. Noch ein letzter eiliger Blick in den Spiegel – ich hatte gar nicht gemerkt, wie viel Zeit über meinen Gedanken im Badezimmer vergangen war –, dann schlüpfte ich in das, was meine Arbeitskleidung ist, einen leichten Pullover und einen meiner eleganten, aber bequemen Hosenanzüge, warf meinen Regenmantel über, ergriff meine Handtasche und einen Regenschirm und verschwand nach unten in die Bar.
»Buongiorno, Dottoressa, Sie sehen aber müde aus«, begrüßte Matteo mich wie immer gut gelaunt und stellte mit Schwung einen Cappuccino und eine duftende Brioche vor mich auf die Theke.
»Sie waren auch schon mal galanter«, erwiderte ich lächelnd, griff zu meiner Tasse, nahm einen großen Schluck, tunkte die Brioche hinein und biss ein Stück ab.
»Das steht Ihnen aber gut«, setzte Matteo schmunzelnd nach und verschwand wieder zu seiner Espressomaschine. Matteo ist einer dieser Baristas, wie man sie an einem solchen Ort in Italien erwartet, mit schnellen, perfekt sitzenden Handgriffen am Siebträger der glänzenden Maschine, dem routinierten Zugriff auf die Tassen und das Gebäck in der Vitrine, seinen locker hingeworfenen Sprüchen und einer Freundlichkeit, die niemandem zu nahe tritt, aber auch nicht aufgesetzt ist. Am frühen Morgen ist in seiner Bar stets viel los, auch wenn sie gar nichts vom Charme der historischen Kaffeehäuser hat, für die Turin berühmt ist, diesen opulenten Genusstempeln, wo man auf mit rotem Samt gepolsterten Stühlen an Marmortischen sitzt und unter Stuckdecken und holzgetäfelten, mit Spiegeln geschmückten Wänden seinen caffè oder ein Glas Weißwein trinkt. Matteos Bar liegt im Erdgeschoss meines Wohnhauses, einem sechsstöckigen Altbau im nah am Po gelegenen Viertel Crimea, und sie besteht nur aus einem nüchternen großen Raum mit ein paar Plastiktischen und einer schier endlosen Theke, hinter der die Espressomaschine um diese Zeit ununterbrochen zischt und brummt. Die meisten Gäste wohnen in der Nähe und machen auf dem Weg zur Arbeit dort nur kurz halt, um im Stehen einen Espresso zu kippen, dazu vielleicht wie ich eine Brioche zu essen und einen schnellen Blick auf die Schlagzeilen der neuesten Ausgabe von La Stampa zu werfen. Man kennt und begrüßt sich, wechselt ein paar Worte, eigentlich immer über das Wetter und in den Tagen damals natürlich auch über das befürchtete Hochwasser.
»Buongiorno, Camilla, come va? Che tempo brutto!« Das war Vittorio, mein Nachbar aus dem zweiten Stock, der sich zu mir an die Theke gesellt hatte. Vittorio war mehr als ein Jahrzehnt älter als ich, lebte Wand an Wand mit mir in einer riesigen und sehr luxuriösen Wohnung und trat immer elegant in Anzug, blassblauem Hemd und Krawatte auf. Seit kurzem hatte er einen jungen Hund, den er im Tierheim gefunden hatte, einen sehr lieben Terrier namens Cesare, den ich hin und wieder ausführte, wenn er selbst keine Zeit dafür fand, weil in seinem Software-Unternehmen zu viel los war.
»Nimmst du etwa trotzdem dein Fahrrad?«, fragte er, und es war genau die Frage, die ich mir selbst gerade stellte und mit einem schnellen Blick durch die Fenster der Bar auf den Dauerregen entschied. »Nein, ich gehe zu Fuß.«
»Ich kann dich auch ein Stück mit dem Auto mitnehmen.«
»Nein, nein, vielen Dank, Vittorio, das ist sehr nett von dir, aber das geht schon in Ordnung, wir sind ja in Turin.«
Das war eine Feststellung, die Vittorio sofort verstand, die sich für Ortsfremde aber ziemlich rätselhaft anhören würde, denn dazu müsste man wissen, dass Turin mit seinen Arkaden, die sich durch das historische Zentrum ziehen – immerhin über eine Länge von insgesamt achtzehn Kilometern –, für Regentage wie gemacht ist, da man auch dann dank ihres Schutzes zumindest halbwegs trockenen Fußes durch weite Teile der Innenstadt kommt.
»Va bene, Camilla, dann nicht. Ich muss jetzt los«, sagte Vittorio und trank den letzten Schluck von seinem Espresso. »Ci vediamo. Übrigens hat Cesare Sehnsucht nach dir.«
»Ich auch nach ihm«, gab ich zurück. »Wie sieht es denn aus? Morgen Nachmittag hätte ich Zeit, mal wieder eine Runde mit dem Kleinen zu drehen. Wenn es hoffentlich mal ausnahmsweise nicht ganz so heftig schüttet. Würde dir das passen?«
»Perfekt. Ich bin ab mittags unterwegs, aber du hast ja den Schlüssel zu meiner Wohnung. Hol ihn gerne ab. Dann ist er nicht so lange allein und wird sich freuen.« Vittorio legte ein paar Münzen auf den Tresen, nahm seinen Regenschirm, der so elegant war wie alles andere an ihm, und wandte sich zum Gehen, drehte sich aber doch noch einmal auf dem Absatz zu mir um, schaute mich mit ernster Miene an, zeigte mit dem Finger auf sein Auge. »Und sieh dich vor, Camilla. Du weißt ja, heute ist Freitag, der 17.«
3
»Mein Gott, du siehst aber mitgenommen aus.«
Ich war es gewohnt, dass Franca kein Blatt vor den Mund nahm, aber dass ich an diesem Tag nun schon zum zweiten Mal zu hören bekam, wie schlecht ich aussah, war doch ein bisschen viel. Dabei fühlte ich mich trotz der kurzen Nacht und des fehlenden Schlafs durchaus entspannt. In der Praxis hatte – gegen alle Unkenrufe anlässlich des angeblichen Unglücksdatums und anders als am Tag zuvor – alles seinen gewohnten Gang genommen, ganz ohne Notfälle und Überraschungsbesuche. Gegen Mittag hatte es sogar aufgehört zu regnen, und als mein letzter Patient am späten Nachmittag die Praxis verlassen hatte, hatte ich mich zu Fuß in den Stadtteil San Salvario aufgemacht, in dem das Café liegt, das Franca seit ein paar Jahren betreibt und wo wir nun bei einem Espresso zusammensaßen. Auf halber Strecke dorthin war plötzlich die Wolkendecke aufgerissen, die Frühlingssonne hatte ein wunderbares Licht verströmt, und mit einem Schlag war die gigantische, noch schneebedeckte Alpenkette aus den Wolken aufgetaucht. Ein magischer Moment, der mich niemals kaltlässt, so oft ich ihn auch schon erlebt habe. Turin, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, kann der wunderbarste Ort auf Erden sein, aber sie ist eine verkannte Schöne, die ihrer einstigen Geltung nachhängt, eine narzisstisch Gekränkte, die, sehr zugespitzt gesagt, zu mir auf die Couch gehört. Was ist meine Heimatstadt nicht alles gewesen! Sitz der Herrscherfamilie und für kurze Zeit Hauptstadt Italiens, später ein Hollywood am Po, aus dem die ersten Stummfilme Italiens kamen, dann nach dem Ersten Weltkrieg mit den Schriftstellern und Intellektuellen rund um den Verlag Einaudi ein Nukleus des italienischen Geisteslebens mit Strahlkraft über die Grenzen hinaus, und seit mehr als einem Jahrhundert als Autoproduzent mächtiger Treiber des ökonomischen Wachstums Italiens. Aber sie liegt eben doch etwas ab vom Schuss am nordwestlichen Rand des Landes, wirtschaftlich und kulturell übertrumpft vor allem von Mailand, der Metropole, mit der man sich ständig misst. Lange Zeit sahen viele in Turin nur ein hässliches, von Industrie geprägtes Entlein, obwohl es das niemals gewesen ist, ganz im Gegenteil. Von mir aus hätte es auch so bleiben können, mir gefiel diese unprätentiöse Seite meiner Stadt und dass sie nicht so viele Touristen anlockte, doch in den letzten Jahren hat Turin aufgeholt, sich neu erfunden, wie das in der Tourismuswerbung heißt, und ist geradezu trendy geworden, sodass ich neuerdings von vielen meiner Landsleute um meinen Wohnsitz beneidet werde.
Das einst volkstümliche Quartiere San Salvario, in dem Franca ihr Café betreibt, erstreckt sich hinter einem wunderbaren Stadtpark, dem Parco del Valentino, und hat sich in den letzten Jahren zu einem angesagten Viertel gemausert, wie zuvor schon das Quadrilatero, die historische Altstadt, in der meine Praxis liegt. In SanSa, wie es die hier Heimischen gerne nennen, findet auf der Piazza Madama Cristina jeden Tag ein quirliger Markt statt und gleich um die Ecke komme ich niemals an der Panetteria Papale vorbei, ohne ein paar Biscotti und Brot zu kaufen. In den Straßen rundum koexistieren alteingesessene Läden, die alltägliche Dinge wie Haushaltswaren oder Wäscheartikel vertreiben, mit Handwerksbetrieben und originellen Kleidershops, arabischen Friseuren, Imbissen und trendigen Restaurants. Letztere haben meist auch ein paar Tische draußen, wo man speisen kann, bevor man ins Nachtleben des Borgo ausschwärmt – ein Auftrieb nicht unbedingt zum Wohlgefallen vieler Anwohner, da er vor allem am Wochenende stets nächtlichen Lärm, Dreck und Drogen mit sich bringt.
Wenn ich so zu Fuß durch Turin laufe, wie an diesem Freitagnachmittag, nehme ich das rege Treiben oft gar nicht mehr richtig wahr, meine Gedanken schweifen ab, wandern hinter die Fassaden der Häuser, und es geht mir durch den Kopf, was sich dort abspielt. Die Angewohnheit, mich zu fragen, was sich hinter dem Offensichtlichen verbirgt, ist zweifellos eine déformation professionelle, da ich in meiner Praxis ja jeden Tag mit Menschen zu tun habe, die nach außen meist ganz normal wirken, aber doch mehr oder weniger verborgen Dinge tun und erleben, die jenseits von Normalität liegen, zumindest jenseits von dem, was man gemeinhin darunter versteht. Etwa eine junge Frau, die sehr aufgeweckt und eine begabte Violinistin ist, aber seit ein paar Monaten zu mir in die Praxis kommt, weil sie sich heimlich ritzt, oder ein Mann mittleren Alters, ein erfolgreicher Architekt, durchaus warmherzig und seriös, der eine Analyse bei mir begonnen hat, weil er seine Freundin regelmäßig beim Sex gewürgt hat, sodass sie ihn schließlich verlassen hat. Es ist manchmal schwer und immer ein langer Weg, mit den Patienten herauszufinden, was hinter ihren Verhaltensstörungen steckt. Oft gelingt es, manchmal auch nicht. Immerhin strengen wir uns an, die Patienten und ich. Aber was ist mit denen, die keine Hilfe suchen, die sich nicht behandeln lassen? Das ist es, was sich mir beim Gang durch die Straßen aufdrängt, mich nicht loslässt. Ich male mir aus, welche Absonderlichkeiten und wie viel Zwanghaftes sich hinter den Mauern in all diesen Häusern unbemerkt abspielt. Wieder musste ich an die Frau in Rot denken. Die hatte ihre exzessive Seite immerhin nicht versteckt, sie im Gegenteil offen ausgelebt, wobei ihre Familie zweifellos darunter gelitten hatte und sie selbst vermutlich auch. Meine Gedanken sprangen denn auch gleich weiter zu ihrer Tochter und dieser diffusen Mischung aus Mitleid und Irritation, die sie am Tag zuvor in mir ausgelöst hatte. Wie war es wohl gewesen, Tochter dieser Mutter zu sein?
In meiner Manteltasche steckte ein edel aussehendes, ledergebundenes Notizbuch, das Alba gehören musste. Ich hatte es erst heute beim Verlassen meiner Praxis im Flur gefunden, aber bisher nur einen flüchtigen Blick hineingeworfen. Es war bestimmt aus ihrer Jacke gefallen, als ich sie zum Trocknen über die Heizung gehängt hatte. Oder hatte Alba es absichtlich dort liegen lassen, damit ich es fände? Und konnte es sein, dass sie gar nicht durch Zufall in meiner Praxis gelandet war, sondern mich gezielt unter den vielen Therapeuten in Turin ausgewählt hatte? Weil sie etwas über mich wusste?
»Haben dir deine Patienten heute mal wieder den letzten Nerv geraubt?«, fragte Franca. Wir saßen in den etwas zerschlissenen, aber gemütlichen 50er-Jahre-Sesseln, die sie in ihrem Café um niedrige ovale Tische herum gruppiert hatte. Franca hat zwar Respekt vor mir, ihrer Freundin mit dem Doktortitel, aber von der Psychoanalyse hält sie nichts, vor allem nicht von den Patienten, die für sie überwiegend selbstmitleidige, zu sehr mit sich selbst Beschäftigte sind, die ihre Freundin stundenlang mit ihren Problemen zuquatschen. Dabei ist Franca eigentlich ausgesprochen mitfühlend, der Typ Freundin, der immer für einen da ist, nicht nur, wenn es darauf ankommt, aber dann erst recht. Manchmal war mir ihre Fürsorge sogar zu viel, insbesondere, wenn sie kombiniert mit Bergen von Schokolade auftrat. So wie an diesem Freitag.
»Du musst unbedingt meine neuen Trüffel probieren«, sagte sie, »die sind atemberaubend, und deine nervigen Patienten kannst du dann vergessen.« Sie hielt mir eine offene Schachtel hin, aus der es wirklich verführerisch duftete. Franca kreierte die Rezepte für ihre Trüffel seit einiger Zeit selbst, und inzwischen kamen die Leute aus ganz Turin angefahren, um ihre Naschereien zu erstehen, was ein enormer Erfolg in dieser von Schokolade durchtränkten Stadt war. Sehr erfolgreich waren auch die Veranstaltungen, die sie hin und wieder im Café organisierte, mal eine Lesung, mal ein Poetry Slam oder auch ein kleines Konzert. Ich wusste nicht, was dem Café mehr Kundschaft brachte, diese Abende oder ihre köstlichen Trüffel.
»Was ist da drin?«, fragte ich.
»Probier einfach«, erwiderte Franca und rückte mit der Schachtel noch ein wenig näher.
»Aber nur einen«, sagte ich und schob mir den Trüffel in den Mund. »Mmm, wirklich lecker.«
»Lecker? Sensationell sind die!« Franca tat beleidigt.
»Und was ist da drin?«, fragte ich, auf etwas Knackiges beißend. »Nüsse? Die Dinger sind jedenfalls ganz schön scharf.«
»Blaubeere und rote Pfefferkörner, das schmeckt man doch, du Banausin.«
In diesem Moment kam Kundschaft in das nur halb volle Café, ein älteres Ehepaar mit einem rothaarigen Jungen, wahrscheinlich der Enkel. Franca machte ihren Kollegen ein Zeichen, dass sie sich selbst um die neuen Gäste kümmern würde, und verschwand zu ihnen an den Tisch – nicht ohne die Schachtel Trüffel mit einer aufmunternden Geste auf dem Tisch vor mir zurückzulassen und mir noch einen Espresso zu ordern. Ich sah ihr nach, wie immer ein wenig neidisch auf ihre eindrucksvolle Erscheinung. Franca hat ihren eigentlich braunen, weich fallenden Locken einen Hauch von Rot verpasst und sich ihren lässigen Kleidungsstil bei den Französinnen abgeschaut, trägt meist blumige Kleider und grob gestrickte Jacken aus Mohair, dazu gerne Pumps oder Turnschuhe und auch mal einen weichen Hut. Aber das ist es nicht, was mich an ihr so fasziniert. Und besonders schön ist sie eigentlich auch nicht. Es ist ihr Gang, wie unverschämt geschmeidig sie sich bewegt, dieser frappierende Einklang mit sich selbst und dem eigenen Körper, der sie so unwiderstehlich macht.
Wir kennen uns mittlerweile schon seit Jahrzehnten, seit wir uns als Dreizehnjährige in einem Rennskikurs in den nahen Alpen, in Saint-Martin-des-Moulins, begegnet sind. Beide kommen wir aus Turin, allerdings aus vollkommen unterschiedlichen Milieus, ich aus einer Arbeiterfamilie, sie aus sehr wohlhabenden Kreisen, und doch sind wir auf Anhieb Freundinnen geworden. Ich kann mir keine bessere Freundin vorstellen als sie. Gleich an meinem ersten Abend mit unserer Skigruppe, als ich beim Abendessen ziemlich eingeschüchtert am voll besetzten Tisch vor meinem Teller saß und sie neben mir, half sie mir aus der Bredouille. Es gab ein typisches Gericht aus dem Aostatal, Polenta mit Wildschweinragout und Steinpilzen, etwas, was ich von der sizilianischen Küche meiner Großmutter nicht kannte und, weil die Pilze so glitschig waren, ziemlich eklig fand. Aber unter den strengen Augen unserer Betreuerin und weil ich nicht als schwierig gelten wollte, zwang ich mich, sie zu essen. Franca bemerkte meinen hilflosen Widerwillen, warf mir einen verstehenden Blick zu, fischte die Pilze aus ihrem Ragout, schlang sie herunter und tauschte ihren nun pilzfreien Teller in einem günstigen Moment unbemerkt gegen meinen aus. Ich wollte mich ein paar Tage später, als man sie beim Rauchen erwischte, revanchieren, indem ich die Schuld auf mich nahm und behauptete, es seien meine Zigaretten und dass ich Franca zum Ausprobieren überredet hatte. Aber natürlich nahm sie die Ausrede nicht an und stand zu ihrem Vergehen. Auf der Piste war sie immer schneller als ich, obwohl sie weniger Ehrgeiz an den Tag legte. Als ich einmal doch vor ihr über die Ziellinie fuhr, hatte ich sie im Verdacht, mir mit Absicht den Vortritt gelassen zu haben. Wir verloren uns dann nach dem Abitur ein paar Jahre aus den Augen, weil sie in Frankreich studierte, während ich in Italien blieb. Eines Tages hatten wir uns dann zufällig in Turin auf der Straße wiedergetroffen. Wir waren, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, ineinandergerannt und haben uns seitdem nicht mehr aus den Augen gelassen.
Franca schien das neu angekommene Ehepaar zu kennen, unterhielt sich angeregt mit ihnen, strich dem Jungen immer wieder zärtlich übers Haar, was ich etwas übergriffig fand, ihm aber zu gefallen schien. Schließlich nahm sie die Bestellung auf und verschwand in die Küche. Ich nippte an meinem Espresso, nahm mir doch noch einen von Francas Trüffeln, obwohl ich gar nicht so gern Süßes esse, ließ ihn langsam im Mund zergehen und hoffte, dass sich noch ein ruhigerer Moment im Café ergeben würde und damit eine Gelegenheit, mit Franca über die vermutlich ermordete Signora de Magris zu reden. Allerdings möglichst, ohne den Besuch von Alba in meiner Praxis zu erwähnen, was zweifellos gegen die Regeln gewesen wäre, da aus meinem Sprechzimmer nichts nach außen dringen darf.
Das Rätsel um Albas Mutter, diese Frau, die ein so ungewöhnliches Doppelleben geführt hatte, ließ mich seit der Begegnung mit der Tochter nicht los. Was waren diese de Magris’ für Leute? Bestimmt wusste Franca mehr. Sie entstammte selbst diesem großbürgerlichen Milieu, dem Torino bene, das ein hermetischer Zirkel ist, diskret, elegant und wohlanständig, von dem wenig nach außen dringt, weil man am liebsten unter sich bleibt. Allerdings hatte Franca das alles hinter sich gelassen, mit ihrer Familie, vor allem aber mit deren Erwartungen gebrochen, nur den selbstsicheren Habitus dieses Milieus hatte sie mit in ihr neues Leben genommen.
Franca blieb eine Weile in der Küche verschwunden, und mir fiel wieder das Notizbuch ein, das Alba in der Praxis zurückgelassen hatte und das noch in meiner Manteltasche steckte. Ich nahm es mir vor, blätterte ziellos darin herum. Es war eher ein Adressbuch als ein Notizbuch, und es gehörte nicht Alba, sondern ihrer Mutter, stellte ich fest. Jedenfalls hatte die Signora de Magris auf der ersten Seite in einer eleganten Handschrift ihren Namen notiert. Ansonsten sagten mir die Namen in dem Büchlein – manchmal mit einer Telefonnummer, selten auch mit einer Adresse versehen – alle nichts. Ich fand es aber befremdlich, das private Notizbuch einer Toten in Händen zu halten, und da ich außerdem nicht viel damit anfangen konnte, legte ich es schließlich wieder weg.