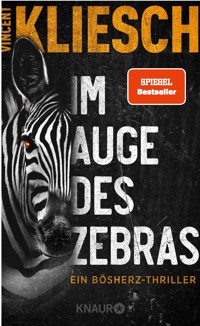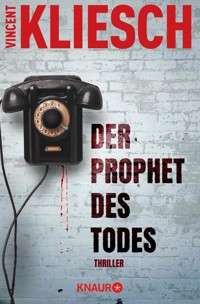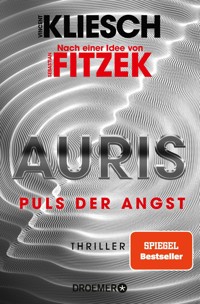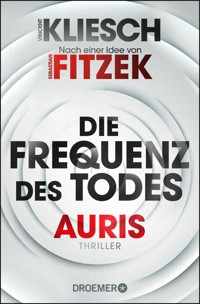
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Jula und Hegel-Thriller
- Sprache: Deutsch
Akustische Forensik, ein undurchsichtiger Profiler und ein entführtes Baby: die rasante Fortsetzung des Nr.-1-Spiegel-Bestsellers »Auris« der Thriller-Autoren Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek! »Hilfe, mein Baby ist weg! Hier ist nur Blut …« Nach kurzen Kampfgeräuschen bricht der panische Notruf einer Mutter bei der Nummer 112 plötzlich ab. Wenn jemand aus diesem Tonfragment Rückschlüsse auf den Aufenthaltsort der Frau ziehen kann, dann der forensische Phonetiker Matthias Hegel – den einige nach wie vor für einen Mörder halten. True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge ist es zwar gelungen, Hegel vom Mordverdacht an seiner Frau zu entlasten, doch dabei ist sie der dunklen Seite des genialen Profilers deutlich zu nahe gekommen. Als Hegel nun im Fall des entführten Babys erneut auf ihre Recherche-Fähigkeiten zurückgreifen will, weigert Jula sich zunächst. Doch kann sie das Baby und seine Mutter wirklich ihrem Schicksal überlassen? Und was ist mit den Informationen zu ihrem tot geglaubten Bruder Moritz, die Hegel ihr angeblich beschaffen will? Auch im zweiten Teil der Thriller-Reihe ziehen die Bestseller-Autoren Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek wieder alle Register: Nichts ist, wie es auf den ersten Blick scheint, und niemand bleibt so unschuldig, wie er es gern wäre. Rasante Spannung für die Fans außergewöhnlicher Thriller mit mehr als einer unerwarteten Wendung! Die Jula und Hegel-Thriller-Reihe ist folgender Reihenfolge erschienen: - Auris - Die Frequenz des Todes - Todesrauschen - Der Klang des Bösen - Tödlicher Schall
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Vincent Kliesch
Die Frequenz des Todes
AURIS
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Nach einer Idee von
Sebastian Fitzek
Über dieses Buch
»Hilfe, mein Baby ist weg! Hier ist nur Blut …« Nach kurzen Kampfgeräuschen bricht der panische Notruf einer Mutter bei der Berliner Polizei plötzlich ab. Wenn jemand aus diesem Tonfragment Rückschlüsse auf den Aufenthaltsort der Frau ziehen kann, dann der forensische Phonetiker Matthias Hegel – den einige nach wie vor für einen Mörder halten.
True-Crime-Podcasterin Jula Ansorge ist es zwar gelungen, Hegel vom Mordverdacht an seiner Frau zu entlasten, doch dabei ist sie der dunklen Seite des genialen Profilers deutlich zu nahe gekommen.
Als Hegel nun im Fall des entführten Babys erneut auf ihre Recherche-Fähigkeiten zurückgreifen will, weigert Jula sich zunächst. Doch kann sie das Baby und seine Mutter wirklich ihrem Schicksal überlassen? Und was ist mit den Informationen zu ihrem tot geglaubten Bruder Moritz, die Hegel ihr angeblich beschaffen will?
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
Danksagung
1
Cecile
Von allen Geräuschen, die es vermögen, das Grauen anzukündigen, vernahm Cecile Dorm das vermutlich schlimmste. Es war kein heftiges Pochen an der Wohnungstür mitten in der Nacht. So wie letztens, als der Nachbar von schräg gegenüber im Pyjama vor ihrer Haustür gestanden hatte. Friedmann, der sonst nicht einmal grüßte, vermutlich, weil er sich für etwas Besseres hielt, hier in der Villengegend in Westend … die uns eigentlich eine Nummer zu groß ist, Schatz. Findest du nicht? Aber ihr Mann Jonathan mochte es, war hier groß geworden, wenn auch in einem Mietshaus ohne Garten. So gesehen hatten sie es nun in dem renovierungsbedürftigen, aber großzügigen Anwesen besser. Auch wenn es einsamer war als in ihrem Heimatdorf in Mahlow, wo Cecile früher nie schräg angeguckt worden war, wenn sie mal eilig im Jogginganzug, ungeschminkt und mit einem hastig gebundenen Verlegenheitszopf was fürs Frühstück holte. »Ist das nicht die Tante vom Jugendamt? Die Frau vom Nervenarzt? Der holt sich seine Irren nach Hause, heißt es. Ja, er hat jetzt sogar die Praxis vom Dachboden in den Keller verlegt. Ob er in der Klinik rausgeflogen ist? Und das Haus! Nicht mal einen Anstrich können die sich leisten.«
Das hatte ihr Friedmann, der sich seit seiner Pensionierung zu so etwas wie einem Nachbarschaftssheriff aufgeschwungen hatte, sogar einmal ins Gesicht gesagt: »Eine Schande, wie Sie die alte Villa verkommen lassen.« Damals jedoch, als er sie aus dem Schlaf gerissen hatte, war ihm die bröckelige Fassade nicht wichtig gewesen. Barfuß und mit einem nicht funktionierenden Telefon in der Hand stand er vor ihnen.
»Sie sind doch Arzt«, hatte er flehentlich zu Jonathan gesagt. »Bitte, mein Enkel erstickt!«
Der Vierjährige, den die Friedmanns für ihre Tochter babysitteten, hatte einen Pseudokrupp-Anfall erlitten. Cecile wickelte den Kleinen einfach in eine Decke und trug ihn nach draußen. Sein spastischer Hustenkrampf hatte sich schnell gelöst.
Jetzt hingegen war es kein ersticktes Röcheln, das Ceciles Herz dazu brachte, ihr gegen die Rippen zu schlagen wie ein Basketball aufs Turnhallenlinoleum. Auch kein Hupen, gefolgt von quietschenden Autoreifen, das sich rasend schnell auf sie zubewegte. Weder das Bersten von Fensterglas im Wohnzimmer, während sie nachts im Bett lag, noch das helle Knacken eines Knochens beim Aufprall nach einem Sturz. Das Geräusch, das sie so sehr ängstigte, war weit schlimmer als all das. Es kam direkt aus der Wiege, in die sie die kleine Selma zum Schlafen gelegt hatte. Das Geräusch war Stille. Nichts als absolute, erbarmungslose Stille.
Von dieser beängstigenden Ruhe war Cecile geweckt worden. Nur für einen kurzen Moment hatte ihre Erschöpfung die Oberhand gewonnen über das Beschützertier, das seit Neuestem in ihr wohnte. Die Bärenmama, die ihr Junges nicht für einen Augenblick aus den Augen lassen wollte, hatte versagt und war mit der Milchpumpe in der Hand auf dem Sofa eingeschlafen. Und das lag nicht einmal daran, dass Nachtruhe und Durchschlafen seit nunmehr sechs Wochen nicht mehr als entfernte Erinnerungen für sie waren. Nachts war sie alle zwei Stunden aufgestanden, um ein Fläschchen zuzubereiten, weil das wenige, das aus ihren Brüsten in die Pumpe tropfte, nicht einmal ein Mäusebaby hätte satt machen können. Einmal hatte Jonathan angeboten, ihr zu helfen, hatte mit schläfriger Hand und geschlossenen Augen müde nach ihr getastet, doch sie hatte abgewinkt. Er brauchte seinen Schlaf für die Patienten. Musste ausgeruht sein, durfte keine Fehler machen. Gerade jetzt, da er sich endlich – nach über einem Jahrzehnt als Arzt und Psychotherapeut in verschiedenen Berliner Kliniken – selbstständig gemacht hatte. Die Depressions-, Essstörungs- und Panikpatienten, die ihn hier zu Hause in seiner Praxis aufsuchten, hätten kein Verständnis dafür, wenn er es Cecile gleichtat und während einer der Therapiesitzungen einschlief. Wobei es aber gar nicht das Baby gewesen war, das Cecile in der vergangenen Nacht so beschäftigt hatte – in den zwei Stunden zwischen den Fläschchen, die sie Selma anreichte und während derer sie nur schwer zurück in den Schlaf finden konnte. Es war die Tatsache, dass sie nun schon seit Tagen ihre Mutter nicht erreichen konnte. Die beiden telefonierten regelmäßig miteinander, und es sah ihrer Mutter so gar nicht ähnlich, dass sie bereits seit einer Woche nicht mehr auf Ceciles Nachrichten reagierte, die sie ihr auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hatte.
»Ruf mich bitte zurück, Mama, ich hab dir so viel zu erzählen. Meine Kollegin hat mir von einem Einsatz berichtet – in einer völlig verwahrlosten Familie, die bis zum Mutterschutz unter meiner Betreuung stand. Sie musste das Kind aus der Familie nehmen, dabei hatte ich bis zuletzt gehofft, dass es zu vermeiden wäre. Du kannst dir die Zustände nicht vorstellen. Gott, bin ich froh, dass Jonathan nicht trinkt oder Drogen nimmt. Wobei ich das Gefühl habe, dass er sich verändert hat, seit Selma da ist. Manchmal denke ich sogar, er ist eifersüchtig auf die Kleine. Aber vielleicht irre ich mich ja auch, ich meine, es ist schon alles etwas viel für ihn. Du weißt ja, wie überfordert er mit privaten Dingen manchmal ist. Erinnerst du dich an die Hochzeit? Gott, was war er nervös …« Cecile hatte kichernd aufgelegt.
Die Hochzeit! Was für ein wunderschöner Tag das gewesen war. Mindestens genauso schön wie der Moment, als Jonathan ihr den Antrag gemacht hatte. Er hatte so unglaublich aufrichtig geklungen, als er nach dem Besuch im Theater des Westens in dem kleinen Restaurant an der Hardenbergstraße ihre Hand ergriffen hatte. Als er sie angesehen hatte, wie er es nur dann tat, wenn er etwas Bedeutsames zu verkünden hatte. Mit diesem Funkeln in den grünen Augen, das Cecile immer nur dann an ihm bemerkte, wenn er mit ihr sprach.
»Könntest du dir vorstellen, einen Mann zu heiraten, der zwanzig Jahre älter ist als du, der seltsame Hobbys hat, jeden Tag mit psychisch Kranken arbeitet und der morgens nach dem Aufwachen immer erst mal mürrisch ist und aussieht wie ein Kobold?«
Cecile hatte gelacht, aber nicht wegen Jonathans selbstironischer Scherze. Immerhin war es auch ein solcher Scherz gewesen, mit dem er sie das erste Mal zu einem Rendezvous eingeladen hatte. »Würden Sie mit mir essen gehen, solange ich die Gabel noch selbst zum Mund führen kann?«, hatte er sie gefragt, nachdem sie ihn überraschend auf der Geriatrie besucht hatte. Eine Schwester reichte dort gerade fürsorglich einer alten Dame das Essen an, und Cecile und Jonathan hatten ihr für einen Augenblick dabei zugesehen. »Nur, wenn ich Ihnen danach nicht den Rücken mit Franzbranntwein einreiben muss«, hatte Cecile geantwortet und damit ihre Beziehung nach wochenlangem Austausch von E-Mails und WhatsApp-Nachrichten auf eine neue Ebene gehoben.
Nein, Cecile hatte aus Verlegenheit über den Heiratsantrag gelacht. Aus Verlegenheit darüber, dass sie nicht sicher war, was sie Jonathan antworten sollte. Sie hatte keinen Zweifel daran, dass es absolut richtig für sie wäre, ihn zu heiraten. Das Beste, was ihr jemals passieren könnte. Woran sie zweifelte, war, ob es auch das Beste für ihn sein würde, sie zur Frau zu nehmen. Eine kleine Inspektorin vom Jugendamt, die gern Daily Soaps sah, im Konzert an den falschen Stellen klatschte und mit ihrer Abstammung vom brandenburgischen Dorf auch sonst nicht eben von dem Kaliber war, das ein Dr. Jonathan Dorm aus dem feudalen Westend an seiner Seite erwarten durfte.
Zu Ceciles Freude war ihre Mutter stolz darauf, dass sie Jonathan an ihrer Seite hatte. Was hätten wohl andere Mütter gesagt? Er ist zu alt für dich, als Psychologe ist der garantiert selbst verrückt, wenn der sich eine andere sucht, sitzt du mit dem Kind auf der Straße. Doch so etwas hätte Ceciles Mutter nie gesagt. Im Gegenteil, es gab nichts Gutes, das sie ihrem einzigen Kind nicht gegönnt hätte. Und dann hatte ihre Tochter diese wahrhaft gute Partie gemacht, denn wenn Jonathan auch nicht reich war, so vermochte er ihr doch immerhin ein Leben in bürgerlichem Wohlstand zu ermöglichen. Einem Wohlstand, den ihre Mutter nie erlebt hatte und den sie ihrer kleinen Cecile allein deswegen von ganzem Herzen gönnte.
Es war eine unerträgliche Stille, die sich ihren Weg aus Selmas Wiege zu Cecile bahnte.
Hat Jonathan sie vielleicht woanders hingebracht? Cecile wagte es nicht, sich dem Babybett zu nähern. Wie versteinert blieb sie auf der Schwelle der Verbindungstür stehen, die das Kinderzimmer vom Schlafraum trennte. Die Tür war seit Selmas Ankunft niemals geschlossen gewesen, noch nie hatte die Kleine ein Geräusch von sich gegeben, das Cecile nicht gehört hätte. Warum sollte Jonathan sie aus der Wiege nehmen? Und warum sollte ich das nicht merken?
Als läge ein böser Fluch über dem Kinderzimmer, verweilte Cecile auf der Schwelle, während ihr Puls sich mit jedem Schlag ihres Herzens weiter und weiter beschleunigte. Das liebevoll eingerichtete Zimmer mit den niedlichen Bildern an der Wand, den Kuscheltieren auf den Möbeln und dem sanften Rosenduft erschien Cecile mit einem Mal so düster und unheimlich wie ein Grabgewölbe. In ihrem hellblauen Trainingsanzug stand sie mit zittrigen Knien da und hoffte entgegen aller Vernunft, dass sie sich nur in einem bösen Traum befand.
Es war erst wenige Wochen her, dass Cecile mit der kleinen Selma nach Hause gekommen war. Ein kerngesundes Mädchen, das jedem, der es zu Gesicht bekam, unweigerlich ein Lächeln auf die Lippen zauberte. Auch wenn es nicht viele Menschen waren, die das Kind bislang zu sehen bekommen hatten. Cecile und Jonathan hatten Selma noch nicht herumgezeigt, wie andere Eltern es getan hätten. Sie hatten keine Fotocollagen immer gleicher Babybilder auf sozialen Netzwerken veröffentlicht, keine Karten an den erweiterten Bekanntenkreis verschickt, die mit einem niedlichen Foto von Selma, erwartbaren Körpermaßen und einem Spruch wie Hier bin ich! bedruckt waren. Und das, obwohl Cecile es eigentlich in die Welt hatte hinausschreien wollen: Seht sie euch an, das ist Selma, das wundervollste Kind auf dem Planeten! Kerngesund, bildschön, ein wahrer Engel! Doch Jonathan war es mit seiner einfühlsamen Art gelungen, sie davon abzuhalten. Die Geburt war schwer und belastend für euch beide, Schatz. Lass es uns noch nicht an die große Glocke hängen, ihr braucht jetzt erst mal Ruhe. Wenn unsere Familien und Freunde alle ankommen, setzen wir Selma nicht nur Stress aus, sondern auch der Gefahr von Infektionen. Ich weiß, du denkst jetzt, dass da der überängstliche Mediziner aus mir spricht. Der in seinem Beruf zu viele schlimme Dinge erlebt hat und jetzt bei seinem eigenen Kind auf Nummer sicher gehen will. Aber wir haben doch Zeit und sollten auf keinen Fall irgendwas riskieren! Lass Selma erst noch ein bisschen unser Geheimnis sein. Und dann gibt es eine große Überraschung für alle!
Doch jetzt war es still in der Wiege.
Vielleicht schläft sie nur ganz ruhig? Vorsichtig setzte Cecile den rechten Fuß ins Kinderzimmer. Aber es gibt doch immer ein Geräusch, auch wenn sie schläft! Sie atmet, oder es raschelt. Irgendwas höre ich immer. Sie biss die Zähne zusammen und presste sich die Hände auf den Mund. So, als ziehe eine magische Kraft sie an, während ihre Angst noch immer versuchte, sie zurückzuhalten, setzte Cecile auch den zweiten Fuß auf den flauschigen Teppich, der in dem zarten Grün gehalten war, das sie so liebte. Für einen Moment fuhr ihr Blick wirr durchs Zimmer. Über die Poster mit den Bären, Feuersalamandern und Hundewelpen, um sich dann an den wiederkehrenden Mustern der lustigen Kindertapete festzuhalten, als habe sie die Orientierung verloren. Also gut. Sie rieb sich mit den Händen übers Gesicht und atmete tief durch. Ich werde jetzt in diese Wiege sehen. Ein letztes Mal schien ihre Angst sie zurückhalten zu wollen, doch schließlich war es die Sorge um ihr Baby, die Cecile mit kleinen, gleichmäßigen Schritten vorangehen ließ. Als sie kurz davor war, in das Babybett hineinsehen zu können, schloss Cecile die Augen. Sie tastete sich die letzten Schritte vor und hielt inne. Dann nahm sie all ihren Mut zusammen, atmete tief durch – und öffnete die Augen wieder.
Blut!
2
Jonathan
Wann bescheinigen Sie mir endlich meine Diensttauglichkeit und beenden diesen Mist hier?«
Jonathan Dorm antwortete nicht sofort, und das nicht nur, weil dieser große, viel zu muskulöse Kerl mit den kurz geschorenen Haaren und dem Stoppelbart sich so vehement gegen seine Traumatherapie zur Wehr setzte. Es hatte fast einen Monat gedauert, bevor er überhaupt kooperiert hatte, und selbst jetzt, da er kurz vor der entscheidenden Beurteilung stand, hatte er offenbar noch immer kein volles Vertrauen in seinen Therapeuten gefasst. Schon wieder eines dieser armen Schweine, die in ihrem inneren Gefängnis hocken und lieber darin verrecken, als sich einzugestehen, dass sie nicht perfekt sein können.
Jonathan war nicht Psychotherapeut geworden, weil er – wie viele seiner Kommilitonen – von den Lehren Sigmund Freuds wahlweise begeistert oder gegen sie eingenommen war. Auch nicht, weil ihm diese Wissenschaft gleichermaßen Verantwortung und Macht über die Menschen verlieh, die sich ihm anvertrauten. Er hatte seinen Beruf erlernt, weil er die Menschen liebte. Und weil es ihm Unbehagen bereitete, wenn jemand aufgrund eines Traumas oder einer unglücklichen Entwicklung in seinem Leben die Zeit, die er auf der Erde hatte, nicht genießen konnte. Ein großer Anspruch, ich weiß, hatte er seinem Professor bereits im zweiten Semester erklärt. Aber würden Sie einen Therapeuten wollen, der nur seine Quartalsabrechnung im Sinn hat? Der Professor hatte süffisant gelächelt und mit einer gewissen Ironie erwidert: Mit dieser Einstellung wird der weite Weg zu Ihrem eigenen Seelenheil Sie aber nicht reich machen. Dorm hatte nicht lange überlegen müssen, was er darauf antworten sollte: Das Seelenheil selbst ist der Reichtum! Und wenn ich mein eigenes nicht finde, will ich zumindest dafür kämpfen, dass es möglichst vielen anderen gelingt.
»Also gut, Justin, Sie fühlen sich noch immer schikaniert. Sie sehen die vergangenen Wochen als Zeitverschwendung an. Sehe ich das richtig?«
Dorm saß vorgebeugt in seinem Sessel. Hätte er sich entspannt zurückgelehnt, was ihm aufgrund der kurzen Nächte, die Selma ihm bereitete, lieber gewesen wäre, hätte dies Desinteresse signalisieren können. Auch die zerschlissene Jeans und den alten Wollpullover mit den abgenutzten Stellen am Ellbogen hätte er normalerweise nicht bei der Arbeit angezogen, doch Justin Hollstein entstammte einer ehrlichen Arbeiterfamilie und würde sich von einem zurechtgemachten Schnösel sicher nichts sagen lassen. Schließlich war der bullige Polizist nicht freiwillig zu ihm gekommen, was üblicherweise Voraussetzung für eine Erfolg versprechende Psychotherapie war. Der für seine Dienststelle zuständige Amtsarzt hatte dem Beamten die Sitzungen mit Dorm verordnet und zur Voraussetzung für seine Wiederaufnahme in den Polizeidienst gemacht. Umso mehr war sich Jonathan bewusst, dass jeder Blick, jede Geste, jedes Wort sich darauf auswirkte, ob sein Patient entschied, mit ihm zu kooperieren oder sich ihm zu verweigern.
»Ich habe diesen Typen nun mal erschossen, was soll ich denn jetzt noch machen? Ihn wieder aufstellen?«
Dorm hatte zahlreiche Polizisten wie Justin erlebt. Viele dieser testosterongeladenen, aufgepumpten Jungs aus den Plattenbauten, die zur Polizei gegangen waren, weil sie von ihrer jungenhaften Vorstellung fasziniert waren, frei zu sein und über den Gesetzen zu stehen, Macht auszuüben, schnell fahren und schießen zu dürfen, Sonderrechte zu haben und ihre Gegner vermöbeln zu können, wenn sie einem blöd kamen – und das vollkommen legal auf der richtigen Seite des Gesetzes. Auch Justin war eines dieser Alphatiere, die ihrer Frau und ihren Kindern am Abend stolz davon berichten wollten, wie sie mit ihrer Einheit ein Waffenlager gestürmt, ausgehoben und wie viele Verbrecher sie dabei festgenommen hatten. Ein großer, bulliger Kerl, der im Grunde das Gute wollte, aber niemals wirklich verstanden hatte, was das Gute eigentlich war.
»Sie haben einen schizophrenen Mann erschossen, der zwei Frauen mit einer Machete abschlachten wollte.« Dorm fixierte seinen Patienten mit festem Blick. »Und seitdem sehen Sie ihn jedes Mal vor sich, wenn Sie die Augen schließen. Wieder und wieder, er verfolgt Sie.«
»Herrgott noch mal, hätte ich Ihnen das bloß nicht erzählt!« Hollstein schlug die Hände über dem Kopf zusammen.
»Warum denn? Weil so ein Trauma schon wieder weggehen wird, wenn man es bloß allen verschweigt? Oder weil ein Indianer keinen Schmerz kennt?«
»Was labern Sie da, Mann? Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheiß hier, wir machen das schon ewig. Bescheinigen Sie mir einfach meine Diensttauglichkeit, wenn ich mit dem Supervisionsheini komme!« Justin erhob sich.
»Sie beenden die Sitzung?« Dorm lehnte sich jetzt doch zurück, aber nur, um der Aufbruchsbewegung seines Patienten etwas entgegenzusetzen. »Was würde Ihre Mutter Ihnen jetzt wohl raten? Gehen oder bleiben?«
»Meine Mutter würde nie im Leben zu einem Psychodoktor gehen. Schon gar nicht zu einem, der so was da spielt.« Justin Hollstein deutete auf das Schachbrett, das auf dem kleinen Glastisch in der hinteren Ecke des Raumes aufgebaut war.
»Was hat Ihre Mutter gegen Schach?«
»Sie hat was gegen Leute, die das Leben nicht kapieren! Glauben Sie etwa, so funktioniert die Welt da draußen? Ich einen Zug, du einen Zug? Schön fair, möge der Bessere gewinnen? Am Arsch!«
»Interessant, was Sie da sagen. Als ein großes Schachbrett, auf dem jeder Mensch erfolgreich sein kann, wenn er nur mit Klugheit und Bedacht die richtigen Züge macht, habe ich die Welt bisher noch gar nicht gesehen. Spannender Gedanke.«
»Was labern Sie, Mann? Wenn da so ein Penner mit seiner verschissenen Machete steht, dann wägst du nicht in aller Ruhe deinen nächsten Zug ab. Dann musst du reagieren, aber sofort! Auge um Auge, der oder ich, das ist keine bekackte Zielscheibe auf dem Schießstand!«
Dorm schloss kurz die Augen und kratzte sich am Kopf. »Das Leben ist für Sie also keine Schachpartie, na gut. Was denken Sie, Justin, würden Sie die Welt eher als einen Boxring bezeichnen, in dem jeder auf jeden einprügelt und der Stärkste am Ende gewinnt?«
Hollstein lachte auf, und Dorm konnte nur erahnen, welche Erlebnisse aus seinem Berufsalltag in den Berliner Gettos aus diesem bitterbösen Lachen klangen.
»Das kommt der Sache näher«, sagte er und wollte sich schon zur Tür umdrehen.
»Also gut! Dann schlage ich Ihnen jetzt was vor.« Dorm stand auf und trat an den kleinen Holzschrank heran, auf dem er Wasser, Halsbonbons und Taschentücher für seine Patienten bereitstellte. »Wir tragen es auf Ihre Weise aus.« Unter den verdutzten Blicken seines Patienten holte er zwei Paar abgenutzte Boxhandschuhe aus dem Schrank, von denen er eines Justin reichte.
»Was soll der Scheiß?«
»Nur ein kleines Sparring, Sie sind ja gut im Training.« Dorm streifte sich sein Paar Boxhandschuhe über. Es war etwas zu klein für seine Hände, das größere Paar musste er seinem Patienten überlassen, dessen Pranken wahrhaft ehrfurchtgebietend waren. »In ein paar Tagen steht ja endlich der Termin mit Ihrem Supervisor an. Wir machen es so: Sie versuchen, meine Deckung zu treffen. Wenn Sie das drei Mal schaffen, erkläre ich Sie bei dem Treffen wieder für dienstfähig.«
Und da sind sie wieder. Die Fragezeichen in den Augen eines Hünen mit überbordenden Kräften, der jetzt, vollkommen überfordert mit der Situation, am liebsten in sein Kinderzimmer laufen und die Tür hinter sich zuknallen würde.
»Ich will Ihnen nicht wehtun!«
Justin Hollstein wirkte auf Dorm mit einem Mal wie ein Teenager, dem seine erste Freundin beim Besuch auf dem Rummelplatz vorschlug, Hau den Lukas zu spielen. Er hatte dabei nichts zu gewinnen. Würde er fest genug schlagen, dass die Glocke ertönte, hätte er lediglich die Erwartung seiner Freundin erfüllt. Aber wehe ihm, wenn etwas schiefginge. Wenn er danebenschlug oder – Gott bewahre! – seine Kräfte nicht so groß waren, wie er vermutete.
Immerhin, abgesehen von seiner beachtlichen Statur war Justin ein ausgebildeter Schutzpolizist mit guter Kondition und besten Kenntnissen im Nahkampf. Den sein blöder Seelenklempner von Ende vierzig allen Ernstes aufgefordert hat, gegen ihn zu boxen. Und das noch nicht einmal in einem Boxring, sondern in einer spartanisch eingerichteten psychotherapeutischen Praxis mit Laminatfußboden.
»Sie tun mir schon nicht weh.« Dorm hob die Hände vors Gesicht und begann, über den Boden zu tänzeln. »Immer auf die Deckung!«
Justin rührte sich noch immer nicht. Aus seinem Berufsalltag war er daran gewöhnt, von Schwächeren provoziert zu werden, es war sein täglich Brot, sich darauf nicht einzulassen.
»Ist das echt Ihr Ernst?«
»Mein völliger Ernst! Drei Treffer, und Sie können wieder zum Dienst antreten. Los, machen Sie schon!«
Dorms Bewegungen verrieten seinem Patienten anscheinend, dass der Therapeut zumindest über gewisse Grundkenntnisse im Boxsport verfügte. Nach weiteren Sekunden des konsternierten Abwartens zog sich der Polizist schließlich die Boxhandschuhe über und beugte sich leicht vor. Halbherzig und kraftlos schob er die Rechte in Dorms Richtung, doch dieser wich dem Schlag mit derselben Leichtigkeit aus, mit der eine Katze wohl dem Hieb eines Faultiers entkommen wäre.
»Mehr haben Sie nicht drauf?«
Immer schneller und wendiger tänzelte Dorm um seinen Patienten herum, und allmählich schien diesen der Ehrgeiz zu packen. Der zweite Hieb kam bereits deutlich schneller und kräftiger daher, doch wieder wich Dorm ohne Schwierigkeiten aus.
»Kommen Sie schon, Sie wollen Ihr Trauma doch so gern mit sich allein ausmachen. Ohne einen blöden Psychoheini, der sowieso keine Ahnung hat, wie es da draußen wirklich abgeht. Ich verbessere mein Angebot: Ein Treffer auf meine Deckung reicht, und Sie bekommen Ihre Bescheinigung!« Dorm ließ nun selbst die Faust ansatzlos vorschnellen. Nur wenige Zentimeter vor Hollsteins Kinn bremste er den Schlag ab, der in einem echten Boxkampf ein Wirkungstreffer geworden wäre.
»Alter, echt jetzt?« Der Polizist hob die Fäuste endlich mit voller Entschlossenheit und sah Dorm mit strengem Blick in die Augen.
»Dieser Kerl mit seiner Machete ist schuld daran, dass Sie jetzt immer wieder sein Bild sehen müssen, wenn Sie die Augen schließen. Los schon, stellen Sie sich vor, ich wäre dieser Kerl. Hauen Sie mich um!«
Justin Hollstein tänzelte auf einmal überraschend gekonnt um Dorm herum, fixierte ihn und holte aus. Dorm analysierte die Bewegung und duckte sich vor dem Schlag weg. Zweimal kurz nacheinander trafen nun Dorms Fäuste auf die Deckung des Polizisten, der seine anfänglichen Hemmungen abstreifte und sich dem Duell endlich mit Ernsthaftigkeit stellte. Immer wieder versuchte er, Dorms Deckung zu treffen, doch der ließ ihm keine Chance.
Schließlich trat der Therapeut einen Schritt zurück und streifte die Boxhandschuhe ab. Sein Patient hatte ihn nicht ein einziges Mal getroffen. »Justin, Sie können diesen Kerl vor Ihrem inneren Auge nicht einfach umhauen. Indem Sie ihn getötet haben, ist er ein Teil Ihres Lebens geworden. Und wenn Sie nicht wollen, dass er Sie und alle, die Sie lieben, wie ein böser Geist verfolgt, müssen Sie sich ihm stellen. Je früher, desto besser.«
Der Polizist schwitzte und atmete schnell. Er ließ die Fäuste sinken und sah Dorm an. Und zwar mit diesem ganz bestimmten Blick, den Jonathan schon so oft bei seinen Patienten gesehen hatte. Aus Was soll diese Scheiße hier? war Danke für Ihre Hilfe! geworden.
»Versuchen Sie doch mal, sich umzudrehen, wenn Sie den Kerl mit seiner Machete sehen.«
»Was?«
»Sie blicken immer nur auf den Mann, den Sie getötet haben. Wenn Sie sich in Gedanken umdrehen, sehen Sie stattdessen die beiden Frauen.«
»Die Frauen, die der Kerl umlegen wollte?« Hollsteins Stimme wurde brüchig.
»Die unschuldigen Frauen, die noch am Leben sind, weil Sie den Kerl erschossen haben, der ihnen gerade die Köpfe abhacken wollte. Wenden Sie dem Täter den Rücken zu und sehen Sie zu den Opfern. In ihre dankbaren Augen. Und in die dankbaren Augen der Familien dieser Frauen.«
»Okay …« Justin lief eine Träne über das markante Kinn, bis sie sich in seinem Stoppelbart verlor.
»Sie haben diese Therapie bisher besser gemeistert, als Sie denken, Justin. Aber wenn Sie ehrlich zu sich sind, dann wissen Sie auch, dass Sie noch nicht ganz an Ihrem Ziel angekommen sind. Ich freue mich trotzdem auf das Gespräch mit Ihrem Supervisor. Bis dahin werde ich noch mal gut über Ihre Entwicklung nachdenken.«
Hollstein legte den Kopf leicht schräg und sah Dorm mit erwartungsvollem Blick an. »Eine Frage hätte ich noch!«
»Schachboxen!«
»Was?«
»Sie wollten doch sicher fragen, warum ich das so gut kann. Ich betreibe Schachboxen, schon seit fünf Jahren. Mann gegen Mann, immer abwechselnd eine Runde Schach und eine Runde Boxen. Das war vom Erfinder ursprünglich mal als Kunstperformance gedacht, aber mittlerweile ist es ein echter Sport geworden. Verstand, Strategie, Beweglichkeit und körperliche Kraft vereinen sich zu einer Disziplin. Wer gewinnen will, muss gleichermaßen schlau sein und sich seiner Haut wehren können. Was denken Sie, könnten Sie sich mit so einem Bild von der Welt anfreunden?«
»Vielleicht habe ich Sie unterschätzt.«
Dorm genoss die Anerkennung, die aus Hollsteins Blick sprach. Er zuckte mit den Schultern und lächelte verschmitzt, als er antwortete: »Ach, das tun viele. Aber die meisten nur ein Mal!«
3
Kaum dass er seinen Patienten verabschiedet hatte, war Jonathan in seine Pantoffeln geschlüpft. Endlich raus aus diesen muffigen Turnschuhen mit den abgetretenen Sohlen, die er ebenso ungern trug, wie er das steife Hemd und die Krawatte getragen hatte. Damals, als er noch hauptberuflich in der Klinik gearbeitet hatte. Ein weiterer Vorteil der Selbstständigkeit. Ein paar Notizen wollte er sich noch machen, auch wenn die Sitzung mit Justin eher nicht zu denen gehörte, deren Verlauf und Ergebnis er bis zum nächsten Termin vergessen haben könnte. Doch die Dokumentation des Therapieverlaufs gehörte nun mal zu seinen Aufgaben. Jonathan gähnte. Drei Sitzungen in Folge, und das auch noch an einem Samstag. Aber was sollte er tun? Der Umzug des Therapieraums ins Souterrain hatte Geld verschlungen, ebenso der Ausbau des Dachbodens. So blieb Jonathan kaum etwas anderes übrig, als auch noch am Samstag Termine zu vereinbaren. Zudem waren viele seiner Patienten berufstätig, sodass ihnen die Sitzungen am Wochenende entgegenkamen. Nicht mal eine einzige Tasse Kaffee habe ich bisher trinken können. Luisa, die seit etwa einem Jahr zu ihm in die Therapie kam, hatte am Abend zuvor einen unerwarteten Anruf von diesem Kerl bekommen, der sie erst geliebt, dann betrogen, sich anschließend mit ihr verlobt und sie dann wegen ihrer eigenen Schwester verlassen hatte. Luisa war außer sich gewesen und hatte nicht aufhören können, abwechselnd wie ein Wasserfall zu reden und zu weinen. Jonathan war froh gewesen, seine Patientin zumindest so weit stabilisieren zu können, dass sie keine Medikamente brauchte.
Danach war Kurt gekommen, der als Teenager einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet hatte. Kurt hatte mal wieder in den schillerndsten Farben von seiner Studienkollegin erzählt, mit seinen schwärmerischen Worten aber offenkundig deren älteren Bruder gemeint. Nur dass er sich dies selbst immer noch nicht eingestand. Lediglich die Sitzung mit Justin Hollstein war für Jonathan an diesem Tag ein Erfolgserlebnis gewesen.
Dann wollen wir mal! Gerade als Jonathan seinen Laptop aufgeklappt hatte, wurde er aus seiner Konzentration gerissen.
»Sie ist weg!«, schallte es von oben, und hektische Schritte bewegten sich in Jonathans Richtung.
Es war nicht das, was seine Frau gesagt hatte. Es war die Art, wie sie es gesagt hatte. Die Angst, die Not, die Verzweiflung in ihrer Stimme. Sofort legte Jonathan seinen Laptop beiseite, sprang aus dem Sessel auf und eilte in den Flur seiner Praxis.
»Schatz? Was ist denn los?«
Cecile war am oberen Treppenabsatz angekommen und stürzte zu Jonathan hinunter.
»Selma! Sie ist weg, ihre Wiege ist leer. Und überall ist Blut!«
»Was?!«
Cecile hatte das Souterrain erreicht. Mit ungebremstem Schwung warf sie sich Jonathan in die Arme und umklammerte ihn so fest, dass er sich kaum noch bewegen konnte. Er erwiderte die Umarmung mit sanfterem Druck und gab Cecile einen Kuss auf den Nacken, wie er es immer tat, wenn sie Angst hatte oder traurig war.
»Schnell, wir müssen sie finden! Bitte, Jonathan, tu was!«
»Das kann doch gar nicht sein!«
Jonathan spürte, wie sich alles um ihn zusammenzog. Der Raum, die Luft, sein eigener Körper, alles schien sich mit einem Mal um ihn zu winden wie ein Python, dessen Würgegriff mit jedem Atemzug fester und fester wurde.
»Bitte, bitte! Jonathan, tu was! Irgendwas!« Cecile schien dem Zusammenbruch nahe, so außer sich wirkte sie.
»Du sagst, es ist Blut in der Wiege?« Jonathan versuchte, sich zu fokussieren, den Python abzuschütteln, nicht in Panik zu geraten.
»Selma!« Cecile klang verzweifelt, Tränen flossen ihr aus den Augen.
»Warte hier!«
Jonathan löste sich aus Ceciles Umklammerung und rannte die Treppe in den ersten Stock hinauf. Er stürzte ins Kinderzimmer und beugte sich schwer atmend über die Wiege.
Nein, das darf nicht wahr sein! Wo kommt das Blut her? Verdammt, bitte nicht!
Hastig warf er einen Blick ins angrenzende Schlafzimmer, in dem nichts Ungewöhnliches zu sehen war. Er überprüfte das Badezimmer und sah nach oben zum Dachgeschoss, in dem sich früher seine Praxis befunden hatte. Mit einem Kontrollgriff an seine Hosentasche vergewisserte er sich, dass er den Schlüssel für den Raum noch bei sich trug. Den habe nur ich, da kommt außer mir niemand rein. Vielleicht ist sie unten?
Jonathan lief zurück, die Treppe runter. Er riss die Tür zum Wohnzimmer auf, in dem Cecile um diese Zeit sonst immer mit Selma im Arm auf der Couch lag und eine der Kinder-CDs hörte, die das Baby noch gar nicht verstehen konnte, die Cecile aber ein wohliges Gefühl bereiteten. Die Wolldecke, die sie sich dabei gern über die Beine warf, lag noch genauso zerknüllt über der Sofalehne, wie sie am Abend zuvor dort liegen geblieben war. Doch von Selma war auch hier weder etwas zu sehen noch zu hören. Zurück also in den Flur, wo Jonathans Blick auf die Küchentür fiel. Aber wie sollte die Kleine denn da hingekommen sein? Es war egal, er würde jeden Winkel des Hauses nach Selma absuchen. Doch auch die viel zu kleine und viel zu altmodisch eingerichtete Achtzigerjahre-Küche war menschenleer, und nichts deutete darauf hin, dass hier etwas Ungewöhnliches geschehen wäre.
»O Gott, Cecile …«, hauchte er leise genug, damit sie es nicht hören konnte.
»Wie ist der Code für das Handy? Ich muss sofort die Polizei rufen!«
Ceciles Worte ließen Jonathan aufhorchen. Eilig stürmte er aus der Küche. »Was hast du da?«
Cecile hielt ein altes iPhone aus der ersten Generation in der Hand. »Das lag in deinem Sprechzimmer, es hing am Ladekabel.«
»Leg das bitte weg.« Jonathan sprach schlagartig ruhiger und verlangsamte seine Schritte.
»Was redest du da? Die Polizei muss sofort kommen und uns helfen!«
»Nein, das muss sie nicht! Leg einfach das Handy wieder weg.« Jonathan sprach mit Cecile, wie er auch mit einer Frau gesprochen hätte, die im Begriff war, sich von einem Hausdach zu stürzen.
Ungeachtet seiner Worte aktivierte sie das Mobiltelefon und stellte fest, dass sie keine PIN benötigte, um zumindest einen Notruf abzusetzen.
»Stopp!« Jonathan rief so laut, dass Cecile zusammenzuckte. »Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht erschrecken, mein Schatz. Leg bitte jetzt das Handy weg. Ich weiß, was zu tun ist.«
Sie sah ihn an, als wäre er ein Fremder. So, als sei er soeben in einer dunklen Gasse aus einem Versteck hervorgeschossen und hielte ihr ein Messer an die Kehle. Bereit dazu, sie jeden Augenblick aufzuschlitzen. Nur dass hier nicht ihr Leben in Gefahr war, sondern Selmas.
»Aber … das ist doch wohl nicht dein Ernst?«
»Cecile, wir haben darüber geredet. Du darfst mit niemandem außerhalb dieses Hauses über das Baby sprechen!«
»Außerhalb dieses Hauses?« Cecile sah Jonathan entgeistert an. »Bist du völlig …?«
Und noch bevor Jonathan antworten konnte, hatte seine Frau auch schon den Notruf betätigt. Das Freizeichen war aus dem Telefon zu hören. Jonathan schüttelte ungläubig den Kopf und fuhr sich mit zittriger Hand durchs Haar. Dann sah er Cecile mit einem Blick an, als zerreiße es ihm das Herz, bevor er ihr ebenso sanft wie klar entgegnete: »Es tut mir leid, mein Engel, aber ich darf nicht zulassen, dass du Hilfe rufst!«
4
Cecile
Cecile sah Jonathan betont ruhig auf sich zukommen. So, als hätte sie sich in eine giftige Schlange verwandelt, die in sein Haus gekrochen war und die er fangen musste, ohne sie aufzuschrecken. Der Anblick erschien ihr irreal, aber darauf kam es jetzt auch nicht mehr an. Denn absolut alles, was Cecile gerade wahrnahm, erschien ihr irreal. Das dumpfe Summen, das in ihrem Kopf klang, seit sie in die leere Wiege gesehen hatte, wollte nicht verstummen, und ihr Körper fühlte sich an, als könne er sich jeden Augenblick in die Luft erheben, so leicht und bedeutungslos schien er zu sein.
Verzweifelt und verloren stand Cecile in ihrem rot befleckten Morgenmantel mit blutigen Händen zwischen den Töpfen mit den Zimmerpflanzen, den überall wild im Flur abgestellten Schuhen und den auf dem Boden herumliegenden Kuscheltieren, für die es nun vielleicht niemals mehr Verwendung geben würde.
»Schatz, bitte leg auf!« Jonathan kam immer näher.
»Mein Baby braucht Hilfe, und die wird es bekommen!«
Ceciles Blick und der Klang ihrer Stimme schienen Jonathan klargemacht zu haben, dass er nicht die geringste Chance hatte, sie von dem Notruf abzuhalten. Jedenfalls bemerkte sie, dass sich etwas an seiner Körperhaltung veränderte. Das Sanfte, Väterliche, das er jedes Mal annahm, wenn er sie sah, schien verschwunden.
»Notruf Berliner Feuerwehr, wo genau ist der Notfallort?«, klang es aus dem Handy.
»Hilfe, mein Baby ist weg. Hier ist nur … Blut …!« Cecile sprach so klar, als wäre sie ein Roboter.
»Bitte bewahren Sie Ruhe, wo ist der Notfallort?«
Cecile wollte gerade die Adresse durchgeben, als sich Jonathans Gesicht zu einer verzweifelten Fratze verzog, er ansatzlos auf sie zustürzte und versuchte, ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Reflexartig zog sie das Telefon weg, wobei es zu Boden fiel. Als Jonathan sich danach bückte, fiel Ceciles Blick auf die blaue Vase, die eingestaubt auf dem Schuhschrank direkt vor ihr stand. Ich weiß nicht, wer dieser Mann da ist. Er hat so gar nichts mehr von Jonathan, meinem liebevollen Helden. Intuitiv griff Cecile nach der Vase und schlug sie Jonathan auf den Hinterkopf.
Mit einem hellen Aufschrei ließ er von dem Handy ab und fasste sich an den Kopf. Cecile griff das Telefon vom Boden, atmete tief durch und schüttelte sich. Dann rannte sie auf die Schiebetür zu, durch die sie in den Garten gelangen würde. Doch sie benötigte kostbare Sekunden, um die schwergängige Tür aufzuschieben, sodass Jonathan ihr nun wieder dicht auf den Fersen war. Im Laufen nahm sie das Handy ans Ohr.
»Mein Baby ist weg. Überall ist Blut! Sie müssen mir helfen!«
»Das habe ich verstanden. Wo ist der Notfallort?«
Während Cecile die Adresse zu nennen versuchte, hatte Jonathan sie auch schon erreicht. Sie spürte den Ruck, mit dem er sich von hinten auf sie stürzte. Sie fiel zu Boden, das Handy noch immer fest umklammert. Die Stimme des Mannes von der Leitstelle drang zu ihr, als Jonathan das Telefon an sich riss. Noch einmal versuchte sie mit aller Kraft, dem Mann vom Notruf etwas zu sagen, als Jonathan das Telefonat beendete, das Handy deaktivierte und es in seine Hosentasche steckte.
»Warum?« Cecile wimmerte, während sie noch immer mit aller Kraft versuchte, sich ihrem Mann zu entwinden.
»Vertrau mir!«
Jonathan, dessen Kräften Cecile nichts entgegenzusetzen hatte, fasste sie und zog sie vom nasskalten Boden hoch. Sein fester Griff umklammerte ihre Handgelenke wie ein Schraubstock.
»Was passiert denn hier bloß?« Cecile liefen Tränen übers Gesicht.
»Ich bringe dich nach oben in die ehemalige Praxis. Da ist alles vorbereitet.«
»Vorbereitet?«
»Du wirst es verstehen, wenn es so weit ist.«
Bitte, lass das alles nur einen bösen Traum sein!
Cecile schloss die Augen, als würde sie dies aus einem Schlaf erwecken, den sie gar nicht schlief. Noch einmal versuchte sie, sich loszureißen, doch die trainierten Boxerhände ihres Mannes ließen ihr keine Chance. In kürzester Zeit hatte Jonathan sie ins Dachgeschoss getragen. Im Flur setzte er sie ab, ohne sie loszulassen, zog mit einer Hand den Schlüssel zu seiner ehemaligen Praxis aus der Hosentasche und stieß die Tür mit dem rechten Fuß auf.
»Was ist das denn?« Cecile riss die Augen auf.
Der Raum unter dem Dach hatte für Jonathans Patienten noch vor wenigen Wochen eine behagliche Therapieatmosphäre verbreitet. Jetzt war er wie ein Behandlungszimmer eingerichtet, das trotz seiner medizinischen Zweckmäßigkeit offenbar dennoch so etwas wie Wohlbefinden vermitteln sollte. Ausgelegt mit praktischem Laminat, in beruhigendem Blau gestrichen und mit Bildern von Blumen und Seen an den Wänden. Kein Tageslicht fiel mehr in den Raum, vor die Fenster waren Metallplatten geschraubt. Es roch nach Desinfektionslösung und Wandfarbe, und das gedämpfte Licht der Lampen flackerte leicht; ein leises Surren kam von dem Kühlschrank neben der Badezimmertür. Cecile sah die Kisten mit den Wasserflaschen, die Mikrowelle, das IKEA-Regal mit den Lebensmitteln darin und das Geschirr. Dann zog Jonathan sie vom Flurboden hoch und zerrte sie in den Raum. Ceciles Blick fiel auf Puppen und Kuscheltiere, ihren Bademantel, die Körperpflegeartikel und den Kleiderständer, an dem die Sachen hingen, die sie nach Selmas Geburt in die Säcke für die Altkleidersammlung gegeben hatte. Er hat das hier alles von langer Hand geplant und vorbereitet! Ein gedämpfter Schrei riss Cecile aus ihren Gedanken. Erst jetzt wendete sie ihren Blick auf etwas in diesem unheimlichen Raum, das ihr noch nicht aufgefallen war. Auf jemanden, der ihr bislang nicht aufgefallen war!
»Aber das kann doch nicht …« Die Worte blieben ihr im Halse stecken.
In einem Krankenbett, das ganz hinten im Raum unter der Dachschräge stand, lag jemand. Ein Mensch, den Cecile nur allzu gut kannte. Und den sie seit ihrer Hochzeit nicht mehr gesehen hatte.
»Mama? Was machst du denn hier?«
Ceciles Mutter antwortete nicht. Sie lag an Händen und Füßen gefesselt auf dem Bett und starrte an ihrer Tochter vorbei mit angsterfülltem Blick auf Jonathan.
»Was hast du mit meiner Mutter gemacht?«
Jonathan versuchte ganz offensichtlich, so sanft wie möglich zu klingen. »Um Petra geht es hier nicht!«
Cecile sah noch einmal in die verängstigten Augen ihrer Mutter, bevor sie ebenso bang wie nachdrücklich fragte: »Wo ist mein Baby?«
Endlich ließ Jonathan die Handgelenke seiner Frau los. Und auf einmal veränderte sich sein Blick, wurde weich und mitfühlend. Seine Augen füllten sich mit Tränen, und mit brüchiger Stimme, die Cecile zum letzten Mal an ihm wahrgenommen hatte, als er ihr vor dem Standesbeamten das Jawort gegeben hatte, schluchzte er:
»Alles wird gut, meine Liebe. Denk nicht mehr an das Baby, es wird alles wieder in Ordnung kommen. Es tut mir so leid, aber irgendwann wirst du das hier alles verstehen!«
5
HegelDrei Tage später
Das Hallen der Schritte drang vom Gefängnisflur an Matthias Hegels Ohren, als wolle es wie ein Bote vorauseilen, der das Eintreffen seines Herrn zu verkünden hatte.
Er trägt immer noch diese Schuhe mit den kleinen Metallplatten an den Fersen. Aber die Schritte mit rechts klingen weiter und zügiger als die linken. Und er rollt links nicht richtig ab. Er scheint sich den Knöchel verletzt zu haben. Wenn er in dieser Geschwindigkeit weitergeht, klopft es in acht Sekunden an meine Tür. Acht.
Hegel war in Jeans und T-Shirt gekleidet, womit er sich unter normalen Umständen in etwa so fühlen würde, als habe man ihm ein Tigerkopf-Tattoo in den Nacken gestochen. Doch zum Tragen seiner Maßanzüge und Designermode boten sich dem Forensiker nicht allzu viele Anlässe. Nicht hier in der Untersuchungshaftanstalt Moabit.
Sieben.
Hegel sah durch die vergitterten Fenster seiner Zelle auf den Hof hinaus. Es war noch früh, dennoch herrschte bereits reges Treiben da unten. Was konnten ein bisschen Regen und Wind diesen harten Kerls schon anhaben? Männer, die sich nach Nationalität, religiöser Überzeugung, begangenen Straftaten oder anderen willkürlich gewählten Kriterien zu kleinen Gruppen zusammenrauften, in denen sie darüber berieten, aus welchen Gründen ihre jeweilige Zusammensetzung eine bessere sei als die der anderen. Männergebaren, Revierkampf. Und dazwischen die armen Hunde, die nicht kriminell waren, sondern einfach nur Mist gebaut hatten. Chronische Schwarzfahrer, kleine Steuersünder, Ladendiebe. Was für ein gottverdammter Ort zum Leben.
Sechs. Fünf. Vier.
Hegel betrachtete seine Fingernägel. Sie waren zu lang und stellenweise dreckig. Als er sich mit der Hand durchs Haar fuhr, wurde er daran erinnert, dass seine früher stets akkurate Frisur nun ungeordnetem, viel zu langem Gestrüpp gewichen war. In der Welt da draußen standen Friseure, Maniküristen und Herrenschneider in seinem Adressbuch auf den vorderen Seiten, doch was nützte ihm das hier in seiner Zelle? Auf diesen mickrigen paar Quadratmetern, auf denen der geniale Phonetiker seit seiner Verurteilung nun insgesamt schon länger als ein Jahr einsitzen musste. Wegen eines brutalen Mordes, den er zunächst gestanden und von dem er später behauptet hatte, ihn doch nicht begangen zu haben.
Drei. Zwei.
Draußen sprach jemand zu dem Vollzugsbeamten, der den Gast zu Hegels Zelle begleitet hatte.
»Ich möchte allein mit ihm sprechen.«
Eins.
Es pochte an die Tür, und gleich darauf wurde sie von außen geöffnet.
»Sie haben also endlich das Rauchen aufgegeben, Oswald. Sehr gut, ich gratuliere.« Hegel drehte sich nicht zu seinem Gast um. »Mit dem jahrelangen Nikotinkonsum haben Sie die Schleimhäute geschädigt. Und wenn die Stimmbänder nicht mehr von Schleimhäuten geschützt werden, reiben sie aneinander. Davon schwellen sie an, was irgendwann zur typischen Raucherstimme führt. Glücklicherweise regenerieren sich unsere Schleimhäute ziemlich schnell. Wenn ich das Ausmaß der Verbesserung Ihrer Stimme zwischen unserem letzten Treffen und heute vergleiche, dann schätze ich, dass Sie seit zwei Monaten rauchfrei sind.«
Der Besucher regte sich nicht.
»Neun Wochen, um genau zu sein.«
Keine Reaktion.
»Und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Ich vermute, das LKA hat einen gewichtigen Grund.« Erst jetzt wandte sich Hegel seinem Besucher zu.
Der Erste Kriminalhauptkommissar Oswald Holder war etwas kräftiger geworden, seit Hegel zuletzt mit ihm zusammengearbeitet hatte. Es musste etwa drei oder vier Jahre her sein. Damals war es um ein Erpresservideo gegangen, ein Maskierter hatte einer Supermarktkette angedroht, deren Produkte zu vergiften. Hegel hatte hören können, dass der Täter aus Dänemark stammte, aber in Mannheim aufgewachsen sein musste. Seine Aussprache wies auf eine operierte Gaumenspalte hin. Die aus diesen Erkenntnissen resultierende Rasterfahndung hatte innerhalb von weniger als zwei Stunden zur Identifizierung und Festnahme des Täters geführt.
»Ich komme nicht gern zu Ihnen, das können Sie mir glauben. Schon gar nicht in dieser Angelegenheit.«
»Das klingt ernst.«
Holder hielt die Arme hinter dem Rücken verschränkt. In seiner Daunenjacke wirkte er auf Hegel, als habe seine Frau ihn angezogen, sogar einen Schal hatte er umgebunden, was Hegel angesichts der eher milden Temperaturen übertrieben vorkam. Aber so war er schon immer. Stets auf alles vorbereitet. Kritisch, misstrauisch und unnahbar. Oswald Holder, der als einer der Jahrgangsbesten die Ausbildung für die höhere Polizeilaufbahn abgeschlossen und sich im LKA schnell hochgearbeitet hatte.
»Vor drei Tagen ist bei der Leitstelle ein Notruf eingegangen. Eine völlig aufgelöste Frau hat berichtet, dass ihr Baby verschwunden und alles voller Blut sei. Kurz danach wurde der Anruf unterbrochen. Der Disponent hat den Vorfall zunächst als einen Vierundzwanzig eingestuft.«
Hegel zog die linke Augenbraue hoch. »Der Berliner Polizeiapparat benötigt meine Hilfe für eine mögliche Fehlgeburt?«
»Warten Sie es ab! Nach dem Tauwetter und dem Scheißregen am Samstag sind überall in Berlin Wasserrohre geplatzt. Und es gab einen Autounfall nach dem anderen. Die Mitarbeiter der Notrufleitstelle mussten ohne Pause Anrufe entgegennehmen, da wäre dieser vermeintliche Vierundzwanzig beinahe untergegangen.«
»Aber dennoch hat er offenbar seinen Weg ins LKA gefunden.«
»Der Leitstellenmitarbeiter hat selbst Kinder. Deswegen ist ihm dieser Anruf nicht aus dem Kopf gegangen. Auch weil danach kein zweiter Notruf in der Sache mehr kam. Er hat sich dann nach Feierabend noch mal den Mitschnitt angehört, und dabei ist der Eindruck entstanden, dass die Frau mit jemandem gekämpft haben könnte. Danach ist ihm die Sorge gekommen, dass sie mit dem Satz ›Mein Baby ist weg‹ eine Entführung gemeint haben könnte.«
Hegel sah seinen Gast so teilnahmslos an, wie es ihm möglich war. »In der Leitstelle der Berliner Feuerwehr gehen an einem ganz normalen Tag etwa dreitausend Anrufe ein, die zu etwa tausendfünfhundert Einsätzen führen. Am Samstag dürften es noch einige mehr gewesen sein. Also, Oswald, was war an diesem Notruf einer unbekannten Frau so besonders, dass Sie hier bei mir in der Zelle auftauchen?«
»Wir haben wie gesagt Grund zu der Annahme, dass es sich um eine Kindesentführung handelt.«
Holders Blick weicht aus, seine Augen werden glasig, er spricht leiser und etwas brüchig.
Hegel beugte sich ein paar Zentimeter zu seinem Gast vor. »Sie werden mich ja wohl kaum wegen einer simplen Kindesentführung um Hilfe bitten.«
»Natürlich nicht.«
Hegel lächelte süffisant. »Nun, dann lassen Sie mal die Katze aus dem Sack.«
»Wir vermuten, dass in dieser Angelegenheit Remus die Hände mit im Spiel hat.«
Hegel verharrte kurz in seiner Haltung, setzte sich dann auf die Tischkante und dachte einen Augenblick lang nach.
»Das erklärt allerdings einiges …«
»Sie verstehen also, wie ernst die Lage ist?«
»Allerdings, Oswald. Allerdings! Wie lange ist diese unangenehme Sache jetzt her?«
Holder musste nicht überlegen. »Ziemlich genau zehn Jahre.«
»Wie doch die Zeit vergeht. Also, wenn Ihre Vermutung zutrifft, sitzen Sie tatsächlich ziemlich tief in der Scheiße! Ich wüsste nur beim besten Willen nicht, wie ich Ihnen helfen sollte.«
»Hegel, ich spüre, dass wir dieses Mal eine echte Chance haben, Remus das Handwerk zu legen! Ihre Aufgabe wäre es einfach nur …«
»… diesen Notruf zu analysieren?« Hegel zuckte mit den Schultern. »Warum sollte ich das tun?«
»Wir können diesen Anruf nicht zurückverfolgen. Sie sind unsere beste Chance, herauszufinden, wo sich diese Entführung abgespielt hat. Aber wir dürfen keine Zeit mehr verlieren.«
Hegel erhob sich von der Tischkante, steckte die Hände in die Hosentaschen und wendete seinen Blick wieder auf den Gefängnishof. »Ich bin nicht interessiert!«
Hegel hörte, wie Oswald Holder etwas aus seiner Jackentasche zog. »Sie wollen also lieber hier drinnen versauern?«
Er vernahm das Klicken eines Knopfes, der gedrückt wurde. Unmittelbar darauf erklang Rauschen, dann ein Freizeichen und schließlich der Mitschnitt des Notrufs, den die Leitstelle drei Tage zuvor aufgezeichnet hatte. Nachdem der Mitschnitt verklungen war, schloss Hegel die Augen und schwieg mehrere Sekunden lang.
»Was hat die Ortung des Handys ergeben?«, fragte er schließlich.
»Wir wissen nur, in welche Funkmasten sich das Gerät eingeloggt hat. Diese Gegend ist dünn besiedelt. Wir haben einen Umkreis von über fünfzehn Kilometern, in dem der Anruf abgesetzt worden sein muss. Vom Berliner Westen bis nach Brandenburg rein. Wir müssen das Suchgebiet unbedingt eingrenzen.«
»Und zwar mithilfe der Informationen, die ich aus diesem Telefonat heraushören kann.« Hegel lächelte in sich hinein.